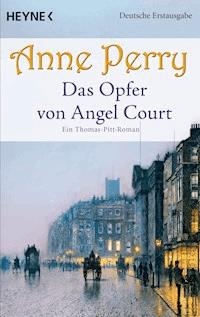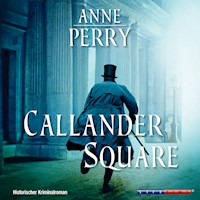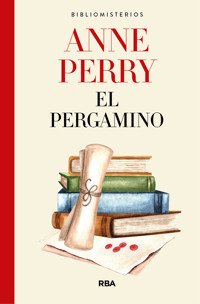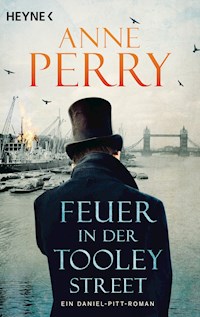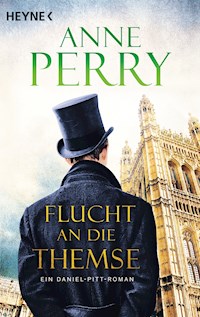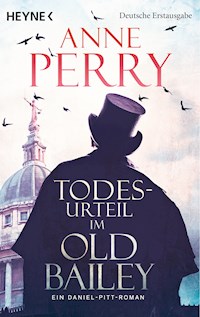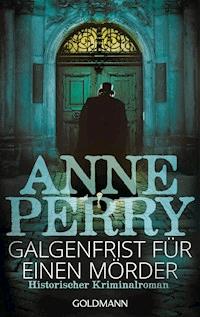
7,99 €
7,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: William Monk
- Sprache: Deutsch
Der neue William-Monk-Roman
Als es William Monk, Inspector bei der Londoner Wasserpolizei, endlich gelingt, Jericho Phillips, einen Kinderschänder und Mörder, zu fassen, glaubt er an die sichere Verurteilung des perversen Verbrechers. Doch dann erhält Monks Freund, der Anwalt Sir Oliver Rathbone, Besuch von seinem Schwiegervater Arthur Ballinger, der ihn bittet, die Verteidigung von Phillips zu übernehmen. Rathbone sagt zu – und kämpft zum ersten Mal in seiner Karriere gegen seinen Freund Monk. Aber Rathbone ist nicht bewusst, wie weit er selbst in den Fall Phillips verwickelt ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2009
4,6 (16 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2007 by Anne Perry Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Published by Arrangement with Anne Perry Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Umschlagfoto: © Valentino Sani / Trevillion Images Redaktion: Ilse Wagner BH · Herstellung: Str.
ISBN : 978-3-641-02930-2V004
www.goldmann-verlag.de
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Buch
Autorin
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Copyright
Buch
Autorin
Die Engländerin Anne Perry verbrachte einen Teil ihrer Jugend in Neuseeland und auf den Bahamas. Schon früh begann sie zu schreiben. Mit ihren Helden, dem Privatdetektiv William Monk sowie dem Detektivgespann Thomas und Charlotte Pitt, begeistert sie seit Jahren ein Millionenpublikum. »Galgenfrist für einen Mörder« ist ihr sechzehnter William-Monk-Roman.
Von Anne Perry sind bei Goldmann außerdem folgende Romane mit William Monk lieferbar:
In feinen Kreisen. Roman (45957) · Schwarze Themse. Roman (46199) · Dunkles Labyrinth. Roman (46326) · Gefährliche Trauer /Eine Spur von Verrat. Zwei Romane in einem Band (13400) · Das Gesicht des Fremden/Die russische Gräfin. Zwei Romane in einem Band (13433) · In feinen Kreisen/Im Schatten der Gerechtigkeit. Zwei Romane in einem Band (13392)
Titel der Originalausgabe: »Execution Dock«
Diane Hinds gewidmet, für ihre Hilfe und Freundschaft
1
Der Mann balancierte am Heck des Leichters, ein Frachtkahn mit flachem Rumpf. Über dem glitzernden Wasser der Themse gab er eine verwegene Gestalt ab, das Haar vom Wind zerzaust, die Lippen in dem kantigen Gesicht fest zusammengepresst. Im letzten Moment, als der andere Leichter schon fast vorübergefahren war, duckte er sich kurz und sprang. Beinahe verfehlte er das Deck, geriet ins Straucheln, richtete sich jedoch sogleich wieder auf. Sobald er sicher stand, drehte er sich um und winkte, eine groteske Geste des Jubels. Dann ließ er sich auf die Knie sinken und verschwand hinter dicht gestapelten Wollballen.
Monk verzog die Lippen zu einem grimmigen Lächeln, während die Ruderer das Polizeiboot unter Aufbietung ihrer ganzen Kraft wendeten und gegen den Sog des meerwärts strömenden Wassers in Richtung des Pool of London lenkten. Unter keinen Umständen hätte er den Befehl zum Schießen erteilt, selbst dann nicht, wenn er sicher gewesen wäre, dass in dem dichten Flussverkehr niemand anders getroffen würde. Er wollte Jericho Phillips lebend fassen und mit eigenen Augen sehen, wie er vor Gericht gestellt und gehängt wurde.
Im Bug des Polizeibootes fluchte Orme leise vor sich hin. Er war immer noch nicht so selbstsicher, dass er es wagte, seinen Gefühlen vor seinem neuen Kommandanten freien Lauf zu lassen. Monk war erst nach Durbans Tod vor einem halben Jahr zur Wasserpolizei gekommen. Der Dienst hier brachte ganz andere Anforderungen mit sich als die Arbeit an Land, mit der Monk Erfahrung hatte, doch noch schwieriger war es für ihn, die Führung von Männern zu übernehmen, die ihn für einen Außenseiter hielten. Er galt als brillanter Ermittler, aber auch als rücksichtsloser und verschlossener Einzelgänger, der es anderen schwer machte, ihn zu mögen.
In den acht Jahren seit seinem Unfall, der 1856 sein Gedächtnis ausgelöscht, ihm aber auch die Chance zu einem Neuanfang gegeben hatte, hatte er sich verändert. Er hatte gelernt, sich durch die Augen anderer zu sehen, und das war eine ebenso erhellende wie bittere Erfahrung gewesen. Allerdings gab es niemanden, dem er das erklären konnte.
Sie holten rasch zu dem Leichter auf, wo Phillips, vor ihren Augen verborgen, auf der Ladefläche kauerte, ohne dass der Mann am Ruder auf ihn achtete. Noch dreißig Meter, und sie würden Seite an Seite fahren. Sie waren zu fünft im Polizeiboot und damit mehr Polizisten als üblich, aber um einen Mann wie Phillips zu stellen, war Verstärkung womöglich durchaus vonnöten. Gesucht wurde er wegen der Ermordung eines Jungen von etwa dreizehn oder vierzehn Jahren namens Walter Figgis, den man als Fig gekannt hatte. Er war schmächtig und von geringem Wuchs gewesen, und daran mochte es gelegen haben, dass er überhaupt so lange überlebt hatte. Phillips handelte mit Jungen ab einem Alter von vier, fünf Jahren bis zu der Zeit, in der sich ihre Stimme veränderte und sie begannen, die physischen Eigenschaften erwachsener Männer zu entwickeln, womit sie für diesen speziellen Bereich der Pornografie unbrauchbar wurden.
Das Polizeiboot schoss durch das aufgewühlte Wasser. Fünfzig Meter von ihnen entfernt fuhr ein Vergnügungsboot träge stromaufwärts, vielleicht mit dem Ziel Kew Gardens. An seinen Masten flatterten bunte Bänder im Wind, und Lachen, vermischt mit Musik, wehte herüber. Weiter vorn, im Upper Pool, lagen von Kohlenbarkassen bis hin zu Teeklippern beinahe hundert Schiffe vor Anker. Dazwischen kreuzten Leichter hin und her, auf die Schauermänner Frachten aus allen Winkeln der Welt luden.
Monk beugte sich etwas weiter vor. Schon holte er tief Luft, um die Ruderer zu noch größeren Anstrengungen anzufeuern, überlegte es sich dann aber anders. Das hätte so gewirkt, als traute er ihnen nicht zu, dass sie von sich aus ihr Bestes gaben. Doch es war schlichtweg unvorstellbar, dass es ihnen weniger wichtig sein könnte als ihm selbst, Phillips zu stellen. An Monk und nicht an ihnen hatte es gelegen, dass Durban in den Fall Louvain verwickelt worden war, der ihren damaligen Kommandanten letztlich das Leben gekostet hatte. Und Monk war derjenige, den Durban als seinen Nachfolger vorgeschlagen hatte, als ihm klar wurde, dass er sterben würde.
Orme hatte jahrelang unter Durban gedient, aber falls er Monk verübelte, dass nun er das Kommando führte, hatte er das kein einziges Mal gezeigt. Er war zuverlässig, gewissenhaft, sogar hilfsbereit, aber distanziert. Je länger Monk ihn allerdings beobachtete, desto klarer erkannte er, dass sein Erfolg bei der Truppe von Ormes Respekt abhing und – mehr noch – dass es ihm auf das Wohlwollen dieses Mannes ankam. Letzteres ging ihm gegen den Strich. Er konnte sich nicht erinnern, sich jemals darum gekümmert zu haben, was ein Untergebener von ihm hielt.
Der Leichter war jetzt nur noch fünf Meter vor ihnen und wurde langsamer, um ein anderes, mit Fässern voller Rohzucker beladenes Transportboot vorbeizulassen, das vor einem Schoner quer über den Fluss zum Ufer zurücksteuerte. Das Schiff lag, von seiner Last so gut wie befreit, höher auf dem Fluss, und da seine riesigen Segel eingerollt worden waren und die Spieren nackt in die Luft ragten, bewegte es sich sanft schaukelnd im Wasser.
Während der beladene Kahn an Steuerbord querte, schoss das Polizeiboot vor und erreichte den Leichter an Backbord. Der erste Polizist sprang an Deck, der nächste gleich hinterher, beide mit gezogener Pistole.
Der Fall Phillips war der einzige, den Durban nicht abgeschlossen hatte, und er war, sogar in seinen letzten Aufzeichnungen, eine offene Wunde für ihn geblieben. Seit seinem Antritt von Durbans Erbe hatte Monk immer wieder jede Seite studiert. Die Akte enthielt sämtliche Fakten, die Daten, die Uhrzeiten, die Namen der Verhörten, die Antworten und Schlussfolgerungen, die Entscheidungen, was als Nächstes getan werden sollte. Aber hinter all den Worten, den über die Seiten gekritzelten Buchstaben, schwelten Emotionen. Sie bargen eine Wut, die weit mehr war als bloße Frustration über Scheitern oder verletzten Stolz, weil der Gegenspieler raffinierter gewesen war als man selbst. Sie verrieten einen tiefen, sengenden Zorn über das Leiden von Kindern und Mitleid mit all den Opfern von Phillips’ Gewerbe. Und ob Monk es wollte oder nicht, diese Akte hatte auch in ihm eine immer wieder aufbrechende Wunde hinterlassen. Er musste daran denken, wenn die Arbeit getan und er wieder zu Hause war. Sie überfiel ihn während der Mahlzeiten. Sie drängte sich in seine Gespräche mit Hester, seiner Frau. Solche Auswirkungen auf sein Seelenleben hatte bisher nur sehr wenig gehabt.
Monk saß angespannt im Heck des Bootes. Alles in ihm drängte danach, zu seinen Männern auf den Leichter zu springen. Wo waren sie eigentlich? Warum waren sie nicht längst mit Phillips wieder aufgetaucht?
Dann begriff er. Sie waren auf der falschen Seite. Phillips hatte das exakt vorausberechnet. In dem Wissen, dass sie von backbord kommen mussten, um einen Zusammenstoß mit dem anderen Boot zu vermeiden, hatte er sich nach steuerbord gestohlen und war erneut gesprungen. Riskant war das gewiss, aber er hatte ja nichts zu verlieren. Wenn sie ihn erwischten, landete er vor Gericht, und dort konnte es nur ein Urteil geben. Am dritten Sonntag danach würde man ihn hängen.
Monk sprang von seinem Sitz auf. »Holen Sie die Männer zurück! Er ist an Steuerbord! Auf dem anderen Leichter!«
Sie hatten es bereits selbst bemerkt. Orme packte das andere Ruder, tauchte es ins Wasser und legte sich verzweifelt in die Riemen, um das Boot an die andere Seite des ersten Leichters zu bringen.
Die zwei Polizisten sprangen in das Boot zurück, das heftig zu schaukeln begann. Doch jetzt war keine Zeit, mit Orme den Platz an den Rudern zu tauschen. Der andere Leichter hatte schon einen Vorsprung von zwanzig Metern und hielt Kurs auf den Kai. Wenn Phillips es bis dorthin schaffte, bevor sie ihn stellten, war er ihnen so gut wie entwischt. Zwischen all den Kisten und Ballen, den Teetruhen, den Rum- und Zuckerfässern, den Stapeln von Holz, Fellen, Stoßzähnen und Töpfereiwaren, die die Mole füllten, würden sie ihn gewiss nicht mehr finden.
Monk stand immer noch hoch aufgerichtet im Boot, der Wind, jetzt bei Ebbe mit den Gerüchen von Salz und Fisch beladen, peitschte ihm ins Gesicht. Phillips zu verhaften war das Einzige, was er noch für Durban tun konnte. Damit wäre das Vertrauen gerechtfertigt, das der andere Mann in ihn gesetzt hatte, obwohl sie einander nur ein paar Wochen gekannt hatten. Sie hatten nie den Alltag samt seinen Routineangelegenheiten miteinander geteilt, nur jenen einen Fall, der beinahe unvorstellbares Grauen mit sich gebracht hatte.
Der Leichter vor ihnen verschwand kurz aus ihrer Sicht, als sich das Heck eines Fünfmasters zwischen sie schob. Monk starrte wie gebannt nach vorn. Es schien viel zu lange zu dauern, bis das andere Boot wieder auftauchte. Klammerte sich Phillips inzwischen an ein loses Seil, schrie er womöglich um Hilfe und ließ sich von den Schauermännern an Bord helfen? Wenn es tatsächlich so war, würde Monk zur Polizeiwache in Wapping zurückkehren und Verstärkung holen müssen. Und bis dahin konnte alles Mögliche passieren.
Orme musste dieselbe Befürchtung durch den Kopf geschossen sein. Er legte sich mit seinem ganzen Gewicht ins Ruder und feuerte die anderen Männer mit lauter Stimme an. Das Boot machte einen Satz nach vorn, gerade als der Leichter mit immer noch beträchtlichem Vorsprung wieder vor ihnen auftauchte. Monk wirbelte herum und fixierte den Rumpf des Schoners. Dort hangelte sich jedoch niemand an den Seilen empor. Die Schauermänner beförderten nach wie vor mit gekrümmtem Rücken ein Fass nach dem anderen aus dem Bauch des Schiffs an Deck.
Erleichterung durchflutete Monk, als sie das Transportboot endlich einholten. Noch ein, zwei Minuten, dann würden sie sich Phillips schnappen, und die Jagd wäre vorüber. Hatten sie ihn erst in Gewahrsam, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Mühlen der Gerechtigkeit zu mahlen begannen.
Das Polizeiboot erreichte die Längsseite des Leichters. Erneut sprangen zwei Männer an Deck, nur um Sekunden später mit düsterer Miene und kopfschüttelnd zurückzukehren. Diesmal fluchte auch Monk. An den Wänden des Schoners war Phillips nicht hochgeklettert, dessen war sich Monk sicher. So beweglich der Mann auch sein mochte, so schnell hätte er in der kurzen Zeit, in der er vor ihren Augen verborgen war, unmöglich auf den Schoner klettern können. Und zum Nordufer war keiner der vorüberfahrenden Leichter unterwegs gewesen. Damit blieb nur noch das Südufer.
Die Schultern angespannt, ruderten die Männer das Boot mit wütenden Schlägen um das Heck des Schoners herum und lenkten es in das Kielwasser einer Gruppe von Leichtern, die sich stromaufwärts bewegte. Sie legten sich in die Riemen und peitschten mit den Rudern auf das Wasser ein, bis die Gischt hochspritzte. Monk klammerte sich an die Seiten und stieß ein Knurren aus, als er einen weiteren Leichter bemerkte, der südwärts auf Rotherhithe zuhielt.
Orme entdeckte ihn im selben Augenblick und gab sofort den entsprechenden Befehl.
Eilig schlängelten sie sich zwischen den Booten hindurch. Vor ihnen überquerte eine Fähre zügig den Fluss, während sich die Passagiere zum Schutz gegen den Wind niederkauerten. Von einem anderen Vergnügungsboot stiegen Musikfetzen in die Luft. Der Leichter erreichte die Mole nur zehn Meter vor ihnen, und sie sahen Phillips’ geschmeidige Gestalt mit wehenden Haaren und Frackschößen vom Heck springen. Er landete auf der untersten Stufe, die von der Flut mit schleimigem Tang bedeckt war. Einen Moment lang ruderte er mit den Armen durch die Luft, dann kippte er zur Seite und prallte gegen die von grünem Seetang bedeckte Steinmauer. Die Schmerzen mussten immens sein, doch natürlich wusste Phillips, dass das Polizeiboot nicht weit hinter ihm war, und die Angst spornte ihn an, sich aufzurappeln und auf Händen und Knien nach oben zu kriechen. Das freilich war ein Manöver ohne jede Würde und wurde prompt vom Hohngelächter einiger Schauermänner begleitet. Als das Polizeiboot an der Mauer entlangschabte, hatte Phillips bereits den trockenen Kai erreicht und sprintete auf den nächsten Liegeplatz zu, wo noch Paletten voller Töpferwaren aus Spanien zwischen aufs Geratewohl abgeladenen dunkelbraunen Fässern herumstanden. Dahinter erstreckten sich die Bermondsay Road und ein Labyrinth von Gassen und Hinterhöfen, Bettlerherbergen, Pfandleihhäusern, Kerzendreherwerkstätten, Tavernen und Bordellen.
Monk zauderte nur einen winzigen Moment. Bei einem Sprung konnte er sich leicht die Knöchel verstauchen. Und was, wenn er ins Wasser fiel? Die Hafenarbeiter und Schauermänner würden vor Lachen brüllen. Und was für eine Blamage wäre es, wenn Phillips entwischte, weil seine eigenen Männer die Verfolgung abbrechen mussten, um ihren Kommandanten aus dem Fluss zu fischen! Aber die Zeit reichte einfach nicht für langes Überlegen und Abwägen. Er richtete sich in dem schlingernden Boot auf und machte einen Satz in Richtung der Stufen.
Elegant war die Landung nicht. Seine Hände trafen auf mit Seetang überwachsenen Stein, er fiel auf ein Knie und schlug auf der Kante der nächsten Stufe auf. Ein grässlicher Schmerz jagte durch seinen ganzen Körper, doch er konnte gleich wieder aufstehen und hinter Phillips herklettern, als wäre es seine Absicht gewesen, so und nicht anders am Kai zu landen.
Er erreichte die oberste Stufe. Gut zehn Meter vor ihm stürmte Phillips auf einen Stapel dunkler Holzfässer und die Winde dahinter zu. Die Schauermänner, die mit dem Entladen eines weiteren Leichters beschäftigt waren, achteten nicht auf ihn. Einige arbeiteten mit entblößtem Oberkörper in der Sonne, auf ihrer Haut glänzte der Schweiß.
Monk rannte über die freie Fläche zu den Fässern. Dort zögerte er. Er wusste, dass Phillips unmittelbar dahinter lauern konnte, womöglich mit einem Stück Holz oder Rohr bewaffnet, im schlimmsten Fall mit einer scharfen Klinge. Monk entschied sich für den längeren Weg den Stapel entlang und bog um die weiter entfernte Ecke.
Genau damit musste Phillips gerechnet haben. Er erklomm bereits einen Stapel von Ballen, der sich hinter den Fässern auftürmte. Ein Seemann, der täglich den Mast hinaufstieg, hätte nicht geschickter sein können. Nur ein Mal blickte er sich um, den Mund zu einem höhnischen Feixen aufgerissen, dann schwang er sich auf den obersten Ballen, wo er kurz innehielt, ehe er sich auf die andere Seite abrollte und sich fallen ließ.
Monk hatte nur eine Wahl: hinterher oder ihn verlieren. Phillips konnte sein verfluchtes Bordellboot aufgeben, ein Zimmer in irgendeiner Absteige am Ufer nehmen und sich eine Weile verstecken, um vielleicht in einem halben Jahr wieder aufzutauchen. Gott allein mochte wissen, wie viele Jungen in dieser Zeit gequält, wenn nicht sogar getötet würden.
Unbeholfen und deutlich langsamer als sein Gegner kletterte Monk die Ballen hinauf und war erleichtert, als er oben anlangte. Dann kroch er zur anderen Seite hinüber. Es ging tief hinunter, wohl an die fünf Meter. Phillips jagte mit beträchtlichem Vorsprung auf weitere Berge aus aufeinandergetürmten Weinfässern, Gewürzkisten und Tabakballen zu.
Einen Sprung in die Tiefe wollte Monk nicht riskieren. Wenn er sich den Knöchel brach, würde er Phillips endgültig verlieren. Er ließ sich an der Seite der Ballen hinabgleiten und verkürzte damit die Fallhöhe. Unten angekommen, drehte er sich sofort um und spurtete zu den Weinfässern. Gerade als er sie erreichte, rannte Phillips über die Steinplatten dahinter auf ein gewaltiges Frachtschiff zu, das an der Kaimauer vor Anker lag. Seine Taue hingen über die Seitenwände, daneben ragte ein Kran empor, von dem soeben eine Ladung Holz herabgelassen wurde.
Auf den unebenen Pflastersteinen fuhr ratternd ein von Pferden gezogener Wagen. Ein Trupp Hafenarbeiter näherte sich dem Kran. Zwei Müßiggänger stritten sich um etwas, das aussah wie ein Blatt Papier. Überall herrschte Lärm: die Rufe von Männern, das Kreischen der Möwen, das Rasseln von Ketten, das Knirschen von Holz, das unablässige Klatschen des Wassers gegen die Steinmauern. Dazu die ständige Bewegung der sich auf dem Wasser spiegelnden Sonne, grell und gleißend. Die riesigen Schiffe hoben und senkten sich mit den Wellen. Männer in grauer und brauner Kleidung mühten sich mit Dutzenden verschiedener Aufgaben ab. Alle möglichen Gerüche füllten die Luft – der dicke, saure Gestank des Flussschlamms, die strenge Sauberkeit von Salz, die schwere Süße von Rohzucker, die ätzenden Ausdünstungen von Tierhäuten, das faulige Aroma der an den Schiffsrümpfen klebenden Meerespflanzen und – etwas weiter vorn – der betörende Duft von Gewürzen.
Monk setzte alles auf eine Karte. Seiner Einschätzung nach würde Phillips nicht versuchen, sich auf das Schiff zu retten. Wollte er an seiner Wand hochklettern, wäre er zu deutlich sichtbar. Nein, er würde in die andere Richtung flüchten und in den dunklen Gassen verschwinden.
Oder würde er bluffen? Doppelt bluffen?
Orme war jetzt dicht hinter Monk.
Monk jagte auf einen Durchgang zwischen zwei Lagerhäusern zu. Orme sog scharf die Luft ein, dann folgte er seinem Vorgesetzten. Der dritte Polizist blieb am Kai zurück. Er hatte solche Verfolgungen oft genug mitgemacht und wusste, dass die Flüchtenden auf einem Umweg zurücklaufen konnten. Er würde einfach warten.
Der Durchgang, keine zwei Meter breit, führte mehrere Stufen hinunter, ehe er unmittelbar nacheinander zwei enge Biegungen machte. Der beißende Gestank von Urin stieg Monk in die Nase. Rechts befand sich das Geschäft eines Schiffsausrüsters, dessen schmale Tür von zusammengerollten Tauen, Schiffslaternen, massiven Holznägeln und einem Eimer voller Bürsten zusätzlich verengt wurde.
Dieser Laden lag nicht tief genug in der Gasse, dass Phillips sich hier hätte verstecken können. Monk lief weiter. Als Nächstes passierte er ein Malergeschäft. Durch das Fenster konnte er sehen, dass es innen leer war. Orme war dicht hinter ihm.
»Der nächste Durchgang ist eine Sackgasse«, murmelte er. »Er könnte am oberen Ende auf uns warten.« Das war eine Warnung. Phillips hatte ein Messer und würde nicht zögern, es zu benutzen. »Er steht mit einem Fuß unter dem Galgen«, fuhr Orme fort. »Der Moment, in dem wir ihm die Handschellen anlegen, ist für ihn der Anfang vom Ende. Das ist ihm klar.«
Monk musste unwillkürlich lächeln. Sie waren jetzt nahe dran, ganz nahe. »Ich weiß«, flüsterte er. »Glauben Sie mir, noch nie wollte ich einen Schurken so dringend schnappen wie diesen hier.«
Orme erwiderte nichts. Langsam tasteten sie sich tiefer in die Gasse hinein.Vor ihnen bewegte sich etwas. Auf den Steinen war ein leises Kratzen zu hören. Ormes Hand wanderte zu seiner Pistole.
Plötzlich huschte aus einem Seitendurchgang eine braune Ratte heraus und flitzte an ihnen vorbei. Irgendwo vor ihnen war ein Keuchen zu hören, dann ein Fluch. Phillips?
In der Luft war kein Hauch zu spüren. Es war dunkel, und der Gestank wurde immer unerträglicher, zumal sich auch noch der Geruch von schalem Bier aus einer nahe gelegenen Taverne damit mischte. Monk beschleunigte seine Schritte, denn er wusste, dass Phillips sich von alldem hier bestimmt nicht aufhalten lassen würde. Wenn er etwas zu fürchten hatte, dann das, was hinter ihm war.
Die Gasse teilte sich nun. Die linke Abzweigung führte zurück zum Kai, die rechte mündete in einem neuen Gewirr von Durchgängen und Gassen. Rechts von ihnen stand eine Bettlerherberge. In der Tür kauerte ein auf einem Auge blinder Mann, über dessen Hose sich sein Bauch wölbte und auf dessen Kopf ein alter Zylinder saß.
Würde Phillips hier untergeschlüpft sein? Plötzlich wurde Monk klar, wie viele Freunde Phillips an Orten wie diesem haben konnte: Profiteure, deren Einkünfte von seinen Geschäften abhingen, Lieferanten, Schmarotzer.
»Nein«, warnte ihn Orme. Er packte Monk am Arm und zog ihn mit erstaunlicher Kraft zurück. »Wenn wir da reingehen, kommen wir nie wieder heraus.«
Monk starrte ihn wütend an. Er wollte streiten.
Selbst im Spiel der Schatten, die auf Ormes Gesicht fielen, war seine Entschiedenheit unverkennbar. »Der Hafen ist nicht die einzige Gegend, wo’s Stellen gibt, in die kein Polizist reinkann«, erklärte er leise. »Und sagen Sie mir bloß nicht, dass es Beamte gibt, die sich in die Bluegate Fields oder den Devil’s Acre reinwagen. Wir alle wissen nämlich, dass das nicht stimmt. Das ist ein Kampf – wir gegen sie -, und wir gewinnen nicht immer.«
Monk riss sich los, machte aber keine Anstalten mehr, die Gasse zu betreten. »Ich lasse diesen Dreckskerl nicht entkommen«, erklärte er betont langsam und deutlich. »Figs Ermordung ist nur die Spitze des Eisbergs.«
»Es gibt sicher noch einen verborgenen Weg hier raus«, führte Orme seinen Gedanken weiter. »Wahrscheinlich mehr als einen.«
Monk lag schon die scharfe Erwiderung auf der Zunge, dass er das selbst wusste, doch er schluckte sie hinunter. Orme verdiente es genauso wie er, Phillips zu schnappen, wenn nicht sogar noch mehr. Von Anfang an hatte er zusammen mit Durban an diesem Fall gearbeitet. Nur dass Durban jetzt tot war, was nicht das Geringste mit Orme zu tun hatte, aber sehr viel mit Monk.
Sie folgten der Hauptgasse, die sie immer weiter fort vom Hafen führte. Sie marschierten zügig. Zu beiden Seiten klafften Hauseingänge und bisweilen Gassen von weniger als einem Meter Breite, die nicht selten nach wenigen Schritten an Mauern endeten.
»Er wird noch’ne ganze Weile weiterlaufen«, stieß Orme grimmig hervor. »Instinkt. Auch wenn er hier leben kann wie die Made im Speck.«
»Er wird hier Freunde haben«, stimmte Monk zu.
»Und Feinde«, knurrte Orme. »Er ist ein verkommenes Subjekt. Es gibt keinen, den er nicht für’nen Sixpence verraten würde. Darum wird er auch nirgendwo mit Treue rechnen … Versuchen wir’s mal mit dem hier.« Er deutete auf einen verschlungenen Weg zu ihrer Linken, der offenbar zurück zum Hafen führte. Noch während des Sprechens hatte er das Tempo verschärft – wie ein Hund, der neue Witterung von seiner Beute aufgenommen hat.
Monk widersprach nicht, blieb aber dicht hinter Orme. Der Platz reichte nicht, um nebeneinander zu gehen. Irgendwo links von ihnen fluchte ein Mann, und eine Frau stieß Beschimpfungen aus. Ein Hund begann zu kläffen, und vor sich hörten sie Schritte. Orme fing an zu rennen, Monk folgte ihm auf dem Fuß. Rechts nahmen sie einen niedrigen Torbogen wahr, durch den irgendetwas huschte. Orme blieb so abrupt stehen, dass Monk zuerst gegen ihn und dann gegen eine Wand prallte, über die aus einem offenbar losen Abflussrohr weit oben im Dunklen eine Flüssigkeit rann.
Orme setzte sich wieder in Bewegung, jetzt allerdings vorsichtiger. Immer waren sie diejenigen, die auf der Hut sein mussten. Hinter jeder Mauer, jedem Bogen oder Eingang konnte Phillips, das Messer in der Hand, lauern. Er konnte und würde jedem, der eine Bedrohung für ihn darstellte, den Bauch aufschlitzen. Ein Polizist durfte nur töten, um sein eigenes Leben oder das von Menschen in Todesgefahr zu retten. Und trotzdem musste er danach beweisen, dass es keine andere Möglichkeit gegeben hatte.
Phillips konnte am Hafen in zwei entgegengesetzte Richtungen fliehen, an Deck eines der an der Mole vertäuten Schiffe klettern oder die Stufen hinunter zu einem Leichter laufen und erneut den Fluss überqueren. Kurz, sie konnten sich nicht ewig hinter der Mauer verschanzen.
»Zusammen«, knurrte Monk. »Alle beide kann er nicht kriegen. Los!«
Orme gehorchte, und sie stürmten durch die Öffnung in das grelle Sonnenlicht. Von Phillips fehlte jede Spur. Monk wurde von dem Gefühl überwältigt, geschlagen worden zu sein. Er musste regelrecht um Luft ringen, und in seinem Magen breitete sich Schmerz aus. Phillips hätte überallhin verschwinden können. Es war dumm von ihm gewesen, seine Verhaftung als reine Formsache zu betrachten, bevor er tatsächlich hinter Schloss und Riegel saß. Er hatte sich einfach zu früh an seinem vermeintlichen Sieg berauscht. Die eigene Arroganz stieg ihm jetzt wie bittere Galle in den Mund.
Am liebsten hätte er blind auf irgendjemanden eingeschlagen, aber da war niemand, dem er die Schuld geben konnte, außer sich selbst. Er wusste, dass er mehr Kraft, mehr Selbstbeherrschung beweisen musste. Ein guter Führer musste fähig sein, den Zorn hinunterzuschlucken und sofort an den nächsten Schritt zu denken. Es galt, zu handeln, Enttäuschung oder Wut zu verbergen, persönlichen Schmerz zu ersticken. Durban hätte das getan. Daran musste Monk sich messen, und zwar mehr denn je, nun, da er Phillips verloren hatte.
»Laufen Sie nach Norden«, befahl er Orme. »Ich versuche es mit der anderen Richtung. Wo ist eigentlich Coulter?« Er spähte nach dem Mann, den er am Kai zurückgelassen hatte. Dann entdeckte er gleichzeitig mit Orme unter all den Hafenarbeitern den Beamten in der dunklen Uniform. Coulter bemerkte sie ebenfalls und begann, heftig zu gestikulieren.
Sie rannten los. Nur mit Mühe konnten sie erst einem Pferdekarren, dann einem schwer beladenen Lastenträger ausweichen.
»Die Stufen runter!«, brüllte Coulter und deutete hektisch auf das Wasser hinter dem Schiff. »Er hat ein Messer und hält einen von den Bootsmännern als Geisel! Kommen Sie schnell!«
»Wo ist unser Boot?«, rief Monk, sprang über ein im Weg liegendes Fass und geriet dann auf den unebenen Steinen ins Stolpern. »Wo stecken die anderen?«
»Sind hinter ihm her«, antwortete Coulter, instinktiv an Orme gewandt. Normalerweise achtete er auf korrektes Benehmen, aber in der Hitze des Gefechts setzten sich die alten Gewohnheiten durch. »Sie werden ihn schnell einholen. Leichterboote sind langsam. Aber ich hab eine Fähre beschlagnahmt, die da unten auf uns wartet. Beeilen Sie sich, Sir!« Er lief zu den Stufen und kletterte hinunter, ohne sich zu vergewissern, dass ihm Monk und Orme tatsächlich folgten.
Monk eilte hinter ihm her. Er musste Coulter loben und durfte auf keinen Fall den Moment mit Kritik über fehlenden Respekt verderben. So schnell er konnte, stieg er die mit Schlamm verschmierten Stufen hinunter und sprang an Bord der Fähre. Die Enttäuschung darüber, dass jetzt die Ruderer seines eigenen Bootes diejenigen sein würden, die Phillips verhafteten, schluckte er hinunter. Er würde sie gerade rechtzeitig erreichen, um sie zu beglückwünschen.
Aber sie waren schließlich eine Mannschaft, hielt er sich vor, als Orme hinter ihm an Deck sprang und dem Fährschiffer zurief, er solle losfahren. Es war wirklich nicht nötig, dass er die Verhaftung persönlich vornahm, tröstete er sich. Es war völlig egal, wer Phillips als Erster stellte und über die Wut in dessen Gesicht triumphieren durfte.Was zählte, war, dass es geschah. Es war eben nicht mehr so wie in seinen alten Tagen als Privatdetektiv, der sich auf niemanden zu verlassen brauchte, den Erfolg für sich einheimste, aber auch das Risiko allein trug. Kooperation hatte er nicht gekannt – das hatte Runcorn immer über ihn gesagt. Er war nicht einer, dem eingefallen wäre, anderen zu helfen oder sich notfalls helfen zu lassen. Ein Egoist.
Schon pflügten sie durch das Wasser. Der Fährschiffer war unglaublich geschickt. Übermäßig stark wirkte er zwar nicht – er war eher zäh statt muskelbepackt -, aber er lenkte die Fähre auf kürzestem Weg, sodass sie schnell aufholten. Monk bewunderte solche Fähigkeiten.
»Dort!« Coulter deutete auf ein Leichterboot vor ihnen, das nun langsamer wurde, um einem Verband von Lastkähnen Platz zu machen, der stromabwärts unterwegs war. An Deck war eine kauernde Gestalt auszumachen. Ob das Phillips war, ließ sich aus der Entfernung nicht erkennen.
Kooperation. Das hatte letztlich den Ausschlag dafür gegeben, dass Runcorn und nicht Monk befördert worden war. Runcorn verstand es, seine Meinung auch dann für sich zu behalten, wenn er im Recht war. Außerdem wusste er den Männern zu gefallen, die mehr Macht hatten als er. So etwas verachtete Monk, und er hatte das auch laut gesagt.
Doch Runcorn hatte recht gehabt: Es war wirklich nicht leicht, mit Monk zusammenzuarbeiten, denn er hatte es sich nie gestattet, umgänglich zu sein.
Die Barkassen waren vorbeigeglitten, und der Leichter beschleunigte wieder. Gleichwohl waren sie ihm deutlich näher gekommen. Und diesmal war Phillips auf dem offenen Fluss, wo er sich nicht mehr verbergen konnte. Der Abstand zwischen ihnen schrumpfte schnell: zwanzig Meter, fünfzehn, zwölf …
Plötzlich sprang Phillips auf, den linken Arm um den Hals des Schiffers gelegt, in der rechten Hand ein Messer mit langer Klinge, die er dem Mann an die Kehle drückte. Er lächelte.
Jetzt lagen nur noch fünf Meter zwischen ihnen, und der Leichter trieb führerlos dahin. Beide Männer standen wie erstarrt an Deck. Andere Lastkähne glitten auf sie zu, und die ersten änderten bereits den Kurs, um einen Zusammenprall zu vermeiden.
Kochend vor Wut erkannte Monk Phillips’ Absicht und sah keine Möglichkeit, ihn daran zu hindern. Er fühlte sich absolut hilflos.
Nur noch drei Meter. Ein weiterer Verband von Lastkähnen näherte sich.
Auf einmal senkte Phillips das Messer und rammte es seiner Geisel von der Seite in den Bauch. Blut spritzte, und der Bootsmann sackte in dem Moment zu Boden, als Coulter an Bord sprang. Phillips zögerte eine Sekunde, dann machte er einen Satz zu einem Leichter hinüber, der in geringem Abstand vorbeifuhr. Doch der Sprung geriet zu kurz, und er fiel ins Wasser. Nach dem ersten Schock ruderte er, verzweifelt nach Luft schnappend, mit Armen und Beinen.
Coulter tat, was jeder anständige Mann getan hätte. Er rief Phillips eine Reihe von Flüchen hinterher und beugte sich über den verwundeten Bootsmann, der dringend Hilfe brauchte. Hastig raffte er so viel Stoff zusammen, wie seine Hand nur fassen konnte, und presste ihn auf die Wunde, während Orme sich Jacke und Hemd auszog, das Hemd faltete und als Mullbinde benutzte, womit er die Blutung weitgehend zum Versiegen brachte.
Inzwischen hatte die Besatzung des Leichters Phillips aus dem Wasser gefischt, und schon wuchs wieder der Abstand zwischen ihm und dem führerlos neben der Fähre dümpelnden Kahn. Ob sie wollten oder nicht, aufgrund ihrer Geschwindigkeit und ihres Gewichts konnten die in dem Verband fahrenden Schiffer nicht ohne weiteres stoppen. Binnen fünfzehn oder zwanzig Minuten würde Phillips die Flussbiegung hinter der Isle of Dogs hinter sich lassen.
Rasch musterte Monk den verletzten Schiffer. Sein Gesicht war aschfahl, aber wenn er rechtzeitig ärztliche Hilfe erhielt, konnte er vielleicht noch gerettet werden. Darauf hatte Phillips sich wohl verlassen. Er hatte zu keinem Zeitpunkt vorgehabt, seine Geisel zu töten.
Der Fährmann stand noch unter Schock und war sich nicht schlüssig, was er tun sollte.
»Bringen Sie ihn zum nächsten Arzt«, befahl Monk. »Rudern Sie, so schnell Sie können, Mann. Coulter, Sie kümmern sich um den Verwundeten. Orme, ziehen Sie Ihre Jacke an und kommen Sie mit.«
»Jawohl, Sir!« Orme riss seine Jacke an sich und salutierte.
Der Fährmann griff nach den Rudern.
Sachte, wenn auch unbeholfen, hoben Orme und Coulter den Verletzten zur Fähre hinüber, wo sie ihn auf den Boden betteten. Während der gesamten Zeit presste ihm Coulter die improvisierte Mullbinde auf die Wunde.
Monk nahm unterdessen das herabgefallene Ruder des Leichters mit dem flachen Rumpf an sich und tauchte das Blatt mit beiden Händen ins Wasser, in dem schwankenden Gefährt ständig um sein Gleichgewicht kämpfend. Kaum war Orme im Boot, entfernte er sich von der Fähre. Das Rudern gelang ihm mit einer Selbstverständlichkeit, die er nicht erwartet hatte. Dank Erinnerungen und Dingen, die man ihm erzählt hatte, wusste er, dass er in Northumberland von Booten umgeben aufgewachsen war; meistens hatte er wohl gefischt und bei Regen in Rettungsbooten gesessen. Das Meer mit seinen vielen Eigenarten war tief in ihm verwurzelt und mit ihm Achtsamkeit und Disziplin. Man kann gegen Menschen und die Gesetze rebellieren, aber nur ein Dummkopf lehnt sich gegen das Meer auf. Und das tut er auch bloß ein Mal.
»Wir holen ihn nicht mehr ein!«, rief Orme verzweifelt. »Dabei würde ich ihm liebend gern mit meinen eigenen Händen die Schlinge um den Hals knüpfen und dann die Falltür unter seinen Füßen runterklappen.«
Monk gab keine Antwort. Er hatte ein Gefühl für die Länge und das Gewicht des Ruders entwickelt und tauchte es immer im richtigen Moment ein, sodass er mit jedem Schlag die höchstmögliche Geschwindigkeit herausholte. Und endlich fuhren sie mit der Strömung, so wie fünfzig Meter vor ihnen auch die anderen Kähne.
Im Moment konnte Orme nichts tun, um zu helfen. In dieser Art von Boot konnte nur ein Mann rudern. Er saß auf der anderen Seite, um Monks Gewicht auszugleichen. Sein Blick war starr nach vorn gerichtet, seine Uniformjacke bis zum Hals zugeknöpft, um zu verbergen, dass er kein Hemd trug. Dasjenige, das jetzt als Mullbinde diente, würde er mit Sicherheit nie wieder anziehen.
»Das ist ein ganzer Verband«, meldete Monk voller entschlossenem Optimismus. »Die können sich nicht wie wir einfach zwischen ankernden Schiffen hindurchschlängeln. Sie werden außen herumfahren müssen.«
»Aber wenn wir zwischen den Schiffen fahren, können wir sie leicht aus den Augen verlieren«, warnte Orme düster. »Und wir könnten weiß Gott wo rauskommen.«
»Wenn wir das nicht tun, verlieren wir sie in jedem Fall«, erwiderte Monk. »Sie sind fünfzig Meter vor uns, und der Abstand wächst.« Er legte sein ganzes Gewicht in den nächsten Schlag, und prompt rutschte ihm das Ruderblatt weg. Die Art des Widerstands im Wasser verriet ihm sofort, dass er einen Fehler gemacht hatte. Das Boot kam vom Kurs ab, und es dauerte über eine Minute, bis er in seinen Rhythmus zurückfand.
Orme blickte zur Seite und tat so, als hätte er nichts bemerkt.
Der Kahnverband beschrieb einen weiten Bogen um ein Schiff der East India Company, auf dessen Deck Schauermänner mit entblößtem Oberkörper Truhen voller Gewürze, Seide und vermutlich auch Tee schleppten.
Monk setzte alles auf eine Karte und entschied sich für die Abkürzung durch den Hafen. Fieberhaft suchte er nach einer Lücke zwischen dem East-India-Schiff und einem spanischen Schoner, von dem gerade Töpferwaren und Orangen abgeladen wurden. Er konzentrierte sich darauf, sein Gewicht richtig auszubalancieren und die Schläge regelmäßig auszuführen. Soweit ihm das möglich war, bemühte er sich, nicht daran zu denken, dass die Kähne jetzt, da sie außerhalb ihres Gesichtsfeldes waren, womöglich auf das andere Ufer zuhielten. Wenn das geschah, würden sie sie garantiert verlieren.
So knapp, wie er es nur wagen konnte, passierte er das East-India-Schiff. Er hörte das Klatschen des Wassers gegen seinen mächtigen Rumpf und das gedämpfte Rauschen und Flattern der eingeholten Segel im Wind.
Kaum hatte er wieder offenes Wasser erreicht, riskierte er einen Blick nach steuerbord. Die Lastkähne waren jetzt deutlich näher gekommen, höchstens noch vierzig Meter entfernt. Er beherrschte sich nur mühsam. Mit geballten Fäusten und hochgezogenen Schultern wirkte Orme ebenfalls aufs Äußerste angespannt. Seine Lippen bewegten sich – er zählte die Kähne vor ihnen, nur um sich zu vergewissern, dass sich keiner abgesetzt hatte, als sie sie kurz aus den Augen verloren hatten.
Der Vorsprung wurde immer geringer. Allerdings konnten sie Phillips nicht mehr ausmachen. Aufmerksam ließ Monk den Blick über die mit Segeltuch bedeckte Fracht der Kähne schweifen. Ihr Mann konnte sich hinter einem Ballen oder Fass verbergen, vielleicht lag er auch unter der Abdeckung oder hatte sich die Jacke eines der Bootsmänner übergestreift, sodass er sich auch aus wenigen Metern Abstand kaum noch von ihnen unterschied. Aber das würde ihm nichts nützen. Monk war fest entschlossen, diesen Kerl trotz allem zu schnappen.
Allerdings würde er die Kähne allein durchsuchen müssen. Einer von ihnen musste auf dem Boot bleiben, weil sie sonst keine Möglichkeit mehr hätten, Phillips an Land zu bringen. Es war lange her, seit er zuletzt mit einem Messer Mann gegen Mann gekämpft hatte. Ja, er war sich nicht einmal sicher, dass er das je getan hatte. An die Zeit vor seinem Unfall konnte er sich schließlich nicht mehr erinnern. Würde er sich überhaupt auf irgendeinen Instinkt verlassen können?
Nur noch zehn Meter. Er musste sich auf den Sprung vorbereiten. Sie gerieten in den Windschatten eines Klippers, dessen Masten am Himmel zu kratzen schienen. Ansonsten bewegte sich das riesige Schiff so gut wie gar nicht; sein Rumpf war einfach zu schwer, um auf den Wellen des Flusses zu schaukeln. Der Leichter glitt mühelos über das Wasser, aber dann gab es einen Ruck, als sie den durch den Klipper geschützten Bereich verließen und wieder den offenen Fluss erreichten. Gleichwohl holten sie den letzten Kahn schnell ein. Vier Meter, drei, zwei … Monk sprang. Sofort nahm Orme seinen Platz ein und ergriff die Ruder.
Monk landete auf dem Boden des Kahns, strauchelte und erlangte rasch sein Gleichgewicht wieder. Der Leichterschiffer achtete nicht weiter auf ihn. Mit dem Drama, das sich hier vor seinen Augen abspielte, hatte er nichts zu tun.
Da Monk sich auf dem hintersten Kahn befand, konnte Phillips nur weiter vorn sein, wenn er sich denn überhaupt von der Stelle gerührt hatte. Kurz entschlossen bewegte sich Monk voran. Auf der mit Leinwand abgedeckten Ladung setzte er von einem formlosen Hügel zum nächsten behutsam einen Fuß vor den anderen. Sicheren Halt fand er nie und musste ständig mit weit ausgebreiteten Armen sein Gewicht ausbalancieren. Seine Augen schossen unablässig hin und her, jeden Moment auf eine Überraschung gefasst.
Er war schon fast am Bug angelangt und bereit, auf das nächste Boot zu springen, als er aus dem Augenwinkel ein Zucken wahrnahm. Im nächsten Moment hatte sich Phillips auf ihn gestürzt und holte mit dem Messer aus. Monk trat mit dem Fuß nach ihm, und weil er gleichzeitig zur Seite hin auswich, verlor er kurz das Gleichgewicht und konnte sich nur mühsam aufrecht halten.
Phillips stach ins Leere. Da er sich darauf eingestellt hatte, auf festes Fleisch zu treffen, der erwartete Widerstand jedoch ausblieb, riss ihn der eigene Schwung mit. Auf einem Bein taumelnd, ruderte er hektisch mit den Armen, konnte aber den Sturz nicht mehr verhindern und landete auf den Knien. Den heftigen Tritt von Monks Stiefel gegen seinen Schenkel registrierte er nicht. Sofort stach er wieder zu. Diesmal zerfetzte er Monk vorn am Schienbein die Hose und fügte ihm eine blutende Wunde zu.
Obwohl ihm der Stich einen brennenden Schmerz durchs Bein jagte, war Monk vor allem überrascht. Er hatte nicht damit gerechnet, dass Phillips sich so schnell erholen würde – ein Fehler, der ihm nicht noch einmal unterlaufen sollte. Außer der Pistole hatte er keine Waffe im Gürtel stecken. Die zog er jetzt, allerdings nicht, um zu schießen, sondern um den Mann niederzuschlagen. Dann überlegte er es sich anders und trat erneut zu, fest und gezielt. Mit einem Treffer an der Schläfe schickte er Phillips zu Boden. Doch sein Gegner hatte den Tritt kommen sehen und zurückweichen können, womit er dem Tritt die Wucht nahm.
Monk musste sich über die ausgebeulte Leinwandplane auf ihn zubewegen, von der er keine Ahnung hatte, was sich darunter verbarg. In diesem Moment wurden die Kähne vom Kielwasser eines Kohlenschiffs getroffen, das weiter vorn mit geblähten Segeln vorüberrauschte. Sie gerieten ins Schlingern, und sogar die Bootsmänner verloren das Gleichgewicht. Am schlimmsten traf es Monk, der als Einziger stand – ein Fehler, wie sich nun zeigte. Ganz im Gegensatz zu Phillips hatte er nicht mit der Welle gerechnet. Er geriet ins Schwanken, taumelte und wäre direkt auf Phillips gestürzt, wenn dieser sich nicht rechtzeitig zur Seite gerollt hätte. Der Aufprall war hart und schmerzhaft, und im nächsten Moment lag Phillips auch schon auf ihm und drückte ihn mit Armen und Beinen so hart wie Stahl nieder.
Monk war festgeklemmt – und ganz allein. Orme konnte vielleicht beobachten, was hier geschah, doch er war zu weit entfernt, um zu helfen. Und die Bootsmänner hielten sich aus der Angelegenheit heraus.
Einen Augenblick lang war Phillips’ Gesicht dem von Monk so nahe, dass dieser seine Haut und seine Haare sehen und seinen Atem riechen konnte. Phillips’ Augen glänzten, und grinsend hob er die Hand mit dem Messer.
Jäh schnellte Monks Kopf hoch und traf Phillips mit einem kräftigen Stoß an der Nasenwurzel. Der Schmerz war entsetzlich – Knochen auf Knochen -, doch Phillips war derjenige, der aufschrie, und mit einem Mal wurde sein Griff schlaff. Monk warf ihn ab und richtete sich auf, um jäh mit der Pistole in der Hand herumzuwirbeln.
Aber es war zu spät, um zu schießen. Das ganze Gesicht blutverschmiert, hatte sich Phillips zusammengekauert weggedreht, als wüsste er, dass Monk ihm nicht in den Rücken schießen würde. Dann explodierte er förmlich und sprang zum nächsten Kahn hinüber, wo er auf allen vieren auf der Plane landete.
Ohne zu überlegen, folgte ihm Monk.
Phillips richtete sich schwankend auf und eilte auf dem Scheitel der Plane weiter. Monk setzte ihm nach. Jetzt fiel ihm das Balancieren noch schwerer. Was immer unter der Plane war, es rollte ihm unter den Füßen weg und zwang ihn, schneller zu laufen, als ihm lieb war.
Phillips erreichte den Bug und sprang erneut. Wieder tat Monk es ihm gleich. Diesmal hatte er Ballen unter den Füßen, auf denen das Gehen leichterfiel. Von einem zum anderen hüpfend, holte er Phillips ein, warf sich auf ihn und ging mit ihm zu Boden. Der Aufprall war hart und schmerzhaft. Mit einem Hieb gegen die Brust presste er Phillips die Luft aus der Lunge. Er konnte den anderen Mann keuchen hören bei dem Versuch, wieder einzuatmen. Plötzlich spürte er einen Schmerz im Unterarm und entdeckte Blut. Aber es war nur ein Schnitt, nicht tief genug, um ihn zu beeinträchtigen. Erneut traf er Phillips an der Brust, und diesem fiel endlich das Messer aus der Hand. Monk hörte, wie es über die Leinwandplane glitt und scheppernd auf das Deck prallte.
Phillips wand sich wie ein Aal. Er schien nur noch aus Ellbogen, Knien und sonstigen spitzen Knochen zu bestehen. Und er entwickelte ungeheure Kräfte. Monk konnte ihn einfach nicht festhalten.
Schnell hatte sein Gegner sich befreit und torkelte weiter zum Bug, bereit zum Sprung auf den nächsten Kahn. Ein Leichter, der allein unterwegs war, schickte sich soeben an, sie zu überholen. Damit stand Phillips’ Absicht bereits fest. Er würde versuchen, auf ihn zu gelangen. Und es war kein anderes Boot in der Nähe, mit dem Monk die Verfolgung würde fortsetzen können.
Monk rappelte sich auf und hastete zum Bug. Doch zu spät. Phillips sprang, bevor Monk nach ihm greifen konnte. Der Satz geriet allerdings zu kurz, und Phillips stürzte in das vom Bug aufgewühlte, weiß schäumende Wasser.
Monk zögerte. Er konnte ihn ohne weiteres ertrinken lassen. Der Rettungsversuch bräuchte nur einen Moment zu spät zu erfolgen, und kein Mensch der Welt würde Phillips da noch herausfischen können. Wegen seiner Verletzung würde er binnen Minuten ertrinken. Aber das wäre ein besseres Ende gewesen, als er verdient hätte. Monk wollte ihn lebend, damit er vor Gericht gestellt und gehängt wurde. Durban würde im Nachhinein Genugtuung erfahren und ebenso all die Jungen, die Phillips festgehalten und gequält hatte.
Monk beugte sich weit vor und erwischte Phillips an den Schultern. Irgendwie gelang es ihm, die Finger um seinen Arm zu schließen, ihn hochzuhieven und unter Aufbietung seiner ganzen Kraft an Bord zu wuchten. Nass war Phillips ungemein schwer, fast wie totes Gewicht. Seine Lunge füllte sich bereits mit Wasser, und er leistete keinerlei Widerstand.
Phillips war noch nicht richtig an Bord, als Monk die Handschellen zückte und um seine Handgelenke zuschnappen ließ. Erst danach wälzte er ihn auf den Bauch und begann, ihm das Wasser aus der Brust zu pressen. »Atmen!«, knurrte er durch aufeinandergebissene Zähne. »Atmen, du Schwein!«
Phillips hustete, spuckte Flusswasser und schnappte nach Luft.
»Prima, Sir!«, rief Orme, der mit dem Leichter herangerudert war. »Mr. Durban wär’ glücklich gewesen, wenn er das erlebt hätte.«
Nach seinem verzweifelten Kraftakt hatte Monk auf einmal ein Gefühl, als strömte Wärme durch seinen ganzen Körper. »Hier musste ja mal Ordnung geschaffen werden«, erwiderte er bescheiden. »Danke für Ihre Unterstützung, Mr. Orme.«
Monk erreichte sein Haus an der Paradise Place in Rotherhithe vor sechs Uhr, was für seine Verhältnisse früh war. Nachdem die Fähre am Steg von Princes Stairs angelegt hatte, war er zügig zur Church Street marschiert, von der die Paradise Place nach einem scharfen Knick wegführte. Unterwegs hatte er sich die ganze Zeit geweigert, den Gedanken zuzulassen, dass Hester vielleicht gar nicht daheim war und er noch würde warten müssen, bis er ihr erzählen konnte, dass sie Phillips endlich erwischt hatten. Doch so dumm das auch von ihm war, er konnte diese Befürchtung einfach nicht aus seinem Bewusstsein bannen.
Der Polizeiarzt hatte die Stichwunden genäht, die ihm Phillips am Arm und am Bein zugefügt hatte, und neben vielen blauen Flecken war er immer noch blutverschmiert und starrte vor Schmutz. Außerdem hatte er für seine Männer eine Flasche hervorragenden Brandy gekauft, die sie im Revier zusammen geleert hatten. Der Schnaps hatte keinem von ihnen geschadet, allerdings war ihm klar, dass er jetzt nach Alkohol roch. Der Gedanke an all das war freilich wie ausgelöscht, als sein Haus in Sicht kam; die letzten Meter legte er im Laufschritt zurück und sperrte auf.
»Hester!«, rief er, noch bevor die Tür hinter ihm zufiel. »Hester?« Erst jetzt zog er die Möglichkeit in Betracht, dass sie tatsächlich noch unterwegs sein konnte. »Wir haben ihn!«
Die Worte dröhnten in der Stille.
Plötzlich ertönte im oberen Stockwerk ein Klappern, und Hester eilte die Treppe herunter. Ihr dichtes blondes und wie immer eigenwilliges Haar hatte sich zur Hälfte aus dem Knoten gelöst. Sie umarmte ihn mit aller Kraft, die, ihrer zierlichen Gestalt und den fehlenden Rundungen zum Trotz, beträchtlich war.
2
Eines Abends, beinahe zwei Wochen nach Jericho Phillips’ Festnahme, kehrte Sir Oliver Rathbone etwas früher als sonst von seiner Kanzlei in den Inns of Court in sein äußerst gemütliches Heim zurück. Es war Mitte August, und die Luft stand heiß über der Stadt. Da war es viel angenehmer, in seinem eigenen Salon zu sitzen, den Blick durch die geöffnete Terrassentür auf den Rasen zu genießen und den Duft der spät blühenden Rosen einzuatmen, statt sich dem Gestank der Straßen, dem Schweiß und Mist der Pferde, dem Staub und Lärm auszusetzen.
Margaret begrüßte ihn mit der Freude, die sie immer zeigte, seit sie vor kurzem geheiratet hatten. In einem Wirbel von blassgrünem und weißem Musselin kam sie die Treppe heruntergerauscht und wirkte trotz der Hitze unglaublich kühl. Sie küsste ihn sanft und verriet dabei immer noch eine Spur von Verlegenheit. Er selbst empfand großes Glück, das er sich lieber nicht anmerken ließ, weil das womöglich taktlos gewesen wäre.
Beim Essen sprachen sie über eine neue Kunstausstellung, die sich als unerwartet umstritten erwiesen hatte, über die Abwesenheit der Königin mitten in der Londoner Saison wegen des Todes von Prinz Albert und über die Frage, was sich dadurch in Zukunft verändern würde, und natürlich über diesen unseligen Bürgerkrieg in Amerika.
Die Konversation war hinreichend interessant, um Rathbone intellektuell zu reizen, und doch höchst angenehm. Er konnte sich nicht erinnern, jemals so glücklich gewesen zu sein, und als er sich in sein Arbeitszimmer zurückzog, um ein paar wichtige Dokumente zu studieren, lächelte er unwillkürlich in sich hinein, einfach weil er Frieden in sich spürte.
Allmählich brach die Abenddämmerung herein, und die Luft kühlte wohltuend ab. Dann klopfte unvermittelt der Butler an und teilte ihm mit, dass ihn sein Schwiegervater zu sprechen wünschte. Selbstverständlich ließ Rathbone ihn sofort zu sich kommen, auch wenn es ihn wunderte, dass Arthur Ballinger ausdrücklich ein Gespräch mit ihm suchte und nicht auch seine Tochter mit einbezog.
Als Ballinger fast unmittelbar nach dem Diener eintrat, erkannte Rathbone auf den ersten Blick, dass ihn eine berufliche Angelegenheit und nichts Persönliches zu ihm geführt hatte. Ballinger war ein äußerst erfolgreicher Kronanwalt von hohem Ansehen. Gelegentlich hatten sie beruflich miteinander zu tun, aber bisher hatten sie nie gemeinsame Mandanten gehabt, denn Rathbones Kanzlei befasste sich fast ausschließlich mit großen Prozessen gegen Kriminelle.
Um die Vertraulichkeit zu wahren, schloss Ballinger die Tür hinter sich, ehe er auf dem Stuhl Rathbone gegenüber Platz nahm. Rathbones Gruß erwiderte er äußerst knapp. Er war ein großer, ziemlich schwerer Mann mit dichtem braunem Haar, das nur wenige graue Fäden zeigte. Sein Gesicht wirkte massiv. Ihre feinen Züge und ihre Anmut verdankte Margaret ausschließlich ihrer Mutter.
Ballinger begann ohne Umschweife. »Ich befinde mich in einer schwierigen Lage, Oliver. Ein langjähriger Mandant hat mich um einen Gefallen gebeten, den ihm zu erweisen mir eigentlich widerstrebt. Andererseits habe ich das Gefühl, dass ich nicht ablehnen kann. Es handelt sich um eine Angelegenheit, mit der ich offen gesagt lieber nichts zu tun hätte, aber ich sehe einfach keinen ehrenhaften Weg, mich ihr zu entziehen.« Er deutete mit nur einer Schulter ein Achselzucken an. »Und wohl auch keinen legalen. Man kann sich eben nicht aussuchen, in welchen Fällen man für Menschen eintritt und in welchen nicht. Damit würde das ganze Konzept unserer Justiz zur Farce geraten, doch sie muss für alle gelten, sonst gilt sie für niemanden.«
Diese Vorrede verblüffte Rathbone, legte sie doch einen Mangel an Selbstvertrauen nahe, der für Ballinger völlig untypisch war. Eindeutig hatte ihn etwas durcheinandergebracht. »Kann ich von Hilfe sein, ohne das Recht deines Mandanten auf Diskretion zu verletzen?«, fragte er voller Hoffnung. Es würde ihn freuen, Margarets Vater in einer für ihn wichtigen Sache beistehen zu können. Damit würde er nicht nur Margaret glücklich machen, sondern auch die Bande zu ihrer Familie vertiefen, etwas, das von sich aus zu tun nicht in seiner Natur lag, denn er hatte einen ausgeprägten Hang zur Zurückgezogenheit. Außer einer intensiven Beziehung zu seinem Vater hatte er in seinen Jahren als Erwachsener nur wenige Freundschaften aufgebaut. In mancher Hinsicht war William Monk sein bester Freund. Davon war natürlich Hester ausgenommen, für die er stärkere, intimere und bisweilen auch schmerzlichere Gefühle hegte. Aber dazu, sich Letzterem zu stellen und es zu analysieren, war er noch nicht wirklich bereit.
Ballingers Anspannung ließ ein wenig nach, zumindest äußerlich. Allerdings verbarg er immer noch die Hände im Schoß, als befürchtete er, sie könnten etwas preisgeben.
»Es würde überhaupt keinen Vertrauensbruch bedeuten«, versicherte er Rathbone hastig. »Ich benötige dich nur mit deinen besonderen Fähigkeiten als rechtlichen Beistand in einem Fall, bei dem ich befürchte, dass du ihn als abstoßend empfinden und von vornherein nur wenig Erfolgsaussichten erkennen wirst. Doch selbstverständlich wirst du angemessen für deinen Zeitaufwand und deine meiner Meinung nach einzigartige Qualifikation entlohnt.« Er war klug genug, ihn nicht über Gebühr zu loben.
Rathbone war verwirrt. Es war sein Beruf, Mandanten vor Gericht zu vertreten. In seltenen Fällen fungierte er auch als Ankläger auf Seiten der Krone, aber das waren Ausnahmen. Warum war Ballinger bei dieser Sache derart nervös? Warum suchte er Rathbone bei ihm zu Hause auf und nicht in seiner Kanzlei, wie es üblich wäre? Was war an diesem Fall so besonders? Er hatte Menschen verteidigt, die wegen Mordes, Brandstiftung, Erpressung oder Diebstahls angeklagt waren, eigentlich wegen jedes nur denkbaren Verbrechens, einschließlich Vergewaltigung.
»Was wird deinem Mandanten vorgeworfen?«, erkundigte er sich. Konnte es etwas so Schwerwiegendes wie Verrat sein? An wem? An der Königin etwa?
Ballinger deutete ein Schulterzucken an. »Mord. Aber er ist kein beliebter Mann. Kein Geschworener wird ihn mögen. Er wird einfach keinen guten Eindruck machen«, fügte er eilig hinzu, denn er musste Rathbone den Zweifel angesehen haben. Er beugte sich etwas vor. »Aber das ist nicht das Problem, Oliver. Ich weiß, dass du alle Arten von Leuten vertreten hast, selbst bei Anklagen, bei denen der Täter keinerlei öffentliche Anteilnahme erwarten konnte. Auch wenn mir in diesem speziellen Fall jedes Detail zuwider ist, geht es auch hier um die Gerechtigkeit, die in den Augen meines Mandanten das höchste Gut darstellt.«
Rathbone entdeckte in dieser Bemerkung eine bittere Ironie. Nur wenige drückten ihren Wunsch, erfolgreich verteidigt zu werden, mit derart allgemeinen Formulierungen aus.
»Ich habe meine Bitte noch nicht vollständig erklärt«, fuhr Ballinger fort. »Mein Mandant wird deine Gebühren für die Verteidigung einer ganz anderen Person begleichen. Er hat keine Beziehung zu dem Beschuldigten und verbindet mit dem Ergebnis keine persönlichen Absichten, außer dass es juristisch einwandfrei zustande kommt, unbelastet von irgendwelchen Vorurteilen. Er befürchtet, dass der Angeklagte in diesem Fall jedem Durchschnittsgeschworenen so widerwärtig erscheinen muss, dass er ohne die bestmögliche Verteidigung für schuldig befunden und gehängt wird, aber nicht auf der Grundlage von Fakten, sondern auf der von Emotionen.«
»Sehr altruistisch«, bemerkte Rathbone, auch wenn er bereits eine Erregung verspürte, als hätte er einen Blick auf etwas Erhabenes geworfen, eine Schlacht, ausgefochten mit all der Leidenschaft und Hingabe, die er nur aufbringen konnte. Aber es war nur ein sehr kurzer Blick, das Aufblitzen eines Lichts, das sofort wieder erlosch. »Wer ist es?«, fragte er.
Ballinger lächelte oder verzog vielmehr matt die Mundwinkel. »Das darf ich nicht enthüllen. Er wünscht anonym zu bleiben. Er hat mir auch seine tieferen Gründe nicht verraten, aber ich muss diesen Wunsch respektieren.« Seine Miene und dazu die schief hochgezogenen Schultern legten den Schluss nahe, dass dieses Detail den Ausschlag gegeben hatte, sich nicht auf einen Prozess einzulassen, bei dem er sein Scheitern befürchten musste.
Rathbone starrte den anderen Mann verblüfft an. Wie konnte es sein, dass ein Mensch, der ein so hehres Ziel verfolgte, sich selbst seinem Anwalt nicht zu erkennen geben wollte? Dass er die Öffentlichkeit scheute, ließ sich ohne weiteres begreifen. Dort konnte schnell der Eindruck entstehen, er hätte ein gewisses Verständnis für den Beschuldigten, und dass er das vermeiden wollte, lag auf der Hand. »Wenn ich an Diskretion gebunden bin, werde ich mich daran halten«, antwortete Rathbone sanft. »Das hast du ihm doch sicher gesagt?«
»Natürlich«, erwiderte Ballinger eilig. »Aber auf diesem Punkt beharrt er. Ich konnte ihn nicht dazu bringen, diesbezüglich nachzugeben. Was dich betrifft, werde ich den Beschuldigten dir gegenüber vertreten und in seinem Namen handeln. Du brauchst nur zu wissen, dass dein Honorar durch einen Mann von höchstem Ansehen und absoluter Integrität in voller Höhe beglichen wird und dass seine eigenen Einkünfte über jeden Verdacht erhaben sind. Darauf bin ich bereit einen Eid zu leisten.« Regungslos verharrte er auf seinem Stuhl und starrte Rathbone eindringlich in die Augen. Bei einem weniger würdevollen Mann wäre einem dieser Blick vielleicht flehentlich erschienen.
Rathbone behagte es nicht, dass ihn sein eigener Schwiegervater um berufliche Unterstützung bat, die er bisher immer gern gegeben hatte, selbst Fremden und Leuten, die er nicht mochte, denn das war schließlich sein Gewerbe. Er war Advokat und dazu berufen, im Namen derer zu sprechen, die selbst nicht die Voraussetzungen dafür hatten und Unrecht erleiden würden, wenn niemand für sie Partei ergriffe. Das Rechtssystem beruhte auf dem Prinzip Kläger gegen Beklagten. Beide Seiten mussten einander hinsichtlich Fähigkeiten und Einsatz für ihre Sache ebenbürtig sein, wenn die ganze Angelegenheit nicht zur Farce ausarten sollte.
»Selbstverständlich werde ich für deinen Mandanten tätig«, versprach Rathbone ernst. »Gib mir die nötigen Dokumente und einen Vorschuss, und dann wird alles, was wir sagen, unter dem Schutz der Vertraulichkeit stehen.«
Endlich löste sich Ballingers Anspannung. »Dein Wort genügt mir, Oliver. Bis morgen Vormittag werde ich alles, was du benötigst, in deine Kanzlei bringen lassen. Ich bin dir zutiefst dankbar. Ich wünschte, ich könnte Margaret sagen, was für einen großartigen Mann sie hat, aber dessen ist sie sich sicher längst bewusst. Ich bin überglücklich, dass sie so klug war, sich von ihrer Mutter nicht in eine Vernunftheirat drängen zu lassen, auch wenn ich zugeben muss, dass ich damals außer mir war.« Ein betrübtes Lächeln flackerte über sein Gesicht. »Wenn man eine Frau mit starkem Willen im Haus haben will, sollte man sich noch eine holen, nach Möglichkeit eine mit entgegengesetzten Ansichten, dann kann man sich je nach Bedarf auf die eine oder die andere Seite schlagen, um am Ende doch noch seinen Kopf durchzusetzen.« Er seufzte, und einen Moment lang verriet sein Gesicht trotz aller Erleichterung Trauer. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin, Oliver.«
Darauf wusste Rathbone nichts zu erwidern. Ballingers offen gezeigte Wertschätzung hatte ihn etwas verlegen gemacht. Rasch lenkte er das Gespräch auf die praktischen Aspekte. »Wen soll ich also verteidigen? Die Anklage lautet auf Mord, hast du gesagt?«
»Ja. Bedauerlicherweise.«
»Wer ist der Mann, und wer war sein Opfer?« Da sie beide erfahrene Anwälte waren, brauchte er Ballinger nicht davor zu warnen, ihm von irgendwelchen Geständnissen zu berichten, was seine Position vor Gericht womöglich nur geschwächt hätte.
»Jericho Phillips«, antwortete Ballinger beinahe beiläufig.
Plötzlich wurde Rathbone bewusst, dass Ballinger ihn aufmerksam beobachtete, auch wenn er seinen Blick mit halb gesenkten Lidern zu kaschieren suchte. »Der Mann, der beschuldigt wird, den in Greenwich gefundenen Jungen ermordet zu haben?«, fragte er. Er hatte von dieser Sache in der Zeitung gelesen, und schon jetzt überlief ihn ein kalter Schauer, den er sich nicht erklären konnte.
»Richtig«, bestätigte Ballinger. »Er leugnet das allerdings, sagt, der Junge sei weggelaufen und er habe keine Ahnung, wer ihn getötet hat.«
»Warum wird er dann angeklagt? Irgendwelche Beweise müssen schließlich vorliegen. Wasserpolizei, richtig? Monk ist doch kein Dummkopf.«
»Natürlich nicht«, entgegnete Ballinger höflich. »Ich weiß, dass er ein Freund von dir ist oder es zumindest war. Aber selbst gute Leute können sich irren, vor allem dann, wenn sie noch neu in ihrem Beruf und ein bisschen zu eifrig auf Erfolg bedacht sind.«
Rathbone traf die Spitze gegen Monk schmerzhafter, als er erwartet hatte. »Ich habe ihn in letzter Zeit nicht gesehen. Ich war sehr beschäftigt und könnte mir vorstellen, dass es bei ihm nicht anders ist. Aber ich betrachte ihn immer noch als Freund.«
Ballingers Gesicht verriet auf einmal Bedauern, ja schlechtes Gewissen. »Ich möchte mich entschuldigen. Ich wollte ihm nichts Unehrenhaftes unterstellen. Hoffentlich habe ich dich jetzt nicht in eine Rolle gedrängt, in der du das Urteil eines Mannes anzweifeln musst, den du magst und achtest.«
»Sympathie für Monk hat nichts mit der Verteidigung eines Mannes zu tun, den er verhaftet hat!«, rief Rathbone hitzig, nur um im selben Moment zu merken, dass das sehr wohl der Fall sein könnte, wenn er es zulassen würde. »Hältst du es für möglich, dass meine Verbindungen zur Polizei, zur Staatsanwaltschaft oder von mir aus auch zum Richter irgendwelche Auswirkungen darauf haben, wie ich einen Fall führe, egal welchen?«