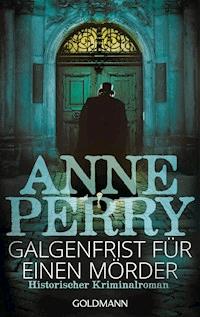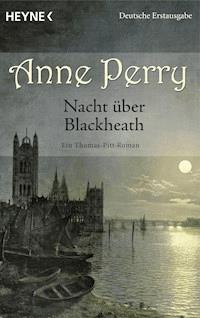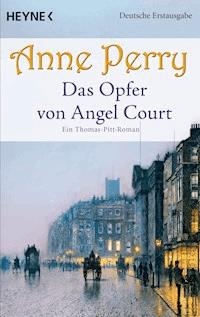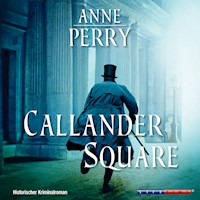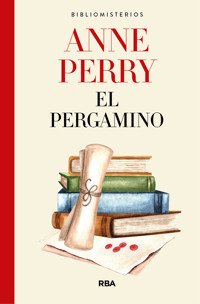7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Thomas & Charlotte-Pitt-Romane
- Sprache: Deutsch
An einem stürmischen Morgen wird in der Themse die Leiche eines Mannes in Frauenkleidern entdeckt. Die Ermittlungen führen Oberinspektor Pitt ins Zentrum der Londoner Boheme, zum Theater und in Ateliers, in denen mit der neuen Kunst der Fotografie experimentiert wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
An einem stürmischen Septembermorgen wird auf der Themse die Leiche eines Mannes entdeckt. In dem grünen Samtumhang und an einen Stechkahn gefesselt bietet sie einen merkwürdigen Anblick – sie wirkt wie eine bewusst arrangierte Parodie des berühmten »Ophelia«-Gemäldes von dem zeitgenössischen Maler Millais. Der erste Verdacht, dass es sich bei dem Toten um einen vermisst gemeldeten französischen Diplomaten handelt, bestätigt sich nicht. Die weiteren Ermittlungen führen Oberinspektor Pitt ins Zentrum der Londoner Boheme, zum Theater, wo die wunderschöne Cecily Antrim mit einem kühnen Porträt Anstoß in der Gesellschaft erregt, und in Ateliers, in denen mit der neuen Kunst der Fotografie experimentiert wird. Genau hier, in der distinguierten Sphäre der Schauspieler, Dichter und Künstler, macht Pitt eine Entdeckung, mit der er nicht gerechnet hatte.
Die Autorin
Anne Perry, 1938 in London geboren, lebt und schreibt in Portmahomack, Schottland. Ihre historischen Kriminalromane um Oberinspektor Pitt und seine kluge Ehefrau Charlotte zeichnen ein lebendiges und hintergründiges Bild des spätviktorianischen London.
Inhaltsverzeichnis
Für Carol Ann Lee in Dankbarkeit
Kapitel eins
DUNSTSCHLEIER STIEGEN TRÄGE vom silbergrauen Wasser der Themse auf, das im ersten Sonnenlicht schimmerte. Im Hintergrund zeichneten sich vor dem perlmuttfarbenen Himmel die düsteren roten Bogen der Brücke ab, die zum südlich der Themse liegenden Stadtteil Lambeth hinüberführte. Sofern schon Schleppzüge mit dem Tidenstrom zum Londoner Hafen unterwegs waren, verbarg sie der Septembernebel.
Schutzlos dem Wind ausgesetzt stand Oberinspektor Thomas Pitt auf der obersten Stufe der nassen Steintreppe und sah auf den unten angebundenen Kahn hinab, der mit dem sachten Wellenschlag gegen den Fähranleger von Horseferry stieß. Er war eineinhalb Stunden zuvor einem Streifenbeamten aufgefallen, der ihn im Wasser hatte treiben sehen. Doch nicht dem Kahn galt die Aufmerksamkeit des Leiters der Polizeiwache von Bow Street, sondern dem, was darin lag und auf ihn wie eine groteske Parodie von Millais’ Gemälde der ertrunkenen Ophelia wirkte.
Der Streifenbeamte wandte den Blick ab und sah Pitt viel sagend an.
»Ich habe gedacht, wir sollten Ihnen das besser melden, Sir.«
Pitt sah auf die Leiche im Kahn, deren Handgelenke ebenso wie die Fußgelenke an die Bordwände gekettet waren. Die Knie waren leicht gespreizt und der Kopf wie in Ekstase nach hinten geworfen. Das lange grüne Gewand, in das sie gehüllt war, sah aus wie ein Kleid, war aber so zerfetzt und verheddert, dass sich unmöglich hätte sagen lassen, wie es ursprünglich ausgesehen hatte. Obwohl auch die Körperhaltung wie die einer Frau wirkte, handelte es sich unverkennbar um einen Mann. Er war blond, dürfte um die Mitte dreißig sein, hatte ein angenehm geschnittenes Gesicht und trug einen sauber gestutzten Schnurrbart.
»Warum denn?«, fragte Pitt. »Was hat das mit der Bow Street zu tun? Das hier gehört doch gar nicht zu meinem Revier.«
Mit schmatzendem Geräusch schlug das Wasser an die Stufen des Anlegers, vielleicht die Wellen eines vorüberfahrenden Bootes, das man im Nebel nicht sehen konnte.
Voller Unbehagen trat der Polizist von einem Fuß auf den anderen. »Die Sache könnte Kreise ziehen, Mr. Pitt.« Er vermied es nach wie vor, zu dem Kahn und dem Mann darin hinzusehen. »Vielleicht gibt es einen Skandal. Deshalb habe ich gedacht, es wäre das Beste, wenn Sie das von Anfang an in die Hand nehmen würden.«
Äußerst vorsichtig, um nicht auf den nassen Stufen auszugleiten, ging Pitt zu dem Kahn hinab. Schwermütig dröhnte ein Nebelhorn über das Wasser, und von irgendeinem Schleppkahn hörte man den Warnruf eines Mannes. Die Antwort wurde vom Nebel verschluckt. Erneut sah Pitt auf den Mann im Kahn. Aus diesem Winkel ließ sich unmöglich erkennen, auf welche Weise er ums Leben gekommen war. Weder eine Wunde noch eine Waffe waren zu sehen, doch sofern er einem Schlaganfall oder Herzinfarkt erlegen war, hatte jemand anschließend mit Bedacht dies groteske Bild gestellt. Seine Angehörigen, wer auch immer sie sein mochten, würden ab heute in einem Albtraum leben, und womöglich würde das Leben dieser Menschen ab sofort nie mehr sein wie zuvor.
»Ich nehme an, dass Sie nach dem Polizeiarzt geschickt haben?«, erkundigte sich Pitt.
»Gewiss, Sir. Er müsste eigentlich jeden Augenblick hier sein.« Der Mann schluckte und trat von einem Fuß auf den anderen, wobei die Sohlen seiner Stiefel auf den Steinen scharrten. »Mr. Pitt – Sir.«
»Ja?« Pitt hielt nach wie vor den Blick auf den Kahn gerichtet, dessen Bug gegen die Stufen stieß und mit den Wellen ein wenig auf und ab tanzte.
»Ich habe Sie nicht nur gerufen, weil das so merkwürdig aussah.«
Etwas in seiner Stimme erregte Pitts Aufmerksamkeit, und so hob er den Blick zu dem Mann. »Sondern warum?«
»Nun ja, Sir. Ich glaube, ich weiß, wer das ist, und deswegen nehme ich auch an, dass die Sache großes Aufsehen erregen wird.«
Pitt spürte, wie ihm die Kälte des Flusses in die Knochen drang. »Aha. Und um wen handelt es sich Ihrer Ansicht nach, Konstabler?«
»Entschuldigung, Sir, aber das könnte Mussjöh Bonnard sein, der seit vorgestern vermisst gemeldet ist. In dem Fall würden die Franzosen mächtig Wirbel schlagen.«
»Die Franzosen?«, fragte Pitt argwöhnisch.
»Ja, Sir. Er ist in der Botschaft angestellt.«
»Und Sie meinen also, das könnte er sein?«
»Ich habe den Eindruck, Mr. Pitt. Man sieht, dass er ein feiner Herr ist, und die Personenbeschreibung passt auch auf ihn: ungefähr einsfünfundsiebzig, schlank, helle Haare, gut aussehend, kleiner Schnurrbart. Es sieht ganz so aus, als wäre er ein bisschen überkandidelt – er geht gern auf Gesellschaften, ins Theater und so weiter.« In seiner Stimme schwangen unüberhörbar Verständnislosigkeit und Abscheu mit. »Er verkehrt in den Kreisen von so genannten Schöngeistern …«
Hufgeklapper und das Rattern von Rädern auf der Straße über ihnen ersparte es Pitt, auf diese Äußerungen eingehen zu müssen, und schon bald kam der ihm wohlbekannte Polizeiarzt, dem der Hut ein wenig schief auf dem Kopf saß, mit seiner Tasche in der Hand die Stufen herab. Er sah an Pitt vorüber auf die im Kahn liegende Leiche und hob die Brauen.
»Ist das wieder einer von Ihren Skandalfällen, Pitt?«, fragte er trocken. »Um die Aufgabe, den zu lösen, beneide ich Sie nicht. Wissen Sie, wer das ist?« Er seufzte tief auf, als er den Fuß der Treppe erreicht hatte und nur zwei Handbreit über dem an die Stufen klatschenden Wasser stand. »Da sieht man es wieder. Ich hatte immer gedacht, es gibt nicht mehr viel, was ich nicht über die Menschennatur weiß, aber ich schwöre Ihnen, ich werde nie begreifen, wie weit manche Leute in ihrem Bestreben gehen, sich zu amüsieren.« Mit größter Vorsicht setzte er einen Fuß in den Kahn und zog das andere Bein nach. Als das flachbödige Gefährt zu schwanken anfing, kniete er sich rasch nieder und begann mit der Untersuchung des Toten.
Obwohl es nicht wirklich kalt war, sondern nur feuchtkühl, überlief Pitt unwillkürlich ein Schauer. Sein Mitarbeiter Tellman, nach dem er geschickt hatte, war noch nicht eingetroffen. Er wandte sich erneut dem Streifenbeamten zu.
»Wer hat den Mann gefunden, und wann war das?«
»Ich, Sir. Das hier gehört zu meiner Streife. Ich wollte mich gerade einen Augenblick auf die Stufen setzen und einen Happen essen, als ich den Kahn entdeckte. Das war gegen halb sechs, Sir. Natürlich kann er schon eine ganze Weile da gewesen sein, ohne dass ihn in der Dunkelheit jemand entdeckt hat.«
»Aber Sie haben ihn gesehen? War es da nicht noch ziemlich dunkel?«
»Ich habe gehört, wie der Kahn an die unterste Stufe stieß, und bin hingegangen, um nachzusehen. Wie ich mit meiner Laterne hineingeleuchtet habe, hätte mich fast der Schlag getroffen. Ich verstehe die feinen Leute nicht, ehrlich nicht.«
»Und Sie meinen also, dass er so einer ist?« Unwillkürlich fühlte sich Pitt ein wenig belustigt.
Der Mann verzog das Gesicht. »Woher sollte denn jemand, der von seiner Hände Arbeit lebt, solche Sachen kriegen, wie der sie anhat? Das ist echter Samt. Und sehen Sie sich nur seine Hände an. Mit denen hat er noch nie gearbeitet.«
Zwar befand Pitt, dass in den Äußerungen des Mannes Vorurteile mitschwangen, doch hatte er mit seiner Beobachtung vermutlich Recht, und das sagte Pitt ihm auch.
»Vielen Dank, Sir«, erwiderte der Streifenpolizist erfreut. Es war sein Ziel, eines Tages zur Kriminalpolizei versetzt zu werden.
»Jetzt sollten Sie sich am besten zur französischen Botschaft aufmachen und zusehen, dass Sie da jemanden finden, der den Mann identifizieren kann«, fuhr Pitt fort.
»Wer – ich, Sir?« Der Beamte war verblüfft.
Lächelnd bestätigte Pitt: »Ja, Sie. Schließlich haben Sie die Ähnlichkeit mit dem Vermissten entdeckt. Aber warten Sie ruhig noch ab, was der Arzt zu sagen hat.«
Eine Weile herrschte völlige Stille, bis der Kahn wieder leicht schaukelte und sich knirschend an der steinernen Ufermauer rieb. »Er hat einen Schlag auf den Kopf bekommen, und zwar mit einem sehr harten, abgerundeten Gegenstand. Das könnte beispielsweise ein Polizeiknüppel oder ein Nudelholz gewesen sein«, sagte der Arzt bestimmt. »Um einen Unfall dürfte es sich kaum handeln. Mit Sicherheit hat er sich nicht selbst so gefesselt.« Er schüttelte den Kopf. »Weiß der Himmel, ob er sich selbst oder jemand anders ihn so verkleidet hat. Meiner Einschätzung nach müsste er es gewesen sein, denn es ist verflucht schwer, einer Leiche etwas anzuziehen.«
Obwohl Pitt mehr oder weniger vermutet hatte, dass es sich so verhielt, traf ihn diese Erklärung hart. Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn es sich um einen Unfall gehandelt hätte – zwar wäre das unangenehm und hässlich, aber kein Verbrechen. Jetzt hoffte er inständig, es möge sich bei der Leiche nicht um den vermissten französischen Diplomaten handeln.
»Am besten sehen Sie sich den Mann selbst einmal an«, sagte der Arzt. Schwerfällig kletterte Pitt in den auf und ab tanzenden Kahn und beugte sich über den Toten, um ihn aufmerksam zu betrachten. Im Licht der inzwischen vollständig aufgegangenen Sonne konnte er alle Einzelheiten erkennen.
Der Mann schien gepflegt und gut genährt, ohne dick zu sein. Seine Gliedmaßen wirkten weich, eher von Fettgewebe als von Muskeln bedeckt. Auch seine feingliedrigen Hände waren weich. An der Linken trug er einen goldenen Siegelring. Man sah weder Schwielen noch Tintenflecke, wohl aber eine dünne Narbe am linken Zeigefinger, wo er sich mit einem Messer geschnitten haben mochte. Sein im Tode ausdrucksloses Gesicht ließ keine Rückschlüsse auf irgendwelche Wesensmerkmale zu. Das dichte Haar war ordentlich geschnitten, weit besser, als es Pitts je gewesen war. Unwillkürlich hob er seine Hand und schob sich die Haare aus der Stirn. Sie fielen sofort wieder nach vorn. Sie waren sicher an die fünfzehn Zentimeter länger als die des Mannes, der da auf dem Rücken im Kahn vor ihm lag.
Pitt hob den Blick zu dem wartenden Streifenbeamten.
»Verhalten Sie sich diplomatisch. Sagen Sie einfach, wir haben eine Leiche gefunden und sähen es gern, wenn man uns bei der Identifizierung behilflich sein könnte. Stellen Sie die Sache als dringend dar.«
»Soll ich sagen, dass es sich um Mord handelt, Sir?«
»Nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt – aber lügen Sie auf keinen Fall. Und behalten Sie um Himmels willen alle Einzelheiten für sich. Vermutlich werden Sie den Botschafter nicht selbst zu sprechen bekommen, aber sehen Sie zu, dass nicht irgendein kleiner Angestellter mitkommt, sondern ein höherrangiges Mitglied der Botschaft, wie zum Beispiel ein Attaché. Die Sache muss mit Umsicht behandelt werden.«
»Ja, Sir. Meinen Sie nicht, dass möglicherweise Wachtmeister Tellman da hingehen sollte, Sie wissen schon … wegen dem Kleid und so?«, fragte der Beamte hoffnungsvoll.
Pitt, der Tellman bestens kannte, sagte: »Nein, das glaube ich nicht.«
»Er ist da.«
»Gut. Schicken Sie ihn runter. Und nehmen Sie eine Droschke. Hier!« Er warf ihm einen Shilling Fahrgeld zu. Der Beamte fing die Münze auf und dankte Pitt. Er verharrte noch ein wenig in der vergeblichen Hoffnung, dieser werde es sich anders überlegen, tat dann aber zögernd, was man ihm aufgetragen hatte.
Allmählich löste sich der Nebel über der Themse auf. Hier und da sah man silbern ein Stück der Wasserfläche aufblitzen, und allmählich wurden die dunklen Umrisse der Schleppkähne, die Waren für aller Herren Länder an Bord hatten, verschwommen sichtbar. Weiter flussaufwärts machten sich jetzt in Chelsea Dienstmädchen daran, Frühstückstische zu decken, Küchenmädchen trugen ihren Herrschaften Badewasser nach oben, und Kammerdiener und Zofen legten ihnen Kleidungsstücke heraus. Weiter flussabwärts, bis zur Isle of Dogs, waren Schiffsbesatzungen und Hafenarbeiter wahrscheinlich dabei, Waren an Bord zu hieven, Schiffe an Liegeplätze zu verholen und Kräne zu dirigieren. Und auf den Märkten in Bishopsgate herrschte schon seit Stunden lebendiges Treiben.
Tellman, dessen Haare glatt nach hinten gekämmt waren, kam langsam die Stufen des Anlegers herab. Auf seinem hohlwangigen Gesicht lag unübersehbar der Ausdruck von Abscheu.
Pitt wandte sich erneut der Leiche zu und nahm die ungewöhnliche Bekleidung des Mannes etwas genauer in Augenschein. Das grüne Gewand war an mehreren Stellen beschädigt, doch ließ sich unmöglich sagen, ob das erst kürzlich geschehen war. Das Oberteil wies einen Riss auf, der von den Schultern bis zur Ärmelnaht ging, und der dünne Rock war vorn eingerissen.
Mehrere Girlanden aus künstlichen Blumen umgaben den Leichnam. Eine davon lief ihm schräg über die Brust.
Pitt sah sich die feste metallene Fessel am rechten Handgelenk des Mannes an und schob sie ein wenig beiseite. Auf der Haut waren keine Abschürfungen oder sonstige Verletzungen zu sehen. Auch am anderen Handgelenk wie an den Fußgelenken fanden sich keine Verletzungen.
»Hat man ihn vorher umgebracht?«, fragte er.
»Entweder das oder er hat sich freiwillig fesseln lassen«, gab der Arzt zur Antwort. »Genau kann ich das nicht sagen. Wenn Sie aber mit einer Vermutung zufrieden sind, würde ich sagen, dass man ihm die Fesseln nach dem Tod angelegt hat.«
»Und das Kleid?«
»Keine Ahnung. Falls er es sich selbst angezogen hat, ist er damit nicht gerade pfleglich umgegangen.«
»Wie lange ist er Ihrer Ansicht nach tot?« Pitt rechnete nicht mit einer genauen Auskunft und bekam auch keine.
»Ich kann nicht mehr sagen, als Sie sich wahrscheinlich selbst denken können. Nach der Totenstarre zu urteilen, muss es irgendwann im Verlauf der Nacht passiert sein. Lange kann er nicht so auf dem Fluss getrieben sein, sonst wäre das irgendeinem Schleppkahnführer aufgefallen.«
Damit hatte er Recht. Pitt war zu dem Ergebnis gekommen, dass die Tat irgendwann nach Einbruch der Dunkelheit begangen worden sein musste. Am Vorabend hatte kein Nebel über der Themse gelegen, und an einem schönen Abend flanierten Menschen am Ufer und bevölkerten Ausflugsboote den Fluss bis weit in den späten Abend.
»Gibt es irgendwelche Hinweise auf einen Kampf?«, fragte er.
»Nicht, soweit ich sehen kann.« Der Arzt richtete sich auf und kletterte auf die Stufen des Anlegers zurück. »An seinen Händen lässt sich nichts erkennen, aber ich vermute, dass Ihnen das auch schon aufgefallen ist. Tut mir Leid, Pitt. Ich seh ihn mir natürlich noch genauer an, aber im Augenblick sieht es so aus, als wäre das eine unangenehme Sache, die ich Ihnen vermutlich nur noch unangenehmer machen werde. Einstweilen guten Morgen.« Ohne auf eine Antwort zu warten, ging er zur Uferstraße empor, wo sich Menschen angesammelt hatten, die neugierig hinabspähten.
Mit finsterer Miene sah Tellman zugleich verständnislos und verächtlich auf den Kahn. Er rückte sich den Uniformrock ein wenig zurecht und fragte: »Franzose, was?« Dem Klang seiner Stimme war zu entnehmen, dass damit alles gesagt war.
»Möglich«, gab Pitt zur Antwort. »Armer Teufel. Aber wer das getan hat, kann ohne weiteres ein Engländer sein wie Sie.«
Ruckartig hob Tellman den Kopf und funkelte seinen Vorgesetzten an.
Pitt erwiderte den Blick mit einem unschuldigen Lächeln.
Mit fest zusammengekniffenen Lippen wandte sich Tellman ab und sah flussaufwärts, wo das Licht silbrig auf der großen Wasserfläche tanzte, über der sich der Nebel gehoben hatte, so dass jetzt die dunklen Umrisse der Schleppkähne deutlich sichtbar waren. Der Tag versprach schön zu werden. »Ich setz mich mal mit den Leuten von der Wasserpolizei in Verbindung«, sagte er voll Ingrimm. »Die sollen feststellen, wie weit er getrieben sein kann, nachdem man ihn in den Kahn gelegt hat.«
»Der Zeitpunkt ist nicht bekannt«, teilte ihm Pitt mit. »Man sieht kaum Blut. Eine solche Kopfwunde müsste eigentlich stark bluten, es sei denn, jemand hat eine Art Decke oder Segel untergelegt und anschließend beiseite geschafft, oder man hat den Mann woanders getötet und erst später in den Kahn gelegt.«
»In dem Aufzug?«, fragte Tellman ungläubig. »Das war wohl irgendeine Gesellschaft von feinen Pinkeln in Chelsea oder dergleichen? Da ist vermutlich etwas … nicht so gelaufen, wie es sollte … und dann mussten sie ihn loswerden. Gott steh uns bei, das wird eine ganz üble Sache.«
»Das ist es schon. Trotzdem halte ich es für einen guten Gedanken, die Wasserpolizei hinzuzuziehen, damit wir erfahren, wie weit er getrieben sein kann, wenn man ihn gegen Mitternacht oder eine Stunde davor oder danach auf dem Fluss ausgesetzt hat.«
»Ja, Sir«, sagte Tellman diensteifrig. Dazu war er gern bereit, denn es war weit besser, als herumzustehen und auf einen Mitarbeiter der französischen Botschaft zu warten. »Ich versuche so viel herauszufinden, wie ich kann.« Mit geschäftiger Miene machte er sich auf den Weg, immer zwei Stufen auf einmal nehmend – was angesichts der glatten und nassen Steine nicht ungefährlich war.
Pitt wandte seine Aufmerksamkeit erneut dem Kahn und dem Mann darin zu. Er lag ziemlich tief im Wasser, was ihm bisher noch gar nicht aufgefallen war, und Pitt nahm ihn näher in Augenschein. Als er das Holz berührte, merkte er, dass es alt und ein Teil der Beplankung verrottet war und sich mit Wasser voll gesogen hatte. Der Kahn hatte sich nicht am Anleger verfangen, sondern war sozusagen auf dessen unterste Stufe gesunken, die unter Wasser lag. Ganz offenkundig war er bereits länger nicht mehr für Ausfahrten auf der Themse benutzt worden, sondern hatte schon eine ganze Weile irgendwo gelegen.
Erneut sah Pitt auf den Leichnam mit den angeketteten Händen und Füßen in seiner sonderbaren Lage. Die Fesselung war ebenso Bestandteil des Verbrechens wie der Akt des Tötens und wohl nur dadurch zu erklären, dass ein übersteigertes Gefühl den Täter angetrieben hatte, sei es Liebe, Hass, Angst oder Panik. Sicher war er ein großes Wagnis damit eingegangen, den Toten in dies zerfetzte Samtkleid zu stecken, in seiner grotesken Lage im Kahn anzuketten und diesen dann ins Wasser zu stoßen. Das dürfte nicht nur viel Zeit gekostet haben, sondern der Täter war dabei vermutlich auch nass geworden. Wozu der große Aufwand?
Wenn er eine Antwort auf diese Frage bekäme, hätte er unter Umständen auch die Antwort auf alle anderen.
Pitt stand hinten im leicht schaukelnden Kahn und bemühte sich, auf den Beinen zu bleiben, als die Heckwelle eines Schleppzugs herankam. Hatte der Mörder das grüne Kleid, die Handschellen und die Ketten mitgebracht und die künstlichen Blumen um sein Opfer verstreut? Oder hatte sich all das am Tatort befunden? Den Kahn hatte er bestimmt nicht eigens herbeigeschafft – man hätte ihn unmöglich über eine größere Entfernung transportieren können. Also konnte er nur wenige Kilometer zurückgelegt haben.
Das Geräusch einer Kutsche, die sich auf der Uferstraße näherte, der Hufschlag von Pferden auf Pflastersteinen und Schritte oben auf der Treppe unterbrachen ihn in seinen Gedanken.
Er ging zur untersten Stufe hinüber, deren glatter Algenbewuchs jetzt freilag, da das Wasser mit der Ebbe abgelaufen war. Er hob den Blick und sah einen ausgesprochen besorgten, untadelig gekleideten Herrn, dessen auf Hochglanz polierte Schuhe im Licht der Morgensonne blitzten. Er hielt den Kopf gesenkt, sein Gesicht war sehr bleich.
»Guten Morgen, Sir«, sagte Pitt und ging ihm entgegen.
»Guten Morgen«, antwortete der Mann mit kaum wahrnehmbarem ausländischem Akzent. »Gaston Meissonier«, stellte er sich vor, wobei er den Blick fest auf Pitt gerichtet hielt und es vermied, die Gestalt im Kahn anzusehen.
»Oberinspektor Pitt. Es tut mir Leid, Sie so früh am Morgen zu belästigen, Monsieur Meissonier«, sagte Pitt. »Aber unglücklicherweise passt die Beschreibung eines Mitarbeiters Ihrer Botschaft, dessen Verschwinden man uns gemeldet hat, auf eine von uns aufgefundene männliche Leiche.«
Meissonier sah zu dem Kahn hin. Seine Gesichtshaut spannte sich, seine Lippen wurden schmal. Eine Weile sagte er nichts.
Pitt wartete.
Als die letzten Dunstfetzen über dem Fluss verschwanden, wurde das gegenüberliegende Ufer deutlich sichtbar. Der Verkehr auf der Uferstraße über ihnen nahm zu und wurde lauter.
»›Unglücklich‹ dürfte kaum der treffende Ausdruck sein, Oberinspektor«, sagte Meissonier schließlich. »Was für eine äußerst bedrückende Situation.«
Pitt trat beiseite, und der Franzose ging vorsichtig die Stufen hinab. Kurz oberhalb des Wasserspiegels blieb er stehen und sah in den Kahn.
»Das ist nicht Bonnard«, sagte er mit Nachdruck. »Ich kenne diesen Mann nicht. Bedauerlicherweise kann ich Ihnen nicht helfen.«
Pitt sah ihn aufmerksam an und erkannte auf den Zügen des Mannes nicht nur Abscheu, sondern auch eine gewisse Anspannung, die auch nicht schwand, nachdem er erklärt hatte, den Toten nicht zu kennen. Selbst wenn er nicht unbedingt log, sagte er auf keinen Fall die volle Wahrheit.
»Sind Sie sicher, Sir?«, drang Pitt in ihn.
Meissonier wandte sich zu ihm um. »Ganz sicher. Zwar ähnelt er Bonnard ein wenig, aber er ist es nicht. Ich hatte das auch nicht wirklich angenommen, wollte aber völlige Gewissheit haben.« Er sog die Luft ein. »Es tut mir Leid, dass man Sie falsch informiert hat. Bonnard wird nicht vermisst, sondern hat Urlaub. Ein übereifriger Angestellter hat wohl die Unterlagen nicht vollständig gelesen und voreilige Schlüsse gezogen. Ich werde feststellen, wer das war, und ihm einen Verweis erteilen, weil er unnötig Unruhe gestiftet und – wie ich sehe – Ihre Zeit vergeudet hat.« Er verbeugte sich höflich und wandte sich zum Gehen.
»Und wohin ist Monsieur Bonnard in seinem Urlaub gereist, Sir?«, erkundigte sich Pitt mit leicht erhobener Stimme.
Der Franzose blieb stehen. »Ich weiß es nicht. Wir verlangen von rangniederen Diplomaten keine solchen Auskünfte. Vielleicht hat er Bekannte hier im Lande, es ist allerdings auch möglich, dass er allein irgendwo hingefahren oder zu seinen Angehörigen nach Paris gereist ist.«
»Aber sind Sie nicht gekommen, um sich den Toten anzusehen?«, beharrte Pitt.
Meissonier hob die Brauen leicht, um anzudeuten, dass er die Frage für überflüssig hielt.
»Ich wollte mich vergewissern, dass er nicht auf dem Weg in den Urlaub einen Unfall hatte. Das war zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Überdies wollte ich mich nicht der Unhöflichkeit gegenüber den Beamten Ihrer Majestät schuldig machen, zu deren Regierung wir denkbar gute Beziehungen pflegen und deren Gäste wir sind.« Es war ein ebenso höflicher wie unübersehbarer Hinweis auf seinen Status als Diplomat.
Pitt blieb nichts anderes übrig, als ihm beizupflichten. »Vielen Dank, Monsieur Meissonier. Es war äußerst zuvorkommend von Ihnen herzukommen, noch dazu um diese Uhrzeit. Ich freue mich zu hören, dass es sich nicht um Ihren Landsmann handelt.« Das zumindest entsprach der Wahrheit. Internationale Verwicklungen waren das Letzte, woran Pitt lag. Sofern es sich um den Leichnam eines französischen Diplomaten gehandelt hätte, wären sie trotz aller Mühe kaum zu vermeiden gewesen. In dem Fall hätte sich Pitt in einer alles andere als beneidenswerten Lage befunden.
Meissonier wiederholte seine leichte Verbeugung, ging nach oben und entschwand Pitt aus den Augen. Kurz darauf hörte man seine Kutsche davonfahren.
Der Leichenwagen kam, und Pitt sah zu, wie man dem Toten die Handfesseln löste, ihn aufhob und fortbrachte, damit ihn der Polizeiarzt im Leichenschauhaus gründlich untersuchen konnte.
Tellman kehrte mit einem Angehörigen der Wasserpolizei zurück, dessen Aufgabe es sein würde, den Kahn an eine Stelle der Themse zu bringen, die so seicht war, dass er nicht vollständig unterging.
»War es der Franzmann?«, erkundigte sich Tellman, als er mit Pitt allein an der Uferstraße stand. Starker Verkehr brauste in beiden Richtungen an ihnen vorüber. Der Wind hatte ein wenig aufgefrischt und trug den Geruch von Salz, Schlamm und Fischen herüber. Obwohl die Sonne schien, war es ziemlich kalt.
»Er sagt nein«, gab Pitt zur Antwort. Er war hungrig und sehnte sich nach einer Tasse heißen Tee.
Tellman brummte etwas. »Das war wohl nicht anders zu erwarten, oder?«, sagte er. »Können wir es beweisen, falls er lügt? Ich meine, was können wir tun, wenn es doch ein Franzose ist und die gesamte Botschaft das bestreitet? Wir können kaum sämtliche Bewohner von Paris herholen, damit sie ihn sich ansehen!« Angewidert verzog er das Gesicht.
Auch in Pitt waren bereits Zweifel aufgekeimt. Der Gedanke wurde immer unangenehmer.
»Es wird schwer genug sein festzustellen, wer der Täter war«, fuhr Tellman fort, »zumal wir nicht wissen, wer das Opfer ist.«
»Nun, entweder ist es Bonnard oder jemand anders«, sagte Pitt trocken. »Am besten nehmen wir an, dass es sich um einen anderen handelt und fangen an, uns umzusehen. Der morsche Kahn kann kaum mehr als ein paar Kilometer flussabwärts gekommen sein.«
»Das sagen die von der Wasserpolizei auch«, stimmte ihm Tellman zu. »Irgendwo aus der Gegend von Chelsea.« Er rümpfte die Nase. »Ich bin immer noch überzeugt, dass es der Franzmann ist und die das einfach nicht zugeben wollen.«
Pitt hatte keine Lust, gegen Tellmans Vorurteile anzugehen, jedenfalls noch nicht. Er zog die Möglichkeit, dass es sich um einen Engländer handelte, bei weitem vor. Die Sache würde auch noch schlimm genug, wenn keine ausländische Botschaft in sie verwickelt wäre.
»Es dürfte das Beste sein, wenn Sie den Mann von der Wasserpolizei begleiten und sich ansehen, wo der Kahn in zwei bis drei Kilometern Entfernung von Chelsea gelegen haben könnte. Außerdem könnten Sie feststellen, ob ihn jemand zufällig auf dem Wasser gesehen hat …«
»Im Dunkeln?«, fragte Tellman entrüstet. »Bei dem Nebel? Die Schleppkähne, die vor Sonnenaufgang weiter flussaufwärts fahren, sind doch sowieso längst hinter der Towerbrücke.«
»Das weiß ich selbst!«, sagte Pitt scharf. »Probieren Sie es am Ufer. Immerhin ist es möglich, dass jemand den üblichen Liegeplatz des Kahns kennt. Ganz offensichtlich war er eine ganze Zeit lang im Wasser.«
»Ja, Sir. Wo finde ich Sie?«
»Im Leichenschauhaus.«
»Der Polizeiarzt ist bestimmt noch nicht so weit. Er ist gerade erst abgefahren.«
»Ich gehe erst einmal frühstücken.«
»Ach so.«
Pitt lächelte. »Sie können sich an dem Stand da drüben eine Tasse Tee holen.«
Tellman warf ihm einen Seitenblick zu und ging dann mit durchgedrücktem Kreuz und straffen Schultern davon.
Es war heller Tag, als Pitt die Tür aufschloss und ins Haus trat. Alles war still. Er legte den Mantel ab und hängte ihn auf, zog die Schuhe aus, ließ sie in der Diele stehen und ging auf Socken zur Küche. Das Feuer im Herd war erloschen. Er holte die kalte Asche heraus und versuchte die letzte Glut wieder anzufachen. Oft hatte er Gracie bei dieser Tätigkeit zugesehen, so dass er sich zutraute, mit den Eigenheiten des Herdes fertig zu werden, doch lag eine gewisse Trostlosigkeit über einer Küche, in der sich keine Frau zu schaffen machte. Mrs. Brady kam jeden Morgen, um die groben Arbeiten, die Wäsche und das Putzen zu erledigen. Auch wenn sie eine Seele von Mensch war und ihm oft ein wenig Pastete oder ein schönes Stück Roastbeef mitbrachte, war all das kein Ersatz für seine abwesende Familie.
Charlotte war von ihrer Schwester Emily und deren Mann Jack für drei Wochen nach Paris eingeladen worden. Es wäre Pitt schäbig erschienen, ihr die Reise zu verwehren oder sein Missvergnügen so offen zu zeigen, dass sie keine Freude mehr daran gehabt hätte. Wohl wäre Charlotte die Erste gewesen zuzugeben, dass sie durch die Eheschließung mit einem finanziell und gesellschaftlich weit unter ihr stehenden Mann ein großes Maß an Freiheit gewonnen hatte, das vieles ermöglichte, was für Damen in der Stellung ihrer Mutter oder Schwester undenkbar war, doch musste sie gerade wegen dieser Ehe auch auf so manches verzichten. Pitt war klug genug zu erkennen, dass es ihrem Eheglück nur förderlich sein konnte, wenn er sich ihrem Besuch bei Schwester und Schwager nicht widersetzte, ganz gleich, wie sehr sie ihm fehlte oder wie gern er seinerseits mit ihr nach Paris gereist wäre.
Das vor siebeneinhalb Jahren im Alter von dreizehn Jahren zu ihnen ins Haus gekommene Hausmädchen Gracie, inzwischen in seinen Augen fast so etwas wie ein Mitglied der Familie, war mit den Kindern, Jemima und Daniel, für zwei Wochen an die See gefahren. Alle drei waren schrecklich aufgeregt gewesen, hatten voller Begeisterung alles Mögliche eingepackt und sich über all das unterhalten, was sie tun und besichtigen wollten. Da es ihre erste Reise ans Meer war, war es für sie ein richtiges Abenteuer. Gracie war sich der Verantwortung voll und ganz bewusst und sehr stolz, dass man sie ihr übertrug.
So kam es, dass sich Pitt jetzt allein im Hause befand. Seine einzige Gesellschaft waren die beiden Katzen Archie und Angus, die behaglich zusammengerollt in dem großen Waschkorb mit der frischen Bettwäsche lagen.
Da Pitt auf einem großen Landsitz aufgewachsen war, wo sein Vater Wildhüter gewesen war und seine Mutter eine Zeit lang in der Küche ausgeholfen hatte, konnte er durchaus für sich selbst sorgen, wenn er auch seit seiner Eheschließung aus der Übung gekommen war. Mehr als das Fehlen der vielen kleinen Annehmlichkeiten des Zusammenlebens mit Charlotte bedrückte ihn die Einsamkeit. Mit keinem Menschen konnte er reden, keinem Menschen seine Empfindungen mitteilen, mit keinem Menschen lachen oder sich einfach über die Ereignisse des Tages unterhalten.
Auch die Kinder fehlten ihm. Niemand rannte durchs Haus, lachte, stellte unaufhörlich Fragen und verlangte nach Aufmerksamkeit oder Bestätigung. Niemand unterbrach ihn bei dem, was er tat, damit er hinsah, etwas erklärte, niemand wollte wissen »Was heißt das?« oder »Warum ist das so?«. Ruhe und Frieden waren nicht einfach Ruhe und Frieden, sondern schlichte Lautlosigkeit.
Es dauerte eine ganze Weile, bis der Herd richtig zog, und noch einmal zehn Minuten, bis das Wasser im Kessel siedete, so dass er sich seinen Tee aufgießen und Brot zum Frühstück rösten konnte. Er überlegte, ob er nicht auch zwei Bücklinge braten sollte, verwarf dieses Vorhaben aber gleich wieder, als er an den Fischgeruch und die Mühe des Abwaschens dachte.
Mit der ersten Post kam lediglich eine Rechnung des Metzgers. Insgeheim hatte er auf einen Brief von Charlotte gehofft. Vielleicht war es dafür noch zu früh, doch merkte er überrascht, wie enttäuscht er war. Zum Glück würde er am Abend mit seiner Schwiegermutter Caroline Fielding ins Theater gehen. Nach dem Tode von Charlottes Vater Edward Ellison und einer angemessenen Trauerzeit hatte sie einen Schauspieler kennen gelernt, der bedeutend jünger war als sie, und sich in ihn verliebt. Zum Entsetzen von Edwards Mutter Mariah war sie mit ihm eine neue Ehe eingegangen und offensichtlich sehr glücklich, was ihre Schwiegermutter als ausgesprochen peinlich empfand. Caroline führte ein deutlich freizügigeres Leben als zuvor, und auch das bot Anlass zu Reibereien. Da sich Mrs. Ellison kategorisch geweigert hatte, mit ihr und ihrem neuen Mann unter einem Dach zu leben, hatte sie zu Emily ziehen müssen, deren Gatte Jack Radley als Unterhausabgeordneter eine weit geachtetere gesellschaftliche Stellung hatte als ein Schauspieler, der charmanter war, als ihm gut tat, aber weder ein Adelsprädikat noch einen sonstwie bemerkenswerten Familienhintergrund aufzuweisen hatte.
Meist brachte Emily die Kraft auf, ihre Großmutter zu ertragen, trat ihr aber bisweilen ebenso unverblümt gegenüber wie sie ihr, woraufhin sich die alte Dame in eine kalte Wut hüllte, bis es ihr langweilig wurde und sie zum nächsten Angriff überging.
Jetzt aber lebte die Großmutter vorläufig wieder bei Caroline, da sich Emily und Jack in Paris aufhielten und ihre Abwesenheit dazu nutzten, die sanitären Anlagen im Hause erneuern zu lassen. Pitt hoffte inständig, sie werde sich nicht hinreichend wohlfühlen, um am Abend mit ihnen ins Theater zu gehen. Er hätte sich keine Sorgen zu machen brauchen: Die alte Mrs. Ellison sah in der Art von Stücken, die Caroline mittlerweile besuchte, keine ihr angemessene Unterhaltung, und trotz ihrer brennenden Neugier war ihr der Gedanke unerträglich, ein Bekannter könne sie beim Besuch einer solchen Veranstaltung sehen.
Am späten Vormittag hörte sich Pitt im Leichenschauhaus an, was der Polizeiarzt festgestellt hatte. Es war herzlich wenig.
»Es ist genau, wie ich es gesagt habe. Man hat ihm mit einem schweren runden Gegenstand einen Schlag auf den Kopf versetzt. Dieser Gegenstand hatte einen größeren Durchmesser als ein Schürhaken und war regelmäßiger geformt als ein Baumast.«
»Könnte es ein Bootsriemen oder die Stange eines Stocherkahns gewesen sein?«, wollte Pitt wissen.
»Möglich.« Der Arzt dachte kurz darüber nach. »Durchaus möglich. Haben Sie einen solchen Gegenstand gefunden?«
»Wir wissen noch nicht, wo er getötet wurde«, gab Pitt zu bedenken.
»Der Täter könnte das Tatwerkzeug natürlich auch in den Fluss geworfen haben.« Der Arzt schüttelte den Kopf. »Wahrscheinlich werden wir es nie finden, falls aber doch, wird längst alles Blut abgewaschen sein. Sie können dann Vermutungen anstellen, aber nichts beweisen.«
»Wann ist der Tod eingetreten?«
»Spät in der Nacht. Genauer kann ich es nicht eingrenzen.« Er zuckte die schmalen Schultern. »Als ich ihn zum ersten Mal untersucht habe, war er bestimmt seit fünf oder sechs Stunden tot. Wenn Sie erst einmal herausbekommen haben, um wen es sich handelt, lässt sich die Tatzeit sicher genauer bestimmen.«
»Was wissen Sie über ihn?«
»Er dürfte zwischen dreißig und fünfunddreißig Jahre alt sein.« Der Arzt überlegte einen Moment. »Sehr guter Allgemeinzustand. Äußerst gepflegt und sauber, keine Schwielen an den Händen. Keine Körperteile, die der Sonne ausgesetzt waren.« Er schürzte die Lippen. »Er hat mit Sicherheit nicht mit seinen Händen gearbeitet. Entweder verfügte er über ein Einkommen aus Kapitalvermögen oder er war Kopfarbeiter. Er könnte natürlich auch irgendeine Art Künstler oder Schauspieler gewesen sein.« Er warf Pitt einen Seitenblick zu. »Aber vielleicht denke ich das auch nur wegen des Aufzugs, in dem man den armen Kerl gefunden hat.« Er seufzte. »Lachhaft.«
»Ist es möglich, dass er erst im Kahn einen Schlag auf den Kopf bekommen hat?«, fragte Pitt, obwohl ihm die Antwort klar war.
»Nein«, sagte der Arzt entschieden. »Der Schlag hat ihn auf den Hinterkopf getroffen. Im Kahn wäre das nur möglich gewesen, wenn er gesessen hätte, aber das kann nicht sein, denn dafür sind die Fesseln zu kurz und die Beine waren zu weit gespreizt. So hätte er nie und nimmer sitzen können. Wenn Sie mir nicht glauben, probieren Sie es selbst. Außerdem müsste dann mehr Blut da sein.«
»Sind Sie sicher, dass er das Kleid nicht anhatte, als man ihn tötete?«, drang Pitt in ihn.
»Absolut.«
»Woher können Sie das wissen?«
»Weil es weder blaue Flecken noch Hämatome gibt, die man sehen würde, wenn man ihn mit Gewalt festgehalten hätte«, erklärte der Arzt geduldig. »Wohl aber finden sich winzige Kratzer auf der Haut. Das könnten Spuren von Fingernägeln sein, die entstanden sind, als jemand versucht hat, ihm das Kleid über den Kopf und an seinem Körper glatt zu ziehen. Es ist verdammt schwer, einer Leiche etwas anzuziehen, vor allem für eine einzelne Person.«
»Es war also ein Einzeltäter?«, fragte Pitt ruhig.
Der Arzt sog die Luft durch die Zähne. »Ich denke schon«, räumte er ein. »Sie haben Recht. Das war eine Spekulation von mir, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass mehrere gemeinsam diese Art von… Wahnsinnstat begehen. Eine Manie ist etwas, das ein Mensch ganz allein für sich empfindet, und diese Tat ist manisch geprägt, weiß Gott. Vermutlich ist auch eine andere Möglichkeit denkbar, aber das müssten Sie mir beweisen, bevor ich daran glaube. Meiner Ansicht nach war ein abartig veranlagter einzelner Mann der Täter, dessen Liebe oder Hass alle Schranken der Vernunft niedergerissen und sogar den Selbsterhaltungstrieb ausgeschaltet hat. Nicht nur hat er das Opfer niedergeschlagen und getötet, er sah sich auch gezwungen, es anschließend in Frauenkleider zu stecken und auf dem Fluss auszusetzen.« Er drehte sich zu Pitt um und sah ihn fragend an. »Ich kann mir keinen vernünftigen Grund dafür vorstellen. Sie etwa?«
»Er hat damit die Identität des Opfers verschleiert …«, sagte Pitt nachdenklich.
»Unsinn!«, entfuhr es dem Arzt. »Dazu hätte es genügt, ihn auszuziehen und in eine Decke zu wickeln. Auf keinen Fall hätte er ihn wie Ophelia oder die Lady of Shalott aufs Wasser setzen müssen, die umkommt, während sie Sir Lancelot in einem Boot nach Camelot folgt.«
»Ist nicht Ophelia aus eigenem Antrieb ins Wasser gegangen?«, fragte Pitt.
»Na schön – dann eben die Lady of Shalott«, knurrte der Arzt. »Auf ihr ruhte ein Fluch. Passt Ihnen das besser?«
Pitt lächelte. »Ich suche nach einem Element, das auf den Menschen hinter der Tat verweist. Sie können mir wohl nicht sagen, ob er Franzose war, oder?«
Die Augen des Arztes öffneten sich weit. »Natürlich nicht! Was erwarten Sie – einen Nationalitätsstempel unter den Fußsohlen?«
Pitt schob die Hände in die Taschen. Es ärgerte ihn, dass er gefragt hatte. »Hinweise auf Reisen, Krankheiten, chirurgische Eingriffe …«
Der Arzt schüttelte den Kopf. »Nichts, was uns weiterhelfen würde. Seine Zähne sind in glänzendem Zustand, und er hat einen kleinen Kratzer an einem Finger. Es handelt sich schlicht und einfach um einen ganz gewöhnlichen Toten, der ein grünes Kleid trägt und gefesselt ist. Tut mir Leid.«
Pitt sah ihn lange ausdruckslos an, dankte ihm und ging.
Am frühen Nachmittag suchte Pitt die französische Botschaft auf, nachdem er in einer Gaststätte ein belegtes Brot gegessen und dazu einen halben Liter Apfelwein getrunken hatte. Ihm lag nicht daran, erneut mit Meissonier zusammenzutreffen, denn dieser würde nur wiederholen, was er am Anleger von Horseferry gesagt hatte. Pitt jedoch war keineswegs davon überzeugt, dass der Mann im Kahn nicht der Diplomat Bonnard war. Bisher besaß er keine weiteren Hinweise, und Meissonier hatte sich erkennbar unwohl in seiner Haut gefühlt. Zwar war bei genauerer Betrachtung der Leiche Erleichterung auf seine Züge getreten, dennoch war seine Besorgnis nicht vollständig von ihm gewichen. Hatte es lediglich damit zu tun, dass sich keine Verbindung zu ihm nachweisen ließ und er daher bestreiten konnte, dass es sich um Bonnard handelte?
Wie hätte Pitt ihn jetzt erneut befragen können? Das hätte lediglich den Anschein erweckt, dass er Meissonier für einen Lügner hielt, was angesichts von dessen Diplomatenstatus – er hatte ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er Gast des Landes sei – genügen würde, einen unangenehmen Zwischenfall zu provozieren, an dem man Pitt mit Recht die Schuld zuweisen würde.
Also musste er für seinen Besuch einen anderen Vorwand finden. Doch welchen? Meissonier hatte jede Verbindung zwischen der Botschaft und dem Leichnam bestritten. Also gab es keine weiteren Fragen zu stellen.
Pitt stand bereits vor der Tür. Er musste entweder anklopfen oder seinen Weg fortsetzen. Er klopfte.
Ein livrierter Lakai öffnete.
»Sie wünschen?«
»Guten Tag«, sagte Pitt rasch. Er gab dem Mann seine Karte und fuhr fort: »Einer der Botschaftsangehörigen wurde als vermisst gemeldet, und zwar irrtümlich, wenn ich Monsieur Meissonier richtig verstanden habe. Bevor ich die Akte entsprechend abändere, würde ich gern mit demjenigen Mitarbeiter der Botschaft sprechen, der die Vermisstenmeldung aufgegeben hat. Es wäre besser, wenn er selbst diese Meldung zurückzieht …«
»Ach ja? Und wer soll das sein, Sir?«, fragte der Lakai mit unbewegtem Gesicht.
»Das weiß ich nicht.« Der Vorwand war ihm gerade erst eingefallen. Er hätte den Streifenbeamten am Anleger von Horseferry fragen sollen, doch da war die Sache nicht wichtig gewesen. »Der Vermisste soll ein gewisser Monsieur Bonnard sein. Ich vermute, dass ein Kollege oder persönlicher Bekannter die Meldung gemacht hat.«
»Das dürfte Monsieur Villeroche sein, Sir. Nehmen Sie bitte einen Augenblick Platz, ich werde feststellen, ob er Zeit für Sie hat.« Er wies auf eine Reihe lederbezogener Sitzbänke und ging.
Nach wenigen Minuten kehrte er wieder.
»Monsieur Villeroche ist bereit, Sie in einer Viertelstunde zu empfangen, Sir. Im Augenblick ist er mit einem anderen Besucher beschäftigt.« Die Entscheidung, ob er warten wollte oder nicht, wurde Pitt abgenommen, denn es zeigte sich, dass Monsieur Villeroche früher als vorgesehen frei war. Er kam selbst in den Vorraum, um Pitt abzuholen. Irgendetwas schien den gut aussehenden, mit ausgesuchter Eleganz gekleideten, südländisch wirkenden jungen Mann zu beunruhigen. Er sah flüchtig um sich, bevor er auf Pitt zutrat.
»Inspektor Pitt? Gut. Ich habe etwas zu erledigen. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mich zu begleiten? Vielen Dank.« Er ließ Pitt keine Zeit abzulehnen. Ohne auf den Lakaien zu achten, ging er zum Ausgang, so dass Pitt ihm wohl oder übel folgen musste. »Wirklich sehr freundlich von Ihnen«, sagte er im Hinausgehen.
Pitt musste kräftig ausschreiten, um mit ihm Schritt zu halten, doch kaum waren sie um die nächste Straßenecke gebogen, als Villeroche stehen blieb.
»Es … es tut mir Leid.« Er spreizte die Hände mit entschuldigender Gebärde. »Ich wollte nicht sprechen, wo man mich hören könnte. Es handelt sich um eine heikle Angelegenheit. Ich möchte niemandem Ungelegenheiten bereiten, doch mache ich mir Sorgen…« Er hielt inne, offensichtlich unsicher, wie er fortfahren sollte.
Pitt wusste nicht, ob dem Mann der Leichenfund bekannt war. Zwar hatte der Bericht darüber in den Mittagszeitungen gestanden, aber möglicherweise war noch keine davon in die Botschaft gelangt.
Schließlich sagte der Mann: »Ich bitte um Entschuldigung, Monsieur. Ich habe Ihrer ausgezeichneten Polizei berichtet, mein Freund und Kollege Henri Bonnard sei verschwunden … Das heißt, er befindet sich nicht dort, wo wir ihn vermuteten. Er ist nicht an seinem Arbeitsplatz und auch nicht in seiner Wohnung. Keiner seiner Bekannten hat ihn in den letzten Tagen gesehen, und er hat berufliche wie auch gesellschaftliche Verabredungen nicht eingehalten.« Er schüttelte rasch den Kopf. »Das entspricht in keiner Weise seiner Art. Er tut so etwas nicht. Ich habe Angst, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte.«
»Und daher haben Sie ihn als vermisst gemeldet«, schloss Pitt. »Monsieur Meissonier hat uns gesagt, dass er einen Urlaub angetreten hat. Ist es denkbar, dass er aufgebrochen ist, ohne Ihnen das mitzuteilen?«
»Möglich ist es natürlich«, stimmte Villeroche zu, ohne den Blick von Pitts Gesicht zu wenden. »Aber seine Pflichten hätte er nie und nimmer vernachlässigt. Er ist ehrgeizig und auf seine Karriere bedacht. Die würde er … die würde er nie und nimmer wegen irgendeiner Kleinigkeit gefährden. Es ist natürlich denkbar… äh…« Es war zu sehen, dass er nicht recht wusste, wie er fortfahren sollte. Von der Sorge um den Freund getrieben, wollte er die Situation erklären, ohne zu viel preiszugeben.
»Was für ein Mensch ist er?«, fragte Pitt. »Wie sieht er aus? Was sind seine Gewohnheiten, womit verbringt er seine Freizeit? Wo wohnt er? Zu welchen gesellschaftlichen Verabredungen ist er nicht erschienen?« Vor sein inneres Auge trat das Bild des Mannes im Kahn in dem sonderbaren grünen Samtkleid. »Geht er gern ins Theater?«
Villeroche fühlte sich sichtlich unbehaglich. Er nahm den Blick nicht von Pitts Zügen, als erwarte er von diesem, dass er ihn ohne weitere Worte verstand.
»Ja, er hat Gefallen an den schönen Dingen des Lebens… Manches davon würde nicht unbedingt den Beifall des Herrn Botschafters finden. Das heißt aber nicht etwa, dass er…«
Um ihm zu helfen, fragte Pitt: »Wissen Sie schon, dass wir heute Morgen am Anleger von Horseferry in einem Kahn, der auf der Themse trieb, einen Toten gefunden haben, auf den die Beschreibung von Henri Bonnard passt? Monsieur Meissonier war so freundlich, hinauszufahren und ihn sich anzusehen. Seiner Aussage nach ist es nicht Bonnard. Er schien seiner Sache ziemlich sicher zu sein. Bei dieser Gelegenheit hat er mir zu verstehen gegeben, dass sich Monsieur Bonnard im Urlaub befinde.«
Villeroche sah kläglich drein. »Davon wusste ich nichts. Das tut mir sehr Leid. Ich hoffe nur… Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es sich nicht um Henri handelt, aber zugleich bin ich sicher, dass er keine Urlaubsreise unternimmt.« Er sah Pitt unverwandt an. »Er hatte eine Einladung zu einem Stück von Monsieur Oscar Wilde und sollte anschließend mit ihm und seinen Freunden dinieren. Er ist nicht hingegangen. Das würde er nie ohne eine ausführliche Entschuldigung und eine Erklärung tun, die jeden Untersuchungsrichter zufrieden stellen würde, ganz zu schweigen von einem Dramatiker!«
Pitt spürte ein sonderbares Gefühl in der Magengrube.
»Wären Sie bereit, mich zum Leichenschauhaus zu begleiten und sich den Toten anzusehen, damit wir wissen, ob es sich um Bonnard handelt – auch zu Ihrer eigenen Beruhigung?«, bot er an.
»Zum Leichenschauhaus!«
»Ja. Es ist die einzige Möglichkeit, Gewissheit zu erlangen.«
»Ich… ich vermute, dass das unumgänglich ist.«
»Für mich nicht. Monsieur Meissonier hat gesagt, dass Bonnard nicht vermisst wird. Damit muss ich mich zufrieden geben. Er kann es also eigentlich gar nicht sein.«
»Gewiss. Ich komme. Wie lange wird das dauern?«
»Mit einer Droschke können wir in weniger als einer Stunde zurück sein.«
»Dann sollten wir uns beeilen.«
Mit aschgrauem Gesicht und zutiefst unglücklich sah Villeroche auf den Toten hinab und sagte, es handele sich nicht um Henri Bonnard.
»Er sieht ihm sehr ähnlich, aber ich kenne ihn nicht.« Er hustete und hielt sich das Taschentuch vor das Gesicht. »Ich bedaure sehr, Ihre Zeit beansprucht zu haben. Sie waren äußerst zuvorkommend. Bitte erwähnen Sie unter keinen Umständen Monsieur Meissonier oder sonst jemandem gegenüber, dass ich hier war.« Er wandte sich ab, verließ das Leichenschauhaus fast im Laufschritt, stieg eilends in die Droschke und sagte dem Fahrer, er solle zurück zur Botschaft fahren. Wenn Pitt nicht noch schnell hineingesprungen wäre, wäre er ohne ihn abgefahren.
»Wo wohnt er?«, fragte er und warf sich in den Sitz, während die Droschke schon fuhr.
»Am Portman Square«, gab Villeroche zurück. »Aber dort ist er nicht…«
»Geht es etwas genauer?«, ließ Pitt nicht locker. »Und könnten Sie mir den Namen von einem oder zwei Freunden oder Bekannten sagen, die mehr wissen?«
»Nummer vierzehn, zweiter Stock. Nun, vielleicht könnte man Charles Renaud oder Jean-Claude Aubusson fragen. Ich gebe Ihnen ihre Anschrift. Sie… sie arbeiten nicht in der Botschaft. Außerdem hat er natürlich englische Bekannte, beispielsweise George Strickland und Mr. O’Halloran.« Er suchte in seinen Taschen nach etwas zu schreiben, fand aber nichts.
Pitt, der zur Verzweiflung seiner Vorgesetzten gewöhnlich allerlei Krimskrams in seinen Taschen mit sich herumtrug, zog ein Stück Bindfaden, ein Taschenmesser, Siegelwachs, einen Bleistift, drei Shilling-Münzen und sieben Pence hervor, zwei gestempelte französische Briefmarken, die er für Daniel aufgehoben hatte, eine alte Quittung für ein Paar Socken, einen Zettel, der ihn daran erinnern sollte, dass er die Schuhe zum Schuster bringen und Butter einkaufen musste, zwei Pfefferminzbonbons voller Staubflocken und einen kleinen Notizblock. Den gab er mitsamt dem Bleistift Villeroche und stopfte den Rest wieder in die Taschen.
Villeroche schrieb ihm die Namen und Adressen auf, ließ den Kutscher eine Straßenecke von der Botschaft entfernt anhalten, verabschiedete sich, eilte über die Straße und verschwand die Treppe hinauf.
Pitt suchte jeden der Männer auf, die ihm Villeroche genannt hatte. Zwei waren zu Hause und bereit, ihm Auskünfte zu erteilen.
»Doch, er ist ein feiner Kerl«, sagte O’Halloran lächelnd. »Aber ich habe ihn schon über eine Woche nicht gesehen, wirklich eine Schande. Er war am vorigen Samstagabend zu Wylies Gesellschaft eingeladen, und ich hätte mein letztes Hemd darauf verwettet, dass er am Montag ins Theater kommen würde. Wilde war selbst da, und wir haben uns einfach köstlich amüsiert.« Er zuckte die Achseln. »Ich kann freilich nicht beschwören, dass ich mich noch an alles erinnere.«
»Aber Henri Bonnard war nicht dort?«, fasste Pitt nach.
»Da bin ich ganz sicher«, sagte O’Halloran. Er sah Pitt aus munteren blauen Augen aufmerksam an. »Haben Sie gesagt, Sie sind von der Polizei? Stimmt da was nicht? Warum erkundigen Sie sich nach Bonnard?«
»Weil zumindest einer seiner Bekannten vermutet, dass er verschwunden ist«, sagte Pitt.
»Und dann lassen die ihn durch einen Oberinspektor suchen?«, fragte O’Halloran spöttisch.
»Nein. Aber man hat heute Morgen am Anleger von Horseferry eine Leiche in der Themse gefunden, auf die seine Beschreibung passte. Allerdings haben zwei Angehörige der französischen Botschaft gesagt, dass er es nicht ist.«
»Gott sei Dank«, sagte O’Halloran. Es klang aufrichtig. »Armer Kerl. Sie vermuten ja wohl nicht, dass Bonnard dahintersteckt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Er könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Vielleicht hat er etwas überdrehte Vorlieben, er genießt das Leben nun mal gern in vollen Zügen, ist aber in keiner Weise bösartig.«
»Das hat nie jemand angenommen«, versicherte ihm Pitt.
Diese Aussage schien O’Halloran zu beruhigen. Da er keine weiteren nützlichen Auskünfte geben konnte, dankte ihm Pitt und verabschiedete sich.
Der andere Mann, der bereit war, ihn zu empfangen, war Charles Renaud.
»Eigentlich war ich fest überzeugt, dass er sich in Paris aufhält«, sagte er überrascht. »Ich meine mich zu erinnern, dass er gesagt hat, er müsse packen, und dass er auch die Uhrzeit genannt hat, zu der sein Zug nach Dover abging. Ich habe allerdings nur mit halbem Ohr zugehört und mir vielleicht was Falsches zurechtgereimt. Es hat mich nicht besonders interessiert. Tut mir Leid.«
Bereitwillig suchte Tellman den Wasserpolizeiposten auf, nicht, weil er sich besonders dort hingezogen gefühlt hätte, sondern weil er sich weit lieber um den Gezeitenkalender kümmerte als den Versuch unternahm, von Ausländern, die diplomatische Immunität genossen, peinliche Wahrheiten zu erfragen. Er konnte und wollte sich nicht vorstellen, wodurch der Mann im Kahn den Täter dazu herausgefordert hatte, ihn umzubringen. Tellman waren die erbärmlichen und tragischen Aspekte des Lebens alles andere als fremd. Er war in äußerster Armut aufgewachsen und kannte nicht nur das Verbrechen, sondern auch Not und Elend, die oft der Auslöser dafür waren. Außerdem gab es noch dies und jenes, was so genannte Herren taten, vor allem solche, die in Verbindung mit dem Theater standen; Dinge, an die anständige Menschen keinen Gedanken verschwendet hätten und deren Zeugen sie schon gar nicht werden wollten.
Zu ihnen rechnete er Männer, die grüne Samtkleider trugen. Man hatte Tellman in der Überzeugung erzogen, dass es zwei Arten von Frauen gab: anständige wie Gattinnen, Mütter und Tanten, die keinerlei Leidenschaften zeigten und vermutlich nicht einmal wussten, was das war, und die anderen, die solche Leidenschaften nicht nur besaßen, sondern sie auch in peinlicher Weise öffentlich zur Schau stellten. Dass sich ein Mann als eine Angehörige dieser Kategorie verkleiden konnte, überstieg sein Verständnis.
Beim Gedanken an Frauen und Liebe fiel ihm Gracie ein. Ganz ohne sein Zutun trat ihm ihr fröhliches kleines Gesicht vor das innere Auge, die Form ihrer Schultern, ihre Art, sich rasch zu bewegen. Sie war sehr klein – all ihre Kleider mussten gekürzt werden – und nach dem Geschmack der meisten Männer zu dürr; ihre Rundungen waren nur angedeutet. Er hatte selbst nicht gewusst, dass ihm eine solche Frau gefallen könnte. Sie besaß Witz, Geist und Mut und hatte eine scharfe Zunge.
Tellman wusste nicht, was sie von ihm hielt. Während er im Pferde-Omnibus die Uferstraße entlangfuhr, erinnerte er sich mit einem sonderbar schmerzenden Gefühl der Einsamkeit an den Blick, der in ihren Augen gelegen hatte, als sie von dem jungen irischen Kammerdiener gesprochen hatte. Er bemühte sich, nicht weiter auf den Schmerz zu achten, den er spürte. Er wollte lieber nicht genau wissen, worum es sich dabei handelte.
Er würde sich auf das konzentrieren, was er die Männer von der Wasserpolizei fragen musste: Einzelheiten über die Gezeiten und die Uhrzeit, zu der man den Kahn vermutlich ins Wasser gelassen hatte, damit er im Morgengrauen den Anleger von Horseferry erreichte.
Am Spätnachmittag berichtete er Pitt in dessen Haus in der Keppel Street, was er herausbekommen hatte. Zwar war es dort warm und sauber, doch schien das Haus ohne die Frauen in der Küche oder den oberen Räumen sehr leer zu sein. Man hörte keine Kinderstimmen, keine leichten Schritte eilten durch das Gebäude, niemand sang. Tellman vermisste sogar Gracies übliche Mahnungen, nicht mit schmutzigen Stiefeln hereinzukommen, keine Unordnung zu machen und nichts anzustoßen.
Er saß Pitt am Küchentisch gegenüber, trank seinen Tee und fühlte sich sonderbar leer.
»Nun?«, fragte Pitt.
»Das bringt uns wohl nicht recht weiter«, sagte Tellman. Auf dem Tisch stand statt eines selbst gebackenen Kuchens eine Dose gekaufter Kekse. Das war nicht annähernd vergleichbar. »An der London Bridge war um drei Minuten nach fünf Niedrigwasser und weiter flussaufwärts entsprechend später, bei Battersea also gegen Viertel nach sechs.«
»Und Flut?«, wollte Pitt wissen.
»An der London Bridge gestern Abend um Viertel nach elf.«
»Das heißt, in Battersea eine Stunde und zehn Minuten danach…«
»Nein… eben nicht, nur zwanzig Minuten danach, also etwa fünf nach halb zwölf.«
»Und mit welcher Geschwindigkeit konnte der Kahn treiben?«
»Das ist auch so eine Sache«, erklärte Tellman. »Die Ebbe dauert mehr oder weniger sechsdreiviertel Stunden, die Flut aber nur fünfeinviertel. Der Kollege hat mir gesagt, dass der Kahn bis zu vier Kilometern pro Stunde zurücklegen konnte, doch muss man die Möglichkeit bedenken, dass er bei Ebbe an einer Schlamm- oder Sandbank hängen geblieben ist…«
»Das ist aber nicht der Fall«, machte Pitt geltend, »denn sonst wäre er erst mit der Flut wieder flott geworden.«
»Auch ein Lastkahn oder sonst etwas kommt als Hindernis infrage«, fuhr Tellman fort. »Beispielsweise ein Brückenpfeiler. Dann wäre er erst wieder weitergetrieben, wenn ihn etwas anderes angestoßen hätte… Was weiß ich, dafür kommt ein Dutzend Sachen infrage. Das Einzige, was sie sicher sagen können, ist, dass er höchstwahrscheinlich von stromaufwärts gekommen ist. Dafür gibt es zwei Gründe: Kein Mensch hätte das Gewicht gegen den Ebbstrom ziehen können, und außerdem gibt es für einen solchen Kahn nirgendwo stromabwärts vom Fähranleger einen Liegeplatz, denn dort ist das ganze Ufer bebaut, voller Hafenanlagen und so weiter.«
Mehrere Minuten lang dachte Pitt schweigend über das Gesagte nach.
»Aha«, sagte er schließlich. »Das heißt, weder Uhrzeit noch Gezeiten helfen uns wirklich weiter. Der Liegeplatz könnte sich in zwanzig oder eineinhalb Kilometern Entfernung befinden, je nachdem, wo ein Haus in Ufernähe steht. Oder sogar noch näher, wenn jemand den Kahn irgendwo einfach am Flussufer vertäut hat. Man muss der Sache nachgehen und sich erkundigen.«
»Das Ganze wäre einfacher, wenn man wüsste, wer der Tote ist«, sagte Tellman. »Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass es der Franzose sein könnte und es denen peinlich ist, das zuzugeben. Wenn ein Engländer so was in Frankreich täte, würde ich ihn auch verleugnen.«
Pitt sah ihn mit feinem Lächeln an. »Ich habe mit einem Bekannten von ihm gesprochen, der der Ansicht war, dass er über Dover nach Paris reisen wollte. Ich wüsste gern, ob das stimmt.«
»Über den Kanal?«, fragte Tellman mit erkennbar gemischten Gefühlen. Er war nicht darauf erpicht, ins Ausland zu reisen, andererseits wäre es ein richtiges Abenteuer, mit einem Dampfer oder Postschiff nach Calais überzusetzen und vielleicht sogar bis Paris zu fahren. Dann hätte er Gracie etwas zu erzählen! »Ich kann mich ja mal darum kümmern«, sagte er hoffnungsvoll. »Wenn er nicht das Opfer ist, könnte er der Täter sein.«
»Sofern er nicht das Opfer ist, gibt es nicht den geringsten Grund anzunehmen, dass er in die Sache verwickelt ist«, gab Pitt zu bedenken. »Aber Sie haben Recht, wir müssen unbedingt feststellen, wer der Tote ist. Wir haben keinen weiteren Anhaltspunkt.«
Tellman erhob sich. »Dann fahre ich also nach Dover, Sir. Die Leute von der Reederei müssten wissen, ob er nach Frankreich gefahren ist oder nicht. Ich sehe zu, dass ich das herausbekomme.«
Kapitel zwei
DIE LETZTE POST DES TAGES kam gerade, als Tellman das Haus verließ. Freudig erregt erkannte Pitt auf einem dicken Brief die Handschrift seiner Frau. Ohne die restliche Post zu beachten, kehrte er in die Küche zurück, wobei er den Umschlag aufriss und die Blätter herausnahm. Dann setzte er sich an den Tisch und las:
Mein liebster Thomas,
Paris ist wunderschön. Was für eine herrliche Stadt! Du fehlst mir zwar, trotzdem genieße ich es, hier zu sein. Es gibt so vieles zu sehen, zu hören und zu entdecken. Noch nie im Leben war ich an einem Ort so voller Leben und Ideen. Sogar die Plakate an den Mauern stammen von richtigen Malern und sind ganz anders als die in London. Mit ihrer Farbenpracht fordern sie geradezu auf, sie zu betrachten – selbst wenn es sich nicht um die Art Abbildung handelt, die man gern im Hause hätte.
Zu beiden Seiten der ungewöhnlich breiten Straßen, die man ›Boulevards‹ nennt und die alle relativ neu und einfach großartig sind, stehen Unmengen von Bäumen. Das Licht, das sich in den Wasserstrahlen der Springbrunnen bricht, tanzt in alle Richtungen. Das hat Elizabeth Barrett Browning sehr treffend mit den Worten beschrieben: »Und so weht hin der Silberhauch der Träume, senkt in die Zukunft des Denkens Samen und zählt den Ablauf ihrer Feierstunden.«
Jack will mit uns ins Theater gehen, aber es ist gar nicht so einfach, sich zu entscheiden, was wir sehen wollen. Angeblich besitzt die Stadt über zwanzig Theater, und dabei ist die Oper natürlich noch nicht mitgezählt. Ich würde zu gern Sarah Bernhardt sehen – ganz gleich in welchem Stück. Sie soll sogar schon den Hamlet gespielt haben oder beabsichtigen, das zu tun.
Unsere Gastgeber sind ganz reizend und tun alles, um uns das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Trotzdem fehlt mir das eigene Heim. Niemand hat hier eine Vorstellung davon, wie man eine ordentliche Tasse Tee macht, und es ist einfach abscheulich, morgens als Erstes Schokolade zu trinken.
Man redet hier viel über einen jungen Mann, der unter Mordanklage vor Gericht steht. Er beteuert, dass er sich zu dem Zeitpunkt anderswo befunden habe, und sagt, er könne das auch beweisen, wenn sich der Freund meldete, mit dem er zusammen war. Niemand glaubt ihm. Das Pikante an der Sache ist, dass er sagt, er sei zu der Zeit im Moulin Rouge gewesen, einem berühmten oder, genauer gesagt, berüchtigten Vergnügungslokal. Ich habe Madame danach gefragt, aber das Thema schien ihr recht peinlich zu sein, und so bin ich der Sache nicht weiter nachgegangen. Jack sagt, dass dort Cancan getanzt wird und die Tänzerinnen keine Unterwäsche tragen. Ein sonderbarer Maler namens Henri Toulouse-Lautrec hat für das Moulin Rouge fantastische Plakate geschaffen. Ich habe gestern eins auf der Straße gesehen. Zwar war es ziemlich anstößig, aber so voll prallem Leben, dass ich es mir einfach ansehen musste. Es kam mir vor, als könnte ich dabei die Musik hören.
Morgen wollen wir uns den von Monsieur Eiffel erbauten Turm ansehen, der wirklich enorm ist. Ganz oben soll es ein WC geben, aus dessen Fenstern man den allerbesten Blick über Paris hätte – wenn man hinaussehen könnte!
Ihr fehlt mir alle, und jetzt, da Ihr nicht bei mir seid, merke ich erst richtig, wie sehr ich Euch liebe. Wenn ich zurückkomme, werde ich mich Euch hingebungsvoll widmen und ganz reizend zu Euch sein – mindestens eine Woche lang!
Stets die Deine
Charlotte
Lächelnd hielt Pitt den Brief in der Hand. Ihre Worte zu lesen, die sie voll Begeisterung quer über die Seiten geschrieben hatte, war fast so, als könnte er ihre Stimme hören. Wieder musste er daran denken, wie richtig es gewesen war, sie bereitwillig reisen zu lassen, statt Unmut zu zeigen. Schließlich waren es nur drei Wochen. Auch wenn sich jeder einzelne Tag dahinschleppte, war doch ein Ende abzusehen. Erschrocken merkte er, wie spät es schon war. Es wurde höchste Zeit, sich für den Theaterbesuch mit Caroline umzuziehen. Er faltete den Brief zusammen, steckte ihn in den Umschlag zurück und schob diesen in seine Jacketttasche. Dann ging er nach oben, um sich zu waschen und für das Theater umzuziehen. Er besaß einen Abendanzug, dessen Kauf unumgänglich gewesen war, als er sich einmal längere Zeit dienstlich auf Emilys Landsitz Ashworth Hall aufhalten musste.
Er gab sich große Mühe, gepflegt auszusehen, um seine Schwiegermutter Caroline, die er gut leiden konnte, nicht in Verlegenheit zu bringen. Er war voller Bewunderung für den Mut, den es sie gekostet haben musste, ohne Rücksicht auf ihre gesellschaftliche Stellung die Ehe mit Joshua einzugehen. Charlotte hatte sich bei der Eheschließung mit ihm ähnlich verhalten, und er gab sich keinen Täuschungen darüber hin, dass damit für sie wirkliche Opfer verbunden gewesen waren.
Er betrachtete sich im Spiegel. Was er sah, befriedigte ihn nicht restlos. Sein Gesicht war eher klug, als dass es gut aussah. Seine Haare ließen sich nicht bändigen, ganz gleich, was er mit ihnen anstellte. Sicher sähe er um den Kopf herum ordentlicher aus, wenn ein guter Friseur sie ein gutes Stück gekürzt hätte, aber mit kurzen Haaren fühlte er sich unwohl, ganz davon abgesehen, dass er immer wieder vergaß, zum Friseur zu gehen. Sein Hemdkragen war ausnahmsweise glatt, wenn auch etwas höher, als es die Mode vorschrieb, und das blendende Weiß der Hemdbrust schmeichelte seiner Erscheinung. Das würde reichen müssen.
Raschen Schritts ging er zum Bedford Square, von wo er eine Droschke zur Shaftesbury Avenue nahm, an der das Theater lag. Sie war voller Menschen, die Herren in fantasielosem Schwarz und Weiß, die Frauen in leuchtenden Farben und mit blitzendem Schmuck. Gelächter vermischte sich mit dem Hufschlag von Pferden und dem Klirren ihrer Geschirre, während sich die Kutscher ihren Weg zu bahnen versuchten. Die Gaslaternen leuchteten hell, und riesige Plakate am Eingang des Theaters kündigten die Vorstellung an, wobei der Name der Hauptdarstellerin noch über dem des Stückes stand. Keiner von beiden sagte Pitt etwas, dennoch fühlte er sich unwillkürlich von der aufgeregten Atmosphäre um ihn herum angesteckt. Sie knisterte förmlich, wie die Kälte in einer mondhellen Nacht.