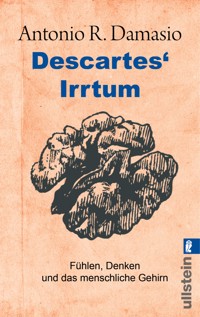
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine der Grundannahmen des westlichen Denkens ist die Trennung von Verstand und Gefühl. Antonio R. Damasio beweist anhand seiner bahnbrechenden Forschungsergebnisse, daß ohne Gefühle kein vernünftiges Handeln möglich ist und daß Geist und Körper eine weit engere Einheit bilden, als die Philosophie uns weismachen möchte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Anhand zahlreicher Fallgeschichten legt Antonio R. Damasio überzeugend dar, welch grundlegende Rolle den Emotionen beim »vernünftigen « Verhalten des Menschen zukommt; bezeichnenderweise vermag ein Mensch, dessen emotionales und soziales Verhalten durch Hirnverletzungen gestört ist, sogenannte »rationale« Entscheidungen nicht mehr zu treffen. Die Vorstellung einer vom Gefühl unabhängigen Ratio, wie Descartes sie postulierte, kann daher nicht länger aufrechterhalten werden. Die enge Verknüpfung von Denken und Fühlen im Gehirn weist zudem darauf hin, daß Geist und Körper eine weit engere Einheit bilden, als die Philosophie uns bislang weismachen mochte.
Der Autor
Antonio R. Damasio ist David Dornsife, Professor für Neurowissenschaften, Neurologie und Psychologie und Direktor am Brain und Creativity Institute an der University of Southern California. Er ist außerdem außerordentlicher Professor am Salk Institute und an der University of Iowa. Er wurde vielfach (oft gemeinsam mit seiner Frau, der Neurologin und Neurowissenschaftlerin Hanna Damasio) für sein Werk ausgezeichnet, zuletzt mit dem Price of Austrias Prize für Wissenschaft und Technologie. Damasio ist Mitglied des Institute of Medicine of the National Academy of Sciences und der American Academy of Arts and Science. Seine Bücher wurden in über dreißig Sprachen übersetzt.
Von Antonio R. Damasio sind in unserem Hause außerdem erschienen:
Ich fühle, also bin ich
Der Spinoza-Effekt
Antonio R. Damasio
Descartes’ Irrtum
Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn
Aus dem Englischen von Hainer Kober
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Für wissenschaftliche Beratung danken Übersetzer und Verlag Herrn Dr. Ulrich Müller am Max-Planck-Institut für neuropsychologische Forschung, Leipzig.
ISBN 978-3-8437-0895-1
Neuausgabe im List Taschenbuch © für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2004 © 1995 für die deutsche Ausgabe by Paul List Verlag in der Südwest Verlag GmbH & Co. KG, München © 1994 by Antonio R. Damasio, M. D. Titel der amerikanischen Originalausgabe:Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain (G. P. Putnam’s Son, New York) Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Titelabbildung: FinePic®, München
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book: CPI books GmbH, Leck
Für Hanna
Inhalt
Vorwort
Descartes’ Irrtum aus heutiger Sicht
Einleitung
Erster Teil
1. KAPITEL
Verhängnis in Vermont
Phineas P. Gage
Gage war nicht mehr Gage
Warum Phineas Gage?
Ein Exkurs über Phrenologie
Aus der Rückschau ein denkwürdiges Ereignis
2. KAPITEL
Ein Blick in Gages Gehirn
Das Problem
Ein Exkurs über die Anatomie des Nervensystems
Die Lösung
3. KAPITEL
Ein moderner Phineas Gage
Ein neuer Geist
Ein neuer Ansatz
Denken und Entscheiden
4. KAPITEL
Gefühlsärmer
Anhaltspunkte aus anderen Fällen präfrontaler Schädigung
Anhaltspunkte von Schädigungen außerhalb des präfrontalen Cortex
Gedanken zum Verhältnis von Anatomie und Funktion
Eine Energiequelle
Daten aus Tierversuchen
Exkurs über neurochemische Erklärungen
Schluß
Zweiter Teil
5. KAPITEL
Elemente einer Erklärung
Eine geheimnisvolle Allianz
Von Organismen, Körpern und Gehirnen
Zustände von Organismen
Wechselwirkungen von Körper und Gehirn – im Inneren des Organismus
Über Verhalten und Geist
Wechselwirkungen von Organismus und Umwelt – Auseinandersetzung mit der Außenwelt
Exkurs über die Architektur neuronaler Systeme
Ein integrierter Geist aus parzellierter Aktivität
Vorstellungsbilder vom Jetzt, von der Vergangenheit und von der Zukunft
Die Entstehung von Wahrnehmungsbildern
Speicherung von Vorstellungsbildern und Abruf von Erinnerungsbildern
Wissen ist in dispositionellen Repräsentationen abgelegt
Denken vollzieht sich weitgehend in Bildern
Einige Bemerkungen zur neuronalen Entwicklung
6. KAPITEL
Biologische Regulation und Überleben
Überlebensdispositionen
Mehr über basale Regulation
Tristan, Isolde und der Liebestrank
Jenseits von Trieben und Instinkten
7. KAPITEL
Gefühle und Empfindungen
Gefühle
Primäre Gefühle
Sekundäre Gefühle
Die Spezifität der neuronalen Mechanismen hinter den Gefühlen
Empfindungen
Wenn das Gehirn genarrt wird
Empfindungsarten
Hintergrundempfindungen
Der Körper als Bühne der Gefühle
Vergeistigung des Körpers
Der Empfindungsprozeß
8. KAPITEL
Die Hypothese der somatischen Marker
Denken und Entscheiden
Denken und Entscheiden im persönlichen und sozialen Raum
Wie funktioniert Rationalität?
Die Hypothese der somatischen Marker
Exkurs über Altruismus
Somatische Marker – woher kommen sie?
Ein neuronales Netz für somatische Marker
Somatische Marker – Theater im Körper oder Theater im Gehirn?
Manifeste und verdeckte somatische Marker
Honysuckle Rose!
Intuition
Denken außerhalb des persönlichen und sozialen Bereichs
Die Hilfe von Gefühlen – mit positiven und negativen Folgen
Neben und jenseits der somatischen Marker
Tendenzen und die Entstehung von Ordnung
Dritter Teil
9. KAPITEL
Die Hypothese der somatischen Marker auf dem Prüfstand
Wissen, aber nicht empfinden
Risikobereitschaft – die Glücksspielexperimente
Kurzsichtig für die Zukunft
Zukunftsvorhersagen – physiologische Korrelate
10. KAPITEL
Das körperbewußte Gehirn
Kein Körper – was macht das?
Der Körper als Grundreferenz
Das neuronale Selbst
11. KAPITEL
Eine Leidenschaft für das Denken
Descartes’ Irrtum
POSTSKRIPT
Das menschliche Herz im Konflikt
Moderne Neurobiologie und die Idee der Medizin
Eine Anmerkung zu den Grenzen der gegenwärtigen Neurobiologie
Eine Überlebensstrategie
ANMERKUNGEN UND LITERATUR
ZUR LEKTÜRE EMPFOHLEN
DANKSAGUNG
Vorwort
Descartes’ Irrtum aus heutiger Sicht
Hätten wir um 1900 gelebt und uns für geistige Fragen interessiert, wären wir vermutlich der Meinung gewesen, es sei an der Zeit, das Gefühl (emotion)* *[Im vorliegenden Buch hatte man sich in der deutschen Fassung für das Begriffspaar »Gefühl« (emotion) und Empfindung (feeling) entschieden. In späteren Damasio-Übersetzungen wurden, der üblichen Praxis folgend, die Bezeichnungen »Emotion« (emotion) und »Gefühl« (feeling) gewählt. (A.d.Ü.)] in seinen vielen Dimensionen zu ergründen und eine klare Antwort auf die wachsende Neugier der Öffentlichkeit zu finden. In den vorangehenden Jahrzehnten hatte Charles Darwin gezeigt, daß einige emotionale Phänomene auf bemerkenswert vergleichbare Weise in verschiedenen nichtmenschlichen Arten vorhanden sind. William James und Carl Lange hatten eine ganz neue Hypothese vorgeschlagen, um die Auslösung von Gefühlen zu erklären. Sigmund Freud behandelte die Gefühle bei seiner Untersuchung psychopathologischer Zustände, und Charles Sherrington hatte mit der neurophysiologischen Untersuchung der für das Gefühl verantwortlichen Schaltkreise im Gehirn begonnen.
Doch zu einem großangelegten Versuch, das Forschungsfeld der Gefühle zu bearbeiten, kam es nicht. Im Gegenteil: Als im 20. Jahrhundert die Wissenschaften von Geist und Gehirn florierten, galt deren Interesse ganz anderen Dingen. Die Disziplinen, die wir heute etwas allgemein unter dem Stichwort »Neurowissenschaft« zusammenfassen, klammerten das Problem der Gefühle ganz bewußt aus. Zwar blieb die Psychoanalyse den Gefühlen treu, und auch sonst gab es lobenswerte Ausnahmen – Pharmakologen und Psychiater, die sich mit Stimmungsstörungen beschäftigten, und vereinzelte Psychologen und Neurowissenschaftler, deren Interesse den Affekten galt. Diese Ausnahmen ließen jedoch nur noch deutlicher erkennen, wie sehr das Gefühl als Forschungsgegenstand vernachlässigt wurde. Behaviorismus, kognitive Revolution und Neuroinformatik vermochten dies nicht nennenswert zu ändern.
Im großen und ganzen war das auch 1994, als Descartes’ Irrtum erstmals erschien, noch der Stand der Dinge, obwohl sich bereits erste Veränderungen andeuteten. In dem Buch geht es ausschließlich um neurowissenschaftliche Erkenntnisse über Gefühle und um ihre Bedeutung für Entscheidungsprozesse im allgemeinen und Sozialverhalten im besonderen. Ich hoffte damals, meine Ansichten würden wenigstens keinen Sturm der Entrüstung auslösen, hatte aber keinen Grund zu der Annahme, man werde das Buch freundlich und aufmerksam willkommen heißen. Tatsächlich aber fand ich allseits eine freundliche, aufmerksame und großzügige Leserschaft. Zahlreiche Ideen des Buchs wurden von Fachkollegen und der breiten Öffentlichkeit übernommen. So unerwartet wie die Rezeption war der Umstand, daß sehr viele Leser das Bedürfnis verspürten, mit mir ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, Vorschläge zu unterbreiten und Korrekturen zu empfehlen. In etlichen Fällen korrespondierte ich mit diesen Lesern, und einige sind mir sogar zu Freunden geworden. Ich habe viel dabei gelernt und tue es noch, da kaum ein Tag vergeht, ohne daß ich von irgendeinem Ort der Welt eine Mail zu Descartes’ Irrtum erhalte.
Zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung hat sich die Situation entscheidend verändert. Nicht lange nach Descartes’ Irrtum publizierten Neurowissenschaftler, welche die Gefühle an Tieren erforscht hatten, ihre eigenen Bücher. Schon bald widmeten neurowissenschaftliche Laboratorien in Amerika und Europa ihre Aufmerksamkeit der Emotionsforschung. Philosophen, die sich mit dem Thema beschäftigten, fanden verstärkte Aufmerksamkeit, und Bücher, welche die Ergebnisse der Emotionsforschung verwerteten, erwiesen sich als sehr erfolgreich. Endlich findet das Gefühl – wenn auch mit hundertjähriger Verspätung – das Interesse, das sich schon unsere illustren Vorgänger gewünscht hätten.
Das zentrale Thema in Descartes’ Irrtum ist die Beziehung zwischen Gefühl und Denken. Ausgehend von meinen Untersuchungen an neurologischen Patienten, die sowohl unter Beeinträchtigungen der Entscheidungsfindung als auch unter Gefühlsstörungen litten, stellte ich eine Hypothese (die Hypothese der somatischen Marker) auf, derzufolge das Gefühl in das Denken eingebunden ist und die Denkprozesse eher fördert als stört (wie man allgemein annahm). Heute löst diese Idee kein Befremden mehr aus, damals aber wurde sie mit Staunen und auch einer gewissen Skepsis betrachtet. Alles in allem aber wurde dieser Gedanke positiv aufgenommen, manchmal so begeistert, daß er kaum noch wiederzuerkennen war. Beispielsweise habe ich nie die Ansicht geäußert, das Gefühl könne ein Ersatz für das Denken sein, doch in einigen oberflächlichen Rezeptionsversuchen wurde der Eindruck erweckt, ich verträte die Ansicht, alles werde gut, wenn man nur dem Herzen und nicht dem Verstand folge.
Natürlich können Gefühle manchmal als Ersatz für den Verstand dienen. Das emotionale Aktionsprogramm, das wir Furcht nennen, kann die meisten Menschen augenblicklich und ohne – oder mit nur geringer – Hilfe des Verstands aus einer gefährlichen Situation befreien. Ein Eichhörnchen oder ein Vogel reagiert aufeine Bedrohung, ohne nachzudenken, und das kann auch bei einem Menschen passieren. Tatsächlich ist unter bestimmten Umständen zuviel Denken weit nachteiliger als gar kein Denken. Das zeichnet die Wirkung des Gefühls während der gesamten Evolution aus: Es ermöglicht den Lebewesen, gescheit zu handeln, ohne gescheit denken zu müssen. Beim Menschen ist diese Situation jedoch komplizierter – mit welchem Ergebnis auch immer. Denken bewirkt das gleiche wie Gefühle, allerdings bewußt. Denken eröffnet uns die Möglichkeit, gescheit zu denken, bevor wir gescheit handeln – was durchaus von Vorteil ist: Wir haben entdeckt, daß die Gefühle allein zwar viele, aber durchaus nicht alle Probleme lösen, vor die uns unsere komplexe Umwelt stellt, und daß die Lösungen, die uns das Gefühl anbietet, gelegentlich sogar kontraproduktiv sind.
Doch wie hat unsere komplexe Spezies das gescheite Denksystem entwickelt? Die neuartige These in Descartes’ Irrtum besagt, daß sich das Denksystem als Erweiterung des automatischen Gefühlssystems entwickelt hat, wobei das Gefühl verschiedene Funktionen im Denkprozeß übernimmt. Beispielsweise kann das Gefühl die Auffälligkeit (Salienz) einer Prämisse verstärken und dadurch die Schlußfolgerung zugunsten dieser Prämisse verschieben. Das Gefühl kann auch dabei helfen, die verschiedenen Tatsachen im Bewußtsein präsent zu halten, die es bei einer vernünftigen Entscheidung zu berücksichtigen gilt.
Die unumgängliche Beteiligung des Gefühls am Denkprozeß kann vorteilhaft oder verheerend sein, je nach den Umständen der Entscheidung und der Lebensgeschichte des Entscheidenden. Die Bedeutung der Umstände kommt sehr anschaulich in der Geschichte zum Ausdruck, die Malcolm Galdwell am Anfang seines jüngsten Buchs Blink (2005) erzählt. Von dem Wunsch beseelt, eine bestimmte griechische Skulptur ihrer Sammlung einzuverleiben, gelangten die Kuratoren des Getty-Museums zu dem Schluß, dieses Kunstwerk sei echt, während es zahlreiche außenstehende Experten aufgrund des instinktiven Widerwillens, den sie beim ersten Anblick der Skulptur empfanden, für eine Fälschung hielten. An diesen beiden verschiedenen Urteilen waren in einzelnen Phasen des Denkprozesses Gefühle unterschiedlicher Art beteiligt. Bei einigen Protagonisten gab es den belohnenden und beherrschenden Wunsch, das Objekt gutzuheißen, bei anderen das instinktive, bestrafende Empfinden, daß irgend etwas fehle. In beiden Fällen war jedoch nicht allein das Denken ausschlaggebend – und das ist der entscheidende Aspekt, um den es mir in Descartes’ Irrtum ging. Wenn das Gefühl am Denken gar nicht beteiligt wird, wie bei bestimmten neurologischen Erkrankungen, ist das Denken noch unzulänglicher als in den Fällen, wo wir uns bei Entscheidungen von unseren Gefühlen täuschen lassen.
Die Hypothese der somatischen Marker geht von folgender Annahme aus: Gefühle markieren bestimmte Aspekte einer Situation oder bestimmte Ergebnisse möglicher Handlungen. Das Gefühl nimmt diese Markierung entweder offen vor, etwa als »Bauchgefühl«, als instinktives Empfinden, oder verdeckt mittels Signalen, die unterhalb der Bewußtseinsschwelle empfangen werden. Auch das Wissen, das wir beim Denken verwenden, kann ganz explizit oder partiell verborgen sein, zum Beispiel, wenn wir intuitiv aufeine Lösung kommen. Mit anderen Worten, das Gefühl ist an der Intuition beteiligt, jenem raschen kognitiven Prozeß, bei dem wir zu einer bestimmten Lösung gelangen, ohne uns aller beteiligten logischen Schritte bewußt zu sein. Dabei bleiben uns die Zwischenschritte nicht unbedingt verborgen, immer aber liefert uns das Gefühl die Schlußfolgerung so direkt und rasch, das uns nicht viel Wissensinhalte bewußt werden.
Das deckt sich mit der landläufigen Vorstellung, daß die Intuition den präparierten Verstand begünstigt. Betrachten wir diese Vorstellung, indem wir die Hypothese der somatischen Marker zugrunde legen. Die Qualität der Intuition hängt vom Niveau unseres bisherigen Denkens ab – davon, wie gut wir unsere bisherigen Erfahrungen in Beziehung zu den Gefühlen klassifiziert haben, die ihnen vorausgingen oder nachfolgten, und davon, wie genau wir die Erfolge oder Mißerfolge früherer Intuitionen eingeschätzt haben. Intuition ist einfach rasche Kognition, in deren Vollzug das dafür erforderliche Wissen dank des Gefühls und umfassender früherer Praxis teilweise unterschwellig bleibt.
Ganz bestimmt wollte ich das Gefühl nie gegen den Verstand ausspielen, sondern immer nur verdeutlichen, daß das Gefühl im mindesten Fall den Verstand unterstützt und sich im besten Fall im Dialog mit ihm befindet. Auch hatte ich nie die Absicht, einen Gegensatz zwischen Gefühl und Kognition zu konstruieren, da ja nach meiner Auffassung die Emotion – direkt oder über Empfindungen – kognitive Informationen liefert.
Die Daten, welche die Grundlage für die Hypothese der somatischen Marker bildeten, ergaben sich im Laufe mehrerer Jahre durch Studien an neurologischen Patienten, deren Sozialverhalten durch Hirnschädigungen in einer bestimmten Region des Frontallappens verändert worden war. Die Beobachtungen an diesen Patienten führten schließlich zu einem weiteren wichtigen Gedanken in Descartes’ Irrtum – der Vorstellung, daß die Gehirnsysteme, die gemeinsam an Gefühl und Entscheidungsprozessen beteiligt sind, im allgemeinen für den sozialen Kognitions- und Verhaltensstil verantwortlich sind. Diese Vorstellung eröffnete die Möglichkeit, das Geflecht sozialer und kultureller Phänomene mit bestimmten Merkmalen der Neurobiologie in Zusammenhang zu bringen – einen Zusammenhang, für den schwerwiegende Fakten sprachen.
Die Veröffentlichung von Descartes’ Irrtum führte zu einer weiteren Entdeckung. Eltern junger Männer und Frauen, deren Verhalten dem unserer im Erwachsenenalter erkrankten Frontalhirnpatienten ähnelte, schrieben mir Briefe, in denen sie höchst hellsichtig fragten, ob die Probleme ihrer jetzt erwachsenen Kinder nicht ebenfalls auf Hirnschädigungen zurückzuführen seien. Wir konnten diese Vermutungen bestätigen und berichteten darüber 1999 in den ersten veröffentlichten Untersuchungen zu dem Thema. Diese jungen Erwachsenen hatten zu einem frühen Zeitpunkt ihres Lebens eine Hirnschädigung erlitten, ein Umstand, den die Eltern entweder gar nicht bemerkt oder nicht mit dem deutlich abnormen Sozialverhalten ihrer Kinder in Zusammenhang gebracht hatten. Wir entdeckten auch ein Kriterium, mit dessen Hilfe sich die Früh- von den Spätfällen (das heißt, den erst im Erwachsenenalter auftretenden Fällen) prinzipiell unterscheiden ließen: Frühfälle schienen die sozialen Konventionen und ethischen Regeln nicht gelernt zu haben, die eigentlich ihr Verhalten hätten bestimmen müssen. Während die Spätfälle die Regeln kannten, aber es nicht schafften, sich nach ihnen zu richten, hatten die Frühfälle sie nie gelernt. Mit anderen Worten, die Spätfälle zeigten uns, daß Gefühle für die Entwicklung eines angemessenen Sozialverhaltens erforderlich sind, die Frühfälle dagegen, daß wir die Gefühle sogar brauchen, um das Regelwerk zu lernen, welches angemessenem Sozialverhalten zugrunde liegt. Wie wichtig diese Erkenntnisse sind, um die möglichen Ursachen eines gestörten Sozialverhaltens zu erklären, beginnen wir erst allmählich zu begreifen.
Das Nachwort zu Descartes’ Irrtum enthielt zusätzlich noch eine Idee, die einen Ausblick auf die Zukunft der neurobiologischen Forschung eröffnete: Die Mechanismen der grundlegenden Homöostase stellen einen Entwurf für die kulturelle Entwicklung der menschlichen Werte dar, die uns erlauben, Handlungen als gut oder böse zu beurteilen und Objekte in schöne und häßliche zu unterteilen. Als ich damals diese Idee skizzierte, hoffte ich, zwischen der Neurobiologie und den Geisteswissenschaften werde sich eine in beide Richtungen begehbare Brücke errichten lassen, die uns ein besseres Verständnis menschlicher Konflikte und eine umfassendere Erklärung der Kreativität ermöglichen würde. Heute kann ich mit Freude vermelden, daß beim Bau dieser Brücke schon einige Fortschritte erzielt wurden. Beispielsweise untersuchen einige Forscher die Gehirnzustände, die mit moralischem Denken einhergehen, während andere zu ermitteln versuchen, was im Gehirn während ästhetischer Erfahrungen geschieht. Damit sollen Ethik oder Ästhetik nicht auf Schaltkreise im Gehirn reduziert, sondern die Verbindungen zwischen Neurobiologie und Kultur untersucht werden. Ich bin heute sogar noch zuversichtlicher, daß eine solche Verbindung zustande kommen kann, und denke eigentlich, daß wir nicht noch einmal hundert Jahre warten müssen, bis wir sie nutzen können.
Einleitung
Zwar kann ich nicht genau sagen, wie es zu meinem Interesse an den neuronalen Grundlagen der Vernunft kam, aber ich weiß noch genau, wann ich die Überzeugung gewann, daß die traditionellen Auffassungen über das Wesen der Rationalität nicht stimmen könnten. Schon früh hatte man mich gelehrt, daß vernünftige Entscheidungen mit einem kühlen Kopf getroffen werden und daß Gefühle und Vernunft wie Feuer und Wasser sind. Ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, daß sich die Mechanismen der Vernunft in einer eigenen Domäne des Geistes befänden, zu der man dem Gefühl keinen Zutritt gewähren dürfe. Wenn ich an das Gehirn hinter diesem Geist dachte, dann stellte ich mir separate neuronale Systeme für Vernunft und Gefühl vor. Das war eine gängige Auffassung von der Beziehung zwischen Vernunft und Gefühl – sowohl was ihre geistige wie ihre neuronale Struktur anbelangte.
Doch dann hatte ich einen denkbar gelassenen, emotionslosen, intelligenten Menschen vor Augen, und doch war sein praktischer Verstand so beeinträchtigt, daß er in den ganz alltäglichen Situationen seines Lebens eine ununterbrochene Folge von Fehlern beging, ständig dem zuwiderhandelte, was sozial angemessen und persönlich von Vorteil gewesen wäre. Er war geistig vollkommen gesund gewesen, bis ihm eine neurologische Krankheit einen bestimmten Bereich des Gehirns zerstörte und von einem Tag auf den anderen die Prozesse seiner Entscheidungsfindung tiefgreifend störte. Die Instrumente, die im allgemeinen als notwendig und hinreichend für rationales Verhalten gelten, waren intakt geblieben. Wissen, Aufmerksamkeit und Gedächtnis waren nicht beeinträchtigt. Er drückte sich einwandfrei aus, führte komplizierte Rechnungen aus und ging abstrakte Probleme logisch an. Die Störung seiner Entscheidungsfähigkeit wies nur eine einzige auffällige Begleiterscheinung auf: eine deutliche Beeinträchtigung seiner Fähigkeit, Gefühle zu empfinden. Gemeinsam bildeten Vernunftmängel und defektes Gefühlsleben die Folgen einer spezifischen Hirnschädigung, und dieser Zusammenhang brachte mich zu der Annahme, daß das Gefühl ein integraler Bestandteil der Verstandesmechanismen sei. In zwanzig Jahren klinischer und experimenteller Arbeit mit einer großen Zahl neurologischer Patienten hatte ich Gelegenheit, diese Beobachtungen viele Male zu wiederholen und eine vage Vermutung in eine überprüfbare Hypothese zu verwandeln.1
Mit diesem Buch möchte ich darlegen, daß die Vernunft möglicherweise nicht so rein ist, wie die meisten Menschen denken oder wünschen, daß Gefühle und Empfindungen vielleicht keine Eindringlinge im Reich der Vernunft sind, sondern, zu unserem Nach- und Vorteil, in ihre Netze verflochten sein könnten. Weder im Verlauf der Evolution noch in irgendeinem Individuum dürften sich die Strategien der menschlichen Vernunft unabhängig vom bestimmenden Einfluß der biologischen Regulationsmechanismen entwickelt haben, zu deren Ausdrucksformen Gefühl und Empfindung wesentlich gehören. Mehr noch, sogar wenn sich die Vernunftstrategien in den Entwicklungsjahren ausgebildet haben, hängt ihre wirksame Anwendung wahrscheinlich in beträchtlichem Maße von der steten Fähigkeit ab, Gefühle zu empfinden.
Damit will ich nicht in Abrede stellen, daß sich Gefühle und Empfindungen unter bestimmten Umständen verheerend auf Denkprozesse auswirken können. Das entspricht nicht nur der herkömmlichen Auffassung, sondern auch neueren Untersuchungen des normalen Denkprozesses, die gezeigt haben, wie nachteilig sich emotionale Voreingenommenheit auswirken kann. Hingegen ist überraschend und neu, daß das Fehlen von Gefühl und Empfindung nicht weniger schädlich ist, nicht in geringerem Maße dazu angetan, jene Rationalität zu gefährden, der wir unsere spezifisch menschlichen Züge verdanken und die uns ermöglicht, uns mit Rücksicht auf unsere persönliche Zukunft, auf soziale Konventionen und moralische Grundsätze zu entscheiden.
Auch soll das nicht heißen, daß unsere Gefühle, da sie diese positive Wirkung haben, uns unsere Entscheidungen abnähmen oder wir keine vernunftbestimmten Wesen wären. Ich möchte nur zeigen, daß bestimmte Aspekte von Gefühl und Empfindung unentbehrlich für rationales Verhalten sind. Im Idealfall lenken uns Gefühle in die richtige Richtung, führen uns in einem Entscheidungsraum an den Ort, wo wir die Instrumente der Logik am besten nutzen können. Ungewißheit befällt uns, wenn wir vor der Aufgabe stehen, ein moralisches Urteil zu fällen, über die weitere Entwicklung einer persönlichen Beziehung zu entscheiden, die richtigen Maßnahmen zur Altersversorgung auszuwählen oder das vor uns liegende Leben zu planen. Gefühl und Empfindung nebst den verborgenen physiologischen Mechanismen, die ihnen zugrunde liegen, helfen uns bei der einschüchternden Aufgabe, eine ungewisse Zukunft vorherzusagen und unser Handeln entsprechend zu planen.
Nach einer Analyse des Falles von Phineas Gage, der im 19. Jahrhundert großes Aufsehen erregte, weil er zum erstenmal einen Zusammenhang zwischen beeinträchtigter Rationalität und einer spezifischen Hirnschädigung erkennen ließ, wende ich mich neueren Untersuchungen an seinen modernen Leidensgenossen zu und berichte über einschlägige Daten aus neuropsychologischen Forschungsarbeiten an Menschen und Tieren. Im weiteren Verlauf lege ich meine Auffassung dar, daß die menschliche Vernunft nicht von einem Hirnzentrum, sondern von mehreren Gehirnsystemen abhängt und aus dem Zusammenwirken vieler Ebenen neuronaler Organisation erwächst. Sowohl »höhere« wie »niedere« Gehirnzentren – von präfrontalen Rindenabschnitten bis zum Hypothalamus und Hirnstamm – kooperieren zur Herstellung der Vernunft.
Die unteren Stockwerke des neuronalen Vernunftgebäudes steuern zugleich die Verarbeitung von Gefühlen und Empfindungen sowie die Körperfunktionen, die fürs Überleben des Organismus notwendig sind. Dabei unterhalten diese unteren Ebenen eine direkte und wechselseitige Beziehung zu praktisch jedem Körperorgan, so daß der Körper unmittelbar in die Kette jener Vorgänge einbezogen ist, die die höchsten Ausformungen des Denkens* *[Unter Denken (reasoning) ist hier und im folgenden, vor allem in dem häufig vorkommenden Doppelbegriff Denken und Entscheidungsfindung (reasoning and decision making), stets zielgerichtetes, das heißt schlußfolgerndes und urteilendes Denken zu verstehen. Der englische Begriff emotion wird durchweg mit Gefühl wiedergegeben, feeling mit Empfindung. (A.d.Ü.)], der Entscheidungsfindung und im weiteren Sinne des Sozialverhaltens und der Kreativität hervorbringen. Die unteren Organisationsstufen unseres Organismus sind also entscheidend an den höheren Vernunftmechanismen beteiligt.
So machen wir die faszinierende Entdeckung, daß der Schatten unserer entwicklungsgeschichtlichen Vergangenheit noch auf die höchsten und spezifisch menschlichen Ebenen geistiger Aktivität fällt. Allerdings hat Charles Darwin die Essenz dieser Erkenntnis schon vorweggenommen, als er von dem unauslöschlichen Stempel schrieb, den die niederen Ursprünge in der Körpergestalt des Menschen hinterlassen hätten.2 Und doch verwandelt die Abhängigkeit von niederen Gehirnbereichen die höhere Vernunft nicht in niedere Vernunft. Daß das Handeln nach einem ethischen Grundsatz auf die Beteiligung einfacher Schaltkreise im Inneren des Gehirns angewiesen ist, tut dem ethischen Grundsatz keinen Abbruch. Die Wertordnung bricht nicht zusammen, die Moral ist nicht bedroht, und der Wille des Menschen bleibt sein Wille, sofern wir es mit einem normalen Individuum zu tun haben. Allenfalls ändert sich unsere Auffassung vom Beitrag der Biologie zur Entstehung bestimmter ethischer Grundsätze in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem viele Individuen mit ähnlicher biologischer Disposition unter bestimmten Bedingungen interagieren.
Empfindungen sind das zweite und zentrale Thema dieses Buches, nur daß ich mir das nicht ausgesucht habe, sondern daß es mir aufgezwungen wurde, als ich versuchte, die kognitiven und neuronalen Mechanismen zu verstehen, die Denken und Entscheidungsfindung zugrunde liegen. So ist also eine zweite Idee des vorliegenden Buches, daß das Wesen einer Empfindung möglicherweise nicht eine schwer faßbare psychische Eigenschaft ist, die einem Objekt zugeschrieben wird, sondern vielmehr die direkte Wahrnehmung einer bestimmten Landschaft: der des Körpers.
Meine Untersuchungen an neurologischen Patienten, bei denen Hirnläsionen die Empfindungsfähigkeit beeinträchtigten, haben mich zu der Überzeugung gebracht, daß Empfindungen gar nicht so schwer greifbar sind, wie ihnen nachgesagt wird. Man kann sie auf der mentalen Ebene dingfest machen und möglicherweise sogar ihr neuonrales Substrat entdecken. In Abweichung vom herrschenden neurobiologischen Denken vertrete ich die Auffassung, daß die Netze, auf denen Empfindungen vor allem beruhen, nicht nur das limbische System umfassen, also jene Gehirnstrukturen, denen man diese Aufgabe traditionell zuschreibt, sondern auch einige präfrontale Rindenabschnitte und, vor allem, jene Hirnbereiche, in denen Signale aus dem Körper kartiert und integriert werden.
Im wesentlichen verstehe ich Empfindungen als Phänomene, die Sie und ich durch ein Fenster betrachten können – ein Fenster, das sich direkt auf ein immer wieder aktualisiertes Bild von der Struktur und dem Zustand unseres Körpers öffnet. Wenn Sie sich den Blick aus diesem Fenster als Landschaft vorstellen, entspricht die »Körperstruktur« dreidimensionalen Objekten im Raum, während der »Körperzustand« dem Licht und dem Schatten, den Bewegungen und den Lauten der Objekte im Raum gleicht. In der Landschaft Ihres Körpers sind die Objekte die inneren Organe (Herz, Lunge, Darm, Muskeln), während Licht und Schatten, Bewegungen und Laute einen Punkt im Funktionsbereich dieser Organe zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellen. Im großen und ganzen ist eine Empfindung ein momentaner »Blick« auf einen Teil dieser Körperlandschaft. Sie hat einen spezifischen Inhalt – den Zustand des Körpers – und spezifische neurale Systeme, auf denen sie beruht – das periphere Nervensystem und die Hirnregionen, die die Signale der Körperstruktur und der Körperregulation integrieren. Da der Eindruck von dieser Körperlandschaft zeitlich mit der Wahrnehmung von oder der Erinnerung an Dinge verknüpft ist, die kein Teil des Körpers sind – ein Gesicht, eine Melodie, einen Duft –, werden Empfindungen am Ende zu »Merkmalen« dieser Dinge. Doch eine Empfindung umfaßt noch mehr als nur diesen zentralen Aspekt. Wie ich erläutern werde, wird der als – positives oder negatives – Merkmal fungierende Körperzustand von einer entsprechenden Denkweise begleitet und ergänzt: rasch und ideenreich, wenn sich der Körperzustand im positiven und angenehmen Bereich des Spektrums befindet, langsam und repetitiv, wenn er in den unangenehmen Bereich driftet.
So gesehen, sind Empfindungen Sensoren für die Kongruenz oder die fehlende Kongruenz zwischen Natur und Umständen. Und unter Natur verstehe ich sowohl die Natur, die wir als Paket genetisch vermittelter Anpassungsfertigkeiten geerbt haben, als auch die Natur, die wir im Zuge unserer individuellen Entwicklung durch bewußte und gewollte, aber auch unbewußte und unbeabsichtigte Interaktionen mit unserer sozialen Umwelt erworben haben. Empfindungen sind kein Luxus, sowenig wie die Gefühle, von denen sie sich herleiten. Sie dienen der inneren Orientierung, und sie stellen eine Verbindung zwischen uns und anderen Signalen her, die ebenfalls richtungweisend sein können. Und Empfindungen sind weder unbegreifbar noch undefinierbar. Im Gegensatz zur herkömmlichen wissenschaftlichen Auffassung sind Empfindungen ebenso kognitiv wie andere Wahrnehmungsinhalte. Sie sind das Ergebnis eines höchst merkwürdigen physiologischen Arrangements, welches das Gehirn in das faszinierte Auditorium des Körpers verwandelt hat.
Dank den Empfindungen können wir einen Blick auf den Organismus in voller biologischer Aktion, auf die Lebensmechanismen bei der Arbeit werfen. Hätte der Mensch nicht die Möglichkeit, Körperzustände zu empfinden, die genetisch als unangenehm oder angenehm definiert sind, gäbe es in seinem Leben kein Leid und keine Seligkeit, keine Sehnsucht und kein Erbarmen, keine Tragödie und keinen Ruhm.
Auf den ersten Blick mag diese Auffassung von der menschlichen Seele nicht unmittelbar einleuchtend oder tröstlich erscheinen. Bei dem Versuch, Licht auf die komplexen Phänomene des menschlichen Geistes zu werfen, laufen wir Gefahr, sie lediglich zu banalisieren und fortzuerklären. Allerdings wird das nur geschehen, wenn wir ein Phänomen selbst mit den einzelnen Bestandteilen und Operationen verwechseln, die wir hinter dem Erscheinungsbild entdecken können. Das liegt keineswegs in meiner Absicht.
Die Entdeckung, daß eine bestimmte Empfindung von der Aktivität zahlreicher spezifischer Gehirnsysteme abhängt, die mit einer Reihe von Körperorganen interagieren, tut dieser Empfindung in ihrem Rang als menschlichem Phänomen keinen Abbruch. Weder die Seelenpein noch die Hochstimmung, die Liebe oder Kunst in uns wachzurufen vermögen, werden gemindert, wenn wir einige der unzähligen biologischen Prozesse verstehen, die sie zu dem machen, was sie sind. Genau das Gegenteil sollte der Fall sein: Angesichts der komplizierten Mechanismen, die dies magische Geschehen ermöglichen, müßte sich unser Staunen vertiefen. Empfindungen bilden die Grundlage dessen, was Menschen seit Jahrtausenden als Seele bezeichnen.
Noch ein drittes und verwandtes Thema hat dieses Buch: daß der Körper, wie er im Gehirn repräsentiert ist, möglicherweise das unentbehrliche Bezugssystem für die neuronalen Prozesse bildet, die wir als Bewußtsein erleben; daß unser eigener Organismus und nicht irgendeine absolute äußere Realität den Orientierungsrahmen abgibt für die Konstruktionen, die wir von unserer Umgebung anfertigen, und für die Konstruktion der allgegenwärtigen Subjektivität, die wesentlicher Bestandteil unserer Erfahrung ist; daß sich unsere erhabensten Gedanken und größten Taten, unsere höchsten Freuden und tiefsten Verzweiflungen den Körper als Maßstab nehmen.
So überraschend es klingen mag, unser Geist existiert in und für einen integrierten Organismus. Er wäre nicht, was er ist, erwüchse er nicht aus der Wechselbeziehung zwischen Körper und Gehirn während der Evolution, während der individuellen Entwicklung und im gegenwärtigen Augenblick. Um überhaupt zu existieren, mußte es dem Geist zuerst um den Körper gehen. Nur dank des Orientierungsrahmens, den der Körper fortwährend liefert, kann sich der Geist dann auch anderen Dingen zuwenden, realen und imaginären.
Dieser Gedanke findet seinen Niederschlag in folgenden Aussagen: 1. Das menschliche Gehirn und der restliche Körper bilden einen unauflöslichen Organismus, integriert durch wechselseitig aufeinander einwirkende biochemische und neuronale Regelkreise (zu denen unter anderem das Hormon-, das Immun- und das autonome Nervensystem gehören). 2. Der Organismus befindet sich als Ganzes in Wechselwirkung mit seiner Umwelt, in einem Prozeß, den weder der Körper allein noch das Gehirn allein bestimmt. 3. Die physiologischen Operationen, die wir Geist nennen, entstammen der Gesamtheit der strukturellen und funktionellen Organisation und nicht dem Gehirn allein: Geistige Phänomene lassen sich nur dann ganz verstehen, wenn wir die Wechselwirkung des Organismus mit seiner Umwelt einbeziehen. Daß die Umwelt zum Teil erst aus der Aktivität des Organismus entsteht, unterstreicht nur, wie komplex die Wechselwirkungen sind, die wir berücksichtigen müssen.
Es ist nicht üblich, von Organismen zu reden, wenn es um Gehirn und Geist geht. Geist erwächst so offenkundig aus der Aktivität von Neuronen, daß man nur das Verhalten von Neuronen erörtert, als vollziehe es sich unabhängig vom Rest des Organismus. Nun habe ich aber bei der Untersuchung von Gedächtnis-, Sprach- und Denkstörungen zahlreicher hirngeschädigter Personen die feste Überzeugung gewonnen, daß geistige Aktivität in ihren einfachsten und höchsten Ausprägungen nicht nur auf das Gehirn, sondern auch auf den restlichen Körper angewiesen ist. Ich glaube, daß der Restkörper für das Gehirn mehr leistet als nur Unterstützung und Modulation: Er ist ein Grundthema für Repräsentationen im Gehirn.
Es gibt Daten, die für diese Annahme sprechen, Gründe, die sie plausibel erscheinen lassen, und Gründe, die wünschenswert machen, daß sich die Dinge tatsächlich so verhielten. Zu letzteren gehört vor allem, daß die hier vorgeschlagene Priorität des Körpers eine der schwierigsten Fragen erhellen könnte, mit denen sich der Mensch herumschlägt, seit er angefangen hat, über sich selbst nachzudenken: Wie kommt es, daß wir uns der Welt um uns her bewußt sind, daß wir wissen, was wir wissen, und daß wir wissen, daß wir etwas wissen?
Aus Sicht der oben dargelegten Hypothese beruhen Liebe, Haß und Schmerz, Eigenschaften wie Freundlichkeit und Grausamkeit, die planvolle Lösung eines wissenschaftlichen Problems oder die Entwicklung eines neuen Gebrauchsgegenstands alle auf neuronalen Ereignissen im Gehirn, vorausgesetzt, das Gehirn stand und steht in Wechselbeziehung zum Körper. Die Seele atmet durch den Körper, und Leiden findet im Fleisch statt, egal, ob es in der Haut oder in der Vorstellung beginnt.
Das vorliegende Buch schrieb ich als Beitrag zu einem Gespräch mit einem wißbegierigen, intelligenten und wachen imaginären Freund, der wenig über Neurowissenschaft, aber viel über das Leben wußte. Wir hatten eine Vereinbarung getroffen: Von dem Gespräch wollten wir beide profitieren. Mein Freund sollte etwas übers Gehirn und die geheimnisvollen geistigen Vorgänge erfahren, und ich sollte tiefere Einsicht gewinnen, während ich mich zu erklären bemühte, was es nach meiner Auffassung mit Körper, Gehirn und Geist auf sich hat. Wir waren übereingekommen, das Gespräch nicht zu einem langweiligen Vortrag ausarten zu lassen, uns nicht zu streiten und nicht zuviel zu behandeln. Über bewiesene Tatsachen wollte ich sprechen, über Daten, an denen noch Zweifel bestanden, und über Hypothesen, auch wenn ich nur vage Anhaltspunkte für sie ins Feld zu führen vermochte. Ich wollte ihm Einblick in meine gegenwärtige Arbeit gewähren, in einige Forschungsprojekte, die damals gerade durchgeführt wurden, und in Arbeiten, die erst in Angriff genommen werden sollten, lange nachdem unser Gespräch vorüber war. Auch waren wir uns darüber einig, daß es, wie es sich für ein Gespräch geziemt, Umwege und Abschweifungen geben würde, auch Abschnitte, die beim erstenmal unklar bleiben würden und auf die man deshalb würde zurückkommen müssen. Aus diesem Grund werden Sie es hin und wieder erleben, daß ich einige Themen aus veränderter Sicht wieder aufgreife.
Von Anfang an machte ich meine Auffassung über die Grenzen der Wissenschaft klar: Ich bin skeptisch in bezug auf ihren Objektivitätsanspruch. Mir fällt es schwer, in wissenschaftlichen Ergebnissen, vor allem auf dem Gebiet der Neurobiologie, etwas anderes als vorläufige Annäherungen zu sehen, an denen wir uns eine Zeitlang erfreuen können, die wir aber aufgeben müssen, sobald bessere Erklärungen zur Verfügung stehen. Doch Skepsis gegenüber dem augenblicklichen Stand wissenschaftlicher Erkenntnis schmälert nicht die Begeisterung für den Versuch, die vorläufigen Annäherungen zu verbessern.
Vielleicht ist der menschliche Geist so komplex, daß wir das Problem infolge der uns angeborenen Grenzen nie lösen können. Vielleicht sollten wir gar nicht von einem Problem sprechen, sondern von einem Geheimnis, und damit eine Unterscheidung vornehmen zwischen Fragen, die sich wissenschaftlich klären lassen, und Fragen, die dem wissenschaftlichen Zugriff wahrscheinlich für immer entzogen bleiben.3 Doch sosehr ich auch mit denen sympathisiere, die sich nicht vorstellen können, daß das Geheimnis jemals gelöst wird (»Mysterianer« – mysterians – hat man sie genannt4), und soviel Verständnis ich für alle habe, die zwar meinen, daß das Problem unserer Erkenntnis zugänglich ist, aber enttäuscht wären, wenn die Erklärung auf bereits bekannte Dinge zurückgriffe, bin ich doch – meistens jedenfalls – davon überzeugt, daß wir das Rätsel lösen werden.
Mittlerweile sind Sie wahrscheinlich zu dem Schluß gelangt, daß es in unserem Gespräch zwar um Geist, Gehirn und Körper ging, aber weder um Descartes noch um die Philosophie. Mein Freund machte den Vorschlag, es unter dem Patronat des französischen Philosophen zu führen, da es keine Möglichkeit gäbe, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ohne die Symbolfigur zu beschwören, der wir die bekannteste Auffassung über das Verhältnis von Geist und Körper verdanken. Da wurde mir klar, daß dieses Buch auf eine merkwürdige Weise von Descartes’ Irrtum handeln würde. Natürlich möchten Sie wissen, was es mit diesem Irrtum auf sich hat, doch im Augenblick bin ich noch zu Stillschweigen verpflichtet. Aber keine Sorge, Sie werden es erfahren.
Damit begann sich unser Gespräch seinem eigentlichen Thema zuzuwenden, zunächst dem seltsamen Leben und Tun des Phineas Gage.
Erster Teil
1. KAPITEL
Verhängnis in Vermont
Phineas P. Gage
Es ist Sommer 1848. Wir befinden uns in Neuengland. Aus heiterem Himmel schickt sich das Verhängnis an, Phineas P. Gage, einen vielversprechenden jungen Mann von fünfundzwanzig Jahren, Vorarbeiter bei einer Eisenbahngesellschaft, zugrunde zu richten. Anderthalb Jahrhunderte später wird sein Schicksal die Menschen immer noch beschäftigen.
Gage arbeitet für Rutland & Burlington Railroad und trägt die Verantwortung für einen großen Bautrupp, »Gang« genannt, der die Aufgabe hat, neue Bahngleise durch Vermont zu verlegen. Während der letzten zwei Wochen haben sich die Männer langsam auf die Stadt Cavendish zubewegt und sind nun ans Ufer des Black River gelangt. Die Arbeit ist keineswegs einfach, da das Gelände von harten Gesteinsschichten durchzogen ist. Statt die Schienen in Windungen und Kurven um jede Anhebung herumzuführen, sprengt man den Fels, wo es für eine gerade und ebene Trassenführung erforderlich ist. Diese Arbeiten beaufsichtigt Gage, eine Aufgabe, der er bestens gewachsen ist. Die Bewegungen des ein Meter siebzig großen und athletisch gebauten Mannes sind rasch und exakt. Er sieht aus wie der junge Jimmy Cagney, ein Yankee Doodle Dandy, der in Stepschuhen über Schwellen und Schienen tanzt, kraftvoll und anmutig in seinen Bewegungen.
In den Augen seiner Vorgesetzten ist Gage jedoch mehr als nur ein brauchbarer Vorarbeiter. Nach ihrer Einschätzung ist er der »tüchtigste und fähigste Mann« ihres Unternehmens.1 Und das ist gut so, denn er braucht für seine Aufgabe ein hohes Maß an körperlicher Gewandtheit und Geistesgegenwart, besonders wenn Sprengungen vorzubereiten sind. Dabei müssen einige Maßnahmen in strenger Reihenfolge ausgeführt werden. Zuerst bohrt man ein Loch in den Fels. Das wird zur Hälfte mit Sprengpulver gefüllt, mit einer Zündschnur versehen und mit Sand zugestopft. Dazu wird der Sand mit kräftigen Stößen einer Eisenstange »festgestampft«. Schließlich muß die Zündschnur in Brand gesetzt werden. Wenn alles wie geplant verläuft, explodiert das Pulver in den Fels hinein. Der Sand ist wichtig, weil die Explosionsenergie ohne seinen Schutz vom Felsen fortstreben würde. Auch die Form der Eisenstange und ihre Handhabung spielen dabei eine Rolle. Gage führt seinen Eisenstab, den er sich nach eigenen Angaben hat anfertigen lassen, mit virtuoser Fertigkeit.
Doch wenden wir uns nun dem eigentlichen Geschehen zu. Halb fünf ist es, ein heißer Nachmittag. Gerade hat Gage Pulver und Zündschnur in einem Bohrloch verstaut und seinen Helfer aufgefordert, das Ganze mit Sand abzudecken. Da ruft jemand von hinten, und Gage blickt einen Augenblick lang über seine rechte Schulter zurück. Dadurch abgelenkt, beginnt er, noch bevor sein Helfer Sand eingefüllt hat, den Sprengstoff direkt mit der Eisenstange zu bearbeiten. Augenblicklich schlägt er Funken aus dem Felsen, und die Sprengladung explodiert ihm ins Gesicht.2
So gewaltig ist die Explosion, daß der gesamte Bautrupp schreckensstarr verharrt. Deshalb brauchen die Leute ein paar Sekunden, um zu erfassen, was vor sich gegangen ist. Der Knall war ungewöhnlich, und der Fels ist unversehrt geblieben. Ungewöhnlich ist auch das pfeifende Geräusch, wie von einer Rakete, die in den Himmel geschossen wird. Doch das hier ist mehr als Feuerwerk. Es ist Gewalt und schwerste Körperverletzung. Die Eisenstange tritt durch Gages linke Wange ein, durchbohrt die Schädelbasis, durchquert den vorderen Teil seines Gehirns und tritt mit hoher Geschwindigkeit aus dem Schädeldach aus. In einer Entfernung von mehr als dreißig Metern fällt die Stange herunter, mit Blut und Hirngewebe bedeckt. Phineas Gage ist zu Boden geworfen worden. Da liegt er in der Nachmittagshitze, benommen und stumm, aber wach. Und benommen und stumm sind wir alle, die hilflosen Beobachter.
»Schrecklicher Unfall« lautet eine Woche später, am 20. September, die wenig originelle Schlagzeile in den Bostoner Zeitungen Daily Courier und Daily Journal. Etwas merkwürdig titelt der Vermont Mercury am 22. September: »Wunderbarer Unfall«, während es im Boston Medical and Surgical Journal schlicht und sachlich heißt: »Kopf von Eisenstange durchschlagen«. Liest man, wie nüchtern die Berichterstatter den Vorgang schildern, so könnte man meinen, sie wären mit Edgar Allan Poes absonderlichen und schrecklichen Erzählungen vertraut gewesen. Und vielleicht waren sie es auch, obwohl es nicht sehr wahrscheinlich ist. Seine schauerlich-romantischen Geschichten sind noch nicht sehr bekannt. Erst im folgenden Jahr wird Poe unbekannt und mittellos sterben. Möglicherweise liegt das Schreckliche einfach in der Luft.
Nachdem der Verfasser des medizinischen Artikels erwähnt hat, wie überrascht die Augenzeugen waren, daß Gage nicht auf der Stelle getötet wurde, schildert er, daß »der Patient unmittelbar nach der Explosion auf den Rücken geschleudert wurde«, daß er kurz darauf »ein paar konvulsive Bewegungen der Extremitäten« zeigte und »nach ein paar Minuten sprach«, »daß seine Männer [bei denen er sehr beliebt war] ihn hochhoben und zur Straße trugen, die nur einige Rod entfernt war [ein Rod entspricht 51/2 Yard oder 161/2 Fuß, also fünf Metern], daß sie ihn auf einen Ochsenwagen hoben, auf dem er, aufrecht sitzend, mehr als einen Kilometer zum Hotel von Mr. Joseph Adams zurücklegte«, und daß Gage »selbst vom Wagen herunterstieg, nur ein wenig gestützt von seinen Männern«.
Ich möchte Ihnen Mr. Adams vorstellen. Er ist Friedensrichter von Cavendish und Besitzer des einzigen Hotels und Gasthauses der Stadt. Ich stelle ihn mir größer als Gage vor und doppelt so dick; er ist so ängstlich besorgt, wie seine Falstaffschen Formen vermuten lassen. Nach einem Blick auf Gage schickt er sofort nach Dr. John Harlow, einem der Ärzte der Stadt. Ich stelle mir vor, daß er, während sie warten, sagt: »Oh, oh, Mr. Gage, was haben wir denn da bloß?« Und vielleicht: »Nein, nein, wie ist das alles furchtbar.« In ungläubigem Entsetzen schüttelt er den Kopf und führt Gage in den Schatten der Hotelveranda, die einer der Zeugen als piazza bezeichnen wird, was im Amerikanischen zwar auch »Veranda« heißt, aber doch den Eindruck eines geräumigen und offenen Platzes vermittelt. Geräumig und groß ist sie vielleicht, aber nicht offen, eben eine ganz gewöhnliche Veranda. Und dort bekommt Phineas Gage jetzt von Mr. Adams Limonade oder vielleicht auch kalten Apfelwein vorgesetzt.
Seit der Explosion ist eine Stunde vergangen. Die Sonne steht inzwischen tiefer, und die Hitze ist erträglicher geworden. Bald darauf trifft Dr. Edward Williams ein, ein jüngerer Kollege von Dr. Harlow. Jahre später wird Dr. Williams den Anblick beschreiben, der sich ihm bietet: »Bei meinem Eintreffen saß er auf einem Stuhl auf der piazza von Mr. Adams’ Hotel in Cavendish. Als ich vorfuhr, sagte er: ›Hier gibt es reichlich für Sie zu tun, Doktor.‹ Bevor ich von meiner Kutsche stieg, bemerkte ich die Wunde auf dem Kopf und sah deutlich das Pulsieren des Gehirns. Außerdem nahm ich ein Phänomen wahr, das ich mir nicht erklären konnte, bevor ich den Kopf untersucht hatte: Das Schädeldach hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit einem umgekehrten Trichter. Wie ich später entdeckte, hing das damit zusammen, daß der Knochen rund um die Öffnung auf eine Entfernung von fünf Zentimetern in alle Richtungen gebrochen war. Ich hätte erwähnen sollen, daß die Öffnung im Schädelknochen und den umgebenden Schichten fast vier Zentimeter im Durchmesser betrug. Die Ränder der Öffnung waren nach außen gestülpt, und die ganze Wunde sah aus, als sei ein keilförmiger Körper von unten nach oben hindurchgegangen. Während ich seine Wunde untersuchte, berichtete Mr. Gage den Umstehenden, wie es zu der Verletzung gekommen war. Er äußerte sich so vernünftig und antwortete so bereitwillig, daß ich meine Fragen an ihn richtete statt an die Männer, die dem Unfall beigewohnt hatten und noch zugegen waren. Daraufhin schilderte mir Mr. G. einige der Umstände, wie er es seither öfter getan hat. Und ich darf getrost behaupten, daß er auf mich weder zu diesem noch zu einem späteren Zeitpunkt, von einem einzigen Mal abgesehen, anders als vollkommen vernünftig wirkte. Der eine Vorfall, auf den ich anspiele, ereignete sich etwa vierzehn Tage nach dem Unfall. Da bestand er darauf, mich John Kirwin zu nennen, beantwortete aber alle meine Fragen zutreffend.«3
Wie erstaunlich es war, daß Gage überlebte, wird klar, wenn man sich Form und Gewicht der Eisenstange vergegenwärtigt. Der Chirurgieprofessor Henry Bigelow von der Harvard University beschreibt das Eisen wie folgt: »Das Eisen, das den Schädel dergestalt durchquert hat, wiegt sechs Kilogramm und zehn Gramm. Es ist einen Meter achtundneunzig Zentimeter lang und hat einen Durchmesser von dreieinachtel Zentimetern. Das zuerst eingedrungene Ende verläuft spitz. Die Verjüngung ist achtzehn Zentimeter lang und die Spitze sechs Millimeter im Durchmesser – Umstände, denen der Patient möglicherweise sein Leben verdankt. Das Eisen weist eine ganz eigene Form auf und wurde von einem Schmied in der Gegend nach den Wünschen des Besitzers angefertigt.«4 Gage nimmt seinen Beruf sehr ernst und wendet große Sorgfalt auf sein Handwerkszeug.
Daß er die Explosion mit einer so gewaltigen Kopfwunde überlebt hat, daß er unmittelbar danach in der Lage war, zu reden, zu gehen und sich vernünftig zu verhalten – das alles ist erstaunlich. Doch ebenso erstaunlich ist, daß er die unvermeidliche Infektion überleben wird, die von seiner Wunde Besitz ergreifen muß. Sein Arzt John Harlow weiß sehr wohl, wie wichtig eine gründliche Desinfektion ist. Zwar stehen ihm keine Antibiotika zur Verfügung, doch unter Zuhilfenahme aller chemischen Stoffe, die in Frage kommen, reinigt er die Wunde gründlich und regelmäßig, wobei er den Patienten eine halb liegende Position einnehmen läßt, so daß die Drainage natürlich und mühelos vonstatten geht. Trotzdem bekommt Gage hohes Fieber und mindestens einen Abszeß, den Harlow sofort mit dem Skalpell entfernt. Am Ende gewinnen Gages Jugend und kräftige Natur gegen alle Wahrscheinlichkeit die Oberhand, unterstützt, wie Harlow es ausdrücken wird, von göttlichem Wirken: »Ich habe ihn behandelt, Gott hat ihn geheilt.«
In weniger als zwei Monaten wird Phineas Gage für geheilt erklärt. Doch dieser erstaunliche Vorgang verblaßt vor dem Hintergrund der erstaunlichen Wandlung, die Gages Persönlichkeit erleben wird. Seine ganze Veranlagung, seine Vorlieben und Abneigungen, seine Träume und Hoffnungen – alles wird sich verändern. Gages Körper mag lebendig und wohlauf sein, aber er wird von einem neuen Geist belebt.
Gage war nicht mehr Gage
Was im einzelnen passierte, können wir uns heute aus dem Bericht zusammenreimen, den Dr. Harlow zwanzig Jahre nach dem Unfall anfertigte.5 Es handelt sich um einen zuverlässigen Text mit einer Fülle von Fakten und einem Minimum an Interpretation. Menschlich und neurologisch macht er einen plausiblen Eindruck, und wir gewinnen aus ihm nicht nur eine Vorstellung von Gage, sondern auch von seinem Arzt. John Harlow war Lehrer gewesen, bevor er ans Jefferson Medical College in Philadelphia ging, und er übte den Arztberuf erst wenige Jahre aus, als Gage sein Patient wurde. Der Fall nahm sein ganzes Interesse in Anspruch und weckte in Harlow, wie ich vermute, den Wunsch nach wissenschaftlicher Betätigung – was nicht unbedingt in seiner Absicht gelegen haben wird, als er seine ärztliche Praxis in Vermont eröffnete. Daß er Gage erfolgreich behandelt hatte und seinen Bostoner Kollegen von diesem Ergebnis berichten konnte, dürfte zu den glanzvollsten Höhepunkten seiner Laufbahn gezählt haben. Um so mehr wird es ihn betrübt haben, daß Gages Heilung von einer dunklen Wolke überschattet war.
In seinem Bericht schildert Harlow, wie Gage wieder zu Kräften kam und wie vollständig seine physische Genesung war. Gage konnte fühlen, hören und sehen und litt unter keinerlei Lähmung der Gliedmaßen oder der Zunge. Zwar konnte er mit dem linken Auge nicht mehr sehen, dafür aber war das rechte vollkommen in Ordnung. Sein Gang war sicher, die Bewegung der Hände geschickt, und er hatte keine erkennbaren Schwierigkeiten mit Artikulation und Sprache. Und doch war gewissermaßen, wie Harlow berichtet, das »Gleichgewicht zwischen seinen geistigen Fähigkeiten und seinen animalischen Neigungen« gestört. Sichtbar wurden diese Veränderungen, sobald die akute Phase seiner Hirnverletzung abklang. Er ist jetzt »launisch, respektlos, flucht manchmal auf abscheulichste Weise, was früher nicht zu seinen Gewohnheiten gehörte, erweist seinen Mitmenschen wenig Achtung, reagiert ungeduldig auf Einschränkungen und Ratschläge, wenn sie seinen Wünschen zuwiderlaufen, ist gelegentlich entsetzlich halsstarrig, und doch launenhaft und wankelmütig, macht ständig Zukunftspläne, die er, kaum gefaßt, schon wieder fallenläßt … Während er sich in seinen geistigen Fähigkeiten und Äußerungen auf der Entwicklungsstufe eines Kindes befindet, hat er doch die animalischen Leidenschaften eines starken Mannes.« Seine Ausdrucksweise war so gemein und abscheulich, daß man Frauen aus Rücksicht auf ihr Feingefühl riet, nicht zu lange in seiner Gegenwart zu verweilen. Auch die strengsten Vorhaltungen von Dr. Harlow vermochten unser Unfallopfer nicht zu einem besseren Benehmen zu bekehren.
Diese neuen Persönlichkeitszüge standen in krassem Gegensatz zur »Mäßigung« und »auffallenden Charakterstärke«, die man vor dem Unfall an Phineas Gage beobachtet hatte. Damals hatte er sich durch »besonnene Wesensart ausgezeichnet und galt bei den Menschen, die ihn kannten, als gerissener, kluger Geschäftsmann, der alle seine Pläne energisch und ausdauernd in die Tat umsetzte«. Zweifellos durfte er, gemessen an seiner Stellung und seiner Zeit, als erfolgreich gelten. Die Wandlung, die er erfuhr, war so tiefgreifend, daß ihn Freunde und Bekannte kaum wiedererkannten. Traurig stellten sie fest, daß »Gage nicht mehr Gage war«. Der Mann hatte sich so grundlegend verändert, daß ihn die Eisenbahngesellschaft nicht weiterbeschäftigte, als er seine Arbeit wiederaufnehmen wollte. Dort hielt man nämlich »seine Wesensveränderung für so ausgeprägt, daß man ihn nicht in seiner Stellung belassen konnte«. Also lag das Problem dabei nicht in seiner körperlichen Verfassung oder Fertigkeit, sondern in seinem neuen Charakter.
Rapide setzte sich der Abstieg fort. Da Gage für die Arbeit als Vorarbeiter nicht mehr taugte, nahm er Stellungen auf Pferdefarmen an. Man muß annehmen, daß er immer wieder aus einer Laune heraus kündigte oder wegen Disziplinlosigkeit entlassen wurde. Wie Harlow anmerkt, besaß er eine besondere Begabung, »stets Stellungen zu finden, für die er sich nicht eignete«. Dann begann seine Laufbahn als Zirkusattraktion. Gage trat in Barnums Museum in New York City auf, wo er prahlerisch seine Narben und das Stopfeisen zur Schau stellte. (Harlow berichtet, von der Eisenstange habe er sich nie mehr getrennt, und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß er eine große Anhänglichkeit gegenüber Gegenständen und Tieren bewies – ein neuer und etwas ungewöhnlicher Zug. Dieses Merkmal, man könnte es »Sammlerverhalten« nennen, habe ich öfter an Patienten mit ähnlichen Verletzungen und an Autisten beobachtet.)
In weit höherem Maße als heute machte sich der Zirkus damals die Grausamkeiten der Natur zunutze. Zu den endokrinen Sensationen zählten Zwerge, die dickste Frau der Erde, der größte Mann, der Mensch mit dem größten Kiefer, zu den neurologischen Schauobjekten Jugendliche mit Elefantenhaut, Opfer der Neurofibromatose – und jetzt Gage. Unschwer kann man ihn sich in solch Fellinischer Gesellschaft vorstellen, bemüht, sein Elend zu Geld zu machen.
Zehn Jahre nach dem Unfall folgte der nächste Theatercoup. Gage ging nach Südamerika. Zunächst arbeitete er wieder auf Pferdegütern, dann wurde er Postkutscher in Santiago de Chile und Valparaíso. Von seinem Leben in der Fremde ist wenig bekannt, nur daß sich 1859 sein Gesundheitszustand verschlechterte.
1860 kehrte Gage in die Vereinigten Staaten zurück und lebte bei Mutter und Schwester, die inzwischen nach San Francisco gezogen waren. Anfangs bekam er eine Anstellung auf einer Farm in Santa Clara, hielt es dort aber nicht lange aus. Er zog viel umher und fand schließlich eine Beschäftigung als Arbeiter in der weiteren Umgebung von San Francisco. Zweifellos hatte er seine Unabhängigkeit verloren und war nicht mehr in der Lage, den Anforderungen einer so langfristigen und gutbezahlten Stellung gerecht zu werden, wie er sie einst gehabt hatte. Das Ende der traurigen Geschichte kündigte sich an.
Das San Francisco in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts stelle ich mir als überaus geschäftige Stadt vor, voller waghalsiger Unternehmer, die ihr Glück im Bergbau, in der Landwirtschaft und in der Schiffahrt versuchten. Dort finden wir Gages Mutter und Schwester, letztere mit einem wohlhabenden Kaufmann am Ort verheiratet (D. D. Shattuck, Esq.), und dort hätte wohl auch der gute Phineas Gage hingehört. Doch antreffen würden wir ihn ganz woanders, wenn wir in der Zeit zurückreisen könnten. Trinkend und krakeelend würden wir ihm in einem übel beleumdeten Viertel begegnen, wo er nicht gerade mit den Wirtschaftskapitänen verkehrt, die genauso überrascht sind wie alle anderen, als die Erde sich auftut und bedrohlich erschüttert wird. Er hat sich jener Schar von Gestrandeten angeschlossen, die, wie Nathanael West es Jahrzehnte später und ein paar hundert Kilometer weiter südlich ausdrücken sollte, »nach Kalifornien gekommen waren, um zu sterben«.6
Aus den wenigen Zeugnissen, die vorliegen, geht hervor, daß Gage epileptische Anfälle bekam. Der Tod ereilte ihn am 21. Mai 1861 nach einer Krankheit, die wenig mehr als einen Tag dauerte. Gage hat einen heftigen Krampfanfall, bei dem er das Bewußtsein verlor. Darauf folgten eine Reihe von weiteren Krämpfen unmittelbar nacheinander. Er kam nicht wieder zu sich. Nach meiner Ansicht fiel er einem Status epilepticus zum Opfer, bei dem Dauerkrämpfe zum Tode führen. Achtunddreißig Jahre war er alt. In den Zeitungen von San Francisco wurde sein Tod nicht erwähnt.
Warum Phineas Gage?
Was macht diese traurige Geschichte erzählenswert? Welche Bedeutung kann das seltsame Geschehen für uns haben? Die Antwort ist einfach. Während andere Fälle neurologischer Schädigung, die sich etwa zur gleichen Zeit ereigneten, deutlich machten, daß das Gehirn für Sprache, Wahrnehmung und motorische Funktionen verantwortlich ist, und während sie aufschlußreichere Einzelheiten lieferten, ließ Gages Geschichte einen erstaunlichen Umstand erkennen: Offenbar gibt es Systeme im menschlichen Gehirn, die mehr mit dem Denken, vor allem mit seinen persönlichen und sozialen Dimensionen, befaßt sind als mit anderen Tätigkeiten. Wie dieser Fall zeigt, können infolge einer Hirnschädigung soziale Konventionen und moralische Regeln ihre Verbindlichkeit verlieren, ohne daß allem Anschein nach grundlegende geistige und sprachliche Fertigkeiten beeinträchtigt sind. Gages Beispiel zeigte, daß Teile des Gehirns für spezifisch menschliche Eigenschaften zuständig sind, unter anderem für die Fähigkeit, die Zukunft vorwegzunehmen und sie in einem komplexen sozialen Umfeld angemessen zu planen, für das Verantwortungsgefühl sich selbst und anderen gegenüber und für das Vermögen, das eigene Überleben nach Maßgabe des freien Willens zu organisieren.





























