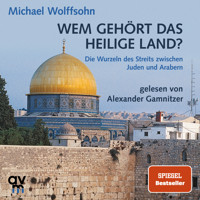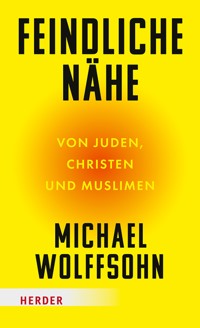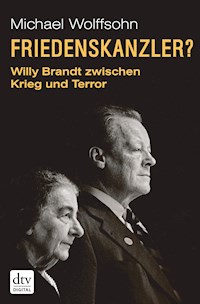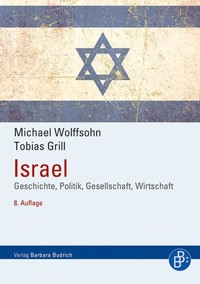10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Bestseller jetzt im Taschenbuch Als Glückskinder oder fast Glückskinder – denn sie hatten alles verloren außer dem Leben – können die Mitglieder der weitverzweigten Familie Wolffsohn bezeichnet werden, die dem Holocaust entkommen sind, nach Palästina, später Israel, oder in andere Gegenden der Welt. Einige kehrten sogar nach Deutschland zurück, trotz allem, so wie Michael Wolffsohns Großvater Karl Wolffsohn mit seiner Frau Recha. Was sie erlebten, wie sie vorher, im Exil und nachher lebten und liebten, wie ihr Erleben Kinder und Kindeskinder prägte, davon erzählt Michael Wolffsohn pointiert und ohne jede Schönfärberei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Michael Wolffsohn
Deutschjüdische Glückskinder
Eine Weltgeschichte meiner Familie
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Mit Bildteil und einem Nachwort zur Taschenbuchausgabe
GEDANKEN ZU ERINNERUNGEN
Bin ich mit diesem Anspruch vermessen? Ich denke nein und kann es begründen. Wie jede Familie in der Welt ist auch Familie Wolffsohn Teil der Welt. Wie nicht gar so viele Familien, doch besonders jüdische und noch mehr deutschjüdische, ist sie über die ganze Welt verstreut. Eher unfreiwillig als freiwillig.
Und so ist die Wolffsohn’sche Familiengeschichte tatsächlich auch Weltgeschichte. Nicht »die« Weltgeschichte, aber doch – wenn auch nur ein kleiner – Teil »der« Weltgeschichte. Wir haben keine Weltgeschichte gestaltet oder geprägt. Vielmehr hat die Geschichte uns geprägt.
Wolffsöhne haben, wie Abermillionen Menschen, Geschichte erlebt, erliebt, erlitten. In diesem Buch versuche ich das Wechselspiel von großer Welt, kleiner Welt, Außenwelt und Innenwelt nachvollziehbar zu machen. Diese Geschichte, liebe Leser, hätte auch Ihre Geschichte sein können. Wir alle werden ins Zufällige hineingeboren. Jeder wird in diese oder jene Nation, in diese oder jene Geburtsraumgemeinschaft hineingeboren. Nation kommt von »natus«, geboren. Viele verwechseln dieses Teil- und So-Sein, ihre Welt, mit dem Ganzen.
Dies ist keine Opfer- und Unglücks-, sondern eine Glücksgeschichte. Oder sagen wir lieber: fast eine Glücksgeschichte. Nicht einmal fast alle werden diese Geschichte und Geschichten »glücklich« nennen. Sie werden jedoch vielleicht nicht umhin können, den einen oder anderen neuen Gedanken oder Eindruck über Glück und Unglück sowie, o ja, Deutsche und Juden, überhaupt Kollektiv und Individuum nachzuvollziehen oder gar selbst zu entwickeln.
Auch von guten Deutschen wird hier erzählt. Sogar von dem einen oder anderen jüdischen Schlitzohr, um keine gröberen Ausdrücke zu gebrauchen. Selig- und Heiligsprechungen kann ich nicht versprechen.
Während Millionen anderer Juden ermordet wurden, auch Angehörige, Geliebte, Freunde und Bekannte, ging das Alltagsleben der Wolffsohns und anderer jüdischer Flüchtlinge, die sich nach Palästina retten konnten, sozusagen normal weiter. Üppig war es nicht, meist arg karg, aber trotzdem oft sehr schön. Nicht nur in der Erinnerung. Die Sonne strahlte, der Strand lockte, es wurde gelebt und geliebt. Ja, so sagte mir meine Mutter vor einigen Jahren, wir »hatten gehört, was da Schreckliches an den Juden Europas verbrochen wurde, aber so genau wollten wir es, ehrlich gesagt, gar nicht wissen. Wir waren, so grausam und unmoralisch es klingt und ist, glücklich.«
In gut deutschjüdischer Tradition hatte sie ein Zitat »zur Hand«, Prediger Salomonis (8, 15), das sie sogar als »Resümee« ihres Lebens bezeichnete: »Wer ist glücklich? ›Der, der sich über seinen Teil freut.‹ Und da habe ich allen Grund, zufrieden und glücklich zu sein.«
Ganz korrekt zitiert hat meine Ima (= Mutter) nicht. Der vermeintliche Autor, König Salomon, pries an jener Stelle als einzig wahre (Lebens-)Freude (gutes) »Essen, Trinken und Freude«. »Freude« (Simcha) wird durch »Freude« erklärt, was die Interpretation nicht gerade erleichtert. Raschi (1040–1105), der bis heute einflussreichste Kommentator, erklärt es so: Glücklich sei, wer mit seinem Teil zufrieden. Meine Mutter liefert automatisch den Kommentar mit. Von wem ich das wohl habe? »Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme.«
Wie für die Überlebenden im »Volk der Täter« ging es nach der Katastrophe auch für die Überlebenden im »Volk der Opfer« aufwärts. Langsam, aber eben doch aufwärts. Glückskinder?
Ja und nein. Die Dialektik ist so alt wie das Nachdenken und Nacherzählen der Menschen über die Menschheit. Sie entspricht der Schöpfungslogik: Heiliges neben Profanem, Gutes neben Schlechtem, Helles neben Dunklem, Sabbatruhe einerseits und Hektik der Werktage andererseits. Sind deutsche Juden, wie die Wolffsohns, Holocaust-Überlebende? Ja und nein. Dazu wieder meine, wenngleich nicht intellektuelle, doch selbstkritische und (manchmal) selbstironische Mutter in ihrem Lebensherbst, im Februar 2015: »Ich fühlte mich eigentlich nie als Überlebende der Schoah, sondern als Israelin und in Berlin als Deutsch-Israelin. Ehrlich gesagt hab ich mich bis jetzt nie mit dieser Frage beschäftigt. Das ist sicher ein Zeichen meiner Oberflächlichkeit.« Ist das wirklich oberflächlich? Es ist ihre subjektive Wahrheit.
Objektiv ist meine Mutter sehr wohl Holocaust-Überlebende, denn sie hat den Holocaust überlebt; nicht in Auschwitz oder einer anderen Hölle, sondern in der Hitze Palästinas. Das Wo besagt viel über das Wie, es ändert nichts am Dass.
Bekannt, relevant und umstritten ist der Begriff »zweite Generation Holocaust-Überlebender«. Hier sollte ebenfalls zwischen der subjektiven und objektiven Wirklichkeit (nicht zu verwechseln mit Wahrheit) der Einzelnen unterschieden werden. Subjektiv fühle ich mich, meiner Mutter in der ersten Generation vergleichbar, nicht als zweite Generation der Opfernachfahren. Objektiv ist an dieser Wirklichkeit nicht zu rütteln. In manchen Situationen führte meine subjektive Sicht zu grotesken Reaktionen. Im April 2015, in einer Fernsehgesprächsrunde des Ersten Deutschen Fernsehens, wollte mich Bundesjustizminister Heiko Maas, dritte Generation der Täternachfahren und individuell so wenig Täter wie ich Opfer, belehren, wie ich die ns-deutsche Geschichte aus der Opferperspektive zu betrachten hätte. Dass sich der damals fürs Recht zuständige Minister Maas dieses Recht anmaßte, ging nach meinem unmaßgebenden Geschmack einen Schritt zu weit. Geschichtsmoralisch hatte der Rechtsminister ein krummes Ding gedreht. Ich habe, etwas heftig, seine schiefe Sicht begradigt. Wie gesagt, ich bin nur objektiv und nicht subjektiv Holocaust-Überlebender der zweiten Generation. Ganz anders meine gleichaltrige Freundin R. und mein etwas jüngerer Freund J. Ihre Eltern hatten die NS-Höllen im NS-Machtbereich überlebt. Sie blieben ihr Leben lang hiervon seelisch und körperlich schwerstverwundet, schwerstkrank. Nachts hatten sie oft Albträume und schreckten ihre Kinder auf, tagsüber war ihr Nachleid jedermann erkennbar. An den leidvollen Leidfolgen ihrer Eltern leiden R. und J. noch heute. Das Leid ihrer Eltern ist ihr Leid. Beide sind subjektiv und objektiv Holocaust-Überlebende der zweiten Generation.
Gibt es eine »dritte Generation von Holocaust-Überlebenden«? In schwersttraumatisierten Familien gewiss, wenngleich diesbezügliche Studien aus meiner Sicht noch kein wissenschaftlich schlüssiges Gesamtbild ermöglichen. Und sonst? Die »dritte Generation von HolocaustÜberlebenden« trifft man eher in der deutsch-amerikanisch-jüdischen Wirklichkeit. Erfunden wurde der Begriff nicht von jüdischer, sondern deutscher Seite. Die Erfinder hatten eine auf dem wirtschaftlichen und politischen US-Markt hochwerbewirksame Formel gefunden, eine weltliche Monstranz, mit der sie ihr deutsches Gutsein demonstrieren und ihre Produkte bestens platzieren können. Nach der dritten Generation von Holocaust-Überlebenden dürfte sich der Effekt der Inflation bemerkbar machen.
Die Fast-Glücksgeschichte der erweiterten Familie Wolffsohn endet nicht 1945. Sie führt in die Gegenwart und in eine Zukunft, die – wer weiß? – vielleicht jüdisch ist und vielleicht auch nicht. Ihre deutsch-jüdische oder deutsch-nichtjüdische oder deutsch-teiljüdische Zukunft ist offen. So offen wie die Offene Gesellschaft, denn inzwischen ist die Familie Wolffsohn durch zahlreiche sogenannte Mischehen sowie ihre Lebensweise und Weltsicht längst nicht mehr »rein« jüdisch. Wahrscheinlich, hoffentlich, wird sie bei aller Weltoffenheit inhaltlich nie »judenrein«.
Meine Enkelin Anna ist nicht jüdisch. Als sie zwei Jahre alt war – ihr Wortschatz war noch begrenzt – wünschte sie mir zum Pessachfest in reinstem Hebräisch »chag sameach«, ein frohes Fest. Sollte, konnte, durfte das für mich weniger beglückend sein als wenn es eine jüdische Anna gesagt hätte?
Hat es mich provoziert, dass mir, dreijährig, mein ebenfalls nichtjüdischer Enkel Noah, am ersten Weihnachtsfeiertag begeistert erzählte, am Abend zuvor sei »der echte Weihnachtsmann« gekommen? Beglückt hat mich das Kinderglück.
Zu unserer engsten Familie gehört ein Atheist, der politisch links steht. Er ist ein offener Mensch. Das gilt auch für ein anderes Mitglied unserer Kernfamilie. Sie ist praktizierende Katholikin mit großem Interesse am Judentum und breiten Kenntnissen darüber.
Beide sind, jiddisch gesagt, »a Mentsch« und mir als Menschen lieb. Unter Menschen zählt die Menschlichkeit, nicht ihre politische oder konfessionelle Verortung.
Im doppelten Sinne gibt es auch die deutsch-jüdische Familie Wolffsohn eigentlich nicht mehr. Sie ist längst untergegangen. Das deutsche Judentum ist, die deutschen Juden sind tot. Geflohen, gestorben oder ermordet. Kaum jemand kehrte zurück. Die deutsch-jüdische Familie Wolffsohn ähnelt überlebenden Dinosauriern. Freilich, es gibt heute wieder rund zweihunderttausend Juden in Deutschland. Nur die Hälfte ist zur Mitgliedschaft in den jüdischen Gemeinden bereit.
Es ist kein Werturteil, doch eine geografisch-kulturelle Tatsache: Die heute in Deutschland lebenden Juden haben mit dem traditionellen deutschen Judentum nichts mehr gemein. Der Großteil stammt aus Polen und der Sowjetunion. Sie hatten die nationalsozialistisch-deutschen Vernichtungshöllen überlebt und waren am östlichsten Punkt des Westens gestrandet. Meist mit schlechtem Gewissen vor sich selbst und der jüdischen Mitwelt außerhalb Deutschlands. Dieses schlechte Gewissen hatte keiner der aus Israel zurückkehrenden Wolffsohns.
Die Mehrheit der Juden der frühen Bundesrepublik hatte ein ausschließlich jüdisches Wir-Gefühl, kein deutsches. Das ist aufgrund ihrer Biografie und Kulturgeografie verständlich. Das Wir-Gefühl der Wolffsohns war atypisch. Es war zugleich deutsch und jüdisch und nicht nur diasporajüdisch, sondern nicht zuletzt israelgeprägt jüdisch, aber nicht (mehr) israelisch. Nie klebte es nur am Juden- oder Deutschtum. Offen und offensiv war es.
Einer meiner jüdischen Klassenkameraden in der Westberliner Grundschule (die ich von 1954 bis 1959 besuchte) war Hans, ein anderer Dieter. Jahrzehnte später erfuhr ich ihren richtigen Namen: Oded der eine, David der andere. Der jüdische Pressesprecher einer großen deutschen Bank – wie ich nach 1945 geboren und in der Bundesrepublik aufgewachsen – heißt Siegfried. In allen drei Fällen (es gibt freilich viel mehr) handelten die namensgebenden Eltern defensiv, weil sie, historisch und psychologisch durchaus verständlich, »den« Deutschen misstrauten. Siegfried hieß wirklich Siegfried, weil der Vorname sein jüdisches Sein tarnen sollte. Hans und Dieter trugen eine doppelte Tarnkappe. Ihr Nenn-Vorname sollte sowohl ihren wahren Vornamen als auch ihr wahres Sein verdecken und überdecken. Kein möglicher Judenfeind sollte ihr Judentum entdecken. Der Schein-Vorname der Kinder war Tarnkappe und Schutzpanzer zugleich, weil die traumatisierten Eltern Angst vor Deutschland, genauer: vor »den« Deutschen hatten. Bei den Wolffsohns galt Misstrauen keinem Kollektiv, sondern Individuen. Das eigene Sein und Dasein, ob jüdisch oder nicht, vertrat man offensiv. Wer die Nazizeit in Vernichtungshöllen überlebt hatte, war individuell und kollektiv misstrauischer als die Wolffsohns oder andere Juden, die sich ins relativ sichere Britisch-Palästina oder in echte Schutzburgen retten konnten. Aber auch da hatte es keine »Willkommenskultur« gegeben.
Seit 1990/91 besteht der Großteil der hiesigen Juden aus Zuwanderern. Sie sind oft hochgebildet, doch jüdisch betrachtet meistens Analphabeten und manchmal auch Scheinjuden. Sie kamen freiwillig und gerne aus der zerfallenden Sowjetunion ins wiedervereinigte Deutschland. Ironie der Geschichte. Das »Land der Mörder« war und blieb für sie so etwas wie das Gelobte Land.
Ins biblisch-jüdisch »Gelobte Land«, nach Israel, wollten sie nicht. Höchstens zu Besuch. Dieser Teil des neubundesdeutschen Judentums blüht und gedeiht. Er entwickelt hoffentlich ein ganz neues, eigenständiges deutsch-jüdisches Sein. Sicher ist das nicht. Und wenn es dazu kommt, wird dieses neue deutschjüdische Sein zwangsläufig ganz anders – egal, ob besser oder schlechter – als das einstige deutsch-jüdische Sein der Wolffsohns und anderer Deutschjuden von »damals«. Morgen gibt es mehr Puschkin, Dostojewski und Tolstoi als vorgestern Goethe und vor allem Schiller. Wir Wolffsohns, auch die jungen und quicklebendig in die Zukunft schauenden, sind überlebende oder nachgeborene Tote. Unsere Epoche ist vorbei. Auch wo und wenn deutsch-jüdische Individuen leben, das Kollektiv ist ausgestorben (worden).
Das Deutschland-Verständnis und -Verhältnis der Wolffsohn-Rückkehrer fasst die Grabinschrift meines Vaters Max Wolffsohn (1919 bis 2000) zusammen: »Von Berlin nach Israel und trotz allem zurück nach Berlin.« Unsere Geschichte ist nicht einzigartig, aber, weil atypisch, doch quasi einzig. Sie zeigt den Lesern hoffentlich, dass nach allem und trotz allem im Mikrobereich ein deutsch-jüdisches Wir möglich war und ist.
Die Offene Gesellschaft gibt uns die menschheitsgeschichtlich erstmalige (auch einmalige?) Gelegenheit, die Fesseln der Herkunft zu sprengen – oder sie nicht als Fesseln, sondern als Stützen zu betrachten. Es liegt an uns. Es ist unser Recht auf Selbstbestimmung. Ein Recht, das uns in die Pflicht nimmt, wir selbst zu sein. Der Weg zu uns selbst, individuell und kollektiv, ist eine schwer zu lösende Aufgabe. Kein Schüler, Rabbi, Pfarrer oder Imam kann sie uns abnehmen. Sie kann unser Glück oder Unglück sein.
IPERSONEN-BILDER
Recha Wolffsohn – die Christjüdin
Recha benahm sich in der Regel sehr damenhaft. Doch eines Tages bewarf sie ihren Sohn Max aus heiterem Himmel mit Gurken. Die hatte er auf dem Tel Aviver Markt gekauft. Hatte Rechas Gurkenkanonade, wie bei Karl Wolffsohns Schlauchaktion, Vorgeschichten? Hatte die Gurkenkanonade einen tieferen Sinn? Ja, auch ihr Seelenknoten war geplatzt. Der Auslöser? Eine der Gurken war verfault. Mehr als eine konnte es nicht gewesen sein. Denn auf dem »Schuck HaKarmel«, dem Karmel-Markt, bekam man täglich bestes, frisches, meist auch relativ preiswertes Obst und Gemüse. Man darf sogar annehmen, dass die Ware besser und auf jeden Fall frischer und preisgünstiger war, als einst in den noblen Feinkostläden Berlins, wo Recha bis 1939 eingekauft hatte. Genauer: wo sie hatte einkaufen lassen. Denn meistens erledigte das Personal den Einkauf, allen voran Elli und Paul Pötschner. Er war Familienchauffeur, sie als Hausdame Mädchen für alles. »Gnä’ Frau, was darf ich bringen, was soll ich machen? Ja, gnä’ Frau, gerne, gnä’ Frau.«
Sehr gerne mochte Recha zum Beispiel Crêpes Suzettes. Die hatten die beiden in den Goldenen Zwanzigern abends oft in Berlins Feinschmecker-Tempeln verspeist. Eher selten zu Hause, denn abends waren Karl und Recha oft unterwegs. Sie repräsentierten und sie amüsierten sich.
Für die Söhne Willi und Max war das weniger schön. Statt der Mutter kümmerte sich die Nanny, Gouvernante Dada, um die Buben. Dada statt Mama. Eines Morgens, 1924, wachten Willi und Max auf, und die Eltern waren weg. Ohne ein Wort des Abschieds und ohne vorab etwas zu sagen, waren sie verreist. Über den Atlantik mit der (wie es sich für staatstragende Juden gehörte) »MS Deutschland« in die USA, für vier Monate. Blankes Entsetzen, heiße Wut.
Ja, auch die Legende von der immer fürsorglichen jüdischen Mamme hat ihre Risse. Als Mama Recha über den Großen Teich tuckerte, tröstete Dada die beiden Jungs. Max und Zeew/Willi haben Recha später deswegen oft bittere Vorwürfe gemacht. Dann weinte sie sehr. Das hinderte sie nicht daran, ihre Söhne ihr Leben lang herumzukommandieren. Ich erinnere mich an einen Familiensonntag im Garten des Bungalows am Stölpchensee. Ihr Sohn Willi war ungefähr fünfzig. Er solle ihr die Gartenliege hierher bringen, herrschte sie ihn an. Nein, dorthin. Besser da. Nicht doch da. Dort. Und so weiter und so fort. Willi, der sonst eine mit- und hinreißende große Klappe hatte, folgte seiner Mami wie ein dressiertes Hündchen.
Dada wurde besonders vom anlehnungsbedürftigen Max sehr geliebt. Sie liebte ihn auch. So sehr, dass sie ihm 1938, nach ihrer eigenen Auswanderung in die Vereinigten Staaten, eine der wenigen, heiß begehrten Einwanderungsgenehmigungen erkämpfte und zukommen ließ. Max, der immer folgsame Sohn, folgte jedoch seinen Eltern nach Palästina. Dada war tief enttäuscht, verletzt und ließ nie wieder von sich hören.
Am Enkelkind, an mir, übte Sabta (Großmutter) Recha tätige Reue, Umkehr, Wiedergutmachung. Sie galt auch mir, doch nicht nur mir. War sie nicht eigentlich an Willi und Max adressiert? Nach dem Tod ihres über alle und alles geliebten Karl, ungefähr von 1958 bis 1966/67, gingen Sabta und ich, Wolffsohn’scher Filmtradition folgend, fast jeden Samstag ins Kintopp. Meistens und am liebsten in den komfortablen Gloria-Palast neben der Gedächtniskirche. Der gehörte Max Knapp, einem früheren Kollegen Karl Wolffsohns, der unbefleckt das Dritte Reich überstanden hatte. In den Gloria-Palast gingen wir auch gerne, weil wir dort den guten alten Paul Pötschner trafen, der als Kartenabreißer seine Rente aufstockte. Karl Wolffsohn und seine »gnädige Frau« hatten ihm diesen Job vermittelt.
Natürlich kaufte Sabta, solange es angeboten wurde, das vierseitige Filmprogramm. Längst wurde es nicht mehr von der Lichtbildbühne verlegt. Nach dem Kino gingen wir zwei, drei Schritte weiter. Ins »Mampe« am Ku’damm, die altbürgerlich gute Stube mit großem Kachelkamin. Dort wehte noch oder wieder ein Hauch vom guten alten hinüber ins neue Berlin.
Dada war im großbürgerlichen Altberliner Wolffsohn-Alltag Mamaersatz, Paul Pötschner, Ellis Mann, war der Vaterersatz. Der schwarzhaarige Paul hatte lange einen Oberlippenschnurrbart getragen. Als aber diese Schnurrbartart automatisch mit einem bei den Wolffsohns und anderen anständigen Deutschen ungut beleumundeten und brüllenden deutschen Politiker verbunden wurde, rasierte der Wolffsohn- und judentreue Familien-Chauffeur den zahnbürstenartigen »Schnurres« unter seiner Nase ab. Paul war nicht nur Faktotum, er war ein herzensguter Mann, und er war, nicht zuletzt, Spielkamerad der beiden Buben, deren Eltern für Kinderspielereien selten Zeit hatten. Sie mussten, sie wollten, sie haben repräsentiert. Glamourös. Weniger bravourös waren sie als tatkräftige, anwesende Erzieher.
Hermann Landecker und seine Frau, deren Vorname mir nicht bekannt ist, waren offensichtlich mehr als nur ein Kaufmannsehepaar. Sie hatten das eine oder andere Buch gelesen und ganz gewiss den von unzähligen deutschen Juden heiß geliebten, hochverehrten Lessing. Wahrscheinlich nicht den »ganzen Lessing«, aber seinen Nathan, ›Nathan der Weise‹. »Ja«, erzählte Recha immer wieder voller Stolz, »meine Eltern nannten mich Recha. Wie die Tochter von Nathan dem Weisen.«
Wer Lessings phänomenal tolerante Ringparabel kennt, wird sich nicht wundern, dass meine Sabta Recha Jesus und Maria hoch achtete. Sie sprach ihren Namen so locker aus wie das »Schma Israel, Höre-Israel«-Gebet – auf Deutsch.
Jahrzehntelang habe ich wenig über Großmutter Recha oder ihre mir völlig unbekannten Eltern nachgedacht. Jetzt, da ich mich zu erinnern, einzudenken und einzufühlen versuche und in ihre Welt eintauche, bin ich voller Dankbarkeit. Für den Bezug auf Lessing, den Höchstpriester der Toleranz, braucht man sich wahrlich nicht zu schämen.
Vergessen wir nicht, dass Lessings Recha, wie sich am Ende des Stückes zeigt, christlicher, nicht jüdischer Herkunft, der Jude Nathan nicht ihr leiblicher, sondern Pflegevater und der christliche Ordensritter ihr leiblicher Bruder war.
Der Jude Hermann Landecker und seine jüdische Frau wählten folglich mit Recha den Vornamen einer Frau, die als Jüdin galt und Christin war. Also Judenchristin? Christjüdin? Recha ist bezogen aufs Judentum und Christentum so ununterscheidbar wie die drei Ringe der Ringparabel im ›Nathan‹. Welcher der drei Ringe war das Original? Diese Frage war nicht zu beantworten. Ergo war für Hermann Landecker und seine Frau der Vorname Programm: Nichts sollte Juden(tum) und Christen(tum) voneinander trennen. »Alle Menschen werden Brüder.« Ja, natürlich, Schiller. Neben Lessing der Lieblingsdichter so vieler (aller, der meisten?) jüdischen Deutschen der damaligen Zeit. Lessing und Schiller, die hatte »man« zu kennen. Und jeder Jude, der sie kannte, liebte sie. Ganz offensichtlich auch Herr und Frau Hermann Landecker.
Hermann und seine Frau hatten noch drei weitere Töchter: Hedwig, Trude und Grete. Was war an diesen Vornamen jüdisch? Nichts beziehungsweise so viel wie beim Vornamen des Vaters: Hermann. Hermann, nicht Herschl oder Hosea, Hermann – wie Hermann der Cherusker, der strahlende Held der Germanen, der 9 nach Christus Varus’ römische Legionen so vernichtend schlug, dass Kaiser Augustus ihn anflehte: »Varus, gib mir meine Legionen wieder!« Nix da, Germaniens Faust, eben Hermann, hatte zugeschlagen. Hermann, das leuchtende Vorbild des alten und neuen Germanien, des Deutschen Reichs. Der alte Kaiser Wilhelm (Wilhelm Eins) hatte jenem Hermann zwölf Jahre vor Rechas Geburt im Teutoburger Wald ein grässlich-bombastisches Denkmal errichten lassen.
Hermanns Eltern, Recha Landeckers Großeltern haben wohl ganz prosaisch, aber auch politisch und identifikatorisch entschieden: Sie haben dem Römer metzelnden germanischen Guerillakämpfer durch den Vornamen ihres Sohnes ihr eigenes Denkmal gesetzt. Sie waren und blieben Juden, aber ihr Herz schlug fürs Deutschtum. So muss es gewesen sein, denn sie wählten für ihren Sohn nicht einfach nur einen nichtjüdischen, angepassten, sondern einen hyperangepasst-deutschen Vornamen, Hermann eben. Das war eine Botschaft an die Außenwelt. 80 bis 90 Prozent der deutschen Juden gaben ihren Kindern damals nichtjüdische Vornamen. Aber höchstens vier Prozent entschieden sich Mitte des 19. Jahrhunderts für hyperangepasste bzw. hyperassimilierte Vornamen wie Hermann. Um 1930, deutlich nach Hermann Landeckers Geburt, war diesbezüglich der Höchststand mit 5,5 Prozent erreicht.
Schlug das jüdische Herz von Hermann Landeckers Eltern hypergermanisch? Wollten sie, zumindest nach außen, verbergen, dass sie Juden waren? 80 bis 90 Prozent der deutschen Juden haben sich von 1860 bis 1930 für diesen Weg entschieden. Sie gaben ihren Kindern nichtjüdische Vornamen. Nein, sie konvertierten nicht zum Christentum. Sie blieben Juden – aber sie wollten es nicht zeigen. Thomas Brechenmacher und ich haben in unserem Buch ›Deutschland, jüdisch Heimatland. Die Geschichte der deutschen Juden vom Kaiserreich bis heute‹ (2008) das Thema »Identifikation und Vornamen« systematisch, statistisch-repräsentativ aufgearbeitet, ausgebreitet und hierfür eine Methode entwickelt, die wir historische Demoskopie nennen.
Das Ehepaar Hermann Landecker war zwar hyperassimiliert deutsch, aber nicht christianisiert. Ein Weihnachtsbaum wurde beispielsweise nicht aufgestellt. Der Weihnachtsbaum ist alles andere als ein wirklich christliches Symbol. Er ist faktisch und zweifelsfrei heidnischen Ursprungs, doch mental, emotional gilt er, besonders bei Juden, als »typisch christlich«.
Wie bei den meisten deutschen Juden ihrer Zeit war Recha Landeckers Prägung weltoffen und weil weltoffen, jüdisch nicht ganz (treff)sicher. Sie verkündete oft: »Ich bin eine Judenfrau.« »Nein, Sabta«, belehrte ich sie oberlehrerhaft (sie starb 1972