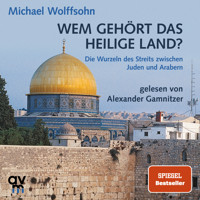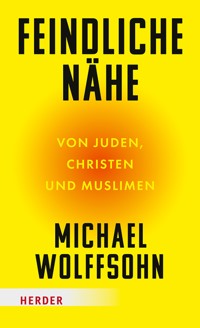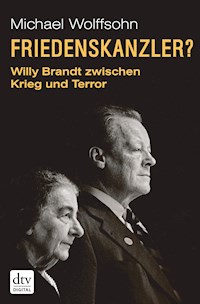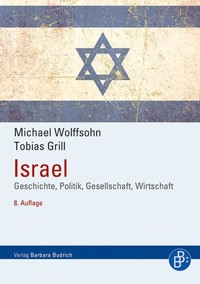Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Michael Wolffsohn erweist sich in seinem neuen Buch einmal mehr als brillianter Historiker und Analytiker der politischen Gegenwart. In zahlreichen bisher unveröffentlichten Texten räumt Wolffsohn mit Klischees und Legenden in Geschichte und Politik auf. Er kritisiert scharf und pointiert den aktuellen Antisemitismus in Deutschland sowie den Umgang der Politik damit oder geht der Geschichte des Begriffs "Abendland" auf den Grund und attackiert die Argumentationsmuster vieler Populisten. In weiteren Beiträgen setzt sich Wolffsohn mit der deutschen Nahostpolitik auseinander und stellt die Frage, was Freiheit eigentlich ist. Die glanzvollen Essays des unerschrockenen Denkers eröffnen neue Horizonte und stehen in bester aufklärerischer Tradition.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Wolffsohn
Tacheles
Im Kampf um die Fakten
in Geschichte und Politik
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2020
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: Michael Wolffsohn
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, Torgau
ISBN (E-Book): 978-3-451-81955-1
ISBN (Print): 978-3-451-38603-9
Inhalt
Wider die Fachidiotie – Einleitung
Abendländische Geschichte und deutsches Gedächtnis
Mehr Fiktion als Fakt: Das »Christliche Abendland«
Geist und Geister: (Fast) 1000 Jahre Hohenzollern
Friedrich II. – »Groß« und »modern«?
»Kunst« als Politik: Das Berliner Holocaust-Mahnmal
Mission erfüllt – Ein Nachruf auf die SPD
Deutsche Volkstrauer: Wer trauert hier und wozu?
6 x Deutschland. Zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert
Von Menschen und Übermenschen
50 Jahre Kanzler Willy Brandt – Was noch heute wirkt
Juda(s) – Juden: Ein Name als Fakt, Fluch und Segen
Der Messias-Ahne als Räuberhauptmann: König David
»Du sollst dir kein Bildnis machen«: Anne Frank und andere Juden
Zerrbilder, Realbilder – Über das Judentum
Auf der Suche nach »dem« Judenbild
Antisemitismus – Wider Phrasendrescherei. Oder: Die dümmsten Kälber
Israel, die Orthodoxie oder das Nichts – (Diaspora-)Juden heute
Ethik und Gewalt – Militär
Rabbiner in der Bundeswehr?
Bundeswehr – Ethik-Kodex statt Traditionserlass!
Widerstand und Bundeswehr
Von fundamentalen und letzten Dingen
Gewaltenteilung: Justiz und Demokratie
Über unsere Freiheit
Der Tod: Wirklich ein Tabu in unserer Gesellschaft?
Über den Autor
Quellenverzeichnis
Wider die Fachidiotie – Einleitung
Zusammenhänge denken, modisch: Vernetzt denken. Kommt es nicht zuerst und vor allem darauf an? Ja und nochmals ja. Zugleich müssen wir einsehen: Spezialwissen ist unverzichtbar. Wer aber kann zugleich Generalist und Spezialist sein? Wahrhaft streiten kann man darüber, wer, wo, wann Universalgenie war. Dass ich keines bin, erkannte ich, dank abwechselnd freundlicher und unfreundlicher Nachhilfe, erfreulich früh. So wurde auch ich ein Fachidiot unter vielen und eignete mir engeres Fachwissen an.
Juli 1967. Auf dem Weg zum Fachidioten traf ich, genauer: hörte ich fasziniert im überfüllten Auditorium Maximum der Freien Universität Berlin die (heutige) Ikone der (heute so genannten) 68er, Herbert Marcuse.
Ein Diskussionspartner Marcuses war Rudi Dutschke. In manchen Milieus inzwischen seinerseits eine Ikone. Viel war die Rede von Revolution. Dutschke träumte dabei und dafür vom Schulterschluss mit der Arbeiterschaft und hielt Kultur eher für eine Bremse. Den Glauben an die revolutionäre Rolle des Proletariats versuchte der junge Rudi dem alten und trotzdem Dynamik ausstrahlenden Herbert einzuhämmern. Vergeblich. Gerade durch den Kontrast zur Wirklichkeit sei Kultur ein, nein, der revolutionäre Faktor, konterte der weise Marcuse.
Der Gegensatz war offenkundig. Hörbar, sichtbar, fühlbar: Hier der eindimensionale, vermeintlich internationalistische und durch seine Stakkato-Rhetorik auf mich geradezu Goebbels-braun-deutsch wirkende Dutschke, dort der vieldimensionale, hochgebildete und hochkultivierte weißhaarige Weltbürger Marcuse. Über ihn und von ihm wollte ich mehr wissen. Dabei stieß ich schnellstens auf seinen »Eindimensionalen Menschen«. Kaum eine West-Berliner Buchhandlung hatte es damals nicht in ihr Schaufenster gelegt.
Ich mache es kurz, vereinfache »Faust« plus »Herbert« und bekenne: Die Vergeblichkeit einer Synthese aus Allgemein- und Fachwissen erkennend, hat mich der Gedanke nicht losgelassen, dass man trotzdem versuchen müsse, über den Schrebergarten des eigenen Fachwissens hinaus verwandte, vernetzte, zusammenhängende, weiterführende, sich selbst und die eigenen Studienergebnisse infrage stellende »Dimensionen« zu entdecken. So kam es, dass ich nicht nur auf meinem Hauptweg, der europäisch-deutsch-jüdisch-israelischen Geschichte (in ihren Vielfältigkeiten), voranschritt. Zusammenhänge, Neben-, auch Ab- und Umwege von dieser Geschichte – diesen Geschichten – von und zu anderen Geschichten wollte ich erkunden. Jenseits der Blätter und einzelnen Bäume wollte ich wenigstens die Umrisse des Waldes sichten, also Spezialgeschichte in universalhistorischer Absicht betreiben.
Klingt überzeugend, erinnerte man nicht unweigerlich an Tom Wolfes so oft zutreffenden, boshaften Spruch über echte und Möchtegern-Intellektuelle, die sich auf einem bestimmten Gebiet bestens auskennen, aber sich »nur zu anderen äußern«. Roman Bucheli hat mich diesbezüglich beruhigt. »Die wahre Herausforderung beginnt doch erst im unsicheren Terrain, wo der Zweifel als das eigentliche Werkzeug des kritischen Verstands am eigenen Gedanken zu nagen beginnt.«1
Auch andere Rechtfertigungen beziehungsweise Beruhigungen sind für diesen Ansatz denkbar. Anders als etwa der lateinische Begriff »historia« oder seine sprachlichen Nachfahren im Englischen und Französischen signalisiert das deutsche Wort »Geschichte« die Mehrschichtigkeit der Vergangenheit. Geschichte, Ge-schicht-e, besteht eben aus vielen Schichten. Die Mehrschichtigkeit zu erkennen und zu benennen, ist sowohl sprachgedanklich als auch methodisch die Ur-Aufgabe der Historiker. Es sollte ihr Fach-Ethos sein. Ist es das?
Wenn Mehrschichtigkeit für die Vergangenheit gilt, dann gilt sie auch bezüglich der Gegenwart, denn die Gegenwart von heute ist die Vergangenheit von morgen. Wenn das Grundmuster der Vergangenheit beziehungsweise der Geschichte dem Grundmuster der Gegenwart gleicht, dann ist die Darstellung und Bewertung der Geschichte nicht nur, aber nicht zuletzt auch Darstellung und Bewertung der Gegenwart. Wer das bestreitet, täuscht sich oder auch andere wissentlich oder auch nicht wissentlich.
Von Goethe über Marcuse, Wolfe und der vielschichtigen Gegenwärtigkeit und Vergangenheit zur »Berliner Schnauze«: Ich weiß natürlich nicht, was die Welt im Innersten zusammenhält. Selbst wenn ich nicht eindimensional bin, gibt es jenseits der vielen Dimensionen, die ich zu erkunden versuchte, unzählig viele andere. »Ick weeeß Schillern, ick weeeß Joethen, ick weeß Brockhaus, ick weeeß allet« – damit kann ich also nicht dienen. Trotzdem oder gerade deshalb ist dieses Buch nichts für Fachidioten oder eindimensionale Menschen.
*
Wie kommen die einzelnen »Dimensionen«, die Themen dieses Buches, zueinander? Wie und warum hängen sie zusammen? Was verbindet sie, was verbindet mich und meine Arbeit mit ihnen, was, am wichtigsten, könnte außenstehende Leser interessieren?
Eine Gemeinsamkeit: der Ansatz. Ich rede nicht gern »um den heißen Brei herum«. Erst denken, erkennen. Dann das Gedachte benennen und sich dazu auch bekennen. Somit Tacheles reden und schreiben. Auch wenn es nicht allen gefällt. Mut zum Denken und Mut zum Aussprechen. Nicht taktisch denken, sondern faktisch.
Wer sich in universalhistorischer Absicht mit europäisch-deutsch-jüdisch-israelischer Geschichte beschäftigt, stößt eher über kurz als lang auf das Stichwort »Abendland«. Wer, wie ich, fast ein Methusalem ist, erinnert sich, dass jenem Begriff in der eigenen Jungsteinzeit das Adjektiv »christlich« vorangestellt wurde. Der geschichtspolitisch-ideologischen Wiedergutmachungssteuerung entsprechend gehörte später das Doppeladjektiv »christlich-jüdisch« zum Abendland. Noch wird es nicht »christlich-jüdisch-muslimisch« genannt. Einstweilen wird darüber gestritten, ob »der Islam zu Deutschland gehört«. Eine gesamteuropäische Debatte hierüber ist nur noch eine Frage der Zeit, denn jenseits der Migrationsproblematik haben die Vorfahren diverser Ost- und Südosteuropäer historische Erfahrungen mit dem Islam. »Die« Polen haben Wien 1683 von »den« Türken befreit, »die« Ungarn, »die« Serben oder »die« Bulgaren wurden seit 1526 lange von »den« Türken beherrscht und so weiter und so weiter.
Allgemein deutsche, auch deutsch-jüdische und Weltgeschichte kann die Hohenzollern nicht außer Acht lassen. Schon gar nicht ihren vermeintlich oder tatsächlich Größten, Friedrich Zwei.
Auch unter Historikern gibt es seit jeher Geisterfahrer. Zu denen zählen inzwischen diejenigen, die wider die Empirie eine direkte Linie von »der« deutschen Geschichte (und natürlich den Hohenzollern) zu Hitler und Holocaust ziehen. »Wie hältst du’s mit Holocaust und Holocaust-Mahnmal?« An wen wurde diese neudeutsche Gretchenfrage nicht gerichtet? Doch wer weiß Genaueres über Motivation und Entscheidungsvorgang, die zu dessen Errichtung führten? Hier werden einige der Allgemeinheit eher unbekannte Basisinformationen vorgelegt.
Der Holocaust, das sechsmillionenfache Judenmorden, ist sozusagen »die« deutsche Urschuld. Dieser Ausdruck ist nicht mit Kollektivschuld gleichzusetzen. Oder doch? Grund genug, über Schuld, Sühne, Versöhnung, Frieden, »Deutsche Volkstrauer heute« sowie über die sechs verschiedenen »Deutschlands« im 20. Jahrhundert und bis in unsere Gegenwart nachzudenken. Vom Allgemeinen zum Besonderen, zur Sozialdemokratie Deutschlands. »Die« SPD gilt als geschichtsethischer Leuchtturm der deutschen Parteiengeschichte. War sie das, ist sie das wirklich? Gerade angesichts ihres jetzigen Überlebenskampfes ist eine historisch-politische Bilanz nicht unangebracht. Abzuwarten bleibt, ob es eine des Anfangs der Schlussbilanz ist.
Nicht nur »Männer machen Geschichte«. Selbstverständlich auch Frauen. Geschichte ist Menschenwerk. Überall und immer gibt es solche und solche, meist positiv oder negativ erwähnte. David und Anne Frank zählen zu den Lichtgestalten. Schauen wir näher hin. Auch auf den allgemein als Dunkelgestalt wahrgenommenen Judas, der, wie es heißt, Jesus verriet. Allein von seinem individuellen Namen ausgehend, wurde (und wird gelegentlich immer noch oder wieder) von dem Judas auf »die« Juden als »Gottesmörder« oder als Kollektiv-Kategorie von Finstermenschen geschlossen. Wer und was steckt hinter dieser Person und diesem Namen?
Apropos Namen, genauer: Vornamen. Sie sind ein höchst brauchbarer Indikator für öffentliche Meinung in vordemoskopischer Zeit, für die historischen Epochen, in denen Umfragen gänzlich unbekannt waren, also für den Großteil der Menschheitsgeschichte. Erst in den 1930er Jahren begann der Siegeszug der Demoskopie. Wer Vornamen vergibt, sendet der Außenwelt ein Signal aus der eigenen Innen- beziehungsweise Geistes- und Gefühlswelt. Mit dem geeigneten wissenschaftlichen Instrumentarium kann man jenseits des Individuellen auf der Mikroebene von Vornamen aufs Allgemeine, auf Gesellschaftsgruppen und Nationen, sprich: auf die Makroebene schließen und eben öffentliche Meinung nachzeichnen.
Jüdische Themen haben in der Berliner Republik weder quantitativ noch qualitativ das gleiche Gewicht wie in der Bonner Republik. Nicht, dass hierzu alles gesagt sei, »nur nicht von jedem«, aber man übersehe nicht, dass der den meisten im Vergleich zum Judentum noch unbekanntere Islam, allein mengendemografisch, gewichtiger als »die« Juden ist. Den dennoch jüdisch Unersättlichen seien hier einige eher heiße jüdische Eisen geboten. Sie sind teils religionsbezogen, teils historisch, teils allgemein- und nicht zuletzt militärpolitisch.
Stichwort »Militär«: Aus den Konflikten in und um Nahost, freilich auch aus der Deutschen und Weltgeschichte ist dieses Thema nicht wegzudenken, auch wenn unsere »post«- und antiheroische Gesellschaft es gerne wegdächte. Der Konjunktiv »dächte« ist falsch gewählt. Der Indikativ muss gebraucht werden, denn »die« (meisten) Deutschen denken Militärisches oft und gerne weg. Das ist sehr sympathisch, doch leider nicht realistisch.
In intakten demokratischen Staaten entscheidet »die« Politik über Krieg und Frieden, also den Einsatz des Militärs. Grund genug, um grundsätzlich über Gewaltenteilung nachzudenken. Meine These hierzu lautet: Anders als allgemein und gebetsmühlenartig behauptet, herrscht in den meisten Demokratien kein Gleichgewicht zwischen den drei Gewalten, also der Legislative (Parlament), der Exekutive (Regierung) und der Judikative (Justiz). Empirisch besteht kein Gleichgewicht zwischen diesen drei Gewalten, sondern ein Übergewicht der Justiz. Die meisten Juristen gehen verbal gegen diese These auf die Barrikaden. Ich verrate den Lesern zwar keine Namen, aber ein Geheimnis, wenn ich erwähne, dass mir Topjuristen, auch ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht ebenso wie ausländisches Recht sprechende Spitzenrichter, Recht geben. Ist die von mir vorgeschlagene Alternative gangbar? Ich weiß es nicht. Sehr wohl weiß ich, dass über jenes Ungleichgewicht nachgedacht werden muss, wenn man Volkssouveränität auch im Bereich der Justiz ernst nimmt, ohne das »gesunde« (also meist krankhafte) Volksempfinden anzurufen.
Von der Gewaltenteilung ist der gedankliche Weg zur Freiheit an sich naheliegend. Auch dazu wurde bereits »alles gesagt, doch nicht von jedem«. Doch über die Freiheit kann man gar nicht genug nachdenken, reden und schreiben. Sie ist wie die Gesundheit. Nur Kranke wissen den Wert der Gesundheit wirklich zu schätzen.
Gesundheit, Krankheit, »Militär«, leben, sterben – der Tod ist ein Thema, »das« Thema unseres Lebens. Um uns aufs ewige Schweigen vorzubereiten, sollten wir über den Tod reden. Doch was ist Reden ohne Denken und Wissen, selbst bezogen auf das Thema, über das wir so wenig wie über Gott wirklich wissen und wissen werden?
1Neue Zürcher Zeitung vom 20. August 2019.
Abendländische Geschichte und deutsches Gedächtnis
Mehr Fiktion als Fakt: Das »Christliche Abendland«
Geistiger Müll muss beseitigt werden, wenn vom »Christlichen Abendland« die Rede ist. Oder auch von der »Christlich-Jüdischen« Prägung des Abendlands. Das alles ist mehr Fiktion als Fakt. Das »Christlich-Jüdische« – oder meinetwegen »Jüdisch-Christliche« Abendland – ist reine Wiedergutmachungssprache, weil, wo und wenn ein (nicht nur deutsches) Kollektiv sein schlechtes Gewissen dauerhaft beruhigen möchte.
Der nicht selten geistlose Zeitgeist missversteht den Begriff des Christlichen oder Christlich-Jüdischen Abendlandes. Da gibt es eher stammtischlerisch grölende Zeitgenossen. Sie wollen die »Islamisierung des Abendlandes« verhindern. Dabei reden sie sich und anderen ein, das Abendland vor dem (neuerlichen) Untergang zu »retten«. Das ist der eine Meinungsstrom.
Im anderen Meinungsstrom findet man sogar Wissenschaftler. Sie behaupten: »Abendland« sei Kampfbegriff der Islamophoben, also der Islamfeinde. Solche Wissenschaftler, meist Zeithistoriker, kennen im Wesentlichen nur ihr enges Fachgebiet. Sie sind das, was man »Fachidioten« nennt. Wer nur sein Minifach und nicht auch wenigstens die Grundzüge der Universalgeschichte kennt, schweige besser, denn nur ein Zeit und Raum übergreifender Blick von der Vorgeschichte über die Antike bis zur Gegenwart gibt darüber Auskunft, wer, was oder seit wann sich hinter dem Begriff »Abendland« verbirgt. Das sei hier in der gebotenen Kürze versucht.
*
Zur Etymologie: Wir verdanken oder zutreffender: verwenden den Begriff »Abendland« seit dem 16. Jahrhundert als Eindeutschung des traditionellen und dem Volkswissen meist unbekannten Wortes Okzident. Ohne einen Orient kein Okzident, also ohne Morgenland kein Abendland. »Und es ward Abend, und es ward Morgen«.
»Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident« … klar, Goethe. Selbst »unser« deutsches Genie irrte. Von Anfang an diente sowohl der Begriff Okzident als auch »Abendland« oft als eher polemische Abgrenzung des Westens vom Osten.
Zur Geografie: Unter »Abendland« verstand dessen Untergangsprophet Nummer eins, Oswald Spengler, vornehmlich die Großregion Europa-Nordamerika. Sein Zeitgenosse Thomas Mann schüttete 1917/18 während seiner erzreaktionären Phase (die er später gerne verdrängte), in den »Betrachtungen eines Unpolitischen«, voller Verachtung teutonischen Met aufs »römische Westeuropa«. In der heutigen Jedermanns-Bibel Wikipedia zählt zum Abendland Westeuropa – vor allem Deutschland, England, Frankreich, die Iberische Halbinsel sowie Italien mit dessen Zentrum Rom. Doch gerade Rom ist ohne Athen, das antike Hellas, undenkbar. Wer zum Ursprung des Abendlands dringen will, kann über das Alte Griechenland nicht schweigen.
Zu fragen wäre, weshalb ausgerechnet die Benelux-Staaten, Schottland und Irland mit seinen Missionaren im frühmittelalterlichen Germanien, Österreich oder die Schweiz nicht zu diesen Abendländern gehören sollten. Und kann man Polen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Slowenien und Kroatien, die skandinavischen Staaten oder das Baltikum ausschließen?
Wann und wo war besagter Anfang? Zunächst war er sonnengeografisch. Bekanntlich geht die Sonne im Osten früher auf und dann unter als im Westen. So einfach und wertfrei ist das.
Wertfrei – und geografisch inkorrekt, denn Europa ist zwar für Vorderasien der Westen, aber westlicher als dieser Westen ist Amerika. Wäre, so gesehen, etwa Amerika das eigentliche Abendland? Natürlich nicht, eher ein kulturhistorischer Nachläufer, ein Kind des westeuropäischen Abendlands. Hat sich dieses Kind emanzipiert? Gar die Eltern hier und da übertrumpft? Eher nein, wenn man an den aus Rheinland-Pfalz stammenden Präsidenten Donald T. denkt. Wir erkennen: Sowohl geografisch als auch ideologisch oder kulturhistorisch ist der Abendland-Begriff mehr assoziativ als präzise.
Zur Demografie: Absolut wertfrei war der demografisch-geografische Anfang des Abendlandes. Vor circa 45.000 Jahren (neue Funde besagen: viel früher) wanderte der Homo sapiens, aus dem südöstlichen Afrika stammend, über Westasien nach Europa.1 Westasien war damals so wenig der Orient beziehungsweise Morgenland wie Europa der Okzident beziehungsweise Abendland. Ideologiefreie Migration war Anstoß dieser fundamentalen weltgeografischen und -demografischen Veränderung. Ob diese Migration zugleich eine Invasion war oder mehrere, und in welchen Schüben, ist wissenschaftlich zumindest umstritten. Das muss uns beim Thema Abendland aber auch nicht beschäftigen.
Wertebepackt wurde der West-Ost-Gegensatz in der Antike als Abgrenzung zu dem, was in der Moderne im Sinne von Wittfogel als »Orientalische Despotie« bezeichnet wird. Während der Perserkriege, im 5. vorchristlichen Jahrhundert also, wurde das erkennbar. Hier, im hellenischen Westen, das (modern formuliert) »aufgeklärte« Athen auf dem Weg zur politischen Teilnahme und Teilhabe aller Bürger, dort der Orient mit seinen vermeintlich gottgleichen Despoten. Zur Veranschaulichung empfehle ich »Die Perser« von Aischylos. Zwar gibt es kaum ein mir bekanntes Werk, das, auf der individuellen (Mikro-)Ebene, dem Feind gegenüber so viel Einfühlungsvermögen und Menschlichkeit entgegenbringt, doch auf der kollektiven (Makro-)Ebene ist die Abgrenzung eindeutig. Persien, der Orient, wolle um Hellas, »fern im Westen«, also dem Okzident, ein »knechtisches Joch« schließen. Als König sei Dareios ebenso »Gott« wie sein Sohn Xerxes. Scheitert der Gottkönig, »so schuldet er dem Volk nicht Rechenschaft«. Im Jahre 472 vor Christus, im Goldenen Zeitalter der Athenischen Demokratie, war eine so unfreiheitliche Verfassung nicht nur für Aischylos, sondern auch für alle seine Zeitgenossen schlichtweg verabscheuungswürdig.
Zur Ideologie: Diese geografische West-Ost-Abgrenzung war zugleich und vor allem ideologisch. Letztere wurde, ebenfalls in der griechischen Antike, auf innerhellenische Kriege und Konflikte übertragen. Hier Athen, dort Sparta. Beispielhaft dafür ist Perikles’ Leichenrede vom Winter 431/430 vor Christus. Nachzulesen in Thukydides’ »Peloponnesischem Krieg« (Buch II/34). Hier, in der Athenischen Demokratie, Freiheit, Recht, Menschenwürde, Individualität plus Polis-Gemeinschaftsgeist, Wohlstand und zugleich Hilfe für Schwache, Fremdenfreundlichkeit, Kunst, Kultur und Ästhetik. Dort, im Militärstaat Sparta, das genaue Gegenteil von alldem.
Eine Abfolge von Abendland-Morgenland-, Ost-West- sowie West-Ost-Invasionen, nicht Migrationen, stellen wir für die Antike seit dem 5. vorchristlichen Jahrhundert fest. Zuerst stieß das Morgenland ins Abendland. Ost – West, das war zunächst die Invasionsrichtung.
Das änderte sich im 4. vorchristlichen Jahrhundert. Seitdem – und bis heute – beobachten wir unterschiedlich lange machtpolitische Wellen. Einmal schwappt die Welle von Ost nach West, ein anderes Mal von West nach Ost, und so weiter und so weiter. Anders als die meisten Historiker sehe ich im Verhältnis Abendland-Morgenland mehr zyklische als strukturelle Wirkungsfaktoren – was das Vorhandensein von Strukturen keineswegs ausschließt, aber die Faktoren anders gewichtet.
Zurück vom Allgemeinen zum Besonderen, ins 4. vorchristliche Jahrhundert. Nun stießen Griechen, genauer: Makedonier unter Alexander dem Großen, vom Okzident in den Orient, bis zum Indus. Aus ideologischer, machtpolitischer und religiöser Abgrenzung. Aus Vernichtung und Feindschaft wurde Vermischung. Die hellenische Kultur wurde hellenistisch, sprich: orientalischer. Aus der jeweils kleinen Welt der Stadtstaaten (Polis) wurde ein Reich, Imperium, ja ein Weltreich. Das vormals freiheitliche Polis-Abendland verwandelte sich mehr oder weniger in eine Orientalische Despotie.
Aufstieg und Fall von Reichen: Das hellenistische Weltreich zerfiel, der Römische Stadtstaat stieg zur Regional- und dann Weltmacht auf. Rom eroberte seit ungefähr 200 vor Christus schrittweise sowohl das hellenisierte Hellas als auch später (nicht nur) die hellenistischen Nachfolgereiche. Aus der Römischen Libertas im Stadtstaat – sie war auch rechtlich weniger »demokratisch« als die Polis – wurde seit Caesar und Augustus das Imperium Romanum. Wieder vermischten sich Orient und Okzident sowohl politisch als auch kulturell und, ja, ebenfalls religiös.
Nach Etymologie, Geografie, Ideologie und Demografie zur Theologie. Religion, hier ist es wieder, das eingangs erwähnte Stich- und für manche Reizwort. Am antiken Abendland ist bis zur Zeitenwende nichts und bis ins 4. nachchristliche Jahrhundert nur sehr wenig, wenn überhaupt, christlich. Christlich im Sinne religiöser und kultureller Dominanz.
Bis zur Zeitenwende war das Abendland (auch nördlich der Alpen) nur polytheistisch und mehr oder weniger regional-religiös geprägt. Am Anfang war das Abendland also alles andere als christlich. Am Anfang war es polytheistisch. Vielgötterei statt Monotheismus.
Wer die Geschichte des Christentums auch nur oberflächlich kennt, weiß zudem: Das Frühchristentum ist ohne griechisch-römisches »Heidentum« und erst recht ohne Judentum sowie die Konkurrenz zum Judentum personell, historisch, theologisch, geografisch, soziologisch sowie demografisch undenkbar. Schlimmer (?) noch: Es stammt aus dem Morgenland. So viel zur reinen Christlichkeit des »Christlichen Abendlandes«.
Nicht nur im Heiligen Land war das Frühchristentum bereits vor der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre 70 nach Christus in jeder Hinsicht sozusagen jüdisch »durchmischt«. Auch in der süd- und südwesteuropäischen Diaspora gab es diese wechselseitige Beeinflussung. Bekanntlich gehörten viele Diaspora-Juden bereits zur Zeit des Apostels Paulus, also wiederum vor der Judäa- und Tempelzerstörung, zu den ersten Christen. Man lese zum Beispiel die Paulusbriefe. Wer sie kennt, weiß, wovon die Rede ist.
Zunächst war also das Christliche Abendland nicht nur heidnisch, sondern auch jüdisch. So gesehen wäre es auch vor der Wiedergutmachungsära sinnvoll gewesen, vom »Heidnisch-Jüdisch-Christlichen Abendland« zu sprechen.
Das – variiert – heidnische Element ist derzeit wieder aktueller denn je. Man schaue nicht nur auf das fast vollständig religionsferne Ostdeutschland, sondern auch auf die rasante Säkularisierung des restlichen Abendlands. Noch krasser: Die Christlichkeit des Abendlands wurde überhaupt erst durchs Morgenland ermöglicht; nämlich durch den »Import« des morgenländischen Christentums. Selbst dessen theologisch-geografische Folklore, die Heiligen Stätten, blieb bis heute orientalisch, morgenländisch: Nazareth, Kapernaum, See Genezareth. Jesu Krippe wird nicht in Garmisch verortet, sondern in Bethlehem, und das Urkreuz des Christentums wird auf Golgatha, in Jerusalem, lokalisiert.
Zeitlich sind wir noch immer in der Römischen Kaiserzeit. Wir schauen aufs späte 4. Jahrhundert. Das Christentum ist etablierte Staatsreligion, es folgt die Teilung des Reiches in je einen westlichen und östlichen Teil. Rom und Konstantinopel. Das östliche Byzanz war christlich, der westliche Teil ebenfalls. Doch Byzanz war griechisch mit beachtlichen arianischen Einsprengseln, der abendländische Westen italisch-lateinisch und seit dem späten 5. Jahrhundert nicht mehr römisch-kultiviert, sondern germanisch-barbarisiert.
Wer wüsste nicht, dass und wie blutig die vornehmlich von englischen und irischen Missionaren wie Bonifatius und Kilian betriebene Christianisierung der Germanen war? Frankenkönig Karl (meist der Große genannt) taufte um 800 die Sachsen auf seine »christliche« Weise: in einem Meer von Blut. Abendländische Hochkultur?
Die Verchristlichung, Zivilisierung und Kultivierung der neuen Abendland-Herrscher, der Germanen, dauerte Jahrhunderte, und lange hielt sich, etwa bei den Westgoten, welche die Iberische Halbinsel im 5. Jahrhundert erobert hatten, auch das (ebenfalls morgenländische) arianische Christentum. Diese christliche Variante bestritt die Gottgleichheit Jesu kategorisch und verachtete, wie der Islam, die beim Konzil von Nicäa (325 nach Christus) verfügte Trinität von »Vater, Sohn und Heiligem Geist« (Heilige Dreieinigkeit) als ketzerische »Vielgötterei«.
In jedem Schulbuch ist zu lesen: Die (ich füge hinzu: natürlich abendländischen) Westgoten seien 711 von den muslimischen Omajaden besiegt worden. Seitdem habe der Islam die Iberische Halbinsel mehr oder weniger beherrscht und sei 1492 durch die Reconquista »endgültig« vertrieben worden.
Daran ist so manches falsch. Erstens: Endgültig vertrieben wurden die Morisken, also die scheinkonvertierten Muslime, erst zwischen 1609 und 1611. Zweitens: Die Ergebnisse der internationalen und interdisziplinären »Inarah«-Forschergruppe besagen: Von einer islamischen Invasion könne keine Rede sein. Vielmehr habe die westgotisch-arianische Aristokratie gegen ihre eigene, seit 589 unter König Rekkared I. katholische Monarchie geputscht. Hierfür habe sie arianische Christen, vornehmlich Berber, aus Nordafrika zu Hilfe gerufen und diese auch bekommen. Erst knapp 200 Jahre später könne man vom Islam als der entscheidend machtausübenden Religion auf der Iberischen Halbinsel sprechen. (Leicht nachzulesen in Barbara Köster, Der missverstandene Koran, Berlin 2010.) Wie jede Neuentdeckung werden auch die Inarah-Forschungen von den »Alten Platzhirschen«, dem »Establishment«, bekämpft und bestritten. In unserem Falle nicht zuletzt aus tagespolitischen Gründen. Wer Recht hat, sei hier nicht entschieden. So oder so, bis ca. 1600 gehörte der Islam zu Südwest-Europa, wenngleich noch nicht zu Deutschland (um einen deutschen Hobby-Historiker, der zeitweilig Bundespräsident war, zu zitieren).
Zu Südosteuropa gehörte der Islam bereits seit dem 14. Jahrhundert. Im Jahre 1354 eroberten die Osmanen unter Sultan Orhan mit Gallipoli die erste Stadt auf europäischem Boden. 1453 wurde bekanntlich Konstantinopel, die altrömische, dann oströmisch-byzantinische Hauptstadt, eingenommen. Erst war sie heidnisch, dann römisch-katholisch, griechisch-orthodox und bis heute als Konstantinopel beziehungsweise seit Kemal Atatürk als Istanbul muslimisch. Der europäische Teil der Türkei und Istanbuls gehört zwar nicht zum Abendland, wohl aber zu Europa. Ebenso – schon seit dem 14. Jahrhundert – die muslimischen Albaner, Bosnier und Bulgaren. Zum Abendland gehört diese Region nicht, doch mit diesem vielfach verflochten ist sie allemal. Das gilt erst recht fürs wahrlich abendländische Wien. Vor dessen Toren standen »die« Türken 1529 und 1683. »Was wäre wenn …« sie Wien erobert hätten? Wie christlich wäre das Abendland geblieben? Ob es gefällt oder nicht: Historisch, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, gehört der Islam nicht zu Klein-Deutschland, sehr wohl aber zu, Entschuldigung, »Großdeutschland« und damit eindeutig zu Europa.
Was für den Islam im »Christlichen Abendland« gilt, gilt noch mehr und viel früher fürs Judentum. Religiös, theologisch, ist das unbestreitbar. Auch demografisch. Lange bevor die Germanen Christen wurden, gab es in Europa Juden. Auch nördlich der Alpen. Mit der römischen noch-nicht-christlichen zog auch die jüdische Hochkultur und Religion etwa seit der Zeitenwende zum Beispiel an Rhone, Donau, Rhein und Mosel. Damals hockten die vorabendländischen Germanen und Kelten sicher nicht auf oder unter Kokospalmen. Sie träumten und besangen, wie später Wilhelm Müller und Franz Schubert, den Lindenbaum »vor dem Tore«. Nicht einmal die Eiche war damals typisch deutsch. Jahrhunderte vor den Kirchen gab es in Germanien (amtlich seit 321 n. Chr.), Gallien und Britannien Synagogen. Christliches Abendland?
Die christliche Gegenoffensive ließ auf sich warten, doch sie kam. Denken wir an die Rolandssage um Karl den Großen. »Muslime raus!« So steht es da nicht, aber so war es gemeint.
Das mittelalterliche Gegenstück zum neuzeitlichen »Juden raus!« folgte im nun wirklich kirchlich-christlichen, weniger christlich-barmherzig-milden und kaum jesuanischen Zeitalter der Kreuzzüge ab 1096. Am Rhein wurden Juden vom Pöbel regelrecht abgeschlachtet. Der niedere Klerus war nicht ganz unbeteiligt, der hohe Klerus versuchte durchaus, die Juden zu schützen. Aus wirtschaftlichen ebenso wie theologischen Gründen. Nämlich: Die Juden sollten als Zeugen der Ecclesia Triumphans leben, und Tote können bekanntlich kein Zeugnis ablegen. Der Grundgedanke als Maxime verkürzt und vereinfacht: Juden diskriminieren ja, liquidieren nein. Christlich, theologisch verfeinert und päpstlich abgesegnet wurde dieser Ansatz 1215 durch das Vierte Laterankonzil. Nicht alle Vertreter des hohen und niederen Klerus befolgten jene Maxime. Sonst wäre es nicht seit der Großen Pest im 14. Jahrhundert zu Quasi-Pogromen oder im 15. und 16. Jahrhundert zu Judenvertreibungen im Herzen des Christlichen Abendlands gekommen. »Juden raus« und »Muslime raus!« ist keine zeithistorische Erfindung.
Erinnert sei an die judenmörderische Inquisition vom 13. bis 18. Jahrhundert. Sie trug seit dem 15. Jahrhundert durch ein verbohrt missverstandenes Christentum, sozusagen vormodern, auch rassistische Züge. »Limpiezadi sangre«, Reinheit des Blutes, sollte unter den abendländischen Spaniern hergestellt werden. Oft wird dieser vormodern-rassistische Aspekt des Antijudaismus auch von der Wissenschaft übersehen. (Nur so kann der Bosheitsrekord der Moderne bewahrt werden.) Selbst nach dem Ende der Inquisition, bis ins 19. Jahrhundert, in der Misch-Ära aus Aufklärung, Revolution und Restauration, wurde in Spanien gegenüber nur vermeintlichen Christen wie den Nachfahren getaufter Juden und Muslime diese menschenfreundliche Praxis der »Blutreinheit« fortgesetzt. Christlich im genuin christlichen, jesuanischen Sinn der Evangelien kann all das im Christlichen Abendland nicht genannt werden, denn seit dem späten 10. Jahrhundert, sprich: seit Reconquista und Kreuzzügen galt im Christlichen Abendland in zyklischen Abständen, teils funktional ökonomisch motiviert, ganz unjesuanisch: Juden raus oder Muslime raus oder beide raus.
Das Sündenregister des kirchlich-christlichen Abendlandes ist lang. Dabei ist eine fundamentale Einschränkung vorzutragen: Christentum und Kirche waren und sind nicht gleichzusetzen.
Stichwort Aufklärer: Dass Aufklärer wie Voltaire frei von Antjüdischem und Antimuslimischem gewesen wären, kann man kaum behaupten. Freilich gab es auch Aufklärer anderen Kalibers: Lessing zum Beispiel. Von einigen Aufklärern gewollt, von anderen nicht, aber letztlich von »der« Aufklärung bewirkt, begann im Christlichen Abendland allmählich die Entchristlichung, im Fachjargon »Säkularisierung«, sprich: die Entfernung und Entfremdung von Religion an sich und bei fast jedermann für sich. Wer oder was ist heute im Abendland, abgesehen von Minderheiten, noch christlich, und wo? Überspitzt könnte man Deutschland, besonders im Osten, eine Heidenrepublik nennen. Das übrige Abendland ist längst weder kirchlich noch christlich im jesuanischen Sinn.
*
Wie in der Antike und im Mittelalter folgten den Wellen vom Morgenland ins Abendland umgekehrt die Wellen vom Abendland ins Morgenland: 1683, Türkenabwehr vor Wien. Beginn des abendländischen »Roll Back« ins Osmanische Reich. Zu nennen wäre dann Napoleons Orientabenteuer in Ägypten, Palästina und Syrien in den Jahren 1798/99, Britanniens Vordringen von Malta über Zypern nach Ägypten, Palästina und Mesopotamien in den Jahren 1800 bis 1920. Eine Wende – kurzfristig ohne Welle in die eine oder andere Richtung – folgte nach dem Zweiten Weltkrieg.
Für die Ära danach sind zwei Stichworte zu nennen: Kalter Krieg und Entkolonialisierung. Im Kalten Krieg gab es einen scheinbar ganz neuen Ost-West-Konflikt: Zwischen West und Ost, dem Abendland, das kurzerhand zum »Nordatlantik« wurde, und dem geografischen Morgenland Sowjetunion.
Etwas willkürlich, wenngleich nicht nur gewollt, ließ sich sowohl historisch als auch theologisch dieser Ost-West-Konflikt unschwer in die Kontinuität früherer Orient-Okzident-Rivalitäten einordnen. Moskau, das »Dritte Rom«, galt als Byzanz Zwei, und die Diktatur der (O-Ton Konrad Adenauer) »Soooowjets« wurde in die Tradition des byzantinischen Absolutismus gestellt.
Das zweite Stichwort: Entkolonialisierung. Nun drangen neue, keine unmittelbar abendländischen Mächte direkt oder indirekt ins Morgenland: die Sowjetunion und die USA. Dann, ab 1956, die nächste, bis heute anhaltende, sowohl zyklische als auch durch Einzelereignisse ausgelöste Welle vom Morgenland ins längst nicht mehr Christliche Abendland, das sein Christentum, wenn überhaupt, inhaltslos und deshalb wenig überzeugend oder überzeugt benutzt, um diese Wellen zu brechen.
Die Rede ist von den muslimischen Migrationen aus Nordafrika und dem Vorderen Orient nach Westeuropa, wobei sich durchaus die Frage stellt, ob es sich hier um Zyklen beziehungsweise Wellen oder eine neue Struktur handelt. Ich neige zur strukturellen Einordnung, denn erstmals im uralten Clash und Crash von Abendland und Morgenland erleben wir keine Invasionen, sondern Migrationen, regelrechte Völkerwanderungen. Ins postkirchliche, weitgehend nicht christliche und teils originär antichristliche Abendland strömten und strömen Millionen Muslime. Ein Ende ist nicht abzusehen. Das mag gefallen oder nicht. So ist es.
Das bedeutet: Wir erleben im Abendland eine demografische, soziologische, theologische, kulturelle und zivilisatorische Revolution oder, wenn es eher beliebt, Transformation. Nein, das Abendland wird nicht morgenländisch, aber im Abendland ist immer mehr Morgenland zu finden. Mehr Morgenland heißt mehr Muslime, mehr Religion, mehr Islam und, unabhängig von Muslimen, noch weniger Kirche, weniger Christentum. Bedeutet weniger Kirche zugleich weniger Moral? Das ist ein anderes Thema.
Eingeleitet wurde diese neue Struktur 1956, unmittelbar mit der Unabhängigkeit Marokkos und Tunesiens, und seit 1962 mit dem Rückzug Frankreichs aus Algerien. Alles das lange vor dem »Arabischen Frühling« 2011, der ein Winter wurde, und lange vor der Fluchtwelle von 2015. Konflikte, Krisen, Kriege und Bürgerkriege um und in Palästina, Libanon, Syrien, Irak, Libyen, Tunesien, Algerien, Korruption und Dauerelend in der überwiegend muslimischen Subsahara lösten und lösen eine Migrationswelle nach der anderen aus. (Am meisten geredet und gestritten wird dabei über Flucht und Vertreibung der Palästinenser. Dieser sowohl quantitativen als auch qualitativen Unverhältnismäßigkeit nachzugehen, lohnte eine gesonderte Betrachtung.)
Wo weder Kriege noch Bürgerkriege jene Wellen bedingten, wirkten wirtschaftliche Magnet- oder Überlebensfaktoren ins nachchristliche Abendland. Mauerbau und Stacheldraht, also das plötzliche Ausbleiben von Arbeitskräften aus der DDR, waren seit August 1961 das Startsignal für die zunächst gemäßigt muslimisch-türkische Migration ins damals noch halbwegs christlich-abendländische Westdeutschland. »Die« Türken stehen nicht, wie 1529 und 1683, vor Wien, sondern in Berlin und anderswo im Abendland. Das ist keineswegs der neuerliche »Untergang des Abendlands«, doch eine nicht nur demografische, kulturelle und religiöse Transformation beziehungsweise Revolution.
Wer ernsthaft die Entchristlichung des Abendlands und damit indirekt dessen Untergang beklagt, muss – bevor über »Islamisierung« gejammert wird – erstens die Kirchen im jesuanischen Sinne verchristlichen und zweitens sein Christentum nicht unbedingt praktizieren, wohl aber zumindest kennen. Wer nicht einmal weiß, weswegen Christen – jenseits des Geschenketerrors – Weihnachten oder Ostern und Pfingsten feiern, ist unfähig, mit Angehörigen anderer Religionen den überlebenswichtigen Dialog zu führen. Vielleicht wird das Abendland irgendwann im jesuanischen Sinne christlich und der Islam in Europa ein europäischer Islam? Wer weiß.
Geist und Geister: (Fast) 1000 Jahre Hohenzollern
Kaiser Wilhelms altes Herz
Ruht nun aus von Lust und Schmerz.
Unser Fritz ging auch zur Ruh,
Vicky kommt nach Monbijou.
Wilhelm II. nun Kaiser ist,
Der uns unsre Juden frisst …
In Theodor Fontanes Knittelvers aus dem »Dreikaiserjahr« 1888 ist von Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm II. die Rede. Unversehens sind wir beim beliebten Hohenzollern-»Bashing«, der Hohenzollern-Dämonologie. Selbst der kluge Theodor Fontane verwechselte gelegentlich die Hohenzollern-Geister mit dem Geist der Hohenzollern. Historisch betrachtet relativ kurz vor dem tausendjährigen Gedenken an die Hohenzollern – das »Tausendjähriger Reich« der Hitlers währte, gottlob, deutlich kürzer – krachte es einmal mehr zwischen den Nachfahren dieser deutschen Monarchie und den Vertretern der bundesrepublikanischen Demokratie. Im Jahre 2019 wurde öffentlich bekannt: Der Chef der Kaiser-Nachfahren hatte Entschädigungsforderungen gestellt und für seine Familie unter anderem das Wohnrecht im Potsdamer Schloss Cecilienhof verlangt. Das schloss die amtliche Berliner Republik kategorisch aus und schoss dabei (politisch) schneller zurück, als es die Preußen je taten. Die republikanische Aufregung überrascht. Der Herzog von Bayern zum Beispiel residiert immer noch und längst wieder im Münchener Schloss Nymphenburg, und, soweit korrekt berichtet, steht sogar in Bayern die Wiedereinführung der Monarchie nicht unmittelbar bevor. Die vermeintlichen Versuche von Franz Josef Strauß, seine Familie als post-wittelsbacher Dynastie in Bayern zu inthronisieren, wurden nicht von Erfolg gekrönt.
Bei ihrem Rückschuss auf die »unverschämten« Hohenzollern-Forderungen übersahen die Repräsentanten unserer Demokratie zudem, dass sie selbst, freilich in ganz anderem Zusammenhang, den gedanklichen und politischen Erstschuss abgegeben hatten: durch die Diskussion um die Rückgabe von Raubgut, das im »Tausendjährigen Reich« vornehmlich Juden entrissen worden war. Ironie der Geschichte: Ein bedeutender Hohenzoller, der »Große Kurfürst«, hatte die Juden 1671 in sein Land geholt.
Die bundesdeutschdemokratische (Fast-)Einheitsfront vergaß: Wer A sagt, muss auch B sagen. Raub ist Raub und nicht »nur« auf Juden oder die Gruppen A bis Y begrenzt. Es gefalle oder nicht: Es ist deshalb zumindest ebenso logisch wie ethisch von »den« Hohenzollern folgerichtig, das wann, warum und von wem auch immer Geraubte zurückzufordern – obwohl »der Kronprinz«, also der Sohn Wilhelms II., sich gerne den Nationalsozialisten als Legitimator anbiederte. Im Rechtsstaat sind »alle Tiere gleich«. Oder ist es am Ende in Deutschland doch so wie in George Orwells »Farm der Tiere«, dass »manche gleicher sind«? Und wenn nicht gleicher, so doch ungleicher. In diesem Falle die Hohenzollern.
Was jene Einheitsfront offenbar übersieht: Sie wendet, wenngleich unter anderen Vorzeichen, das gleiche Instrumentarium »wie die Nazis« an: Sippenhaft(ung). Die wiederum entspricht weder der »jüdisch-christlich« abendländischen noch der rechtsstaatlichen Tradition – selbst wenn das eine oder andere Gericht, Bundesrecht anwendend, »Recht« spricht. Dieses Gesetz, ebenso wie dieses Urteil, mag legal sein, ethisch sowie rechtssystemisch legitim sind sie nicht. Um diese Feststellung zu treffen, muss man kein Jurist sein. Bar jeder zivilisatorischer Rationalität »argumentierte« der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Er bezog sich nicht nur auf »die« Hohenzollern, sondern »den« Adel: Er rufe im Hinblick auf den Adel ja nicht gleich nach der Guillotine, aber Entschädigungen kämen für ihn nicht in Frage (Interview, 3sat, 21.12.2019).
Streiten kann man auch über Wilhelm II. Seine Schwächen sind offenkundig, doch Hohenzollern-Dämonologie ist weder bei ihm noch anderen seines Geschlechtes angebracht. Im Rückblick noch weniger, denn, anders als Fontane, wissen wir, wer Juden sechsmillionenfach »gefressen« hat. Weder Wilhelm II. noch irgendein Hohenzoller hätte je solche Verbrechen begangen oder daran auch nur gedacht. Ja, Wilhelm II. war sozusagen »bekennender Antisemit«, und am »Berliner Antisemitismusstreit« von 1878/79 war der Kaiserhof Wilhelms I. nicht unbeteiligt. Als aber am 9. November 1938 der nationalsozialistische Pöbel Synagogen in Brand setzte und Juden auf offener Straße drangsalierte und liquidierte, sagte Wilhelm II. in seinem niederländischen Exil: Zum ersten Mal in seinem Leben schäme er sich, Deutscher zu sein. Nein, der »Weg nach Auschwitz« führte gerade nicht vom bald tausendjährigen Geschlecht der Hohenzollern zu Hitlers »Tausendjährigem Reich«.
Ohne Scheuklappen sei neben der Dämonologie die Geschichte der Hohenzollern in folgenden Kategorien betrachtet:
Geografie, Strategie und Militär Demografie Philosophie und SoziologieBiografie und PsychologieTheologie und schließlichHistorische DemoskopieAuf Futurologie sei verzichtet, doch zur Chronologie dies hervorgehoben: Fast 1000 historisch nachweisbare Hohenzollern-Jahre. Was für eine Leistung, allein dieses lange Überleben! Vergleichbares bietet keine bürgerliche Familie und schafften nur wenige andere Adelsfamilien.
Die Geschichte der Hohenzollern beginnt vor dem Ersten Kreuzzug der Jahre 1096 bis 1099. Das bedenkend und in Anlehnung an Großmeister Goethe, könnte man den Hohenzollern zurufen: Von damals bis heute gingen viele neue Epochen der Weltgeschichte aus, »und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen.«
1. Aus der Defensive: Zu Geografie, Strategie und Militär der Hohenzollern
Aufgrund der Mittellage ihres Staates mussten die Hohenzollern militärisch hochgerüstet und gegebenenfalls aus der geografisch-strukturellen Defensive offensivfähig sein – um sicher überleben zu können, um Subjekt und nicht Objekt der Politik, um nicht wehrloses Opfer zu werden – wie weiland im Dreißigjährigen Krieg.
In seinem politischen Testament von 1667 mahnte der Große Kurfürst, zu verhindern, dass im Kriege »Ewere Lande Das theatrum sein wurden, Darauff man die tragedi Spillen werde.« Die Mark Brandenburg hatte in jenem Krieg etwa die Hälfte ihrer Bevölkerung verloren.
Nach diesem Urtrauma war der größte Hohenzollern-Staat bis zuletzt von einem bleibenden Gefühl der Verwundbarkeit geprägt. Auch seine späteren Offensiven, sogar Aggressionen, entsprangen – abgesehen vom 1740 erfolgten Überfall Friedrichs II. auf Schlesien – einem defensiven Geist.
Auch die schwäbischen Hohenzollern lagen strategisch-politisch sozusagen in der Mitte: in der Mitte zwischen Württemberg und Baden. Beide hatten mehr als nur ein Auge aufs schwäbisch-hohenzollerische Ländle geworfen. Es überlebte trotzdem, ging 1849 im großen brandenburgisch-preußischen Bruder und nunmehr, bundesdeutsch, in Baden-Württemberg auf. Im gemütlichen Ländle, nicht in Brandenburg-Preußen, Borussien, liegt die Stammburg der Hohenzollern. Die schwäbische, nicht die fränkische, kurmärkisch-preußische ist die Urlinie der Hohenzollern. Nebenbei: Aus dem schwäbisch-alemannischen Raum stammen zwei andere bedeutende Dynastien: die Staufer und die Habsburger. Fast könnte man versucht sein, die großräumliche Einheit dieser historisch machtvollen Dreiheit zu mythologisieren. Doch halten wir uns an die Fakten.
Schwäbischen Ursprungs ist auch das seit Mitte des 13. Jahrhunderts gebräuchliche Schwarz-Weiß des Hohenzollern-Wappens. Das war eine geradezu prophetische Farbentscheidung: Wie das Wappen, so die häufigste Beurteilung der Hohenzollern – schwarz oder weiß.
Die hohenzollerischen Nürnberger Hofgrafen übernahmen das schwäbische Familien-Schwarz-Weiß ebenso wie die fränkischen und brandenburgischen Verwandten. Später galt es als urpreußisch. Heute verbinden Herr und Frau Jedermann dieses Schwarz-Weiß nicht mehr mit den Hohenzollern aus Schwaben, Nürnberg, Franken, Brandenburg oder Preußen, sondern mit dem Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Was den Deutschen einst die Hohenzollern waren, sind ihnen heute die Fußballkaiser. Hat sich Deutschland aufwärts, rückwärts oder vorwärts bewegt?
Die fränkische Hohenzollern-Linie lag ebenfalls quasi in der Mitte: zwischen Bayern und Thüringen plus Sachsen und Brandenburg. Nach der preußischen Katastrophe von 1806 schluckten die bayerischen Wittelsbacher mit Hilfe Napoleons die Franken, die, anders als die Kurmärker-Hohenzollern, nicht die Kraft hatten, ihren Mittelraum zu vergrößern, wovon inzwischen die nach-wittelsbacher CSU profitiert. Nach-hohenzollerische Befreiungsversuche in Form eines bayerischen Ministerpräsidenten aus Franken gelangen bislang zweimal: Die Franken Günther Beckstein und Markus Söder in die Hohenzollerngeschichte einzuordnen, geht allerdings zu weit. Oder doch nicht? Wir »lernen aus dieser Geschichte« nämlich die relative Beliebigkeit kollektiver Identifikationen. Vor Napoleon richtete sich der politische Frankenblick nordwärts, nach Berlin, zu den Hohenzollern, danach südwärts, nach München, zu den Wittelsbachern. Vergangen ist die Monarchie der Hohenzollern und Wittelsbacher, nicht vergangen ist sowohl die geografische als auch politische »Sandwich«-Lage Frankens zwischen den beiden längst republikanischen Metropolen, Berlin und München.
Beim Stichwort »Geografie der Hohenzollern« denken fast alle an Deutschland, kaum jemand an Europa. Doch gerade die europäische Dimension gehört zur ganzheitlichen Betrachtung der Hohenzollerngeschichte. Im monarchisch-aristokratischen Europa gehörte der »Export« und »Import« von Frauen, manchmal auch der zweit- oder drittgeborenen Männer eines Adelsgeschlechtes zum guten Ton dynastischer Politik.
Die brandenburgisch-preußischen Hohenzollern waren fleißige Ex- und Importeure europäischen Adels und Hochadels, auch in hochkarätig-gewichtige Staaten wie Großbritannien und Russland. So war zum Beispiel der Hunderttage-Kaiser Friedrich III. Schwiegersohn der britischen Königin Victoria und Kaiser Wilhelm II. daher ihr Enkel. Charlotte von Preußen, Schwester von König Friedrich Wilhelm IV., wurde mit Zar Nikolaus I. verheiratet und hieß seitdem Zarin Alexandra Fjodorowna. Sophie, Schwester Kaiser Wilhelms II., wurde Königin von Griechenland. Dort war im 19. Jahrhundert der Wittelsbacher Otto zu Fall gekommen.
Auch die Sigmaringer Hohenzollern schnitten beim blaublütigen Im- und Export nicht schlecht ab, wenngleich es 1870 nicht nur gefährlich, sondern brenzlig, ja kriegerisch brennend zwischen Frankreich und Noch-nicht-ganz-Klein-Bismarck-Deutschland wurde. Weshalb? Weil sich Frankreich, wie einst in der Frühen Neuzeit vom Habsburger Reich, nun vom Deutschen Reich umzingelt fühlte. Vom Osten und Südwesten. Ultimativ forderte Kaiser Napoleon III. Preußens Verzicht auf den spanischen Thron. Es kam zum Krieg, den Preußen mit »gesamtdeutscher« Hilfe gewann. Am Ende war zwar kein Hohenzoller König von Spanien, aber »Deutschland« erstmals Deutschland beziehungsweise das »Deutsche Reich«.
Selbst in dynastischen oder später nationalen Kriegen blieben die Hohenzollern und andere europäische Adelsgeschlechter sozusagen unter sich, »in der Familie«, den adeligen Großfamilien Europas. Das machte den Krieg, sogar den Ersten Weltkrieg, als Krieg zwar nicht menschlicher, aber nicht so »total« wie den Zweiten Weltkrieg, der auch deshalb ein Zivilisationsbruch war, weil es keine vergleichbaren aristokratisch-dynastischen Verflechtungen mehr gab und somit auch keine verwandtschaftlich-politisch bedingten Mordhemmungen und Ausrottungsdämpfer.
Wir bleiben beim Thema »Militär und Strategie«. Das Hohelied aufs Militär hätten die Hohenzollern gesungen, behaupten Hohenzollern-Dämonologen. Tatsache oder Legende? Hier einige repräsentative Beispiele:
Johann Cicero, vierter Kurfürst von Brandenburg, gestorben 1499: »Vom Krig-führen halte ich nichts.« Kriege »bringen nichts Gutes.«
Kurfürst Joachim II. hielt sich »vor keinen Kriegsmann«2 und ermahnte 1562 seine Söhne im Testament, »dass ire inen den lieben frieden wolden lassen befohlen sein.«
Selbst der »Soldatenkönig« Friedrich Wilhelm I. empfahl seinen Nachfolgern: »… bitte ich umb Gottes willen kein ungerecht krikg anzufangen und nicht ein agressör sein, den(n) Gott (hat) die ungerechten Krige verbohten.«
Sein Sohn Friedrich II. (der Große) war nicht nur Philosoph, Schöngeist, Literat und Musiker, sondern eben auch Herrscher, Kriegs- und Feldherr. Dem Militärerzieher des Kronprinzen hämmerte er dies ein: »Es ist von größter Wichtigkeit, ihm Geschmack für das Militärwesen beizubringen. Deshalb müssen Sie ihm bei jeder Gelegenheit sagen …, dass jeder Mann von Geburt, der nicht Soldat ist, nur ein Elender ist.«3 Den Schlesienkrieg hatte Friedrich II. 1740, er gestand es später, des Ruhmes wegen begonnen. Spätestens im Siebenjährigen Krieg, ab 1756, ging es nicht mehr um Ruhm, sondern ums Sein oder Nichtsein seines Preußens.
So »begeistert« liefen damals »die« Hohenzollern-Untertanen zu den Waffen, dass gegen Ende der Ära Friedrichs des Großen 42 Prozent der Soldaten ausländische Söldner (also wirklich »Sold«-aten) waren, genau: 81.000 von insgesamt 195.000 Mann.4 Kämpfende kosteten damals den Staat viel Geld, es sei denn, der Krieg ernährte den Krieg. Zynisch, aber wahr: Zum quasi Nulltarif bekam »der« Staat, nicht nur der deutsche, seine Soldaten erst durch die Einführung der Allgemeinen Wehrpflicht. Das revolutionäre Frankreich hat es mit der levée en masse eingeführt und vorgemacht.
Friedrich Wilhelm II., sein Nachfolger, suchte keine Konflikte. Ihm folgte Friedrich Wilhelm III. Er sagte 1806, nach seinem lange hinausgezögerten (und törichten) Entschluss, gegen Napoleon Krieg zu führen: »Mehr als ein König ist untergegangen, weil er den Krieg liebte; ich, ich werde untergehen, weil ich den Frieden liebte.« Wozu hatte er dann gegen die Weltmacht Frankreich Krieg erklärt?
Vor dem Freiheitskrieg von 1813 bis 1815 »fürchtete« er »viel Widerwärtiges«, eben einen Volkskrieg. Der Krieg war für ihn ein viel zu ernstes Geschäft, um ihn unberechenbarem Enthusiasmus anzuvertrauen. Die Allgemeine Wehrpflicht musste er widerstrebend verkünden, und ganz entsetzlich war ihm das »Edikt zum Landsturm«. Nach 1815 wollte er nur noch »Ruhe für das erschöpfte Preußen« und für sich selbst.
Auch die »Vorstellung, dass die intellektuellen Schichten sich enthusiasmiert in Massen [am antinapoleonischen Befreiungskrieg; M. W.] beteiligt hätten, hält realistischer Nachprüfung nicht stand« (Wolfgang Neugebauer).5 Wer konnte, drückte sich. Faktisch dienten eher die Söhne ärmerer Bauern.6 Eine allgemeine Notsituation war nach der Niederlage Preußens gegen Napoleon gegeben. Und nur weil »Not am Mann« war, haben Preußens Monarchie und Aristokratie die für sie bittere Pille der (auch nur nominellen) Allgemeinen Wehrpflicht geschluckt.
Zwischengedanken – vom Besonderen zum Allgemeinen
Es galt nicht zum ersten oder letzten Mal in der Militärgeschichte der Menschheit, wohlgemerkt nicht nur der der Hohenzollern: Krieger jeglicher Art und Ranges gewinnt man nur, wenn sie für die Bereitschaft, ihr Leben zu riskieren, entweder Macht, Geld oder Ansehen – am besten alle drei Bedingungen – erfüllt bekommen.
Sind »die Herrschenden« hierzu nicht bereit, verbleiben ihnen zwei Möglichkeiten. Beide sind empirisch, historisch, doch nur eine moralisch akzeptabel. Die erste: Die Krieger werden gepresst, also wie auch immer gezwungen. Dieses Los traf und trifft vor allem die armen Bevölkerungsschichten. Für sie galt und gilt: Weil und wenn du arm bist, musst du früher sterben. Wie weiland die armen Bauern. Siehe oben.
Möglichkeit zwei zur Gewinnung von Sold-aten ist die Allgemeine Wehrpflicht. Auf den ersten Blick scheint sie eine genial machiavellistische Idee. Erstmals in der Militärgeschichte der Menschheit bekamen »die Herrschenden« durch die Allgemeine Wehrpflicht ihre Kämpfer kostenlos. Kämpfer und eben keine Sold-aten mehr, wenngleich sie weiter so genannt wurden. Auch das ließ sich inhaltlich und sprachlich rechtfertigen, denn sie erhielten einen Sold. Mickriger als in den tatsächlich sold-atischen Zeiten und keinesfalls (wie einst) die eigenen oder gar familiären zivilen Lebenskosten halbwegs deckend, aber zumindest formal Sold.
Der erste Blick täuscht. Die Allgemeine Wehrpflicht kostete die Herrschenden zwar keinen nennenswerten Sold, wohl aber Macht, was wiederum die Untertanen zu Bürgern machte. Der oder die Machthaber mussten nämlich der Allgemeinheit Macht oder Machtteile abgeben. Den Untertanen wurde »von oben« selten präventiv, also eher reaktiv und mehr nolens als volens, dem Druck »von unten« nachgebend, politische Teilhabe und Teilnahme gewährt: in der antiken athenischen Polis in der und durch die Vollversammlung der Bürger – nicht Untertanen! – und in der Moderne durch die Demokratie, also die zumindest gedanklich-theoretisch-legitimatorische Mitbestimmung aller beziehungsweise der Allgemeinheit. So gesehen sind Demokratie und Allgemeine Wehrpflicht zwei Seiten derselben Medaille. Ihr Name: Politische Partizipation.
In Demokratien wiederum ist die Allgemeinheit der Allgemeinen Wehrpflicht nur so lange politisch durchsetzbar, wie die Allgemeinheit darin übereinstimmt, dass ihr staatlich physisches Überleben gefährdet ist. Deshalb ist Israel bis heute eine Demokratie mit Allgemeiner Wehrpflicht, deren Allgemeinheit aus anderen Gründen – Religion und zerbröselndem sicherheitspolitischen Konsens – mehr als nur etwas durchlöchert ist. Ende von Zwischengedanken 1.
Zwischengedanke 2 nutzt wieder den Blick zurück vom Besonderen für den Blick nach vorn und zum Allgemeinen und allgemein Deutschen: Liberale Bemühungen und Reformen im Innern oder die Wege zur Demokratie in Deutschland bedurften (zu?!) oft des Anstoßes von außen. Hier einige Beispiele seit dem 19. Jahrhundert:
nach Napoleons Siegen von 1806 und in den Freiheitskriegen gegen den Kaiser der Franzosen; 1830 als Folge der Julirevolution in Frankreich; ähnlich die Revolution 1848: im Februar zuerst in Frankreich, dann ab März in Deutschland;