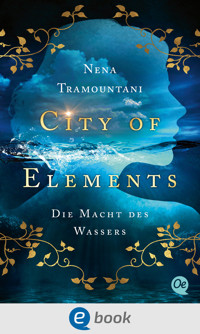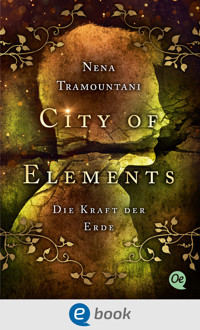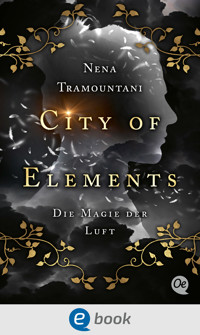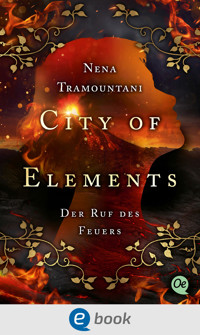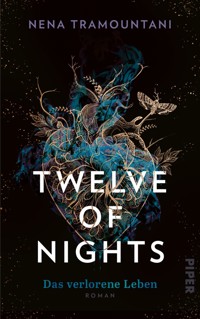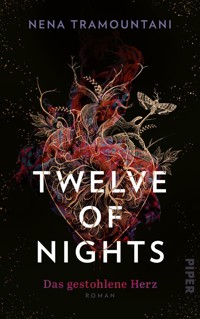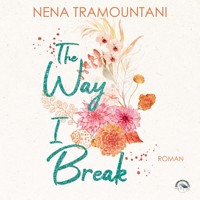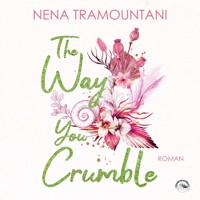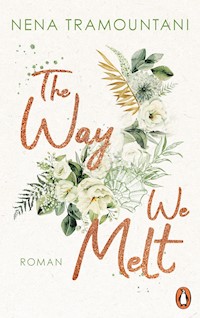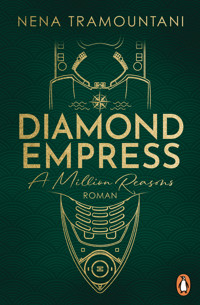
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Ziel? Den Safe ausrauben. Die Erfolgschancen? Gering. Die Motivation? EAT THE RICH.
Fesselnde Spannung trifft auf unwiderstehlichen Spice – Nena Tramountanis hochkarätige Heist-Reihe auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff!
Noemi sitzt in der Falle. Dank ihrer zahlreichen Fehltritte hat die Pianistin weder Geld noch Job und greift in ihrer Not nach dem letzten Rettungsanker: An Bord des Luxusliners Diamond Empress soll sie während seiner 100-tägigen Jungfernfahrt Klavier für die Reichen und Schönen spielen. Als sie gleich am ersten Tag den attraktiven Akrobaten Viktor kennenlernt, verspricht die Reise prickelnder zu werden als erwartet. Und als sie beide einer mysteriösen Einladung um Mitternacht in die Schiffsbibliothek folgen, eröffnet sich ihnen auf einmal eine Welt voller Verheißung und Nervenkitzel. Denn auf dem Schiff befindet sich eine Diebescrew, die den größten Raub aller Zeiten plant. Doch um sich als Mitglieder zu beweisen, müssen Noemi und Viktor sich bei einer Challenge unerwartet nahe kommen – und plötzlich erkennt Noemi: Auf der Diamond Empress riskiert sie nicht nur ihre Freiheit und ihr Leben. Sondern auch ihr Herz.
Funkelnde Diamanten, heiße Emotionen, elektrisierende Cliffhanger
Willkommen an Bord der DIAMOND EMPRESS!
Wenn du auf diese Tropes stehst, bist du hier genau richtig:
• Secret Identity • Opposites Attract • Strangers to Lovers • Only One Bed • Found Family • Eat the Rich
Die Stolen-Dreams-Reihe im Überblick:
1. Diamond Empress. A Million Reasons
2. Diamond Empress. Seven Thieves
3. Diamond Empress. One Heist
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
NENA TRAMOUNTANI begeistert ihre Leserschaft mit ihren New-Adult- und Fantasyromanen. Nach ihrer Soho-Love- und Hungry-Hearts-Reihe schlägt sie ein neues spannendes Kapitel ihrer Autorinnenkarriere auf: In ihrer Stolen-Dreams-Reihe voller heißer Emotionen und elektrisierender Cliffhanger verbindet sie drei unwiderstehliche Lovestories mit dem Nervenkitzel einer fesselnden Heist-Geschichte und lässt ihre Fans bis zur letzten Seite atemlos mitfiebern. Nena Tramountani lebt in Stuttgart.
Außerdem von Nena Tramountani lieferbar:
Die Soho-Love-Reihe:
Fly & Forget
Try & Trust
Play & Pretend
Die Hungry-Hearts-Reihe:
The Way I Break
The Way You Crumble
The Way We Melt
www.penguin-verlag.de
Nena Tramountani
Diamond Empress
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de).
Lektorat: Melike Karamustafa
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Innenillustration: Thilo Corzilius
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-31843-7V001
www.penguin-verlag.de
Playlist
Billie Eilish – you should see me in a crown
RAYE – Escapism.
Sam Tinnesz – Play with Fire (feat. Yacht Money)
Muse – Supermassive Black Hole
MARINA – Hermit the Frog
AWOLNATION – Sail
Valerie Broussard – Trouble
Bea Miller – Playground
Rihanna – Diamonds
Arctic Monkeys – Arabella
Barns Courtney – Sinners
Bow Anderson – Midnight
Michael Bublé – Feeling Good
Stefflon Don – 16 Shots
Lil Wayne – Sucker for Pain (with Wiz Khalifa, Imagine Dragons, Logic & Ty Dolla $ign feat. X Ambassadors)
Lady Gaga – Just Dance
Mother Mother – Burning Pile
Imagine Dragons – Enemy feat. J. I. D.
Saint Motel – Van Horn
Madonna – 4 Minutes (feat. Justin Timberlake & Timbaland)
Rag’n’Bone Man – Skin
Ariana Grande – Into You
Gnarls Barkley – Crazy
Rihanna – Love On The Brain
The Script – Hall of Fame (feat. will. i.am)
Cody Fry – Eleanor Rigby
Black Eyed Peas – I Gotta Feeling
James Blunt – Best Laid Plans
Måneskin – CORALINE
The Ting Tings – That’s Not My Name
Nina Simone – Feeling Good
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell belastende Inhalte.
Deshalb findet sich hier eine Contentwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für die gesamte Handlung.
Wir wünschen allen das bestmögliche Leseerlebnis.
Nena Tramountani und der Penguin Verlag
Für alle, die nach einem Grund suchen.
1. Kapitel NOEMI
Bite my tongue, bide my time
Alles begann mit einem falschen Namen.
»Wie heißt du, Mädchen?«
Ich hatte mich in den letzten Jahren so oft neu erfunden, dass die Situation keine ungewohnte für mich war.
»Noemi.«
Diese Variante des Namens war unter anderem italienisch oder auch spanisch, um bestmöglich zu meinem Aussehen zu passen; in seiner ursprünglichen Form kam er aus dem Hebräischen. Er stammte aus dem Buch Rut, das die ungerechte soziale Realität von Frauen thematisierte.
Ich hasste Frauen.
»Warum bist du hier?«, fragte die Frau neben mir mit schottischem Akzent und entblößte dabei eine Reihe schiefer Zähne.
»Lipgloss.«
Ein keuchendes Husten erfüllte die Zelle, das sich erst nach einigen Sekunden als Lachen entpuppte. Ihr schmächtiger Körper krümmte sich. Sie trug eine lilafarbene Lackhose, darüber einen langen Strickpullover, der aussah, als lebte sie seit Wochen darin. Einzelne Wollfäden hatten sich gelöst, auf Brusthöhe prangte ein dunkelbrauner Fleck.
Ich hatte das tief ausgeschnittene Samtkleid vom gestrigen Auftritt an, dessen Seitenschlitze meine wuchtigen Oberschenkel fast vollständig entblößten. Meine nackten Füße waren von Blasen übersät. Die High Heels, meine Peiniger, lagen vor mir auf dem Boden.
Meine Haut roch subtil nach sündhaft teurem Parfüm, die der Frau neben mir nach säuerlichem Schweiß, dennoch fühlte ich mich deutlich schäbiger als sie.
»Neunundachtzig Pfund«, fügte ich erklärend hinzu.
Ihr Lachen verklang.
Und du, könnte ich fragen, wer bist du? Was hat dich zu diesem Punkt geführt?
Ich hatte mir abtrainiert, Fragen zu stellen. Fragen führten zu falscher Verbundenheit.
»Niemand wird wegen so was eingebuchtet«, brummte sie.
»Ich habe ihn meiner Chefin«, jetzt Ex-Chefin, »aus der Handtasche gestohlen.«
Sie verdrehte die dunkel umrandeten Augen. »Und?«
»Und es ist nicht das erste Mal, dass etwas in der Richtung passiert.«
Es war auch nicht das zweite oder dritte oder zehnte Mal. Bagatelldelikte waren keine große Sache, wenn man aussah wie ich und den entsprechenden Background hatte. Außer man wiederholte sie so oft, dass eine daraus wurde. Aber das hatte die Frau nicht zu interessieren.
Bevor sie etwas erwidern konnte, näherten sich Schritte. Durch das vergitterte Fenster neben der Tür erkannte ich die Polizistin mit dem blonden Pagenkopf, die nun die Arrestzelle aufschloss und mich mürrisch ins Visier nahm.
»Scopelliti«, knurrte sie. »Mitkommen.«
Der Name meiner Eltern ließ mich seit geraumer Zeit zusammenzucken, aber ich hatte seit vierundzwanzig Stunden nicht geschlafen und war zu müde für melodramatische Reaktionen.
Erst später, viel zu spät, würde mir auffallen, dass es nicht der Name war, den ich den Polizisten genannt hatte, als sie mich festgenommen und hierhergebracht hatten. Und auch nicht der Name, unter dem ich im Theater, meiner letzten Arbeitsstelle, bekannt gewesen war.
Ich bückte mich nach meinen Schuhen und folgte der Polizistin nach draußen.
Auf diesem Revier war ich noch nie gewesen. South London war bis vor Kurzem keine Gegend gewesen, in der ich mich oft aufhielt. Aber vor knapp zwei Monaten hatte ich hier einen Job als Pianistin in einem kleinen Theater gefunden.
Wir waren im Eingangsbereich angelangt, und die Polizistin hielt mir einen Briefumschlag sowie einen Plastikbeutel mit meinem Eigentum hin. Eine halb leere Packung Paracetamol, ein mit Strass besetzter Flaschenöffner und eine kleine Tube Vaseline.
»Lass dich nie wieder hier blicken«, zischte sie.
Fast hätte ich gelacht. Als wäre ich freiwillig hergekommen. Doch das Bedürfnis verschwand schnell, als ich realisierte, was sie mit dem Satz implizierte.
Stirnrunzelnd starrte ich von ihrem verkniffenen Gesicht zu ihrer Hand und hinter sie zu ihrem Kollegen, der am Empfang saß und mich aus schmalen Augen musterte.
»Was?«
Meine Stimme klang zittrig. Das musste der Schlafmangel sein.
Die Polizistin drückte mir unsanft den Beutel und den Briefumschlag in die Hand und rauschte ab.
Der Kerl legte den Kopf schief. »Deine Kaution wurde bezahlt.«
Drei Sekunden lang sah ich ihn bewegungslos an, dann folgte der altbekannte Emotionscocktail aus Ohnmacht, Grauen und Scham.
Ich klemmte mir den Beutel unter den Arm und riss den Briefumschlag mit den Zähnen auf, bevor ich den Inhalt hervorzog. Der süß-chemische Geschmack des Klebers breitete sich auf meiner Zunge aus.
Zwei Boarding-Pässe kamen zum Vorschein. Ein One-Way-Flugticket nach New York City und ein Crew-Ticket für …
Ich fluchte. Für das neuste und teuerste Kreuzfahrtschiff von Diamond Cruise Enterprise. Bei dem meine verdammten Eltern Investoren waren.
Der kleine Diamant auf dem Logo funkelte und glitzerte unter der sterilen Deckenbeleuchtung. Hundert-Tage-Reise, stand da. The Diamond Empress, stand da. Jungfernfahrt, stand da.
Was da nicht stand, aber stehen sollte: Leckt mich doch am Arsch.
Der Name, auf den beide Tickets ausgestellt waren, war der aus meinem Pass, der mir bei der Adoption gegeben worden war. Das Datum: Mittwoch nächste Woche.
Ich stopfte die Tickets zurück in den Umschlag. Dann setzte ich einen Fuß vor den anderen, stieß die Tür mit der Schulter auf und ließ das Revier hinter mir. Nach wenigen Metern trat ich in eine schlammige Regenpfütze, ließ mich allerdings nicht davon beirren und dachte erst gar nicht daran, die Drecksschuhe wieder anzuziehen. Es war warm für März, Klimawandel sei Dank.
Mein erster Halt: das Theater. Es war fußläufig erreichbar, wie mir der Stadtplan an der nächsten Tube-Station bestätigte. Gestern, bei der Fahrt im Streifenwagen hierher, war ich nicht besonders aufnahmefähig gewesen. Der Lipgloss-Rausch hatte mir sämtliche Sinne vernebelt. Je mehr Abstand zwischen den Diebstählen lag, desto länger hielt der Rausch an. Und diesmal war er für meine Verhältnisse wirklich lang gewesen. Es hatte beinahe zwei Stunden gebraucht, bis meine Finger nicht mehr gezittert hatten und mein Herz mir nicht mehr aus der Brust springen wollte. Dabei war es zweitrangig, dass ich geschnappt worden war.
Sowohl mein Handy als auch mein Rucksack lagen aus diesem Grund noch in meinem Spind im Theater.
Ich kam an dem Café vorbei, wo ich mir die letzten sechs Wochen fast täglich einen Flat White gegönnt und dabei die kostenlosen Zuckertütchen mitgehen lassen hatte. Das verbuchte ich nicht als Diebstahl, Kunden zahlten schließlich nicht dafür, aber für mich war es wie ein Nikotinpflaster für Kettenraucher. Kein richtiger Adrenalinkick, aber dafür ähnliche Gedanken: Wirst du erwischt? Wirst du erwischt? Wirst du erwischt? Dicht gefolgt von Triumph: Du wirst nicht erwischt. Du bist unbesiegbar.
Zwei Männer mittleren Alters in weißen Hemden saßen an einem der Klapptische draußen und tranken Espresso. Vom Schlag: Dads eklige Arbeitskollegen. Ihre gierigen Blicke fuhren an meinem Körper Aufzug.
Abrupt blieb ich stehen, ließ mein Hab und Gut zu Boden fallen, trat an den Tisch neben ihrem, auf dem sich noch schmutziges Geschirr befand, und griff nach der halb vollen Tasse, an deren Rand ein Lippenstiftabdruck glänzte. Während ich beiden abwechselnd in die Augen starrte, hob ich die Tasse an meinen Mund und trank. Eiskalter bitterer Kaffee floss meine Speiseröhre und mein Kinn hinab, auf direktem Weg in mein Dekolleté. Ich trank die Tasse leer, bevor ich sie auf die Untertasse knallte.
Die beiden Männer tauschten einen beunruhigten Blick, dann sahen sie zeitgleich weg. Ich leckte mir über die Lippen und bückte mich nach meinem Zeug, ohne darauf zu achten, dass meine Brüste aus dem Ausschnitt hervorquollen.
Noemi war ein böses Mädchen.
2. Kapitel NOEMI
One by one by one
Als ich die gepflasterte Straße zum Hintereingang des Theaters ansteuerte, dämmerte es bereits. Der Himmel über den edwardianischen Häusern erstrahlte in einem satten Dunkelorange. Auf den Stufen, die zur mit Stickern beklebten Tür führten, saß eine Frau mit kinnlangem weißblondem Haar. Sie war offenbar gerade mit einem Videocall beschäftigt, aber sobald unsere Blicke sich trafen, sprang sie auf.
»Clover, ich ruf dich später zurück!«, sagte sie in Richtung Bildschirm, nahm die Kopfhörer aus den Ohren und steckte sie zusammen mit dem Handy in die Gesäßtasche ihrer beigefarbenen Jeans.
Keine Ahnung, wie sie hieß. An meinem ersten Arbeitstag war mir das gesamte Ensemble vorgestellt worden, aber so gut ich darin war, mir Informationen zu merken, die ich las, so schlecht war ich darin, mich an irgendwelche Namen zu erinnern, die ich mal gehört hatte, und diese wiederum Gesichtern zuzuordnen. Ich hätte in den vergangenen Wochen nachfragen können, aber wie bereits erwähnt – ich stellte keine Fragen mehr. Ich hatte meine Lektion gelernt. Zu einer Gruppe, auch nur zu einem Menschen gehören zu wollen, war der initiale Fehler, also hatte ich mir das Bedürfnis danach abtrainiert.
Alles, was ich über die Frau vor mir wusste, war, dass sie von den anderen geliebt wurde und eine wichtige Rolle im aktuellen Theaterstück spielte. Es war eine Indie-Produktion irgendeiner abgedrehten Regisseurin mit dramatisch-musikalischer Untermalung, wegen der ich gebucht worden war, ansonsten war auch vom Inhalt nur wenig bei mir hängen geblieben. Das Stück handelte von unglücklicher Liebe, aber tat das nicht jedes Theaterstück seit Anbeginn der Zeit?
Ich hatte perfekt Klavier gespielt. Niemand hatte etwas an mir auszusetzen gehabt. Sechs Wochen regelmäßiges – wenn auch lächerliches – Einkommen. Nur um dann alles für einen Lipgloss aufs Spiel zu setzen.
Eine neue Meisterleistung meinerseits.
»Odessa!«, rief die Schauspielerin. »Oh Gott, ich habe mir solche Sorgen gemacht!«
Es war hart, nicht verwirrt dreinzublicken.
Odessa. Der Name klang so falsch und unpassend in meinen Ohren. So war es immer, wenn ich die alte Haut abgestreift hatte und bereits in der nächsten steckte. Mein vorheriges Leben erschien mir plötzlich weit, weit weg, obwohl es bis gestern Abend noch existiert hatte. Es hatte nichts mehr mit mir zu tun.
»Wie geht’s dir?«, fuhr sie atemlos fort. Auf ihren weißen Wangen bildeten sich rosa Flecken. »Ich will, dass du weißt, ich glaube dir! Es ist mir egal, was die anderen sagen. Du würdest so was niemals tun, das habe ich denen auch gesagt!«
Sie war die Einzige im Theater, die selbst nach mehreren Abfuhren (»Nein, Blondi, ich werde auch heute keinen Kaffee mit dir trinken gehen«) immer noch scheißnett zu mir war.
Das Problem mit Frauen, die nett zu anderen Frauen waren: Man ließ sich leichter von ihnen einlullen, wenn man mal einen schwachen Moment hatte. Und dann tat es noch viel mehr weh, wenn sie früher oder später ihr wahres Gesicht zeigten.
Ja, ich meine dich, Mutter.
»Ich habe es getan«, sagte ich mit einem freundlichen Lächeln.
Ihre blassblauen Augen weiteten sich kaum merklich, bevor sie heftig blinzelte und gleich darauf eine neutrale Miene aufsetzte. »Du bist sicher hier, um deine Sachen zu holen. Warte. Ich bringe sie dir. Nicht, dass Suzie dich sieht. Sie ist seit gestern Abend … na ja, kannst du dir sicher denken …«
Suzie war die Besitzerin des kleinen Theaters. Daran erinnerte ich mich, weil sie meinen Arbeitsvertrag unterschrieben hatte. Das S in ihrer Unterschrift war viel größer als die restlichen Buchstaben. Arrogant, war mein erster Gedanke gewesen. Ich will auch so eine Unterschrift, mein zweiter. Sieht aus, als gehöre sie einem Menschen, den man respektieren sollte.
Respektiert hatte ich Suzie trotzdem nicht, nachdem mir aufgefallen war, dass sie allen, die keine Hauptrolle im Stück spielten, nie richtig in die Augen sah. Für darstellende Kunst hatte sie wenig übrig. Dafür umso mehr für das Prestige, das damit einherging, wenn man ein Avantgarde-Theater besaß und von anderen dafür bewundert wurde.
Ehe ich etwas erwidern konnte, wirbelte die Frau herum, nahm die Treppenstufen nach oben, öffnete die Tür und verschwand im Inneren.
Eine Mischung aus Gesprächen, Gelächter und Musik drang für den Bruchteil einer Sekunde zu mir nach draußen.
Ich ignorierte den Stich in meiner Brust. Der Job war nicht mehr als ein Mittel zum Zweck gewesen, genau wie alle anderen zuvor. Es war nicht so, dass ich mich hier besonders wohlgefühlt hatte. Ich hatte keine »Freunde fürs Leben« gefunden. Dafür hatte ich gesorgt.
Ein paar Sekunden später flog die Tür wieder auf, und die Frau kehrte mit meinem Rucksack zurück. Sie hatte sich die Haare hinter die Ohren gesteckt. Nicht zum ersten Mal musste ich an eine Elfe denken, wenn ich sie ansah.
»Danke«, rang ich mir ab und nahm den Rucksack entgegen.
Sie nickte knapp. »Das Handy habe ich dir in die Vordertasche gesteckt.« Ein tiefer Atemzug. »Wenn ich irgendwas für dich tun kann …«
»Danke«, wiederholte ich lauter. Dann wandte ich mich ab und ging hastig davon.
Ich war schon fast außer Hörweite, als noch einmal ihre Stimme hinter mir erklang.
»Wieso hast du es getan?«
Geh einfach weiter. Geh weiter!
Wie ferngesteuert drehte ich mich um. »Weil ich mich nicht mehr dagegen wehren konnte.«
Sie zog die Brauen zusammen. »Gegen was?«
Mein Herz donnerte gegen meine Rippen. »Die Sinnlosigkeit.«
3. Kapitel NOEMI
A little context, if you care to listen
Ich wusste nicht, wer meine Erzeuger waren, und es war mir auch egal. Als ich endlich verstanden hatte, was meine Adoptiveltern mir angetan hatten, war der Schaden bereits angerichtet. Bei feierlichem Kerzenlicht schwor ich mir, nie wieder einer Menschenseele zu vertrauen. Es war mein achtzehnter Geburtstag. Inzwischen über sechs Jahre her.
In diesem Alter hatte ich mich überall als Isabella vorgestellt. Isabella war still und fügsam gewesen. Das musste sie nach außen hin sein, denn sie war mein Ticket in die Freiheit. Mein Plan ging auf: Ich zog für ein Studium, das ich nie auch nur anzufangen gedachte, nach London und brachte damit einen Ozean zwischen meine Eltern und mich. Ich ließ den Kontakt langsam einschlafen, meldete mich immer sporadischer. Die Kraft, mir eine neue Nummer zuzulegen und sie schließlich zu ghosten, fand ich erst drei Jahre später. Nein, nicht ich. Und auch nicht Isabella.
Beatriz. Sie war eine meiner Lieblinge gewesen. Bis sie sich verliebte.
Übelkeit stieg in mir auf, während ich meine Wohnungstür aufschloss und dabei die mit gelbem Gaffer Tape angeklebten Mahnungen abriss.
Meine Wohnung bestand aus einem zehn Quadratmeter großen Zimmer, die Dusche befand sich in der Küche, das WC draußen auf dem Flur. Ich teilte es mir mit drei anderen Leuten. Es war alles, was ich für mein Budget bekommen hatte.
Die Sache mit dem Geld: Nur um das klarzustellen, ich war eine privilegierte Bitch. Das war mir vielleicht nicht in die Wiege gelegt worden, aber seit den unterschriebenen Adoptionspapieren beschlossene Sache. Meinen Eltern konnte ich zumindest diesen Teil nicht verdenken, ich war ein entzückendes Kleinkind gewesen: dunkle Locken, rote Pausbacken und riesige Augen, die meinem Gesicht stets einen erstaunten Ausdruck verliehen – ich hätte mich auch ausgesucht.
Bis vor einem Jahr hatten mir meine Eltern jeden Monat, pünktlich zum Ersten, fünftausend Dollar überwiesen. Ich hätte mir locker etwas Größeres, Schöneres, Besseres leisten können. Ich hätte das Konto sperren lassen können. Alles an sie zurücküberweisen können. Stattdessen hatte ich es als Schmerzensgeld betrachtet und Monat für Monat irgendeiner gemeinnützigen Organisation gespendet, von der ich wusste, dass meine Eltern sie niemals unterstützen würden. Al-Towbah Islamic Centre zum Beispiel. Oder The National Transgender Charity. In ihrem Namen, selbstverständlich. Manchmal, wenn ich einen besonders schlechten Tag gehabt hatte, hatte ich mir auch Junkfood davon gekauft und es im Stehen inhaliert, bis mir so übel war, dass ich nur noch gekrümmt zu meiner Matratze kriechen konnte. Aber nie etwas Grundlegendes. Nie hatte ich Miete oder Strom davon bezahlt. Nie wieder von ihnen abhängig sein, das hatte ich mir geschworen, selbst wenn sie es nicht mitbekamen.
Inzwischen bereute ich meinen Stolz. Es war einfach, sparsam zu leben, wenn man sich sicher sein konnte, dass im Hintergrund ein finanzielles Polster vorhanden war. Mein Leben war trotzdem nicht sonderlich tragisch. Wirklich nicht, versprochen. Ich langweilte mich nur oft zu Tode. Das war tatsächlich ein Problem.
Abwechslung musste her. Ein neuer Job. Nicht der manipulative Scheiß, der sich in dem Briefumschlag befand, den ich neben das mit Staub und Concealer-Flecken bedeckte Spülbecken pfefferte.
Ein Job, den ich mir selbst besorgte.
Odessa war durch einen Zufall an das Theater gekommen, nicht wegen ihrer strahlenden Persönlichkeit, aber Noemi war dynamisch. Noemi standen alle Möglichkeiten offen. Sie würde duschen, sich nicht am eiskalten Wasser stören und auch nicht daran, dass Wasser eine nette Umschreibung für die gelbe Brühe war, die aus dem Strahl kam, ihre kastanienbraunen Locken sorgfältig trocken föhnen, ihr professionellstes Outfit anziehen und sich auf die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz machen.
Ich gähnte so herzhaft, dass ich kurz Angst hatte, ich würde mir dabei den Kiefer ausrenken.
Okay, Noemi würde gar nichts, bevor sie sich nicht eine Mütze Schlaf gegönnt hatte.
Ohne mich umzuziehen oder abzuschminken, sank ich auf die Matratze. Kaum dass meine Wange das Kissen berührte, schlief ich ein.
Ich träumte von Diamanten.
4. Kapitel NOEMI
I found myself in a shit position
Am Dienstag klapperte ich sämtliche Pianobars ab, bei denen ich nicht schon gearbeitet hatte und rausgeworfen worden war. Vergeblich – niemand suchte nach einer neuen Pianistin.
Bei der letzten unterlief mir ein Fehler, sie hatten einen neuen Anstrich und ein neues Logo, weswegen ich sie für eine mir unbekannte Kneipe hielt. Sobald Zachary mich erblickte, griff er nach dem Besen hinter dem Tresen und stürzte auf mich zu.
»Fünf Wochen!«, brüllte er. »Es hat fünf Wochen gedauert, bis ich Speedy gefunden habe!«
In letzter Sekunde gelang es mir zu flüchten.
Speedy war der heiß geliebte Pomeranian-Chihuahua-Mix des Barkeepers, und obwohl ich wirklich großen Respekt vor Tieren als theoretisches Konzept hatte, war mir schleierhaft, warum man den Drang verspürte, mit ihnen zusammenzuleben. Ein weiteres hilfloses Lebewesen, um das ich mich kümmern musste? Nein danke!
Jedenfalls hatte ich weniger Probleme mit Speedy gehabt, mehr mit seinem Besitzer, der nicht aufhörte, mir auf die Pelle zu rücken, nachdem mir mal in leicht angetrunkenem Zustand nach Schichtende rausgerutscht war, dass ich in der Vergangenheit süchtig nach der Aufmerksamkeit von Männern gewesen war.
Also hatte ich besagten Hund geklaut und in das am weitesten entfernte Tierheim gebracht, das ich auf die Schnelle auftun konnte. Zachary hatte, nett ausgedrückt, das Interesse an mir verloren, aber ich leider auch meinen Job.
Am Mittwoch nahm ich mir die teuersten Hotels vor, obwohl bei dem Gedanken, für diese Art von Klientel zu spielen, mein Würgereflex ausgelöst wurde.
Es zahlte sich nicht aus, meine Prinzipien über Bord zu werfen. Niemand wollte mich einstellen. Als ich die Lobby eines besonders pompösen Hotels in Kensington betrat, starrte mich die Rezeptionistin unverhohlen an, verschwand durch eine Hintertür und kehrte kurz darauf mit einem laminierten Zettel zurück, auf dem mein Gesicht prangte und darüber in fetten roten Lettern Hausverbot. Sie nickte dem Security-Typen zu, und ich machte mich aus dem Staub, bevor er mich packen konnte. Ich wusste nicht mehr, was genau ich hier verbrochen hatte, aber das grün-rosafarbene Deckenfresko löste eine entfernte Erinnerung in mir aus. Mir kam der Gedanke, dass ich vermutlich anfangen sollte, eine Liste der Etablissements zu führen, aus denen ich bereits rausgeschmissen worden war.
Am Donnerstag wurde ich von meiner Vermieterin geweckt, die so heftig gegen meine Tür hämmerte, dass die Wände zitterten, und dabei meinen Namen brüllte. Ich zog meine Bettdecke bis ans Kinn und stellte mich tot, bis sie abrauschte. Aus der neuen Mahnung, die an meiner Tür klebte, faltete ich einen Papierflieger und ließ ihn über den Haushof ins gegenüberliegende offen stehende Fenster segeln. Danach beschloss ich, dass es an der Zeit war, auch andere Jobs in Erwägung zu ziehen.
Klavierspielen war das Einzige, was ich mehrere Tage am Stück tun konnte, ohne den Drang zu verspüren, mir die Haut abziehen zu wollen, aber ich konnte es mir gerade nicht leisten, wählerisch zu sein. In der Vergangenheit hatte ich unter anderem schon als Barista gearbeitet, als Putzkraft, als Hostess in einem Escape-Room, als Kinderanimateurin, als Verkäuferin in einem Burgerladen, als Ticketverkäuferin im Zoo. Die Liste war lang. Keiner dieser Jobs war besser als der andere gewesen. Es spielte keine Rolle, wie nett oder unfreundlich die Chefs, Kolleginnen oder Kunden waren. Spätestens an Tag zwei verspürte ich ein inneres Kribbeln, das sich mit jeder weiteren Stunde zu einem immer ekelhafteren Jucken auswuchs.
Da ich weder eine Ausbildung noch ein Studium vorzuweisen hatte, konnte ich mir auch Jobs in der Oper oder in größeren Theatern abschminken. Ich hatte mir kurzzeitig überlegt, Musik zu studieren, aber beim Klavierspielen verließ ich mich ausschließlich auf mein Gehör. Sobald ich die Noten las und verstand, hatte ich keine Lust mehr auf das Stück. Aus diesem Grund hatte ich auch bei meinem einzigen Versuch als Klavierlehrerin versagt. Ich hatte mich an meinen eigenen Klavierunterricht als Kind erinnert, trotz, nicht wegen dem ich eine Leidenschaft für dieses Instrument entwickelt hatte, und hatte alles anders machen wollen. Die Stunde endete damit, dass der Junge weinend in die Arme seiner Mutter rannte und diese sich weigerte, mich zu bezahlen.
Also kein Klavierjob.
Ich bewarb mich als Kellnerin bei einem Coffeeshop in Soho – mit leicht modifiziertem Lebenslauf – und hatte schon Freitagmorgen meinen Probetag. Sie waren wohl verzweifelt. Als ich vier Stunden später Mittagspause hatte, trat ich auf die Straße, um mir etwas zu essen zu holen, lief stattdessen aber immer weiter, weiter und weiter, stundenlang, durch den Regen, auf die andere Seite der Themse, bis ich meine Wohnung erreichte. Die Geräusche der Siebträgermaschine und der Kaffeemühle verfolgten mich bei jedem Schritt, die immer gleichen Gespräche … Auch ich war verzweifelt, aber ich konnte nicht. Ich konnte nicht.
Am Samstag wachte ich weit nach Mittag mit dem Gedanken an einen tiefen schwarzen Ozean auf. Ich presste mein Gesicht ins Kissen und schrie. Dann griff ich nach meinem Handy, verband mich mit dem WLAN der Nachbarn über mir und gab Diamond Cruises in die Suchmaschine ein. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass die Uhrzeit trotz Zeitverschiebung angemessen war, rief ich die Telefonnummer an, die ausgespuckt wurde, und betete, mein verbliebenes Guthaben möge für einen transatlantischen Anruf reichen.
Eine übermotivierte Automatikstimme wies mich an, eine Zahl zu drücken, je nachdem, was für ein Anliegen ich hatte. Ich wählte die Drei – eine Frage zu meiner Buchung – und landete in der Warteschleife. Ein klassisches Stück, das mit einem Trauermarsch begann, lief. Wenn mich nicht alles täuschte, hatte ich es schon bei einer Ballettaufführung in der Metropolitan Opera gehört. Ich verbrachte acht Minuten damit, zu überlegen, welche es gewesen war. Gerade als ich darauf kam – Tschaikowskys Sinfonie Nr. 3 in D-Dur, zu der George Balanchine in seinem Ballett Jewels den dritten Akt namens Diamonds choreografiert hatte –, klickte es in der Leitung.
»Diamond Cruise Enterprise, Sie sprechen mit Ava Jamshidi, wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
Ich setzte mich auf, rollte die Schultern nach hinten, bis es knackte, und räusperte mich. »Guten Tag, ich bräuchte eine Auskunft zu meinem Crew-Ticket.«
»Ihr Name oder Ihre Ticketnummer, bitte.«
»Moment.«
Ich rannte in die Küche, zog das Ticket aus dem Umschlag und las die Nummer vor, die oben rechts abgedruckt war.
»Miss Scopelliti?«
»Ja«, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Welche Art von Auskunft benötigen Sie?«
»Ich wüsste gern, worum genau es sich bei meinem Job handelt.«
Eine lange Pause entstand. Selbst durch den Hörer konnte ich ihre Verblüffung spüren.
»Wie … wie meinen Sie das?«
»Als was soll ich arbeiten? Auf diesem neuen Schiff?«
Erneut schwieg sie.
Ich seufzte tief. »Bitte.«
»Wurde Ihnen das nicht während Ihres Vorstellungsgesprächs oder bei Ihrer Zusage mitgeteilt?«
Es kostete mich einige Willenskraft, nicht zu schreien oder hysterisch zu lachen. »Doch, klar. Ich habe es bloß vergessen.«
»Soll das ein Scherz sein?« In ihre Stimme hatte sich ein Anflug von Verärgerung geschlichen.
»Nein. Bitte.«
Weitere Sekunden vergingen.
»Bitte.«
Als sie erneut sprach, klang sie wieder professionell-distanziert wie zu Beginn. »Als Pianistin in unserem Eventbereich Dream Factory. Wir freuen uns schon sehr auf Sie, Miss Scopelliti.«
»Verarschen Sie mich nicht«, wollte ich antworten, aber da ertönte ein Piepen.
Mein Guthaben war leer.
5. Kapitel VIKTOR
I light the match to taste the heat
Würdest du lieber den Hitze- oder den Kältetod sterben?
Ich trat ein paar Schritte zurück, streifte mir Schuhe und Socken ab. Startete die Musik. Ließ meinen Blick über die blinkenden LED-Bildschirme und Reklametafeln wandern: Parfüm-Werbespots, der Trailer eines neuen Marvel-Films, ein Musical-Plakat. Über die Autos. Über die Passanten. Grinste träge, als der Blick einer Frau mit Kleinkind an der Hand an mir hängen blieb. Sie lächelte vorsichtig zurück.
Samstagabend, Punkt 22 Uhr. Der Times Square war laut, überfüllt und lichtüberflutet wie eh und je.
Es hatte lange gedauert, bis ich den perfekten Ort, die perfekte Uhrzeit und den perfekten Act mit dem perfekten Equipment zusammengestellt hatte.
Hitze oder Kälte?
Die Musik wurde lauter. Nicht wirklich. Nur in meinem Kopf. So war es immer, wenn ich die Welt für ein paar Sekunden ausschalten und mich nur auf meinen Körper konzentrieren konnte.
Ich griff nach dem Holzstab, drehte ihn mit beiden Händen über meinem Kopf im Kreis, schneller und schneller, bis weitere Augenpaare in meine Richtung zuckten. Zum Taktwechsel des Beats hämmerte ich ihn auf den Asphalt, stützte mich mit beiden Händen darauf ab, spannte meine Muskeln an, stieß mich vom Boden ab und sprang. Wie in Zeitlupe wirbelte ich durch die Luft, drehte mich exakt im richtigen Moment, dann noch mal, während ich den Stab blitzschnell mitriss. Als ich wieder auf beiden Beinen landete, waren mehrere Leute stehen geblieben. Zehn, um genau zu sein.
Zehn war für den Anfang besser als gut.
Sag schon. Wenn du dich entscheiden müsstest?
Ich deutete eine Verbeugung an, ließ den Stab dabei zu Boden gleiten und griff nach den drei kleineren Fackeln, die ich dort abgelegt hatte. In Sekundenschnelle entzündete ich sie der Reihe nach und warf sie in die Luft, sobald sie brannten.
Ein Raunen ging durch die Menge. Sie kamen näher. Wie Raubtiere, die ihre Beute umzingelten.
Dabei war es genau andersrum. Sie waren meine Beute.
Es war natürlich strengstens verboten, eine derartige Show auf dem Times Square aufzuführen. Ich hätte mir auch einen anderen Platz aussuchen können, wo das Risiko, erwischt zu werden, geringer war. Aber in den letzten Monaten hatte ich oft den Standort gewechselt, und nirgendwo gab es innerhalb kürzester Zeit so viel Kohle wie hier. Also hatte ich analysiert, wann die NYPD und weitere Sicherheitskräfte in der Regel patrouillierten, wann es Schichtwechsel gab und wie ich reagieren musste, wenn jemand von ihnen auf mich aufmerksam wurde. Auch wenn es hin und wieder knapp gewesen war, geschnappt worden war ich noch nie, und das würde mir auch heute nicht passieren.
Die Hitze des Feuers war eine willkommene Abwechslung. Meine Brust war nackt und der Märzwind erbarmungslos.
Mit brennenden Fackeln jonglieren war eine Sache. Mich dabei im Takt der Musik zu bewegen, eine ganz andere. An diesem Punkt stellte ich mir immer vor, um meinen Hals befände sich ein brennender Strick, der mich passend zum Rhythmus herumriss. Ich war nicht mehr Herr meiner Bewegungen, so sollte es wirken. Eine unsichtbare Macht zog mich mit.
Als ich zurückzuckte, den Rücken durchbog, den Kopf für den Bruchteil eines Moments nach hinten riss und eine der Fackeln mich beinahe am Schlüsselbein streifte, keuchte jemand links von mir auf. Mit einem erneuten Grinsen jonglierte ich weiter.
Der Song dauerte drei Minuten, eine war bereits verstrichen. Zeit für die nächste Phase.
Ich fing eine Fackel nach der anderen auf, ohne das Feuer zu löschen, und rannte mit ihnen von mir gestreckt am Publikum entlang, das inzwischen einen Halbkreis um mich gebildet hatte. Einige zuckten reflexartig zurück. Andere filmten mit erhobenen Handys und schienen sich nicht an der Nähe des Feuers zu stören. Manche waren nicht zum ersten Mal hier. Es hatte sich rumgesprochen, wann ich wo zu finden war.
Ich nahm wieder meinen Platz ein, legte den Kopf in den Nacken und führte die Fackeln ganz langsam in meinen Mund, um sie zu löschen. Der Schrei eines kleinen Jungen tönte in meinen Ohren.
Hitze oder Kälte?
Die letzte Fackel löschte ich nicht, stattdessen klemmte ich sie auf dem Boden zwischen zwei Steinen ein, die ich mir dort bereitgelegt hatte. Ich tanzte im Takt der Musik um sie herum wie bei einer Beschwörung, zuckte heftig, schlang die Arme um mich, machte mich ganz klein, dann breitete ich sie aus wie Flügel. Beim Drop des Beats ging ich in einen kerzengeraden Handstand und führte die Runde im gleichen Tempo auf den Händen fort.
Jubel durchbrach den lasziven Gesang.
Ich griff nach der brennenden Fackel, stützte mich währenddessen mit einem Arm ab, konzentrierte mich auf die Spannung in meinem Körper, beugte die Beine, klemmte die Fackel zwischen meinen Füßen fest, alles innerhalb von Sekunden, ehe ich meine Beine wieder in die Höhe streckte.
Ein paar Leute klatschten.
Ich begann, mich schneller vorwärtszubewegen. Kurz vor dem großen Finale durchbrach ich die Kreisbewegung und steuerte erneut das Publikum an. Aus dem Halbkreis war ein geschlossener geworden. Dutzende Schuhpaare waren zu sehen. Während ich eine ganze Runde drehte, zuckte niemand vor mir zurück.
Ich hatte mir schon viele meiner Aufnahmen angesehen. An diesem Punkt wirkte es, als würde das Feuer flüssig werden, so schnell bewegte ich mich. Bei Nacht war es noch eindrucksvoller. War es dunkel genug, so schien die Flamme in der Luft zu schweben.
Schweiß rann mir den Rücken hinauf, direkt zwischen meine Schulterblätter und meinen Nacken entlang. Meine Muskeln brannten.
Nur noch zehn Sekunden.
Ich schloss die Augen. An diesem Punkt hörte ich ihre Stimme immer am deutlichsten.
Viktor.
Ich schwang meine Füße nach hinten und schleuderte die brennende Fackel in die Höhe, schlug die Augen auf, presste meine Handflächen mit ganzer Kraft gegen den Asphalt und sprang im hohen Bogen auf die Füße.
In der Sekunde, in der mir die Fackel entgegenflog, fing ich sie auf. Die Flamme zischte wütend.
Das Lied endete. Alles bebte. Der Boden zu meinen Füßen. Die Welt. Mein Körper.
Ohrenbetäubender Applaus brach aus. Einen Augenblick lang klang es wie Wellenbrechen. Obwohl ich mein ganzes bisheriges Leben in New York City verbracht hatte, sah ich das Meer viel zu selten.
Ich malte ein Lächeln auf meine Lippen und verbeugte mich tief. Mein Atem kam stoßweise.
Hitzetod, antwortete ich in meinem Kopf. Ich würde tausendmal lieber verbrennen als erfrieren.
Das kann nur jemand sagen, der noch nie in seinem Leben in einem brennenden Haus gefangen war, erwiderte sie in meiner Erinnerung.
Ich richtete mich auf, schnappte mir die Cap, die neben meinem Rucksack lag, und ließ sie durch die Menge wandern. Die Leute hatten längst ihre Portemonnaies gezückt.
Mein Blick traf auf ein Mädchen in der ersten Reihe, das sich an das Bein seiner Mutter klammerte und mich mit riesigen Augen anstarrte. Aus ihren Nasenlöchern rann dunkelrotes Blut. Über ihre Lippen, über ihr Kinn … Wie gebannt sah sie mich an. Sie befand sich kaum zwei Meter von mir entfernt.
Schwindel überfiel mich.
Nein. Fuck. Bitte nicht jetzt. Nicht hier.
Als ihre Mutter das Nasenbluten bemerkte, zückte sie ein Taschentuch. Zu spät. Mir gelang es gerade noch, die brennende Fackel zu löschen. Dann knickten meine Beine weg, und meine glühende Wange machte Bekanntschaft mit dem Boden.
Du hast dich geirrt, Mom, dachte ich, bevor ich das Bewusstsein verlor. Das brennende Haus bin ich.
6. Kapitel VIKTOR
Secrets I can’t tell
Kälte. Das war das Erste, was mir auffiel. Das Zweite war ein durchdringender Schmerz in meinem Rücken. Ein vertrautes Gemisch aus hupenden Autos, Regentropfen und Stimmengewirr drang an meine Ohren. Mein Herz raste.
Ächzend schlug ich die Augen auf. Und kniff sie direkt wieder zu. Die Neonlichter waren viel zu grell. Immer noch Times Square. Aber keine Polizei vor mir. Alles gut. Ich tastete meinen Körper ab. Mit jeder Sekunde trat der Schmerz mehr in den Hintergrund. Nichts gebrochen.
Erneut öffnete ich die Augen, diesmal langsamer. Über mir befanden sich Magazine und Zeitungen. People. Women’s Health. Forbes. NY Times. Mein Blick krallte sich an der erstbesten Schlagzeile fest: Titanic des 21. Jahrhunderts?
Ganz langsam drehte ich den Kopf weg vom Zeitungsstand. Ein spitz zulaufendes Paar Schuhe, unmittelbar vor meinem Gesicht. Italienische Herrenschuhe. Dunkles Krokodilleder. Obwohl es in Strömen zu regnen angefangen hatte, waren die Schuhe blitzblank.
Ich hob den Kopf. Eine behaarte Hand wurde mir entgegengestreckt.
Ohne zu überlegen, packte ich sie und ließ mich hochziehen. Sie gehörte zu einem Mann, der mir gerade mal bis zur Schulter reichte, aber überraschend kräftig war. Er hatte einen silbergrauen Dreitagebart, hohe Wangenknochen und trug einen schwarz-weiß gescheckten Pelzmantel und eine weiße Schiebermütze. An jedem seiner tätowierten Finger steckte ein Goldring. Ich schätzte ihn auf Anfang sechzig. Als er lächelte, funkelten seine Augen wie Obsidiane.
»Danke«, wollte ich sagen, doch in dem Moment registrierte ich unsere Umgebung – und was fehlte. Die Menschenmenge hatte sich aufgelöst.
Wie viel Zeit war vergangen? Wer hatte mich hier rübergezogen? Und wo zur Hölle …
Ich ließ ihn los, als hätte ich mich verbrannt. »Meine Sachen …«
Der Kiosk befand sich schräg gegenüber von dem Punkt, an dem ich ohnmächtig geworden war. Aus der Entfernung und durch den Regen konnte ich keine Details erkennen, aber eins war sicher: Mein Rucksack war nirgendwo zu sehen, ebenso wenig wie meine Kopfbedeckung, in der ich Geld sammelte.
Ich rannte los. Ein Taxi bremste mit quietschenden Reifen vor mir ab. Das Fluchen des Fahrers war trotz geschlossener Fenster nicht zu überhören. Meine Umgebung erschien mir wie weichgezeichnet. Meine Knie waren butterweich, aber ich rannte weiter, ließ das lang gezogene Hupen hinter mir. Quetschte mich zwischen einer Touristengruppe und einer Bachelorette-Partygruppe durch, blieb erst stehen, als ich mich in der Mitte der Kreuzung befand. Ich entdeckte die Fackeln und den Holzstab. Klatschnass und jeglicher Magie beraubt. Meine Schuhe und Socken lagen ebenfalls dort, wo ich sie zurückgelassen hatte.
Das Blut rauschte in meinen Ohren, während ich mich hinunterbückte und mir beides überstreifte, obwohl mich die nasse Kälte frösteln ließ. Regen lief mir in Schlieren übers Gesicht und über meine Brust. Niemand nahm Notiz von mir. Noch vor wenigen Augenblicken war ich die Attraktion schlechthin gewesen, jetzt konnte ich niemanden mehr täuschen. Der Bann war gebrochen.
Die Musikbox war weg. Und mein Rucksack mit meiner Kleidung, dem ganzen Equipment, mit dem Bargeld, das ich mir mühsam Woche für Woche verdient hatte. Alles, was mir auf dieser Welt geblieben war. Ich wollte schreien, doch kein Ton kam mir über die Lippen.
Denk nach, flüsterte meine Mutter in meinem Kopf. Du kannst es dir nicht leisten auseinanderzufallen. Was ist der nächste Schritt?
Essen besorgen. Dann einen trockenen Schlafplatz suchen. Bowery Mission war eine Option. Falls die voll waren – das waren sie um die Uhrzeit meistens – und das Wetter so blieb, vielleicht Penn Station. Davor wenigstens zum nächsten Food-Bank-Spot.
»Tut mir leid«, ertönte es hinter mir.
Ich fuhr herum. Der Mann im Pelzmantel war mir gefolgt. Erst jetzt fiel mir auf, dass er einen Gehstock benutzte und leicht gebeugt lief. Seine kehlige Stimme klang ganz und gar nicht nach Mitgefühl. Das Funkeln in seinen Augen drehte mir den Magen um.
Vertraue deiner Intuition. Selbst wenn dein Verstand etwas nicht gleich benennen kann, dein Bauch spürt es sofort. Lerne aus meinen Fehlern.
»Haben Sie etwas gesehen?«, würgte ich hervor und deutete auf die Stelle, wo sich mein Rucksack befunden hatte.
Er drehte den Kopf leicht zur Seite. »Ein paar Halbwüchsige«, sagte er und schnalzte bedauernd mit der Zunge. »Man kann heutzutage niemandem mehr vertrauen, Viktor.«
Meine Gesichtszüge entglitten mir. Aus Reflex wollte ich einen Schritt nach hinten treten, rührte mich allerdings nicht von der Stelle.
Lass sie niemals deine Angst spüren. Du bist groß. Du bist stark. Im Gegensatz zu mir kannst du gefährlich wirken. Nutze diesen Vorteil.
»Kennen wir uns?«, gab ich so gelassen wie möglich zurück.
Auch wenn ich mir sicher war, ihm noch nie begegnet zu sein, konnte ich nicht ausschließen, dass er einen oder mehrere meiner Auftritte gesehen hatte.
»Nein.« Ein Lächeln umspielte seine vollen Lippen. »Aber ich bin hier, um das zu ändern.« Er streckte eine Hand aus. »Ernest. Du kannst mich Ernie nennen.«
Ich bewegte mich nicht.
»Hast du schon einen Schlafplatz für heute Nacht?«, fuhr er fort, während er sich über den Bart strich.
»Ich mach so was nicht mehr.«
Eine Weile hatte ich mir überlegt, mich richtig zu verkaufen. Mein Körper war mein verlässlichstes Mittel zum Zweck, wieso sollte ich ihn also nicht auch auf diese Weise nutzen? Ich hätte so viel schneller so viel mehr Kohle machen können. Millionen Menschen auf der Welt hatten tagtäglich Sex gegen ihren Willen oder obwohl sie die Person nicht attraktiv fanden – warum es nicht für Geld und nach den eigenen Spielregeln tun? Ich kannte genug Leute, denen das Spaß machte.
Mein Weg war bisher ein anderer gewesen. Ich hatte mich nicht bezahlen lassen. Nicht direkt jedenfalls. Mich selbst verkaufte ich vermutlich trotzdem. Meine Entlohnung bestand darin, eine Nacht lang, manchmal mehrere Nächte am Stück, so tun zu können, als wäre ich einfach irgendein Typ Mitte zwanzig mit einem Dating-App-Profil. In einem warmen Bett zu schlafen, in einer eingerichteten Wohnung. Leider hatte mir die Beziehung zu Nat, oder was auch immer das gewesen war, gezeigt, dass ich andere Wege finden musste.
»Ich weiß.« Sein Lächeln erlosch. »Wie sieht es mit einem Schlafplatz für hundert Nächte aus? Wärst du in diesem Fall interessiert?«
Wortlos starrte ich ihn an. Der Regen wurde mit jeder Sekunde stärker. Eine dicke Gänsehaut überzog meinen Körper. Bald würde mir so kalt sein, dass ich meine Zehen nicht mehr spürte.
Dreh den Spieß um. Wenn sie dich ausnutzen wollen, musst du sie ausnutzen.
Der Mann seufzte. »Du bist süß, aber ungefähr dreißig Jahre zu jung für mich, mein Lieber. Niemand will dir an die Wäsche.«
»Was wollen Sie dann?«
Seine Mundwinkel bogen sich wieder nach oben. »Dir die Chance deines Lebens bieten.«
7. Kapitel VIKTOR
How long before you tell the truth?
Sein Name sei Ernest Ramon Ariel Walker-Petrakis, sagte er, und er bewohne eine Suite in einem Hotel am Central Park. Die er mir für heute Nacht überlassen wolle. Als er ein Taxi heranwinkte – »Sechs Blocks zu Fuß sind sechs zu viel«, fügte er hinzu und wedelte mit seiner Gehhilfe –, stieg ich ein und nahm auf der Rückbank Platz.
Er selbst setzte sich neben den Fahrer, der im Rückspiegel argwöhnisch meinen nackten Oberkörper musterte.
»Zum Plaza, bitte.«
Das Auto fuhr los.
Panik hämmerte ihre Klauen in mein Herz. Was tat ich hier? Hatte ich vollständig den Verstand verloren? Alles, was ich besaß, war weg. Wollte ich auch noch mein Leben verlieren?
Ich vergrub meine Hände in den Hosentaschen. Wie sehr ich mich jetzt dafür verfluchte, dass ich mein Messer während der Auftritte immer im Rucksack ließ. Mit einem Wildfremden in einem der teuersten Hotels der Stadt abzusteigen – das war definitiv etwas anderes, als jemanden übers Onlinedating kennenzulernen. Anhand der Profile konnte ich inzwischen ganz gut einschätzen, wer eine Lüge präsentierte und wer die Wahrheit zeigte. Wenn der Kerl wirklich keinen Sex im Sinn hatte, dann könnte er mich immer noch an jemanden verkaufen. Oder Schlimmeres. Selbst wenn ich es körperlich mit ihm aufnehmen konnte, wer garantierte mir, dass er keine Waffe bei sich trug? Oder Komplizen hatte, die in seiner Suite auf mich warteten? Er hatte meinen Namen gekannt. Was wusste er noch über mich? Wie lang hatte er mich beobachtet?
»Hier.«
Ernest – oder wie auch immer er in Wirklichkeit hieß – streckte eine Hand in meine Richtung aus, ohne mich anzusehen. »Googel mich.«
Ich zögerte keine Sekunde, sondern schnappte mir sein Handy. Im Notfall würde ich damit abhauen, sobald das Taxi hielt. Mein eigenes Telefon befand sich in meinem geklauten Rucksack.
Da das Handy bereits entsperrt war, klickte ich auf das Browser-Symbol und begann in die Suchleiste zu tippen. Schon nach »Ramon« wurde mir der gesamte Name vorgeschlagen. Über zehntausend Treffer.
Der aktuellste war ein Artikel eines Diamanten-Unternehmens mit dem Titel Unser Ass im Ärmel. Darunter: Ältester Mitarbeiter wird geehrt. Ich überflog den Text und blieb an einem Zitat von irgendeinem hohen Tier hängen. »Ernie, wie seine Freunde ihn nennen dürfen, ist Diamond Cruises. Unsere Gäste können sich keine Kreuzfahrt ohne ihn vorstellen, und wir sind gottfroh, dass er auch bei der Jungfernfahrt unseres ganzen Stolzes als Croupier im Casino zu finden sein wird.«
Ich klickte zurück. Wie sollte mich das absichern? Nur weil er nach außen hin ein angesehener Mitarbeiter von irgendeinem protzigen Scheißunternehmen war, hieß das nicht, dass er keinen Dreck am Stecken hatte. Und dann auch noch Glücksspiel.
Es gab weitere Artikel dieser Art sowie unzählige Social-Media-Accounts – von ihm persönlich, von dem Unternehmen, von Influencerinnen und Influencern. Auf einigen Fotos war er an einem Roulettetisch zu sehen, mit Prominenten an seiner Seite.
Meine Mutter wäre ganz aus dem Häuschen gewesen. Man könnte meinen, wenn man in New York lebte, gewöhnte man sich irgendwann daran, berühmten Leuten zu begegnen. Mom nicht. Seit ich denken konnte, hatte sie mehrere Klatschmagazine abonniert gehabt. Es hatte sie schon in Aufregung versetzt, wenn sie nur jemanden kannte, der einen Star getroffen hatte. »Ich weiß schon, dass es theoretisch Menschen wie du und ich sind«, hatte sie mal kichernd gesagt, nachdem ich mich zum wiederholten Male über ihr Hobby lustig gemacht hatte. »Aber sobald sie berühmt werden, sobald sie Geld haben, werden sie unantastbar, verstehst du? Und der einzige Weg, an sie ranzukommen, ist, ihre Privatsphäre zu verletzen und darüber zu fantasieren, was sie wohl gerade denken, was sie essen, in wen sie sich verlieben.«
Ich verurteilte sie schon längst nicht mehr dafür. Es war eine Flucht aus ihrem miserablen Alltag gewesen. Aus ihrer Ehe zu einem Mann, der nicht mit Worten, sondern mit Fäusten kommunizierte. Aus ihrer Krankheit, der sie hilflos ausgeliefert war. Aus einer Realität, in der sie erst ihren Job verlor, dann ihre Krankenversicherung und schließlich ihr Zuhause. Meine Mutter hatte sich nie gewünscht, berühmt zu sein. Alles, was sie sich je für ihren Sohn und sich gewünscht hatte, war Unantastbarkeit.
Das Taxi stoppte, und mein Kopf ruckte hoch.
Ernest hielt seine schwarze American Express an das Kartenlesegerät und streckte dem Fahrer zusätzlich einen Zwanzig-Dollar-Schein hin, den dieser, ohne mit der Wimper zu zucken, entgegennahm.
»Einen angenehmen Abend noch, Mr. W.-P.«
»Ernie, wie oft noch?«
Der Fahrer lachte, stieg aus, lief um das Taxi herum und öffnete Ernest die Tür, ehe er ihm nach draußen half.
Wie in Trance stieg auch ich aus. Wir befanden uns an der Kreuzung von Central Park und Fifth Avenue. Das imposante Gebäude mit seinen zwanzig Stockwerken, zahlreichen Fenstern und markanten Ecktürmen erhob sich vor uns, direkt gegenüber vom südlichen Rand des Parks.
Der Regen war noch stärker geworden.
Als sich das Taxi wieder in Bewegung setzte, richtete ich meinen Blick auf den Mann neben mir.
»Ich lasse mich nicht verarschen.«
Ernest nickte. »Das ist eine gute Lebenseinstellung.« Und mit diesen Worten setzte er sich schlurfend in Richtung Eingang in Bewegung, ohne sich zu vergewissern, ob ich ihm folgte.
Der Portier eilte ihm entgegen und hielt einen Regenschirm über ihn.
»Danke, danke, Jeff.«
Ich holte tief Luft. Ein Bild blitzte vor meinem inneren Auge auf. Ich, nackt und gefesselt an ein Himmelbett. Eine Messerklinge an meiner Kehle. Dann der Lauf einer Pistole zwischen meinen Lippen. Zwischen meinen Beinen. Ich atmete aus. Das Bild verschwand. Ein beheizter Raum. Heißes Wasser. Kein Regen. Keine Lungenentzündung.
Du darfst weder vom Schlimmsten noch vom Besten ausgehen, Viktor. Überleben ist ein Balanceakt. Und die meisten Menschen wollen weder dein Leben retten noch es zerstören. Die meisten Menschen denken nur an sich. Also finde raus, was sie wollen, und nutze es für das, was du willst.
Genau in der Sekunde, nachdem Ernest die Treppenstufen nach oben genommen hatte und durch den beleuchteten Eingang im Inneren des Hotels verschwand, setzte ich mich in Bewegung. Das Handy ließ ich in meine Hosentasche gleiten.
Jeff, der rothaarige Portier, hielt mir den Regenschirm nicht über den Kopf. Aus verengten Augen musterte er meine nackte Brust. Doch er sagte nichts, als ich Ernest ins Innere folgte, und hielt mich auch nicht davon ab.
Die Lobby sah genauso aus, wie man das von der Lobby eines Luxushotels erwartete. Protzige Kronleuchter, Marmorsäulen, üppige Blumenbouquets, Stuck an den Wänden, auffallend attraktives Personal. Und Gold. So viel Gold.
Es roch auch anders. Als hätte man beim Übertreten der Schwelle die schmutzige, stinkende Stadt hinter sich gelassen und wäre in einem duftenden Paradies gelandet. Lavendel dominierte. Von irgendwoher ertönten sanfte Klavierklänge.
Sämtliche Angestellte begrüßten Ernest überschwänglich, der sich seinen Weg an der Rezeption vorbei zu den Aufzügen bahnte. Er grüßte sie alle zurück.
Mir schlug Argwohn entgegen, doch jede einzelne Person sah rasch wieder weg. Ich dagegen versuchte, ihre Blicke ein wenig länger festzuhalten. Prägt euch mein Gesicht ein, beschwor ich sie innerlich. Erinnert euch an mich, falls ich verschwinde.
Wie oft er wohl jemanden mit ins Hotel brachte, der nicht hierher passte? War das bereits zur Normalität geworden, oder spielte es schlichtweg keine Rolle, was ein Gast tat, solange er zahlte?
Die Aufzugtüren öffneten sich, Ernest trat ein und drehte sich um. Als er mich sah, verzogen sich seine Lippen zu einem anerkennenden Lächeln.
Ich erwiderte es nicht, sondern stellte mich bloß neben ihn und hielt dabei so viel Abstand wie möglich zwischen uns.
Nachdem er eine Schlüsselkarte an das Kartenlesefeld gehalten, auf die Sechs gedrückt hatte und die Türen wieder zugeglitten waren, wandte ich mich von ihm ab – und blieb an meinem Spiegelbild hängen. Meine Augen waren blutunterlaufen, die Ringe darunter schwarz wie die Nacht. Mein Bart war so lang wie noch nie.
Es gab ein paar simple Tricks, um im Alltag nicht direkt als obdachlos gelesen zu werden. Doch diese Tricks musste man sich leisten können. Da ich seit Nat niemanden mehr an mich rangelassen hatte, hatte ich mir auch nicht die Mühe gegeben, mich herzurichten.
Erste Etage. Mein Magen zog sich zusammen. Meine dunklen Locken klebten an meinen Schläfen und meinem Nacken.
Zweite Etage. Mein Oberkörper glänzte, ein frischer Kratzer zierte meine Leiste, und meine Jeans haftete an mir wie eine zweite Haut.
Dritte Etage. Meine Wangen wirkten eingefallen. Ich musste mehr essen. Das letzte Mal, als ich mich im Spiegel betrachtet hatte, hatte ich älter gewirkt. Gefährlicher.
Vierte Etage. Meine Lippen waren bläulich angelaufen.
Fünfte. Meine Hände zitterten.
Ich sah weg.
Sechste Etage. Mit einem Pling öffneten sich die Türen. Zu einer Suite, nicht zu einem Hotelflur. Alles war in Blau und Silber gehalten. Die schweren, bestickten Vorhänge. Die in einem Rechteck angeordneten Sofas. Der Couchtisch. Selbst die Kristalllampen.
Ernest verließ den Aufzug – erneut, ohne sich nach mir umzusehen. Diese Selbstverständlichkeit! Wann hatte ich es mir zuletzt leisten können, keinen Blick über die Schulter zu werfen?
Ich wartete, bis sich die Fahrstuhltüren wieder schlossen, dann stürzte ich mich auf ihn. Gerade hatte er seinen Gehstock an die Wand gelehnt und war dabei, seine Mütze abzunehmen, da riss ich ihn von hinten an mich und nahm ihn in den Schwitzkasten.
Ein Keuchen erfüllte die Luft. Sein teuer riechendes Rasierwasser stieg mir in die Nase.
»Was willst du von mir?«, knurrte ich ihm ins Ohr.
Er wehrte sich nicht. Stattdessen schien er sich in meiner Umklammerung zu entspannen, was meine Wut nur noch anheizte.
»Das sagte ich bereits«, gab er ruhig zurück. »Und wenn du das Theater sein lässt, können wir wie vernünftige Menschen miteinander sprechen.«
Mein Griff wurde fester. »Warum sollte ich auch nur ein Wort glauben, das aus deinem Mund kommt?«
Ein kehliges Lachen. »Hast du eine Wahl, mein Junge?«
Seine Worte klangen nicht grausam, dennoch schnürte mir die Ausweglosigkeit meiner Situation die Kehle zu.
Ein, zwei, drei Sekunden drückte ich ihm die Luft ab, dann ließ ich ihn los.
Hatte ich meine körperliche Überlegenheit demonstriert oder mich vielmehr zu meiner Schwäche bekannt?
Einen Moment lang hustete er, dann drehte er sich völlig gelassen zu mir um und rieb sich gedankenverloren über den Hals, ehe er sich Mütze und Mantel auszog, die er fein säuberlich an die Garderobe links von ihm hängte. Anschließend ließ er sich auf ein anthrazitfarbenes Samtsofa sinken und überschlug die Beine.
»Hunger? Durst?«
Ich presste die Lippen zusammen. Sowohl als auch, aber ich würde mich hüten, das zuzugeben.
Seufzend griff er nach dem altmodischen Schnurtelefon, das neben dem Sofa auf einer Kommode stand, drückte eine Ziffer und hielt es sich ans Ohr. »Die 24, die 36 und die 48, bitte. Und … genau, wie immer. Danke dir, Anita.« Er legte auf und schaute wieder zu mir. »Die Suite ist bis nächsten Mittwoch gebucht. So lange hast du Zeit, dich zu entscheiden. Nein, eigentlich hast du nur diese Nacht. Aber bis nächsten Mittwoch könntest du es dir noch anders …«
»Was. Willst. Du. Von. Mir.«
Mit dem Kinn deutete er zum gläsernen Couchtisch vor sich, auf dem neben Prospekten mit dem Hotel-Logo auch eine Broschüre lag, auf deren Cover ein gigantisches Luxusschiff zu sehen war.
»Dir einen Job anbieten.«
Weder machte ich Anstalten, mich auf das gegenüberliegende Sofa zu setzen, noch, die Broschüre näher unter die Lupe zu nehmen.
»Ich bin langjähriger Mitarbeiter von Diamond Cruise Enterprise. Deine kurze Recherche im Taxi müsste dir das bestätigt haben. In einer Woche startet das neuste Schiff von New York aus. Eine Hundert-Tage-Reise mit Barcelona als Ziel. Im Eventbereich gab es einen spontanen Ausfall – sie suchen dringend einen Artisten, der sich schnellstmöglich einarbeiten ließe. Ich habe einige deiner Auftritte gesehen und halte dich für mehr als geeignet. Das war’s.« Er lächelte, und schon wieder funkelten seine dunklen Augen. »Keine krummen Geschäfte.«
Mein Herz raste.
Nie im Leben. Nie im Leben stimmte das.
»Und deshalb wurde ich in dieses Hotel gebracht?«, stieß ich hervor.
Er hob eine silbergraue Braue. »Habe ich dich gezwungen mitzukommen?«
»Wer bezahlt die Suite?«
Aus dem Ausschnitt seines Pullovers holte er eine Goldkette, an der eine Art Medaillon baumelte, und küsste den Anhänger, ehe er ihn zurückgleiten ließ. »Mein liebster Gregori. Möge er in Frieden ruhen.«
Ich erwiderte nichts.
»Es ist eine einmalige Chance, Viktor. Aber sie wird dir nicht einfach so geschenkt.«
Unwillkürlich hielt ich die Luft an. Da war er. Der Haken.
Ernest legte den Kopf schief und musterte mich von oben bis unten. »Du musst morgen zum Vorstellungsgespräch und deine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das scheint kein Problem für dich zu sein, du weißt deinen Körper eindeutig bestens einzusetzen, aber du musst außerdem präsentabel aussehen. Sie suchen nicht nur jemanden, der sich nahtlos ins Event-Team einfügt, sondern auch jemanden, der es versteht, mit den Reichsten der Reichen zu verkehren. Dies ist kein gewöhnlicher Job.« Sein Grinsen wurde breiter. »Aber zum Glück bist du auch kein gewöhnlicher Mann, nicht wahr?«
»Was für ein Vorstellungsgespräch?«
Ich klang nicht mehr wie ich. Ein Fremder hatte übernommen. Ein Fremder, der noch zu so etwas wie Hoffnung imstande war.
»Alle Informationen befinden sich hier drin.« Er deutete erneut auf die Broschüre. »Im Grunde ist es ein Casting, um zu prüfen, ob du geeignet bist. In den Headquarters, ganz hier in der Nähe. Ich war so frei und habe deine Bewerbung abgeschickt.«
Mit weichen Knien lief ich zum Sofa und ließ mich darauf sinken. Mein Kopf rauchte.
»Meine … Bewerbung?«
Ernest nickte freundlich. »Schau dir das Video von den Proben an, das sich auf dem Handy befindet. Es bedarf etwas Übung, aber das würde auf jeden Ersatz zutreffen, den sie für ihren ausgefallenen Stuntman in Erwägung ziehen. Und sie befinden sich wirklich, wirklich …«, er fuhr sich mit dem kleinen Finger über die Unterlippe, »… in einer Notlage. Du tust ihnen im Grunde einen Gefallen.«
Ein hysterisches Lachen wollte aus mir herausbrechen. In letzter Sekunde schluckte ich es hinunter.
»Eine Sache nur.« Sein Blick brannte sich in meinen. »Was war das vorhin?«
»Was?«
»Bei deinem Auftritt. Hast du schon länger nicht mehr gegessen? Ist dir deshalb nicht gut gewesen?«
Ich biss die Zähne fest aufeinander. Das ging ihn einen Scheißdreck an. Andererseits … Konnte wirklich etwas an der Geschichte dran sein? Konnte ich ein derartiges Glück haben?
Deine Schwächen sind nur Schwächen, wenn du sie als solche betrachtest. Kinn hoch, direkter Blickkontakt und raus damit.
»Blut«, brachte ich nach einer Weile hervor. »Eine Zuschauerin hatte Nasenbluten.«
Er starrte mich so lange und durchdringend an, dass sich mir die Nackenhärchen aufstellten. Erst als es beinahe unerträglich wurde, nickte er knapp. »Gut, gut, jeder hat seine Achillesferse. Dann sorgen wir dafür, dass niemand in deiner Nähe blutet.«
Wir?
»Was muss ich können?«, hörte ich mich fragen.
»Ein paar Kunststücke. Ein bisschen Tanz. Nichts, was eine Herausforderung für dich darstellen sollte. Das Team wird nachsichtig mit dir sein, auch wenn du noch nicht perfekt bist, immerhin springst du spontan ein.«
Ich öffnete den Mund, wollte ihn mit weiteren Fragen bombardieren, da erhob er sich mit einem Ächzen, griff nach seiner Gehhilfe, seinem Mantel und seiner Mütze.
»So, das war es auch schon von mir. Viel Glück.«
Was zur Hölle …
Ein Klopfen ertönte von nebenan. Erst jetzt fiel mir auf, dass die Suite aus mehreren Räumen bestand.
»Hereinspaziert!«, rief Ernest gut gelaunt, und aus dem Nebenzimmer war ein Klicken zu hören, dann Schritte und das Geräusch von Rollen auf Parkett.
»Hey, Moment mal!«, rief ich. »Wo gehst du hin? Woher soll ich wissen, wo ich hin …«
»Wir sehen uns nächste Woche an Bord, wenn du dich gut anstellst«, sagte er mit einem Zwinkern. »Bitte stell dich gut an. Wir brauchen dich.«
Mit diesen Worten humpelte Ernest in Richtung Aufzug.
Die Beleidigung lag mir schon auf der Zunge, als ein junger Mann in Hoteluniform und mit einem Servierwagen um die Ecke kam.
»Guten Abend, Sir.«
Die Aufzugtüren sprangen auf. Ernest trat ein, drückte den Knopf für die Lobby und drehte sich um. »Der Schrank ist mit Kleidung und Accessoires für dich ausgestattet. Bedien dich. Im Bad findest du die Nummer eines Barbiers. Er ist bereits bezahlt. Fühl dich wie zu Hause.«
Ich wollte ihm das Grinsen aus dem Gesicht wischen.
In dem Moment fielen mir zwei Dinge auf: Erstens – er hatte die Zimmerkarte auf dem Tisch liegen lassen. Zweitens – das Handy befand sich noch immer in meiner Hosentasche.
Die Türen schlossen sich.
»Soll ich Ihnen das Dinner hier anrichten, oder würden Sie es gern im Schlafzimmer einnehmen?«, erkundigte sich der Hotelangestellte höflich.
Mein Kopf ruckte in seine Richtung. Nichts als Respekt war in seiner Miene zu lesen. Auch während meiner Auftritte brachten mir die Leute Bewunderung und Respekt entgegen. Doch niemals auf diese Weise. Nie, weil ich über ihnen stand.
Auf dem Wagen befanden sich dampfende Teller und Schalen. Dieser Duft … Mein Magen zog sich unsanft zusammen. Mir war kotzübel vor Hunger und Überforderung.
Ich könnte dem Mistkerl hinterherrennen. Oder ich machte mich über das geschenkte Essen her.
»Hier, danke«, gab ich zurück.
Ernest lag falsch – ich war sehr wohl ein gewöhnlicher Mann.
8. Kapitel VIKTOR
Thought I was a fool for no one
Bevor ich mich über das Essen hermachte, verriegelte ich die Tür, durch die das Personal in die Suite gelangte. Anschließend nahm ich die gesamte Suite unter die Lupe. Ich durchsuchte jede Ecke nach einer Kamera, nach einer Waffe, nach irgendeiner Spur von Gefahr. Weil ich nichts als Perfektion und Luxus vorfand, kehrte ich schließlich zum Servierwagen zurück und begann zu essen – ein Club Sandwich mit den besten Pommes meines Lebens, dazu französische Zwiebelsuppe und zum Nachtisch Cheesecake. Als ich die starke Brühe probierte und der Geschmack des Käses sich auf meiner Zunge ausbreitete, schossen mir Tränen in die Augen. Als ich ins Sandwich biss, liefen sie über. Als ich die knusprigen Pommes in die Trüffelmayonnaise tunkte und sie zu meinem Mund führte, schüttelte es mich am ganzen Leib. Ich weinte mich durch das gesamte Menü. Erst als ich die letzten Krümel des Kuchenkeksbodens vom Teller leckte, beruhigte ich mich langsam wieder. Zum Schluss schenkte ich mir eine dampfende Flüssigkeit in eine überdimensionierte Teetasse und trank einen großen Schluck. Eine Geschmacksexplosion aus unterschiedlichsten Kräutern und einer feinen Rum-Note überraschte mich.
Was, wenn er mich vergiftet hat?
Nein. Vernünftig bleiben. Warum sollte er mich vergiften?
Ich durchforstete das Handy nach irgendwelchen Hinweisen auf Ernest – nichts. Es schien ein nagelneues Gerät zu sein, ohne gespeicherte Kontakte oder spezielle Apps. In den Nachrichten fand ich einen Videolink und klickte darauf.
Es war eine Bühne zu sehen, darauf ein Dutzend Menschen in Sportkleidung. Irgendjemand außerhalb des Bildes rief Anweisungen. Es handelte sich um eine Choreografie. Eine Mischung aus verschiedenen Tanzstilen, im Hintergrund war Klaviermusik im Takt der Bewegungen zu hören.
Mom hatte mich früher zum Broadway mitgenommen: Sister Act,Once Upon a Time in New Jersey,Catch Me If You Can, The Importance of Being Earnest, The Addams Family … Eine Aufführung pro Monat, unter der Woche, immer tagsüber, wenn sie frei und mein Vater Frühschicht hatte. Auf diese Weise kamen wir an die billigsten Tickets und gingen seinen Launen aus dem Weg. Wenn sie mich frühmorgens mit einer dampfenden Tasse Kakao in der Hand und einem Strahlen in den Augen weckte, wusste ich, dass es an dem Tag so weit war. Dann rief sie in meiner Schule an und meldete mich krank. Bis zum Beginn der Veranstaltung putzten wir gemeinsam die Wohnung und bereiteten das Essen für meinen Vater vor, damit er nichts auszusetzen hatte, wenn er nachmittags nach Hause kam. Sobald wir fertig waren, durfte ich ihr beim Auswählen ihres Outfits helfen – ihre Wahl fiel jedes Mal auf dasselbe rote Kleid, doch sie probierte trotzdem immer mehrere an –, anschließend suchten wir etwas für mich raus. Ich kam mir an diesen Tagen unglaublich erwachsen vor. Unser Ritual sah vor, dass wir uns einen Hotdog vor der Veranstaltung teilten. Sie nahm stets den ersten Bissen, stöhnte genießerisch auf, gab dann vor, schon satt zu sein, und überließ mir den Rest.
Wir hatten die schlechtesten Plätze, aber das war mir damals nicht klar gewesen. In meiner Erinnerung war alles perfekt. Die Farben. Die Musik. Die Gerüche. Die Artisten. Niemand auf der Bühne schien ein Einzelkämpfer zu sein, sie bewegten sich gemeinsam und aufeinander abgestimmt. Sie waren schön. Sie waren besonders. Und vor allen Dingen wurden sie bewundert.