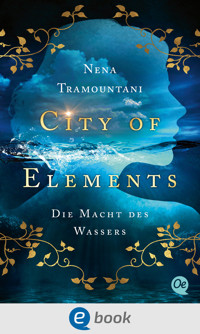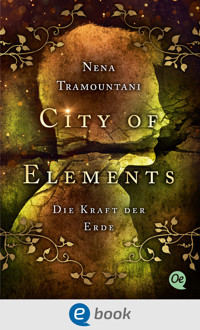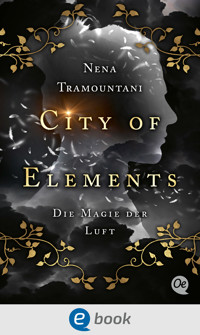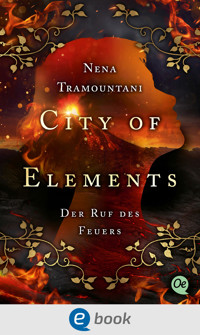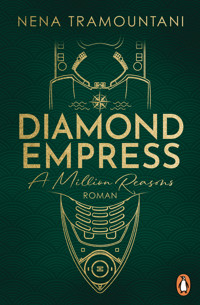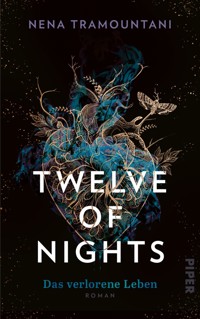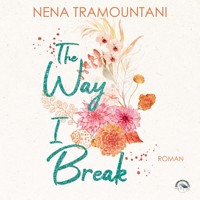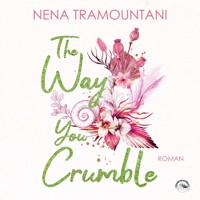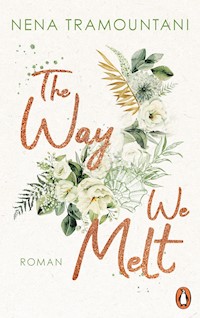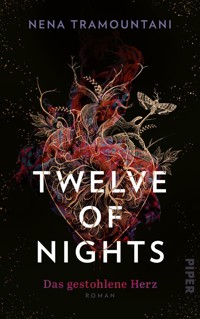
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In einem griechischen Bergdorf leiten die zwölf Raunächte mit besinnlichen Ritualen und winterlichen Festen den Jahreswechsel ein. Doch einer alten Legende zufolge stehlen sich in dieser Zeit auch die dämonischen Kalikanzari in das Dorf und opfern ein Menschenleben. Als die zweiundzwanzigjährige Daphne kurz nach der Weihnachtsmesse eine junge Frau kennenlernt, fühlt sie sich sofort zu ihr hingezogen. Während der Feierlichkeiten im Dorf kommt Daphne der mysteriösen Ioanna immer näher. Doch Ioanna hütet ein Geheimnis, und ihre Liebe kann außerhalb der Raunächte nicht existieren …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Twelve of Nights – Das gestohlene Herz« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
»Twelve of Nights – Das gestohlene Herz« enthält Themen, die belasten können. Deshalb findet ihr am Ende dieses Buchs eine Inhaltswarnung.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Melike Karamustafa
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
I
1
Daphne
24. Dezember
Gegenwart
Kurz vor Mitternacht
2
Ioanna
31. Dezember
Fünf Jahre zuvor
Kurz vor Mitternacht
3
Ioanna
31. Dezember
Fünf Jahre zuvor
Mitternacht
4
Daphne
25. Dezember
Gegenwart
Kurz nach Sonnenaufgang
5
Daphne
25. Dezember
Gegenwart
Kurz nach Sonnenaufgang
6
Daphne
25. Dezember
Gegenwart
Morgen
7
Ioanna
1. Januar
Fünf Jahre zuvor
Morgengrauen
8
Ioanna
1. Januar
Fünf Jahre zuvor
Morgen
9
Daphne
25. Dezember
Gegenwart
Vormittag
10
Ioanna
1. Januar
Fünf Jahre zuvor
Mittag
11
Daphne
25. Dezember
Gegenwart
Vormittag
12
Ioanna
1. Januar
Fünf Jahre zuvor
Mittag
13
Ioanna
1. Januar
Fünf Jahre zuvor
Nachmittag
14
Daphne
25. Dezember
Gegenwart
Nachmittag
15
Ioanna
2. Januar
Fünf Jahre zuvor
Morgengrauen
16
Daphne
25. Dezember
Gegenwart
Kurz vor Sonnenuntergang
17
Ioanna
3. Januar
Fünf Jahre zuvor
Morgengrauen
18
Ioanna
3. Januar
Fünf Jahre zuvor
Vormittag
19
Ioanna
3. Januar
Fünf Jahre zuvor
Abend
20
Ioanna
4. Januar
Fünf Jahre zuvor
Nach Sonnenuntergang
21
Ioanna
5. Januar
Fünf Jahre zuvor
Nach Mitternacht
22
Ioanna
5. Januar
Fünf Jahre zuvor
Nach Mitternacht
23
Ioanna
5. Januar
Fünf Jahre zuvor
Kurz vor Morgengrauen
24
Daphne
25. Dezember
Gegenwart
Kurz vor Sonnenuntergang
25
Daphne
26. Dezember
Gegenwart
Kurz nach Mitternacht
26
Ioanna
5. Januar
Fünf Jahre zuvor
Kurz nach Morgengrauen
27
Ioanna
5. Januar
Fünf Jahre zuvor
Nach Sonnenuntergang
II
28
Daphne
26. Dezember
Gegenwart
Kurz nach Sonnenuntergang
29
Ioanna
6. Januar bis 25. Dezember
Vier Jahre zuvor
Nach Mitternacht
30
Ioanna
5. Januar
Vier Jahre zuvor
Nach Sonnenuntergang
III
31
Ioanna
25. Dezember
Drei Jahre zuvor
Kurz nach Mitternacht
32
Ioanna
5. Januar
Drei Jahre zuvor
Abenddämmerung
33
Daphne
27. Dezember
Gegenwart
Kurz nach Mitternacht
IV
34
Ioanna
25. Dezember
Zwei Jahre zuvor
Nach Mitternacht
35
Daphne
27. Dezember
Gegenwart
Kurz nach Mitternacht
36
Ioanna
31. Dezember
Zwei Jahre zuvor
Kurz vor Sonnenuntergang
37
Ioanna
31. Dezember
Zwei Jahre zuvor
Kurz vor Mitternacht
38
Ioanna
31. Dezember
Zwei Jahre zuvor
Mitternacht
39
Daphne
27. Dezember
Gegenwart
Nach Mitternacht
V
40
Ioanna
31. Dezember
Ein Jahr zuvor
Nach Sonnenuntergang
41
Daphne
30. Dezember
Gegenwart
Abend
42
Ioanna
31. Dezember
Ein Jahr zuvor
Kurz vor Mitternacht
43
Daphne
30. Dezember
Gegenwart
Kurz vor Mitternacht
VI
44
Ioanna
1. Januar bis 5. Januar
Ein Jahr zuvor
Kurz vor Mitternacht
45
Daphne
31. Dezember
Gegenwart
Kurz nach Mitternacht
46
Daphne
31. Dezember
Gegenwart
Kurz nach Mitternacht
47
Ioanna
31. Dezember
Gegenwart
Nach Sonnenuntergang
48
Ioanna
31. Dezember
Gegenwart
Nach Sonnenuntergang
49
Ioanna
1. Januar
Gegenwart
Nach Mitternacht
50
Ioanna
1. Januar
Gegenwart
Kurz vor Sonnenaufgang
51
Ioanna
1. Januar
Gegenwart
Kurz vor Sonnenaufgang
52
Ioanna
5. Januar
Sechs Jahre zuvor
Kurz vor Mitternacht
53
Ioanna
1. Januar bis 5. Januar
Gegenwart
Kurz vor Sonnenaufgang
54
Ioanna
5. Januar
Gegenwart
Kurz vor Mitternacht
Playlist
Inhaltswarnung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für das schlagende Herz in meiner Brust.
I
»Was, wenn ich jemanden gehabt hätte? Jemanden, der mir hilft?«
»Du hattest niemanden. Deshalb sind wir gekommen.«
»Aber was, wenn?«
»Dann hättest du diesen Jemand mit in den Abgrund gezogen.«
1
Daphne
24. Dezember
Gegenwart
Kurz vor Mitternacht
In Griechenland wünscht man sich zu sämtlichen Feiertagen Chronia polla, das bedeutet wörtlich Viele Jahre. Viele Jahre zum Geburtstag. Viele Jahre zum Namenstag. Viele Jahre zu Ostern. Viele Jahre zu Weihnachten. Als hätte irgendjemand die Macht, darüber zu entscheiden. Als wäre Zeit das Schönste, was man verschenken kann.
Seit fünf Jahren benutze ich die Floskel nicht mehr. Der letzte Mensch, dem ich viele Jahre gewünscht habe, hat nicht mal mehr eines weitergelebt. Zeit ist der größte Fluch, wenn sie einen daran erinnert, was man verloren hat.
Aris Blick brennt auf mir. Er weiß, was ich fühle, auch wenn er mehrere Meter von mir entfernt auf einer der gegenüberliegenden Holzbänke sitzt. Es gibt nach wie vor eine strikte Trennung zwischen Männern und Frauen, weswegen er auf der linken Seite vom Mittelgang sitzt und meine Großmutter, seine Mutter und ich rechts. Die Kirche ist brechend voll. Überall dicke Wintermäntel, frisierte Hinterköpfe, Menschen in Anzügen und spektakulären Kleidern, die Gesichter gezeichnet von Ungeduld. Meine Jiajia – meine Oma – nennt es das große Affentheater. Ansonsten lässt sich hier kaum jemand blicken, aber zweimal im Jahr, zur Geburt und zur Auferstehung Christi, strömt das ganze Dorf in die prunkvolle Kathedrale, die sich auf einem Bergvorsprung oberhalb des Ortes befindet. Aus diesem Grund sind wir schon vor Stunden aufgekreuzt, um noch einen Platz zu ergattern.
Auch ich bin Teil des Theaters. Zwar begleite ich meine Großmutter manchmal sonntags in den Gottesdienst, doch das liegt nicht an meinem Glauben. Früher ist Papou mit ihr hingegangen, auch wenn ich den Verdacht habe, dass er ebenso wenig gläubig war, wie ich es bin. Es bricht uns wohl einfach beiden das Herz, sie allein gehen zu lassen.
Endlich erwidere ich Aris Blick. Seine dunklen Augen glänzen mitfühlend. Er trägt einen silbergrauen Anzug, der gut mit seinen dunklen Locken harmoniert und ihn noch erwachsener aussehen lässt. »Gleich geschafft«, formt er mit den Lippen, und ein liebevolles Lächeln zupft an seinen Mundwinkeln.
Nicht ganz die Wahrheit. Nach der Mitternachtsmesse werden wir in das Gasthaus meiner Großeltern zurückkehren und dort die Dorfbewohner mit den Leckereien versorgen, die wir in den letzten Tagen zubereitet haben. Nach der vierzigtägigen Fastenzeit wollen sich alle die Bäuche vollschlagen. Am liebsten würde ich die Zeit vorspulen, bis ich mit Ari in unserem warmen Bett liegen und mich an ihn klammern kann. Ich brauche unsere kleine heile Welt. Seine Lippen auf meinen, geflüsterte Worte unter der Decke, das Gefühl von Geborgenheit, auch wenn es seit Langem nicht mehr dasselbe ist. An manchen Tagen frage ich mich, ob ich überhaupt noch in der Lage bin, etwas zu empfinden. Nicht nur in Bezug auf Ari, sondern auf mein gesamtes Leben. Die meiste Zeit empfinde ich nur Leere.
»Ich liebe dich«, gebe ich lautlos zurück. Das schlechte Gewissen klopft an wie jedes Mal, wenn ich die drei Worte zu ihm sage. Sein Lächeln kann ich nicht erwidern. Ari versteht, wie hart die Zeit von Weihnachten bis zum 6. Januar für mich ist. Mein Leben lang habe ich mich das ganze Jahr über darauf gefreut. Seit fünf Jahren, seit Papou nicht mehr ist, wünschte ich, wir könnten sie einfach überspringen.
Aris Mutter und meine Jiajia verlassen ihre Plätze und reihen sich in die Schlange ein, um die Kommunion zu empfangen. Da ich weder gefastet habe noch daran glaube, folge ich ihnen nicht. Außerdem kommt mir stets die Warnung meiner Vorschullehrerin in den Sinn, wenn ich den goldenen Kelch betrachte, in dem sich Wein und Brotstücke befinden, die sinnbildlich für das Blut und Fleisch Jesu stehen. Sollten Gottlose es wagen, die Kommunion zu empfangen, würden sich der Wein und das Brot noch im Mund in Blut und Menschenfleisch verwandeln. Danke, nein.
Ari sieht mich nach wie vor an, doch plötzlich hat sein Blick nichts Tröstliches mehr. Er engt mich ein. Genau wie die Menschenmenge. Und die Psalmen, die immer lauter gesungen werden. Das Knarzen in den Lautsprechern, wenn die Kirchenchormitglieder dem Mikrofon vorne zu nahe kommen. Die brennenden Kerzen, deren Hitze sich in der gesamten Kirche auszubreiten scheint. Der schwere Weihrauchgeruch. All das Gold an den Wänden, all die Ikonen, die auf mich niederstarren. Es ist Weihnachten, Daphne, scheinen sie zu sagen. Es ist Weihnachten, du solltest doch glücklich sein.
Die Kirchenglocken ertönen. Mein Puls schießt in die Höhe, meine Nackenhaare richten sich auf. Mitternacht. Ich muss raus hier. Die frische Dezemberluft inhalieren. Mich daran erinnern, dass es in Ordnung ist. Dass ich in Ordnung bin.
Es sind nur zwölf Tage, die ich überstehen muss, dann kann ich mich zurück in meinen Alltag flüchten. Ich greife nach meiner Handtasche, erhebe mich und dränge mich an Eleni Christophou vorbei, die mit uns in der Reihe sitzt und der die beste Zuckerbäckerei im Dorf gehört. Sie ist gerade dabei, ihre Töchter nach vorn zu scheuchen, und bemerkt mich nicht. Ari beobachtet mich, während ich mich an Frauen und Kindern, an Heiligenbildern, Opferkerzen und Tischen mit Spendenkörben vorbeiquetsche. Je weiter man Richtung Ausgang kommt, desto lauter wird das Geflüster.
»Hast du gesehen, wie tief der Ausschnitt von Anastasias Kleid ist?«
»Die Liturgien werden auch jedes Jahr länger, oder?«
»Ich hab Hunger, Mama!«
»Glaubst du, wenn wir kurz eine rauchen gehen, bekommen wir die Schlusspredigt noch mit?«
Als ich die schwere Holztür aufstoße, schlägt mir der heftige Wind Schneeflocken ins Gesicht, und meine langen schwarzen Locken fliegen nach hinten. Auf dem Platz vor der Kathedrale tummeln sich mindestens so viele Menschen wie im Inneren – vermutlich, weil sie keinen Platz mehr gefunden haben. Das Stimmengewirr wird durch das ohrenbetäubende Läuten der Glocken übertönt.
Für einen Moment verharre ich auf der Stelle und atme die frostige Luft ein. Es ist schön hier, nicht wahr? Die Bäume sind von einer dünnen Schneeschicht überzuckert, unten im Tal funkeln die Dorflichter wie ein Sternenmeer, Rauch steigt von den Schornsteinen in den Nachthimmel auf. Es ist magisch. Weiße Weihnachten, wer wünscht sich das nicht?
Innerhalb von Sekunden ist mein bodenlanger schwarzer Mantel von Schneepünktchen übersät. Mit gesenktem Kopf laufe ich wieder los, vorbei an den Menschen, um die Ecke, wo ich zwischen einem Baum und der Kirchenfassade etwas abseits der Menge Unterschlupf finde.
Ich lasse mich gegen die Außenmauer sinken. Mir ist schlecht, und mein Herz rast. Der 25. Dezember ist nicht nur Weihnachten. Das Datum markiert den Beginn der Raunächte. Die nächsten zwölf Tage wird sich das gesamte Dorf im Ausnahmezustand befinden, weil verschiedene Rituale bevorstehen. Alle bereiten sich auf den Jahreswechsel vor, nehmen Abschied von Altem und begrüßen neue Möglichkeiten. Doch ich will nichts Neues. Ich will wieder ein Kind sein und die faltige Hand meines Großvaters halten. Sein verschmitztes Lächeln sehen, seinen vertrauten Geruch nach würzigem Aftershave und Pfeifentabak riechen. Ich will doch einfach nur wieder etwas fühlen.
»Daphne.«
Mein Kopf ruckt hoch. Vor mir steht eine junge Frau. Sie kann kaum älter als ich sein, höchstens Mitte zwanzig. Ihre goldbraunen Haare sind glatt und reichen ihr bis zum Kinn, sie hat stechend schwarze Augen, mit langen seidigen Wimpern, darüber ebenso schwarze Brauen, ihr Mund glänzt burgunderrot, dieselbe Farbe wie ihr Mantel. Sie ist mindestens zehn Zentimeter größer als ich, obwohl ich Stiefel mit Absatz trage und sie flache Budapester.
Bestimmt ist sie eine Verwandte von jemandem und für die Feiertage hergekommen. Ich habe sie noch nie gesehen. Bei unter tausend Einwohnern fallen Neuankömmlinge in unserem Dorf auf wie bunte Hunde.
»Daphne«, wiederholt sie, diesmal leiser, beinahe zärtlich.
Mein Herz setzt einen Schlag aus. Woher kennt sie meinen Namen? Aber das ist nicht der einzige Grund, aus dem ich erstarrt bin. Ihr Blick … Etwas in ihrem Blick scheint unsere gesamte Umgebung einfrieren zu lassen. So schaut man keine Fremde an. So schaut man jemanden an, den man besser als sein eigenes Leben kennt. Meine Großmutter hat meinen Großvater auf diese Weise angesehen. Er sie nicht. Ich habe mich immer gefragt, wieso.
Ich versuche mich an einem Lächeln. Seltsam, wie leicht es mir plötzlich fällt. »Du verwechselst mich.«
Statt einer Antwort zieht sie einen Briefumschlag aus ihrer Manteltasche und hält ihn mir hin. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Bevor ich mir einen Reim darauf machen kann, beugt sie sich blitzschnell vor – Orangenblüten, Jasmin, Zedernholz, alles wirbelt gleichzeitig auf und vermischt sich zu einem betörenden Strudel –, küsst mich rechts und links auf die Wangen und verharrt dann mit den Lippen an meinem Ohr. Nun scheint nicht nur unsere Umgebung eingefroren. Auch ich werde zu Eis, die Zeit steht still, die Glocken hoch oben im Kirchturm verharren in der Bewegung, genau wie die Schneeflocken um uns herum. Die gesamte Welt hört auf, sich zu drehen, während Gedankenfragmente mein Hirn fluten. Ein Wald. Raketen, zu früh abgeschossen. Der Geschmack von bitterem Rotwein auf meiner Zunge. Ein zugefrorener See. Knackendes Eis. Gelächter. Blicke, die mein Inneres verflüssigen. Worte wie hauchzarte Berührungen: »Ich könnte dich nicht nur seinen, sondern auch deinen eigenen Namen vergessen lassen.«
Berührungen wie Versprechen.
Woher kommen diese Gedanken?
»Chronia polla.« Kaum mehr als ein Hauchen. Sie spricht keinen Dorfdialekt, ihr Griechisch ist klar und deutlich, es klingt nach Großstadt, vielleicht sogar Athen.
Und in diesem Moment, nur für den Bruchteil eines Herzschlags, verstehe ich. Ich verstehe zum ersten Mal seit langer Zeit, wieso man jemandem viele Jahre wünscht. Denn in diesem Moment will ich nicht bloß viele Jahre, sondern eine ganze Ewigkeit, genau hier.
Die Fremde weicht zurück. Sie drückt mir den Brief in die Hand. Eine einzelne Träne läuft über ihre Wange, hinterlässt eine glänzende Spur auf ihrer Haut.
»Vernichte ihn, sobald du ihn gelesen hast«, flüstert sie.
Mit diesen Worten wendet sie sich um. Die Schneeflocken setzen sich wieder in Bewegung, wilder, erbarmungsloser, der Lärm der Kirchenglocken ist zurück, vermengt sich mit dem Geschnatter der Leute.
Zitternd atme ich aus, während meine Finger den Briefumschlag aufreißen. Immer wieder verschwimmt er vor meinen Augen.
Weine ich? Warum zur Hölle weine ich?
Der Brief besteht aus mehreren Blättern Papier, dicht beschrieben in geschwungener Schreibschrift mit dunkelroter Tinte.
Daphne, lese ich, während ein Schluchzen aus mir herausbricht und mich schüttelt. Eine dicke Schneeflocke landet auf meinem Namen, lässt ihn bluten. Ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich verspreche dir, du liebst mich.
2
Ioanna
31. Dezember
Fünf Jahre zuvor
Kurz vor Mitternacht
Der Anfang. Ich erinnere mich genau an ihn. Meine Erinnerung ist unversehrt.
Ich sollte nicht mehr hier sein.
Sechs Tage in diesem Drecksloch von einem Kaff sollten ausreichen, um jemanden aufzuspüren. Wenn ich sie bis jetzt nicht gefunden hatte, konnte das nur bedeuten, dass sie nicht mehr hier war.
Unter meinen Schuhen knirschten die gefrorenen Grashalme, während ich den Hang hinauf durchs Dickicht rannte, als seien die Dorfbewohner hinter mir her. Ein bitteres Lachen entwich mir. Als wäre nicht ich diejenige, vor der sich das gesamte Dorf fürchten musste …
Ein irrsinniger Gedanke hatte mich davon abgehalten, vor Silvester zu gehen. Was, wenn sie hier sein würde? Was, wenn ihr Herzschlag mich um Mitternacht locken würde?
Aber so funktionierte die Magie nicht, das hatte mir Despina erklärt, als wir nackt und atemlos nebeneinander in ihrem Bett gelegen hatten. Schnell war ihr meine Fragerei auf den Zeiger gegangen, und sie war auf den Olymp geflüchtet, um ihre Ruhe zu haben. Es war erstaunlich, wie nervtötend ich selbst ohne Emotionen sein konnte.
Die anderen waren am 25. Dezember sofort ausgeströmt und hatten wie Drogensüchtige den Kontakt zu den Menschen im Ort gesucht. Mich dagegen interessierte nur ein einziger. Der Mensch, der mich aus purem Egoismus zu diesem Dasein verdammt hatte.
Rache kettete mich an diesen Ort.
Ich beschleunigte meine Schritte. Es war bitterkalt. Nicht dass mir die Kälte während der Raunächte ernsthaft etwas anhaben konnte, aber es tat gut, sie zu fühlen. Ich hatte keine wärmere Jacke angezogen, denn heute Nacht wollte ich alles fühlen.
Die Bäume lichteten sich ein wenig, und aus der Ferne war der Schrei einer Eule zu hören.
Die meisten Menschen feierten unten im Tal oder auf einem der Berggipfel, aber was, wenn sich auch jemand hierher verirrt hatte? Nur noch wenige Minuten, und niemand würde mehr sicher sein. Vor mir.
Würde ich mich dagegen wehren können? Hatte ich überhaupt eine Wahl?
Ich krallte meine Finger ineinander und grub meine Nägel in die Handrücken, bis scharfer Schmerz durch meinen Körper pulsierte. Schmerz war gut. Er war echt und klar, und schon bald würde ich ihn zusammen mit all den anderen Gefühlen vermissen.
Natürlich hatte ich eine Wahl. Vor etwa einem Jahr hatte ich die Wahl gehabt, das Schicksal seinen Lauf nehmen zu lassen. Und die letzten dreihundertsechzig Tage hatte ich jede Sekunde die Wahl gehabt, einem Menschen in die Augen zu sehen und diese Welt schmerzfrei zu verlassen. Mensch oder kein Mensch, man hatte immer eine Wahl. Das war die Wahrheit. Ich war hier, weil ich es wollte. Die Hand auf den Brustkorb eines Menschen legen, das wilde Pulsieren spüren, das inzwischen nichts als eine ferne Erinnerung war, das Erkennen in ihrem Blick aufflackern sehen, meine Angst vom Vorjahr …
Ein regelmäßiges Pochen ließ mich innehalten. In den letzten Tagen waren die Herzschläge um mich herum immer lauter geworden, doch diese Intensität war neu. Sie ließ den Boden beben und erschütterte meine Knochen.
Fuck! Da war wirklich jemand.
Dies war meine letzte Chance umzukehren. Ich schaute auf meine Armbanduhr. Viertel nach elf. Noch war es nicht zu spät.
Im nächsten Moment ertönte ein Schniefen.
Vorsichtig setzte ich einen Fuß vor den anderen, registrierte nur am Rande, wie dornige Äste mich streiften. Sekunden später fand ich mich auf einer Lichtung mit kleinem See wieder, die von knochigen Ahornbäumen und Eichen umrahmt war. Die gefrorene Wasseroberfläche reflektierte das silbrige Mondlicht. Dahinter, auf der gegenüberliegenden Seite des Sees, ging es hangaufwärts. Und am Ufer, zwischen Schlittschuhen und Glasflaschen, saß ein Mensch mit dem Rücken zu mir im Gras.
Ihr wallendes schwarzes Haar reichte bis zur Mitte ihres Rückens. Allem Anschein nach war sie gerade dabei, sich von ihren Schlittschuhen zu befreien, scheiterte, fluchte, griff nach einer Weinflasche, nahm einen großen Schluck, stellte sie wieder ab und versuchte erneut, die Schnürsenkel zu lösen. Ohne Erfolg.
Gegen meinen Willen musste ich grinsen.
Obwohl das Gras unter meinen Schuhen knirschte, hörte sie mich nicht, bis ich neben ihr stand.
»Hi.«
Sie schaute hoch. Ihr Mantel war schwarz und kurz, genau wie das Kleid, das sie darunter trug.
»Was machst du hier ganz allein?«
Es sollte nicht wie eine Drohung klingen, doch ihr Herzschlag beschleunigte sich wie auf Knopfdruck.
Eine Gänsehaut jagte mir über den Rücken. Die letzten Tage war ich vielen Menschen begegnet, die mich unverhohlen gemustert, versucht hatten, mich in ein Gespräch zu verwickeln, oder mich plump angemacht hatten, aber Angst hatte niemand vor mir gehabt. Eine junge Frau wie ich, die allein unterwegs war, verbreitete wohl kaum Furcht und Schrecken. Außerdem hatte ich mir jeden Tag Mühe mit meinem Make-up und meiner Kleidung gegeben. Heute trug ich einen dunkelroten Overall aus Samt. Eine schöne junge Frau war noch viel weniger Angst einflößend.
Auch das Exemplar zu meinen Füßen sah gut aus. Verheult, aber süß. Ihre geröteten Augen traten leicht hervor, braun und tief, umrandet mit grünem Glitzerzeug, darunter lagen dunkle Schatten; auf ihren gepuderten Wangen waren Tränenspuren zu sehen. Ihre Nase war lang, leicht krumm, ihr Mund einen Tick zu groß, um zum Rest des Gesichts zu passen. Ich wollte eine Hand ausstrecken und ihre Lippen mit meinen Fingern nachzeichnen. Und dann wollte ich tiefer wandern, bis meine Hand auf ihrem Dekolleté lag, ihre Hitze spüren, das Hämmern in ihrem Brustkorb und …
»Meine Freunde sind abgehauen«, nuschelte sie. Mit einem weiteren Schniefen wischte sie sich übers Gesicht. Ihr Blick zuckte gehetzt über meine Gestalt, als könnte sie nicht einschätzen, in welche Kategorie sie mich stecken sollte. Freundin oder Feindin?
Mein Grinsen wurde breiter. Ich deutete auf ihre Schlittschuhe. »Brauchst du Hilfe damit?«
Mit großen Augen sah sie zu mir hoch. »Wer bist du?«
»Ioanna.« Ich streckte ihr die Hand hin. »Und du?«
Zögerlich nahm sie meine Hand. Aus einem Impuls heraus umklammerte ich ihre fester und zog sie ruckartig hoch.
Selbst mit den Schlittschuhen an den Füßen war sie kleiner als ich.
Ihr Atem stockte, ihre Wangen röteten sich. »Daphne«, erwiderte sie erstickt. »Wir kennen uns nicht, oder? Du kommst nicht von hier?«
Mit einem Kopfschütteln gab ich ihre Hand frei. »Ich würde mich definitiv an dich erinnern.«
Und du dich an mich.
Verwirrung zuckte über ihr Gesicht. Wäre ihr rasendes Herz nicht eine solche Ablenkung gewesen, hätte ich vielleicht gelacht.
Ich legte den Kopf schief und durchbohrte sie mit meinem Blick. »Wie heißt er?«
Mit neunundneunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit gab es einen Kerl, wegen dem sie sich die Augen aus dem Kopf heulte.
Ihre Augen wurden noch größer. »Wie … Wie heißt wer?«
O ja, sie war definitiv der Typ Unschuld vom Lande, der sich in einen Jungen aus ihrer Schulklasse verknallte, ihn kurz nach ihrem Abschluss heiratete, sich unzählige Babys von ihm machen ließ und glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende mit ihrer Familie in demselben Kaff blieb, in dem sie geboren war.
Ich erwiderte nichts, starrte sie einfach nur an.
Meine Schwester hatte meinen Röntgenblick gehasst. »Bitte hör auf, Leute so anzuglotzen«, hatte sie mich angefleht. »Du ziehst zu viel Aufmerksamkeit auf dich. Das ist an einem Ort wie diesem besonders riskant.« Steriani war immer ein Fan von mit dem Hintergrund verschwimmen gewesen, besonders wenn es um mich ging. Natürlich machte sie sich Sorgen, immerhin war ich das schwarze Schaf der Familie. Der Grund, aus dem wir den Kontakt zu unseren Eltern abgebrochen hatten. Aber manchmal hatte ich mich gefragt, ob sie sich nicht bloß Sorgen um mich machte, sondern sich auch für mich schämte.
»Ari«, riss mich Daphnes Stimme aus meinen Gedanken. Sie seufzte laut. Es klang nach Aufgeben. »Er heißt Ari.«
Mein Grinsen kehrte zurück. »Was hat das Schwein getan?«
Ein Lachen entwich ihr. Sie selbst schien überrascht davon zu sein.
Es klang schön. Frei.
»Ich bin nur kurz in den Wald gegangen, weil ich mal pinkeln musste, und dann waren meine Freunde plötzlich weg.« Sie biss sich auf die volle Unterlippe. Mein Blick blieb zu lange daran hängen. »Ich habe gehofft, ihn um Mitternacht endlich zu küssen. Aber es sieht so aus, als würde er lieber Zeit mit Thalia verbringen wollen … Sie antworten mir alle nicht auf meine Nachrichten.«
Ich schaute auf die Schlittschuhe neben uns und wieder zurück in ihre dunklen Augen, und plötzlich spürte ich den Leichtsinn, der mein Inneres zum Tanzen brachte und die Verzweiflung der letzten Tage in den Hintergrund rücken ließ.
»Ich könnte dich seinen Namen vergessen lassen«, sagte ich.
Ihre Gesichtszüge entgleisten ihr. »Was?«
Mit einer gehobenen Braue deutete ich auf die Schlittschuhe vor uns. »Lust, eine Runde mit mir zu laufen?«
Ein paar Sekunden schien sie zu überlegen, dann zuckte sie mit den Schultern. »Okay. Warum nicht?«
Ich war wirklich nicht Angst einflößend genug.
Kurz darauf hatte ich meine Stiefel gegen Schlittschuhe getauscht, die mir eine halbe Nummer zu eng waren. Auch dieser Schmerz war willkommen.
Nur ein paar Minuten, bevor die anderen zurückkamen. Ich würde ihre Herzschläge hören, sobald sie in der Nähe waren. Nur ein paar Minuten Ablenkung, bevor ich mich wieder der Finsternis übergab. Das hatte ich mir verdient.
Die vereiste Oberfläche des Sees war von Fahrspuren zerkratzt, das Mondlicht offenbarte in den Tiefen darunter das dunkle Wasser. Daphne war etwas wackelig auf den Beinen, und ihr Blick zuckte immer wieder in Richtung Wald. Vermutlich hoffte sie, dass ihre Freunde jede Sekunde zurückkehren würden.
Nachdem wir beide ein paar Runden nebeneinander gefahren waren, beruhigte sich ihr Herzschlag. Die Stille drückte auf meine Ohren. Ich wollte keine Stille. Das ganze verfluchte Jahr lang hatte ich Stille gehabt. Abrupt blieb ich stehen, änderte meinen Kurs, sodass ich nun auf sie zulief, erwiderte ihr zaghaftes nervöses Lächeln nicht, sondern starrte ihr ausdruckslos in die Augen und beschleunigte. Ihr Herz begann wieder zu rattern. Sie wollte ausweichen, aber keine Chance, ich war viel zu schnell. Kurz bevor ich gegen sie prallen konnte, verlagerte ich mein Körpergewicht zur Seite, schnappte mir ihre Hand und riss sie herum. Sie schwankte, kämpfte um ihr Gleichgewicht, doch mein Griff war eisern, stützte sie.
»Was zum …«
»Vertrau mir«, wisperte ich. Und damit stieß ich sie von mir, nur um sie im nächsten Moment ruckartig an mich zu ziehen. Die Hitze unserer Körper war im Kontrast zur Kälte beinahe unerträglich. Wie lange war es her, dass ich die Wärme eines Menschen an mir gespürt hatte?
Daphne schnappte nach Luft, ihr Herz raste jetzt, ihre Augen blitzten, wurden ganz schmal. War sie wütend auf mich? Jedes ihrer Gefühle war ein gefundenes Fressen für das ausgehungerte Loch in meiner Brust. Mein Gott, ich hätte es von Anfang an den anderen gleichtun und mich an alle Menschen in Reichweite ranschmeißen sollen …
Ich griff auch nach ihrer anderen Hand, ehe ich begann, in Schlangenlinien rückwärts übers Eis zu gleiten und sie mitzuziehen. Der eisige Wind wirbelte meine Haare nach hinten und ihre nach vorn. Ihre dunklen Locken peitschten mir ins Gesicht. Sie trug Parfum. Etwas Süßliches, das mich an Honig und Zimt erinnerte.
Während wir über den See flogen, riss ich unsere Hände nach oben und krallte meine Nägel in ihre Haut. Mein Blick liebkoste ihr errötetes Gesicht. Ihre Lippen waren leicht geöffnet, als wollte sie etwas sagen, das ihr auf halber Strecke entfallen war.
»Was noch?«, rief ich gegen den brausenden Wind an, ließ unsere Hände wieder sinken, gab eine frei, um Daphne um ihre eigene Achse wirbeln zu können. Einmal, zweimal, dreimal.
Ein erstickter Laut entwich ihr. Erst als sich ihr Gesicht wieder vor meinem befand, realisierte ich, dass sie lachte. »Was?«, keuchte sie.
»Was willst du noch?«, fuhr ich fort, samtweich und eine Spur provozierend. Ich verringerte mein Tempo, sodass auch sie automatisch langsamer wurde. »Im Leben, meine ich. Außer einen Kuss von deinem Angebeteten.«
Ihre Wangen färbten sich noch röter. Und dann passierte es. Nur für den Bruchteil einer ihrer viel zu hektischen Herzschläge zuckte ihr Blick zu meinem Mund. So schnell, dass man es für Einbildung hätte halten können. Hätte ich noch ein Herz gehabt, hätte es in diesem Moment vermutlich vergessen, dass es schlagen sollte.
»Herausfinden, wer ich bin, schätze ich«, murmelte sie. »Aber eigentlich will ich nur, dass es allen gut geht.«
Stirnrunzelnd ließ ich sie los. »Allen?«
»Meiner Familie, meinen Freunden. Wenn bei ihnen alles in Ordnung ist, bin ich glücklich.«
Erst kam der Neid, Sekunden später wurde er von Spott übertrumpft. »Und was ist mit dir?«, fragte ich höhnisch. »Wie willst du herausfinden, wer du bist, wenn dein Glück von anderen Menschen abhängt?«
»Vielleicht ist das meine Bestimmung. Vielleicht gibt es Menschen, die auf der Welt sind, um sich um andere zu kümmern. Ist das etwas Schlechtes?«
»Sich kümmern, ja klar.« Ein hohles Lachen entwich mir. »Du meinst, du bist dazu da, um anderen zu gefallen?« Sie war stehen geblieben, ich begann sie zu umkreisen. Erst langsam, dann immer schneller. »Das ist dein Lebensziel? Wie überaus inspirierend!«
Sie verdrehte die Augen. Doch da war etwas in ihrer Miene. Argwohn? Scham?
»Und du willst die Weltherrschaft, oder was?«
»Die Welt geht mir am Arsch vorbei.« Ich verließ den Kreis, den ich um sie gefahren war, und bewegte mich ein bisschen weiter weg.
Die Welt ist nichts, wenn du keinem Menschen in die Augen sehen darfst.
»Ich habe keine Ziele«, rief ich ihr über die Schulter zu. »Ich lebe nur im Jetzt.«
Ihr Lachen schien mich zu verfolgen. »Lügnerin.«
Bevor ich mir eine Antwort darauf überlegen konnte, erklangen ihre Schlittschuhe hinter mir, aggressiv und entschlossen trafen sie aufs Eis. Diesmal war sie diejenige, die nach meinen Händen griff, sie umklammerte und mich an sich riss, die begann, schneller übers Eis zu fahren und mich vor sich herzuschieben. Ich war viel zu perplex, um mich zu wehren. Ihre Augen glühten. Und obwohl ihr Herz immer noch so heftig in ihrer Brust schlug, dass es unsere Umgebung zum Vibrieren brachte, war von ihrer Unsicherheit nichts mehr zu spüren.
Kurz bevor wir das Ende des Sees erreichten, verzogen sich ihre Lippen zu einem schiefen Lächeln, sie fuhr eine scharfe Kurve und riss mich an sich, damit ich nicht ins Gras fiel. Ihr Mund war nur Millimeter von meinem Hals entfernt. Ihr heißer Atem strich über meine Haut. Die Schwere von Rotwein, vermischt mit etwas Süßem.
Mein Körper stand in Flammen. Ich wollte den See verlassen, sie mitzerren, zu Boden stoßen, mich über sie beugen und meine Lippen auf ihre pressen. Zur Hölle mit ihrem Herzen! Ich brauchte ihr Herz nicht. Ich brauchte nur ein paar Augenblicke …
»Wie alt bist du?«, fragte sie, ließ eine meiner Hände los, umklammerte die andere umso fester. Seite an Seite schwebten wir über den See. »Anfang zwanzig?«
Es war eine Herausforderung, nicht auf ihre Lippen zu starren. »Neunzehn.«
Erneut lachte sie, diesmal klang es allerdings traurig. »Eine Siebzehnjährige, die für andere, und eine Neunzehnjährige, die nur für den Moment leben will? Was meinst du, wer von uns beiden redet den überzeugenderen Blödsinn?«
Das Zischen einer Rakete ertönte, bevor sich Lichterkonfetti über den Nachthimmel ergoss. Ich sah es nur aus den Augenwinkeln. Und auch Daphne löste den Blick nicht von mir.
»Wahrheit gegen Wahrheit?«, flüsterte sie.
Ich konnte bloß nicken. Ihr Herz. Ihr wild pochendes Herz. Ihr Mund. Diese Augen.
Das Feuerwerk hatte begonnen. Die Zeit rannte davon. Ich musste weg von hier.
»Ich würde gern jemanden lieben.«
Meine Brauen schossen in die Höhe. »Was ist mit deinem Ari?«
Schon wieder errötete sie, aber das hielt sie nicht davon ab, genervt dreinzublicken. »Ich meine keine Schwärmerei. Ich meine das, wovon alle reden. Das einzig Wahre. Ich würde gern wissen, wie es sich anfühlt, sich vollkommen nach jemandem zu verzehren. Ich will nicht mehr atmen können, wenn er vor mir steht. Ich will Herzrasen und Verzweiflung und Leidenschaft. Alles auf einmal. Und dann will ich mich an ihn gewöhnen, mich öffnen und ihn öffnen, ich will, dass wir einander erkennen wie aus einem anderen Leben, unsere eigene Geheimsprache entwickeln. Ich will ihm jeden Moment erzählen, den er verpasst hat, und alles über ihn erfahren. Das ist es, was ich will.«
Sie war viel zu nah. Ihre Hand in meiner war glühend heiß.
Ich räusperte mich. »Und du glaubst nicht, das könntest du mit Ari haben?«
»Vielleicht schon.« Schulterzuckend biss sie sich auf die Unterlippe. »Keine Ahnung. Dafür müsste er mich erst mal beachten.«
»Glaubst du nicht, du hast jemanden verdient, der …«
»Ja, ja, ich weiß«, schnitt sie mir das Wort ab und lachte peinlich berührt.
Und plötzlich war die Hitze nicht nur an meiner Hand. Sie breitete sich wie ein Lauffeuer aus, kroch meinen Arm empor, geradewegs in meine Brust, wo sie in Flammen aufging.
Das Donnern weiterer Raketen ertönte, diesmal näher. Wir zuckten gleichzeitig zusammen.
Als wir am Rand des Sees vorbeifuhren, stolperte ich vom Eis und zerrte sie mit mir. Wir wankten, und bevor sie ihr Gleichgewicht wiederfinden konnte, stieß ich sie zu Boden und beugte mich über sie. Mein Verstand hatte sich verabschiedet. Ich wollte Wärme. Ich wollte Gefühle. Ich wollte alles, alles, alles.
Daphnes Brustkorb hob und senkte sich viel zu hektisch. Doch da war keine Furcht in ihren Augen. Sie schaute zu mir auf, als sähe sie mich zum ersten Mal.
Mein Atem stockte, mein Mund war staubtrocken. »Ich könnte dich nicht nur seinen, sondern auch deinen eigenen Namen vergessen lassen.«
Als ihr Herz erneut schneller schlug, war mir für eine Sekunde, als befände es sich nicht in ihrer, sondern in meiner Brust.
Raketen. Feuerwerk. Gelächter. Ein Schrei aus weiter Ferne.
Daphne machte keine Anstalten, sich aufzurichten. Wieso war es so einfach? Wieso wehrte sie sich nicht? Wieso kamen ihre Freunde nicht zurück, um sie vor dem Monster zu retten, das über ihr kauerte?
»Ioanna.« Ein Lächeln zupfte an ihren Lippen, als bereitete es ihr Freude, meinen Namen auszusprechen. »Zeit für deine Wahrheit.«
Für ein paar Sekunden hatte ich keinen Schimmer, wovon sie sprach. Meine Wahrheit. Was wollte ich von meinem Leben? Wer wollte ich wirklich sein?
Sie hatte recht. Nur im Jetzt zu leben, war nicht genug.
»Ich will dir nichts antun«, hörte ich mich sagen, als wäre ich eine Fremde. »Ich will, dass du lebst.«
»W… wie bitte?« Zum ersten Mal schlich sich Furcht in ihre Stimme.
Plötzlich fiel mir das Schlucken schwer. »Du sollst leben. Du sollst alles bekommen, was du dir wünschst. Du sollst herausfinden, wer du bist. Du sollst jemanden lieben. Du sollst eine Chance haben.«
Nicht so wie ich.
Sie war ein Jahr jünger, als ich es gewesen war. Ich konnte ihr das nicht antun. Ich konnte das niemandem antun.
Mit all meiner Willenskraft zwang ich mich, den Blick von ihr abzuwenden. Ich ließ mich nach hinten fallen und begann, die Schlittschuhe aufzuknoten. Meine Finger zitterten. Ich fluchte, wurde aggressiver, ich musste weg von hier, jetzt sofort, sonst würde es zu spät sein, verdammt!
Als ich mich endlich von den Schuhen befreit hatte, schleuderte ich sie von mir, fluchte lauter, mied jeden Blick in ihre Richtung, während ich in meine Stiefel stieg. Nicht nur meine Hände, sondern mein ganzer Körper bebte inzwischen.
»Das ist keine richtige Antwort«, erwiderte Daphne ruhig. Sie schien keine Notiz davon zu nehmen, was mit mir geschah. »Es geht um dich. Was du willst. Ich war auch ehrlich zu dir.«
»Ich will dein Herz.« Meine Stimme war kaum mehr als ein Knurren.
Nun sah ich sie doch an. Zwar konnte sie nicht ahnen, wie wörtlich ich das meinte, aber mein Tonfall schien ihr zu verraten, dass ich nicht mehr flirtete, denn die Angst in ihren Zügen nahm zu.
»Hoffentlich sehen wir uns nie wieder«, sagte ich.
Ihr Herzschlag nahm all meine Sinne ein. So kräftig. So lebendig. Ich wollte sie an mich ziehen. Ich musste …
Nein! Mein eigenes Gesicht erschien vor mir. Mein unschuldiges naives Gesicht vom Vorjahr. Daran musste ich mich festklammern.
»Wenn du schlau bist, dann verlässt du dieses Dorf für heute Nacht. Solange du noch kannst«, würgte ich hervor.
Alles in mir schrie danach zu bleiben. Genau aus diesem Grund wirbelte ich herum und rannte. Ich würde nicht wie meine Schwester sein. Und auch nicht wie die anderen Monster.
Ich hatte eine Wahl.
3
Ioanna
31. Dezember
Fünf Jahre zuvor
Mitternacht
Ich erinnere mich noch gut an meine Verzweiflung damals.
Die Tränen verschleierten meine Sicht, und jeder Schritt bereitete mir Höllenqualen. Trotzdem wurde ich nicht langsamer. Ein Blick auf meine Armbanduhr verriet mir, dass ich keine Sekunde zu früh abgehauen war. Der ohrenbetäubende Feuerwerkslärm tat sein Übriges. Ein neues Jahr hatte begonnen und mit ihm die Wilde Jagd. Das bedeutete, ich musste einen Menschen markieren. Dafür war allein ich zuständig.
Daphnes Herzschlag vibrierte noch immer durch meinen Körper, aber je schneller ich rannte, desto mehr Herzschläge kamen hinzu.
Was hatte ich mir nur dabei gedacht, so kurz vor Mitternacht das Gespräch mit ihr zu suchen?
Ich rannte und rannte, bis ich nicht mehr gefrorene Erde, sondern Kopfsteinpflaster unter den Füßen hatte. Meine Umgebung verschwamm immer wieder vor meinen Augen. Es spielte keine Rolle mehr. Ich wusste, wo ich hinmusste. Meine Willenskraft hatte ausgereicht, um mich von Daphne loszueisen, nun war es allerdings zu spät. Etwas Dunkles, Mächtiges hatte übernommen. Ich war kein Mensch. Seit fast einem Jahr nicht mehr. Zu glauben, ich hätte eine Wahl, grenzte an Wahnsinn. Genau dieselbe Kraft, die mich in der Weihnachtsnacht vor sechs Tagen nach Dodekada – in dieses Dorf – getrieben hatte, führte mich jetzt. Vorbei an Straßenlaternen, geschlossenen Läden und aufgetürmten Müllsäcken. Ans Ende der Sackgasse, zu einem urigen dreistöckigen Gasthaus. Es weckte keine Erinnerung in mir. Genau wie die anderen Gebäude schien es verlassen zu sein, aber ich wusste es besser. Ich spürte das Pochen in meiner Nähe. Regelmäßig, nicht so hektisch wie Daphnes.
Das war der Grund, aus dem ich hier war. Der Herzschlag hatte mich gelockt.
Eine Goldplakette auf der hölzernen Tür verriet den Namen: To asteraki. Restaurant und Pension. Ich packte den Türgriff in Sternenform, rüttelte daran, doch es tat sich nichts. Neben der Tür befand sich ein Fenster, keinen halben Meter über dem Boden und gerade so groß, dass ich hindurchpassen würde.
Bevor ich wusste, was ich tat, hatte ich ausgeholt und meine Faust in die Scheibe gerammt. Beim ersten Mal knackte sie nur leicht, unter dem zweiten Schlag gab sie nach. Glas splitterte in alle Richtungen, Sekundenbruchteile später durchzuckte scharfer Schmerz meine Hand. Es war surreal, alles zu spüren und gleichzeitig einen Körper zu haben, der unversehrt blieb, egal, was ich ihm antat.
Bald. Bald war es geschafft.
Gerade als ich mich nach oben und ins Innere stemmen wollte, hörte ich einen Schlüssel, der von innen ins Schloss gesteckt wurde, und wie der Herzschlag des Menschen beschleunigte. Im nächsten Moment öffnete sich mit einem Knarzen die Haustür. Es war ein Mann, wahrscheinlich um die siebzig. Er trug ein silberfarbenes Hemd unter einem dunkelgrünen Pullunder, der über seinem Bauch spannte. Er hatte kaum mehr Haare auf dem Kopf, dafür einen dichten grauen Bart. Sein faltiges Gesicht war rund, seine Nase knollig, und in seinen Augen glänzte Verärgerung.
Er streckte seinen Kopf heraus, schaute auf das zerbrochene Fenster, dann auf meine Hand, die noch immer zur Faust geballt war, und schließlich in mein Gesicht. »Bist du noch bei Sinnen?«, donnerte er.
Ich schüttelte den Kopf. Nickte. Öffnete den Mund. Schloss ihn wieder. Und dann brach ich erneut in Tränen aus.
Fliehen Sie, wollte ich ihn anschreien. Fliehen Sie, denn ich kann es nicht mehr.
Siebzig war besser als siebzehn, aber verdammt noch mal, er war ein Mensch. Bestimmt hatte er Familie. Leute, die ihn liebten und auf ihn zählten.
Sein Herz schlug so laut, dass es mich schüttelte.
Bitte, ich will das nicht! Um Himmels willen, beruhigen Sie sich, die Aufregung macht es nur noch schlimmer.
Plötzlich veränderte sich seine Miene. Dann ging es ganz schnell. Er beugte sich vor, packte mich an den Schultern und zog mich ins Innere, ehe er die Tür hinter uns zuschlug.
Der Duft von Hefeteig und Nelken stieg mir in die Nase. Ich schwankte. Die Erinnerung an ein anderes Leben übermannte meine Gedanken. Meine Mutter, die am 31. Dezember in der Küche stand und den Neujahrskuchen buk, in dem sie eine Münze verbarg. Wer sie am 1. Januar in seinem Kuchenstück fand, würde das ganze Jahr über Glück haben. Ich hatte sie nie bekommen. Immer nur meine Schwester, Steriani, oder meine Eltern. Das hätte mir der erste Hinweis darauf sein sollen, wie gut es das Leben mit mir meinte.
Wieder und wieder schüttelte ich den Kopf, meine Tränen flogen in alle Richtungen. Dann stieß ich ihn von mir. »Verschwinden Sie«, japste ich zwischen zwei Schluchzern. »Bitte, ich …«
»Ioanna.« Seine Stimme klang rau wie Schmirgelpapier auf Holz.
Ich erstarrte.
»Du bist Ioanna, oder?
Für den Moment ließ mein Tränenfluss nach, und sein Gesicht wurde scharf.
»Ich erinnere mich an dich«, fuhr er im Flüsterton fort. Ein bedauerndes Lächeln erschien auf seinen Lippen. »Du bist mit deiner Schwester hergekommen, nicht wahr? Letztes Jahr, kurz vor Weihnachten?«
Er erinnerte sich. Wie konnte das sein? Wir hatten gerade mal die Hälfte der Raunächte hinter uns. Die meisten Dorfbewohner hatten bis zum 5. Januar keine Ahnung, wie ihnen geschah. Außerdem erinnerte ich mich nicht an ihn. Wir hatten nicht in dieser Pension übernachtet oder in diesem Gasthaus gegessen. Er musste uns irgendwo im Dorf gesehen haben. Fremde fielen hier sofort auf. Doch es gab jetzt Wichtigeres.
»Meine Schwester«, krächzte ich. »Steriani. Wissen Sie, wo …«
Wehmütig schüttelte er den Kopf. »Sie ist am 6. Januar verschwunden, genau wie du. Ein paar Tage lang habe ich mich nach ihr erkundigt, ich wollte sicherstellen, dass es ihr gut geht, weil …« Seine Stimme verlor sich.
Weil sie ihre Schwester verloren hatte.
Menschen erinnerten sich nach dem Ende der Raunächte zwar nicht mehr an die Magie, aber natürlich erinnerten sie sich an die Tote oder den Toten. Nur dass ich nie tot gewesen war. Es gab deutlich Schlimmeres als den Tod.
War Steriani deshalb verschwunden? Empfand ein Teil von ihr Reue, auch wenn sie nicht wusste, aus welchem Grund?
»Ioanna.« Jetzt klang er beinahe zärtlich.
Irgendwas stimmte nicht. Sein Herz. Es schlug jetzt ruhiger. Das konnte nicht sein. Wenn er sich erinnerte, dann wusste er auch, weshalb ich hier war.
»Fliehen Sie«, wiederholte ich, diesmal lauter. Scheiß auf meine Schwester. Ich musste weg. Nein, er musste weg.
»Ich bin Stefanos.« Schon wieder dieses mitfühlende Lächeln. Er hielt mir eine Hand hin. Der Ehering an seinem Mittelfinger blitzte auf.
Mir war kotzübel. Ich schlug seine Hand weg. Als meine Haut auf seine traf, wurde ich schon wieder geschüttelt. Alles in mir schrie danach. Ich brauchte es so sehr.
»VERSCHWINDE!«
Bei meinem Schrei fuhren wir beide zusammen.
»Sie haben keine Ahnung«, brachte ich hervor und tastete nach meiner Kehle. Ich konnte nicht atmen. Eine lächerliche, menschliche Geste. Wie konnte mein Körper Panikattacken haben, obwohl er unsterblich war? »Keine Ahnung, wer ich …«
»Ich weiß, wer du bist«, sagte er leise. »Und ich weiß, was du tun musst.«
»Nein.«
Nein, nein, nein.
»Sie können noch weg«, brachte ich hervor, hektisch, flehend wie im Wahn, während mein Atem immer abgehackter kam. »Sie … haben noch eine Chance. Sie sind mir körperlich überlegen. Ich kann nicht sterben, aber Sie können mich schlagen oder mir ein Messer in die Brust rammen. Es wird mich für ein paar Momente außer Gefecht setzen.«
Sein Blick wanderte zu seinem Arm, an dem eine silberne Uhr funkelte. »Zehn Minuten nach Mitternacht«, wisperte er kopfschüttelnd. »Wenn nicht ich, wer dann? Du musst jemanden markieren, Ioanna. Es ist in Ordnung. Ich bin froh, dass du hergekommen bist.«
Er trat einen Schritt auf mich zu. Automatisch machte ich einen zurück, presste meinen Rücken und meine Handflächen gegen die Tür hinter mir, obwohl ich den Arm ausstrecken und ihn berühren wollte.
Seine Hände auf meinen Schultern. Mein Schluchzen, das uns beide erbeben ließ.
»Ich hatte ein langes, ein gutes Leben. Ganz im Gegensatz zu dir.« Seine Stimme brach. Zum ersten Mal schien er mit den Tränen zu kämpfen. Im nächsten Moment hatte er mich an sich gezogen und in eine feste Umarmung geschlossen.
Ich versuchte, mich zu wehren, versuchte, mich loszureißen, doch sein Herzschlag so nah an meinem Körper war die reinste Erlösung.
»Es tut mir leid, was mit dir geschehen ist, mein Kind.« Behutsam fuhr er mir mit seiner großen Hand über den Hinterkopf und drückte mich an sich. »Das hast du nicht verdient. Du bist viel zu jung.«
Meine Zähne schlugen aufeinander. Er hielt mich, wie mich in den letzten Jahren nur ein einziger Mensch gehalten hatte. Er hielt mich, wie meine Eltern es nie wieder getan hatten, nachdem sie erfahren hatten, dass ich nicht hetero war. Er hielt mich, als könnte er all die Einsamkeit auslöschen.
Die nächsten Sekunden vergingen wie im Zeitraffer. Irgendwann realisierte ich, dass wir zu Boden gesunken waren. Ich heulte ihm sein Hemd voll, während er beruhigende Worte murmelte, die ich nicht verstand, weil sein Herzschlag alle anderen Geräusche verschluckte. Und schließlich, als ich nicht mehr weinen konnte und das Bedürfnis, ihn zu berühren, alles einnahm, da wich er zurück. Seine Augen waren feucht, doch er nickte mit einem Lächeln.
»Es ist nicht deine Schuld«, flüsterte er. »Vergiss das nie.«
Und mit diesen Worten presste er meine flache Hand auf sein Herz.
Aber nein, er hatte sich nicht gerührt. Ich war diejenige, die die Hand ausgestreckt hatte. Es war meine Entscheidung.
Die anderen hatten mich vorgewarnt. Hatten mir wieder und wieder beschrieben, wie es ablaufen würde. Doch genauso gut hätte ich unwissend sein können. Nichts hätte mich auf diesen Moment vorbereiten können.
Ein Erdbeben.
Stefanos und ich schnappten nach Luft. Die Welt wurde in Stücke gerissen und ich mit ihr. Die letzten sechs Tage waren nichts als ein billiger Abklatsch gewesen. Das hier, das war real. Es dauerte nicht einmal eine Sekunde. Für ihn zumindest. Er riss die Augen auf, gab ein Keuchen von sich – und schon war es vorbei. Es schmerzte nicht. Das wusste ich vom letzten Jahr. Nein, dieser Augenblick schmerzte kein bisschen. Der Schmerz würde später kommen, sollte er sich entscheiden zu bleiben.
Mein Leben flog an mir vorbei, im Takt seines Herzschlags, die Gesichter meiner Eltern, dann Sterianis, ein altes Backsteinhaus am Stadtrand, Nebel über schwarzem Meer, ein Underground-Club in Bahnhofsnähe, brennende Regenbogenflaggen auf einer Demo, nackte Haut auf nackter Haut, Kreuze über Klassenzimmertüren, der Geruch von verbranntem Kaffee, mein Kopf unter Wasser, das Messer in meiner Brust, Gurgeln, Schreie, Tränen.
Ein Herzschlag.
Nicht mehr sein Herzschlag.
Abrupt ließ ich meine Hand sinken und tastete nach meiner linken Brusthälfte. Es pochte, schlug, raste.
Nicht nur ich spürte seinen Herzschlag in meiner Brust, alle Monster in diesem Dorf hatten dank meines Opfers soeben einen erhalten. Dafür herrschte in Stefanos’ Brustkorb jetzt nichts als Stille. Das war der Fluch. Ein menschliches Leben als Preis, damit Dutzende Herzlose sechs Tage lang etwas fühlen konnten.
Inmitten dieser Endlosigkeit wanderte mein Blick hinter ihn. Zum ersten Mal nahm ich unsere Umgebung richtig wahr. Wir befanden uns im Restaurantbereich, mehrere hölzerne Tische und Stühle, an den Wänden Bilder von verschneiten Bergen und Klöstern sowie ein Familienfoto.
Ich schaute weg, schaute wieder hin. Da waren Stefanos, eine Frau mit grauer Kurzhaarfrisur in seinem Alter und in ihrer Mitte … in ihrer Mitte stand ein Mädchen mit dunklen Locken, einem etwas zu großen Mund und naiver Hoffnung in den Augen.
Ein Mädchen, deren Leben ich heute Nacht verschont hatte.
Daphne.