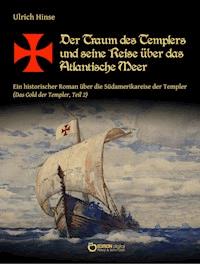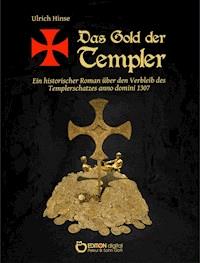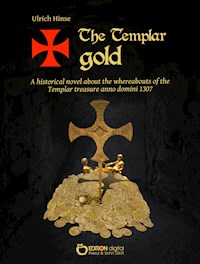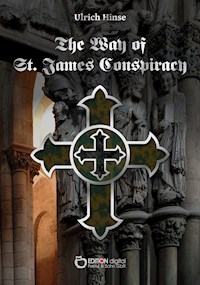8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die 13. Plage der Menschheit – das ist der internationale Terrorismus heute. Um seine große Liebe Jenny aus einem Bordell zu befreien, schließt Boomer einen Pakt mit dem Teufel. Unvermittelt finden sich die beiden in einem Ausbildungslager der Al-Qaeda wieder, wo Boomer zum Sprengstoffspezialisten wird. Um zurück nach Europa zu kommen, schließen sie sich einer Terrorgruppe an und bereiten sich mit ihr auf einen Anschlag in Nordeuropa vor. Als Jenny erkennt, dass ihre Heimat Mecklenburg-Vorpommern ins Fadenkreuz gerät, sucht sie Hilfe bei Kriminalhauptkommissar Raschke, einem Erzfeind aus vergangenen Tagen. Doch kann sie das Schicksal aufhalten? Ein packender Roman vor einem hochaktuellen Hintergrund. Wer in dem Roman „Blutiger Raps“ sich fragte, ob Jenny und Boomer die Flucht aus dem russischen Gefangenenlager überlebt haben, kann in diesem Buch das weitere, schwere Schicksal der beiden Jugendlichen verfolgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Ulrich Hinse
Die 13. Plage
oder Wessen Brot ich esse
ISBN 978-3-86394-352-3 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.deI
Personen und Handlungen dieses Romans sind frei erfunden. Gewisse Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und tatsächlichen Ereignissen wären rein zufälliger Natur, ausgenommen davon sind in der Weltöffentlichkeit bekannte Personen und Ereignisse der nahen Zeitgeschichte.
Besonders bedanken möchte ich mich:
bei meiner Frau Karin für ihre Hilfe, meine weibliche Hauptperson gefühlvoll zu beschreiben,
bei Erika Nagel für die Geduld mit meiner eigenwilligen Grammatik,
bei Charlotte Fleischer für allerlei Tipps, Fachchinesisch verständlicher zu machen,
bei Gerd Thielmann für juristische Hinweise,
bei Harald Bruder für die russischen Dialoge,
bei Reinhard Müller für die rheinischen Dialektbeiträge,
bei Herta, Josef gen. Pep und Christian Eckmair auf Teneriffa,
bei Ernst F. Löhndorff † für geografische Besonderheiten am Khaiber und
last but not least bei meiner Lektorin Carola Herbst für die entscheidenden Veränderungen, damit aus einem Manuskript ein spannendes Buch wird.
Prolog
Am langen Strand an der Hohen Düne, auf der anderen Seite von Warnemünde, da, wo man nur mit der Fähre oder nach einem langen Umweg durch die Rostocker Heide hingelangen kann, aalten sich nur wenige Urlauber am Strand, der sich im Osten im Dunst verlor.
Südlich der Straße von Warnemünde nach Markgrafenheide, im Rostocker Marinehafen, ließ geschäftiges Treiben auf wichtige Ereignisse schließen. Neben hohen militärischen Würdenträgern der Marine, alle in ihren schmucken blauen Uniformen mit den goldenen Kolbenringen an den Ärmeln, hatten sich überraschend viele Zivilisten, jüngere als auch ältere, vor allem aber jüngere Frauen mit Kindern eingefunden.
Plötzlich kam Bewegung in die wartende Menge. Hälse wurden gereckt, als in einer großen schwarzen gepanzerten Limousine der Ministerpräsident des Landes, begleitet von dem ebenfalls schwarzen gepanzerten Fahrzeug seiner Personenschützer, an dem offenstehenden Schlagbaum mit dem salutierenden Marinesoldaten vorbeifuhr.
Der schneidige Marinesoldat im traditionellen Kulani, einem dunkelblauen, zweireihigen, hüftlangen Jackett, und mit seiner weißen Tellermütze, dessen exakt geschnittene Mützenbänder im Wind wehten, salutierte zackig.
Der Wachhabende hatte sofort den Telefonhörer aufgenommen, um dem Kasernenkommandanten die Ankunft des Landesvaters zu melden. Vor dem Offizierskasino rissen Ordonanzen die Wagentüren auf, ein Offizier geleitete den Landesvater in die Lobby, wo ein Admiral dem Politiker die anwesenden Offiziere vorstellte. Im Anschluss an den kleinen Imbiss, zu dem die Ordonanzen alkoholische und alkoholfreie Getränke reichten, ging es zum Appellplatz, wo sich eine recht stattliche Schiffsbesatzung im Karree aufgebaut hatte.
Den Platz umsäumten viele Besucher, von denen sich einige Mütter intensiv um plärrende Kinder kümmerten, die unbedingt zu ihren im Karree stehenden Vätern wollten. Nachdem die Offiziellen aus Politik, Wirtschaft und Militär ihre reservierten Plätze eingenommen hatten, meldete der Kommandant der Fregatte dem Standortkommandanten seine fast vollzählig angetretene Besatzung. Es fehlten die üblichen Unabkömmlichen aus der Maschine, von der Brücke sowie anderen wichtigen Stationen.
Der Standortkommandant wiederum meldete dem Admiral, wobei er zusätzlich noch den Grund für die martialische Veranstaltung nannte. Der Admiral bedankte sich, begrüßte die angetretenen Soldaten, lauschte wohlwollend der vielstimmig gebrüllten Antwort und ließ im Anschluss an die Meldung die Soldaten wieder bequem stehen. Das Marinemusikkorps spielte einen Marsch, dann gab es die erste Rede.
Der Admiral erklärte mit markigen Worten, welche großartige Aufgabe auf die Soldaten warte und warum das Vaterland auf sie stolz sei. Am Horn von Afrika und im Roten Meer hätten sie von nun an ein halbes Jahr Dienst zur Verteidigung des Vaterlandes zu verrichten, sozusagen als Speerspitze im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland werde von der Marine vom Stützpunkt Djibouti aus zwischen Afrika und der arabischen Halbinsel verteidigt. Nicht allein von den Kameraden des Heeres und der Luftwaffe am Hindukusch, wie der Herr Verteidigungsminister vor dem Bundestag erklärt habe.
Nach einem Musikstück schloss sich der Ministerpräsident mit wohlgesetzten Worten seinem Vorredner an. Er wünschte Fortune für die Aufgabe, vor allem aber gesunde Heimkehr von diesem gefährlichen Auftrag. Besonders stolz sei er, dass ausgerechnet die Fregatte mit dem Namen seines Landes diese Aufgabe übernehmen dürfe, um so Mecklenburg-Vorpommern in der Welt bekannt zu machen. Der verhaltene Beifall der Besucher erstarb, als im Anschluss an die Rede die Nationalhymne gespielt wurde.
Die Besatzung der Fregatte marschierte mit einem Lied auf den Lippen, sinnigerweise war es „Schwer mit den Schätzen des Orients beladen“, an den Honoratioren vorbei zum Pier. Dort durften sich die Soldaten noch ein letztes Mal von den Angehörigen verabschieden, danach ging es unwiderruflich an Bord. Kurze Zeit später war das schrille Quieken der Bootsmannsmaatenpfeifen zu hören. Die Soldaten rannten auf ihre Stationen, die Leinen wurden losgeworfen. Langsam schob sich das graue Kriegsschiff aus dem Breitling hinaus auf die Ostsee.
Mit wehmütigen Gedanken sah Kriminalhauptkommissar Raschke, der Chef des Staatsschutzkommissariats der örtlichen Kriminalpolizei, dem Manöver zu. Er fühlte sich an die Zeit erinnert, als er selbst noch als zwanzigjähriger Marinesoldat zur See gefahren war. Vor etwas mehr als dreißig Jahren war das gewesen, zu Zeiten des Kalten Krieges, wo sich Bundesmarine und Volksmarine noch als unversöhnliche Gegner gegenseitig in der Ostsee belauert hatten.
Jetzt war er Mitte fünfzig, hatte der Marine nicht zuletzt aus Liebe zu seiner Frau und den Kindern schon lange den Rücken gekehrt und war bei der Polizei gelandet. Dort hatte er sich bei der Kripo auf den Staatsschutz spezialisiert und vor einigen Jahren die Stelle als Kommissariatsleiter bekommen. Inzwischen waren die Kinder nicht nur aus dem Haus, sondern die ersten Enkel konnten bereits auf den Knien geschaukelt werden. Wenn sie wollten. Meist wollten sie nicht, brüllten wie am Spieß oder durchnässten Opas Hose. Deshalb war es Raschke sehr lieb, wenn er von befreundeten Dienststellen, und die Bundeswehr gehörte selbstverständlich dazu, zu einem derart zwanglosen Termin eingeladen wurde, wie zu der heutigen Veranstaltung.
„Hallo, Herr Hauptkommissar, schön Sie hier bei uns im Stützpunkt zu sehen. Es ist beruhigend, den Staatsschutz in der Nähe zu wissen, wenn wir gegen den islamischen Terror zu Felde ziehen. Darf ich Sie deshalb mit Ihren Kollegen ins Kasino einladen?“
Überrascht drehte sich der Kriminalbeamte um. Hinter ihm standen freundlich lächelnd zwei Offiziere. Ein Kapitänleutnant, wie an den „Kolbenringen“ am Ärmel der Uniformjacke leicht zu erkennen war und ein Major des Heeres. Genauer der Infanterie, wie die grünen Kragenspiegel verrieten. Raschke konnte sich eine Plattitüde nicht verkneifen.
„Ah, Herr Major, wie immer gut zu Fuß und Herr Kaleu, heute trockenen Fußes, wie ich sehe.“
Die beiden Bundeswehroffiziere blieben trotz der ungewöhnlichen Bemerkung weiterhin freundlich und gelassen. Sie schienen Raschkes Sprüche schon zu kennen, deshalb gingen sie auf die Bemerkung nicht weiter ein. Der Polizeibeamte stellte seine Begleiter vor. Zuerst die junge, blonde Frau, die der Kapitänleutnant unverhohlen interessiert musterte.
„Meine Herren, ich darf bekannt machen. Brigitte Hessler, seit kurzem Mitarbeiterin in meinem Kommissariat und in der Soko. Die Kriminalobermeisterin steht übrigens unter meinem ganz persönlichen Schutz, Herr Kaleu und der junge Mann neben mir ist Ihnen ja hinlänglich bekannt. Was für Sie neu sein dürfte, ist die Tatsache, dass Oberkommissar Schrader seit vorgestern mein Stellvertreter ist. Er will bestimmt im Kasino eine Runde ausgeben, so wie ich ihn kenne.“
Peter Schrader verzog das Gesicht, nahm aber die Gratulation der Offiziere freundlich entgegen, dann schlenderten die fünf ohne Eile in Richtung Kasino, wobei Schrader eifersüchtig beobachtete, wie sich Biggi, so wurde die zweiundzwanzig Jahre junge Beamtin von allen Kollegen im Kommissariat der Einfachheit halber genannt, mit strahlenden Augen den Marineoffizier ansah. Schrader war nicht mehr verheiratet, und - anders als Raschke - der für Biggi offensichtlich eine Art Vaterersatz darstellte, bemühte er sich bei der Kollegin um anders geartete Kontakte, war dabei aber bisher nicht sonderlich erfolgreich gewesen.
1. Kapitel
Nach einer längeren Seereise durch Nordsee, Biskaya, Mittelmeer, den Suezkanal und das Rote Meer hatte die Fregatte Mecklenburg-Vorpommern im Stützpunkt Djibouti, am Horn von Afrika, ihren Dienst im Rahmen der internationalen Terrorbekämpfung aufgenommen. Dort sollte das deutsche Kriegsschiff, zusammen mit Schiffen anderer Nationen, den Seeverkehr am Bab el Mandeb, der nur 20 Kilometer breiten Einfahrt in das Rote Meer, überwachen. So pendelte sie zwischen arabischer Halbinsel und afrikanischem Festland hin und her, einmal direkt unterhalb der jemenitischen Küste, dann wieder vor der somalischen, zeitweilig auch bis Eritrea. Das Klima, die hohe Luftfeuchtigkeit sowie die gnadenlose Hitze in der Nähe des Äquators waren fast unerträglich. Der tägliche Dienst dagegen eher langweilig. Gelegentlich wurde eine Dhau, eines der einheimischen hölzernen Segelschiffe, die unvorsichtigerweise aus den Hoheitsgewässern herausgefahren war, auf Waffen kontrolliert. Gefunden hatten sie bisher nichts. Mit stoischer Ruhe ließen die Besatzungen die Prozedur über sich ergehen.
Die deutschen Marinesoldaten machten sich keine großen Hoffnungen, auf diese Art und Weise Terroristen fangen zu können. Interessanter wären Schiffe gewesen, die innerhalb somalischer oder jemenitischer Hoheitsgewässer fuhren. Aber die waren tabu. Deshalb verlief der Dienst tagaus tagein eintönig ohne interessante Abwechslung. Um nicht aus der Übung zu kommen, wurde zwischendurch mit den Maschinenwaffen auf Ziele aus Holz und Segeltuch geschossen, die, ins Wasser gesetzt, von der Motorbarkasse an der Fregatte vorbeigeschleppt wurden. Natürlich an der berühmten langen Leine, denn man konnte ja nie wissen, wie gut oder schlecht die Kanoniere zielten.
Das deutsche Kriegsschiff hatte gerade die südjemenitischen Gewässer nahe der Insel Perim verlassen und mit südlichem Kurs das Inselchen Sawabi auf dem Weg nach Djibouti passiert, um dort seinen Dienst zu beenden. Die gesamte Besatzung freute sich auf die entspannenden Stunden im Hafen. Auch wenn die hohe Luftfeuchtigkeit bei der großen Hitze nicht unbedingt zum Stadtbummel einlud. Aber im Stützpunkt gab es reichlich klimatisierte Abwechslung. Im Seegebiet vor Aden hatten sie immer ein ungutes Gefühl. Allzu präsent war, wie Terroristen dort die US-Fregatte Cole und den französischen Tanker Limbourg angegriffen hatten.
Wieder und immer wieder hatten sie sich Filmberichte über die Angriffe ansehen müssen. Wieder und immer wieder hatten sie auf ihren Stationen geübt, wie bei einem derartigen Angriff zu reagieren ist. Deswegen waren auch alle sofort hellwach, als das durch Mark und Bein gehende Tröten des Alarmhorns die Seeleute auf ihre Stationen rief. Gleichzeitig erhöhte die Fregatte deutlich ihre Geschwindigkeit, wobei sie sich stark nach Backbord legte. Kaum wieder aufgerichtet, feuerte das Buggeschütz. Direkt vor einer stark motorisierten Yacht mit einem kleinen Geschütz auf dem Achterdeck, die sichtlich bemüht war, vor der Fregatte in sichere jemenitische Hoheitsgewässer zu entkommen, erhob sich eine hohe Wassersäule, der das Boot nicht mehr ausweichen konnte. Mit voller Fahrt fuhr sie mitten hinein. Für die Besatzung der Yacht musste das ein Gefühl gewesen sein, als fahre sie gegen eine Wand. Zwei Matrosen, die gerade in einer Art Wahnsinnsaktion die über dem Heck montierte Maschinenwaffe gegen die Fregatte richten wollten, wurden von dem auf das Oberdeck klatschenden Wasserschwall über Bord gerissen. Sie verschwanden in den Wellen. Dem Rest der Besatzung schien das Schicksal der über Bord Gegangenen egal zu sein. Sie kümmerten sich nicht um sie, zumal die Überlebenschancen bei der Menge von Haien, die sich im Meer auf alles stürzten, was wie Futter aussah, mehr als gering waren.
Die Fregatte stoppte. Mit einer Motorbarkasse setzte ein gutes Dutzend bewaffnete Marinesoldaten zu der Yacht über. Ein zweites Boot suchte nach den über Bord gegangenen Männern, die, wie erwartet, nicht geborgen werden konnten. Sie blieben verschwunden.
In der Yacht befanden sich weitere sechs Männer in jemenitischer Landestracht, die sich widerstandslos festnehmen ließen. Nachdem ihnen ihre Dolche und Pistolen abgenommen worden waren, wurden die Männer auf die Fregatte gebracht. Bei der Durchsuchung der Kajüte fanden sich mehrere schultergestützte Flugabwehrwaffen, Kisten mit Sprengstoff, Zündern und Munition. Dazu Fotos, die einen der Festgenommenen zusammen mit Osama bin Laden in einem Ausbildungslager zeigten. Die deutschen Seeleute hatten keine Zweifel, bei den Männern auf dem gestoppten Boot konnte es sich nur um Terroristen der Al Qaeda handeln. Über Funk erstattete der Leutnant zur See, der das Prisenkommando befehligte, dem Kommandanten, der auf der Brücke der Fregatte den Einsatz seiner Leute mit dem Fernglas verfolgte, Bericht. Als er geendet hatte, bekam er unverzüglich neue Befehle. Die Gefangenen wurden mit dem Beiboot an Bord der Fregatte gebracht, die sofort Fahrt aufnahm und dem Hafen von Djibouti zusteuerte. Die aufgebrachte Yacht folgte, von deutschen Seeleuten gesteuert, im Kielwasser des grauen Kriegsschiffes. Am Kai wartete bereits ein von zwei Panzern begleiteter Militärlastwagen mit bis an die Zähne bewaffneten amerikanischen Soldaten. Die Gefangenen wurden von mehreren Matrosen ungefesselt an Oberdeck gebracht. Als die Taliban vor dem Schiff die Amerikaner sahen, versuchten zwei über Bord zu springen, um eine Übergabe zu verhindern. Ein dritter Gefangener klammerte sich laut schreiend an der Reling neben der Fallreepspforte fest. Nur mit Mühe gelang es, die sich wild wehrenden Männer zu bändigen und über das schmale Fallreep an Land zu bringen.
Kaum hatten die Deutschen mit ihren Gefangenen festen Boden unter den Füßen, waren auch schon amerikanische Soldaten zur Stelle, um die Taliban zu übernehmen. Sie schleppten ihre neuen Gefangenen zu dem wartenden LKW, wobei sie nicht gerade zimperlich vorgingen. Dort wurden den Festgenommenen Hand- und Fußfesseln angelegt, die durch Ketten miteinander verbunden waren und nur ein Gehen mit kleinen Trippelschritten ermöglichten. Die Gefangenen wurden auf die Ladefläche gezogen. Die Wachen legten sie mit dem Bauch nach unten auf den Boden, verbanden ihnen die Augen, schlossen die Klappe, dann setzte sich der Konvoi in Bewegung. Kaum waren die Fahrzeuge zwischen den flachen weißen Kasernenbauten verschwunden, erschienen drei Offiziere der amerikanischen Navy mit mehreren Seeleuten, um die von den Deutschen aufgebrachte Yacht mitsamt dem Sprengstoff und den Waffen zu übernehmen.
2. Kapitel
Der Blick über das Tal hin zum Meer war beeindruckend. Unterhalb der Ferienwohnung an einer Mauer aus schwarzer Lava lehnte Jenny, gertenschlank, Mitte zwanzig mit kurzem, leuchtend rotem Haar. Wie viele Frauen mit natürlichem rotem Haar hatte sie einen blassen Teint. In deutlichem Kontrast dazu standen merkwürdig dunkle Augen, aus denen mehr Lebenserfahrung sprach, als für ihr Alter zu erwarten gewesen wäre.
In ihrem Rücken befand sich der große Swimmingpool, dessen klares Wasser glitzernd die hellen Strahlen der Morgensonne brach, wobei flackernde Lichtreflexe auf das weiße Wohnhaus mit seiner schönen Terrasse geworfen wurden. Jennys Blick wanderte über die einige hundert Meter unter ihr liegenden Häuser der kleinen Stadt Arona, das weite zersiedelte Tal mit seinen Terrassenfeldern an den Hügeln aus schlackiger Lava, die unzähligen Apfelsinen- und Mandelbäume, die Kakteen, Agaven und die mit hellen Planen abgedeckten Bananenplantagen hin zum Horizont, den der Atlantik wie einen Strich zeichnete.
Bereits früh am Morgen war die Luft angenehm warm, ließ die Nähe von Afrika erahnen. Der ständig von See kommende weiche Wind trug den Duft von Oleander den Hang herauf. Jenny atmete tief diese seidenweiche, duftende Luft ein. Sie genoss die Ruhe, die der Blick ins Tal vermittelte.
Tief unter sich erkannte sie links von einem aus rötlicher Asche bestehenden Hügel die kleine Küstenstadt Los Christianos; daneben die in den letzten zwanzig Jahren am Reißbrett entstandene, fast ausschließlich aus Hotels oder Appartementanlagen bestehende Touristenhochburg Playa de las Americas. Weiter rechts verhinderte der Conde, ein lang gezogener Tafelberg, die Sicht auf die Westküste von Teneriffa und die dunklen, steilen Felsen von Los Gigantes, während links hinter einigen Hügeln die mit Planen gegen den ewigen Wind geschützten Bananenplantagen erkennbar waren, hinter denen direkt an der Küste die hellen Aparthotels an der Costa del Silencio leuchteten. Über dieser Küste der Ruhe schwebten - welche Ironie - im Minutenabstand große und kleine Flugzeuge, voll besetzt mit urlaubshungrigen Touristen, aus allen möglichen Ländern ein.
Weit unten auf dem Atlantischen Ozean zog eine moderne Katamaranfähre mit schäumendem Heckwasser eine weiße Spur zu der im Dunst liegenden Insel La Gomera, während unweit der Küste eine Handvoll kleiner Schiffe bei den Ruheplätzen der Grindwale in der Dünung dümpelten.
Die weißen Häuser der vielen Ferienorte leuchteten in der Sonne. Irgendwo da unten würden sie und ihr Freund Sigi – alias Yusuf - genannt Boomer, heute einen Verbindungsmann treffen, der ihnen neue Ausweispapiere und Flugtickets nach Deutschland besorgen wird. Aber erst nach dem Frühstück, zu dem die frischen Brötchen fehlten, die Boomer kaufen wollte. Mein Boomer, dachte Jenny, während sie versonnen vor sich hin lächelte. Die Sonne erreichte sie jetzt und streichelte sanft ihr Gesicht. Mit geschlossenen Augen horchte sie in sich hinein. Tief atmete sie die angenehm milde Luft, reckte wohlig ihre Arme gen Himmel, als wollte sie die ganze Welt umarmen. Die unbeschwert heitere Stimmung auf der Ferieninsel hatte sie ruhiger werden lassen.
Jetzt, wo sie sich in Freiheit und relativ gefahrlos bewegten, jetzt endlich konnte sie sich auf sich konzentrieren, konnte sich ganz auf ihre Gefühle einlassen. Sie meinte, Boomers Liebkosungen der letzten Nacht zu spüren, glaubte, seinen Atem zu hören, den er in der Erregung stoßweise ausgepresst hatte. Wieder sog sie den süßen Blütenduft tief ein. Sie fühlte ein leichtes, angenehmes Kribbeln – die Schmetterlinge im Bauch. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich, dachte sie. All die Zweifel, die sie in den vergangenen Jahren fern der Heimat immer wieder heimgesucht hatten, waren wie weggeblasen. Und ja, ich werde bei ihm bleiben. Ich brauche seine Liebe, seine Nähe, seine Unbeschwertheit, mit der er mit den Schwierigkeiten des Lebens umgeht. Vor allem aber seine Leichtigkeit, mit der er mich immer wieder aus meinen bösen Erinnerungen herausholt, dachte sie und lächelte vor sich hin. Ganz weit weg waren jetzt ihre Überlegungen, sich hier auf Teneriffa an die Polizei oder das Deutsche Generalkonsulat zu wenden, um sich von Boomer und seinen neuen Freunden zu trennen. Nein, ein Leben ohne Boomer konnte und wollte sie sich nicht mehr vorstellen.
„Komme was will. Wir werden es zusammen schaffen“, murmelte sie entschlossen vor sich hin. Zur Bekräftigung nickte sie und stampfte mit dem rechten Fuß auf. Sie öffnete die Augen, um ins Tal hinunterzuschauen. Täuschte sie sich? Strahlten die Blüten der zahllosen Bäume und Stauden wirklich intensiver zu ihr herauf? Lachend und ausgelassen wie ein Kind, mehr hüpfend als laufend, kehrte sie zu ihrer Ferienwohnung zurück, um sich um das Frühstück zu kümmern. Was für ein herrlicher Märzmorgen, dachte Boomer gut gelaunt.
Er fuhr mit dem gemieteten Kleinwagen die von Ohrenkakteen umsäumte steile Straße nach Arona hinunter. Sein Ziel war der kleine Tante-Emma-Laden mit dem stolzen Namen Supermercado. Dessen Inhaberin, die freundliche Marguerita mit dem feuerrot gefärbten Haar, verkaufte die besten Brötchen. Garantiert frisch aus dem Ofen.
„Treinta cinco para uno “, flötete sie gerade, als Boomer ihren Laden betrat. Aha, 35 Cent will sie für ein Brötchen haben. Die gut 40-Jährige bedachte ihn mit einem schmachtenden Blick.
Boomer – hochgewachsen, schlank, seinen dunkelblonden Haarschopf trug er lässig strubbelig - wirkte mit seinem Vollbart viel älter, als er es mit seinen 24 Jahren tatsächlich war. Seine blau-grauen Augen erwiderten Margueritas Blick jedoch nicht. Er war eher sauer, weil der kleine Laden von den spanischen Hausfrauen nicht nur zum Einkaufen, sondern hauptsächlich als Kommunikationszentrum genutzt wurde. Nichts, schon gar nicht ein der spanischen Sprache unkundiger, Brötchen kaufender Tourist, konnte die Damen von ihrem Schwätzchen abhalten.
Jenny hatte diese Erfahrung bereits gemacht und heute Boomer zum Einkaufen geschickt. Nicht zuletzt deshalb, weil er gemault hatte, als sie in den vergangenen Tagen nicht sofort zurückgekommen war. Lautes Kläffen riss sie aus ihren Gedanken. Ein kleiner, wuscheliger grau-weißer Hund fegte wie ein Irrwisch die Freitreppe der Veranda herunter, gefolgt von einem schäferhundgroßen schwarzen Mischling. Beide Tiere sausten am Pool vorbei, umrundeten einen Billardtisch, wichen geschickt einem im Weg stehenden, stacheligen Schwiegermutterstuhl, wie die runde Kaktusart sinnigerweise genannt wird, aus und stoppten direkt vor Jenny. Während der kleine Hund mit dem stolzen Namen Simba an Jenny hochsprang, blieb die große Bessy abwartend einige Meter entfernt stehen, um mit ihren bernsteinfarbenen Augen erwartungsfroh auf den Feriengast zu blicken.
„Na, ihr zwei Hübschen“, sprach Jenny die beiden an, „fordert ihr euer Leckerchen ein?“
Als ob der kleine Wuschel verstanden hätte, sauste er zur Veranda zu dem von Jenny bereits gedeckten Frühstückstisch. Bessy trottete neben Jenny her, die sich seufzend auf den Weg zur Terrasse machte.
„Euer Frauchen ist wohl schon in die Stadt zum Einkaufen gefahren? Da ist die Gelegenheit günstig für ein zweites Frühstück“, lachte Jenny und angelte vom Teller zwei Wurstscheiben, die von den Hunden noch in der Luft geschnappt wurden und in null Komma nichts in ihren Mäulern verschwanden. Einen Wimpernschlag später sausten beide kläffend in Richtung Eingangstor. Jetzt hörte auch Jenny das Auto, mit dem Boomer vom Einkaufen zurückkehrte.
„Na endlich“, murmelte sie, „ich dachte schon, es wird heute nichts mehr mit frischen Brötchen.“
„Mann, Mann, Mann“, tönte Boomer. Mit einem Seufzer ließ er sich am Frühstückstisch nieder.
„Die Tratschweiber in dem spanischen Dorfkonsum haben die Ruhe weg. Man steht sich die Beine in den Bauch nur für ein paar Brötchen. Morgen gehe ich in den Laden direkt neben dem Ayuntamiento oder wie das Rathaus hier heißt.“
„Und du meinst, da ist es anders?“, zweifelte Jenny, während sie süffisant grinste. Boomer brummte etwas in den Bart und fing an zu essen.
„Heute muss ich das Quartier für unsere Leute besorgen“, bemerkte er mit vollem Mund, wobei die Krümel nur so über den Tisch flogen.
„Du Ferkel“, giftete Jenny, „wir sind nicht mehr in Afghanistan. Fang endlich an, dich wieder wie ein normaler Mensch zu benehmen. Das gilt sowohl für deine Tischmanieren als auch für den Umgang mit mir.“
Sie atmete einmal tief durch und fügte einen Ton freundlicher hinzu: „Außerdem solltest du dir endlich den Bart abrasieren. Der mag bei den Taliban notwendig gewesen sein, aber jetzt sind wir doch auf dem Weg nach Hause. Und dann darf ich daran erinnern, dass wir die Aufträge gemeinsam abarbeiten werden. Ich bin nicht dein Dienstmädchen. Und wir sind nicht verheiratet. Auch wenn das bis vor Kurzem noch alle geglaubt haben.“
„He, he. Langsam, langsam“, brummte Boomer, „du solltest aber nicht vergessen, dass unsere Freunde genau das weiterhin glauben sollen. Wenn wir mit denen zusammen als Team unsere Aufgaben erledigen wollen, müssen wir uns so verhalten wie bisher.“
„Du spinnst wohl“, beharrte Jenny, „auch Mahmoud und die anderen müssen sich an mitteleuropäische Verhältnisse gewöhnen. Deshalb kommen sie hierher. Sie können es sich ganz gewiss nicht erlauben, fundamental-islamische Gepflogenheiten so mir nichts dir nichts beizubehalten. Das fällt auf. Und Auffallen ist doch das Letzte, was wir wollen. Oder? Mahmoud und die anderen müssen das akzeptieren. Deshalb sollten wir sie auch nicht hier in unmittelbarer Nähe unterbringen. Wir sollten weiter oben in den Bergen ein Haus für sie suchen. Da fühlen sie sich bestimmt wohler als bei uns. Außerdem fühle ich mich wohler, wenn sie weiter entfernt wohnen.“
„Und wie stellt sich das mein aggressives Frauenpowermädchen vor?“ Boomer spülte den letzten Brötchenbissen mit einem Schluck Kaffee hinunter, während er Jenny fragend ansah.
„Du kannst dir deinen Sarkasmus sparen. Wenn ich die Dinge nicht durchdenken würde, sind deine Pläne schneller gegen den Baum gefahren, als es uns lieb sein kann. Wenn es nach dir gegangen wäre, säßen wir jetzt in irgendeinem Hotel mitten in dem Urlaubstrubel da unten. Natürlich ist da unten die Gefahr des Auffallens weniger groß, aber der Kulturschock für unsere Freunde, die in einigen Tagen kommen, wäre kaum zu heilen.“
„Ist ja schon gut“, wiegelte Boomer ab. Er stand auf, holte die Landkarte von Teneriffa und ging zum Pool, wo er die Karte auf einer Liege ausbreitete. Während er sich in die Karte vertiefte, räumte Jenny den Tisch ab.
So ganz hatte sie sich doch noch nicht vom Rollenverhalten der letzten Jahre getrennt. Aber sie genoss die Freiheiten, auf die sie als Frau so lange hatte verzichten müssen. Im Badezimmer betrachtete sie sich nachdenklich im Spiegel. Spurlos waren die vergangenen Jahre nicht an ihr vorübergegangen. Aus der spätpubertären, alternativen Punkerin war eine Frau geworden, der man die Erfahrungen ansah, die sie sich lieber erspart hätte. Sie lächelte sich im Spiegel an, steckte sich die Haare hoch, cremte sich ein, dann setzte sie sich im Badeanzug zu Boomer an den Pool.
„Allzu weit entfernt dürfen wir sie nicht einquartieren“, erklärte er, „es gibt einiges zu besprechen. Natürlich nicht über Handy, sondern nur im persönlichen Gespräch. Ich schlage vor, wir suchen etwas in Ifonche.“
Er tippte mit dem Finger auf den Ort, der fünf Kilometer entfernt und gut tausend Meter hoch in den Bergen liegt. „Da oben gibt es bestimmt einige einsame Fincas mit Nachbarn, die keine Fragen stellen. Genau das Richtige für unsere Freunde.“
„Wie du meinst“, flötete Jenny und sprang kopfüber in den Pool. Aus dem Wasser rief sie prustend: „Wir können ja gleich hinfahren und suchen. Mit etwas Glück finden wir etwas. Vielleicht helfen unsere Vermieter bei der Vermittlung. Die kennen doch hier Hinz und Kunz.“
Boomer blickte grinsend von seiner Karte auf. „Bist du sicher, dass es hier in Spanien Hinz und Kunz gibt? Wohl eher Gomez und Lopez.“ Er sah versonnen auf seine badende Freundin, die alle für seine Frau hielten und die ihm wegen der letzten Bemerkung die Zunge herausstreckte.
Was war in den letzten Jahren alles geschehen? Er empfand es wie einen bösen Traum. Aber es war Realität. Wie im Zeitraffer lief vor seinen Augen ein Film ab: das Arbeitslager im Bergwerk in Russland, die Flucht, die Fahrt durch Kasachstan und Tadschikistan, der Aufenthalt bei den Taliban in Afghanistan, in Pakistan und das Zwischenspiel hier auf Teneriffa. Für was hatte er sich hergegeben, nur um wieder nach Deutschland zu kommen? Er kam nicht mehr dazu, seinen Gedanken weiter nachzuhängen. Jenny war aus dem Pool geklettert, hatte sich abgetrocknet und riss ihn aus seiner Traumwelt wieder in die Wirklichkeit zurück.
„He, du Träumer. Ich zieh mich schnell um. Dann sollten wir fahren, um das Quartier zu suchen. Außerdem haben wir heute noch einen Termin in Los Christianos.“
Boomer faltete umständlich die Karte zusammen. Dann ging er zur Balustrade, um die unter ihm liegende Landschaft in sich aufzusaugen und dabei zu entspannen. Es gelang ihm nicht. Zu viele Gedanken kreisten in seinem Kopf. Was würde passieren, wenn sie die Gelegenheit nutzten, um sich jetzt abzusetzen? Einfach zum Deutschen Konsulat in Santa Cruz gehen, etwas von gestohlenen Papieren und Tickets erzählen, Geld erbitten und verschwinden. War das wirklich die letzte Gelegenheit, ohne später echte Probleme zu bekommen? Vielleicht hatte Jenny ja doch Recht, wenn sie behauptete, ein Ende mit Schrecken sei besser, als ein Schrecken ohne Ende.
Aber dann verwarf er den Gedanken wieder. Er gestand sich ein, dass ihm seine fanatischen Freunde ans Herz gewachsen waren. In ihrer Gemeinschaft hatte er Anerkennung gefunden. Zu lange war er immer nur der Verlierer gewesen, der, den niemand ernst genommen hatte. Wenn er sich jetzt von denen löste, die ihm bedingungslos vertrauten, hieße das Verrat zu üben. Dann wäre er wieder der Verlierer und zwar im doppelten Sinne. Boomer dachte an das viel beschworene weltumspannende Netzwerk und schluckte schwer. Die Verratenen würden den Verräter finden und damit auch Jenny. Die Rache würde furchtbar sein, darüber hegte er keinerlei Zweifel. Nein, dazu durfte er es nicht kommen lassen. Er hatte geschworen, Jenny zu beschützen und das konnte er am besten, wenn er sich Al Qaeda zur Verfügung stellte, dieser Organisation, die einer Spinne gleich in ihrem klebrigen Netz auf Opfer lauerte. Und noch etwas war zu bedenken: ohne die islamischen Freunde verfügten sie weder über Geld noch über Verbindungen. Das deutsche Konsulat würde wegen des angeblichen Diebstahls auf eine Anzeige bei der spanischen Polizei verweisen, zu der er freiwillig ganz bestimmt nicht ginge. Also, Augen zu und durch.
Als sich die Rollläden an ihrer Ferienwohnung mit lautem Gerassel schlossen, wurde Boomer aus seinen Gedanken gerissen. Wenige Augenblicke später kam Jenny mit einer Tasche die Treppe herunter, die beiden Hunde im Gefolge.
„Fahr schon mal den Wagen vom Grundstück. Ich passe auf, dass unsere Beschützer nicht weglaufen“, ordnete sie an.
„Sag mal, kleine Maus. Liebst du mich eigentlich?“
Jenny schaute verwundert auf. Er ist doch sonst nicht der Typ für ernsthafte Beziehungsgespräche, dachte sie. Und warum stellt er diese Frage gerade jetzt.? Bevor sie sich zu einer Antwort entschließen konnte, nahm Boomer ihren Kopf in beide Hände. Seine hellen Augen forschten in ihrem Gesicht. Er küsste sie so leidenschaftlich, dass ihr die Knie weich wurden. Keuchend rang sie nach Atem.
„Hey, mein stürmischer Gebieter. Wie kannst du zweifeln?“
„Beweise es.“
Jenny drehte sich um und zog Boomer hinter sich her. Die Hunde, die schon zum Tor gelaufen waren, schauten irritiert zu den Zweibeinern zurück, die wieder in ihrem Appartement verschwanden.
Nachdem sich das automatische Rolltor wieder geschlossen hatte, fuhren sie die kleine, schmale Straße bergauf in Richtung Vilaflor, der angeblich höchstgelegenen Ortschaft von ganz Spanien. Es ging steil hinauf. Sie durchfuhren den wie ausgestorben in der Mittagssonne liegenden Ort Escalona, bogen in die Straße nach Ifonche ein und rollten an kleinen Feldern mit Rebstöcken, Gemüse und Kartoffeln vorbei. Schmucklose Fincas lagen links und rechts der Straße, eine kleine Kapelle, vor der auf einem Natursteinsockel die Bronzefigur eines Hermano Pedro stand, dem Gläubige einige Rosenkränze um die Hände geschlungen hatten und eine Bar gleichen Namens. Sie durchfuhren einen malerischen, zerklüfteten Barranco, erreichten auf einer kleinen Hochfläche Ifonche, einen aus wenigen, weit verstreut liegenden kleinen Bauerngehöften, den Fincas, bestehenden Ort mit einem Restaurant, das bei Einheimischen wegen seiner Küche geschätzt wird.
Gepflegte Terrassenfelder mit Kartoffeln und Wein ließen auf intensive Landwirtschaft schließen. Wenige hundert Meter hinter dem Restaurant war die geteerte Straße zu Ende. Sie hatten nichts Vernünftiges gefunden.
Auf einer bewohnten Finca, die von einem wütend kläffenden Hund leidenschaftlich gegen die Eindringlinge verteidigt wurde, wendeten sie und versuchten ihr Glück an einem anderen Abzweig. In einiger Entfernung stand ein schmuckes, aus Lavasteinen errichtetes und teilweise verputztes Haus auf einem Bergsattel. Von dem Anwesen bot sich ein beeindruckender Blick hinunter zum Meer.
„Die Hauswand sieht aus wie ein Leopardenfell. Richtig schnuckelig. Ein wirklich schönes Feriendomizil“, schwärmte Jenny.
„Wenn es denn vermietet wird? Im Übrigen glaube ich nicht, dass unsere Freunde ein Auge dafür haben“, bemerkte Boomer mit einem nachsichtigen Seitenblick auf seine Freundin, „die wollen dunkle Pläne schmieden und nicht die schöne Lage genießen. Außerdem dürfte das Haus zu teuer sein.“
„Am Geld soll es nicht liegen“, konterte Jenny, „zum ersten Mal im Leben leiden wir keinen Mangel. Die Organisation ist großzügig.“ „Mag sein, Mädel“, entgegnete Boomer, „aber wir haben Mahmoud Rechenschaft abzulegen und das dürfte nicht einfach sein, wenn wir das Geld mit vollen Händen für in seinen Augen unnütze, westlich dekadente Sachen ausgegeben haben. Es wird schon schwierig genug, ihm klarzumachen, warum du einen Badeanzug haben musstest.“ „Nun werde bloß nicht komisch. Hast du schon eine Touristin ohne Badeanzug gesehen? Ich habe mir schon einen schicken Bikini verkniffen.“
„Hättest du ruhig kaufen können“, kicherte Boomer, „Mahmoud wird nicht in die Verlegenheit kommen, dich darin zu bewundern. In unser Quartier werden wir unsere muslimischen Freunde nicht einladen. Dann kriegen unsere Vermieter eine Krise.“
Boomer fuhr langsam den schmalen Weg weiter. Eine Möglichkeit zum Wenden ergab sich nicht. Zwei einsame Wanderer, die gerade von dem Berg Roque de los Brezos herabgestiegen waren, von dessen Spitze sich ein herrlicher Panoramablick vom Faro de Teno im Nordwesten bis zum Faro de Rasca im Süden über die ganze Küste erschließt, schauten ihnen neugierig hinterher. Ansonsten begegnete ihnen keine Menschenseele.
Hinter einer kleinen Passhöhe, etliche Meter von dem befahrbaren Weg entfernt, schmiegte sich eine schmucklose kleine Finca eng an den Berg. Unterhalb des Hauses fiel das Gelände steil in den wilden Barranco de Fanabe ab. Etwas weiter entfernt entdeckten sie in der Felswand kleine Höhlen. Sie hielten an.
„Das ist genau das Haus, das wir suchen“, bemerkte Boomer und ergänzte schon fast gehässig, „eine einsame Finca am Berg. Fluchtwege und Verstecke sind in der Nähe. Genau das Richtige für unsere afghanischen Bergziegen.“
Er zeigte auf die schmalen Terrassenfelder und die unwegsame Schlucht mit den Höhlen.
„Außerdem sieht es unbewohnt aus.“
„Da wundert man sich manchmal. Wir müssen fragen.“
„Wen, wenn hier niemand zu sehen ist?“
„Versuch macht klug. Vielleicht gibt es ja einen Hinweis.“
Sie stiegen aus und umrundeten das Gehöft. Tatsächlich fanden sie ein kleines Schild. Finca el Dornaja war da zu lesen. Sonst nichts. Boomer klopfte an die Tür. Es rührte sich nichts. Nichts war zu hören. Noch nicht einmal der auf allen bewohnten Fincas unvermeidliche Hund schlug an. Er drückte die Türklinke herunter, das Haus war verschlossen. Mühsam öffneten sie eine der hölzernen Fensterläden und blickten durch die Scheiben hinein.
„Einfach, aber funktionell“, bemerkte Jenny, nachdem sie die Einrichtung gemustert hatte, „ohne modernen Schnickschnack. Zum Umgewöhnen für unsere muslimischen Freunde genau das Richtige.“ Boomer nickte nur zustimmend und winkte ihr, dass es Zeit sei, weiterzufahren.
„Jetzt suchen wir noch ein kleines Restaurant, wo wir ohne groß aufzufallen mit unseren Freunden essen können. Ohne störende, neugierige Touristen.“
Boomer nickte wiederum.
„Wir sollten etwas ungefähr auf der Hälfte zwischen der Finca el Sur und Mahmouds Quartier in Ifonche suchen.“
Diesmal nickte Jenny.
In Altavista, einem Ortsteil von Escalona, direkt an der viel befahrenen Hauptstraße von Arona nach Vilaflor, fanden sie, was sie gesucht hatten. Das Restaurant Casa Camilo, ein unscheinbares, auf den ersten Blick für Touristen unattraktives Straßenrestaurant, das aber von Einheimischen besucht wurde, was für eine gute und preiswerte Küche sprach. Die Wände waren über und über mit Fotos tapeziert. Sie zeigten die Besitzer mit Familienangehörigen oder mit Freunden aus aller Welt. Der Besitzer schien weit in der Welt herumgekommen zu sein. Eine chilenische Flagge an der Decke über dem Tresen war ein deutlicher Hinweis auf die Herkunft der Wirtsleute. Hier würden ihre orientalisch aussehenden Freunde nicht auffallen. Hier konnten sie sich ungestört mit Mahmoud und den anderen zum gemeinsamen Essen treffen. Jetzt tranken sie nur einen Cotardo, den in kleinen Tassen servierten espressoartigen Kaffee.
Sie fuhren mit einem guten Gefühl zu ihrer Wohnung in Arona zurück. Bis zum abendlichen Treffen mit ihrem Verbindungsmann verblieb noch Zeit. Während Boomer es sich am Pool bequem machte, ging Jenny eine Etage höher zu der Vermieterin.
Herta, wie sich die Österreicherin bei der ersten Begrüßung vorgestellt hatte, war eine unkomplizierte Frau, die zusammen mit Mann Josef, genannt Pep, und Sohn Christian schon viele Jahre auf Teneriffa wohnte. Jenny bat sie um Hilfe bei der Suche nach dem Eigentümer der Finca el Dornaja. Herta reagierte verwundert und Jenny beeilte sich, den Hintergrund zu erklären. Nein, sie wollten die Finca del Sur nicht verlassen. Es gefalle ihnen ausgezeichnet. Aber man benötige für Freunde ein Quartier und habe sich für das einsame Landhaus in Ifonche entschieden, beruhigte Jenny.
Herta telefonierte mit ihrem Mann und nach einem Kaffee erfuhr Jenny, bei wem sie die Finca el Dornaja mieten können. Der Eigentümer betreibe nicht weit entfernt von ihrem Quartier eine Fisioterapia, sei aber erst am späten Nachmittag erreichbar.
Am Abend fuhren Jenny und Boomer zu ihm, um das Quartier für Mahmoud und seine Männer anzumieten. Der Mann war sichtlich überrascht, Interessenten für das einsam gelegene und spartanisch eingerichtete Haus vor sich zu haben. Aber nach gut zehn Minuten war man sich einig, die Parteien unterzeichneten einen Mietvertrag für mehrere Wochen. Die jungen Leute erhielten den Schlüssel. Sie besichtigten das Haus ausgiebig und vergaßen nicht, alle christlichen Symbole zu entfernen, die sie in einem Karton verstauten und mitnahmen.
Wieder in Arona angekommen fuhren sie auf direktem Weg nach Playa de las Americas, vorbei an dem Tierpark Aguilas mit seiner faszinierenden Raubvogelshow, vorbei an der von vielen Deutschen, Briten, Österreichern und Schweizern bewohnten Residentensiedlung Chayofa. In Playa de las Americas, dem viel besuchten Ferienort mit seinen unzähligen Hotels, kurvte Boomer längere Zeit vergeblich umher, um einen freien Parkplatz zu finden. Schließlich stellte er den Wagen in einer Parklücke oberhalb des Hafens ab. Jenny zeigte auf das Halteverbotsschild und die gezackten Linien auf dem Asphalt.
„Das ist ein Busparkplatz für die Touribusse. Hier können wir nicht stehen bleiben.“
Boomer winkte frustriert ab und zog Jenny mit sich.
„Heute Abend fährt doch kein Bus mehr. In den Hotels hat die Schlacht an den Büffets schon begonnen. Der Wagen steht da gut.“
„Wie du meinst“, flötete Jenny.
Sie schlenderten zwischen zwei Hotels zur Promenade hinunter, dort am Strand weiter entlang, sahen einer Gruppe niederländischer Boulespieler zu, schließlich wurden sie von dem stetigen Strom der Urlauber erfasst und ließen sich einfach treiben. Restaurants wechselten in bunter Reihenfolge mit Schuhgeschäften, Textilläden, Juwelieren und Elektronikshops. Letztere waren fast ausnahmslos in der Hand von Indern oder Pakistanis.
„Vom Outfit und den Gesichtern der Leute einmal abgesehen, sieht das hier nicht anders aus als in Peschawar oder Bannu“, bemerkte Boomer.
Vor einer Buchhandlung blieb er abrupt stehen. Jenny, die wenige Schritte hinter ihm gegangen war, prallte gegen seinen Rücken und schaute ihn irritiert an. Fast flüsternd wandte er sich seiner Begleiterin zu.
„Ich glaube, ich habe gefunden, was wir suchen.“
„Ist ja gut. Aber warum flüsterst du? Ich habe den Laden auch gesehen.“
„Nicht so laut.“ Boomer blickte sich vorsichtig um.
„Hast du als Kind zu viele schlechte Romane gelesen oder James-Bond-Filme gesehen? Warum verhältst du dich so blöde?“, wollte Jenny wissen, während sie ihn amüsiert ansah.
„Vielleicht wird der Laden durch die spanische Polizei beobachtet“, bemerkte Boomer.
„Ja, wenn schon! Wir sind Touristen. Es ist nicht nur normal, sondern sogar erwünscht, wenn wir in den Läden etwas kaufen. Mit deinem blöden Verhalten machst du Beobachter erst aufmerksam. Wir gehen jetzt erst noch einmal die Straße hinunter und dann ganz entspannt in den Laden“, forderte Jenny selbstbewusst, „hoffentlich hast du an deine Münze gedacht, die du von Mahmoud in Karachi bekommen hast, um sie vorzuzeigen.“
Boomer brummelte etwas vor sich hin. Dann trottete er neben ihr her. Es dauerte nicht lange und Jenny schien ihr eigentliches Anliegen vergessen zu haben. Boomer ging es auf den Keks, wenn sie sich lange bei den Klamottenläden aufhielt, ihn auch noch um seine Meinung fragte, ob ihr das rote T-Shirt besser stehe als das gelbe oder ob der bunte Wickelrock auch ihre Figur richtig betone.
„Wie gefällt dir diese Bluse? Soll ich sie mir kaufen? Oder passt das andere besser?“ Jenny hielt ein quittegelbes Shirt neben das grüne. „Der grüne Fummel steht dir gut. Kauf ihn.“
„Ich probier das gelbe Teil auch noch einmal.“
Boomer verdrehte die Augen. Warum fragt sie mich überhaupt, wenn sie doch noch das andere Leibchen anprobieren will, dachte er unwillig. Verstohlen sah er sich um. Er befand sich in guter Gesellschaft. Den Gesichtern einiger herumstehender Männer nach zu urteilen, beschäftigten die sich mit ganz ähnlichen Gedanken. „Treib es nicht auf die Spitze“, bemerkte er zu Jenny, als sie zum fünften oder sechsten Mal eine Bluse vor den Busen hielt und ihn um sein Urteil bat.
„Hab dich nicht so, das muss jetzt sein. Während du in der letzten Zeit alle Freiheiten hattest, musste ich auf elementare weibliche Bedürfnisse verzichten, durfte nur mit der Burka durch die Gegend rennen. Außerdem brauche ich etwas anzuziehen, wenn wir wieder nach Deutschland kommen. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt, zu Hause werde ich wohl nicht zum Einkaufen kommen.“
Jenny zwinkerte ihrem Freund zu. Boomer fügte sich knurrend in sein Schicksal, grinsend von einem Leidensgenossen beobachtet, der neben ihm an der Kasse stand, um die Errungenschaften seiner Frau zu bezahlen.
Eine Stunde später - Jenny hatte unbedingt noch einen Kaffee con leche, mit Milch - trinken wollen, waren sie wieder vor dem Elektronikladen. Jenny hielt sich zurück und blieb neben dem Laden stehen, wo sie die Auslagen eines Juweliers bewunderte. Von dort aus konnte sie Boomer unverzüglich warnen, sollte etwas Unvorhergesehenes passieren. Boomer war zufrieden.
Entschlossen betrat er das Geschäft. Er war der einzige Kunde. Interessiert blickte ihm ein etwa fünfzig Jahre alter Pakistani entgegen.
„Buenas noches. Ich möchte Senor Raschid sprechen.“ Boomer hoffte inständig, dass der Pakistani sein Kauderwelsch aus Touristenspanisch und Deutsch verstehen möge, zumal sein Englisch auch nicht viel besser war. Trotz der Monate in Afghanistan.
„Sie sprechen mit ihm.“
Der Pakistani war problemlos in der Lage, sich mit jedem beliebigen Touristen in einer Art europäischem Kauderwelsch, gemixt aus einem halben Dutzend Sprachen, zu verständigen. Schließlich lebte er davon. Flexibilität bei der Sprache war für ihn unumgänglich, wenn er Geld verdienen wollte.
Boomer räusperte sich, blickte unsicher im Laden umher, bemerkte jedoch nichts Ungewöhnliches.
„Mein Name ist Yusuf. Ich überbringe die Grüße von Mullah Omar und Scheik Khalid an alle seine Neffen auf Teneriffa.“
Er zog eine rot eingefärbte, uralte Zehn-Rupien-Münze aus seiner Hosentasche und legte sie wie zur Bestätigung auf den Tresen. Raschid warf einen kurzen Blick auf das Geldstück und nickte. Dann bat er seinen Besucher ohne Gemütsregung in einen Raum hinter dem Verkaufstresen. Ein junger Mann, der dort gerade einen Tee trank, wurde angewiesen, sich nach vorne zu begeben. Er erhob sich sofort und verließ, den Blick devot auf den Boden gesenkt, den Raum. Das folgende Gespräch, eine Mischung aus Englisch und Deutsch unterlegt mit einigen arabischen Brocken, beschränkte sich auf das Wesentliche. Raschid hatte seinen Besucher offensichtlich erwartet. Ohne Umschweife kam er gleich zur Sache.
„Du kommst spät. Ich habe dich viel früher erwartet.“
„Die Familie kommt morgen mit der zweiten Fähre von Gran Canaria in Santa Cruz an. Ich werde sie dort im Hafen abholen.“ Raschid nickte erneut.
„Was wollt ihr genau von mir?“
„Wir brauchen Pässe und Flugtickets von Teneriffa nach Deutschland. Für meine Begleiterin und mich wären deutsche Ausweise, für die anderen fünf Familienmitglieder wahrscheinlich englische Papiere sinnvoll. Geld ist vorhanden. Um ein Quartier haben wir uns bereits gekümmert. Ich halte die Verbindung.“
Raschid nickte.
„Wie viel Zeit habe ich?“
„Die Familie will sich drei Wochen hier aufhalten. Dann müssen wir weiter nach Deutschland. Reicht das aus?“
Raschid nickte wieder.
„Wenn ich die Fotos habe, sind die Papiere in zehn Tagen fertig.“ Er reichte eine Visitenkarte mit der Adresse eines Fotografen in Los Christianos über den Tisch.
„Dort werden Fotos für Pässe gemacht. Nur da. Verstanden?“, ordnete er an.
Boomer warf einen kurzen Blick auf die blau-silberne Karte, steckte sie ein und erhob sich. Zum Abschied drückte Raschid ihm einen CD-Player in die Hand.
„Wer meinen Shop betritt, kauft auch etwas“, erklärte er grinsend auf den fragenden Blick von Boomer, der, wieder draußen angekommen, Jenny an die Hand nahm und mit ihr im Touristengewühl verschwand.
„Wie war’s?“, wollte sie neugierig wissen.
„Wie soll’s schon gewesen sein“, kam die lakonische Antwort, „sehr professionell. Cool bis in die Haarspitzen. Auf der Fahrt nach oben erzähl ich’s dir.“
„Eigentlich würde ich gerne noch mit dir in eine Disco gehen“, flötete sie und schmiegte sich an Boomer.
„Dafür haben wir keine Zeit. Du weißt, Mahmoud kommt bereits morgen. Wir sind hier nicht im Urlaub.“
Jennys Miene verfinsterte sich. Insgeheim hatte sie mit einer verzögerten Ankunft der Freunde gerechnet. Die Reise Mahmouds, des Jemeniten, und der anderen Freunde über die arabische Halbinsel, Ägypten und Marokko hätte eigentlich deutlich länger dauern müssen. Aber die Kriege in Afghanistan und im Irak hatten die Organisationsmöglichkeiten in anderen Ländern nicht eingeschränkt. Obwohl es am späten Abend noch recht warm war, fröstelte es Jenny bei dem Gedanken, schon morgen mit Boomer nicht mehr allein zu sein.
„Dann sollten wir diese Nacht erst recht noch einmal richtig genießen. Wer weiß, wann wir wieder Zeit für uns alleine haben. Für mich wird sich die Situation deutlich ändern, wenn die Taliban hier sind“, bemerkte Jenny, wobei Traurigkeit in ihrer Stimme mitschwang.
Boomer versuchte ihre Befürchtungen abzuschwächen.
„So schlimm wird es nicht werden. Mahmoud muss sich an mitteleuropäische Verhältnisse gewöhnen. Außerdem wohnt er ja nicht bei uns. Wir bleiben doch allein in unserer Wohnung.“
„Du willst mich nicht verstehen“, seufzte Jenny, „natürlich wohnen sie nicht bei uns, aber ich fühle mich als Frau nicht wohl, wenn ich die fanatischen Männer in der Nähe weiß. Kannst du das nicht begreifen?“
„Nein, kann ich nicht“, brummte Boomer.
„Du bist und bleibst ein Ignorant. Manchmal hasse ich dich dafür.“ „Ist ja gut, mein Täubchen. Ich habe es doch nicht so gemeint.“ „Hast du doch. Außerdem nenne mich nicht immer Täubchen, sonst zeige ich dir, welche Krallen das Täubchen haben kann.“
Der kleine Streit war sofort beendet, als sie am Parkplatz ihr Auto nicht mehr vorfanden. Boomer wurde bleich.
„Das Auto ist gestohlen“, keuchte er und blickte hektisch die Straße hinauf und hinunter in der Hoffnung, sich nur mit dem Platz geirrt zu haben. Jenny hatte die Situation etwas besser analysiert. Sie ließ Boomer stehen und steuerte auf einen spanischen Polizisten zu, der nur wenige Meter weiter lässig neben seinem Motorrad stand. Boomer äugte misstrauisch zu den beiden hinüber. Nach wenigen Minuten kam Jenny überlegen grinsend zurück.
„Das Auto ist nicht geklaut. Es wurde abgeschleppt, weil es im Parkverbot stand. Wir können es an der Polizeistation der Policia local de la Villa de Adeje wieder abholen. Kostet etwa 50 Euro.“
Boomer schluckte.
„Na, dann mal los. Ist das in der Nähe?“
Jenny zuckte mit den Schultern.
„Keine Ahnung. Fragen wir den Taxifahrer an der Ecke dort vorn, der schon ganz interessiert zu uns herüberäugt. Ich vermute, der wird uns gegen eine kleine Gebühr hinfahren.“
Boomer trabte los, während Jenny noch zögerte.
„He, worauf wartest du noch?“, fragte er und mit einer unwilligen Armbewegung trieb er sie zur Eile an.
„Das Auto gibt es nur gegen Vorlage des Ausweises.“
„Scheiße! Und was nun?“
Ratlos starrte Boomer auf seine Begleiterin, die weiterhin grinsend vor ihm stand.
„... du lässt mich ja nicht ausreden. Oder gegen Vorlage des Mietvertrags. Den hast du doch, oder?“
„Der liegt im Handschuhfach. Ich habe nur den Schlüssel.“
„Vielleicht kommen wir ja auf dem Polizeihof an das Auto heran, dann holen wir den Vertrag, bezahlen und verschwinden wieder.“
Mit einiger Mühe zerrte Jenny ihren Freund in das Taxi. Der Fahrer nickte grinsend, als Jenny ihm erklärte, wohin er sie bringen solle. Nach zehn Minuten hatten sie die Polizeistation erreicht. Ihr Auto stand direkt vor der Tür. Boomer holte aus dem Handschuhfach den Vertrag, mit dem Jenny in der Wache ohne Probleme das Fahrzeug auslöste.
Als sie wieder im Wagen saßen, zögerte Jenny mit der Abfahrt. Boomer schaute sie fragend an.
„Was ist? Warum fährst du nicht?“
„Ob das ein Fingerzeig war?“
„Fingerzeig für was?“
„Ein Fingerzeig, uns der Polizei zu stellen“, flüsterte Jenny.
„Du bist wohl vom wilden Affen gebissen“, polterte Boomer, „die Spanier werden uns ausquetschen wie eine Zitrone und danach an die Amerikaner ausliefern. Wir landen dann in Guantanamo und nicht in Deutschland.“
Jenny schien nicht überzeugt, fuhr aber los. Boomer legte nach. „Denk doch einmal darüber nach, was wir in den letzten Jahren alles erlebt haben. Wir haben den Orient kennengelernt.“
„Genau: Tausend-und-eine-Nacht“, warf Jenny hämisch ein. Boomer ließ sich nicht beirren.
„Der märchenhafte Tausend-und-eine-Nacht-Orient ist ein irrealer, ideologisierter, romantischer Traum des Abendlandes à la Karl May. Die Realität sah schon immer anders aus.“
Jenny reagierte gereizt.
„Von nahem betrachtet sieht immer alles anders aus. Kannst du mir einmal sagen, warum wir Deutschen in alles und jedes eine Moral einbauen müssen? Genügen nicht einfach Fakten? Ist Überleben nicht das Wichtigste? Entweder du oder ich. Wer dabei über Moral nachdenkt, hat verloren. Wir haben überlebt und sind hier, weil wir nicht darüber nachgedacht haben.“
Boomer unterbrach sie.
„Du hast nicht darüber nachgedacht. Ich schon. Du hattest es da als Frau in Afghanistan wesentlich leichter, konntest dich hinter deiner Burka verstecken. Eine Frauenmeinung war unbeachtlich und ebenso wenig gewollt wie eigenes Handeln.“
Jenny schaute ihn regelrecht schockiert von der Seite an.
„Ich nehme an, das meinst du nicht ernst. Nicht wirklich. Das kann ich nicht glauben“, brach es aus ihr heraus. Boomer ging auf ihren Einwand nicht ein.
„Jenny, ich will darüber jetzt nicht diskutieren. Nicht schon wieder. Wir sollten über unseren Auftrag nachdenken. Dabei spielt Moral keine Rolle. Sonst kommen wir nie nach Hause oder werden nicht überleben.“
Jenny sah ihn lange schweigend von der Seite an, bevor sie antwortete.
„Ja, vermutlich hast du Recht. Wer mit dem Teufel paktiert, muss das Feuer schüren. Jetzt sind wir schon bis auf die Kanaren gekommen und haben es nicht mehr weit. Also, Augen zu und durch. Aber ich habe Angst. Angst um dich und um mich. Manchmal erwische ich mich dabei, dass ich jeden arabisch aussehenden Mann für einen Al Qaeda-Kämpfer halte.“
Boomer schwieg.
Jenny war klar, Boomer, der gleichzeitig ihr Retter, Freund, Geliebter und angeblicher Ehemann war, hatte gewählt. Er hatte sich für die Taliban entschieden. Jenny hatte immer wieder versucht, ihn zu verstehen. Die Jahre in Afghanistan, in dieser patriarchalischen Männergesellschaft, hatten ihn doch stärker geprägt, als sie es wahrhaben wollte. Sie konnte sich mit den Zielen der Taliban nicht einverstanden erklären. Sie schuldete ihnen zwar Dank für ihre Befreiung, aber sie wollte doch nur nach Hause, dachte sie verzweifelt. Ohne Boomer konnte und wollte sie jedoch nichts unternehmen. Gab es wirklich kein Zurück?
Die hellen und lauten Urlaubsorte blieben hinter ihnen zurück. Sie fuhren schweigsam die Berge hinauf zu ihrer Ferienwohnung. Aus dem Autoradio tönte der deutschsprachige Kanarensender „Megawelle“. Ein Moderator namens Ralf gab sich alle Mühe seine Hörer mit lockeren Sprüchen aufzuheitern. Ein kleines Stück Heimat in der Fremde.
3. Kapitel
Während Jenny am nächsten Morgen mit dem Vermieter der Finca el Dornaja in Ifonche die Wohnungsübergabe regelte, fuhr Boomer von Los Christianos mit dem Schnellbus über die Autobahn nach Santa Cruz. Der Bus machte seinem Namen alle Ehre, da er zwar an jeder Ausfahrt in der extra dafür vorgesehenen Parkbucht kurz anhielt, um die dort wartenden Fahrgäste ein- oder aussteigen zu lassen, sich sonst aber an keinerlei Geschwindigkeitsbegrenzung hielt.
Unbeeindruckt von hupenden oder blinkenden Autos lenkte der Busfahrer sein vollbesetztes Gefährt über die Autopista del Sur nach Santa Cruz. Die Straßen waren berstend voll, der Autoverkehr in der Inselhauptstadt hielt jedem Vergleich mit einer Festlandsgroßstadt stand.
Die Autobahn ging übergangslos in eine breite Avenida über, auf der sich der Bus an der Oper und dem Containerterminal vorbei zur Innenstadt quälte. An der Plaza de Espana, direkt am Hafen, stieg Boomer aus und schlenderte zum Kai mit dem Fähranleger.
Schon von weitem sah er die Fähre, ein schnelles Tragflügelboot, die bereits angelegt hatte. Mitten in dem Pulk der von Bord drängelnden Menschen befanden sich Mahmoud und die anderen. Der Jemenit, ein Enddreißiger mit sherryfarbenen Augen, schwarzem Haarschopf und ebenso schwarzem Vollbart, hatte ihn schon gesehen und steuerte mit leichtem Handgepäck, die schweren Koffer trugen seine zwei Begleiter, auf ihn zu.
Mahmouds ständig finsterer Miene war nicht zu entnehmen, ob er sich freute. Kaum war die Begrüßung vorbei, fragte er nach dem Wagen. Boomer erklärte, Jenny sei mit dem Auto unterwegs, um das Quartier einzurichten, deshalb müssten sie mit dem Taxi fahren. Mahmoud schien davon nicht sonderlich begeistert zu sein und ließ keinen Zweifel aufkommen, wer Chef der kleinen Gruppe sei, von der er absoluten Gehorsam verlangte. Zudem war er fest davon überzeugt, dass ein Chef eine finstere Miene zur Schau zu tragen habe. Zu einer wichtigen Person, wie einem Chef, gehöre eben eine wichtige Miene, die ernst oder sogar grimmig zu sein habe. Boomer begann zu verstehen, warum sich Jenny in Anwesenheit des immer finster blickenden Jemeniten unwohl fühlte. Der Ägypter Hosni überbrachte herzliche Grüße von Boomers Freund Daud, der seit kurzem zur Leibwache von Ramzi bin al Shib, dem Chefplaner des 11. Septembers, geholt worden sei und jetzt in Karachi lebe. Der Syrer Bairam, den Boomer flüchtig aus dem Ausbildungslager kannte, schüttelte freundlich seine Hand. Ohne Hast trottete die kleine Schar zu den in langer Reihe wartenden Taxis.
Der Fahrer eines der wenigen Großraumtaxis war hocherfreut, als er hörte, seine Fahrgäste wollten nach Escalona. Immerhin fast hundert Kilometer. Auch Richtung Süden war die Autopista del Sur stark befahren und der Taxifahrer wollte zeigen, was er konnte. Er suchte sich, mal links, mal rechts überholend, seinen Weg durch den dichten Verkehr. An Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten sich nur die Kleinwagen der Touristen. Den Fahrgästen war der Fahrstil egal. Sie kannten Ähnliches aus ihrer Heimat.
Unterwegs, in San Isidro, bat Boomer den Taxifahrer, von der Autobahn abzufahren und an einem Supermercado zu halten, dessen grüne Reklameschilder schon von Weitem leuchteten. Er stieg mit Mahmoud aus, um Lebensmittel für die nächsten Tage einzukaufen. Boomer hatte ganz bewusst San Isidro gewählt, weil in diesem schmucklosen Örtchen ein buntes Gemisch von Festlandsspaniern, Afrikanern, Lateinamerikanern und Asiaten lebte. Hier fiel es nicht auf, wenn er zusammen mit Mahmoud einkaufte. Sie versorgten sich mit allem, was für die nächsten Tage gebraucht wurde, schleppten es zum Taxi, verstauten es und fuhren dann über Granadilla de Abona und San Miguel zum chilenischen Restaurant, in dem Jenny schon auf sie wartete.
Während Hosni der Ägypter und Bairam der Syrer sie herzlich begrüßten, verhielt sich Mahmoud erwartet abweisend. Anstatt ihr die Hand zu geben, musterte er sie kritisch. Obwohl sie sich, gemessen am Standard der Ferieninsel Teneriffa, recht konservativ gekleidet hatte, war ihr Outfit in den Augen des überzeugten Moslems schamlos und frevelhaft. Nackte Arme und Beine sowie offen getragenes Haar wollte er in seiner Umgebung nicht dulden. Natürlich war er nicht so weltfremd, als dass er das auf seiner bisherigen Reise nicht schon gesehen und als Teil westlicher Lebensart registriert hätte. Aber in seiner unmittelbaren Umgebung war diese Bekleidung nicht angemessen. Demonstrativ setzte er sich ans andere Tischende und ignorierte Jenny. Während sich die Männer unterhielten und aßen, könne sie ja schon einmal die Lebensmittel im Auto verstauen, erklärte er.
Jenny funkelte ihn böse an.
„Mahmoud, du wirst dich daran gewöhnen müssen, dass hier in Europa andere Sitten und Gebräuche herrschen. Wenn du nicht auffallen willst, musst du das akzeptieren. Die Rolle der Frau ist hier eine andere als in Afghanistan. Ich bin nicht eure Dienerin. Außerdem fahre ich hier das Auto selbst und ziehe mich so an, wie ich es möchte“, versuchte Jenny klarzustellen.
Sie suchte bei Boomer nach Zustimmung. Der hielt sich jedoch vornehm zurück, was sie wiederum zur Weißglut trieb.
„Wenn ihr das nicht begreifen wollt, macht euren Scheiß allein. Dann gehe ich zu Fuß in unser Quartier zurück, mach mir noch einige schöne Tage und du, Boomer, kannst gleich oben bei Mahmoud in der Finca bleiben.“
Boomer rutschte nach Jennys Wutausbruch unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Mahmoud verzog keine Miene.
„Du kannst gehen“, entschied er. Jenny presste wütend die Lippen aufeinander. Wenn Blicke Dolche wären, würde der Taliban jetzt röchelnd auf dem Boden liegen. Als sie sich erheben wollte, wurde es Boomer zu bunt.
„So haben wir nicht gewettet, Mahmoud. Jenny hat Recht. Hier herrschen andere Sitten. Ich stelle keineswegs deine Führung in Frage. Aber wenn wir auf Dauer Erfolg haben wollen, dürfen wir uns nicht so verhalten wie in Afghanistan oder Pakistan. Das wird in Deutschland noch extremer werden. Hier auf Teneriffa ist es multikulturell, die Toleranz gegenüber Fremden ungleich größer als zu Hause. Deshalb ist die Eingewöhnungsphase ja auch hierher verlegt worden. Also fang an, dich daran zu gewöhnen. Sonst wird aus unseren Plänen nichts. Dein Vorhaben scheitert, bevor es richtig begonnen hat. Damit wird der Scheich in Pakistan mit dir nicht zufrieden sein. Jenny hat die Aufgabe, euch in den kommenden drei Wochen Grundbegriffe der deutschen Sprache beizubringen. Sie wird sich bei euch entsprechend kleiden. Aber nicht in einer Burka bei euch sitzen. Ist das klar?“
Mahmoud sah die beiden Deutschen überrascht an. Eine derart energische Rede, vor allem aber Widerspruch, hatte er von Boomer nicht erwartet. Auch Jenny war überrascht und setzte sich wieder an den Tisch.