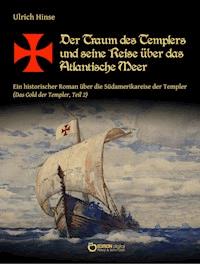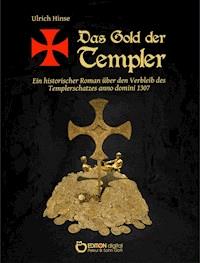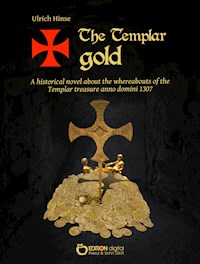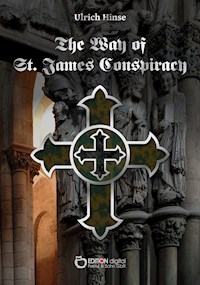7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es beginnt mit der Wende – in der DDR, die nicht zuletzt wegen mangelnder verwandtschaftlicher Beziehungen weit weg war: „Bequem war es, eine deutsche Revolution mitzuerleben. Natürlich nur im Fernsehen. Betroffen zu sein, aber Gott sei Dank nicht selber handeln zu müssen und bei Chips und Bier aus sicherer Entfernung umfassend durch die Medien informiert zu werden. Meine Frau Karin und ich konnten bequem vom Sessel aus die dramatische Entwicklung mit persönlichem Abstand abwarten. Das war schon ein Erlebnis. Meckenheim bei Bonn lag weit weg von der Grenze, und sollte tatsächlich etwas schief gehen, so lebte es sich hinter dem Rhein doch relativ sicher. Kurzum, vor dem Fernsehgerät konnte einem überzeugten Wessi nichts passieren.“ Doch dann gibt es auch im Leben des Autors, Kriminalbeamter im BKA, eine berufliche und damit auch eine persönliche Wende. Anfangs mehr aus Neugier, denn mit langfristigen Absichten, fuhren Hinse und seine Frau zum allerersten Mal in ihrem Leben „nach drüben“ und machten dort im Thüringischen zumindest eine schmackhafte und preiswerte Entdeckung. Und auch ein grauer Polizei-Wartburg mit Blaulicht kreuzt dort ihren Weg: Wie putzig, finden sie. Und nach dieser ersten Reise verfestigte sich der Eindruck, dass wer immer auch wollte, in den Osten gehen und sich mit den Volkspolizisten herumschlagen sollte, nur einer ganz bestimmt nicht – Ulrich Hinse. Doch dann gab es doch ein Angebot, in den neuen Bundesländern Aufbauarbeit zu leisten, und einen ersten Kontakt zu Silvester 1990. Allerdings auch einen kleinen Zwischenfall: „Fast wäre hier unsere Reise schon zu Ende gewesen. Auf der schnurgeraden Bundesstraße, die von Ludwigslust nach Schwerin führt, nur wenige Kilometer vor dem Ortseingang, dröhnte plötzlich ein russischer Kampfpanzer aus dem Wald und überquerte, ohne anzuhalten, in voller Fahrt die Bundesstraße.“ Dennoch fällt wenig später in Meckenheim eine Entscheidung für die neuen Bundesländer: „Ja, ich mache es.“ Und im Mai 1991 war es dann soweit. Es folgt ein spannender Bericht über ein erstes Jahrzehnt Aufbauarbeit in einer Behörde und über die Eingewöhnung eines Neu-Mecklenburgers in ein neues Wohnumfeld, in dem sowohl von Schwierigkeiten und Befremdlichkeiten, aber auch von ersten Erfolgen und auch von lustigen Begebenheiten die Rede ist. Am Ende der Lektüre ist zu verstehen, warum auf dem Cover des Buches ausgerechnet ein großer Elefant abgebildet ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Ulrich Hinse
Wer will schon nach Meck-Pomm?
Autobiografischer Roman
ISBN 978-3-86394-348-6 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.deI
Vorspann
... dass du immer jemanden hast, mit dem du reden kannst, der dich tröstet, wenn es nötig ist, und vor allem mit dir lacht und sich mit dir freut.
In diesem Buch berichtet der Neu-Mecklenburger von den ersten zehn Jahren Aufbauarbeit in einer Behörde und der Eingewöhnung in ein neues Wohnumfeld.
Das Buch lebt von dem Wechsel zwischen dienstlichen Erfahrungen und privaten Erlebnissen, die mit dem Umzug von Bonn in ein Dorf bei Schwerin verbunden waren.
In emotionaler Nähe zu den erlebten Ereignissen berichtet der Autor von den Schwierigkeiten, Befremdlichkeiten, jedoch auch von den lustigen Begebenheiten, die sich in den zehn Jahren seines Wirkens ergaben.
Nachdenkliche Geschichten vermitteln mit gelegentlich spürbarem Zynismus und Sarkasmus einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit.
Die heiteren Erzählungen beschreiben mit zutiefst menschlichen Sicht die positiven und negativen Erfahrungen, die er sammeln durfte, nachdem er von Deutschland nach Deutschland gezogen war. Der Autor kommt schließlich zu dem Ergebnis, dass sowohl ein "dickes Fell" als auch ein hohes Maß an Sensibilität erforderlich waren, um nicht zu resignieren oder zum Fremden in einem Umfeld zu werden, das letztlich ihn und das er angenommen hat.
DIE WENDE
Bequem war es, eine deutsche Revolution mitzuerleben. Natürlich nur im Fernsehen. Betroffen zu sein, aber Gott sei Dank nicht selber handeln zu müssen und bei Chips und Bier aus sicherer Entfernung umfassend durch die Medien informiert zu werden. Meine Frau Karin und ich konnten bequem vom Sessel aus die dramatische Entwicklung mit persönlichem Abstand abwarten.
Das war schon ein Erlebnis. Meckenheim bei Bonn lag weit weg von der Grenze, und sollte tatsächlich etwas schief gehen, so lebte es sich hinter dem Rhein doch relativ sicher. Kurzum, vor dem Fernsehgerät konnte einem überzeugten Wessi nichts passieren.
In Bonn, der Bundeshauptstadt, wurde in der Politik, den Ministerien und den nachgeordneten Behörden eifrig mitgemischt und die Richtung des großen Ganzen bestimmt.
Wir im Westen hatten gewonnen. Das war ein gutes Gefühl. Zufrieden und selbstgerecht konnten wir uns zurücklehnen. Das Schicksal derer, die in der DDR mit persönlichem Einsatz für die Auflösung des Systems gesorgt hatten, berührte uns nicht weiter. Dies nicht zuletzt deshalb, weil weder meine Frau noch ich durch Verwandtschaft in der DDR eine emotionale Bindung zu diesem Land hatten.
Für uns war die DDR weit weg, waren die Gefühle der Menschen nicht nachvollziehbar.
Aber natürlich war uns die historische Dimension dieser einmaligen Ereignisse bewusst. Wie gebannt saßen wir vor dem Fernseher und verfolgten jede Nachrichtensendung.
Eine Gesellschaftsordnung hatte sich aufgelöst. Nicht durch Weisung von oben, wie man Deutschen nach ihrem Verhalten in den letzten Jahrhunderten gemeinhin unterstellen könnte, sondern durch eine Veränderung von der Basis.
Eine Revolution, eine friedliche dazu - und das in Deutschland! Bemerkenswert, äußerst bemerkenswert und kaum zu glauben: Die DDR-Bürger wollten ihren Staat, ihre Gesellschaftsordnung nicht mehr. Sie wollten, mit allen Konsequenzen, Bürger der Bundesrepublik Deutschland werden. Das war toll und das machte stolz. Kein Gedanke daran, dass die ganze Entwicklung, die Motivation der Menschen erheblich diffiziler war, als von vielen Politikern und Politologen dargestellt, die sich mit Kommentaren in den Medien abwechselten.
Nein, es war alles schön einfach und offenbar mit ein paar Mark Steuergeldern zu finanzieren, wie es der amtierende Bundeskanzler immer wieder erklärte. Wiedervereinigung aus der Portokasse sozusagen.
Im Gegensatz dazu war die Auflösung der DDR für ihre Bürger ein tiefer Einschnitt: Das plötzliche Verschwinden aus der internationalen Völkergemeinschaft, der Verlust der realen Existenz als selbstständiger Staat, der Wechsel in eine neue Gesellschaftsordnung, in ein anderes Währungssystem, eine andere Wirtschaftsordnung, einen anderen Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie natürlich ein völlig anderes soziales Netz. Und das Wiederfinden in fünf Bundesländern, statt in fünfzehn Bezirken, in welche die DDR vor der Wiedervereinigung untergliedert war. Das war einschneidender als viele im Westen gedacht haben.
Vierzig Jahre anders leben, vierzig Jahre andere Erziehung, vierzig Jahre andere Gesellschaftsordnung, vierzig Jahre zum Teil andere ethische Werte sind nun einmal nicht von heute auf morgen mit einem Federstrich vergessen zu machen und schon gar nicht aus der Portokasse zu bezahlen.
Die Bereitschaft, diese vierzig Jahre anders erlerntes Verhalten einfach nur zu akzeptieren sowie der sensible Umgang mit dem daraus resultierenden Anderssein der Menschen in den fünf neuen Ländern und dem Ostteil von Berlin war bei vielen Wessis nicht vorhanden. Sie hatten den besseren Staat, die bessere Gesellschaftsordnung. Denn sonst wären die Ossis ja nicht so wild darauf gewesen diesem Gemeinwesen beizutreten. Die Wessis waren plötzlich die besseren Deutschen und sie fühlten sich als Gewinner.
Die anderen aus dem Osten waren die Verlierer. Dazu mit einem unterentwickelten demokratischen Verständnis, wie leichtfertig unterstellt wurde.
Viele waren der Meinung, der Boden des Grundgesetzes müsse jetzt erst einmal auf dem früheren Gebiet der DDR neu verlegt und den Mitbürgern der grundgesetzkonforme aufrechte Gang beigebracht werden. Natürlich konnten die drüben schon mit Messer und Gabel essen, auch wenn die oft aus Aluminium waren, was wiederum heftige Reaktionen an den Zähnen der edelstahlverwöhnten Wessis hervorrief. Das war aber auch schon der Gipfel der Zugeständnisse.
Diese Borniertheit und Arroganz sollte noch vielen Westbürgern, die sich zu einer Aufbauarbeit in den neuen Ländern berufen fühlten, enorme Schwierigkeiten bereiten und menschlich wie beruflich im Wege stehen.
Aber wer machte sich im Jahr 1990 im Westen schon diese Gedanken? Wir hatten gesiegt. Unser Weg war der richtige. Hoch lebe das wiedervereinigte Deutschland unter Führung des Westens!
Zunächst war für uns persönlich erst einmal die Neugierde. Noch nie waren meine Frau und ich in der DDR gewesen. Alles, was wir über die DDR und ihre Bewohner gehört und gesehen hatten, war uns nur aus den Medien oder aus Erzählungen Anderer bekannt.
Natürlich hatten wir schon in den 80er Jahren den einen oder anderen Besucher aus der DDR gesehen, die meisten davon Rentner. Auch hatten wir an unserem Wohnort etliche Menschen getroffen, die Ende der 80er Jahre über Ungarn oder die CSSR aus der DDR geflüchtet und in Notunterkünften untergebracht worden waren. Verhalten neugierig hatten wir sie beäugt, aber uns kaum mit ihnen unterhalten. Somit blieben uns als Erkenntnisquelle nur die Medien. Die Berichte aus der DDR, der UdSSR und anderen Ländern des damaligen Ostblocks hatten uns aber nicht sonderlich gereizt, das andere Deutschland zu besuchen. Außerdem war ich als Kriminalbeamter im Bundeskriminalamt mit Aufgaben befasst, die mir Reisen hinter den „eisernen Vorhang" so ohne Weiteres nicht erlaubten. Oft waren es solche Aufgaben, bei denen ein Nachrichtensprecher im Fernsehen die Stimme senkt und geheimnisvoll mitteilt: „... das BKA hat sich in die Ermittlungen eingeschaltet." Das meiste war weit weniger spektakulär, als es in den Medien klang. Gleichwohl, ein Sack voll Probleme wäre auf uns zugekommen, hätten wir einen Antrag für eine Reise in den Ostblock gestellt. Wer will schon Probleme. Und familiäre Beziehungen in die DDR, die das Interesse an einer Reise begründet hätten, gab es weder bei meiner Frau noch bei mir. Also waren wir im Urlaub in die Türkei, nach Spanien, in die Niederlande, nach Luxemburg und Italien gefahren, nicht jedoch in das andere Deutschland.
Seit dem 3. Oktober 1990 gab es nun die DDR nicht mehr, sondern nur noch neue Bundesländer. Eine Reise nach „drüben", in die ehemalige DDR, war unproblematisch geworden.
THÜRINGEN
Im Oktober 1990 fand mit Freunden und Kollegen bei Würzburg eine Weinprobe statt. Die gelöste weinselige Stimmung ließ bei uns spontan den Plan aufkommen, nicht wie sonst über Würzburg, Frankfurt und Mainz, sondern über Schweinfurt, Meiningen und Eisenach nach Bonn zurückzufahren. Immer schön in Grenznähe, man konnte ja nicht wissen.
Je näher die ehemalige Demarkationslinie, die Staatsgrenze West der früheren DDR, der „eiserne Vorhang" kam, desto größer wurde die gespannte Erwartung.
Uns fiel auf, dass plötzlich in jedem Ort im Westen Gebrauchtwagenhändler wie Pilze aus dem Boden geschossen waren. Fahrzeuge, die noch vor wenigen Monaten ihr Ende auf dem Schrottplatz erwarteten, wurden zu indiskutablen Preisen angeboten und als „Schnäppchen" offeriert.
Leichtes Unbehagen machte sich bei meiner Frau und mir breit. Eine derart offensichtliche Übervorteilung konnte doch nicht unbemerkt bleiben. Die Menschen "drüben", wir waren ja noch in Bayern, mussten doch alle aus dem Westen für Abzocker halten. Oder waren sie blind? Oder nur gierig auf Westautos? Wie trat man uns entgegen?
Es war ein Sonntagmorgen. Wir näherten uns der ehemaligen Grenzkontrollstelle. Das Wetter war unserer Stimmung angemessen. Neblig, trübe, kalt. Noch vor wenigen Monaten wäre hier die Welt für mich zu Ende gewesen. Bei einem Grenzübertritt hätten Festnahme, Durchsuchung, Vernehmung, Haft und andere Unannehmlichkeiten gedroht. Einen Angehörigen der Staatsschutzabteilung des Bundeskriminalamtes zu erwischen, hätte dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR, kurz MfS genannt, seinerzeit bestimmt viel Vergnügen bereitet ...
Aus dem Nebel schälten sich die Gebäude der Grenzanlagen. Leere Fensterhöhlen, eine Würstchenbude ohne Besucher dort, wo früher die Zollabfertigung gestanden hatte. Schlagbaum, Betonsperre und Zaun waren verschwunden. Der Wachturm war unbesetzt, die Eingangstür bewegte sich quietschend im Wind.
Ein Hauch von Verfall lag über dem jetzt einsamen ehemaligen Grenzkontrollpunkt. Kein Grenzer war zu sehen, keine Kontrolle zu erwarten. Freie Fahrt für freie Bürger.
Die Straße führte in Windungen abwärts. Fast schien es so, als seien wir allein auf der Straße. Es gab kaum Verkehr. Kein Haus und keine Menschenseele waren zu sehen. Aus dem Tal quoll Rauch und verfing sich mit dem Nebel in den Tannen. Gelblicher, leicht schweflig stinkender Qualm.
„Man riecht die Dörfer, bevor man sie sieht", stellte Karin sachlich fest. Hinter der nächsten Kurve sahen wir die ersten Häuser von Henneberg. Auch hier war kein Mensch auf der Straße.
„Die sind bestimmt alle in der Kirche", meinte meine Frau.
„Kann sein, schließlich ist Sonntag", bemerkte ich.
Die Straße führte an dem Ort vorbei und es reizte uns nicht sonderlich, die Bundesstraße 19 zu verlassen.
Der nächste Ort war Sülzfeld. Schmucklose, graue Häuser mit bröckelndem Putz und ungepflegten Vorgärten waren das, was uns in Erinnerung blieb. Aus den Kaminen quoll der gelbliche stinkende Rauch, der uns seit dem Grenzübertritt nach Thüringen begleitet hatte. Auch hier war keine Menschenseele zu sehen.
Unser erster Eindruck von den neuen Ländern war merkwürdig fremd und eher abweisend. Karin hatte recht: Man roch die Orte, bevor man sie sah.
In Meiningen kreuzte das erste Polizeifahrzeug unseren Weg. Ein grauer Wartburg mit Blaulicht. Wie putzig.
Der anfänglich abweisende Eindruck von Land und Orten, der unser Unbehagen zunächst noch verstärkt hatte, wich langsam der Neugier.
Die Straßen wurden belebter, der Fahrzeugverkehr nahm zu und bestand nicht nur aus Trabbis, wie wir das noch vor Kurzem im Fernsehen gesehen hatten. Wir bogen Richtung Eisenach ab.
Eine Villa aus der Gründerzeit war bereits renoviert und sah toll aus. Bei näherem Hinsehen entpuppte sie sich als Zweigstelle der Deutschen Bank.
„Die Banker wohnen und arbeiten im Feinsten und haben sich die Rosinen bereits aus dem Kuchen gepickt", stellte Karin fest.
Unsere Vorurteile über die Banker, die wir natürlich auch als gelernte Wessis pflegten, fanden sich voll bestätigt.
Zu einer Besichtigung der Stadt Meiningen konnten wir uns nicht durchringen. Sie wurde nach kurzer Beratung auf irgendwann verschoben.
Was sagte uns schon Meiningen? Klar, sie war früher einmal eine fürstliche Residenzstadt gewesen. Mehr aber auch nicht. Wir wollten weiter. Weiter durch den Thüringer Wald nach Eisenach und zur Wartburg. Die kennt man auch als Wessi. Entweder wegen Luther oder der heiligen Elisabeth. Je nach Konfession.
Thüringen hat eine schöne Landschaft mit viel Wald, so hatten wir gelesen. An diesem Tag erschloss sich uns das Land leider nicht in seiner Schönheit. Wie auch?
Nebel und trübe, nasskalte Witterung nahmen der Landschaft ihren Reiz und uns den Wunsch des genaueren Kennenlernens. Vielleicht haben wir ja noch einmal später Gelegenheit, die Reize zu genießen, trösteten wir uns.
Gegen Mittag erreichten wir Schwallungen. Das kleine Dorf unterschied sich durch nichts von den Orten, die wir bisher durchfahren hatten. Mitten im Ort bemerkten wir eine äußerlich schmucklose Dorfkneipe, die auf einer Schiefertafel Mittagtisch anbot. Den gelben, schwefligen Qualm, der auch hier durch den Nebel zwischen die bröckeligen Fassaden der Häuser gedrückt wurde, ignorierend, traten wir ein.
Trübes Licht, Tresen und Tische aus Sprelacart, der DDR-Variante des westdeutschen Resopals, verräucherte Luft und die lautstarke Unterhaltung sichtbar angetrunkener Gäste, die ihren Frühschoppen ausgedehnt hatten, empfingen uns. Bei unserem Erscheinen erstarb die lebhafte Diskussion schlagartig. Gäste und Wirt, der hinter dem Tresen einige Biere und Schnäpse einschenkte, musterten uns von oben bis unten.
Das Ergebnis der Studien war allen im Gesicht abzulesen. Aha, Fremde und Wessis. Was die hier wohl wollen?
Wir wollten etwas zu essen und zu trinken.
Schnell und eifrig wurde durch die Gastwirtstochter ein Tisch eingedeckt und eine handgeschriebene Speisekarte gereicht, auf der die Preisauszeichnung fehlte.
Die Karte war zu unserer Überraschung ausgesprochen umfangreich. Das hätten wir in dieser kleinen Dorfkneipe nicht erwartet. Aber wer weiß schon, was sich hinter den angepriesenen Gerichten wirklich verbarg. Unsere Skepsis vermochten wir zu verbergen und entschieden uns für eine Soljanka als Vorspeise, weil sie sich für uns so fremdartig und irgendwie russisch anhörte.
Als Hauptgericht wählten wir Hirschbraten mit Rotkohl und als Sättigungsbeilage, nachdem uns der Begriff als solcher erklärt worden war, entschieden wir uns für Knödel. Zuerst kam die Soljanka. Ein Traum in Öl. Reichlich, gehaltvoll und gewöhnungsbedürftig vom Geschmack, weil süßsauer. Allein davon war Karin schon satt. Auf die Hauptmahlzeit hätte sie jetzt gut und gerne verzichten können. Deshalb riet sie in weiser Voraussicht, den Braten abzubestellen, was ich empört ablehnte. Bestellt ist bestellt und aus dem Westen kennt man das ja mit den Wildgerichten. Die Portionen sind klein, dafür teuer und das Fleisch findet man mit Mühe unter den Beilagen.
Es kam, wie es nach der Vorahnung meiner Frau kommen musste. Von der Portion Hirschbraten mit Rotkohl und Klößen, alles hervorragend zubereitet und sehr schmackhaft, hätte eine mehrköpfige Familie problemlos satt werden können.
Den angebotenen Nachtisch lehnten wir mit dem Ausdruck tiefsten Bedauerns ab. Mehr war nicht zu schaffen.
Mit Schrecken dachte ich an die Rechnung und war sehr überrascht, als für alles zusammen nicht mehr verlangt wurde, als im Westen für eine kleine Zwischenmahlzeit.
Die fröhlichen Zecher hatten zwischenzeitlich ihre Scheu vor den plötzlich und unerwartet erschienenen Wessis überwunden. Ihre Artikulationsfähigkeit hatten sie trotz reichlich genossener brauner und weißer Kurzgetränke wiedergefunden und erfragten freundlich das Woher und Wohin.
So gestaltete sich die Mittagspause wesentlich länger als erwartet.
Schwallungens Gastronomie, vom Ambiente einmal abgesehen und die zwanglose Runde der fröhlichen Zecher waren der erste positive Eindruck an diesem trüben Tag und für die Reise prägend.
Der anschließende Besuch auf der Wartburg war es weniger. Außer dem Bewusstsein, aha, wir waren da, ist nichts in Erinnerung geblieben, was der Erwähnung wert gewesen wäre.
Von der Burg fuhren wir nach Eisenach. Vorbei an vom Verfall gekennzeichneten alten Villen aus der Gründerzeit führte uns die holprige Straße in die Stadt. Auch hier sahen wir marode Fachwerkhäuser, heruntergefallenen Putz und viele Ruinen. In den Dachrinnen wuchs Gras. Geschäfte waren nicht zu sehen.
„Nun fahr doch endlich in die Innenstadt, ich will einen Stadtbummel machen", verlangte Karin.
„Dann halte ich am besten gleich hier neben der Ruine, wir sind bereits mitten in der Stadt."
Karin schaute entgeistert aus dem Fenster.
„Ist das alles? Gibt es hier keine Fußgängerzone, keine Geschäfte, keine Kaufhäuser? Wo kaufen die Leute hier ein?"
Ich schaute mich um.
„Vor uns ist das Einkaufszentrum. Ich sehe einen Modeladen."
Karin blickte in die Richtung, in die ich zeigte.
„Wo siehst du einen Modeladen?"
Ich zeigte genauer auf ein halb verfallenes Haus, in dem ein Schaufenster erkennbar war. Ein Jeansladen, dahinter ein HO-Laden, eine Apotheke und eine Spielothek.
„Was ist ein HO-Laden?", wollte Karin wissen.
„Ein Geschäft der staatlichen Handelsorganisation", erklärte ich. „Dann bin ich mit meinem Latein aber auch am Ende. Ich kann dir nicht sagen, was die verkaufen."
Karin wollte es auch nicht näher ergründen und wir machten uns auf die Heimfahrt.
UMDENKEN
Wieder zu Hause in Bonn angekommen dauerte es lange, bis die Eindrücke dieser ersten Reise in das für uns neue Deutschland verarbeitet waren. Sie führten nicht dazu, uns spontan mit leuchtenden Augen für eine Aufbautätigkeit in den neuen Ländern zu entscheiden, für die in den Ministerien gerade eifrig geworben wurde.
Nach meiner Schulausbildung in Münster hatte ich eine Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann abgeschlossen, war freiwillig zur Bundesmarine gegangen und von dort nach einigen Jahren zum Bundeskriminalamt übergewechselt. Dort hatte ich in der Staatsschutzabteilung gearbeitet.
Im Jahre 1990 war ich vom BKA in das Bundesinnenministerium abgeordnet worden. Als Beamter des gehobenen Dienstes erarbeitete ich dort Lageberichte zur Unterrichtung des Bundeskabinetts über extremistische Bestrebungen, terroristische Aktionen und Spionagekriminalität.
Die politische Entwicklung war natürlich Tagesthema und wurde eifrig im Kollegenkreis diskutiert, wobei ich meine jüngsten Erfahrungen mit einbrachte.
„Soll in den 'nahen Osten' gehen und sich mit Volkspolizisten herumschlagen, wer will, ich nicht", erklärte ich vollmundig einem Kollegen, der nach Thüringen gehen wollte.
„Bei dem Eindruck, den das Land auf meine Frau und mich gemacht hat, riskiere ich das Ende der Partnerschaft."
Der Kollege war hartnäckig.
„Es muss ja nicht Thüringen sein. Dr. Stock zum Beispiel geht nach Mecklenburg. Du kommst doch auch aus dem Norden. Vielleicht gefällt es dir da oben besser. Außerdem dürftest du gute Chancen bei der beruflichen Entwicklung haben, außer Dr. Stock geht da noch keiner hin."
Ich sah ihn entgeistert an.
„Na, dass der bisher alleine nach Mecklenburg geht, kann ich sehr gut verstehen. Wer will schon nach Meck-Pomm? Das liegt doch am Achtersteven der Welt. Da ist doch der Hund begraben."
„Nun mach mal halblang. Du kennst das Land doch gar nicht", wurde ich gerüffelt. In diesem Moment kam Dr. Stock auf uns zu, um sich zu verabschieden.
„Na Herr Hinse, haben Sie Interesse, nach Schwerin zu kommen?", wollte er jovial wissen.
„Nein, nein", winkte ich ab.
„Na ja, überlegen Sie es sich ruhig noch einmal", erklärte er und verschwand in seinem Dienstzimmer.
Kurze Zeit später war klar, dass meine Abordnungszeit im Innenministerium zu Ende ging, sie wurde nicht verlängert. Ich musste ins BKA zurück. Gleichzeitig wurde dort heftig diskutiert. Das Amt sollte nach Berlin umziehen. Für meine Frau und mich eine grauenhafte Vorstellung. In diesen städtischen Moloch wollten wir beide nicht. Wir kannten Berlin zwar nur vage, aber da hatten wir eine einheitlich ablehnende Meinung. Dann lieber in ein anderes Bundesland.
Wie Konrad Adenauer schon sagte: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Eine neue Lage erfordert neue Entschlüsse. Gerade einem Polizeibeamten im Allgemeinen und einem Kriminalisten im Besonderen ist derartiges Verhalten nicht fremd. Die rasante Entwicklung, die ich im Innenministerium in Bonn hautnah miterlebte, änderte meine Einstellung.
Flexibilität nannte ich das. Karin war da ganz anderer Meinung.
Um Beamte zu flexibilisieren, schufen Bundesregierung und die Regierungen der neuen Länder Aufstiegsmöglichkeiten, die es in einem anderen Fall nicht gegeben hätte.
Im Westen hätte sich kaum ein Beamter bewegt, wenn ihm nicht die Möglichkeit einer Verbesserung der beruflichen Situation geboten worden wäre. Das ist nicht vorwerfbar, sollte aber auch nicht verschwiegen werden. Wer heute behauptet, er habe Aufbauarbeit in den fünf neuen Ländern nur aus Idealismus geleistet, ohne auf eine berufliche Verbesserung spekuliert zu haben, ist nicht ehrlich.
Wir jedenfalls haben die Aufstiegsmöglichkeiten sehr wohl in unsere Überlegungen mit einbezogen. Der alleinige Grund war es aber nicht. Gereizt hat mich auch eine neue Aufgabe. Wann ist es einem Beamten schon einmal möglich, Aufbauarbeit von Anfang an mitzugestalten?
Aber in welches Bundesland konnte ich als Bundesbeamter gehen? Die Republik war aufgeteilt. Es gab sogenannte Partnerländer. Niedersachsen kümmerte sich um Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen um Brandenburg, Schleswig Holstein um Mecklenburg-Vorpommern, usw.. Ein Partnerland für Bundesbehörden gab es nicht und die Kollegen aus den Ländern versuchten natürlich ihre Pfründe ohne störende Konkurrenz zu sichern.
Wie so oft im Leben eines Kriminalisten spielt der Zufall eine wichtige und entscheidende Rolle. Ich erinnerte mich an das Gespräch mit einem Kollegen im Bundesinnenministerium. Hatte der nicht gesagt, Dr. Stock sei als Abteilungsleiter Polizei ins Innenministerium nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen?
Den könnte ich in Schwerin besuchen. Vielleicht sah der eine Möglichkeit für mich und meine Frau, nach Schwerin oder in das Land Mecklenburg-Vorpommern zu wechseln. Aber die Reise von Bonn nach Schwerin ist weit. Sechshundert Kilometer fährt man nicht mal eben so und die telefonische Verbindung war mehr als dürftig.
ERSTE KONTAKTE
Die Chance eines Besuches bot sich anlässlich einer Silvesterreise 1990 ins Wendland.
Das, was heute das Land Mecklenburg-Vorpommern ist, kannten wir nur aus Büchern und Zeitschriften. Aber wir stellten uns die Landschaft und die Menschen ähnlich vor wie in Schleswig-Holstein. Das Land zwischen den Meeren kannten wir. Meine Frau aus mehrmaligen Urlaubsaufenthalten, und ich selbst aus meiner Zeit bei der Bundesmarine. Dort sagten uns Landschaft und Mentalität der Menschen zu. Dort hatte es uns gefallen. Dort hatten wir uns wohlgefühlt. In Mecklenburg-Vorpommern könnte es ähnlich sein. Gleichwohl wussten wir nicht, was uns und wer uns erwartete. Aber probieren geht über studieren und von Altenmedingen bei Lüneburg war es ein Katzensprung bis an die Elbe.
Am Neujahrstag 1991 fuhren wir an die Elbe, setzten mit der Fähre ans östliche Ufer über und betraten bei Darchau erstmals mecklenburgischen Boden. Weit trauten wir uns nicht in das Land. Das Auto war im Westen auf einem Parkplatz geblieben und so wanderten wir über den Deich, auf dem sich noch stattliche Reste der Grenzanlagen befanden. Der Metallgitterzaun war nur zum Teil abgerissen und die Wachtürme standen in regelmäßigen Abständen auf der Deichkrone. Zur Erinnerung bogen wir ein Stück aus dem Zaun heraus und schossen das obligatorische Erinnerungsfoto.
Danach spazierten wir neugierig an mehreren Bauernhöfen vorbei, die direkt hinter dem Deich lagen und stellten belustigt fest, wie Teile des Grenzzaunes von den Bauern als Einfriedung für den Hühnerstall genutzt wurden.
Es war kalt an diesem Neujahrstag, und da wir in Mecklenburg keine Gaststätte zum Aufwärmen fanden, fuhren wir mit der Fähre beizeiten wieder zurück. Aber wir waren neugierig geworden. Wir diskutierten und am nächsten Tag wollten wir nach Schwerin, das stand bald fest.
Am 2. Januar setzten wir mit der Fähre bei Hitzacker über die Elbe, bummelten langsam auf Landstraßen über Eldena, an Ludwigslust vorbei, überquerten die Autobahn Hamburg-Berlin und passierten kurz vor Schwerin ein militärisches Übungsgelände.
Fast wäre hier unsere Reise schon zu Ende gewesen. Auf der schnurgeraden Bundesstraße, die von Ludwigslust nach Schwerin führt, nur wenige Kilometer vor dem Ortseingang, dröhnte plötzlich ein russischer Kampfpanzer aus dem Wald und überquerte, ohne anzuhalten, in voller Fahrt die Bundesstraße.
Der Aufschrei meiner Frau, der Schrecken, das Bremsen, der Adrenalinstoß waren eins.
War das ein Traum, oder hatten wir gerade eine Begegnung der "Dritten Art?"
Grinsend überholte uns, nachdem wir an den Straßenrand gefahren waren und angehalten hatten, ein Einheimischer mit seinem Trabbi. Was wir gerade mit Schrecken erlebt und fassungslos gesehen hatten, war für ihn, so schien es uns, nichts Ungewöhnliches. Jedenfalls hielt er es nicht für nötig anzuhalten, um uns zu trösten oder sein Mitgefühl zu zeigen. Wir blieben allein mit unserem Schrecken.
Das erste Zusammentreffen mit der Roten Armee bestätigte schlagartig alle Vorurteile gegenüber den Russen, die man als Westbürger nur so haben konnte.
Ich beschloss, später einmal Einblick in die Unfallstatistik mit Beteiligung des russischen Militärs zu nehmen. Danach wollte ich unsere Lebenserwartung hoch rechnen. Jedenfalls regten sich erste Zweifel, ob wir wirklich den Schritt wagen sollten. Was konnte noch alles auf uns zukommen? Fuhren hier alle so rücksichtslos durch die Landschaft und gefährdeten so die eigene und anderer Leute Gesundheit? Oder war das, was wir gerade erlebt hatten, ein unglücklicher Zufall? Waren die vielen Ruinen, an denen wir vorbei gekommen waren, mahnende Reste aus dem Zweiten Weltkrieg, Zeichen maroden Verfalls oder Produkt russischer Militärübungen? Egal, wir waren jetzt in Schwerin, und Fragen kostet bekanntlich nichts.
Schwerin empfing uns mit einer auf das Übelste heruntergekommenen Kaserne. Neugierig fuhren wir langsam an ihr vorbei. Die Torwache trug eine russische Uniform und vermittelte einen eher gelangweilten Eindruck. Warum sollte sie auch aufmerksam sein oder uns besonders beachten? Nur weil gerade zwei neugierige Wessis mit ihrem Auto langsam am Kasernentor vorbei rollten? Natürlich nicht. Die Grenze war schließlich schon mehr als ein Jahr offen beziehungsweise ganz verschwunden und Wessis mit ihren Autos gehörten zwischenzeitlich zur Normalität. Neugierig waren nur wir.
Einige Hundert Meter weiter ging der nächste wenig einladende Eindruck von einer eintönigen, tristen, angegammelt und regelrecht abstoßend wirkenden Plattenbausiedlung aus. Hier gab es nichts zu bestaunen.
„Der Architekt, der diese Häuser entworfen hat, sollte dazu verurteilt werden, sie von morgens bis abends anzusehen", kommentierte meine Frau und vertiefte sich wieder in den Stadtplan.
„Immer geradeaus zum Schweriner Schloss", ordnete sie an. Ein großes Wappen mit einem gelben Reiter auf blauem Grund und ein „Willkommen in Schwerin" begrüßten uns, nachdem wir die triste Siedlung hinter uns gelassen hatten. Vorsichtig fuhren wir Richtung Innenstadt weiter. Wir überquerten die Gleise der Straßenbahn, die mit ebenfalls gelbblauen Wagen in schneller Folge an uns vorbeifuhr. Die Waggons waren gut gefüllt.
„Hier wird nicht nur Trabbi gefahren. Hier wird umweltbewusst die Straßenbahn benutzt", stellte Karin sachlich fest. Ich glaubte leichte ironische Untertöne gehört zu haben.
„Ich denke, es liegt eher an mangelnden Parkplätzen in der Stadt. Die Bahnfahrt wird billiger sein, als eine Stunde Parken", glaubte ich.
Wir fuhren an alten Backsteinhäusern vorbei.
„Das waren bestimmt großherzogliche Ulanenkasernen. Die Räume sind so hoch, da konnten sie mit ihren Pferden in die Zimmer reiten", spekulierte ich, ohne zu ahnen, dass in einigen Jahren Karin dort ihren Arbeitsplatz haben würde.
Unvermutet tauchte rechts von uns das Schloss auf. Wir waren überrascht. Das sah ja wirklich gut aus, mit seinen vielen Türmen und Türmchen. So mitten im See. Ein Postkartenmotiv, wie man es sich wünscht.
„Wenn das die Japaner entdecken, nehmen sie Schwerin in ihren Reisekatalog: „Germany in seven days auf", lästerte ich. Karin nickte zustimmend.
Nachdem wir vor dem Staatstheater einen Parkplatz gefunden hatten, der zu meiner Überraschung auch noch kostenlos war, bestaunten wir zunächst das Schloss aus der Nähe und wandten uns dann Richtung Innenstadt.
Was wir sahen, war alte Bausubstanz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auch hier gab es, wie wir schon auf der Reise durch Thüringen festgestellt hatten, die bröckelnden Fassaden und den für empfindliche Wessinasen unangenehm schwefelig stinkenden Qualm aus zahlreichen Schornsteinen und von den Autoabgasen.
Eilig hastende Menschen mit grauen, unzufriedenen Gesichtern, Männer im grünen Parka mit Prinz-Heinrich-Mütze, Frauen in schwarzer Lederjacke und alle in Jeanshosen, begegneten uns. Doch wir stellten fest, dass die eilig hastenden und auf den ersten Blick unzufriedenen und mürrisch aussehenden Menschen sehr freundlich und hilfsbereit sein konnten. Unsere Fragen nach dem Weg zum Innenministerium wurden immer bereitwillig beantwortet.
„In der BdVP, im Weißen Haus, im Arsenal am Pfaffenteich". Aha!
„Und wo, bitte, ist das?"
„Immer geradeaus bis zum Pfaffenteich, dann links. Nicht zu verfehlen."
Da mit der Hand die ungefähre Richtung angezeigt wurde, konnten wir die Richtung nicht verfehlen. Kurze Zeit später standen wir vor dem auf den ersten Blick beeindruckenden Bau. Auf den zweiten Blick reihte er sich nahtlos in das ein, was wir bei unserem Gang durch die Stadt zur Bausubstanz festgestellt hatten. Aber, das gesamte Bauensemble um den Pfaffenteich würde einmal, nach einer gründlichen Renovierung, eindrucksvoll aussehen und ein sehenswertes Stadtbild abgeben. Das war zwar erst mit viel Fantasie erkennbar, aber daran bestand bei uns kein Mangel.
Die Sympathie für die Stadt wuchs. Nicht sprunghaft, aber spürbar. Wir versuchten einfach, sie uns zehn Jahre im Voraus vorzustellen. Wenn die Renovierung einmal fertig sein würde, dürfte Schwerin ein Schmuckkästchen sein.
Aber heute, am 2. Januar 1991, war noch nicht renoviert und es war kalt.
Lediglich ein Café im Stil eines Wiener Kaffeehauses hatten wir bei unserem Gang durch die Stadt entdeckt. Es hieß Café Prag. Es war ebenso zum Bersten gefüllt wie eine Eisdiele in der Mecklenburgstraße. Ein freier Platz zum Aufwärmen war nicht zu finden.
„Komm, wir gehen ins Innenministerium. Beamte lieben es warm, deshalb wird einigermaßen geheizt sein", lästerte ich wieder.
„Du hast es nötig zu lästern", ärgerte sich Karin.
Das Ministerium war geheizt. Und wie. Der Eintritt durch die Tür hatte den gleichen Effekt wie ein Schlag mit dem Holzhammer. Von einer Sekunde auf die andere ein Temperatursprung von fast vierzig Grad.
Das war keine wohlige Wärme, das war ein Klimaschock und es dauerte einige Minuten, bis wir uns daran gewöhnt hatten. Gleichzeitig mit der Hitze empfing uns eine eigenartige Duftmischung aus Bohnerwachs, Desinfektionsmittel und dem merkwürdigen miefigen Geruch alter feuchter Gebäude, in denen noch Lehmziegel und Stroh verbaut waren. Mich erinnerten diese Gerüche an meine Jugendzeit in Westfalen, wo in den 1950-er Jahren Jugend- und Klubräume in Häusern untergebracht waren, die den Krieg überstanden hatten.
Jedes Ministerium hat einen Pförtner. An einem Pförtner geht man nicht einfach vorbei, sondern meldet sich artig an. So auch hier im Arsenal, dessen Name auf seine Verwendung zu Zeiten des Großherzogs zurückging und in der DDR der Bezirksdirektion der Volkspolizei als Bürogebäude gedient hatte.
Mit strenger Amtsmiene fragte er uns nach dem Wohin. Es handele sich schließlich um ein Amtsgebäude, und da darf längst nicht jeder hinein. In solchen Fällen hilft immer ein Dienstausweis und die Frage nach einem möglichst hochrangigen Beamten.
Nach eingehender Überprüfung unserer Ausweise, einer umständlichen Eintragung in ein Besucherbuch und einem längeren Telefonat durften wir passieren. Der gestrenge Zerberus in der Pförtnerloge beschrieb uns in knappen Worten den Weg durch das Gebäude. Der Beschreibung nach konnte es kein Problem sein, den Raum zu finden, in dem Dr. Stock residierte. Einen Termin hatte ich mit ihm nicht vereinbart. Erstens wusste ich nicht wie, da mir seine telefonische Erreichbarkeit nicht bekannt war, und zweitens war ich der Meinung, unverhofft kommt oft.
Aber das alte Arsenal war ein Fuchsbau. Die Flure verwinkelt, die Linoleumböden klebrig von Wachs, die Stiegen eng und Schilder an den Türen suchten wir vergebens.
In unserer Ratlosigkeit klopften wir an verschiedene Türen und störten über vermutlich wichtige Papiere gebeugte Beamte, die in teilweise unglaublich kleinen Zimmern saßen. Alle halfen uns freundlich weiter, und so fanden wir endlich nach einigem Treppe rauf, Treppe runter unser Ziel.
„Dr. Stock ist ein viel beschäftigter Mann", erklärte uns Herr Kulow, sein engster Mitarbeiter.
„Das bezweifele ich nicht und würde es auch niemals wagen, das Gegenteil anzunehmen", schleimte ich mich mit ernstem Gesicht bei Kulow ein, „aber ich hoffe, er hat für Besucher aus Bonn einige Minuten seiner kostbaren Zeit übrig."
Kulow schüttelte zwar skeptisch den Kopf, entschloss sich dann aber doch zur Störung seines Chefs und verschwand im Zimmer des Vielbeschäftigten.
Ich hatte recht. Dr. Stock hatte Zeit. Das war erfreulich. Die Fahrt war zumindest nicht umsonst gewesen. Wir setzten uns an den großen Konferenztisch und erhielten Kaffee. Herr Kulow setzte sich wie selbstverständlich dazu.
„Na toll, dass sie den Weg nach Schwerin gefunden haben", freute sich Dr. Stock und erinnerte sich an das Gespräch in Bonn.
„Haben Sie sich mein Angebot überlegt und wollen hier im Land mithelfen?"
„Nun ja", tastete ich mich vorsichtig vor, „meine Frau und ich waren zufällig gerade in der Nähe. Gibt es eine Chance innerhalb der Polizei?"
„Wollen Sie nach Schwerin oder nach Rostock?"
„Eigentlich könnte ich mir vorstellen, im Landeskriminalamt beim Aufbau des polizeilichen Staatsschutzes zu helfen. Wo wird das LKA hinkommen, nach Schwerin oder nach Rostock?", wollte ich wissen.
„Wahrscheinlich nach Schwerin", war die unbestimmte Antwort.
„Ist das noch nicht festgelegt?"
„Nein, die Polizeiorganisation im Land wird gerade völlig umstrukturiert", erläuterte Dr. Stock.
„Ich habe gehört, dass lediglich Beamte aus dem Partnerland Schleswig-Holstein kommen können. Stimmt das? Wenn ja, dann hätte ich als Bundesbeamter keine Möglichkeit."
„Da sind Sie falsch unterrichtet. Jeder aus dem Westen, der seinen Beitrag leisten kann, ist im Land willkommen. Natürlich auch ein Bundesbeamter. Sicherlich stehen im Wesentlichen Polizeibeamte aus Schleswig-Holstein für die Aufbauarbeit zur Verfügung, aber auch aus Niedersachsen, Bremen und Hamburg sind Kollegen vor Ort. Es handelt sich aber fast ausschließlich um Uniformierte. Kriminalbeamte haben sich bisher kaum gemeldet. An den Aufbau eines Landeskriminalamtes denke ich natürlich auch, und in diesem Zusammenhang habe ich bereits Kontakt zu Herrn van den Borg vom BKA hergestellt. Der nimmt in Kürze seine Arbeit auf", erklärte Dr. Stock. „In Rostock ist übrigens auch ein BKA-Beamter, Herr Kordus. Er leitet die Polizeidirektion."
„Ich kenne beide", antwortete ich.
„Wenn ich wählen kann, möchte ich lieber dem Kollegen van den Borg beim Aufbau des LKA mithelfen."
„Seien sie willkommen. Sinnvollerweise setzen sie sich aber dann mit van den Borg in Verbindung. Details über die Art und Weise der Aufbauarbeit, an welcher Stelle und in welcher Position, besprechen sie am Besten mit ihm. Alles ist möglich, nichts strukturiert. Hauptsache sie haben Engagement und Arbeitswillen."
„Wie sieht es mit Wohnraum aus und mit einer Arbeitsstelle für meine Frau? Sie ist Angestellte im öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen."
Dr. Stock holte tief Luft und nippte an dem Kaffee.
„Nein, das tut mir leid. Bei Wohnraum kann ich ihnen nicht helfen. Wohnraum gibt es nicht und wegen einer Arbeitsstelle für ihre Frau fragen sie doch einmal bei Herrn Nagel nach, der regelt hier die Personalfragen. Kulow zeigt ihnen den Weg."
Dann verabschiedete er uns, da Innenminister Dr. Diederich nach ihm verlangte. Herr Kulow begleitete uns hinaus.
„Kommen Sie, ich bringe Sie zu Nagel. Mit einer Wohnung kann ich Ihnen leider auch nicht weiterhelfen", ergänzte er seinen Chef. „Ich habe seinen Ausführungen nichts hinzuzufügen."
Das hatten wir auch nicht anders erwartet.
Hinter der nächsten Tür wühlte sich Herr Nagel so konzentriert durch einen Stapel Papier, dass er unseren Eintritt nur nebenbei zur Kenntnis nahm. Herr Kulow stellte uns vor und verschwand.
Der Personalreferent schien unserem Eindruck nach mit seiner Aufgabe überfordert. Er könne meiner Frau eine Stelle als Polizeibeamtin in Anklam anbieten, erklärte er. Dankend lehnte Karin ab. Sie sei Angestellte und keine Beamtin. Es mache keinen Sinn, wenn sie in Anklam und ihr Mann in Schwerin arbeite. Dann täte es ihm leid, schloss Nagel die Unterhaltung und wühlte weiter in seinen Papierstapeln. Er machte keine Anstalten, uns den Rückweg zu erklären.
„Danke, wir finden den Weg allein", giftete Karin ihn an.
Kurz darauf standen meine Frau und ich wieder vor dem „Weißen Haus". Mit einem Haufen von Informationen, die es erst zu sortieren galt. Um weiterzukommen, musste unbedingt Kontakt zu van den Borg hergestellt werden. Ich kannte Gerd van den Borg. Wer kannte ihn im Bundeskriminalamt in Meckenheim nicht? Vor Jahren hatten wir in der Staatsschutzabteilung des BKA im gleichen Referat gearbeitet. Wir waren uns privat nicht unsympathisch und hatten zusammen mehrere Segeltörns in Holland auf dem Ijsselmeer unternommen, uns aber seit längerer Zeit aus den Augen verloren. Er war engagiert, unkompliziert, erfindungsreich und vor allem unorthodoxen Wegen und Methoden gegenüber aufgeschlossen. Ein Schlitzohr hoch drei. Genau der richtige Mann, der in einer solchen Umbruch- und Aufbauphase etwas bewegen konnte. Mein Entschluss hatte sofort festgestanden. Wenn es möglich war, interessante Arbeit zu machen und Ideen umzusetzen, neue Wege zu beschreiten und als Beamter etwas neu gestalten zu können, dann mit Gerd van den Borg. Das bedeutete zwar viel Arbeit, aber sie versprach auch Spaß.
Während wir noch vor dem Hauptportal standen, uns langsam an die frische Luft gewöhnten und darüber nachdachten, wie wir schnell den Kontakt zu van den Borg aufnehmen könnten, kam uns „Kommissar Zufall", der bei Polizeibeamten beliebte Helfer, zu Hilfe. Der Mann mit den roten Haaren, dem rotem Bart und dem wehendem Trenchcoat, der gerade auf das Ministerium zueilte, konnte nur Gerd van den Borg sein.
„Hallo Gerd, auf dem Weg Pflöcke einzurammen?"
Wie angewurzelt blieb Gerd stehen.
„He Alter, was machst du denn hier?"
Die Begrüßung war wie immer derb und für Außenstehende durchaus nicht herzlich. So wirkte sie auch auf meine Frau, die Gerd nicht persönlich, sondern nur aus Erzählungen kannte.
„Ist das deine neue Frau? Warum hast du sie mir noch nicht vorgestellt? Du wechselst die Frauen schneller, als die Wolken ziehen." Karin schnappte nach Luft. Ihr fehlten die Worte. Ich lachte und drückte sie an mich.
„Es gab ziemlich lange wolkenlosen Himmel. Wir haben vor Kurzem in kleinem Kreis geheiratet", rettete ich die Situation.
„Außerdem stehen wir hier schon den ganzen Tag in der Kälte und warten auf dich."
„Entschuldigung, war nicht so gemeint", sagte er zu Karin.
„Wieso wartet ihr auf mich? Auf mich warten Dr. Diederich und Dr. Stock".
Ich erklärte ihm kurz die Lage und schilderte das Gespräch mit Dr. Stock.
„Ich wüsste nicht, mit wem ich das lieber machen würde. Aber lass uns darüber später in Meckenheim reden."
Wir verabredeten ein Gespräch in der folgenden Woche im Bundeskriminalamt. Dann verabschiedete er sich und verschwand im Ministerium.
„Bist du sicher, dass du mit dem Typen zusammenarbeiten kannst? Der scheint mir aber doch sehr gewöhnungsbedürftig", bemerkte meine Frau pikiert und blickte konsterniert hinter Gerd van den Borg her.
„Ja, mit keinem anderen“, war meine lapidare Antwort.
Den Rest des Tages nutzten wir, um Schwerin zu erkunden. Dabei bewegten uns tausend Gedanken. Sollten wir es wirklich wagen?
Es wurde uns von Minute zu Minute immer deutlicher, dass wir vor einem Umbruch in unserem Leben standen.
Wollten wir unsere gewohnte Umgebung, unsere Bekannten, unsere Wohnung im Rheinland aufgeben, um hier in eine unbekannte Landschaft zu uns völlig fremden Menschen, ohne Bekannte, ohne Wohnung in eine ungewisse Zukunft zu ziehen? Was würde uns erwarten? Würden wir wirklich mit den Menschen hier zurechtkommen? Wie würden sie sich uns gegenüber verhalten? Würden wir als Fremde in einem für uns fremden Land akzeptiert werden?
Die Nacht verbrachten wir im Interhotel am Bahnhof. Nur mit Mühe war es uns gelungen, dort ein Zimmer zu bekommen. Es gab in Schwerin wenig Hotels, und die waren ausgebucht mit Leuten aus dem Westen, die bereits in den Verwaltungen und Ministerien die sogenannte Aufbauhilfe leisteten.
Das Interhotel hatte bemerkenswert lange, schmucklose Flure und überhitzte Zimmer. Die Temperatur war nur dadurch zu regeln, dass wir ein Fenster öffneten. Schlaf fanden wir deshalb in dieser Nacht nur wenig. Die Lautsprecherdurchsagen des Hauptbahnhofs und die lauten Dieselmotoren der Lokomotiven russischer Bauart, wegen ihres weithin hörbaren Dröhnens auch Taigatrommeln genannt, ließen Schlaf bei offenem Fenster kaum zu. Vielleicht lag es aber auch an den vielen Gedanken, die uns durch den Kopf gingen.
Die Fahrt von Schwerin zurück nach Bonn verlief anders als alle gemeinsamen Reisen vorher. Es kam kaum ein Gespräch auf. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Zu viele Eindrücke waren zu verarbeiten. Selbst bei der obligatorischen Pause auf dem Rasthof in Vechta, den wir immer ansteuerten, wenn es in den Norden ging, blieben wir beide sehr einsilbig.
In Meckenheim angekommen, stand für mich die Entscheidung fest: Ja, ich mache es.
Karin ahnte, mich wohl nicht bremsen zu können und baute auf eine befristete Abordnungszeit. Insgeheim hoffte sie, dass der Frust nach einem halben oder dreiviertel Jahr ausreichen würde, eine Versetzung zu verhindern.
ENTSCHEIDUNG
Mit dem Tag der Rückkehr ins Rheinland begannen aufregende Wochen.