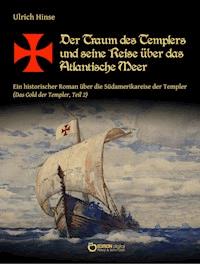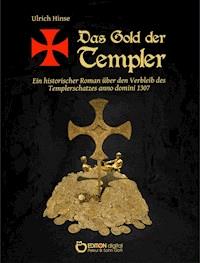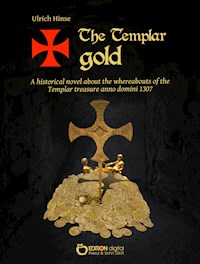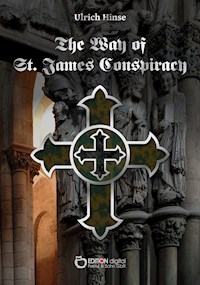14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Auseinandersetzungen zwischen einer gewalttätigen rechtsextremen Kameradschaft und einer linksautonomen Wohngemeinschaft in Mecklenburg-Vorpommern eskalieren. Die Gesellschaft versucht auf rührende Art und Weise ein wirksames Mittel gegen die immer weiter ausufernde Gewalt zu finden, wirkt aber hilflos. Erst die russische Mafia, mit der sich beide Gruppen anlegen, löst das Problem auf ihre Art. Um aus der russischen Falle zu entkommen, treiben Boomer und Jenny den Teufel mit dem Beelzebub aus und geraten an die afghanische Al Kaida. Sie landen auf verschlungenen Wegen wieder in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie gemeinsam mit den Islamisten einen Anschlag auf ein Kreuzfahrtschiff in Rostock planen. Ein Roman über Extremisten und Terroristen, der nach wie vor hochaktuell ist. Das E-Book ist die Zusammenfassung der beiden Bücher „Blutiger Raps“ und „Die 13. Plage“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 854
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Blutiger Raps
Die Wohngemeinschaft
Der Präventationsrat
Im Adlerhorst
Auf dem Friedhof
Die Schlacht am See
Der Anschlag
Die Staatsmacht
Manöverkritik
Schlapphelme und Schlapphüte
Spirale der Gewalt
Mord und Totschlag
Dolph’s Plan
Die Sitzung
Straßenkehrer
Sklavenarbeit
Blutiger Raps
Kaukasus
Unter Schmugglern
Nachruf
Die 13. Plage
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Ulrich Hinse
E-Books von Ulrich Hinse
Impressum
Ulrich Hinse
Die Extremen
Ein Staatsschutzroman aus Mecklenburg-Vorpommern
ISBN 978-3-95655-938-9 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2018, 2013 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
„Wer das Unmögliche nicht wagt, wird das Mögliche nicht erreichen.“ (Michail Bakunin)
Personen und Handlungen dieses Romans sind frei erfunden. Gewisse Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und tatsächlichen Ereignissen wären rein zufälliger Natur, ausgenommen davon sind in der Weltöffentlichkeit bekannte Personen und Ereignisse der nahen Zeitgeschichte.
Besonders bedanken möchte ich mich:
bei meiner Frau Karin für ihre Hilfe, meine weibliche Hauptperson gefühlvoll zu beschreiben,
bei Erika Nagel für die Geduld mit meiner eigenwilligen Grammatik,
bei Charlotte Fleischer für allerlei Tipps, Fachchinesisch verständlicher zu machen,
bei Gerd Thielmann für juristische Hinweise,
bei Harald Bruder für die russischen Dialoge,
bei Reinhard Müller für die rheinischen Dialektbeiträge,
bei Herta, Josef gen. Pep und Christian Eckmair auf Teneriffa,
bei Ernst F. Löhndorff † für geografische Besonderheiten am Khaiber und
last but not least bei meiner Lektorin Carola Herbst für die entscheidenden Veränderungen, damit aus einem Manuskript ein spannendes Buch wird.
Blutiger Raps
Die Wohngemeinschaft
Timo saß auf den steinernen Stufen der Kirchentreppe und beobachtete den Informationsstand der „Kameradschaft Adlerhorst“, der mitten auf dem Marktplatz der mecklenburgischen Kleinstadt aufgestellt worden war.
Vor zwei Stunden waren die fünf Skinheads gekommen, hatten einen großen Sonnenschirm und einen Tapetentisch aufgestellt, eine Vielzahl von Broschüren exakt ausgerichtet auf dem Tisch verteilt und zum Schluss zwei große Laken aufgespannt, auf denen in großen gotischen Buchstaben zu lesen war: Das Boot ist voll - Arbeit nur für Deutsche - und - Bürger wehrt Euch - Keine Graffiti -.
Adrett sahen sie aus, die fünf Skinheads. Die Glatzen frisch poliert, weiße Oberhemden mit schwarzer Krawatte, schwarze Bomberjacke, schwarze Jeans, die mit zwei halben Schlägen aufgekrempelt den Blick auf die glänzenden schwarzen Springerstiefel mit den weißen Schnürsenkeln ermöglichten. Herausfordernd musterten sie die vorbeihastenden Menschen, die am Samstagmittag in der Innenstadt noch ihre Wochenendeinkäufe erledigten. Lediglich ein älteres Ehepaar hatte den Stand aufgesucht und sich auf ein Gespräch eingelassen.
Es war keine kontroverse Unterhaltung, stellte Timo fest und hatte den kritischen Seitenblick der Alten sehr wohl bemerkt. Es war dabei auch um ihn gegangen, nachdem alle sieben unverhohlen zu ihm herüber geblickt und er die Handbewegung des größten und kräftigsten der Skins richtig gedeutet hatte.
Er war so ganz anders. Nicht dass er wesentlich mehr Haare auf dem Kopf gehabt hätte wie die fünf Kameraden unter dem Sonnenschirm. Seine Frisur bestand aus einem drei Zentimeter breiten Streifen, der von der Stirn bis in den Nacken lief. Über der Stirn waren die Haare grasgrün, wechselten in der Mitte zu einem karmesinrot und endeten im Nacken quittegelb. In den Augenbrauen und in den Ohrläppchen blinkten Piercingringe. Seine verwaschene Jeansjacke, die eine Waschmaschine schon lange nicht mehr gesehen hatte, war ausgefranst und die Knöpfe waren auch nicht mehr vollzählig. Auf dem schmuddeligen T-Shirt, es dürfte vor längerer Zeit einmal weiß gewesen sein, war mühsam das Wort „Antifa“ zu lesen. Die schlabberige Hose war zerrissen und die ausgelatschten Turnschuhe hatten schon lange keine Bürste mehr gesehen.
So saß er auf den Kirchenstufen und hatte den Leinenbeutel mit seinen Habseligkeiten neben sich gelegt. Sein Hund, ein Produkt aller freilaufenden Hunde der Stadt und wenig Angst einflößend, hatte es sich neben ihm bequem gemacht, seine Schnauze auf den Beutel gelegt und schlief.
Bruno, so hieß der Hund, hatte sich im Gegensatz zu dem älteren Ehepaar nicht von dem voluminösen Rülpser stören lassen, mit dem Timo seinem Völlegefühl nach dem letzten Schluck Bier aus der Dose Luft gemacht hatte. Just zu dem Zeitpunkt, als das Ehepaar an ihm vorbeigegangen war.
„Haste mal ne Mark?“, hatte er den alten Mann angequatscht, als dieser mit seiner Frau an ihm vorbeiging. Der hatte aber nicht reagiert und war so eilig weitergegangen, dass seine Frau, die in jeder Hand eine schwere Einkaufstasche schleppte, kaum nachgekommen war. Timo fand, dass der Rülpser die richtige Antwort darauf war. Diese Spießer gingen ihm auf den Keks. Deshalb wunderte er sich auch nicht, als ausgerechnet die beiden die ersten Besucher des Infostandes waren.
Timo griff in den Leinenbeutel, zog eine neue Dose heraus und riss sie auf. Das Bier war warm geworden, schäumte aus der Dose und tropfte auf das T-Shirt und die Hose. Es war ihm egal. Er lehnte sich zurück, blinzelte in die Sonne, kaute an den Fingernägeln, spülte die kleinen Hornraspel mit einem großen Schluck hinunter und verschaffte sich erneut mit einem Rülpser Erleichterung.
Die fünf Adretten am Tisch mitten auf dem Platz kannte er. Er war mit ihnen zusammen zur Schule gegangen, bis sich ihre Wege trennten, als er zum Gymnasium gewechselt war. Der mit der wegwerfenden Handbewegung war Daniel Speck - Nomen est omen -, der sich von seinen Freunden seit einiger Zeit Dolph rufen ließ. Schon in der Grundschule, er und Timo waren in die gleiche Klasse gegangen, hatte er das große Wort geführt und jedem Prügel angedroht, der nicht blitzschnell seiner Meinung war. Wer nicht schnell genug reagierte merkte, dass es nicht nur bei einer Drohung blieb. Schon allein deshalb hatte Timo ihn nie gemocht und war ihm aus dem Weg gegangen. In Erinnerung blieb ihm aber, dass Dolphs Schläge um ein Vielfaches besser waren, als seine schulischen Leistungen. Der Nazi hatte schon immer schlagende Argumente, fiel ihm dazu ein und zog noch einen großen Schluck aus der Dose ab.
Die vier anderen Skins waren jünger. Sie stammten alle aus dem gleichen Wohnviertel, der tristen Plattenbausiedlung im Südosten der Stadt mit ihren stupiden, stark renovierungsbedürftigen Fassaden, und wohnten noch bei ihren Eltern in den Wohnblocks, in denen fast sechstausend Menschen zusammengepfercht lebten.
Das heißt, eigentlich stimmte das gar nicht mehr. Viele Wohnungen waren in den letzten Jahren frei geworden und teilweise wohnten in den großen Wohnblocks nur noch fünf oder sechs Familien. Da, wo zu sozialistischen Zeiten die Wohnungen bezahlbar waren, lebten heute nur noch diejenigen, denen das Geld für ein eigenes Häuschen am Stadtrand oder in den Dörfern der näheren Umgebung fehlte. Viele waren auch in andere Bundesländer gezogen. Dorthin, wo es Arbeit gab.
Er selbst hatte sich noch vor dem Abitur davongemacht. Seinen Eltern war es egal gewesen. Vielleicht hatten sie sich sogar gefreut. Vielleicht hatten sie es auch noch gar nicht bemerkt. Sein Vater, eigentlich war es sein Stiefvater, hatte, als sein Arbeitsplatz nach dem Zusammenbruch eines Faserplattenwerkes weggefallen war, in Berlin eine Arbeit gefunden und kam seit dieser Zeit nur noch sporadisch zu Besuch. Das war nicht weiter schlimm gewesen, da er sich sowieso wenig um ihn gekümmert und wenn dann nur Stress wegen seines Aussehens gemacht hatte. Seine Mutter arbeitete bei einer Gebäudereinigungsfirma, musste immer früh zur Arbeit und hatte noch nie Zeit für ihn gehabt. Die ständige Abwesenheit seines Stiefvaters hatte sie nicht sonderlich gegrämt, und da das Geld immer knapp gewesen war, dürfte sie über den Auszug ihres Sohnes nicht sonderlich traurig gewesen sein. Seit er in dem heruntergekommenen Altbau in der Stadt zusammen mit seinen Freunden hauste, hatte er sie nicht mehr gesehen.
„Hey, du Zeckensau, mach dich vom Acker, oder wir helfen dir dabei.“ Timo wurde unsanft aus seinen Gedanken gerissen. Einen Moment hatte er nicht aufgepasst und schon standen sie vor ihm. Bruno drückte seine Schnauze fester auf den Leinenbeutel und tat so, als wenn er fest schlief.
Vorsichtig sondierte Timo die Lage.
Dolph und der Jüngste aus seiner Gruppe standen weiterhin am Infostand und unterhielten sich mit zwei neuen Besuchern.
Normalos, registrierte Timos Unterbewusstsein. Von denen war im Ernstfall keine Hilfe zu erwarten.
So entschloss er sich nichts zu tun und einfach abzuwarten, nahm noch einen Schluck aus der Dose und rülpste erneut. Es klang nicht erleichternd, sondern eher gequält. Er wollte damit seine Verachtung gegenüber den drei Rechten zum Ausdruck bringen, hatte aber gleichzeitig Angst, sie würden auf ihn einschlagen.
Die Haltung der Skins war bedrohlich. Der in der Mitte wippte mit der rechten Schuhspitze auf und ab. Gleichzeitig schlug er leicht mit der rechten Faust in seine flache linke Hand. Die beiden anderen hatten ihre Beine leicht gespreizt und die Hände in Höhe des Bauchnabels in die Gürtel gesteckt.
„Mit deinem Gestank verpestest du die Luft auf dem Marktplatz. Wenn du nicht willst, dass wir dir das Laufen beibringen, verpiss dich sofort und nimm die leeren Bierdosen gleich mit.“
Der Wortführer hatte laut gesprochen und die ersten Passanten blieben in gebührendem Abstand stehen und schauten zur Kirchentreppe hinüber.
„Ihr Naziärsche seht zwar so aus wie Bullen, seid aber keine. Ich kann hier sitzen, wie ich will und nicht wie ihr wollt. Also haut wieder ab.“
„Du Zeckensau hast mich wohl nicht richtig verstanden“, brüllte der Wortführer laut los und blicke sich herausfordernd um. Die Zahl der Zuschauer wuchs. Dolph hatte am Infostand seine Unterhaltung unterbrochen und betrachtete mit beiden Fäusten auf den Tapeziertisch gestützt die Szene, wobei sich die Tischplatte bedenklich durchbog. Er machte aber keine Anstalten, selbst einzugreifen.
Schlagartig wurde Timo klar, dass die drei Figuren vor ihm von Dolph einen Auftrag bekommen hatten und der beobachtete, wie sie mit der Situation fertig wurden. Das machte ihm Mut.
„Dein dummes Gebrüll war nicht zu überhören, arrogantes Nazischwein“, kreischte Timo zurück, „was bläst du dich so auf wie ein Ochsenfrosch. Bist du nicht in der Lage, alleine etwas zu unternehmen. Brauchst du immer Hilfestellung durch mehrere?“
Sein mittleres Gegenüber lief rot an. Jetzt sieht er aus, wie die Nazifahne. Schwarz - weiß - rot, schoss es Timo durch den Kopf.
„Jetzt ist Schluss mit Reden. Du bist in einigen Augenblicken verschwunden oder ich dresche dir neben den bunten Haaren noch eine rote Nase und blaue Augen. Ich zähle bis drei. Eins, zwei … „.
Die Drei erstarb dem Skinhead auf den Lippen. Seine Begleitung hatte in der Zwischenzeit gewechselt. Die beiden „Normalos“, ein untersetzter Mann von etwa 40 Jahren mit seinem gut zehn Jahre jüngeren, erkennbar sportlich durchtrainierten Begleiter, die vor wenigen Augenblicken noch am Infostand mit Dolph gesprochen hatten, hatten sich neben dem Wortführer aufgebaut. Dessen beide Helfer hatten sich verdrückt. Irritiert schaute der Skin erst nach rechts und dann nach links. Die Situation hatte sich für ihn deutlich negativ verändert.
„Können wir helfen? Werden Schlichter gebraucht?“ Freundlich erkundigte sich der Ältere der beiden Männer, wobei er seinen Blick abwechselnd auf den Skin und auf Timo warf.
Der Skin schielte über die Schulter zum Infostand. Dort hatte sich Dolph nicht von der Stelle gerührt. Er wurde unsicher, wollte aber die Situation für sich retten und natürlich auch vor Dolph bestehen.
„Nein, ich werde mit der Sache alleine fertig. Sie werden hier nicht gebraucht. Wenn Sie keinen Ärger haben wollen, verschwinden sie jetzt.“
Der Jüngere der Neuankömmlinge drückte dem Skin eine ovale Dienstmarke vor die Augen.
„Wenn hier jemand Ärger bekommt und nicht augenblicklich verschwindet, dann bist du das. Also, was ist jetzt?“
„Ist das ein Platzverweis?“, wollte der Skin wissen und befand sich schon fast auf dem Rückzug.
„Nein, ein guter Ratschlag, weil ich ein Menschenfreund bin und heute meinen guten Tag habe.“
Zögernd wandte sich der Skin ab und ging aufreizend langsam zum Infostand zurück, wo ihn seine „Kameraden“ erwarteten.
Dolph stand noch immer mit aufgestützten Händen am Tisch und beobachtete, was die beiden Polizisten jetzt gegenüber dem Punk unternahmen. Er kannte die beiden gut, ja vielleicht sogar zu gut. Sie gehörten zur Mobilen Aufklärung Extremismus, der MAEX, einer Spezialeinheit der Polizei, die sich in Mecklenburg-Vorpommern speziell um die Skinheadszene kümmerte. Sie waren dummerweise gerade in dem Moment aufgetaucht, als er seine Leute mit dem Auftrag losgeschickt hatte, den Punk zu vertreiben. Für eine Warnung war es zu spät gewesen.
Die Neugierigen auf dem Marktplatz verliefen sich, nachdem es die erwartete Schlägerei nicht gegeben hatte.
Eigentlich hätte Dolph die Situation auf dem Niederlagenkonto abbuchen müssen. Aber davon konnte nicht die Rede sein. Die Kommentare der Schaulustigen waren ihm nicht entgangen. Das Fazit war für ihn nicht uninteressant. Gut ein Drittel war neugierig auf eine Schlägerei gewesen. Zehn Prozent hatten keine Meinung, beziehungsweise hatten diese nicht verraten und weitere etwa zehn Prozent hatten Mitleid mit dem Punk. Aber bei fast der Hälfte hatte er deutliche Zustimmung registrieren können. Darauf konnte man doch für zukünftige Aktionen aufbauen.
Selbstzufrieden kniff er die Lippen zusammen und zog das Kinn hoch. Er sah in diesem Moment aus wie Benito Mussolini.
Timo ärgerte sich insgeheim. Das hatte noch gefehlt, dass sich ausgerechnet zwei Bullen eingemischt hatten. Das war doch das Allerletzte. Er starrte die Polizisten herausfordernd an.
„Und?“, zischte er seine Gegenüber provozierend an, „muss ich auch verschwinden?“
„Davon war nicht die Rede. Die Bierdosen sollten aber ordnungsgemäß entsorgt werden“, erklärte der Ältere. Dann drehten sich die Beamten um und verschwanden in einer Seitenstraße. „Arschlöcher“, knurrte Timo so, dass sie ihn nicht mehr hören konnten.
Bruno war wieder aufgewacht, hob das Bein und pinkelte der Einfachheit halber direkt auf die Kirchentreppe. Derweil sammelte Timo seine Siebensachen ein, nahm die leere Bierdose und trat sie in Richtung Infostand. Scheppernd hüpfte sie über das Kopfsteinpflaster und trudelte direkt vor dem Sonnenschirm aus. Die halbvolle Dose flog hinterher und zerplatzte neben dem Tisch auf dem Pflaster. Gleichzeitig rannte Timo in Richtung der Seitenstraße, in der die Polizeibeamten verschwunden waren.
Die Verfolgung durch vier der fünf Skins endete an der Hausecke, als sie erkennen mussten, dass die MAEX-Beamten ihnen interessiert entgegenblickten. Deshalb beschränkten sie sich darauf, drohend die Fäuste zu zeigen.
Als Timo die Verfolger nicht mehr auf den Fersen waren, ließ er es wieder gemütlich angehen. Er drückte sich an den Polizeibeamten vorbei, bog in die nächste Querstraße ein und mischte sich unter die Passanten.
„Haste mal ne Mark?“ Mit ausgestreckter Hand ging er auf verschiedene Leute zu und schimpfte bösartig hinter ihnen her, wenn sie ihn nicht beachtet hatten oder mit ebenso dummen Sprüchen reagierten. Bei mehreren alten Frauen hatte er Glück. Er ging provozierend direkt auf sie zu und hielt ihnen die dreckige Hand unter die Nase. Verängstigt griffen sie in ihr Portemonnaie und klaubten einige Münzen heraus, die sie ihm gaben. Ohne weiteren Dank ging er mit Bruno weiter, der mit hängenden Ohren hinter ihm hertrottete.
Nach einer Stunde Bettelei hatte er keine Lust mehr. Die Geschäfte hatten geschlossen und die Passanten wurden deutlich weniger. Sonderlich erfolgreich war er nicht gewesen, was seine Laune nicht verbessert hatte.
„Komm Bruno, es ist Zeit nach Hause zu gehen.“
Bruno kannte den Weg und hatte sein Herrchen verstanden.
Er trabte voraus und verschwand in einem übel heruntergekommenen Altbau, der kurz vor dem Abriss stand. Die Fenster im Erdgeschoss waren teilweise mit Holzplatten vernagelt und die bröckelige Fassade mit Graffiti beschmiert. Die massive und mit einer dicken Holzbohle verstärkte Haustür besaß kein Schloss. Ein breites Eisenband war als Riegel von innen vorzuschieben. So konnte niemand unbemerkt eindringen.
Jetzt stand die Tür offen. Der Flur war dunkel. Eine Lampe gab es nicht. Die Tapeten hingen in Fetzen von der Wand und waren mit verschiedenen Graffiti „verziert“.
Timo ließ die Tür offen und ging die Treppe zum ersten Stock hinauf. In den Zimmern im Erdgeschoss wohnte niemand. Sie waren leer, wenn man von dem Gerümpel absieht, das die Bewohner dort deponiert hatten. Wer durch die Fenster einsteigen und so die Bewohner überraschen wollte, sah sich einem Gewirr alter Möbel, Kisten, Dosen, Steinen und Metallschrott gegenüber. Bei einem Überfall war so genügend Wurfmunition vorhanden.
Die abgenutzten Holzbohlen knarrten verdächtig, das Holzgeländer wackelte bei jedem Tritt und drohte zusammenzubrechen.
Timo ging in sein Zimmer, das er allein mit Bruno bewohnte. Eine Matratze mit Decke, ein Hocker, ein wackeliger Schrank und ein Regal aus Brettern und Ziegelsteinen bildeten die Einrichtung. Seine Sachen waren malerisch im Raum verteilt. Der Aschenbecher auf dem Hocker, der als Tischchen diente, quoll über, in der großen Tasse schwappten die Reste von Kaffee oder Tee. Von der Decke hing eine Glühbirne nur an einer Fassung herunter. Einige halb abgebrannte Kerzen standen auf dem Fensterbrett und dem Regal. Der Leinenbeutel wurde mit Schwung in die Ecke geworfen und Timo hockte sich auf seine Matratze. Bruno legte sich ans Fußende.
Aus dem Nachbarzimmer dröhnte Heavy-Metal-Musik.
Timo dachte nach. Es war kein erfolgreicher Tag gewesen. Obwohl viele Leute in der Stadt einkaufen gewesen waren, hatte er nur einige wenige Mark erbetteln können. Die Stütze vom Sozialamt war auch fast aufgebraucht und bisher war ihm nichts Brauchbares eingefallen, die Tage bis zum nächsten Zahltag zu überbrücken.
„Scheiße, mach deine Musik leiser“, brüllte er gegen den Lärm aus dem Nachbarzimmer an und hielt sich die Ohren zu.
In der Tür erschien ein karottenroter Haarschopf über einem blassen Gesicht mit schwarzem Lippenstift und übertrieben schwarzem Lidschatten. Der Rest war bunt zusammengewürfelt. Ausgefranstes gelbes T-Shirt, löchriger schwarzer Pulli, giftgrüne schmuddelige Jeans, schwarze hohe Schnürschuhe mit schwarzen Schnürsenkeln. Jenny sieht aus wie ein Totenkopf mit roten Haaren, dachte Timo und richtete sich auf.
„Na, kennst du nicht das Zauberwort mit den fünf Buchstaben? Scheiße hat sieben und ist es nicht“, giftete Jenny in den Raum.
„Du solltest froh sein, dass ich mich heute um die Küche und das Klo gekümmert habe. Beide waren voneinander nicht mehr zu unterscheiden. Du solltest dir zukünftig angewöhnen, im Sitzen zu pinkeln und deine leer gefressenen Pappteller nicht in die Spüle zu werfen. Hast du wenigstens was zum Trinken mitgebracht?“
Timo verzog das Gesicht.
„Was mimst du hier die Hausfrau. Gib mir lieber etwas Knete, dann hole ich noch was zu trinken.“
„Du bist wohl nicht ganz klar im Kopf. Wir haben hier zwar eine Wohngemeinschaft, aber keine Einkommensgemeinschaft. Mit dieser Einstellung kannst du dich gleich bei den Nazis anmelden.“
„Womit wir beim Thema wären“, antwortete Timo genervt.
„Wir müssen heute noch beratschlagen, was wir gegen die Saubande unternehmen können. Heute hatten sie mit fünf Mann auf dem Marktplatz einen Stand aufgebaut. Es war zwar bis auf ein paar Spießer und die Bullen keiner da. Dafür haben sie mir Schläge angedroht. Dolph hatte die Führung und einige neue Leute dabei. Die sollten sich wohl beweisen und mir zeigen, was sie können.“
„Und? Wie ist es ausgegangen?“, wollte Jenny wissen.
„Knapp. Die Bullen haben sich eingemischt und da haben sie es vorgezogen, sich zurückzuziehen. Als Arbeitsauftrag haben sie von mir die Entsorgung der Bierdosen erhalten.“
„Ich weiß nicht, ob das klug war“, antwortete Jenny und zog die Stirn in Falten. Totenkopf mit Falten, dachte Timo, strich sich gedankenverloren über das Kinn und hörte weiter zu.
„Die Nazischweine suchen doch nur einen Grund, sich mit uns anzulegen. Die werden immer mehr und wir immer weniger. Wir können keine Eskalation gebrauchen.“
„He he, was sind denn das für Töne? Du willst die Idioten doch nicht gewähren lassen, oder? Die sind zwar doof wie drei Reihen Salat, aber wenn ich das richtig sehe, sind wir die Einzigen, die ihnen Stress machen. Die Bullen von der MAEX halten mit ihnen Händchen und sind auf dem rechten Auge blind. Die Politiker lassen sie gewähren und klopfen nur kluge Sprüche, und währenddessen bauen Dolph und seine Hanseln Infostände auf und sammeln neue Mitglieder. Keiner tut was, um die Ärsche einzusperren.“
„Deswegen musst du keinen Kleinkrieg provozieren, bei dem wir nur verlieren können. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir sie wirklich empfindlich treffen können. Deine platten Provokationen gehören nicht dazu, vor allem nicht, wenn du alleine bist. Bruno ist dir da keine Hilfe.“
Timo schloss die Augen und lehnte sich zurück.
„Was schlägt meine kluge Ratgeberin vor?“
„Heute Abend, wenn wir komplett sind, setzen wir uns zusammen und diskutieren über geile Gegenmaßnahmen“, bestimmte Jenny und verschwand wieder in ihrem Zimmer. Die Musik verstummte. Timo legte sich auf seine Matratze und beschloss, ein Stündchen zu schlafen. Wenn abends diskutiert werden sollte, konnte das lange dauern.
Insgesamt zehn Personen gehörten zur Altstadt-WG, fünf Mädchen und fünf Jungs. Wenn man Bruno hinzurechnete, waren es elf. Alle waren sie im Alter zwischen 16 und 23 Jahren. Timo war der Älteste und Tiffi Rabe die Jüngste. Sie war zu Hause ausgerissen, weil sie es nicht mehr ertrug, von ihrem Stiefvater gegängelt zu werden. Tiffi tu dies. Tiffi lasse das. Tiffi, wie siehst du heute wieder aus. Zieh dir etwas Vernünftiges an. Verunstalte dich nicht so. Treibe dich nicht herum. Bis zehn Uhr bist du wieder zu Hause. Wenn du so weiter machst, bekommst du keine Ausbildungsstelle - und so weiter und so weiter.
Aus Protest hatte sie sich dann extra schrill angezogen, gepierct und die Haare zu einer Bürste geschnitten. Einen mörderischen Krach hatte ihr Stiefvater vom Zaun gebrochen, mit Schlägen gedroht und als sich ihre Mutter schützend vor sie stellte, hatte er sie beiseite gestoßen. Dabei war sie gestolpert, mit dem Kopf gegen die Tischkante gefallen und hatte sich eine große Platzwunde an der Stirn zugezogen. Ihr Stiefvater hatte gleich wieder den Besorgten gemimt und seine Frau in die Klinik gefahren. Das hatte Tiffy ausgenutzt, um ihre Siebensachen zu packen und zu verschwinden. Die WG hatte ihr Schutz und Unterkunft gewährt. Die anderen hier im Altbau waren alles ausgeflippte Typen, die aber jeden so akzeptierten, wie er war. Das hatte ihr gefallen und sie hatte in der zweiten Etage einen Raum für sich eingerichtet.
Nur ein Jahr älter als Tiffi war Boomer. Eigentlich hieß er Sigi Köske. Er wurde aber nur Boomer gerufen, weil er ein richtiger Streuner war. Nichts hielt ihn lange an einem Ort. In der WG tauchte er auf, wenn ihm danach war. Es war sozusagen sein Stützpunkt, den er hin und wieder einmal anlief. Wenn er dann erschien, wurde es unruhig. Er störte alles und jeden und geriet auch schon einmal mit Timo in Streit, wenn er Bruno ärgerte. Wo er herkam, hatte er nicht erzählt. Irgendwann war er gekommen, weil er von der Polizei gesucht wurde und nicht mehr wusste, wo er hin sollte. Mehr durch Zufall hatte er dann das Altstadthaus gefunden, sich dort versteckt und gehörte seit dieser Zeit dazu. Er hatte seine Bude unter dem Dach, nicht größer als eine Abstellkammer. Nur mit einer Dachluke als Fenster. Sein Fabel waren Graffiti. Nicht dass er einen besonders hohen künstlerischen Anspruch für seine Scratchings oder Tacs erhoben hätte. Er wollte einfach nur Spaß haben, wenn andere Leute sich ärgerten.
Annika Schulz und Laszlo Milar waren ein Paar und bewohnten ein großes Zimmer neben Tiffi. Beide waren schon 19 Jahre alt. Sie hatten sich vor drei Jahren in einem Ferienlager in Ungarn kennengelernt. Seit dieser Zeit waren sie zusammen. Annikas Eltern hatten gegen die Verbindung etwas einzuwenden gehabt. Da Annika nicht von Laszlo lassen wollte, zog sie zu Hause aus und mit Laszlo, der illegal in Deutschland lebte, in die WG. Seinen Lebensunterhalt bestritt Laszlo durch Gelegenheitsarbeit. Das, was ihm zum Leben dann noch fehlte, besorgte er sich durch kleine Gaunereien oder durch Bettelei.
In dem großen Raum unter dem Dach, dort wo auch Boomer seine kleine Bude hatte, hausten in einer merkwürdigen Dreierbeziehung Nene Lammers, Pia Harms und Jens Damp. Sie hatten ihren Raum mit dunkler Farbe gestrichen, dunkle Vorhänge besorgt und zwischen ihren Matratzen lag allerlei unheimlicher Trödel. Auf einem Regal stand sogar ein Totenschädel, in den sie ein Teelicht gestellt hatten. Sie bezeichneten sich als Satanisten und trieben sich oft abends und nachts auf den Friedhöfen der Stadt herum, wo sie Gleichgesinnte trafen. Die drei trugen nur schwarze Klamotten, hatten sich die Haare tiefschwarz gefärbt und die Mädchen benutzten beide einen schwarzen Lippenstift, vermutlich den gleichen wie Jenny.
Den farbenfrohen Mitbewohnern aus den unteren Etagen war es egal. Jeder sollte so leben, wie es ihm gefällt. Aber unheimlich war ihnen doch manchmal, und nur selten ging einer von ihnen in die Dachwohnung, um die Drei zu besuchen.
Lediglich Boomer hatte seinen Spaß, und es kam häufiger zum lautstarken Streit. Vor allem dann, wenn er den Totenschädel nahm und damit durch die Wohnung kegelte.
Die drei damals Achtzehnjährigen hatten sich auf einem Friedhof kennengelernt und waren vor knapp zwei Jahren in den Altbau gezogen, da die Eltern bei ihnen zu Hause weder das merkwürdige Outfit noch die Dekorationen dulden wollten. Sie hatten es zuvor mit einer Wohnung in der Plattenbausiedlung versucht, waren aber von den Mitbewohnern derart gemobbt worden, dass sie sich in die WG flüchteten. Hier wurden sie in Ruhe gelassen.
Der letzte, der zur WG zählte, war Reinhard Neuhaus, genannt Reini. Er hatte früher das Zimmer bewohnt, in dem sich jetzt Jenny eingerichtet hatte und wohnte angeblich bei einer Freundin, die aber bisher keiner zu Gesicht bekommen hatte. Reini war fast genauso alt wie Timo, noch etwas bunter und vor allem stärker gepierct. Die Haare hatte er quittegelb gefärbt und zu einer Art Hahnenkamm toupiert und mit Bier gefestigt. Er fühlte sich offenbar aus Tradition noch immer zur WG gehörig und nahm an den Diskussionen eifrig teil. Dabei hatte er durchblicken lassen, dass er seit einiger Zeit Mitglied einer links stehenden politischen Partei war und sich sowohl dort auf kommunaler Ebene engagierte, als auch aktiv an Aktionen einer Alternative teilnahm, die sich einerseits gegen Globalisierung und Beteiligung der Bundeswehr an internationalen Einsätzen, andererseits für einen unbegrenzten Zuzug ausländischer Mitbürger einsetzte.
Er war der Meinung, dass gewaltfreie Aktionen hier wenig hilfreich wären, da sie die Bevölkerung nicht aufrütteln. Nur durch spektakuläre Taten mit Fanalwirkung sei das Interesse der sonst stupiden Mitläufer zu wecken. Hier schieden sich die Geister, was immer wieder für reichlich Diskussionsstoff sorgte.
Timo wurde durch Gepolter und lautes Geschrei geweckt. Unzweifelhaft war Boomer erschienen und hatte den Dachboden in Aufruhr versetzt. Bruno hatte sich in eine Ecke verzogen, den Schwanz zwischen die Beine geklemmt, die Schnauze fest auf den Boden gepresst und äugte ängstlich zur Tür, durch die gerade Jenny ihren Karottenkopf steckt.
„He Timo, wir treffen uns bei mir. Komm hoch. Die anderen sind alle schon da“, krähte sie in den Raum. Mühsam stemmte sich Timo von seinem Lager.
„Hast du auch was zu trinken da?“
„Ja, Wasser.“
„Feuerwasser?“
„Doofmann. Komm endlich. Wir wollen anfangen. Reini hat einen Plan, den wir diskutieren wollen.“
„Wenn es dabei darum geht, den Rechten auf die Schnauze zu hauen, dann bin ich sofort dabei.“
Jenny murmelte etwas Unverständliches und verschwand aus der Türöffnung, während Timo erst noch das Klo ansteuerte.
„Vergiss nicht dich hinzusetzen“, krähte Jenny ihm hinterher.
Timo dreht sich um und zeigte ihr den gestreckten Mittelfinger. Er nannte ihn „Effinger“ in Erinnerung an einen Fußballspieler, der damit kritische Fußballfans provoziert hatte und bundesweit damit in die Schlagzeilen geriet. Als Timo nach vollbrachter Tat zu Jenny ins Zimmer ging, war der Raum voll. Alle waren gekommen. Boomer saß auf der Fensterbank, Jenny im Schneidersitz auf dem Boden, die drei Schwarzen vom Dachboden hatten es sich auf der Matratze bequem gemacht, Reini lehnte an der Wand neben der Tür, Tiffi hatte sich ein Sitzkissen mitgebracht und Annika und Laszlo saßen neben Reini auf dem Boden und hatten ihre Füße ausgestreckt.
„Wenn du jetzt auch noch deinen Hosenstall zumachst, können wir anfangen“, giftete Jenny in Richtung Timo.
„Es ist interessant zu wissen, wo du hinguckst, wenn ich zur Tür reinkomme“, brummte Timo zurück, zog provozierend langsam den Reißverschluss hoch, zwängte sich zwischen Pia und Jenny auf den Boden und angelte sich eine der vor ihm auf dem Tischchen liegenden überreifen Bananen.
„Haste die beim Konsum geklaut?“, wollte er von Jenny wissen.
„Du bist ein ekelhaftes Arschloch“, kreischte sie zurück und drückte ihm mit der flachen Hand die Banane ins Gesicht.
Timo grinste und wischte sich mit dem Ärmel die zermatschte Masse von Nase, Mund und Wangen.
Reini räusperte sich und meldete sich genervt zu Wort.
„Könnt ihr euren Streit nicht verschieben, bis wir hier fertig sind?“
„Man wird doch noch fragen dürfen“, maulte Timo und lehnte sich zurück, um nicht Gefahr zu laufen, von Jenny eine gewischt zu bekommen.
„Also“, eröffnete Reini die Diskussion, „ich habe heute gehört, dass die Rechten auf dem Marktplatz einen Infostand aufgebaut hatten und dann mit Timo in Streit gerieten.“
„Ich habe mich mit niemandem gestritten. Ich habe nur auf der Tempeltreppe gesessen“, wandte Timo ein. Reini räusperte sich.
„Können wir uns darauf einigen mit der Diskussion anzufangen, wenn ich das Thema vorgestellt habe?“
Die Runde nickte und Boomer kicherte albern vor sich hin.
„Also es ist klar, dass die Rechten hier in der Stadt mobil machen. Es vergeht kaum eine Woche, in der sie nicht vor den Schulen und auf dem Marktplatz einen Infostand aufbauen und ihre dreckigen Thesen verkaufen. Es vergeht auch keine Woche, in der sie nicht unsere ausländischen Mitbürger verängstigen oder gar terrorisieren oder etwas gegen uns Autonome unternehmen. Den etablierten Parteien fehlt für durchgreifende Maßnahmen der Mut. Dass es nur bei Lippenbekenntnissen bleibt, können wir nicht dulden. Es hilft auch nicht, wenn wir vereinzelt versuchen, gegen Nazischweine vorzugehen oder sie zu provozieren. Wir Antifaschisten erreichen nur etwas, wenn wir gemeinsam handeln. Nur dadurch werden wir stark. Wir haben auch in unserer Alternative bereits darüber diskutiert und ich bin heute hier, um euch die Diskussionsergebnisse vorzustellen und dafür zu werben, dass ihr euch anschließt.“
„Gibt es dafür Knete?“, wollte Boomer wissen. Reini zog die Augenbrauen hoch und musterte Boomer mit einem langen Blick so intensiv, dass dieser sich unbehaglich fühlte.
„Nein, dafür gibt es keine Knete“, sagte er und fügte belehrend hinzu: „Du musst noch lernen, dass der Straßenkampf, und um den geht es hier im Wesentlichen, mehr durch unseren persönlichen Einsatz und weniger mit den Mitteln des Großkapitals geführt werden muss, wenn wir unser Ziel erreichen wollen.“
„Verkneife dir deine Belehrungen und komme endlich zur Sache“, griff Annika ein.
„Also“, nahm Reini den Vortragsfaden wieder auf, „wir sind zu dem Ergebnis gekommen, sowohl mit langfristig geplanten und teilweise überregionalen, als auch mit kleinen regional begrenzten Aktionen den Kampf zu führen.“
„Von Planungen halte ich überhaupt nichts“, wurde Reini erneut unterbrochen. Diesmal von Tiffi.
„Nun warte doch erst einmal ab, was Reini noch weiter dazu zu sagen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er uns meint, wenn er von Planungen spricht. Ich plane nur meinen nächsten Besuch auf dem Friedhof“, ließ sich Nene vernehmen.
Boomer kicherte wieder albern und konnte sich nicht verkneifen, in Richtung der schwarzen Drei zu stänkern:
„Kerzen auf den Leichenherzen. Links das Mädel, rechts den Schädel und die gute Grabesluft ist Satanisten Lieblingsduft.“
Reini schloss sichtlich genervt die Augen und sammelte sich einen kurzen Moment, bevor er fortfuhr.
„Also, geplant werden die Fahrten zu großen Demonstrationen. Als da wären: G-8-Gipfel, Atomtransporte und Internationale Sicherheitskonferenz. Die Planungen dazu werden natürlich von der Alternative gemacht und auch die Busse angemietet. Es wäre schön, wenn ihr mitfahren würdet. Die Termine würde ich euch frühzeitig mitteilen. Für euch geht es wirklich nur darum, mitzumachen.“
„Wenn es schon keine Knete gibt, gibt es dann wenigstens etwas zu trinken und zu essen?“, wollte Boomer wieder wissen.
Reini entschloss sich, für die nächste Zeit Boomer einfach zu ignorieren.
„Hier in der Stadt und der Umgebung wollen wir gegen das Bundeswehrgelöbnis im Stadtpark demonstrieren und eine Gegendemo als Kontrapunkt zum Aufmarsch der Rechten setzen.“
Boomer ließ nicht locker.
„Gibt es bei der Bundeswehr Erbsensuppe aus der Gulaschkanone?“
„Wenn du Idiot endlich einmal die Schnauze halten würdest, dann würden wir auch schneller fertig“, griff Jens ein, der sich noch über Boomers Schüttelreim ärgerte. Boomer streckte ihm die Zunge heraus, rutschte von der Fensterbank herunter und stakste über die ausgestreckten Beine von Laszlo und Annika zur Tür.
„Also, wir brauchen eure Unterstützung unbedingt bei folgenden Aktionen …“, setze Reini seinen Vortrag fort und wurde jäh durch ängstliches Hundejaulen unterbrochen.
Timo sprang wie von der Tarantel gestochen hoch, war mit einem Satz durch die Tür und stürmte in sein Zimmer. Dort kniete Boomer vor Bruno und versuchte, ihn am Halsband aus der Ecke zu ziehen. Mit einem Griff packte Timo den Störenfried am Kragen und riss ihn hoch.
„Zum letzten Mal, du kleine miese Ratte, lass Bruno in Frieden, sonst vergesse ich mich und breche dir deine sensiblen Taschendiebfinger. Ist das klar?“
„Du verstehst überhaupt keinen Spaß“, versuchte Boomer sich zu wehren und dem Griff von Timo zu entwinden. Der schleifte ihn aus seinem Zimmer durch den Flur zur Toilette.
„Jetzt kack dich aus und komme bloß nicht auf den Gedanken, ohne mich mein Zimmer wieder zu betreten.“
Timo ging allein in Jennys Zimmer zurück, wo die anderen auf ihn gewartet hatten. Lediglich die drei Schwarzgekleideten grinsten. Reini wartete, bis Boomer zurückgekommen war, der wieder auf der Fensterbank Platz nahm.
„Ich habe die Klospülung nicht gehört“, wandte sich Jenny an Boomer.
„Ich habe auch nicht gemusst. Timo hat mich da einfach hingeschleift“, beschwerte er sich und presste die Lippen maulig zusammen. Das Grinsen der drei Satansjünger verstärkte sich. Satanisches Grinsen dachte Timo und konzentrierte sich wieder auf Reini.
„Also, wir brauchen eure Unterstützung unbedingt bei folgenden Aktionen: Wir wollen überall in der Stadt an hervorragenden Stellen mit Graffiti für jeden deutlich machen, dass wir die Nazis nicht wollen.“
„Genau, genau, genau“, meldete sich Boomer wieder zu Wort.
„Das mache ich. Am Supermarkt habe ich schon einen geilen Spruch gemalt.“
„Ja, der war stark“, lobte Reini.
„Ich habe ihn gesehen und stelle mir vor, dass der auch an anderen Stellen in der Stadt seine Wirkung nicht verfehlt. Weiter so.“
„Gibt es dafür Knete?“, wollte Boomer wieder wissen.
„Dazu habe ich schon was gesagt“, entgegnete Reini.
„Ne, ne, so haben wir nicht gewettet“, ließ Boomer nicht locker. „Farbe ist teuer und nicht jede Sprühdose kann ich im Baumarkt klemmen.“
„Ich sehe zu, dass ich da was für dich tun kann“, versicherte Reini und erklärte weiter: „Das war der leichtere Teil. Wir haben auch vor, den Großkonzernen zu zeigen, dass ihre Macht nicht grenzenlos ist. Deshalb wollen wir an ihrem Image kratzen und ihre schönen Ausstellungsräume entglasen. Na, wäre das was für euch?“
Laszlo nickte.
„Wenn wir das mit mehreren gleichzeitig machen, geht es schnell und wir erreichen viel. Ich denke, das übernehmen wir.“
Annika stimmte ihm zu. Auch Tiffi und Jenny nickten.
„Als letztes stellen wir uns vor, dass wir den Naziärschen ihre Baracke vernichten. Dann haben sie keinen Stützpunkt mehr und sind für einige Zeit nicht in der Lage, Infostände zu betreiben oder sich ungestört zu versammeln.“
Die drei Schwarzen nickten wie einstudiert gleichzeitig mit den Köpfen.
„Die Nacht ist unser Freund. Wir machen sie zum Tage“, ließ sich Jens vernehmen. Timo wagte einen Einwand.
„Ich wäre da nicht so optimistisch. Das Fabrikgelände ist unübersichtlich. Wer weiß, wo die überall ihre Wachtposten haben? Außerdem gehe ich davon aus, dass Dolph die Baracke so gesichert hat, dass sie nicht so ohne Weiteres zu vernichten ist. Außerdem glaube ich nicht, dass wir dadurch ihre Aktionen längerfristig stören. Die finden mit Sicherheit in kurzer Zeit einen neuen Raum und wir haben sie am Hals und können hier in der WG nicht mehr sicher sein.“
„Also“, meldete sich Reini, „natürlich sind die Rechten dadurch nicht von heute auf morgen verschwunden. Aber sie merken, dass sie hier nicht alleine sind und dass sie Gegner haben, die unerbittlich mit ihnen umgehen. Die Bullen sind in dieser Richtung Weicheier und dazu noch auf dem rechten Auge blind. Über den Schutz der WG haben wir übrigens in der Alternative auch diskutiert und sind einhellig bereit, euch zur Seite zu stehen, wenn, wer auch immer, euch von hier vertreiben will.“
„Schön zu hören“, mischte sich Jenny ein, „hoffentlich seid ihr auch früh genug hier, sonst könnt ihr uns im günstigsten Fall bei den Bullen abholen, im ungünstigsten Fall an unseren Gräbern singen.“ Die drei Schwarzen verzogen das Gesicht.
„Wir sind zwar gern auf dem Friedhof“, wandte Nene ein, „aber natürlich nicht in der Kiste.“
Reini schüttelte sich unwirsch.
„Nun übertreibt mal nicht. Wollt ihr mitmachen oder nicht?“ Sein Blick schweifte durch die Runde von einem zum anderen. Alle nickten.
„Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Übrigens, ihr handelt natürlich selbstständig“, erklärte er und verschwand.
„Natürlich!“, äffte Boomer hinter ihm her.
Die Runde blieb noch einige Zeit zusammen und besprach Einzelheiten. Danach trollte sich jeder in sein Zimmer und es kehrte Ruhe ein. Timo ging kurz mit Bruno auf die Straße, kontrollierte die Umgebung. Dann kehrte er in das Haus zurück, schloss die Tür und legte die schweren Riegel vor.
Jenny hatte ihre Tür bereits geschlossen, und so legte sich Timo auf seine Matratze, Bruno ringelte sich an seinen Füßen ein und beide waren nach wenigen Minuten eingeschlafen.
Der Präventationsrat
Raschke und Schrader, die beiden MAEX-Beamten, standen an ihrem zivilen Dienstwagen und beobachteten mit Interesse, wie Timo, den sie der alternativen Szene der Stadt zuordneten, so plötzlich an ihnen vorbei rannte, im Gefolge die Skinheads.
„Na, da stören wir schon wieder ein Verfolgungsrennen“, meinte Raschke, der ältere der beiden, „um was wollen wir wetten, dass die Kameraden nicht an uns vorbei laufen?“
„Um nichts“, antwortete Schrader, „die haben das Rennen schon eingestellt. Wahrscheinlich befürchten sie, dass die anderen Bunten den Infostand stürmen.“
„Waren die denn in der Nähe? Ich habe keine gesehen“, fragte Raschke und blickte sich unruhig um.
„Gesehen habe ich auch keine, aber normalerweise ist einer nicht allein. Schon gar nicht, wenn er einen Streit mit den Rechten provoziert.“
„Da hast du recht. Lass uns mal die Gegend abfahren, vielleicht entdecken wir sie ja.“
Raschke und Schrader stiegen in ihr Fahrzeug, sahen Timo in einer Seitenstraße verschwinden und kurvten weiter durch die Innenstadt.
„Es ist schon toll, wie die Häuser jetzt nach der Renovierung aussehen. Die Stadt wird richtig ansehnlich“, stellte Raschke fest. Schrader konzentrierte sich auf den Straßenverkehr und schimpfte:
„Heute ist in der Stadt der Teufel los. Es fährt wohl jeder mit dem Auto direkt bis vor die Geschäfte. Warum machen die im Rathaus nicht die Fußgängerzone größer? Dann wäre die Stadt noch attraktiver.“
„Ja ja, das ist wohl wahr, wenn nur nicht die elenden Schmierereien wären. Bei der Boddenversicherung wurde die gerade frisch gestrichene Hauswand übel beschmiert. Nur mit Kritzeleien und Anarchiesymbolen. Es ist zum Heulen.“
„Die Kritzeleien werden übrigens Scratchings genannt oder auch einfach nur Tacs. Damit können sich Insider untereinander identifizieren.“
„Danke für die Belehrung. Ich wusste gar nicht, dass du dich schon so intensiv damit beschäftigt hast.“
„Der Bürgermeister hat zum Kreuzzug gegen die Schmierer aufgerufen und unser Inspektionsleiter hat den Schulterschluss mit ihm gemacht. Es ist eine Sonderkommission gebildet worden, die sich verstärkt darum kümmern soll.“
„Und mit wem? War der Heldenklau schon unterwegs?“
„Keine Ahnung. Aber alle im Außendienst tätigen Beamten sollen ihre Augen offenhalten und die Informationen direkt an die Soko steuern.“
„Natürlich mit drei Durchschlägen“, lästerte Raschke und fluchte unvermittelt los:
„Verdammter Mist, das darf doch nicht wahr sein. Halte sofort an.“ Schrader trat in die Bremse und hielt. Wütend hupte das Fahrzeug hinter ihnen, was Schrader aber nicht weiter störte.
„Was ist denn los?“
Raschke zeigte auf die weiße Mauer, die das Grundstück eines Supermarktes zur Straße hin abschloss. In großen roten Buchstaben hatte ein Sprayer dort ein Hakenkreuz aufgemalt, dieses durchgestrichen und daneben geschrieben: Scheiße war schon immer braun!!!!
„Oh, das wird der Kameradschaft nicht gefallen“, meinte Raschke lakonisch und griff zum Funkgerät.
„Dem Geschäftsführer vom Supermarkt auch nicht“, ergänzte Schrader. Der Kollege in der Einsatzleitstelle nahm den Hinweis auf, sagte zu, das Ordnungsamt sowie die Soko zu informieren und wies die beiden an, sich mit dem Geschäftsführer vom Supermarkt in Verbindung zu setzen.
„Na, dann können wir unsere Streifenfahrt ja beenden. Hoch lebe der neue Auftrag“, brummte Raschke ungehalten, während Schrader auf den Hof des Supermarktes einbog. Sie stiegen aus.
NUR FÜR PERSONAL stand an der Stahltür, an die Raschke kräftig mit der Faust hämmerte. Keine Reaktion. Nichts regte sich.
„Menschenkinder, warum öffnet denn niemand? Da muss doch noch einer da sein.“
Raschke trommelte weiter gegen die Tür.
„Die lassen sich beim Geldzählen nicht stören“, mutmaßte Schrader und versuchte durch das neben der Tür liegende Fenster nach innen zu blicken. Offensichtlich hatte er dort jemanden entdeckt, denn er kramte seine Dienstmarke aus der Tasche und hielt sie an die Scheibe. Dennoch dauerte es noch einige Minuten, bis sich vorsichtig die Stahltüre öffnete.
„Was gibt's denn so Dringendes?“, wollte der gestresst wirkende Mittvierziger im weißen Kittel wissen, „wir machen gerade Kassenabschluss.“
„Was habe ich gesagt?“, triumphierte Schrader, „wozu ist man Kriminalbeamter, da hat man das Kombinieren gelernt.“
„Halte mal die Füße still“, giftete Raschke, „der gute Mann will nicht wissen, wie gut du kombinieren kannst, sondern warum wir ihn beim Zählen stören. Außerdem kannst du noch beweisen, wie gut du kombinieren kannst, wenn es um die Ermittlung der Täter geht.“
„Meine Herren, können Sie sich endlich einmal einigen. Meine Zeit ist begrenzt“, unterbrach sie der Geschäftsführer.
„Tja“, erklärte Raschke, „Ihre Grundstücksmauer ist an der Straßenseite durch einen Graffitisprayer übel verunziert worden. Wir wollten sie darüber informieren, da wir uns nicht vorstellen können, dass Sie das so lassen wollen.“
Der Geschäftsführer runzelte die Augenbrauen.
„Das darf doch nicht wahr sein. Wir haben die Mauer erst vor zwei Tagen streichen lassen, weil sie mit Graffiti beschmiert war. Das hat uns eine Menge Geld gekostet.“
„Ich hoffe, Sie haben noch Farbe übrig“, meldete sich Schrader wieder zu Wort und bat zur Besichtigung. Umständlich verschloss der Geschäftsführer die Tür und ging mit den Beamten. Fassungslos stand er vor der Schmiererei.
„Natürlich werden wir das sofort entfernen“, erklärte er den Beamten, „haben Sie schon einen Hinweis auf den Täter?“
„Wie denn? Wir haben die Schmiererei erst vor ein paar Minuten entdeckt“, entgegnete Raschke unwirsch.
„Eigentlich wollten wir Sie fragen, ob Sie uns einen Hinweis geben können.“
„Wie denn? Ich verkaufe meine Ware im Geschäft und nicht auf der Straße.“
„Der Kollege meint, ob Sie heute jemanden im Laden bemerkt haben, der die Schmiererei begangen haben könnte oder eine Spraydose mit Farbe gekauft hat. Vielleicht hat auch ein Kunde etwas bemerkt?“, beschwichtigte Schrader.
Der Geschäftsführer wurde böse.
„Ja glauben Sie denn wirklich, ich hätte nicht reagiert, wenn mich irgendjemand informiert hätte? Außerdem führen wir keine Farbdosen. Nein, ich habe keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Aber vielleicht erkundigen Sie sich einmal bei dem Sohnemann von unserem Bürgermeister. Der wurde doch vor wenigen Tagen beim Sprayen erwischt. Oder gehört der zu den Unberührbaren?“
„Na, dann wollen wir doch mal wieder sachlich werden und keine Polemik betreiben“, versuchte Raschke die Situation zu retten, „Sie können sicher sein, dass wir alles tun werden, um den Schmierer ausfindig zu machen und dann können Sie ihn ja auf dem Privatklageweg in Regress nehmen.“
„Das will ich auch hoffen. Wofür bezahle ich denn meine Steuern und das nicht zu knapp“, beruhigte sich der Geschäftsführer wieder und verabschiedete sich von den Beamten.
„Ich werde veranlassen, dass die Schmiererei sofort übermalt wird“, sagte er zu und verschwand hinter der Stahltüre.
„Wir sollten den Schriftzug noch fotografieren, vermessen und eine Farbprobe nehmen“, schlug Schrader vor. Raschke tippte sich an Stirn.
„Die Soko weiß Bescheid. Ich gehe einmal davon aus, dass sie sich darum kümmern wird.“
„Wenn der Geschäftsführer schnell ist, haben wir die Arschkarte gezogen“, wandte Schrader ein.
„Der muss erst noch seine Knete zählen und bis dahin hat die Soko die Sache abgearbeitet. Wir setzen jetzt unsere Streifenfahrt fort“, ordnete Raschke an.
Die Suche nach den Rechten und den Autonomen blieb ohne Erfolg und nach einiger Zeit fuhren die MAEX-Beamten zur Dienststelle zurück. Kaum waren sie in ihrem Büro, als das Telefon klingelte.
„He ihr Komiker“, meldete sich ein Kollege aus der Soko Graffiti.
„Ihr sollt sofort zum Sokoleiter kommen. Zieht euch warm an und denkt euch eine gute Begründung aus, warum ihr die Tatortarbeit nicht gemacht habt.“
Raschke bekam einen Schluckauf und Schrader schaute ihn triumphierend an.
„Habe ich es nicht gesagt? Jetzt haben wir die Arschkarte. Dann gehe mal rüber und kläre die Sache. Ich bleibe im Büro.“
„Klugscheißer“, grummelte Raschke und machte sich auf den Weg.
„Sie wollen mir sicher die Täter präsentieren“, empfing ihn der Sokoleiter freundlich, nachdem Raschke sich bei ihm gemeldet hatte. „Warum sonst sollten Sie in die Fahndung eingetreten sein, ohne sich weiter um die elementarsten Dinge der Tatortarbeit zu kümmern!“
Raschke schluckte.
„Äh ja, äh nein.“
„Ja was denn nun? Ja oder nein?“
„Ja, wir haben die Tatortarbeit nicht gemacht, weil wir der Meinung waren, dass die Soko das übernimmt. Nein, wir können keine Täter präsentieren.“
„Na bravo, das nenne ich gute Arbeit“, erklärte der Sokoleiter und seine Stimme troff vor Ironie. „Ich war fest davon überzeugt, ihr von der MAEX kennt eure Pappenheimer und seid deshalb sofort losgestürmt, weil ihr die Täter kanntet und einsacken wolltet. Es scheint aber alles nicht so weit her zu sein mit euren Szenekenntnissen. Was macht ihr überhaupt? Fahrt ihr nur in der Gegend herum und genießt das schöne Wetter?“
„Wir hatten die Rechten unter Beobachtung“, versuchte Raschke sich an einer Erklärung.
Der Sokoleiter kniff die Augen zusammen und legte seine Stirn in Falten.
„Wenn ich das richtig verstehe, ist die MAEX eine Mobile Aufklärung Extremismus und nicht allein auf Rechtsextremismus spezialisiert. Mobil seid ihr, das habe ich bemerkt. Aufklären tut ihr auch. Aber das ist es dann auch schon. Wenn es um die kriminalistische Arbeit geht, verdrückt ihr euch, und wenn man von euch etwas wissen will, zuckt ihr die Schultern. Herr Raschke, wollen sie wirklich detailliert wissen, was ich davon halte?“
Mit versteinertem Gesicht hatte der MAEX-Beamte zugehört.
„Was ist denn passiert“, wollte er wissen.
„Was passiert ist? Das kann ich Ihnen sagen. Der Geschäftsführer hat den Schriftzug entfernen lassen. Dagegen ist prinzipiell zwar nichts einzuwenden, aber er hat natürlich vorher die Schmiererei nicht fotografiert und die Entfernung so gründlich vorgenommen, dass durch den Kriminaltechniker auch keine verwertbare Farbprobe mehr genommen werden konnte. Jetzt erwarte ich von Ihnen heute noch einen detaillierten Bericht und die Anzeige von Amts wegen.“
Danach war Raschke entlassen und verzog sich wieder in sein Dienstzimmer. Schrader schaute ihn gespannt an, als er durch die Tür kam.
„Na, Haare gewaschen, geschnitten und geföhnt?“
Die Laune von Raschke wurde durch diesen Spruch nicht besser. Er schilderte kurz die Unterredung und sagte seine Meinung über die Soko im Allgemeinen und den Sokoleiter im Besonderen.
„Na, so falsch habe ich wohl doch nicht gelegen“, kommentierte Schrader den kurzen Bericht. Raschke reagierte nicht auf den Kommentar und kramte im Aktenschrank nach den Anzeigeformularen.
„Ich schreibe die Anzeige und du versuchst dich am Bericht“, ordnete er an. „Danach werden wir ja sehen, was du auf deinem Kommissarlehrgang an der Fachhochschule gelernt hast. Wenn wir fertig sind, machen wir Feierabend. Ich habe die Schnauze voll.“
Sie machten sich an den ungeliebten Papierkram und waren noch nicht ganz fertig, als das Telefon klingelte.
„Wir sind nicht mehr da“, kommentierte Schrader das Klingelzeichen und schrieb eifrig weiter an seinem Bericht.
„MAEX-Gruppe“, meldet sich Raschke, dem das penetrante Klingeln auf die Nerven ging. Am anderen Ende war der Sokoleiter. „Moment, ich schalte auf Mithören“, erklärte Raschke und drückte die entsprechende Taste, damit er Schrader nach dem Telefonat nicht alles erzählen musste.
„Also meine Herren, mit Feierabend wird heute erst einmal nichts. Der Bürgermeister hat aus aktuellem Anlass zu einer Sitzung des Kommunalen Präventionsrates eingeladen und legt Wert auf Ihre und meine Teilnahme. Wir fahren gemeinsam um 19.30 Uhr zum Rathaus. Unterwegs können wir uns noch abstimmen, wenn das überhaupt erforderlich sein sollte. Ich denke, Sie leben in der Lage und können sehr gut für sich reden. Wir treffen uns um viertel Acht im Hof.“
Raschke knurrte eine kurze Bestätigung in den Hörer und legte auf.
„Ich bin gerne bei der Polizei“, machte sich Schrader Mut.
Im Rathaus wurden sie schon erwartet. Sie hatten sich verspätet. Wie das so ist, am Bericht war das eine oder andere noch zu ändern, die Einsatzleitstelle hatte noch einige Fragen und die Familien zu Hause mussten auch noch informiert werden. Bei Schrader hatte es etwas länger gedauert, seine Lebensgefährtin davon zu überzeugen, dass es dienstlich zwingend erforderlich sei, erst später - erfahrungsgemäß erst kurz vor Mitternacht - nach Hause zu kommen.
Auch bei Raschke hing der Haussegen schief, als sich seine Frau darüber beschwerte, dass es mit der Heimkehr später werden sollte.
„Vielleicht kommt es noch so weit, dass du nur noch nach Hause kommst, um die Kinder prophylaktisch zu verdreschen und dann wieder zum Dienst fährst“, hatte sie ihn angegiftet.
„Ah, die Herren von der Polizei sind auch schon da“, begrüßte sie der Bürgermeister, als sie zu dritt das Konferenzzimmer betraten. Am großen runden Tisch waren nur noch zwei Plätze frei, die von Raschke und dem Sokoleiter in Beschlag genommen wurden. Schrader angelte sich einen überzähligen Stuhl aus einer Ecke des Raumes und zwängte sich in die Runde. Auf dem Tisch standen belegte Brötchen, Mineralwasser und Fruchtsäfte.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das bedeutet aber auch, dass es länger geht, dachte Raschke und angelte sich ein Salamibrötchen.
„Guten Appetit“, wünschte der Bürgermeister und fuhr fort: „Ich begrüße sie recht herzlich zur Sitzung des Kommunalen Präventionsrates. Da ich davon ausgehe, dass Sie sich nicht alle kennen, möchte ich Sie zunächst einmal vorstellen. Ich habe für den heutigen Abend für Getränke und Essen gesorgt und bitte, ungeniert zuzugreifen. Die Herren von der Polizei haben ja schon richtig kombiniert, wofür die Sachen gedacht sind.“
Der Sokoleiter lief rot an, enthielt sich aber eines Kommentars; Raschke kaute ungeniert weiter und blieb von dem dezenten Hinweis unbeeindruckt.
Der Bürgermeister begann mit der Vorstellung der Sitzungsteilnehmer.
„Der Einfachheit halber fange ich links von mir an. Frau Jestremski, Leiterin des Ordnungsamtes, Pastor Gode von der Stadtkirche, Frau Liebetracht aus dem Jugendamt, Herr Müller vom Sozialamt, Herr Köpf vom DuF, dem Demokratie- und Freundschaftsverein, Herr Brück vom Kreissportbund, Frau Meyer vom Schulamt, Brandmeister Kahl von der Feuerwehr, dann die drei Herren von der Polizei, die sich im Anschluss bitte selbst vorstellen wollen, Herr Kisiwani als Sprecher unserer ausländischen Mitbürger. Sie kommen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, aus Kenia? Wo haben Sie denn so gut deutsch gelernt?“
„Nein, aus Tansania und ich lebe schon 17 Jahre hier. Ich denke, dass ich mich problemlos verständigen kann“, antwortete Herr Kisiwani freundlich, obwohl man ihm den Ärger über die Bemerkung des Bürgermeisters deutlich ansah.
„Nun ja, Kenia und Tansania sind ja nicht so weit voneinander entfernt“, glänzte der Bürgermeister mit seinen geografischen Kenntnissen und stellte ergänzend fest: „Sie sind also schon zu sozialistischen Zeiten gekommen.“
Er sah weiter in die Runde und fuhr fort:
„Dann haben wir noch Herrn Gregor von der Bürgerinitiative Saubere Stadt und last but not least zu meiner Rechten meinen Stellvertreter.“
Raschke hatte zwischenzeitlich sein Salamibrötchen verdrückt und mit einer selbst gemixten Apfelschorle heruntergespült. Er fühlte sich bemüßigt, dem Hinweis des Bürgermeisters nachzukommen und nun die Kollegen vorzustellen, bevor der Sokoleiter etwas sagen konnte.
„Zu meiner Rechten sehen Sie Polizeirat Lenz, den Leiter der Sonderkommission Graffiti, zu meiner Linken den Polizeikommissar Schrader von der Mobilen Aufklärung Extremismus und ich bin Kriminalhauptkommissar Raschke, ebenfalls von der MAEX.“
Er stöhnte verhalten auf, als Lenz ihn unter dem Tisch auf den Fuß trat. Er vermied es, den Sokoleiter anzusehen und angelte sich dafür noch ein weiteres Brötchen.
„Ja, danke Herr Raschke. Dann eröffne ich hiermit die Sitzung und bitte Frau Jestremski, das Protokoll zu führen.“
Die Bitte des Bürgermeisters traf die Leiterin des Ordnungsamtes erkennbar unvorbereitet. Verlegen lieh sie sich von Pastor Gode einen Teil seines Schreibblocks und suchte hektisch in ihrer Handtasche nach einem Kugelschreiber. Der Bürgermeister wartete höflich, bis sie sich ausgestattet hatte und fuhr dann weiter fort:
„Wie Sie sicher aus den kommunalen Medien erfahren haben, erwartet der Innenminister unseres Landes, dass wir verstärkt, noch vor Beginn der Urlaubssaison, etwas gegen die Graffitischmiereien, die aggressive Bettelei und die Rechtsextremen unternehmen. Ich habe vollstes Verständnis für dieses Ansinnen, wenngleich der Minister nicht meiner politischen Heimat angehört.“
Der Stellvertreter verzog das Gesicht und unterbrach den Bürgermeister.
„Ich denke, wir können uns einen Parteienstreit ersparen. Dafür ist die Situation nun wirklich zu ernst. Wir haben deutlich Probleme und dürfen sie nicht negieren. Das hat mit der politischen Heimat nichts zu tun. Unsere Bürger erwarten, dass wir uns verstärkt um Problemlösung über alle politischen Richtungen hinweg bemühen. Insofern unterstützte ich das Ansinnen unseres Ministers in allen Punkten.“
„Nichts anderes habe ich gesagt, Herr Kollege. Lassen Sie mich doch erst einmal meine Gedanken zu Ende vortragen.“
„Ich wollte nur noch einmal unsere generelle Grundhaltung deutlich machen“, wandte der Stellvertreter ein.
Raschke betrachtete gedankenverloren seine Fingernägel. Das kann ja heiter werden, wenn es so weiter geht. Polemik und keine Diskussion um Sachfragen. Geschweige denn Lösungsvorschläge, dachte er.
Der Bürgermeister blätterte in einem Stapel Papier. Schließlich hatte er gefunden, was er gesucht hatte und hielt eine Zeitschrift in den Landesfarben hoch.
IMPULSE war darauf zu lesen und weiter SONDERAUSGABE „Kritisch integrieren“. Zum Umgang mit rechtsextremistischen Jugendgruppen und zu Möglichkeiten der präventiven Arbeit in der Kommune. Empfehlungen der Arbeitsgruppe Extremismus im Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung.
Die meisten der Anwesenden nickten und schienen das Informationsblatt zu kennen. Der Vertreter des DuF-Vereins wiegte ebenso wie Pastor Gode einschränkend mit dem Kopf und meldete sich zu Wort.
„Ja, die Broschüre ist mir bekannt. Aber die Thesen kann ich nicht in allen Punkten unterstützen. Da werden wir in der Tat diskutieren müssen.“
Auch die MAEX-Beamten kannten die Zeitschrift, während der Sokoleiter offenbar noch nichts davon gehört hatte und bat, ihm ein Exemplar zu überlassen. Der Bürgermeister reichte eine Zeitschrift über den Tisch und fuhr fort:
„Wir sollten zunächst die Lage in unserer Stadt kurz analysieren und danach dieses Papier und die sich für uns daraus ergebenden Möglichkeiten diskutieren.“
Zum Thema Extremismus wurden inzwischen so viele neue Initiativen auf nationalen und internationalen Ebenen aus dem Boden gestampft, dass man die Extremisten schon allein mit dem beschriebenen Papier erschlagen kann, dachte Schrader und drückte sich etwas tiefer in den Stuhl.
„Wenn ich die Herren von der Polizei bitten dürfte, kurz, aber bitte wirklich kurz, die Lage aus Sicht der Ordnungsmacht darzustellen.“
„Ernst aber nicht hoffnungslos“, erklärte Raschke und fing sich neben dem erstaunten Blick der Stadtvertreter einen missbilligenden Blick des Sokoleiters ein, der umständlich ein Papier aus der Tasche zog und mit seiner Einschätzung begann.
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Zunächst freue ich mich, vom Vorsitzenden des Kommunalen Präventionsrates zu dieser Sitzung eingeladen worden zu sein. Sie wissen, dass unser Herr Innenminister großen Wert darauf legt, dass die Kommunen und die Polizei auf dieser Ebene intensiver zusammenarbeiten sollen, nein, müssen. Um effektiv handeln zu können ist es unbedingt erforderlich, Sie anhand der polizeilichen Lagebilder über die Situation in der Stadt und im Gebiet umfassend in Kenntnis zu setzen.“
Die Zuhörer hatten sich in ihren Stühlen zurückgelehnt. Nur Frau Jestremski notierte eifrig einige Stichpunkte. Der Bürgermeister beugte sich zu ihr herüber, bemerkte die Notizen und raunte ihr, ohne den Sokoleiter zu unterbrechen, zu:
„Sie brauchen das nicht mitzuschreiben. Ich bin sicher, das hat der Mann in Kopie für uns und wenn nicht, besorge ich es mir über das Innenministerium.''
Erleichtert legte Frau Jestremski den Kugelschreiber beiseite und verlegte sich aufs Beobachten der Sitzungsteilnehmer.
Pastor Gode, Herr Köpf vom DuF und Herr Kisiwani waren ganz bei der Sache. Der stellvertretende Bürgermeister studierte die Architektur des Deckengewölbes. Frau Meyer las in mitgebrachten Unterlagen und Herr Brück in der Zeitung. Brandmeister Kahl lag mehr entspannt in seinem Sessel als er saß und war erkennbar geistesabwesend. Frau Liebetracht machte ihrem Namen alle Ehre und hatte nur Augen für Herrn Kisiwani. Die Herren Müller und Gregor hörten ohne großes Interesse zu.
Raschke genehmigte sich das dritte halbe Brötchen und Schrader wiederum hing aufmerksam an den Lippen des Sokoleiters.
„... und so, Frau Jestremski, ist es unumgänglich, hinsichtlich der angesprochenen Punkte bilateral enger zusammenzuarbeiten, als das bisher der Fall war.“
Frau Jestremski zuckte bei der Erwähnung ihres Namens zusammen. So sehr hatte sie die versammelte Runde studiert, dass ihr der Vortrag des Sokoleiters in seinen Einzelheiten entgangen war. Vorsichtshalber stimmte sie durch Kopfnicken zu und fing sich einen missbilligenden Blick vom Bürgermeister ein.
„Ich denke die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Polizei hat in der Vergangenheit keine Wünsche offen gelassen“, raunte er ihr zu. Sie nickte.
„Ja was denn nun?“ Der Bürgermeister wurde energisch, „hat sie keine Wünsche offen gelassen oder ist sie verbesserungsbedürftig?“
Der Sokoleiter unterbrach seinen Vortrag und schaute irritiert auf den Bürgermeister. Frau Jestremski bekam hektische rote Flecken am Hals und nestelte verlegen an ihrer Handtasche herum, angelte umständlich ein Papiertaschentuch heraus und schnäuzte sich.
„Ich denke, wir sollten uns über die Zusammenarbeit bilateral verständigen“, hatte sie mühsam ihre Fassung wiedergefunden. Der Sokoleiter nickte und führte seinen Vortrag zum Ende. Er hatte die allgemeine Kriminalitätslage kurz skizziert, war auf die Graffiti und die Bettelei eingegangen, hatte die rivalisierenden Jugendgruppen beschrieben und ein Szenario über die zu erwartende Entwicklung aufgezeigt. Abschließend verwies er auf den Umgang mit zu erwartenden Demonstrationen.
Der Bürgermeister bedankte sich für den Vortrag und bat um Stellungnahmen.
„Es war ein wenig dürftig, was Sie über den polizeilichen Umgang mit den rivalisierenden Jugendgruppen erzählt haben. Hier ist doch erkennbar, dass es nicht mehr lange dauert, und es kommt zu Konfrontationen“, mäkelte Pastor Gode und Herr Köpf vom DuF schlug in die gleiche Kerbe.
„Ich vermag überhaupt nicht festzustellen, dass Sie etwas gegen die jugendlichen Nazis unternehmen. Die dürfen ihre Stände ungestraft auf dem Marktplatz aufstellen oder auch vor den Schulen. Und wenn man die Polizei darauf aufmerksam macht, wird nur mit den Schultern gezuckt. Vor einigen Tagen hat ein Polizist nichts unternommen, als ich ihn auf einen rechtsextremen Gewalttäter aufmerksam gemacht habe. Der wird etwa 14 Jahre alt gewesen sein und marschierte mit Hitlergruß durch die Stadt. Als ich ihn zur Rede stellte, brüllte er mich mit Sieg Heil an. Herr Kisiwani, das können Sie doch bestätigen?“
Der so Angesprochene wurde verlegen.
„Na ja, ich habe das nicht gesehen. Aber es kommt bestimmt vor. Meine Freunde und ich haben Angst, wenn wir abends durch die Stadt gehen. Es gibt viele, die sagen 'Ausländer raus', wenn wir vorbeigehen. Und dann gehen wir ganz schnell weiter. Immer in der Gruppe. Alleine geht keiner von uns.“
„Sehen Sie“, ergriff Köpf wieder das Wort, „unsere ausländischen Mitbürger trauen sich nicht mehr alleine auf die Straße. So weit ist es schon gekommen.“
„Nun aber mal langsam. Sie ereifern sich ja richtig“, griff der Vertreter der Bürgerinitiative ein. „Das was da geschildert wurde, ist doch nichts anderes als pubertäres Gehabe von einigen dummen Jungs. Das wächst sich schon aus. Ich finde es zumindest genauso schlimm, wie unsere Stadt durch Müll und Schmierereien verunstaltet wird. Dafür sind ganz andere verantwortlich. Ganz bestimmt nicht die Rechten. Die habe ich heute auf dem Markt beobachtet, als sie die Bierdosen aufsammelten, die so ein bunter Herumtreiber auf den Platz geworfen hatte. Herr Köpf, da haben die Polizisten übrigens auch nicht eingegriffen.“
Bevor sich die Herren Gregor und Köpf in die Haare bekommen konnten, griff der Bürgermeister wieder ein.
„Meine Damen, meine Herren. Wir sind nicht hier, um die Lage zu kommentieren. Wir sind hier, um über Lösungsmöglichkeiten nachzudenken und die Verantwortlichkeit für unser zukünftiges Handeln festzulegen. Soweit das die Verwaltung unserer Stadt betrifft, habe ich das zur Chefsache erklärt. Deshalb bin ich hier. Deshalb sind meine Sachgebietsleiter hier. Sie sind sachverständige Bürger, deren Rat mir wichtig ist. Deshalb sind Sie hier. Wir wollen hier nicht streiten, sondern miteinander reden, und zwar konstruktiv. Ich denke, da sind wir alle einer Meinung oder?“
Allgemeines Kopfnicken war die Reaktion auf die deutlichen Worte.
„Na also. Es geht doch. Um eines möchte ich noch bitten. Es liegt mir viel daran zu erfahren, wie wir ein Problem lösen können. Nicht, wie wir es nicht lösen können.“
Zufrieden lehnte sich der Bürgermeister in seinem Stuhl zurück, als er bemerkte, dass Frau Jestremski seine Worte mitgeschrieben hatte.
Die Diskussion verlief schleppend. Es war für den einen oder anderen nicht leicht, seine verfestigten Vorurteile gegenüber der einen oder anderen Verursacherseite aufzugeben oder seine Vorurteile gegenüber einer Verwaltung oder der Polizei im Sinne der gemeinsamen Sache zurückzunehmen. Jedes der am Konferenztisch versammelten Präventionsratsmitglieder nahm für sich in Anspruch, den Königsweg für die Bekämpfung der Probleme in der Stadt zu kennen.
Raschke und Schrader sahen sich an. Sie hatten sich aus der Diskussion bisher herausgehalten und dem Sokoleiter das Wort überlassen. Beide sahen keinen Grund, durch eigene Wortbeiträge die Sitzung noch zu verlängern. So wie die Sitzung verlief, konnte nichts dabei herauskommen.
Der stellvertretende Bürgermeister schlug vor, die Graffiti sofort durch eine Kolonne vom städtischen Bauhof übermalen oder anderweitig entfernen zu lassen.
Der Bürgermeister verwies bei diesem Vorschlag auf die Kosten und das ohnehin bestehende Haushaltsdefizit. Er lehnte ihn als zu teuer ab. Dafür schlug er vor, auf dem Verordnungswege die betroffenen Bürger zu verpflichten, die Schmierereien binnen 24 Stunden auf eigene Kosten wieder entfernen zu lassen, was erheblichen Protest seines Stellvertreters zur Folge hatte und zudem das Problem von Graffiti in öffentlichen Anlagen nicht löste.
Das Schulamt behauptete, ein Problem mit extremistischen Jugendlichen an den Schulen gebe es nicht, während Herr Köpf behauptete, dass das Skinheadoutfit fast schon als Schuluniform zu bewerten sei. Herr Kisiwani regte an, konsequent rechte Demonstrationen zu verbieten oder die Teilnehmer alle einzusperren. Toleranz gegenüber Ausländern sei besonders wichtig.
Der Sokoleiter hielt dagegen, dass die gesetzlichen Bestimmungen derartiges nicht zuließen.
Herr Köpf war für „Nazis raus“-Aktionen, ohne sagen zu können, wo sie denn hin sollten, und Herr Brück schlug vor, die Jugendlichen durch gelegentliche Abendsportveranstaltungen zusammen mit der Polizeiaktion „Sport statt Gewalt“ von der Straße zu holen. Das regte Frau Meyer vom Schulamt wieder auf, die darauf hinwies, dass die Kinder morgens wieder ausgeschlafen in die Schule müssten.
Endlich unterbrach der Bürgermeister die alles in allem fruchtlos verlaufenen Diskussionen.
„Meine Damen, meine Herren. Das was jetzt passiert ist, habe ich befürchtet. So kommen wir nicht weiter. Ich rege an, dass wir bis zur nächsten Sitzung in zwei Monaten in Arbeitsgruppen versuchen, Lösungskonzepte schriftlich zu fixieren und dann miteinander vergleichen, um so zu einem umsetzbaren Ergebnis zu kommen. Herr Pastor, wenn ich Sie bitten dürfte, die Leitung der einen Gruppe zu übernehmen und Herr Gregor die zweite. Einverstanden?“
Pastor Gode bestätigte seine „Ernennung“, während Herr Gregor ablehnte
„Es tut mir schrecklich leid, aber dazu lässt mir meine Arbeit keine Zeit. Vielleicht könnte Herr Köpf das machen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich sein Verein bereits mit Konzepten und deren Vernetzung beschäftigt.“
Der Bürgermeister verzog leicht die Mundwinkel.
„Nun ja Herr Köpf, wären sie willens und in der Lage?“
Der Vertreter des Demokratie- und Freundschaftsvereins zeigte sich erfreut über den Vorschlag.
„Selbstverständlich werde ich der Bitte nachkommen“, beeilte er sich zu versichern.
Der Bürgermeister bedankte sich bei der Runde und bat die Arbeitsgruppenleiter, ihre Gruppenmitglieder nach der Sitzung selbst zusammenzustellen, wobei er den Sokoleiter darum bat, die Polizei in beiden Gruppen tätig werden zu lassen.
Der Sokoleiter sagte die Unterstützung durch die Polizei zu, wollte aber hierzu noch die Zustimmung seines Vorgesetzten einholen.
Im Adlerhorst
Während im Rathaus der Kommunale Präventionsrat tagte und sich über Maßnahmen die Köpfe heiß diskutierte, hatte Dolph die Angehörigen seiner Kameradschaft ebenfalls zu einer Lagebesprechung in den Kameradschaftsraum in einer leer stehenden Baracke auf dem stillgelegten Fabrikgelände im Süden der Stadt befohlen.
Zwei Kameraden wurden als Wache in der Nähe des Fabriktores eingeteilt und beauftragt, über Handy sofort jeden ungebetenen Besucher anzumelden.
Zwanzig Gleichgesinnte hatten sich eingefunden und auf den harten ehemaligen Kantinenstühlen Platz genommen, die Dolph beim Durchsuchen der leeren Fabrikräume gefunden und in der Baracke zusammengetragen hatte.
Er selbst saß mit seinen zwei Adjutanten vor der versammelten Truppe und musterte die Anwesenden. Schließlich, nachdem er sicher war, dass niemand mehr erschien, stand er auf, nahm seine Lieblingshaltung ein, indem er sich mit beiden Fäusten auf der Tischplatte abstützte und mit vorgestrecktem Kinn herausfordernd in die Runde blickte.
„Kamerrraden“, begann er seine Ansprache und rollte dabei das „r“ so betont, wie er es neulich in einem alten Wochenschaufilm bei einer Parteitagsrede von Adolf Hitler gehört hatte.
„Kamerrraden. Ich habe euch heute in unseren Adlerhorst bestellt, um euch eine Lageinformation über unsere Informationsveranstaltung auf dem Marktplatz zu geben, die Konsequenzen für unser weiteres Vorgehen vorzustellen und die Auftrrräge an Euch zu verteilen. Nur geschlossenes Handeln unter einheitlicher Führung bei strrrikter Umsetzung der Befehle versprrricht Erfolg. Dabei lassen wir uns auch nicht durch kleine verlorrrene Gefechte verunsichern. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Wichtig ist nicht das einzelne Gefecht. Wichtig ist die gewonnene Schlacht.“
Mit Wohlwollen registrierte Dolph das zustimmende Nicken in der Runde. Die Kameraden, die ihn mit großen Augen ansahen und an seinen Lippen hingen, waren fast alle zwischen 15 und 20 Jahre alt.
Zwei Babyskins, den Namen hörte er nicht gerne und bezeichnete sie lieber als Jungvolk, waren erst geschätzte elf oder zwölf Jahre alt.
„Heute war ich mit vier Kamerrraden auf dem Markt und habe unsere Forderungen den Bürgern unserer Stadt vorgestellt.“