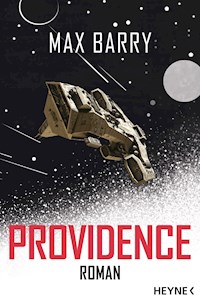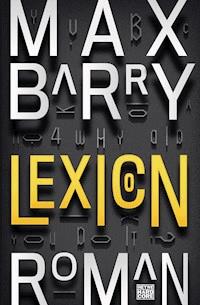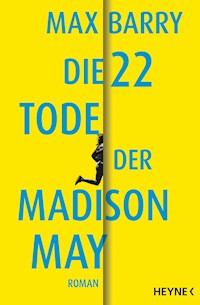
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Am grausamen Mord an Madison May scheint auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches: Die Immobilienmaklerin wird offenbar von einem potenziellen Kunden niedergestochen. Der Täter, der sich keine Mühe gegeben hat, seine Identität zu verbergen, scheint einem Kult anzugehören. Als Journalistin Felicity dem Mann zufällig in der U-Bahn begegnet, nimmt sie die Verfolgung auf. Es kommt zum Handgemenge, sie wird aufs Gleis gestoßen, der herannahende Zug kann gerade noch bremsen. Der Verdächtige ist spurlos verschwunden – ebenso wie Felicitys Katze. Ihre Kollegen können sich beim besten Willen nicht mehr an Madison May erinnern, und ihr langjähriger Freund hat plötzlich neue Hobbies, denen er angeblich schon seit Jahren nachgeht. Langsam wird Felicity klar, dass sie nicht mehr im selben New York ist, sondern in einer Parallelwelt – in der die junge Schauspielerin Madison May in tödlicher Gefahr schwebt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Ähnliche
Das Buch
Die Reporterin Felicity Staples hatte schon bessere Tage: Erst muss sie über den brutalen Mord an der jungen Immobilienmaklerin Madison May berichten, die von einem Kunden niedergestochen wurde. Dann trifft sie den Täter, der sich keine Mühe gegeben hat, seine Identität zu verbergen, in der U-Bahn. Doch er wird auf Felicity aufmerksam und versucht zu fliehen. Sie stellt den Mann und wird aufs Gleis gestoßen – direkt vor einen Zug, der gerade noch bremsen kann. Als Felicity dann nach Hause kommt, ist eine ihrer Katzen spurlos verschwunden. Ihr langjähriger Freund, der plötzlich neue Hobbys hat, denen er angeblich schon seit Jahren nachgeht, schwört, dass sie nur eine Katze hatten. Und ihre Kollegen in der Redaktion können sich nicht mehr an den Mord an Madison May erinnern. Felicity wird klar, dass sie nicht mehr im selben New York ist, sondern in einer Parallelwelt – in der die junge Schauspielerin Madison May in tödlicher Gefahr schwebt …
Der Autor
Max Barry, geboren am 18. März 1973, verbrachte seine besten Jahre bei Hewlett-Packard, bevor er seine Festanstellung gegen das Schreiben von Romanen eintauschte. Mit Logoland, einer beißenden Satire über eine von Großkonzernen beherrschte Zukunft, feierte er seinen ersten großen internationalen Erfolg. Darüber hinaus entwickelte er das Onlinespiel NationStates und arbeitete an unterschiedlichen Software-Projekten mit. Max Barry lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Melbourne, Australien. Zuletzt ist bei Heyne sein Roman Providence erschienen.
Mehr über Max Barry und seine Werke erfahren Sie auf:
MAX BARRY
DIE22 TODE DER MADISON MAY
Roman
Aus dem Englischen von Bernhard Kempen
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:THE 22 MURDERS OF MADISON MAYDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 03/2023
Redaktion: Ralf Dürr
Copyright © 2021 by Max Barry
Copyright © 2023 dieser Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München nach einem Originalentwurf von Tal Goretsky
Coverbild: Plainpicture/Deepol by plainpicture
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-29444-1V001
www.diezukunft.de
Für Finlay & Matilda
1
Sie hielt am Straßenrand und schaute durch das Autofenster zu dem Haus, das sie verkaufen sollte. Der Briefkasten lag in Einzelteilen auf dem Rasen, als hätte ihn jemand mit einem Baseballschläger bearbeitet. »O Mann!«, sagte Maddie. Das Haus war eine Bruchbude. Der Briefkasten war noch das Beste daran gewesen.
Sie nahm ihre Handtasche vom Beifahrersitz, stieg aus und zog ihr Kleid herunter. Es war über dreißig Grad warm und schwül. Das beste Stück an ihrem Haus war über den Boden verstreut worden. Aber sie hatte ihre Turnschuhe dabei, was bedeutete, dass sie das nicht in High Heels erledigen musste. Sie brachte die Bruchstücke des Briefkastens hinter das Haus und warf sie neben einen Haufen aus altem Holz und einem kaputten Fußball. Während sie den kleinen Rasen von den Resten säuberte, bemerkte sie zwei Jungen von etwa vierzehn Jahren, die vor dem Zaun auf Fahrrädern herumlungerten. Sie richtete sich auf und winkte ihnen zu.
»Bück dich noch mal!«, rief einer der beiden. Der andere lachte.
Sie ging ins Haus. Drinnen war es dunkel und eng. Hier herrschte ein muffiger, unverkennbarer Großmuttergeruch nach Vernachlässigung. Aber sie sollte es verkaufen, also zog sie die Vorhänge auf, spülte das Waschbecken aus und öffnete die Hintertür. An strategischen Positionen stellte sie Kerzen auf, im Flur, im Schlafzimmer und in einem seltsamen L-förmigen Raum, den sie als Arbeitszimmer zu bezeichnen beschloss. Es waren ihre speziellen Kerzen, die sie durch eine Onlinesuche nach Gestank kaschieren gefunden hatte. Sie blickte auf ihre Uhr. Die Kerzen waren gut, aber für Notfälle hatte sie eine weitere Geheimwaffe dabei, eine Sprühdose, auf der Wie Kekse stand. Das roch nicht so überzeugend wie die Kerzen, sondern eher nach Wie verbrannter Staub, aber es wirkte schneller. Sie ging durch alle Zimmer und besprühte sie in wohldosierten Schüben.
Sie starrte auf einen dunklen Fleck in einer Ecke des Wohnzimmers, als ein Auto in die rissige Betonauffahrt einbog. »Mist«, sagte sie. Rasch zog sie die Turnschuhe aus, stopfte sie in ihre Tasche und zwängte die Füße in die High Heels. Sie wischte über ihr Handy und wählte die Playlist Verkaufsmusik, hauptsächlich Klavier und wogende Streichinstrumente mit ein paar Bläsern. Stilvoll und gleichzeitig motivierend. Die Autotür knallte. Sie benutzte ihren Handspiegel, um sich zu vergewissern, dass nichts Furchtbares mit ihrem Gesicht passiert war, und konzentrierte sich dann darauf, die Vordertür zu erreichen, ohne mit einem Absatz zwischen die Dielenbretter zu geraten.
Der Interessent kam die Betontreppe vor dem Haus herauf, nahm seine Sonnenbrille ab und reckte den Hals, um etwas zu betrachten, das weiter oben war. Die Regenrinne, vermutete sie. Eigentlich war sie kaum noch irgendwo befestigt. Maddie hatte sich vorgenommen, etwas dagegen zu tun.
»Hallo!«, sagte sie und lächelte. Bsss. Üblicherweise hieß es Lage, Lage, Lage, aber bei Henshaw Realty war es Zähne, Titten, Haar, zumindest wenn es nach Maddies Mentorin Susie ging, die seit dreißig Jahren Häuser verkaufte und vermutlich wusste, wovon sie redete. Bsss: Kopf hoch, Zähne raus, Schultern zurück, den Kopf leicht geneigt, damit das Haar zur Seite fiel. Ihr Haar war lang und rötlich, fast kastanienbraun, und sie hatte sich bislang geweigert, es zu blondieren. »Ich bin Maddie!«, sagte sie. »Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.«
Der Interessent schüttelte ihr die Hand. Er war etwa in ihrem Alter, Anfang zwanzig, mit Grübchen, etwas mager, aber irgendwie süß. Trotz der Hitze trug er ein langärmliges Kragenhemd über einer Chinohose. »Ich bin Clay«, sagte er. »Wow, Sie sind aber groß!«
»Das sind nur die Schuhe.«
Er senkte den Blick, und sie nutzte die Gelegenheit, ein Bein auszustellen und ein wenig zu posieren. Als er ihr wieder in die Augen schaute, machte sie Bsss.
»Sie sind wirklich hübsch«, sagte er.
Sie lachte und drehte sich um, damit er ihr in den Flur folgen konnte. Zu viel Bsss. Sie musste es abschwächen. »Sie haben Glück«, rief sie ihm über die Schulter zu, als sie in die Küche und den chemischen Dunst aus Keksen oder verbranntem Staub traten. »Für dieses Haus hatten wir sehr viele Anrufe. Sie sind der Erste, der es sieht.« Lügen. Schlimme Lügen.
»Wirklich?« Er hatte buschige Augenbrauen. Sein Haar war ein wenig struppig, eigentlich nicht so ihr Ding, aber ihr gefiel die Andeutung, dass er seinen eigenen Stil hatte. Dass er seinen eigenen Weg ging. Dass er sich möglicherweise auf ein heruntergekommenes, unrenoviertes Holzhaus aus den 1960ern mit zwei Schlafzimmern in Jamaica in Queens einließ.
Sie griff nach ihrem Handy, aus dem Klavierklänge klimperten. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich Sie fotografiere?«
»Wozu?«
»Aus Sicherheitsgründen.«
Er wirkte verwirrt.
»Es ist idiotisch, aber wir treffen uns allein mit anderen Leuten, also erwartet man von uns, dass wir …«
»Oh, natürlich. Ich verstehe.«
Sie hob das Handy. Er richtete sich auf und lächelte, machte selbst ein wenig Bsss. Er war ein wenig ungelenk. Unter den Grübchen und dem struppigen Haar spürte sie einen Mann, der sich unter Menschen nicht ganz wohlfühlte.
Sie knipste ihn. »Erledigt«, sagte sie. »Das geht an unser Büro.« Wo man seine Daten aufgenommen hatte, als er den Termin vereinbart hatte. Er war Clayton Hors aus Ulysses in Pennsylvania und lebte derzeit bei seinen Eltern, nachdem er das Studium an der Carnegie Mellon University abgebrochen hatte. Jetzt wollte er mit einem Umzug in die Stadt ein neues Leben beginnen, vermutlich auf Drängen seiner Eltern, konnte sich Maddie denken. Sie legte das Handy weg. »Danke.«
»Kein Problem. Hier treiben sich ein paar üble Leute herum. Man sollte Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.«
»Ich kann auch Jiu-Jitsu.« Was nicht stimmte. »Also«, sagte sie, »dieses Fenster gefällt mir sehr. Es lässt viel Licht herein.«
Er nickte. »Wie lange verkaufen Sie schon Häuser?«
»Seit etwa einem Jahr.« Er schaute gar nicht zum Fenster. Obwohl das vielleicht gut so war, denn hinter dem Haus gab es nur kniehohes Unkraut und einen langsam vermodernden Schuppen.
»Ist das Immobiliengeschäft« – er suchte nach Worten – »Ihr langfristiges Berufsziel?«
»Oh, ich liebe Häuser.« Streng genommen die Wahrheit. Häuser liebte sie wirklich. Immobiliengeschäfte, bei denen es, wie sich herausgestellt hatte, überwiegend darum ging, Leute zu Entscheidungen zu drängen, mochte sie nicht so sehr. In letzter Zeit hatte sie sich gefragt, ob sie vielleicht die falsche Berufslaufbahn eingeschlagen hatte. Lange Zeit hatte sie davon geträumt, Schauspielerin zu werden. Natürlich hatte sie es nie ernsthaft verfolgt, weil es so unpraktisch war, als würde man sagen, dass man Astronaut werden wollte. Aber wenn sie immer noch darüber nachdachte, hatte es dann vielleicht etwas zu bedeuten? Dass sie mutiger hätte sein sollen?
»Lieben Sie auch dieses Haus?«, fragte er und blickte auf die schiefen Schränke und die fleckigen Vorhänge.
»Jedes Haus hat etwas Liebenswertes. Man muss nur darauf achten.«
Er lächelte. Ein aufrichtiges Lächeln. Jetzt war er warm geworden. »Das ist gut für Sie.« Er ging ins Wohnzimmer hinüber, und sie folgte ihm. »Obwohl es mich etwas überrascht, dass Sie keine Schauspielerin sind.«
Sie blieb verdutzt stehen.
Er drehte sich zu ihr um. »Tut mir leid. Manchmal rutscht mir einfach raus, was ich denke. Ist es in Ordnung, wenn ich mich allein umschaue? Ich melde mich, wenn ich Fragen habe.«
»Klar«, sagte sie, als sie sich gefasst hatte. »Toben Sie sich aus.«
Er entfernte sich. Sie betrachtete eine Schranktür, die nur noch an einem Scharnier hing, und überlegte, ob sie den Schaden reparieren könnte. Susie, ihre Mentorin, würde sagen: Maddie, lass es. Das Haus ist eine Bruchbude. Daran kannst du nichts ändern. Wenn du versuchst, es aufzuhübschen, werden alle Käufer sofort sehen, dass du sie belügst. Das stimmte vermutlich, dachte sich Maddie. Aber hier ging es eigentlich gar nicht um die möglichen Käufer. Es störte sie ganz persönlich, wenn sie sah, dass etwas repariert werden musste, und sie es nicht reparierte.
Der Wie-Kekse-Duft ließ bereits nach, also ging sie durch das Haus, um die Sprühdose noch ein paarmal taktisch einzusetzen. Als sie durch die Küche kam, schaute sie auf ihr Handy, weil sie einen Freund hatte, Trent, der ihr Bescheid geben wollte, ob er heute Abend zu Hause sein oder mit Freunden ausgehen würde. Nichts.
Clay tauchte im Türrahmen auf. »Ich werde mir nur schnell etwas aus dem Auto holen.«
»Klar«, sagte sie.
Er hatte sich die Ärmel hochgeschoben. Am rechten Unterarm hatte er eine Verfärbung, einen Fleck in Blau, Rot und Gelb, eine Mischung aus allem, wie eine Verletzung, die nicht richtig verheilt war.
Er bemerkte ihren Blick. »Ich habe eine Hündin. Ab und zu dreht sie ein bisschen durch.«
»Oh«, sagte sie. Was machte sie da? Sie starrte wie eine Idiotin. »Tut mir leid.«
»Sie hat ein gutes Herz. Aber manchmal vergisst sie es. Ich bin gleich zurück.«
Er verschwand. Sie ärgerte sich über sich selbst. Sie ging ins Wohnzimmer und beobachtete, wie er den Kofferraum seines Autos öffnete. Ein netter Wagen, ein neuer schwarzer Chevrolet SUV. Mit dem Aufkleber einer Mietwagenfirma, also konnte sie keine Rückschlüsse auf seine finanzielle Situation ziehen. Sie ging wieder in die Küche und zu ihrem musikalischen Handy.
Er stapfte ins Haus zurück. Nach ein paar Minuten rief sie: »Alles in Ordnung?«
Es kam keine Antwort, also legte sie ihr Handy weg und machte sich auf die Suche nach ihm. Er war nicht im Flur, auch nicht in der Waschküche – »Waschküche« in Anführungszeichen –, ein kleines Zimmerchen voll Rost- und Wasserflecken. Er war auch nicht im Raum, den sie als zweites Schlafzimmer bezeichnete, obwohl sich dort nur ein Bett unterbringen ließ, wenn man es senkrecht aufstellte. Der Flur verlief mitten durch das Haus, vielleicht umkreisten sie sich gegenseitig. Aber in diesem Fall würde er sich sehr leise verhalten. Sie glaubte nicht, dass man sich in diesem Haus bewegen konnte, ohne Geräusche zu machen, sofern man es nicht bewusst zu vermeiden versuchte.
Als sie in das Hauptschlafzimmer trat, sah sie, dass die Vorhänge geschlossen waren. Die hatte sie vorher definitiv aufgezogen. Sie tastete nach dem Lichtschalter, aber hier gab es natürlich keinen Strom. Er war schon vor Monaten abgestellt worden. Im Dämmerlicht konnte sie etwas Silbriges auf dem Teppich erkennen, eine Art Koffer oder vielleicht ein Werkzeugkasten. Der Deckel war aufgeklappt, aber nicht in ihre Richtung, sodass sie nicht sehen konnte, was sich darin befand.
Ihr Handy in der Küche verstummte.
Sie drehte sich um. »Hallo?«
Die Vordertür war drei Meter rechts von ihr. Sie stand offen. Draußen war heller klarer Tag. Betonweg, niedriger Maschendrahtzaun. Die Straße war eine Sackgasse, was in New York recht selten war, ein wahres Juwel in der Pappkrone dieses Hauses. Also gab es hier keinen Durchgangsverkehr, aber sie konnte rufende Kinder hören, wahrscheinlich die beiden, die bei ihrer Ankunft vor dem Haus gewesen waren.
Clays Foto hatte sie an ihr Büro geschickt. Sie hatten seine Daten, die bestätigt worden waren, bevor sie hierhergefahren war. Clay wusste das. Sie hatte die Sicherheitsvorkehrungen auf ihrer Seite.
Sie ging zur Küche.
Dort war er nicht. Ihr Handy auch nicht. Das war nicht so cool. »Hallo?«, wiederholte sie etwas aggressiver. »Kann ich Ihnen helfen?«
Die Geräusche von draußen ließen nach, bis sie in einer abgeschotteten Blase aus Stille dastand. Die Vordertür war geschlossen worden, bemerkte sie.
Der Wind. Du hast alle Türen geöffnet, und der Durchzug kann kräftig sein, er kann einfach hindurchrauschen und eine Tür zuschlagen …
Nur dass die Hintertür nicht mehr offen war. Jetzt war keine Tür mehr offen. Und keine war zugeschlagen. Sie hatten sich so leise geschlossen, dass sie kein Klicken gehört hatte.
Und kein Durchzug hatte ihr Handy fortgeweht.
Sie rief: »Clay, mein Büro hat Ihre Daten. Meine Leute wissen, wer Sie sind.«
Sie stand in einer leeren Küche. Die Schubladen waren leer, keine Messer, nichts anderes, das sich als Waffe benutzen ließ. Aber da draußen waren diese Kinder. Das Haus hatte Holzwände. Wenn sie schrie, würde man sie hören.
Sie bückte sich und zog ihre High Heels aus. Was auch immer als Nächstes geschah, sie wollte es nicht auf hohen Absätzen erleben.
»Tut mir leid.« Seine Stimme wehte zu ihr herüber. »Tut mir leid, Madison. Ich bin hier.«
Sie blieb, wo sie war. »Haben Sie mein Handy?«
»Tut mir leid, ich habe es nur für einen Moment gebraucht.«
»Warum haben Sie mein Handy?«
Stille.
Sie öffnete den Mund, um die Frage zu wiederholen. Er tauchte im Durchgang zum Wohnzimmer auf. Sie spannte sich an. Die Hintertür könnte sie in etwa drei Sekunden erreichen. Wäre sie zugesperrt? Würde sie klemmen? Wenn ja, würde er sie erwischen, bevor sie nach draußen gelangen konnte.
»Es tut mir wirklich superleid. Ich wollte Ihnen keine Angst einjagen.« Er hatte die Hände gehoben, um seine völlige Gefahrlosigkeit zu demonstrieren. Aber er bewegte sich auf sie zu, ein langsamer Schritt nach dem anderen, was ihr gar nicht gefiel. Sie konnte diese Verfärbung an seinem Unterarm sehen, die Hundebisse, die nicht verheilt waren. Eine Kombination aus alten und neuen Wunden, wurde ihr plötzlich klar. Er war immer wieder gebissen worden. Von dieser Hündin, die ihm angeblich gehörte, die ein gutes Herz hatte, es aber manchmal vergaß.
»Könnten Sie stehen bleiben?«, sagte sie. »Ich bekomme wirklich Angst.«
Er blieb stehen. »Es tut mir sehr leid, dass ich so etwas tue. Ich weiß, wie es aussieht. Aber die Zeit drängt.«
»Könnte ich mein Handy wiederhaben?«
Sein Gesicht nahm einen gequälten Ausdruck an. »Bedauerlicherweise nicht.«
»Warum nicht?«
»Madison, Sie müssen mir vertrauen. Ich will Ihnen nicht wehtun. Ich bin Ihretwegen hier.« Er bewegte sich wieder auf sie zu.
»Stopp! Ich möchte, dass Sie dieses Haus verlassen.«
»Das kann ich nicht. Tut mir leid. Sie müssen ins Schlafzimmer gehen.«
Das Schlafzimmer. Wo die Vorhänge zugezogen waren. Wo ein silbriger Kasten falsch herum im Zwielicht stand. Sie würde nicht ins Schlafzimmer gehen.
Mit einer Hand strich er sich durchs Haar. »Es läuft nicht so gut. Tut mir leid. Ich habe keine Zeit für Erklärungen.«
Sie machte einen halben Schritt nach rechts, verlagerte nur ihr Gewicht, und er beugte sich in dieselbe Richtung. Er war bereit, sie zu jagen, erkannte sie. Falls sie wegrannte. Falls sie versuchte zu schreien.
»Bitte«, sagte er. »Bitte kommen Sie einfach mit ins Schlafzimmer.«
Nun wurde sie zur Schauspielerin. Nicht auf die Weise, wie sie es sich früher vorgestellt hatte, nicht für eine Bühne oder eine Kamera, sondern auf die alltägliche Weise, wie sie es bei Treffen mit Klienten oder Interessenten machte, wenn sie für einige Zeit in einer etwas anderen Rolle auftreten musste. Für die Leute war sie eine lebhafte, gesprächige Maddie, die sehr an allem interessiert war, was man zu sagen hatte, ganz gleich, wie lange man brauchte, um es zu sagen. Für Clay würde sie eine Person sein, die nicht gejagt werden musste. Sie würde so vollständig diese Person sein, wie sie konnte, bis sie die Gelegenheit erkannte, zu einer Person zu werden, die um ihr Leben rannte.
Sie nickte.
Er atmete aus. »Danke. Vielen Dank.« Mit einer Geste deutete er an, dass sie an ihm vorbeigehen sollte. Aber das war ein wenig zu viel verlangt, selbst für eine Person, die nicht gejagt werden musste. Sie zögerte. Er nickte und wich zurück, machte ihr Platz. Das war gut. Sie bauten gegenseitiges Vertrauen auf. Er machte Zugeständnisse, die sie ausnutzen konnte.
Doch im Flur stand er mit dem Rücken zur Tür. Er zeigte zum dunklen Schlafzimmer, und sie starrte in sein Gesicht, ohne darin eine andere Option zu erkennen. »Madison«, sagte er und drückte die Hände wie im Gebet zusammen. »Ich verspreche, dass Sie mir vertrauen können.«
Sie schreit. Draußen hören es die Kinder. Ihre Köpfe fahren gleichzeitig herum. Ein paar Augenblicke vergehen. Dann zucken sie mit den Schultern und kehren zu ihren Fahrrädern zurück. Es ist eine üble Gegend, manchmal hört man hier Schreie.
Nein. So nicht. Sie würde nicht schreien.
Aber sie konnte sich nicht dazu überwinden, in diesen Raum zu treten. »Warum?«, fragte sie, obwohl es keinen Sinn hatte. Er war ihr nahe genug, um sie zu packen, wenn er es wollte.
»Ich möchte nur reden. Ich schwöre.«
Sie war verängstigt und sah vielleicht nur das, worauf sie hoffte, aber in seinem Gesicht erkannte sie Aufrichtigkeit. Durch die Schauspielerei hatte sie eine recht gute Menschenkenntnis. Man lernte, wie bestimmte Emotionen aussahen, welche Teile des Gesichts sich bewegten, wenn jemand neidisch oder mitfühlend oder wütend war. Oder wenn jemand log.
Sie ging ins Schlafzimmer. Clay schloss hinter ihnen die Tür. Ein dünner Lichtspalt drang durch die Vorhänge und fiel quer über den Teppich. Der silbrige Kasten stand im Schatten, das Maul zur gegenüberliegenden Wand geöffnet.
Er ging zum Vorhang, schob ihn zwei Fingerbreit auf und lugte hinaus. Wonach hielt er Ausschau? Nach Leuten, vermutete sie. Er vergewisserte sich, dass niemand in der Nähe war. Sie griff nach hinten, suchte die Türklinke. Sie war nur zwei geschlossene Türen von der Freiheit entfernt. Sie müsste nur diese Tür öffnen, hinausstürmen, sie zuwerfen – was sehr wichtig war! –, damit sie sich wieder schloss und Clay sich mit der Türklinke beschäftigen musste. In der Zwischenzeit könnte sie die Vordertür aufreißen, und dann wäre sie draußen, würde rennen, und ja, es war eine üble Gegend, eine schreckliche Gegend, wo es durchaus möglich war, dass niemand kam, um ihr zu helfen, ganz gleich, wie viel Lärm sie machte, aber das war ihre beste Option, fand sie. Das war viel, viel besser, als zu bleiben und herauszufinden, was in diesem Kasten war.
Clay ließ den Vorhang wieder zufallen. Sie legte ihre Hand an den Rücken, bevor er sie sehen konnte. Niemand griff nach dieser Türklinke. Ganz und gar nicht. Hier war niemand, der gejagt werden musste.
»Ich glaube, wir haben ein paar Minuten Zeit«, sagte Clay. »Ich kann Ihnen sagen, was los ist. Aber es wird nicht einfach für Sie, es sich anzuhören. Wir beide müssen uns gegenseitig eine Chance geben. Okay?«
Sie nickte.
»Können Sie mir diese Chance geben?«
»Ja«, sagte sie, obwohl es ihr nicht gefiel, wie er sie zu einer Bestätigung drängte.
»Wie Sie sagten, Ihr Büro weiß, wer ich bin. Dort hat man meinen Namen, mein Foto.« Er hob die Hände. »Ich habe überall Fingerabdrücke hinterlassen. Richtig?«
Sie nickte. Ja! Das waren sehr gute Argumente. Sie alle konnten sich darauf einigen, dass es verrückt wäre, wenn Clay irgendetwas versuchen würde. Es gab Sicherheitsvorkehrungen. Ja.
»Also können Sie sich entspannen.«
»Gut«, sagte sie. Doch sie war nicht entspannt. Diese Situation war noch weit von dem Punkt entfernt, an dem sie sich entspannen würde. Aber sie war entgegenkommend.
Er rieb sich die Hände, eine nervöse Geste. Er stand immer noch neben den Vorhängen. Es war nicht völlig unmöglich, dass sie durch die Tür entkam, bevor er sie davon abhalten konnte. »Ich sage es dir einfach. Madison, ich bin nicht von dieser Welt.«
O Gott, dachte sie.
Er kam auf sie zu. Zuerst glaubte sie, dass er ihre Hände nehmen wollte, und das rüttelte sie wach, denn für einen Moment war sie von der Absurdität seiner Worte verwirrt. Ich bin nicht von dieser Welt – was bedeutete das eigentlich genau, auf welche Weise? Aber nun wurde es ihr klar. Auf die verrückte Weise.
Das Foto im Büro spielte keine Rolle. Die Fingerabdrücke spielten keine Rolle. Er glaubte, dass er aus einer anderen Welt kam.
»Ich bin deinetwegen hierhergereist. Nur für dich, Madison.« Er zögerte. »Wie stehst du dazu?«
Sie hatte das Gefühl, dass sie sich vor Angst übergeben musste. Aber sie sagte: »Ich … bin verwirrt.« Ihr Tonfall war gleichmäßig, fast neugierig, und das war gut. Das war genau das, was sie wollte.
Er blickte wieder zum Vorhang. Wenn er das nächste Mal zum Fenster ging, wäre sie weg. Sie hätte schon beim ersten Mal abhauen sollen. »Natürlich bist du das. Und verängstigt, wette ich. Aber du kannst mir vertrauen.«
Seine Miene war zerknirscht, und da war es wieder, dieses merkwürdige Beharren darauf, dass sie einwilligte, obwohl er die ganze Macht hatte. Vielleicht war das etwas, das sie benutzen konnte. Aus irgendeinem Grund war es ihm wichtig, was sie dachte, und wenn sie klug war, wenn sie nicht zu sehr drängte, fand sie vielleicht eine Möglichkeit, das gegen ihn zu verwenden. Wir beide müssen uns gegenseitig eine Chance geben, hatte er gesagt. Vielleicht konnte sie ihn dazu bringen, dass er ihr eine Chance gab.
»Ich … habe das Gefühl, dass ich dir vertrauen kann«, sagte sie. »Auch wenn ich nicht weiß, warum.«
Seine Reaktion fiel größer aus, als sie erwartet hatte. Seine ausdrucksstarken Augenbrauen schossen nach oben und sein Mund klappte auf. »Wirklich?«
»Ja«, sagte sie und musste sich anstrengen. »Ich habe es bei unserer ersten Begegnung gespürt. Vielleicht erinnerst du mich an jemanden, den ich kenne?« Keine Reaktion. Der Schlag ging daneben. Aber er wartete mit gespanntem Gesichtsausdruck und bot ihr einen weiteren Versuch an. »Oder … vielleicht haben wir uns schon einmal getroffen.«
Zack. Ein Volltreffer. Seine Miene hellte sich auf. »Was glaubst du, wann wir uns getroffen haben?«
Verdammt. »Ich weiß es nicht. Es ist nur ein Gefühl.«
»Wann?«, hakte er nach.
»Am College? An der Highschool?« Aber das war schlecht geraten, erkannte sie. Nicht einmal annähernd. Dann tat sie etwas sehr Mutiges und ging einen Schritt auf ihn zu, also weg von der Tür. Eine kleine Investition in die Hoffnung auf eine künftige Rendite. »Oder etwas Tieferes. Etwas Spirituelles.«
Er atmete zitternd aus. »Du hast recht. Wir sind uns schon einmal begegnet. Aber nicht in dieser Welt.«
Sie nickte. Ja, natürlich, das dürfte es sein.
»All das …« Er deutete auf … den Raum, die Vorhänge? Nein, natürlich auf die Welt. »Es ist nur ein Tropfen im Ozean. Es gibt noch mehr Welten. Mehr, als jemand zählen kann. Sie sehen genauso aus, sind es aber nicht, wenn man aufmerksam ist. Und du bist in allen diesen Welten. Überall, wohin ich komme, tust du andere Dinge. Jedes Mal, wenn ich gehe, tue ich es, um dich wiederzufinden.«
Er starrte sie an. Sie fühlte sich verpflichtet, eine Frage zu stellen. Er hatte ihr gerade erklärt, dass es eine Menge von Welten gab. Natürlich, klar. Sie hätte Fragen, wenn sie das ernst nehmen würde, wenn sich der größte Teil ihres Gehirns nicht damit beschäftigen würde, wo sich der Türgriff befand. Sie fragte: »Warum?« Er antwortete nicht, und sie überlegte, ob das vielleicht eine schlechte Frage war, aber nein, das war es nicht. Er wollte nur, dass sie von selbst auf die Antwort kam.
»In diesen … anderen Welten … sind wir da … sind wir da zusammen?«
Er lächelte betrübt und schüttelte den Kopf. Aber das war die richtige Antwort, dachte sie. Das hatte er von ihr hören wollen. »Manchmal komme ich gar nicht dazu, dich zu treffen. Manchmal treffe ich dich, aber dann klappt es nicht. Es gibt Leute, die uns auf Abstand halten wollen. Leute, die sich bewegen, so wie ich.« Er blickte wieder zu den Vorhängen. »Sie kommen näher.«
Das interessierte sie, die Leute, die sie auf Abstand halten wollten. Jetzt wollte sie diese Leute treffen, falls das überhaupt machbar war. »Warum wollen sie uns auf Abstand halten?«
»Das ist kompliziert. Ich werde es unterwegs erklären.«
Unterwegs. Für einen langen Augenblick versuchte sie, sich vorzustellen, was in aller Welt das bedeuten mochte, doch es gelang ihr nicht. Dann kam es ihr in den Sinn: Sein Kasten war ein Portal. Darin befanden sich eine Autobatterie oder ein totes Opossum, und er war davon überzeugt, dass es ein transdimensionales Reisegerät war. Am Ende würde er ihre Hände halten und sie auffordern, die Augen zu schließen. Und dann: Kawumm! Und sie wären in einer anderen Welt. Die genauso aussehen würde, wie er gesagt hatte. Also gäbe es praktischerweise keinen Beweis, dass sie irgendwohin gereist waren. Aber das war völlig in Ordnung, wurde Maddie klar, denn danach würde er das Haus verlassen wollen, und dann konnte sie wegrennen.
»Unterwegs wohin?«, fragte sie und riss die Augen auf, als wollte sie sagen: Interdimensionale Reisen, wie aufregend!
»Ich habe ein Hotelzimmer«, sagte er.
Aha.
Es hieß, dass man sich niemals an einen anderen Ort bringen lassen sollte. Dort würde man dann ermordet. Aber sie musste aus diesem Haus verschwinden. Sie würde mit ihm gehen, aber nicht in sein Auto steigen. »Also gut«, sagte sie.
Er lächelte. »Ich kann immer noch nicht glauben, dass du mich wiedererkannt hast. Das passiert sonst nie.«
Sie lächelte zurück.
»Ich meine, niemals«, sagte er.
Sie spürte eine eisige Berührung in der Kehle. Ihr Lächeln schien mit ihrem Gesicht verschweißt zu sein.
»Weißt du, ich liebe dich, Madison. In jeder Welt. Auch wenn du meine Liebe nicht erwiderst.«
»Wir sollten gehen«, sagte sie, »bevor diese Leute eintreffen.«
»Darf ich dich etwas fragen?«
Sie nickte stumm.
»Darf ich dich umarmen?«
Sie sagte nichts.
»Es ist nur … weil es so lange her ist. Es bringt mich um, dir so nahe zu sein und dich nicht zu berühren.« Er breitete die Arme aus.
Sie schreckte vor dieser Idee zurück. Sie könnte ihn wegstoßen, dachte sie. Er stand vor dem silbrigen Ding, sie könnte sich ihm nähern und ihn dann über den Kasten schubsen.
Langsam ging sie auf ihn zu. Sie wusste nicht, ob sie ihn wirklich schubsen könnte. In der Theorie klang es gut, aber Kerle waren immer ein wenig schneller und kräftiger, als man erwartete. Oft dachte man nicht darüber nach, aber gelegentlich gab es Situationen, bei einem gemischten Basketballspiel oder wenn ein Kerl auf einer Party die Beherrschung verlor, wenn einem klar wurde: Ach du Scheiße, sie können verdammt schnell sein.
Er breitete die Arme aus. Sein verfärbter Unterarm fing das Licht von draußen ein, und sie sah es jetzt ganz deutlich, ein Gewirr aus älterem Narbengewebe und neueren Verletzungen, ein roter Schorf, der höchstens eine Woche alt war. Nichts davon sah nach einem Hundebiss aus.
Sie hielt inne, konnte sich nicht dazu überwinden, noch näher zu kommen. Er trat vor und legte behutsam die Arme um sie. Sie ließ es geschehen. Er atmete hörbar aus. Seine Hand lag auf ihrem Kopf. »Das ist nett«, sagte er.
Sie konnte über den Deckel in den Kasten blicken. Sie hatte richtig vermutet: Es war ein Werkzeugkasten. Er hatte mehrere Ebenen. Auf jeder lag eine andere Art von Messer. Es war ein Kasten aus glänzendem Metall und Schmerz. Sie sah ein leeres Fach, als würde etwas fehlen, das dorthin gehörte.
Sie begann zu zittern. »Psst«, machte Clay. »Psst.« Aber sie konnte nicht aufhören. Er legte die Hände an ihre Schultern und schob sie zurück, bis er sie auf Armeslänge hielt. Sie musste immer wieder furchtsame Blicke zum Kasten werfen, und ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen. »Ach, Madison. Deswegen musst du dir keine Sorgen machen. Das ist nur für den Fall, dass es nicht klappt. Diesmal ist es anders. Weil du mich diesmal kennst, nicht wahr?«
Sie nickte.
»Du hast eine Verbindung gespürt, richtig? Gleich bei unserer ersten Begegnung?«
»Ja.«
»Oder«, sagte er, »du hast mich verarscht. Mich hingehalten.« Seine Finger schlossen sich fester um ihre Schultern. »Hast du das getan?«
»Nein.«
Verächtlich stieß er den Atem aus. »Weißt du, was ich verrückt finde? Dass es so viele von dir gibt. Du bist absolut gewöhnlich. Morgen könnte ich eine andere finden. Aber du glaubst immer, dass du etwas Besonderes bist. Du bist eine Immobilienmaklerin, verdammt noch mal! Aber ich habe dir eine Chance gegeben, wie jedes Mal. Ich war ehrlich zu dir, und du hast mich angelogen.«
Sie ergriff die Gelegenheit. »Du hast gesagt, dass du mir nichts antun wirst. Du hast es versprochen.«
»Ich will dir nichts antun. Aber das …« Sein Blick strich über ihren Körper. »Das bist nicht du. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Ehrlich, ich ertrage es nicht.«
Sie konnte nicht aufhören, an das leere Fach im Kasten zu denken. Dort fehlte ein Werkzeug, das er irgendwo haben musste.
Sie ergriff die Flucht. Sie versuchte es. Er hatte sie, bevor sie auch nur zucken konnte, und sie öffnete den Mund, um zu schreien, und er verstopfte ihn mit seinem Unterarm. Dann folgte seine ganze Körpermasse, zwang sie zu Boden, trieb ihr die Luft aus den Lungen. Sie konnte nicht atmen, erstickt durch seinen Unterarm, durch die furchtbare runzlige Wunde. Wenn sie versuchte, ihn zu beißen, würden ihre Zähne perfekt in die Vertiefungen seines Narbengewebes passen.
Er griff nach etwas in seiner hinteren Hosentasche. »Ich hasse es, dass du mir keine andere Wahl lässt«, sagte er, und noch während sie sich wehrte, sah sie, dass sein Gesicht tatsächlich Bedauern zeigte, wie das eines Mannes, der gezwungen war, seinen geliebten Hund zu erschlagen, weil er tollwütig geworden war. Das Messer ragte groß und breit und böse auf. »Ich hasse es wirklich.«
2
Hier gab es eine Uhr. Jede Sekunde ruckte sie mit einem entschiedenen mechanischen Klack vorwärts. Während ihres ersten Monats in der Redaktion hatte Felicity gefragt, ob man diese Uhr vielleicht entfernen oder durch etwas Digitales ersetzen könnte, irgendetwas, das keine Geräusche von sich gab, als würden genau über ihrem Kopf sechzig Mal pro Minute Nägel in ein Brett getrieben. Die Antwort war ein Nein gewesen, weil die Uhr eine Institution war. Sie war ein altertümlicher Holzkasten, der von der Decke hing und schon viel länger hier war als sie. In diesen schwierigen Zeiten für den Journalismus war sie eine tröstliche Verbindung zur Vergangenheit, als Zeitungen noch respektiert wurden und die Ausgaben der Daily News stets mit voller Wucht einschlugen. Klack. Klack. Klack. Auf dieselbe Weise.
Am Telefon hörte Felicity Staples einem Bezirksstaatsanwalt zu, der ihr erklärte, dass sie einen Fehler beging. Wegen der Uhr war er schwer zu verstehen. »Was Sie unterstellen, ist einfach nicht richtig«, sagte der Anwalt. Er war der Bezirksstaatsanwalt des County und sein Name war Tom Daniels. Er und Felicity hatten schon ein paarmal miteinander gesprochen, und jedes Mal schien er sie weniger zu respektieren.
»Ich unterstelle überhaupt nichts«, sagte sie. »Ich stelle nur Fragen.«
»Bitte.« Sie hatte erlebt, wie er im Fernsehen dasselbe machte, wenn er wegen etwas bedrängt wurde, das er nicht beantworten wollte. Bitte, gefolgt von einem subtilen Themenwechsel. Ein Stirnrunzeln, das gleichzeitig Belustigung und Verärgerung über die Frage ausdrückte. Daniels war Mitte vierzig, auf eher zweifelhafte Weise gebräunt und hatte eine überwältigend lebhafte Mimik. »Wie lange haben Sie an dieser Story gearbeitet? Es fällt mir schwer zu glauben, dass Brandon so etwas für eine sinnvolle Nutzung Ihrer Zeit hält.«
Brandon Aberman war der Chefredakteur der Zeitung. Sie ging nicht auf den Stich ein, weil es erstens ein Ablenkungsmanöver war und es zweitens, ja, Brandon in der Tat lieber wäre, wenn sie an etwas anderem arbeitete, vorzugsweise etwas mit Bettwanzen.
»Ein junger Mann aus einer Familie mit guten Verbindungen kommt ohne Haftstrafe davon, obwohl eine Myriade von Beweisen …«
»Eine Myriade!«, wiederholte Daniels. »Ich bin so froh, dass Sie eine Gelegenheit gefunden haben, Ihre Schulbildung nutzbringend anzuwenden. Wenn Sie etwas besser mit der Realität der Strafverfolgung vertraut wären, würden Sie verstehen, dass wir die bestmögliche Vereinbarung treffen müssen, in Anbetracht der Umstände.«
»Umstände wie die Tatsache, dass die Familie gesellschaftlich mit dem Bürgermeister verkehrt?«
»Felicity Staples«, sagte er im Tonfall eines enttäuschten Vaters. Felicity Staples, komm sofort hierher. Hast du diese Unordnung angerichtet? »Ich bin mir sicher, dass Sie Ihr Talent viel besser einsetzen können, als einen Bezirksstaatsanwalt mit Fangfragen zu ködern.«
Die Redaktion war ein großer offener Raum mit dunklen Schreibtischen, die sich kreuz und quer unter stummen, hyperaktiven Fernsehbildschirmen tummelten. Felicitys Schreibtisch stand weiter vorn, nicht weit von den Aufzügen, unter der Uhr. Glasbüros mit Jalousien befanden sich links und rechts von ihr, während es geradeaus hinter einer kahlen Schreibtischlandschaft, die schon seit sechs Monaten verlassen war, zwei prächtige Fenster gab, die einen Blick auf ein von Wolkenkratzern eingerahmtes Stück Himmel freigaben. Dazwischen hing ein Schwarzes Brett, vor dem Melinda Gaines stand, eine Politikreporterin und Kolumnistin. Sie hob ihre Kaffeetasse, um einen vorsichtigen Schluck zu nehmen. Felicity wusste, dass am Schwarzen Brett eine interne Stellenanzeige für einen »Social-Media-Redakteur« hing. Sie wusste es, weil sie selbst diese Anzeige schon einige Male studiert hatte. Jedes Mal hatte sie entschieden, dass diese Stelle ganz und gar nicht dem entsprach, was sie studiert und worauf sie hingearbeitet hatte und woran sie glaubte, und obendrein war sie schlechter bezahlt. Andererseits war es ein Job, den es in zwölf Monaten definitiv noch geben würde, was sich von ihrem derzeitigen nicht sagen ließ. Zu beobachten, wie Melinda Gaines das Angebot über einer Tasse Kaffee prüfte, war erschreckend, denn Melinda Gaines war vierundvierzig und hatte eine alles überragende Artikelserie geschrieben, mit der sie drei korrupte Richter der Stadt bloßgestellt hatte. Wenn Gaines über einen Job als »Social-Media-Redakteur« nachdachte, stand es wirklich miserabel um die Zukunft des Journalismus. Buchstäblich ein Menetekel an der Wand der Redaktion.
»Ich bin rundum damit zufrieden, wie ich meine Talente einsetze, vielen Dank, Tom«, sagte Felicity, weil sie sich kein Wortgefecht mit Tom Daniels liefern wollte. Sie wollte ihm ein beruhigendes Gefühl geben und ihn dann in der Zeitung vernichten. Sie war dreiunddreißig. Sie konnte noch sehr viel aus ihrem Leben machen. »Stimmt es, dass Sie sich privat mit den Hammonds getroffen haben, am Abend, bevor Sie die Anklage fallen gelassen haben?«
»Ich müsste in meinem Terminkalender nachsehen.«
Ihr Blick auf Melinda Gaines, die über die Zukunft des Journalismus nachsann, wurde durch die schlaksige Gestalt des Praktikanten Todd versperrt, der ihr einen gelben Notizzettel hinklatschte. Er trug eine Brille mit runden Gläsern und einen besorgten Gesichtsausdruck. »Ich habe hier einen Mord.«
Felicity verscheuchte ihn. Sie machte keine Morde. Sie machte Stadtpolitik, Lifestyle, gelegentliche Geschichten über Leute, die starben, weil sie etwas gegessen hatten, was sie nicht hätten essen sollen, aber keine Morde. »Dennoch haben Sie sich irgendwann mit ihnen getroffen, nicht wahr? Privat?«
»Ich kann es in Erfahrung bringen und Ihnen die Information schicken, wenn Sie möchten.«
Was er nicht tun würde. Er hatte ihren Anruf entgegengenommen, um zu widerlegen, was sie geschrieben hatte: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels hat Bezirksstaatsanwalt Tom Daniels nicht auf die Bitte um einen Kommentar reagiert. Jetzt würde er sie bis zum nächsten Nachrichtenzyklus hinhalten, wenn sich niemand mehr an den ungewöhnlich nachsichtigen Deal mit James Hammond erinnerte, einem nett aussehenden Collegejungen, dessen vielversprechende Zukunft kurzzeitig gefährdet gewesen war, als er sich einen tätlichen Angriff auf ein Mädchen erlaubte, das ihn auf einer Party ausgelacht hatte.
»Könntest du einen Mord übernehmen?«, fragte Todd, der wieder in ihr Blickfeld trat.
Sie drehte sich weg. »Ist es das übliche Prozedere für einen Bezirksstaatsanwalt, sich in Fälle einzumischen, bei denen er eine private Beziehung zur Familie des Beklagten hat?« Daniels räumte ein, dass es nicht das übliche Prozedere für einen Bezirksstaatsanwalt ist, sich in …
»Es ist das übliche Prozedere für einen Bezirksstaatsanwalt, alle Fälle nach besten Kräften strafrechtlich zu verfolgen. Gibt es sonst noch etwas?«
»Wie würden Sie Ihre Beziehung zu den Hammonds beschreiben?«
Bezirksstaatsanwalt Daniels räumte ein, dass er eine »langjährige« Beziehung zur Familie Hammonds hatte …
Alternativ:
Bezirksstaatsanwalt Daniels räumte eine »oberflächliche« Beziehung zur Familie Hammonds ein, doch er hielt sich bei mindestens zwei Gelegenheiten zum Abendessen in ihrem Haus in Hampton Bays auf …
»Jemand muss das übernehmen«, sagte Todd in besorgtem Tonfall. »Levi ist nicht im Haus.«
Sie warf ihm einen strengen Blick zu. Todd setzte eine verletzte Miene auf und ging.
»Ich bin den Hammonds bei mehreren Gelegenheiten über den Weg gelaufen«, sagte Daniels. »In der Gesellschaft sind sie sehr aktiv. Wenn man oft genug ausgeht, kommt man einfach nicht umhin, ihnen zu begegnen.«
Wahrscheinlich hätte sie sich nie auf den Versuch einlassen sollen, einen Anwalt mit Worten in die Falle zu locken. Sie zog einen gelben Stift mit Goofy-Kopf aus ihrem Stiftehalter und rollte ihn zwischen Daumen und Zeigefinger. Vor drei Jahren war sie von der Arbeit losgerannt, um sich zu einem Blind Date zu treffen. In der U-Bahn hatte sie sich Notizen zu einem Artikel gemacht, und als sie in das Restaurant getreten war, hatte sie in einem Spiegel sorgfältig ihr Aussehen überprüft und sich vergewissert, dass ihr dunkelblondes Haar und ihr Gesicht an der richtigen Stelle waren, und sich dann gedankenlos diesen Goofy-Stift hinters Ohr gesteckt. Erst etliche Minuten später, nachdem sie sich vorgestellt und höfliche Küsse ausgetauscht hatten, als sie gerade Der Typ scheint in Ordnung zu sein gedacht hatte, überkam sie die Erkenntnis: HABEICHMIRWIRKLICHDIESENBESCHEUERTENSTIFTHINTERSOHRGESTECKT??? Sie griff danach und spürte ihn. Sie schämte sich zutiefst, weil es aussah, als hätte sie eine überdrehte Affektiertheit durchgezogen, und sie konnte sich gar nicht oft genug entschuldigen, aber den Kerl schien es überhaupt nicht zu stören, und von da an verlief der Abend sogar ziemlich gut. Jetzt lebten sie zusammen, und sie behielt den Goofy-Stift als Erinnerung daran, dass aus manchen Sachen trotzdem etwas wurde, auch wenn sie sich noch so sehr bemühte, sie zu sabotieren.
»Was dachten Sie über die Tatfolgenerklärung des Opfers?«, fragte sie.
Ein Moment der Stille folgte auf ihre seltsame Frage. Es war so einfach, ihr auszuweichen – Was ich dachte, spielt überhaupt keine Rolle –, dass er es gar nicht erst versuchte. »Ich dachte, das ist eine zutiefst traurige Geschichte.«
»Ich fand die Geschichte erschreckend«, sagte Felicity. »Sie erklärte, dass sie gar nicht mehr lacht. Auf einer Party lachte sie über einen Jungen, und er schlug sie so fest, dass sich ihre Netzhaut löste, und nun lacht sie nicht mehr. Ich kann nicht aufhören, daran zu denken.«
Daniels schwieg.
»Ich vermute, für Sie ist das nicht allzu schockierend«, sagte sie. »Sie haben ständig mit viel schlimmeren Sachen zu tun.«
»Die Verletzungen des Opfers waren sehr gravierend und bedauerlich«, sagte Daniels, und schon waren sie zurück im Spiel.
»Vielen Dank für Ihre Zeit, Tom«, sagte sie. »Bitte schicken Sie mir diese Daten.«
Sobald sie das Telefon sinken ließ, wandte sich Todd ihr wieder zu, diesmal mit strahlender Miene.
»Nein«, sagte sie und stand auf. Es war schon nach eins, sie musste etwas essen.
Die Tür zum Konferenzraum ging auf und offenbarte die gepflegte, adrette Gestalt von Brandon Aberman, ihrem Chef, der einen enteneiblauen Pullover über einem Kragenhemd, eine hellbraune Hose und dunkelbraune Halbschuhe trug. Sein Haar war eine zurückgekämmte Haube, von der Felicity jedes Mal dachte, man könnte sie einfach abziehen und auf einen Tisch legen, wie bei einem Lego-Männchen. Er winkte sie heran. Todd schlenderte ihr hinterher und versperrte ihr den Ausgang.
»Hallo, Felicity«, sagte Brandon. »Wie geht es dir?«
Bislang hatte jedes Gespräch zwischen ihr und Brandon mit diesen Worten begonnen, ganz gleich, wie lange ihre letzte Unterredung zurücklag. Sie vermutete, dass es hier irgendwo einen Management-Ratgeber gab, in dem ein Kapitel »Aufbau einer vertrauensvollen Partnerschaft mit Untergebenen« betitelt war.
»Bestens.«
»Wie läuft es mit der Recyclingsache?«
»Sie kommt.« Das war das, woran sie eigentlich arbeiten sollte, statt Bezirksstaatsanwalt Tom Daniels zu schikanieren. Bei einem Recyclingzentrum in Hoboken hatte jemand gefilmt, wie ein Lastwagen Plastik und Glas, das von Bürgern sorgfältig gewaschen worden war, in eine Mülldeponie verkippt hatte, was in den Social Media zu einer großen Sache geworden war. Deshalb brauchte die Zeitung so schnell wie möglich etwas für ihre Website. Felicity hatte ein paar Leute angerufen und herausgefunden, dass die Position des Recyclingzentrums vernünftiger war, als es anfangs den Eindruck gemacht hatte, und zwar aus recht komplizierten Gründen, was sie davon abhielt, den Artikel so zu schreiben, wie Brandon ihn gern hätte, zum Beispiel mit dem Titel Weitere geheime Verkippungen enthüllt – Recyclingzentrum hat Verbindungen zur kriminellen Unterwelt. »Ich kann sie dir bis fünf Uhr liefern.«
Er blickte auf seine Uhr, die voller Icons war. »Hättest du genug für einen VC-Spot? Sie wollen in der nächsten halben Stunde etwas posten.«
VC stand für visueller Content oder vielleicht auch Video-Content, sie konnte sich nicht mehr erinnern. Jedenfalls war das ein Haufen von schlauen Sechsundzwanzigjährigen in hellen Pullovern und leichten Blusen, die Nachrichten zu dreißigsekündigen Kurzberichten komprimierten. Felicity machte gelegentlich VC-Spots, nicht mehr so viele wie vor fünf Jahren, als damit das Nachrichtengeschäft gerettet werden sollte und noch niemand bemerkt hatte, dass die Social-Media-Zahlen gelogen waren, und es tat ihr jedes Mal in der Seele weh.
»Oh, äh … ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin.«
»Wenn du mit dem Recyclingzentrum gesprochen hast, reicht das doch völlig aus. Ich hätte es lieber jetzt als später.«
»Sie haben mir erklärt, dass es keine Möglichkeit gibt, das Zeug kosteneffektiv zu recyceln«, sagte sie. »Seit China dichtgemacht hat, wäre alles andere buchstäblich teurer, als es einfach zur Mülldeponie zu bringen.«
Brandon schürzte die Lippen. »Also ist es ein systembedingtes Problem.«
Sie nickte.
»Warum sagt man es den Leuten nicht? Warum vergeuden wir unsere Zeit damit, Plastik zu sortieren, wenn es dann an derselben Stelle landet?«
»Sie sagen, es hätte Jahre gedauert, die Bürger zu trainieren, ordentlich zu recyceln, und sie wollen nicht, dass wir es uns wieder abgewöhnen. In naher Zukunft könnte ein neuer Käufer auf dem Markt auftreten.«
»Das klingt nach Betrug«, sagte Brandon. »Ich möchte dazu einen VC von dir, wenn es dir nichts ausmacht.«
»Äh«, sagte sie. »Die Sache ist die, dass ich auch einen Mord übernehmen wollte.« Sie drehte sich um und schnippte mit den Fingern nach Todd. Er fuhr zu ihnen herum. »Ein schwerer Fall, und Levi ist nicht im Haus.«
Todd räusperte sich. Er hatte hier erst vor drei Wochen angefangen und wurde zwischen den anderen schnell nervös. »Ich habe einen Anruf von Detective Jim McHenry vom Spurensicherungsteam angenommen. Er sagte, Levi würde so schnell wie möglich alles darüber wissen wollen. Das Opfer ist eine weiße Frau, die erstochen wurde, als sie einem potenziellen Käufer ein Haus an der 177th Street in Jamaica zeigte.«
Nachdenklich strich sich Brandon über das Kinn. Es passierten viele Morde, und die Zeitung berichtete nicht über alle. »Gibt es einen Tatverdächtigen?«
Todd schüttelte den Kopf. »Dazu hat er nichts gesagt.«
»Frag immer danach«, riet er ihm. »Was sonst noch?«
Todd blickte auf seinen Zettel. »Der Name des Opfers ist Madison May.«
Brandon kramte sein Handy aus der Hosentasche und bearbeitete es. »M-A-Y? Und sie ist Immobilienmaklerin?«
»War«, sagte Todd, der nun etwas selbstsicherer wurde. »Hat für Henshaw Realty in Laurelton gearbeitet.«
Brandon drehte das Handy herum und zeigte Felicity eine Website. Unter einem himmelblauen Banner standen die Worte MADISONMAY, MITARBEITERINIMVERKAUF und das Foto einer Frau mit kastanienbraunem Haar, das über einen dunklen Blazer fiel.
»Hübsch«, sagte Felicity.
Brandon schwieg. Offensichtlich stellte er sich vor, wie dieses Foto über einer Schlagzeile aussehen würde, die das Wort erstochen enthielt. Es würde fantastisch aussehen.
»Was macht Levi?«, fragte Brandon.
»Ich weiß es nicht«, sagte Todd. »Er antwortet nicht.«
Er machte es mit Annalise vom Anzeigenverkauf, vermutete Felicity. Levis Schreibtisch war mit dem von Felicity verbunden, und an den meisten Tagen, während die Uhr sich Richtung halb eins voranklackte, schlüpfte Annalise vom Anzeigenverkauf in die Redaktion, entspannte ihren Arsch auf dem Stuhl zwischen ihnen, schlug die Beine übereinander, reckte die Schultern und fragte Levi nach seiner Meinung zu irgendeinem Thema. Dann warf Annalise alle paar Minuten den Kopf zurück und gab ein helles, mädchenhaftes, lautes Lachen von sich, das ganz anders war als alles, was Felicity während der Firmenweihnachtsfeier von ihr gehört hatte, wo sie in Gesellschaft ihres Ehemannes gewesen war.
Brandon tippte sich ans Kinn. Felicity wartete.
»Also gut«, sagte Brandon. »Mach es.«
»Okay«, sagte sie beschwingt. Mit etwas Glück hatten sie jemand anderen für den VC-Spot gefunden, wenn sie zurück war. »Mit einem Fotografen?«
Brandon schüttelte den Kopf. Sein Haar glänzte. »Wir können uns etwas von der Polizei besorgen.«
Noch besser. So konnte sie sich mit ihren eigenen Gedanken beschäftigen, statt mit einem Kamerafuzzi hinzufahren. Sie könnte etwas zu essen mitnehmen. Und sie könnte sich überlegen, was sie mit Bezirksstaatsanwalt Tom Daniels machen wollte, der sein aufrichtiges Mitgefühl für arme geschlagene Mädchen zum Ausdruck brachte, ohne ein einziges Mal ihren Namen auszusprechen. »Ich erledige das.«
Der Wind drehte sich, und als sie die 177th Street erreicht hatte, ließ der Himmel die ersten fetten Tropfen in die Hitze über der Stadt fallen. Die Polizei hatte das Gelände abgesperrt, und mittendrin stand eins der traurigsten Häuser, die Felicity jemals gesehen hatte. Uniformierte Polizisten ergossen sich über die Auffahrt und auf die Straße. Durch schmutzige Fenster erkannte sie Leute, die hin und her liefen, in Uniformen, Anzügen oder losen Plastikumhängen. Alle fünf Sekunden blitzte es in einem der Fenster auf.
»Wie schrecklich«, sagte eine Frau, die den Kragen ihrer Bluse gegen den Wind zuhielt. Neben ihr stand ein breitschultriger, bärtiger Mann mit Truckermütze, der ohne sichtbare Regung auf das Haus starrte.
»Haben Sie sie gekannt?«
»Oh, nein. Es heißt, sie war die Immobilienmaklerin. Ich bin ihr nie begegnet.« Die Frau senkte die Stimme. »Sie sind Diebe.«
»Wie bitte?«
»Diese Makler«, sagte die Frau. »Sie ziehen einem den letzten Cent aus der Tasche.«
»Oh«, sagte Felicity. »Ich verstehe.«
Ein Polizist kam in die Nähe des gelben Absperrbands, und Felicity winkte, um ihn auf sich aufmerksam zu machen. »Ist Detective McHenry hier?«
»Wer sind Sie?«
»Felicity Staples.« Sie zog ihren Presseausweis hervor. »Ich arbeite für die Daily News.«
»Keine Medien«, sagte der Polizist und wandte sich ab.
»Ich muss zu Detective McHenry. Könnte ich bitte mit ihm sprechen?«
Der Polizist ignorierte sie. Sie erschauderte. Regen tropfte ihr in den Nacken. Hätte sie den VC-Spot nicht abgeblasen, hätte sie es jetzt warm und trocken, würde in die Kamera lächeln und die Zuschauer vor den Gefahren betrügerischer Recyclingfirmen warnen. Schon länger hatte sie keine Kriminalreportagen mehr gemacht. Sie hatte vergessen, dass es dabei sehr nass werden konnte.
Ein kleiner Mann in olivfarbenem Mantel näherte sich dem Band. Wasser tropfte von der Krempe seines dunklen Huts. »Wer sind Sie?«
»Felicity Staples.« Sie kramte noch einmal ihren Ausweis hervor.
»Wo ist Levi?«
»Indisponiert.«
»Mit Ihnen habe ich nicht telefoniert. Ich habe Levi angerufen.« Er blickte über die Schulter zurück.
Sie trat von einem Fuß auf den anderen. Ihre Schuhe schmatzten. Sie war davon ausgegangen, dass der Hinweis kein großes Geheimnis sein konnte, da er bei Todd gelandet war, aber vielleicht war das doch nicht der Fall. Vielleicht war er zu gut, um zu warten. »Levi hat mich hergeschickt«, log sie.
McHenry starrte sie an.
Sie zog ihr Handy hervor. »Möchten Sie, dass ich ihn anrufe?«
Er schüttelte knapp den Kopf und verspritzte Wasser. »Gut, bleiben Sie hier. Ich werde schauen, was ich tun kann.«
Felicity blickte sich um. Die Frau war gegangen, um Schutz vor dem stärker werdenden Regen zu suchen, aber ihr Mann war noch da und betrachtete das Haus. Regen lief an seiner Mütze und seinem Bart hinab. Er sah wie ein Waldmensch aus. Als wäre er soeben aus der Wildnis zurückgekehrt, wo er einen Monat lang Wildschweine gejagt hatte. Mit einem selbst gemachten Speer. Halb nackt. Hastig wandte sie den Blick ab. Sie hatte eine sehr lebhafte Fantasie.
Das Fenster, hinter dem es geblitzt hatte, wurde zu einem Rechteck aus Licht. Ein Mann ging mit einer Videokamera daran vorbei, die er auf der Schulter trug und nach unten richtete, auf den Teppich oder etwas, das dort lag. »Was für ein Scheißloch«, sagte er und meinte das Haus, die Straße, das Wetter und die ganze Situation. Der Waldmensch reagierte nicht.
Detective McHenry winkte ihr von der Stelle zu, wo das Absperrband am Maschendrahtzahn befestigt war, und Felicity eilte sofort zu ihm. »Eine ziemliche Sauerei. Das Mordopfer hat ein halbes Dutzend Einstiche. Durchschnittene Kehle.«
Sie holte ihr Notizbuch hervor und schrieb: Kehle, 6+ Einstiche. »Kann ich hineingehen?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, auf gar keinen Fall.«
»Warum nicht?«
»Weil das nicht mein Job ist. Der Deputy Inspector ist mit seinen Ermittlern da drinnen. Das ist alles Hintergrund, ja? Sie erwähnen meinen Namen nicht. So machen Levi und ich es immer.«
In die rechte obere Ecke der Seite schrieb sie: HG. »Warum haben Sie Levi angerufen?«
»Weil ich weiß, dass es ihn interessieren würde.«
»Wegen des Mordopfers?« Noch nie zuvor hatte sie mit einem Polizisten über ein Mordopfer gesprochen. Sie kam sich sehr professionell vor. »Weil es so fotogen ist?«
McHenry sah sie an, als wäre sie verrückt geworden. »Was?«
»Das Mordopfer war sehr hübsch.«
McHenry winkte ungeduldig ab. »Ich habe keine verdammte Ahnung, wie sie aussah. Da ist noch eine andere Sache.«
Ein Licht flammte auf der Straße auf. Sie drehte sich um und sah ein Fernsehteam, das sein Equipment aufbaute. Ein weißer Kleintransporter, ein Kerl mit einer Kamera, eine dünne Frau in grünem Blazer unter einem schwarzen Regenschirm. Kurz darauf trat ein Mann in grauem Anzug durch die Vordertür des Hauses. Der Deputy Inspector, vermutete Felicity. Er war groß, in den Fünfzigern, mit tiefen Falten im Gesicht. Er stemmte die Hände in die Hüften, während er das Fernsehteam musterte. Hinter ihm tauchte eine junge Frau in schwarzem Rock auf, die einen Regenschirm ausschüttelte und öffnete. Sie stiegen die Treppe hinunter, während die Frau unbeholfen den Schirm für ihn hielt.
»Wollen Sie sich drinnen umschauen?«, fragte McHenry, sobald die beiden an ihnen vorbeigegangen waren. »Jetzt hätten Sie die Chance dazu.«
Sie zögerte, aber weswegen war sie sonst hier? Sie duckte sich unter dem Absperrband hindurch.
»Das ist Deputy Inspector Motte«, sagte McHenry zu ihr, als er zügig auf das Haus zuging. »Wird von hellem Licht angezogen.« Er stieg die Betonstufen hinauf. »Sie haben dreißig Sekunden. Rein und wieder raus. Keine Fotos. Verstanden?«
Sie nickte. McHenry sprach mit einem uniformierten Polizisten, reichte Felicity dünne blaue Handschuhe und Schuhüberzieher und wartete, während sie alles überstreifte. Drinnen gab es einen engen Flur und einen feuchten Geruch. McHenry klopfte an die Tür links von ihm, die von einem Mann in weißer Plastikfolie geöffnet wurde. Hinter ihm ragte ein Lichtmast auf, der in den Augen schmerzte.
»Kann ich sie ganz öffnen?«, fragte McHenry. Der Mann in Plastik sagte, dass sie warten sollten. Die Tür wurde geschlossen.
»Was ist das für eine ›andere Sache‹?«, fragte Felicity. Sie tropfte auf den Teppich.
Er deutete mit einer Kopfbewegung auf die Tür. »Gleich können Sie es selbst sehen.«
Offenkundig. Aber sie wollte wissen, worauf sie sich gefasst machen sollte. Gab es eine Leiche? Sie war nicht unbedingt bereit, eine tote Immobilienmaklerin zu sehen, eine Frau, auf die ein halbes Dutzend Mal eingestochen wurde, mindestens, ganz zu schweigen von der anderen Sache, dem zusätzlichen Schauder, der es für eine Zeitung besonders interessant machte.
Die Tür schwang auf. Felicity blinzelte im hellen Licht. Es war ein Schlafzimmer mit dunklem, schwerem Teppich. Ein voller und feuchter Geruch wehte ihr entgegen. Sie sah Markierungen in Gelb und Schwarz. Aber keine Leiche. Definitiv keine Leiche.
»Bleiben Sie, wo Sie sind«, sagte der Plastikmann. »Kommen Sie nicht ins Zimmer.«
Nicht weit von der Tür gab es einen großen Fleck. Dahinter andere, die kleiner waren, mit Markierungen daneben. Es war abscheulich und schrecklich, aber sie hatte Schlimmeres erwartet, sodass es fast eine Erleichterung war. Nirgendwo sah sie eine andere Sache.
»Schauen Sie nach oben«, sagte McHenry.
Die Rigipswand war mit kräftigen Schlägen aufgerissen worden. Da waren fünf spitze Zacken, die einen Kreis kreuzten. Irgendein Zeichen, vermutete sie. Aber keins, das sie wiedererkannte.
Darunter stand ein Wort in scharfen, zornigen Strichen:
STOPP
McHenry war so nahe hinter ihr, dass sie seinen Atem spüren konnte.
»Was ist das?«, fragte sie.
»Keine Ahnung.«
Der Mann im weißen Plastik hob eine Kamera. Für einen Moment kehrte der Blitz die Farben im Zimmer um.
»Kann ich die haben?«, fragte sie. »Diese Fotos?«
»Dazu kann ich nichts sagen.« McHenry trat zurück. »Sie müssen jetzt gehen.«
»Warten Sie«, sagte sie, aber McHenry drängte sie bereits aus dem Haus. Der Plastikmann schloss die Tür und versperrte ihr den Blick auf die Wand mit der Botschaft dahinter.
3
Sie dirigierte den Uber zu ihrem Apartment in Brooklyn, weil sie klitschnass war. Eigentlich wollte sie ins Büro zurückkehren, da es erst vier Uhr war, aber sobald sie unter der Dusche stand und das warme Wasser ihren Rücken massierte, schien sie außerstande zu sein, wieder nach draußen zu gehen. Tief in ihr war ein Kältegefühl, als hätte sie es von diesem Haus in ihr Apartment mitgenommen.
Als sie schließlich in ein Handtuch gewickelt ins Wohnzimmer trat, schmiegte sich ihr mutiger Kater Percival an ihre Beine, während ihr ängstlicher Kater Joey unter dem Esstisch saß und zuschaute. Sie nahm ihr Handy auf und tippte ein: Arbeite den Rest des Tages zu Hause, wenn das okay ist.
Kurz darauf kam Brandons Antwort: Aber sicher doch.
Trotz seiner Lego-Frisur und seiner vorsichtigen Gesprächsführung schienen Brandon seine Mitarbeiter nicht am Arsch vorbeizugehen, wofür sie dankbar war. Vermutlich konnte er sich sogar denken, warum sie zu Hause bleiben wollte. Sie zog eine Jogginghose und ein weites Oberteil an, setzte sich an den Esstisch und klappte ihren Laptop auf. Levi war wieder auf Deck, nachdem seine fleischlichen Gelüste gestillt waren, wie sie vermutete. Er hatte bereits mit der Polizei gesprochen. Sie rief das Dokument auf, an dem er arbeitete, das bereits ein Dutzend Absätze lang war, während ganz unten immer neue Wörter hinzukamen.
Das Opfer, das am heutigen Nachmittag brutal erstochen wurde, war »XXXXXX«, sagt XX.
Ein XX schrieb man, wenn man wusste, dass dort etwas hingehörte, aber noch nicht, was es genau war. Daneben hing eine gelbe Blase: Zitat Familie / Kollegen etc.
Sie griff nach ihrem Handy. Levi antwortete sofort, aber es kamen weiter neue Wörter hinzu. Sie konnte hören, wie er tippte. »Möchtest du, dass ich ihre Familie anrufe?«, fragte sie.
»Vergiss es. Sie gehen nicht ans Telefon. Könntest du es vielleicht in ihrem Büro versuchen? Das wäre hilfreich.«
ein grausamer, nicht provozierter Angriff
»Die Immobilienleute?«
»Die Nummer steht in den Notizen. Ich muss ihr einen Charakter geben. ›Sie war ein intelligentes und hübsches Mädchen mit glänzenden Aussichten.‹ Du weißt schon.«
»Okay.«
»Aber nicht das. So etwas mit Einzelheiten. Sie hatte geplant, nächsten Monat Kajak zu fahren. Sie sammelte Briefmarken. Sie war verlobt und wollte heiraten. Verstanden?«
»Ich habe schon einige Artikel geschrieben«, sagte sie.
hätte alle verfügbaren Möglichkeiten nutzen können
»Aber keine Kriminalfälle«, sagte Levi. »So etwas hat einen anderen Rhythmus, als du gewohnt bist.«
»Inwiefern?«
»Zum Beispiel kannst du sagen, was du meinst. Du musst nicht alles von der Rechtsabteilung absegnen lassen.«
»Ich sage, was ich meine«, erwiderte sie pikiert.
»Ich gebe dir einen Tipp. Bring die Sekretärin zum Reden. Sie hat mich direkt mit dem Chef verbunden, der aber gar nichts sagen will. Macht sich wahrscheinlich Sorgen wegen möglicher juristischer Konsequenzen. Was er auch tun sollte, wenn er eine Zweiundzwanzigjährige allein in leere Häuser schickt.«
»Was ist mit der Botschaft an der Wand?«, fragte sie. In seinem Artikel wurde das nirgendwo erwähnt.
»Das halten wir zurück. Das NYPD ist sogar leicht angepisst, dass wir davon wissen.«
»Das veröffentlichen wir nicht?«
»Noch nicht. Wenn es an der Zeit ist.«
Sie ging davon aus, dass er wusste, was er tat. Es war ein Tanz zwischen dem Wunsch, etwas zu veröffentlichen, und der Notwendigkeit, Quellen zu pflegen und zu schützen. »Was meinst du, was es bedeutet?«
»›Stopp‹? Keinen blassen Schimmer.«
»Mir ist nicht einmal klar, an wen die Botschaft gerichtet ist. Wer soll aufhören? Die Polizei?«
»Vielleicht gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Das könnte schon vor Tagen passiert sein.«
Für sie hatte es frisch ausgesehen. Wie eine neue Wunde. »Hmm«, machte sie.
Levi gluckste. »Lass deine Fantasie aus dem Spiel. Das würde dich nur in Schwierigkeiten bringen. Wir finden es heraus, wenn es so weit ist.«
wollte nicht bestätigen, ob man einen Tatverdächtigen identifiziert hat, aber wie es scheint, soll in Kürze eine Person festgenommen werden, die für die Ermittlungen von entscheidender Bedeutung ist
»Die Polizei weiß, wer das getan hat?«, fragte sie.
»Irgendein Studienabbrecher aus Ulysses in Pennsylvania. Ist als Clayton Hors bekannt.«
»Wie hat man ihn identifiziert?«
»Keine Ahnung. Aber man ist davon überzeugt, dass er es war.«
Felicity kaute auf der Unterlippe.
»Ruf mich an, wenn du etwas Zitierfähiges hast«, sagte Levi. »Oder gibt es noch etwas anderes?«
»Nein«, sagte sie. »Ja. Wie kannst du gleichzeitig reden und tippen?«
»Reine Übungssache«, sagte Levi und legte auf.
Sie stellte die Ellbogen auf den Tisch, klemmte sich das Handy ans Ohr und wartete, während es klingelte.
»Henshaw Realty, hier spricht Alexandra, wie kann ich Ihnen helfen?«
»Hallo, Alexandra. Mein Name ist Felicity Staples. Ich bin eine Reporterin der New Yorker Daily News. Das mit Madison tut mir furchtbar leid.«
Kurzes Schweigen. »Vielen Dank.«
»Hätten Sie einen Moment für mich? Es wäre schön, wenn Sie mir erzählen könnten, was für ein Mensch sie war.«
»Ich werde Sie mit Simon verbinden. Einen Moment, bitte.«