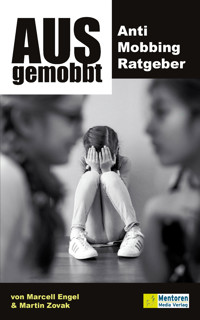12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Riva
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Hinter jedem Tatort steht ein menschliches Schicksal, das Spuren hinterlässt. Marcell Engel ist seit über 25 Jahren Tatortreiniger und täglich mit diesen Spuren konfrontiert. Was geschah an dem Ort, an den er gerufen wurde? Engel beschreibt in seinem Buch sieben Crimescenes – Anzeichen von Gewalt und Zerstörung, zerbrochene Schicksale, kurz: wahre Begebenheiten. All diese Geschichten zeigen, wie festgefahren Menschen oft sind und wie wenig in der Lage, negative Einflüsse aus ihrem Leben zu verbannen. Was er entdeckt und erfährt, macht ihn betroffen und bringt ihn zum Nachdenken – über den Sinn des Lebens und sich selbst. Seine Gedanken münden in sieben Prinzipien. Es sind Weisheiten, die uns lehren, ein Leben fernab von Schmerzen und Angst zu führen, unseren Alltag mit Disziplin zu bewältigen, richtige Entscheidungen zu treffen und stets unseren eigenen Weg zum Glück zu suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Ähnliche
Marcell Engel
DIE7 PRINZIPIENDESTATORTREINIGERS
Marcell Engel
DIE7 PRINZIPIENDESTATORTREINIGERS
Geschichten über Mord, Gewalt, Liebe und Hoffnung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
1. Auflage 2021
© 2021 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Friederike Moldenhauer
Umschlaggestaltung: Sonja Vallant
Umschlagabbildung: © Hartmuth Schröder
Layout und Satz: abavo GmbH, Buchloe
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-7423-1051-4
ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-1397-0
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-1398-7
>
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1: Angst
Der Tatort – das Horrorhaus
Angst nimmt Lebensqualität
Erstes Prinzip: Findet Wege aus der Angst
Kapitel 2: Schmerz
Der Tatort – die Toten in der Jagdhütte
Schmerz ist Heilung
Zweites Prinzip: Lass dich nicht von deinen Schmerzen beherrschen
Kapitel 3: Handeln
Der Tatort – ein ungleicher Kampf
Wie beeinflusst Handeln unser Leben?
Drittes Prinzip: Wir entscheiden immer
Kapitel 4: Disziplin
Der Tatort – die Wohnung eines Fußballprofis ohne Disziplin
Verfall der Disziplin?
Viertes Prinzip: Lebe Rituale, Disziplin schafft Energie
Kapitel 5: Toleranz
Der Tatort – ein toter Nachbar
Toleranz hat unterschiedliche Ebenen
Fünftes Prinzip: Toleranz basiert auf unterschiedlichen Sichtweisen
Kapitel 6: Beziehungen
Der Tatort – ein blutiger Selbstmord
Beziehungen sind lebensnotwendig
Sechstes Prinzip: Beziehungen sind das, was bleibt
Kapitel 7: Glück
Der Tatort – eine Partynacht mit katastrophalen Folgen
Was ist Glück?
Siebtes Prinzip: Finde deinen eigenen Weg zum Glück
Anmerkungen
Über den Autor
Vorwort
Ich bin Tatortreiniger. Seit 27 Jahren räume ich das Leben anderer nach ihrem Tod auf – und das bisher in mehr als 20 Ländern. Ich habe mehr als 5 000 Tatortreinigungen selbst durchgeführt und weitere 10 000 begleitet. Blut, Biomasse, Flüssigkeiten – sterben wir, bleibt nicht mehr viel von uns übrig. Natürlich habe auch ich mir aufgrund meines Berufs Gedanken über das Leben und den Tod gemacht. In manchen Teilen der Erde wird der Tod zum Beispiel gefeiert, Menschen freuen sich auf das, was danach kommt – den Himmel, das Nirwana, die Reinkarnation. Ich habe viele Wege zum Tod gesehen: Menschen, die sich selbst das Leben nahmen, solche, die plötzlich durch einen Unfall aus ihrem Alltag gerissen wurden, Menschen, die einer Krankheit erlagen oder solche, die glücklich und friedlich ihr Ende akzeptierten.
Nicht immer ist der Tod etwas Negatives. Vom Tod können die Lebenden lernen. Aus Tausenden Geschichten – von Extremfällen bis Normalität – konnte ich für mich die Essenz des Lebens filtern. Von den Menschen und deren Schicksalen habe ich viel gelernt. Ich habe mir ihre Geschichten zu eigen gemacht und daraus viel Positives für mich selbst abgeleitet. Ich möchte dir auf Basis meiner Geschichten über meine Erlebnisse am Tatort eine neue Sichtweise auf das Leben zeigen. Was zählt wirklich im Leben? Was können wir für uns mitnehmen? Was lernen wir von den Toten?
Ich möchte dich dazu anregen, deine eigene kleine Welt, deinen Mikrokosmos, einmal zu verlassen und eine andere Perspektive einzunehmen. Dich einmal selbst in deinem Dasein zu reflektieren und zu hinterfragen. Von jedem Tatort habe ich eine Erkenntnis für mein eigenes Leben mitgenommen und kann heute behaupten, dass ich positiver, zufriedener und glücklicher denn je bin. Ich hoffe, dass auch du aus diesem Buch einige Prinzipien für dich ableiten kannst, um dein Leben ein Stückchen besser zu machen.
Viel Spaß beim Lesen.
Marcell Engel
KAPITEL 1ANGST
Der Tatort – das Horrorhaus
Seit jeher haben Menschen Angst. Ein Urtrieb, vor dem es kein Entkommen gibt. Angst vor der Dunkelheit, dem Ungewissen, dem Unerklärlichen. Manchmal steckt die Angst auch in einem ganz normalen Tag. Ich gehöre nicht zu den ängstlichen Menschen, fürchte mich grundsätzlich vor nichts und niemandem. Stelle mich selbstbewusst jeder Situation. Doch an diesem Tag, den ich nie vergessen werde, hat sie auch mich gepackt – die Angst.
Es war ein drückend schwüler Sommertag Anfang der 2000er, das Thermometer zeigte weit über 30 Grad Celsius an. Ich sehnte schon langsam den Feierabend herbei, um der Hitze zu entkommen und es lag eine allgemeine Trägheit in der Luft. Das Schrillen des Telefons riss mich in diesem Moment aus meiner Schreibtischarbeit. Wie fast immer kündigte das Läuten einen neuen Auftrag an. Am anderen Ende der Leitung meldete sich, der Stimme nach, ein noch junger Mann: »Sie müssten hier mal vorbeikommen und eine Reinigung vornehmen. Es geht hier darum, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.« Mehr als diese kryptischen Informationen erhielt ich vorerst nicht. Der Satz, dass es um die öffentliche Ordnung ging, ließ jedoch meine inneren Alarmglocken anspringen. Immer wenn diese Wendung benutzt wird, ist klar, dass mehr im Busch ist als nur eine »normale« Reinigung.
Ich stellte mich gespannt darauf ein, weitere Informationen zu erhalten. Doch nichts – ratlos starrte ich noch einige Minuten auf den Telefonhörer. Aber mehr, als dass es sich um einen Leichenfund handelte und das Haus lange Zeit von niemanden betreten wurde, erfuhr ich nicht. Es war mir zunächst schleierhaft, wie das die öffentliche Ordnung gefährdete. Ich erhoffte mir, dass der Auftraggeber vor Ort bei der Schlüsselübergabe noch mehr zum Geschehen sagen würde.
Ohne zu wissen, was genau dieser Fall für mich bereithalten würde, machte ich mich mit meiner damaligen Auszubildenden Diana kurze Zeit später auf den Weg in einen beschaulichen Frankfurter Vorort. Während der Fahrt begann mein Gedankenkino und die wildesten Theorien geisterten in meinem Kopf umher. Mit jeder Minute stieg die Anspannung. Was würde uns dort erwarten?
Wir fuhren an einer Reihe gepflegter Einfamilienhäuser vorbei, freundlich einladende Fassaden von älteren Häuschen wechselten sich mit den glatten Fronten moderner Neubauten ab. Wäre ich hier nur zu Besuch gewesen, würde ich mich durchaus wohlfühlen. Langsam fuhren wir weiter die idyllische Straße entlang, bis zur gesuchten Hausnummer. Ein Blick aus dem Fenster offenbarte ein für diese Gegend typisches Haus. Allerdings wirkte es im Gegensatz zu den gepflegten Nachbarhäusern verwahrlost. Noch war mir nicht bewusst, welches schreckliche Geheimnis es im Inneren für uns bereithielt. Ich öffnete die Autotür und trat in die heiße Luft hinaus. Kurz darauf kündigten Reifengeräusche unseren Auftraggeber an. Er sprang aus dem Auto, wandte sich an uns mit den Worten: »Hier ist der Schlüssel, wenn es Probleme gibt, anrufen« – und schon war er wieder verschwunden. Dort standen wir also mit dem Schlüssel in der Hand, ohne Details, ohne konkrete Anweisungen.
Ich lächelte Diana noch zuversichtlich an, bevor wir die kleine Gartenpforte erreichten. Eine kleine Steinmauer, auf dessen Schultern ein Metallzaun mit kleinen Säulen thronte, säumte den Vorgarten. Rechts neben dem Haus erstrecke sich ein großer Platz mit Garage. Im Gegensatz zu den Nachbarhäusern war dieses Gebäude extrem weit nach hinten in den Garten versetzt und vor Blicken gut geschützt. Der Zahn der Zeit hatte auch hier mit aller Vehemenz genagt – alles präsentierte sich im fortgeschrittenen Stadium des Verfalls.
Über dem Vorplatz befand sich zu Teilen eine Pergola, die ihren einstigen Glanz längst verloren hatte. Wilder Wein wucherte über die einzelnen Holzbalken und verschlang sie regelrecht. Unter dem Holzgang stand nicht etwa eine schöne Sitzgruppe, die auf ein Glas Wein einlud, sondern es stapelten sich Müll und Unrat. Mülltüte über Mülltüte, gelbe Säcke, Kleidung und vieles mehr lag in einem riesigen Chaos durcheinander. Rechts neben der Pergola befand sich ein kleiner Aufgang zum Haus, davor gelagert ein nachträglich angebauter Windfang. Langsam stiegen wir die wenigen Stufen der ausgetretenen Steintreppe empor. Sie führte uns vorbei an noch mehr wildem Wein, der uns seine Blätter entgegenstreckte. Die Tür bestand aus Milchglas und verwehrte durch einen vorgezogenen Vorhang den Blick in das Innere. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir versuchten, mit dem Schlüssel die Tür zu öffnen, doch das ersehnte, leise Klicken blieb aus. Das Schloss klemmte. Ich rief mir noch einmal kurz die Worte unseres Auftraggebers ins Gedächtnis: »Wenn es Probleme gibt, anrufen.« Ein sanftes Öffnen der Tür war schlicht nicht möglich. Je länger wir dort standen und versuchten, das Schloss doch noch dazu zu bringen, nachzugeben, desto angespannter wurde die Stimmung. Ein seltsames Gefühl durchzuckte mich plötzlich, etwas, das man nicht beschreiben kann. Vielleicht war es eine dunkle Vorahnung, die Intuition, jetzt besser das Weite zu suchen. Es war, als würde mein Körper schon wissen, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmte.
Irgendwie spooky
Diana erkundete derweil das Grundstück, um eventuell einen zweiten Eingang zu finden, den wir übersehen hatten. Beim Rundgang zeigte sich, dass jedes Fenster zur Straße hin mit massiven Holzrollläden verbarrikadiert war. Hier war kein Durchkommen möglich – der hintere Teil des Hauses gab noch einen Kellerabgang preis. Müllberge und meterhoch gestapelter Unrat versperrten jedoch auch hier den Weg. Es war fast so, als würde das Haus nicht wollen, das wir hereinkommen.
Obwohl dieses Einfamilienhaus nicht wirkte, als sei es einem Horrorfilm entsprungen, so war es doch von einer seltsam mysteriösen Aura umgeben. Der Blick in den Garten zeigte, dass sich hier die Natur langsam, aber sicher, ihr Territorium zurückerobert hatte. Alles von Menschenhand Geschaffene verschwand unter einem grünen Teppich, die Betonplatten, die den Weg in den Garten einfassten, ließen nur noch schemenhaft erahnen, wie es hier einmal gewesen sein musste. Ich horchte mit einem Mal auf und … nichts. Kein Vogelgezwitscher, keine fröhlich spielenden Nachbarskinder, kein Hundegebell. Nicht einmal das Surren von Insekten war zu hören. Der verwahrloste Zustand des Hauses war eine Sache, doch diese Totenstille um diese Uhrzeit am Nachmittag in einem sonst belebten Vorort war wirklich unheimlich, ich fühlte mich kurzzeitig wie in Stephen Kings Roman Die Arena, gefangen unter einer Glaskuppel, die nichts nach außen dringen lässt, aber auch nichts nach innen. Ich wandte mich an Diana. »Irgendwie fängt der Auftrag ein bisschen spooky an.« Sie stimmte mir lächelnd zu. Es war zweifelsohne ein bisschen seltsam, aber noch lange kein Grund, um in Panik zu geraten.
Als klar war, dass wir nicht so einfach in das Haus kommen würden, rief ich unseren Auftraggeber an und fragte, ob wir zur Not auch etwas Gewalt anwenden dürften, um das Türschloss aufzubrechen. Als dieser bejahte, holte ich mein Werkzeug und brach die Tür auf. Gemeinsam traten wir in den vorgelagerten Windfang des Hauses ein. Auch hier führte sich fort, was sich schon vor dem Haus angedeutet hatte. Müll und noch mehr Müll. Ich blickte mich um und erkannte drei Garderobenständer, die über und über mit Kleidung bedeckt waren: Jacken, Pullover, Hosen und oben auf den Haufen gestapelt jede Menge Baseballcaps, Mützen und Hüte. In dem Lichtschein, der von draußen hereindrang, präsentierten sich zudem Hunderte filigran durch den Raum laufende Spinnweben. Staubkörner tanzten in dem Luftstrom, den wir mit unserem Eindringen verursacht hatten. Freiwillig hätte ich ein solches Haus wohl nie betreten. Unter meiner kompletten Schutzkleidung begann ich mehr und mehr zu schwitzen, ich merkte, wie mir die Schweißperlen den Rücken herunterliefen, draußen waren es mittlerweile locker über 30 Grad und im Inneren des Hauses bestimmt nochmal zehn mehr. Als wäre das nicht schon genug, schlug uns beim Betreten ein extremer Leichengeruch entgegen. Sogar durch die Schutzmasken hindurch, die mit ihrem Kohlefilter eigentlich dafür sorgen, solche Gerüche fernzuhalten, nahmen wir den süßlichen Geruch des Todes wahr. Diesen Geruch vergisst man nicht. Schafft er es, durch die Masken zu dringen, ist das ein untrügliches Anzeichen dafür, dass das, was kommt, extrem sein wird. Es würde ein richtig harter, abgefuckter Tag werden.
Dunkelheit und Ungeziefer
Im Vorraum diente uns zunächst nur das einfallende Licht aus der Eingangstür zur Orientierung. Unsere Taschenlampen waren zwar griffbereit, aber damals noch weit entfernt von modernen LED-Leuchten – man hätte genauso gut ein Feuerzeug anzünden können, wahrscheinlich hätte dieses noch mehr Licht gespendet. Wenn der Windfang uns schon so abweisend vorkam, wie sollte es dann weitergehen? In dem beengten, vermüllten Vorraum standen wir erst vor unserer eigentlichen Aufgabe, der Haustür. Die schwere Holztür stand in all ihrer Pracht vor uns. Die schmalen Milchglasfenster wurden von massiven Mittelholzstegen gestützt. Sie starrte uns regelrecht an, schien zu sagen, dass das, was jetzt käme, kein Spaß würde. Ich wollte jetzt nur allzu gerne tief durchatmen, um mich auf das Kommende vorzubereiten, aber angesichts des ekelerregenden Gestanks hielt ich meinen Atem flach. Stattdessen steckte ich entschlossenen den Schlüssel ins Schloss. Ein leises Klicken. Diesmal öffnete der Schlüssel die Tür mühelos. Das Geräusch beim Öffnen war nicht etwa ein zu erwartendes Knarren oder Quietschen, es hörte sich vielmehr an, als würde ein Stück rohes Fleisch auf ein Holzbrett klatschen. Ich bekam Gänsehaut, als ich die Geräuschquelle am Boden ausmachte. Tausende kleine weiße Maden, die über den Fußboden krochen, wurden durch das Öffnen der Türe zerquetscht. Mit jedem Zentimeter, den wir die Eingangstüre weiter zur Seite schoben, breitete sich das Geräusch aus. Diana wollte unbedingt ihren Mut beweisen und vorangehen. Vorsichtig steckte sie als Erste ihren Kopf durch den geöffneten Spalt. Plötzlich war im Sekundentakt ein Klopfgeräusch zu vernehmen. Zahllose Fliegen prallten mit einem Geräusch wie Hagel auf ein Autodach gegen das Visier ihrer Schutzmaske. Ich rief ihr noch zu, sie solle aufpassen, denn der dahinterliegende Raum war stockdunkel. Der vage Schein unserer Taschenlampen ließ lediglich ein diffuses Bild zu.
Da standen wir nun umhüllt von tiefstem Schwarz, mit unserer lächerlichen Lichtquelle, die gerade einmal ein paar Zentimeter ausleuchtete, dem Surren der gierigen Insekten um uns herum und den Maden, die sich einen Weg über unsere Gummistiefel bahnten. Wir tasteten nach einem Lichtschalter, in der Hoffnung, dass dieser irgendeine Lampe angehen lassen würde, doch nichts tat sich – die Sicherung war herausgedreht worden.
Wir hatten weder Ersatzakkus noch -batterien für unsere Taschenlampen im Auto. Die einzige Alternative, die sich sonst bot, war, den Tatort wieder zu verlassen, um eine Tankstelle oder einen Supermarkt zu suchen. Mal eben im Internet nach dem Weg suchen, oder das Navi anwerfen, war zu dieser Zeit noch nicht möglich. In einer Gegend, in der wir uns nicht auskannten, wäre es ohne Karte eine zeitraubende Herausforderung gewesen, einen Laden zu finden. Deshalb beschlossen wir, es anders zu versuchen. Einen Nachbarn um Hilfe zu bitten, kam nicht in Frage, da wir uns wieder komplett aus dem Schutzanzug hätten schälen und zudem wahrscheinlich noch einigen neugierigen Fragen oder Geschichten hätten lauschen müssen – dafür war schlicht keine Zeit. Wir entschieden uns für einen anderen Weg. Hätten wir erst einmal einen der Rollläden geöffnet, würde es auch genug Licht geben. Wir kämpften uns also durch den vermüllten Hausflur, an dem links und rechts weitere Türen abgingen, um in einen der Räume zu gelangen. Der Boden war ein einziges Meer aus Stolperfallen: Flaschen, Kleidung, Mülltüten und dazwischen jede Menge Maden. Jeder Schritt fühlte sich an, als würde man auf Luftpolsterfolie gehen. Plopp, plopp, plopp – kleine Maden-Kokons zerplatzten unter den schweren Sohlen der Gummistiefel. Mit jedem Schritt wurde der Belag unter unseren Füßen zu einer schmierigeren Masse aus zerquetschen Maden, Insekten und Müllresten. Plötzlich rutschte Diana aus, schlitterte mit rudernden Armen über den Boden auf der Suche nach Halt und bekam in letzter Sekunde den Türrahmen zu fassen. Das Letzte was ich in diesem Horrorhaus wollte, war jetzt auch noch ein Arbeitsunfall. »Reiß dich mal zusammen, wir haben hier noch einen Tatort zu reinigen«, sagte ich scherzhaft zu ihr, um der Situation die Ernsthaftigkeit zu nehmen. Nach meinem Witz kehrte wieder Grabesruhe ein, kein Mucks war zu hören – ein zunehmend merkwürdiges Gefühl breitete sich in meiner Brust aus. Das Einzige, was ich wahrnahm, war das Geräusch meines eigenen Atmens durch die Maske. Ich spürte, wie sich mein Herzschlag beschleunigte. Es war drückend heiß, der Gestank unerträglich und stockdunkel. Eine Kombination, auf die ich gerne verzichtet hätte. Ich war sehr angespannt, es war noch kein Gefühl der Angst, aber mein Körper war eindeutig in Alarmbereitschaft. In diesem Moment habe ich nur daran gedacht, dass ich jetzt ein gutes Vorbild sein musste – ich konnte nicht einfach den Schwanz einziehen und ängstlich ins Freie rennen. Also Augen zu und durch. Mein Plan war klar: Erstmal in einen der Räume hineinkommen und den Rollladen hochschieben, um endlich Gewissheit zu erlangen, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. Ich schickte Diana in einen anderen Raum mit dem gleichen Ziel. Kaum hatte ich die ersten Schritte über die Müllsäcke gemacht, hörte ich aus dem Nebenzimmer einen markerschütternden Schrei, der die Stille zerriss. Mein Herz blieb stehen. Kurze Zeit später kam zum Glück die Entwarnung. Dianas Taschenlampe hatte nun vollends versagt und sie allein im Finsteren zurückgelassen.
Ich setzte meine Exkursion über die Müllberge fort, mit jedem Schritt wuchsen die Hügel an, die ich auf dem Weg zum rettenden Fenster überwinden musste. Wir waren tatsächlich mitten im Messie-Horror-Leichen-Haus gefangen. Bis unter die Decke vollgestopft mit Hausrat, Kleidung, Essensresten, dreckigem Geschirr, vertrockneten Pflanzen, Hunde- und Katzenfutterdosen, Verpackungsmüll und undefinierbarem Unrat. Aufgrund der ganzen leeren Futterdosen schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass es dazu ja auch noch die entsprechenden Tiere geben müsste, doch wo waren sie? Ich lauschte. War da etwa ein Rascheln? Würde gleich eine Katze aus dem Nichts auf mich springen? So ging es nicht weiter, wir brauchten hier dringend Licht, doch der Weg zu den Fenstern war ein undurchdringlicher Mülldschungel. Eine Alternative musste her. Zurück in den Flur war der einzige Weg. Wir müssten beide wieder über die Müllberge in Richtung des Eingangsbereichs zurück, um die Lage zu besprechen. Konzentriert machte ich mich auf den Weg.
Stimme aus dem Nichts
»Hallo, hier ist Rainer Schmitt*. Gerade ist niemand zu Hause. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Sprechen Sie nach dem Piepton.« Auf einmal sprang der Anrufbeantworter an und versetzte mich in Angst und Schrecken. Eine Sekunde, in der es mir wie ein Stromschlag durch sämtliche Glieder fuhr. Ich war mit einem Mal mehr als wach. Als ich gerade wieder dabei war, mich zu beruhigen, durchbrach erneut ein Schrei die Stille. »Diana«, schoss es mir durch den Kopf. Aufgrund der Bandansage auf dem Anrufbeantworter, war sie erschrocken Richtung Fenster zurückgehechtet. In ihrer Angst, es würde jetzt gleich etwas furchtbar Schreckliches passieren, zog sie mit aller Kraft den Rollladen ein Stück nach oben, um endlich das erlösende Licht hereinzulassen. Mit Entsetzen stellte sie im Sonnenschein fest, dass sie auf einem Bett stand, genauer gesagt, spürte sie den weichen, schwammartigen Untergrund und erkannte, dass sie auf einer mit Leichenflüssigkeit durchtränken Matratze stand. Sie war alleine im Zimmer und mein erster Impuls war, so schnell wie möglich zu ihr zu gelangen. »Hast du es auch gehört? Hast du den Anrufbeantworter gehört? Was ist hier eigentlich los? Das ist doch merkwürdig.« Die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus und ich konnte mir nur allzu gut vorstellen, auf welchem Level ihr Puls gerade war. Natürlich lag es jetzt an mir, den Coolen zu geben, damit die Situation nicht vollends außer Kontrolle geriet. Nach einigen Minuten entspannte sich die Lage wieder und wir glaubten fest daran, dass das Schlimmste jetzt überstanden sei, doch weit gefehlt ...
Die Angst vor der Dunkelheit und dem Ungewissen war durch die eindringenden Sonnenstrahlen zunächst verschwunden. Zugleich offenbarten sie den Blick auf ungeahntes Chaos. So etwas hatte ich während meiner gesamten Berufslaufbahn noch nicht gesehen. Als Tatortreiniger darf man jedoch eines nie verlieren: den Humor. Wir standen beide im Flur des Hauses, haben ein bisschen gescherzt, ohne den nötigen Respekt vor der Situation zu verlieren, haben uns Mut zugesprochen und erstmal die Erkenntnis beiseitegeschoben, dass wir fast knietief im Müll versanken. Ich ging zu den beiden großen Türen am Ende des Flurs und eine Gameshow-Situation tauchte unpassender Weise vor meinem inneren Auge auf: Sollte ich nun Tür eins oder zwei wählen? Hinter welcher verbarg sich wohl der Preis? Diana wählte die linke Tür und ich die rechte. Schon als ich die Türe über den Madenteppich gleiten ließ, wusste ich, dass ich der Verlierer dieses Spiels war. Vor mir breitete sich ein weiteres zugemülltes Schlafzimmer aus. Ein Ungetüm von Schiebetürschrank nahm einen Großteil der Wand ein, ich erhaschte kurz im Spiegel schemenhaft mein Bild, bevor ich auch hier den Rollladen öffnete, um den zweiten Leichenfundort in Augenschein zu nehmen. Es war also nicht nur ein Mensch, der hier gestorben war, es waren zwei. Ein großes Doppelbett stand in der Mitte des Raums, gekrönt von einem Stapel an Matratzen, einer zusammengeknüllten Federbettdecke und mehreren von brauner Leichenflüssigkeit durchzogenen Kopfkissen. An der Wand befand sich eine einst wohl sehr schöne Fototapete, die die atemberaubende Natur der Malediven abbildete, doch auch hier hatten die Maden der Speckkäfer, Schmeißfliegen und Aaskäfer ganze Arbeit geleistet und eine Spur hinterlassen, die einer gefächerten Koralle oder einer von Blitzen durchzuckten Gewitternacht ähnelte. Schlüpfen Maden in Leichenflüssigkeit, hinterlassen sie Spuren an der Wand und zeichnen so ein skurriles Bild des Todes.
Die oberste Matratze des Stapels war bereits durchgelegen, was darauf schließen ließ, dass der Leichnam über ein enormes Körpergewicht verfügt haben musste. Als ich die Bettdecke beiseite nahm und eine Matratze anheben wollte, war dies kaum möglich, sie war komplett mit Flüssigkeit durchtränkt, nass, stinkend und schwer. Beim näheren Hinsehen wurde deutlich, dass die Matratzen bereits ein Eigenleben hatten, Tausende kleine Maden fraßen sich genüsslich durch das Gewebe. Nach der ersten Bestandsaufnahme sah ich mir den Raum etwas genauer an. Ich ließ meinen Blick durch das Zimmer schweifen, vorbei am Schrank, hinauf zur Decke. Dort erkannte ich, dass neben den vielen feinen Spinnweben viele Gewebereste hingen. Die rundlichen Fleischlappen der Gehirnmasse, die an der Decke klebten, waren von dunkelroter Farbe und bereits angetrocknet. Für mich eine klare Sache: Kopfschuss. Es gab einfach keinen anderen Weg, wie menschliches Gewebe sonst an die Decke spritzen könnte. In einem solchen Augenblick hat es Priorität, noch einmal beim Auftraggeber nachzufragen. Wir hatten überhaupt keine Informationen zum Tatort und wussten nicht, ob und was hier eventuell von den zuständigen Behörden noch sichergestellt werden musste.
Erweiteter Suizid
Endlich bekamen wir am Telefon die traurige Gewissheit: In diesem Haus hatte ein erweiterter Suizid eines Ehepaares stattgefunden. Es wurde vermutet, dass der Mann zunächst seine Frau umgebracht und anschließend sich selbst erschossen hat. Dass die beiden Messies waren, war mehr als ersichtlich. Darüber hinaus hatten noch fünfzehn Katzen und zwanzig Hunde im Horrorhaus gelebt. In ihrem Überlebenstrieb hatten die Tiere bereits angefangen, sich von den Leichen zu ernähren. Doch das hatte nicht allen das Überleben gesichert. Wir wurden auch darüber unterrichtet, dass die Leichen wohl mehrere Monate verwesend im Haus gelegen hatten, bevor jemand die Polizei rief. Und das war auch eher dem Zufall zu verdanken, denn das Ehepaar lebte extrem zurückgezogen. Die Nachbarn waren aufgrund des Mülls und der Tierhaltung ja schon an einige Gerüche gewohnt, doch als es nicht mehr zumutbar war, wurden endlich Schritte eingeleitet.
Während des Telefonats haben wir dem Auftraggeber angeboten, auch über die Entsorgung der Überreste der Leichenfunde hinaus, das ganze Haus zu reinigen und zu entrümpeln. Denn alleine den Leichenfund zu bereinigen, löste hier definitiv nicht das Problem einer möglichen Infektions- oder Ansteckungsgefahr – besonders in Anbetracht des verwahrlosten Zustands des alten Hauses und der Holzfußböden. Ich empfahl, das Haus gesamteinheitlich zu räumen. Nachdem diese Frage sofort telefonisch mit dem Amtsgericht geklärt worden war, erhielten wir eine dementsprechende Auftragserweiterung. Endlich gab es auch weitere Neuigkeiten zum Verbleib der Haustiere. Einige Katzen waren wohl noch im Haus. Da sie sich nicht herauslocken ließen, mussten wir bei unserem weiteren Vorgehen also damit rechnen, noch auf einige Katzen zu stoßen. Wir riefen das ortsansässige Tierheim und berichteten diesem, dass wohl noch lebende Tiere im Haus sind. Wenig später rückten die Mitarbeiter des Tierheims mit Transportkisten an, um die scheuen Tiere zu bergen. Die Hunde wurden alle geborgen, einige davon aber leider bereits Tod, da sie verhungert waren.
Die »Animal-Abteilung«
Mit den neugewonnenen Erkenntnissen und aufflammendem Enthusiasmus, soweit man hier davon sprechen konnte, machte ich mich daran, den Rest des Hauses zu erkunden. Schließlich gab es noch das obere Stockwerk. Schon auf dem Treppenabsatz ekelte ich mich – es war abartig und für mich absolut unbegreiflich, wie Menschen über Jahrzehnte so leben konnten. Vorsichtig erklomm ich die Stufen in die »Animal-Abteilung« des Hauses. Sowohl eingetrockneter als auch relativ frischer Kot und Lebensmittelreste pflasterten die Treppe, manches davon war bereits so sehr mit den einzelnen Stufen verklebt, dass es fester Bestandteil geworden war. Mit jedem Schritt knirschte der Unrat unter meinen Schuhen. Die Tapeten waren überall heruntergekratzt, hingen in Fetzen von der Wand und der Geruch wurde von Sekunde zu Sekunde unerträglicher. Oben an der Treppe erwartete mich ein kleiner Flur, von dem drei Räume abgingen. Wieder war alles stockdunkel – ich lauschte in das Schwarz hinein. Ich ging davon aus, dass sich die Tiere weitestgehend in diesem Stockwerk aufhielten. Ich konnte mir nur ausmalen, wie unglaublich ängstlich die armen Tiere sein würden, falls hier welche überlebt hätten. In einem der Räume habe ich tatsächlich neben vielen Kadavern noch eine lebende Katze gefunden, die allerdings erbärmlich aussah. Es musste einst ein Tier mit sehr schönem, flauschigem Fell gewesen sein, doch die Katze sah so aus, als wäre sie gerade in einen Fluss gefallen. Sie war total abgemagert, mit entzündeten Augen und sie sah aus wie ein kleiner, wandelnder Fäkalienhaufen. Nach einigen Bemühungen gelang es uns, das arme Ding in einen Karton zu bugsieren und letztendlich aus diesem Haus, ihrem persönlichen Gefängnis, zu befreien. Sie hatte wahrscheinlich mehr Angst, als wir jemals hätten haben können.
Nachdem wir das gesamte Haus in Augenschein genommen hatten, konnten wir uns noch weniger vorstellen, wie Menschen unter diesen Umständen hatten hausen können. Es war nicht so, als wäre das Haus einfach nur unordentlich oder schmutzig, hier muss über viele Jahre hinweg stetig mehr Müll angehäuft worden sein. Warum sich die beiden Bewohner des Horrorhauses das Leben nahmen, blieb nach wie vor unbeantwortet. Lag es nur daran, dass sie es nicht mehr ertrugen, so zu leben?
Der Weg ins Ungewisse
Um den Überblick zu vervollständigen, fehlte nur noch die Küche im unteren Stockwerk. Ungeziefer, Dreck, Müll – auch hier das gewohnte Bild. Dass jemand hier essen und leben konnte, war mir schleierhaft. In der Küche gab es eine Holztür, die der eines Toilettenhäuschens aus vergangenen Zeiten ähnelte – typisch für diese Art Altbau. Dahinter verbarg sich eine Treppe in den Keller. Ich trat den Weg ins Ungewisse an, denn ich musste wenigstens eine grobe Übersicht über die Zustände im Keller gewinnen. Hochkonzentriert, um nicht über einen der zahlreichen Müllsäcke zu stolpern, nahm ich vorsichtig Stufe für Stufe. Ich habe mit allem gerechnet – weiteren Katzen, Dreck, Kadavern. Im Augenwinkel nahm ich einen dunklen Schatten wahr, der durch die Luft sauste und auf meiner Schulter landete. Ich unterdrückte einen Schrei, wollte mich wegducken und spürte, wie mich die Angst übermannt. Da saß eine Ratte auf meiner Schulter – ja, eine scheiß Ratte. Und ich meine nicht die putzige Sorte, die sich Menschen als Haustiere halten, sondern eine echt große, fiese Kanalratte. Mit ihren schwarzen Augen starrte sie mich an, als wollte sie mich für meine Angst auslachen. Der Keller war voll mit Dutzenden von Ratten. In mir kam Panik auf. Ich wollte nur noch weg, hastete los und stolperte in meiner Eile über den Müll, konnte mich nicht mehr halten und schlug mir mein Schienbein beim Hinfallen auf. Keuchend rappelte ich mich auf und hastete im Turbogang die Treppe nach oben. Am liebsten wäre ich dort Diana in den Schoß gesprungen, so wie man es aus Comics kennt, aber das konnte ich natürlich nicht. Mein Herz schlug so heftig in meiner Brust, dass ich der festen Überzeugung war, dass es gleich herausspringen würde. Jetzt hatte ich endgültig genug von diesem Haus und brauchte dringend frische Luft.
Das Puzzle fügt sich zusammen
Die Tatortreinigung und das Entrümpeln des Hauses war eine Mammutaufgabe. Auch das Rätsel um die Menschen, die hier wohnten, klärte sich Stück für Stück. Ein Frührentner und seine wohl geistig behinderte Ehefrau hatten seit Jahrzehnten im Müll des Horrorhauses gelebt. Zum Zeitpunkt des Todes hatte der Mann nicht nur ein Gewicht von rund 200 Kilo, sondern auch Krebs im Endstadium. So wollte er nicht mehr weiterleben, aber seine Frau auch nicht zurücklassen. Sie waren beide sehr krank und hatten keine Hilfe von anderen Menschen. Nachbarn beschrieben das Ehepaar als zurückgezogen – weder hat man sie gesehen noch gehört. Wochen- sogar monatelang waren die Rollläden zu und das einzig wahrnehmbare Lebenszeichen waren die Tiere draußen und ein Kopf, der sich hin und wieder durch die Tür reckte, um nach ihnen zu rufen.