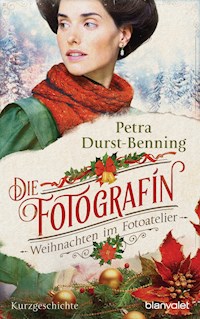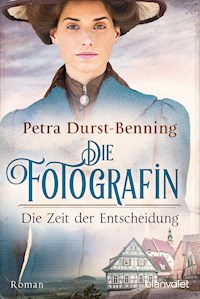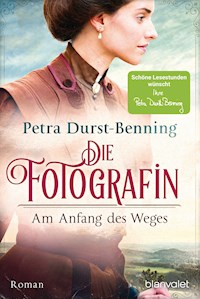9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marie und Wanda - zwei Frauen, zwei Schicksale und die alte Erkenntnis, dass Glück und Glas zerbrechlich sind: Inmitten gesellschaftlicher Umbrüche und Neuanfänge versuchen die Glasbläserin Marie aus dem thüringischen Lauscha und ihre junge, reiche, in Amerika aufgewachsene Nichte Wanda, ihr persönliches Glück zu finden und zu behalten. Von der Beschaulichkeit des Thüringer Waldes ins mondäne New York der zwanziger Jahre, auf den magischen Berg Monte Verità am Lago Maggiore und zur alten, prunkvollen Hafenstadt Genua führen die Stationen dieses ungewöhnlichen Romans, in dem der Leser zwei faszinierende Frauen auf ihrem Lebensweg begleitet. Marie und Wanda - zwei Frauen, zwei Schicksale und die alte Erkenntnis, dass Glück und Glas zerbrechlich sind: Inmitten gesellschaftlicher Umbrüche und Neuanfänge versuchen die Glasbläserin Marie aus dem thüringischen Lauscha und ihre junge, reiche, in Amerika aufgewachsene Nichte Wanda, ihr persönliches Glück zu finden und zu behalten. Von der Beschaulichkeit des Thüringer Waldes ins mondäne New York der zwanziger Jahre, auf den magischen Berg Monte Verità am Lago Maggiore und zur alten, prunkvollen Hafenstadt Genua führen die Stationen dieses ungewöhnlichen Romans, in dem der Leser zwei faszinierende Frauen auf ihrem Lebensweg begleitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Schöne Lesestundenwünscht herzlichst
Petra Durst-Benning
Das Buch
Auf der Suche nach neuen Inspirationen verlässt die Glasbläserin Marie Steinmann mit siebenunddreißig ihr Heimatdorf Lauscha im Thüringer Wald und besucht ihre Schwester Ruth in New York. Durch ihre Nichte Wanda lernt sie das faszinierende Künstlerviertel Greenwich Village kennen – und trifft auf Franco de Lucca, der italienischen Wein nach Amerika exportiert. Mit ihm reist Marie an den Lago Maggiore zum magischen Berg Monte Verità, wo sie Tage des Glücks und der Leidenschaft verbringen. Nach einer Blitzheirat folgt Marie ihm schwanger nach Genua in den elterlichen Palazzo. Doch ihr Glück ist nicht von Dauer, schon bald kommt sie einem düsteren Geheimnis auf die Spur, und der gräfliche Palazzo wird zum Gefängnis …
Maries Nichte Wanda wünscht sich nichts sehnlicher als eine eigene Aufgabe im Leben. Als sie erfährt, dass Ruths Mann Steven gar nicht ihr leiblicher Vater ist, macht sie sich auf die Suche nach ihrer Identität – und steht plötzlich vor der größten Herausforderung ihres Lebens. In Richard, einem jungen thüringischen Glasbläser, findet sie dabei unerwartete Hilfe.
Die Autorin
Petra Durst-Benning, 1965 in Baden-Württemberg geboren, lebt als freie Autorin südlich von Stuttgart auf dem Land. Mit ihren historischen Romanen Die Zuckerbäckerin, Die Glasbläserin und Die Amerikanerin ist sie in die erste Reihe deutscher Bestsellerautorinnen aufgestiegen. Die Gesamtauflage ihrer Bücher liegt inzwischen bei zwei Millionen.
In unserem Hause sind von Petra Durst-Benning bereits erschienen:
Die Glasbläserin · Die Amerikanerin · Das gläserne Paradies ·
Die Samenhändlerin · Floras Traum (Das Blumenorakel) ·
Die Zuckerbäckerin · Die Zarentochter · Die russische Herzogin ·
Solange die Welt noch schläft · Die Champagnerkönigin · Bella Clara ·
Die Silberdistel · Die Liebe des Kartographen · Die Salzbaronin ·
Antonias Wille · Winterwind · Mein Findelhund
Petra Durst-Benning
Die Amerikanerin
Roman
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,
wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,
Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Neuausgabe
Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch
List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.
Juli 2017
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2004
© 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG
© 2002 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG München/Ullstein Verlag
Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München
Titelabbildung: www.buerosued.de
Satz: Dörlemann Satz, Lemförde
eBook-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
eBook ISBN 978-3-8437-0149-5
Für Mimi –
this one’s for you!
PROLOG
Lauscha im Thüringer Wald, März 1910
»Glänzender Reigen, gläserne Welt,
gib meiner Sehnsucht Sinn.
Begehrliche Zärtlichkeit,
die süßes Versprechen hält,
zeig den Weg zu mir hin.«
Noch spät am Abend saß Marie an ihrem Arbeitsplatz, dem Bolg. Vor sich hatte sie auf der rechten Seite eine Kiste mit Glasrohlingen und zur Linken das Nagelbrett, auf dem fertig geblasene Kugeln darauf warteten, zu einem der anderen Arbeitsplätze getragen und dort versilbert und bemalt zu werden. Obwohl Marie die Müdigkeit schon in den Knochen steckte, verspürte sie ein leichtes Hochgefühl, während sie sich auf ihre Tätigkeit konzentrierte. Nicht mehr so heftig wie damals, als sie, Marie Steinmann, mit gerade mal siebzehn Jahren den Lauschaer Männern das Privileg des Glasblasens genommen hatte. Aber es war noch da, und es flackerte auch jedes Mal auf, wenn sie beobachtete, mit welcher Selbstverständlichkeit sich inzwischen ihre Nichte Anna an den Bolg setzte und mit sicherem Griff den Gashahn öffnete.
Eine Frau als Glasbläserin? Das war in Lauscha nichts Neues mehr, jetzt hockten sogar in der Kunstglasbläserschule junge Mädchen und Burschen einträchtig nebeneinander. Marie lächelte. Zwanzig Jahre – anderswo nicht mehr als ein mildes Räuspern im belegten Rachen der Zeitschreibung, in Lauscha waren es Lichtjahre.
Zschschsch … – wie altbekannt das Geräusch! »Die Flamme muss singen, wenn das Glas gelingen soll.« Noch heute klangen ihr die Worte ihres Vaters im Ohr. Und wieder einmal fragte sie sich, was wohl Joost zu alldem sagen würde: Sie eine Glasbläserin, Johanna eine Geschäftsfrau, und dazwischen Tausende Kugeln Christbaumschmuck.
Marie reckte sich. Sie drehte die Flamme aus und stand seufzend von ihrem Hocker auf. Es war an der Zeit, zu Bett zu gehen.
Es geschah völlig unvorbereitet. Jemand stülpte ihr plötzlich von hinten etwas über den Kopf. Ihre Nase wurde gestoßen, ihr rechtes Ohr dabei schmerzhaft zusammengedrückt. Sie drehte sich hin und her, doch das Gefühl der Enge blieb.
»Was soll das?«, rief sie erschrocken. Ihre Worte hörten sich seltsam dumpf an, als ob sich ein kleines Kind einen Blechtopf vors Gesicht hielt. Nur, über ihrem Kopf befand sich kein Topf, sondern etwas Gläsernes. Eine riesengroße Käseglocke, durch ihren Atem milchig trübe beschlagen.
Was war das für ein dummer Scherz? Waren die Zwillinge Johannes und Anna mit ihren sechzehn Jahren nicht längst zu erwachsen für solche Neckereien?
Verärgert wollte Marie das Glasding selbst abnehmen, doch ihre Handinnenflächen waren feucht und rutschten immer wieder an der glatten Wandung ab. Sie hatte die perfekte Wölbung einer Kugel und war so warm, als wäre sie eben erst einer Flamme entronnen.
Die Glasfläche warf Maries heißen Atem zurück.
Es war eine Glaskugel! Deren Öffnung, obwohl perfekt abgeschnitten, dort in Maries Fleisch zu schneiden begann, wo ihr Hals in den Oberkörper überging. Vergeblich versuchte sie, zwei Finger in die Öffnung zu bekommen. Wie ein Saugnapf saß die Kugel auf ihr, luftdicht abgeschottet durch die Schwellung der Haut, die sich bereits gegen die eindringende Glaskante zur Wehr setzte.
Panik stieg in Marie auf. Kein Scherz, sondern auf Leben und Tod! Ihr Atem kam nun stoßweise, in kleinen feuchten Wölkchen, die an dem Glas kleben blieben. Die Luft wurde weniger, je mehr sie mit dem Kopf wackelte und die Kugel abzuschütteln versuchte. Ihre Angst schmeckte auf der Zunge metallisch wie ein kupferner Pfennig. Sie wollte ihre Lippen anfeuchten und stellte fest, dass sie keine Spucke mehr hatte.
»Hilfe! Warum helft ihr mir nicht?«, dröhnte ihre Stimme von weit her.
Im nächsten Moment fand sich Marie außerhalb der Glaskugel wieder. Sie wollte schon erleichtert aufatmen, als sie sich hinter dem Glas entdeckte. Drinnen? Draußen? Sie war immer noch gefangen, ihre Augen hinter dem Glas überdimensional groß wie die eines Frosches. Ihre Wangen, die sich aufbliesen wie die Kiemen eines Fisches. Lachhaft. Pathetisch. Armselig. Schweiß rann ihr über die fahle Stirn und hinunter bis zum Hals, ohne dass ein kalter Tropfen den gläsernen Gefängniswänden entrinnen konnte.
Luft! Sie brauchte Luft zum Atmen. Ein lautes Summen schwirrte um ihren Kopf, wurde noch lauter. Sie wollte sich die Ohren zuhalten und hatte doch wieder nur Glas in der Hand.
Plötzlich ahnte sie, dass sie ersticken würde.
Sie schrie und schrie und schrie …
Im nächsten Moment fand sie sich aufrecht sitzend wieder, ihr Nachthemd von Schweiß getränkt, Magnus’ Arm um ihre Schultern, seine beruhigenden Worte im Ohr.
Ein Traum. Alles war nur ein Traum. Dennoch dauerte es lange, bis sich Maries Atem beruhigt hatte und sie ihre Hand von ihrem noch immer engen Hals nehmen konnte.
Es war fünf Uhr morgens.
Matt legte sie sich wieder zurück, nicht sicher, ob sie noch einmal einschlafen wollte.
Magnus schaute sie mit besorgter Miene an.
Um kein Gespräch anfangen zu müssen, schloss Marie die Augen. Was für eine tolle Art, seinen Geburtstag zu beginnen!
*
»Marie! Ich hätte nicht gedacht, Sie heute bei mir begrüßen zu dürfen.« Alois Sawatzkys Verbeugung war vollendet. »Ich wünsche Ihnen von Herzen nur das Beste zu Ihrem Freudentag.« Er half ihr aus dem Mantel und hängte ihn an einem wackligen Haken hinter der Tür auf.
»Dass Sie sich meinen Geburtstag gemerkt haben …« Sie strich ein paar Regentropfen aus ihrer Stirn. Die feuchten Stellen an ihren Ärmeln, wo der Regen durch den Mantel gedrungen war, schienen sie nicht zu stören.
Der Buchhändler hatte noch nie erlebt, dass sie mit einem Regenschirm gekommen wäre. Der Aufwand, diesen zu tragen, war Marie Steinmann scheinbar lästiger, als nass zu werden.
»Bedauerlicherweise ist das Wetter heute alles andere als einem Festtag gemäß. Gibt es etwas Unangenehmeres als diesen beharrlichen Märzregen?«
»Das ist leider nicht das Einzige, was heute wenig an einen Festtag erinnert«, bemerkte Marie seufzend. »Am besten warne ich Sie gleich vor: Meine Laune lässt heute sehr zu wünschen übrig.«
Sawatzky hob fragend die Augenbrauen. Da sie ihre letzte Bemerkung nicht weiter ausführte, sagte er: »Was halten Sie von einem Glas Tee? Ich habe gerade frischen aufgebrüht.«
»Schaden kann er auf keinen Fall.« Ohne Umstände ließ sich Marie in einen der abgewetzten Ledersessel fallen, die er für seine Kunden aufgestellt hatte. Schmunzelnd bemerkte Sawatzky, dass sie selbst an ihrem Geburtstag ihre übliche Arbeitskluft trug. Mit ihren Beinkleidern hätte Marie Steinmann jedem Enfant terrible der Berliner oder Münchner Kunstwelt Konkurrenz gemacht – doch interessanterweise schienen sich die Leute hier an ihrem Aufzug weniger zu stören als an ihrem Beruf. Oder war es einfach so, dass man sich bei Marie Steinmann über nichts mehr wunderte?
Gekonnt balancierte er zwei Gläser Tee durch die schmalen Gänge, ohne auch nur einmal an einem der mannshohen Bücherstapel anzuecken. Nachdem er ein Glas auf dem Tischchen vor Marie abgestellt hatte, setzte er sich ihr aufseufzend gegenüber. Seine Arthrose hatte ihn am Morgen so geplagt, dass er mit dem Gedanken gespielt hatte, seinen Laden heute geschlossen zu lassen. Nun war er froh, seiner Schwäche nicht nachgegeben zu haben. Schon lange war Marie mehr als eine gute Kundin. Im Laufe der neunzehn Jahre, die sie sich nun kannten, war sie für ihn so etwas wie eine jüngere Schwester geworden, die er nie gehabt hatte.
Bedächtig rührte er in seinem Tee, und Marie tat es ihm gleich. Eine Zeitlang war nur das Klirren der kleiner werdenden Kandisbrocken zu hören.
In diesem Teil des Raumes, wo es genauso gemütlich war wie im Rest des Ladens, konnte ein Kunde ein Buch anlesen oder es einfach nur durchblättern. Hier traf man sich außerdem in angeregter Runde, um sich an Goethe und Schiller zu ergötzen, aber auch, um hitzig über die Werke neuer, junger Dichter zu diskutieren. Ja, Alois Sawatzkys Diskussionszirkel hatte in Intellektuellenkreisen weit über Sonneberg hinaus einen guten Ruf. Dasselbe galt für sein Bücherangebot, das in Umfang wie Qualität manche großstädtische Buchhandlung in den Schatten stellen konnte.
»Sie sehen etwas müde aus«, bemerkte er nun über den Rand seines Glases hinweg. »Haben Sie Ihren Geburtstag etwa schon vorgefeiert? Heißt es nicht, das brächte Unglück?«
Marie winkte ab. »Ein bisschen Unglück würde ich gern in Kauf nehmen, wenn es Hand in Hand mit etwas Abwechslung ginge. Davon abgesehen, dass Johanna und die anderen darauf bestanden haben, dass ich mir freinehme, ist heute ein Tag wie jeder andere.«
Wieder einmal wunderte er sich über den Mangel an Leichtigkeit bei der jungen Frau. Wie viel lieber hätte er es gesehen, Marie Steinmann hätte sich heute feiern lassen! Hätte ihre dunkelbraunen Haare zu Locken aufgedreht, ein hübsches Kleid angezogen und sich von einem Herzallerliebsten ausführen lassen, statt hier mit ihm altem Mann zu sitzen!
»Das müssen wir dringend ändern!« Er stand auf und verschwand erneut in den Tiefen seines Ladens. Im nächsten Moment kam er mit einer Flasche und zwei Gläsern zurück. »Es ist zwar erst früher Nachmittag, aber darf ich Sie trotzdem auf einen Sherry einladen?«
Ohne Maries Antwort abzuwarten, schenkte er je zwei Fingerbreit der goldbraunen Flüssigkeit ein. Wo Tee nicht mehr half, hatte Sherry bisher selten versagt.
»Auf Ihr Wohl!«
Immerhin nahm sie ihr Glas auf.
»Und auf Ihres«, prostete sie zurück.
Dann beugte er sich ihr entgegen. »So. Und jetzt erzählen Sie mir, was Sie auf dem Herzen haben. Und kommen Sie mir bloß nicht damit, dass alles in Ordnung wäre!«
Marie verzog den Mund. »Eigentlich ist es das schon. Im Grunde ist es lachhaft, aber …« Sie zögerte noch einen Moment, doch dann erzählte sie ihm ihren Traum.
»Ich habe wirklich geglaubt, ich müsste ersticken«, endete sie. Sie wirkte noch immer erschüttert. »Dem armen Magnus ist der Schrecken durch Mark und Bein gefahren, so laut habe ich geschrien!« Sie stieß die Luft aus. »Gott sei Dank war alles nur ein Traum. Mir ist immer noch ganz unheimlich zumute, wenn ich nur daran denke.«
Sawatzky kratzte sich am Kopf. »Sigmund Freud würde seine wahre Freude an Ihnen haben«, sagte er trocken.
Marie blickte den Buchhändler schräg an. »Kommen Sie mir bitte nicht schon wieder mit diesem Herrn Freud und seinem Unterbewusstsein! Warum, so frage ich mich, kann der Mensch nicht etwas wirklich Sinnvolles entdecken?« Die Ironie triefte nur so aus jedem Wort. Als Sawatzky nicht gleich antwortete, fuhr sie fort: »Dinge, die das Leben der Menschen erleichtern. Maschinen und so …«
Seltsam, dass Marie stets so heftig reagierte, wenn er es wagte, die Rede auf den Psychoanalytiker zu bringen, dachte der Buchhändler nicht zum ersten Mal. Ansonsten war sie Menschen mit neuen Ideen gegenüber doch recht aufgeschlossen!
»Das Unterbewusstsein, so man sich dessen bewusst ist, kann durchaus geeignet sein, das Leben der Menschen zu erleichtern«, erwiderte er etwas schulmeisterlich. »Aber lassen wir das. Wir wollen doch an Ihrem Freudentag nicht streiten. Und wenn, dann nur konstruktiv.«
Er sprang auf.
»Wissen Sie was? Sie suchen sich jetzt ein Buch aus, das Ihnen gefällt, und ich schenke es Ihnen!« Es wäre doch gelacht, wenn es ihm nicht gelänge, auf dieses verkniffene Frauengesicht wenigstens den Hauch eines Lächelns zu bringen! Auf ihr Zögern hin fügte er hinzu: »Es darf auch einer der teuren Bildbände sein, die Sie so lieben. Nein, nein, Proteste lasse ich heute nicht zu!« Abwehrend hob er beide Hände, da Marie prompt widersprechen wollte.
Zögerlich stand sie auf. Doch sie hatte die erste Reihe Bücher noch nicht durchgesehen, als sie sich zu Sawatzky umdrehte. »Es hat keinen Sinn.« Kopfschüttelnd ging sie zu ihrem Sessel zurück und setzte sich, die Tränen mühsam hinter den Lidern zurückhaltend. »Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ihnen so die Freude zu verderben …«
Er schwieg.
Fast mutlos hob Marie schließlich den Kopf. »Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich geglaubt, in diesen Büchern würde ich die Welt entdecken. Jede Zeile habe ich verschlungen, jeden Bildband stundenlang studiert! Manchmal habe ich mich richtig verbunden gefühlt mit all den Malern und Schriftstellern. Aber hat es mir etwas gebracht? Weiterbilden wollte ich mich. Meine künstlerische Entwicklung fördern. Hah!«
Im Grunde genommen hatte er schon seit längerem mit einem solchen Ausbruch gerechnet. Dass Marie Steinmann nicht glücklich war, konnte jeder Trottel erkennen. Trotzdem erschreckte ihn ihre Heftigkeit.
»Von wegen die Welt entdecken! Das tun andere. Ihr Sigmund Freud findet sein Unterbewusstsein, Franz Marc malt blaue Pferde, dieser Alfred Döblin, von dem Sie mir letzte Woche etwas zu lesen gegeben haben, schreibt über den Mord an einer Butterblume – wie kann man nur auf so eine verwegene Idee kommen?« Geradezu vorwurfsvoll starrte sie den Buchhändler an. »Und ich male Sternchen und Girlanden und Weihnachtsglocken auf Christbaumkugeln. Wie eh und je.« Sie schluckte hart. »Und das nicht einmal mehr gut.« Marie starrte vor sich hin.
Marie Steinmann. Die jüngste der drei Steinmann-Schwestern. Die erste Frau, die es gewagt hatte, sich an den Bolg zu setzen und Glas zu blasen. Während andere Lauschaer Frauen damit zufrieden waren, das zu tun, was seit Jahrhunderten in der Glasherstellung als ihre Aufgabe galt, nämlich Glasbläser zu heiraten und deren Glaswaren zu versilbern und zu bemalen, hatte sie sich als junges Mädchen heimlich an den Bolg ihres verstorbenen Vaters gesetzt und so lange in der Verborgenheit der Nacht das Handwerk geübt, bis sie es gemeistert hatte. Und danach hatte sie im Laufe der Zeit den schönsten Christbaumschmuck hergestellt, den Lauscha bis dahin gesehen hatte. Glaskugeln von einer Poesie, von einem Glanz und einer Kunstfertigkeit, dass sie selbst die dunkelste Hütte in der Heiligen Nacht zum Strahlen brachten. Der Neid und die Anfeindungen waren nicht ausgeblieben, der Erfolg jedoch auch nicht: Was als Familienunternehmen im kleinsten Sinne – mit Marie als Glasbläserin und ihren Schwestern Johanna und Ruth als Helferinnen – begonnen hatte, beschäftigte heute mehr als zwanzig Arbeiter. Zehntausende von Kugeln aus der Glasbläserei Steinmann-Maienbaum wurden alljährlich in die ganze Welt verschickt und ließen Kinderaugen glänzen. Während die meisten Lauschaer Glasbläser über die schlechte Wirtschaftslage und über zu wenige Aufträge klagten, konnte die »Weiberwirtschaft«, wie der Betrieb auch genannt wurde, dank Johannas Geschäftstüchtigkeit und Maries stetig sprudelnder Kreativität an Wachstum sogar noch zulegen. Auch Ruth, die mittlere der Schwestern, die der Liebe wegen vor vielen Jahren Lauscha in Richtung Amerika verlassen hatte, kümmerte sich nach wie vor um das Wohl des Glasbläserbetriebes, indem sie seine amerikanischen Geschäftsverbindungen pflegte.
Viele Lauschaer mussten zusehen, wie ihre Kinder in die Stadt zogen, um sich ihren Lebensunterhalt in den wie Pilze aus dem Boden schießenden Fabriken zu verdienen. Für die Zwillinge von Johanna und Peter Maienbaum hingegen gab es keinen Zweifel daran, dass sie bleiben und die Familientradition fortführen würden.
Als hätte sie Sawatzkys Gedankengänge verfolgt, sprach Marie weiter: »Natürlich bin ich froh und glücklich, dass sich unser Christbaumschmuck nach wie vor so gut verkauft. Gerade heutzutage … Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die anderen merken, dass meine Fantasie aufgebraucht ist. Ständig fühle ich mich so müde, so leer! Finde alles so unsäglich gewöhnlich. Wann immer ich mir etwas Neues ausdenke, habe ich das Gefühl, dasselbe schon einmal gemalt zu haben. Am liebsten würde ich all die banalen Kritzeleien in den Papierkorb werfen, aber unser jährlicher Musterkatalog will schließlich bestückt werden! Und aus Amerika kommen auch ständig Anfragen nach neuen Entwürfen. Vor allem Woolworth drängt und drängt … Kann es sein, dass ich meinen Vorrat an Ideen aufgebraucht habe? All meine Kugeln entworfen?« Ihre Augen weiteten sich plötzlich vor Angst, als traue sie sich gerade zum ersten Mal, diesen Gedanken zu äußern.
Sawatzky schaute auf ihre angespannten Schultern, auf die schmale, trotzige Nase, die dunkelgrauen Augen, in denen tausend Funken unbemerkt verglühten.
Aus dem Nichts tauchte das Bild einer anderen Marie vor ihm auf: Gerade einmal achtzehn Jahre war sie alt gewesen, schlank wie eine Elfe, die Stirn schon damals hoch, die Wangen schmal – und mit Augen, in denen jeder Mann nur allzu gern ertrunken wäre, wenn sie dies zugelassen hätte. Aber Marie hatte nur ihre Handwerkskunst im Kopf gehabt und sich von nichts und niemandem ablenken lassen. Die Erinnerung ließ ihn lächeln. Als er sie damals zum ersten Mal zu den Regalen mit den Büchern über die bildenden Künste geführt hatte, hatte sie nicht glauben wollen, dass so viele andere ihre Leidenschaft teilten.
»Das alles sollen Bücher über die Kunst sein?!«
Wie groß war ihre Gier gewesen! Alles Geld, das sie mit ihrem ersten Glasbläserauftrag verdient hatte, gab sie für seine Schätze aus. Mit einem riesigen Bücherstapel unter dem Arm und einem seligen Lächeln war sie erst nach Stunden von ihm gegangen, gefolgt von Magnus, dessen offene Bewunderung die junge Künstlerin nicht einmal bemerkt hatte.
Rein äußerlich hatte Marie sich kaum verändert, sie besaß immer noch ihre Jungmädchenfigur, ihr Jungmädchengesicht mit den großen Augen und den hohen Wangenknochen. Besorgt kaute Sawatzky auf seiner Unterlippe. Dass ein Künstler in ein unkreatives Loch fiel, war nichts Ungewöhnliches. Aber dass ein Bücherliebhaber seiner großen Liebe frei entsagte, war mehr als bedrohlich.
Plötzlich hatte er nicht übel Lust, aufzustehen und die junge Frau an den Schultern zu schütteln. Stattdessen sagte er:
»Was Ihnen fehlt, ist eine neue Quelle der Inspiration! Sie sind einfach zu lange durch den Wald gelaufen. Haben zu lange das Gefieder der Meisen und Finken studiert. Und dass die Struktur von Tannenzapfen nicht für eine jahrzehntelange Interpretation geeignet ist, wundert mich auch nicht – ich persönlich konnte mit Naturbeobachtungen noch nie sehr viel anfangen!«
Marie runzelte die Stirn. Sie wurde nicht gern kritisiert, aber sie kannten sich lange und gut genug, dass der Buchhändler sich darüber hinwegsetzen konnte.
»Was Ihnen fehlt, liebe Marie, ist die Befruchtung durch andere künstlerische Kräfte! Niemand, auch die große Glasbläserin Marie Steinmann nicht« – er zwinkerte ihr zu, um seinen Worten den Spott zu nehmen –, »kann für alle Zeiten nur aus sich selbst schöpfen.«
Einer Eingebung folgend langte er hinter sich und holte von einem der Bücherberge ein schmales, abgegriffenes Bändchen herunter. Es war das Buch, das die Dichterin Else Lasker-Schüler ihrem verstorbenen Freund Peter Hille gewidmet hatte. Schon seit längerem hatte er vorgehabt, Marie an Elses Lyrik heranzuführen. Die Dichterin tat in ihren Gedichten und Geschichten mit ihrer Sprache nämlich genau das, was Marie mit ihrem Arbeitsmaterial anstrebte: es bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit zu testen und zu verwenden. Nach kurzem Blättern fand er die Stelle, die er gesucht hatte. Dennoch zögerte er. Würde sich Marie – in ihrer verschlossenen Stimmung – die nicht gerade leicht verdauliche, doppeldeutige Symbolik erschließen? In der Vergangenheit hatte sie ihn schon des Öfteren mit ihrem Einfühlungsvermögen für schwierige Texte verblüfft. Also war es einen Versuch wert, beschloss er und reichte ihr das aufgeschlagene Buch.
»Würden Sie so freundlich sein und dies für uns beide vorlesen?«
Unwillig beugte sie sich seinem Wunsch.
»… war ich aus der Stadt geflohen und sank erschöpft vor einem Felsen nieder und rastete einen Tropfen Leben lang, der war tiefer als tausend Jahre …«
Mit geschlossenen Augen lauschte der Buchhändler Maries Stimme, die sich an der eigenwilligen Wortwahl der rebellischen Dichterin rieb.
»… Und eine Stimme riss sich vom Gipfel des Felsens los und rief: ›Was geizt du mit dir!‹ Und ich schlug mein Auge empor und blühte auf, und mich herzte ein Glück, das mich auserlos.«
Maries Sehnsucht und die Poesie der Erzählung begannen von Wort zu Wort zu einem Guss zu verschmelzen. Sawatzkys Herz klopfte heftig und bewegt.
»… Und vom Gestein zur Erde stieg ein Mann mit hartem Bart- und Haupthaar, aber seine Augen waren samtne Hügel …«
Der Buchhändler sah Marie eindringlich an. Würde sie es übertrieben finden, dass Else ihren Freund Peter mit Petrus, dem Felsen verglich? Diese Heroisierung hatte in Intellektuellenkreisen einige Diskussionen ausgelöst, doch Marie las über die Stelle hinweg, ohne einen Kommentar abzugeben.
»… die Nacht hatte meine Wege ausgelöscht, auch konnte ich mich nicht auf meinen Namen besinnen, heulende, hungrige Norde hatten ihn zerrissen. Und der mit dem Felsennamen nannte mich Tino. Und ich küsste den Glanz seiner gemeißelten Hand und ging ihm zur Seite.«
Der Buchhändler hatte seine Augen geschlossen. Als er sie wieder aufschlug, sah er, dass Marie Tränen über die Wangen liefen. Und er wusste, dass er seinen Text richtig gewählt hatte.
»Warum tun Sie mir das an? Warum quälen Sie mich so?« Maries Blick war verzweifelt. Geräuschvoll zog sie die Nase hoch.
»So fühlen zu können! Nicht mehr zu wissen, wo man ist. Wer man ist. … konnte ich mich nicht auf meinen Namenbesinnen, heulende, hungrige Norde hatten ihn zerrissen«, wiederholte sie die bewegenden Worte. »Und dennoch zu wissen, dass man auserkoren ist und seine Zeit nicht verschenken darf!« Ihre Augen glänzten. »Ein Glück, das mich auserlos – diese Frau darf sich wirklich glücklich schätzen.«
Marie schwieg für einen Moment. Dann hob sie erneut an:
»Aber was soll das alles mit mir zu tun haben? Ich habe keinen väterlichen Freund – von Ihnen abgesehen –, der mich dermaßen inspiriert. Und ich lebe auch nicht in einer Großstadt, führe kein aufregendes Leben. Wer oder was sollte mich also ›künstlerisch‹ befruchten? Ich sitze in meinem kleinen Dorf, mit Magnus an meiner Seite und mit meiner Familie, die auf mich und meine Entwürfe angewiesen ist.«
»Aber das liegt doch nur an Ihnen«, sagte Sawatzky mit mehr als einem Hauch Ungeduld. Und er konnte nicht umhin, etwas spröde anzufügen: »Auch Else hat sich erst von ihrem Elternhaus frei machen, hat in die Stadt fliehen müssen, wie Sie gerade eben selbst gelesen haben.«
Marie schaute gereizt auf. »Ich weiß, ich weiß, jeder muss seine eigenen Wege gehen. Jetzt erzählen Sie mir sicher gleich wieder von dieser Malerin, die es vorgezogen hat, als verkannte Malerin zu sterben, statt sich jemals einem Zeitgeist zu unterwerfen. Paula Modersohn-Becker war ihr Name, oder?« Sie hielt ihren Zeigefinger an die Stirn, als denke sie angestrengt nach. »Oder von einer jener Dichterinnen, die zwar nichts zu essen haben, dafür aber kompromisslose Gedichte schreiben.«
»Der Spott steht Ihnen nicht«, sagte der Buchhändler und schaute dabei angestrengt auf seine Schuhspitzen. »Ich …«
Sie ergriff seine Hand, bevor er weitersprechen konnte. »Entschuldigung. Es war nicht so gemeint, und das wissen Sie. Ich bin heute eine ziemlich dumme Kuh, das ist alles. Und eine undankbare noch dazu.« Sie biss sich auf die Lippen.
Halbwegs versöhnt schaute er wieder auf. »Sie hatten noch nie etwas für Vorbilder übrig, nicht wahr?«
Marie zuckte mit den Schultern. »Was würde mir ein Vorbild auch nutzen? In Lauscha habe ich noch keines gefunden. Ich habe mich doch schon längst von dem Leben unserer Väter und Mütter frei gemacht! Darin sehe ich nichts Revolutionäres mehr. Was also sollte ich mit den Frauen von Welt, die Sie so gern anführen, gemeinsam haben?«
»Die Welt, zum Beispiel«, sagte er mit einer lässigen Handbewegung.
Marie lachte. »Wie Sie das sagen! Als ob die Welt ein Stück Kuchen wäre, nach dem man nur greifen muss, um es sich dann gabelweise zu Gemüte zu führen.«
Auch Sawatzky musste lachen. Dieser Vergleich war typisch für Marie. Er seufzte. »Ganz so einfach ist es nicht – Gott sei Dank, möchte ich anfügen! Aber glauben Sie nicht, dass es endlich an der Zeit wäre, Lauscha einmal zu verlassen? Wenigstens ein bisschen von der Welt zu sehen?« Am liebsten hätte er sie an ihren Traum erinnert und auf seine tiefere Bedeutung hingewiesen. Stattdessen sagte er: »Sehen Sie es doch einmal so: Jede von Ihnen geblasene Weihnachtskugel kommt in der Welt weiter als Sie – ist dieser Gedanke nicht ziemlich erschreckend?«
ERSTES BUCH
New York, drei Monate später
»Und als die Nacht zum Tag
und der Tag zum Traume wurde,
zerfielen alle Fragen
zu glitzerndem Staub.«
1
Schraft’s war der beste Delikatessenladen der Stadt. Wem das Geld für einen Eintritt ins Paradies nicht reichte, der ergötzte sich an den ständig wechselnden Schaufensterauslagen, die in ihrer Kunstfertigkeit mit den besten Galerien der Stadt konkurrieren konnten. Mehr als ein Dutzend Mal pro Tag mussten die Reinemachefrauen nach draußen gehen, um Finger- und Nasenabdrücke von den Fensterscheiben zu wischen, so groß war die Sehnsucht der Passanten, dem Schlaraffenland so nahe wie möglich zu kommen. Kaum jemand, der es sich leisten konnte, dort einzukaufen – und manch einer, der es sich eigentlich nicht leisten konnte –, war standhaft genug, an der Drehtür vorbeizugehen und die ausschwärmenden Wohlgerüche zu ignorieren … Nur ein kurzer Rundgang, eine winzige Kleinigkeit kaufen. Musste das nicht nach einem Tag anstrengender Arbeit erlaubt sein? Eine Ecke Käse. Oder drei handgerollte Trüffel. Oder eine Handvoll der dunkellila glänzenden Pflaumen. Meistens scheiterten solche bescheidenen Vorsätze schon wenige Schritte hinter der Drehtür, wo eine Vielfalt, die weltweit ihresgleichen suchte, darauf wartete, zu betören und zu verführen, und am Ende verließen die meisten das Geschäft mit einer prall gefüllten hellblauen Schraft’s-Tüte.
Obst, Gemüse, Wurst, Käse, fertige Speisen – bei Schraft’s gab es nahezu alles. In der Backwarenabteilung standen Körbe mit Ficelles, den dünnen französischen Weißbroten aus Sauerteig, neben süditalienischen Biscotti, daneben türmten sich mit Melasse tiefschwarz gefärbte Pumpernickel-Laibe. In der Käseabteilung hatte der Kunde die Wahl zwischen 80 Sorten, eine Ecke weiter konnte er zwischen Blue-Point-, Chesapeake-Bay- und Pine-Island-Austern wählen. Um sich die Entscheidung leichter zu machen, konnte er sich gleich an Ort und Stelle entweder ein halbes Dutzend Austern – nur mit etwas Salz und Zitrone gewürzt – zu Gemüte führen oder eine Portion von Schraft’s unvergleichlichem Oyster Stew genießen. Während die Sinne des Kunden noch damit beschäftigt waren, das Geschmackserlebnis der in Sahne, Butter und Rosmarin geschmorten Austern zu würdigen, wanderte sein Blick vielleicht schon zur fast zehn Meter langen Theke, hinter der sich kalte Platten mit Häppchen aneinanderdrängten. Ob für ein intimes Dinner für acht Personen oder eine Tafel für dreißig – kaum eine Gastgeberin konnte es sich leisten, nicht wenigstens für einen Gang Schraft’s Häppchen einzuplanen. Die Spezialitäten des Delikatessenladens gehörten zu einem stilvollen Essen wie handgewebte Leinenservietten oder Tafelsilber von Tiffany.
Wer gut genug bei Kasse war, ließ sich sogar die ganze Feierlichkeit von den versierten Schraft’s-Experten ausrichten, für die kein Aufwand zu groß, kein ausgefallener Wunsch des Gastgebers zu verwegen war. Drei Dutzend polnische Piroggen, gefüllt mit russischem Kaviar? Kein Problem, Madam! Ein Bankett für hundertdreißig Personen in fünf Stunden? Nicht unproblematisch, dennoch können Sie sich auf uns verlassen! Die Hektik, die nach solchen Aufträgen ausbrach, fand lediglich hinter den Kulissen statt, wo Köche sich um die Gasflammen stritten, Küchenjungen im Rekord Gemüse putzten und Weintrauben zupften. Die Ware, die nach solchen Schlachten ausgeliefert wurde, war stets von bester Qualität und mit einer Sorgfalt zubereitet, als hätten die Köche die ganze Woche lang nichts anderes getan.
Es war dieser Perfektionismus, der Wanda so faszinierte. Dass sie Teil dieser vollkommenen Maschinerie war, dass ihre Arbeit dazu beitrug, solche Leistungen zu vollbringen, erfüllte sie mit Stolz.
Natürlich hatte ihre Mutter die Nase gerümpft, als Wanda ihren Entschluss, als Servicedame bei Schraft’s anzufangen, kundtat.
»Was ist Unehrenhaftes daran, Lebensmittel zu verkaufen?«, hatte Wanda von ihr wissen wollen, noch bevor Ruth einen Ton sagen konnte. Vielleicht hatte sie aber auch gar nichts sagen wollen. Vielleicht war ihr im tiefsten Herzen sogar gleich, womit Wanda ihre Tage verbrachte. Wanda zog es jedoch vor, sich vorzustellen, dass Ruth unter ihrem Entschluss litt.
»Es ist gar nichts Unehrenhaftes daran, Lebensmittel zu verkaufen. Es ist genauso wenig unehrenhaft wie das Zubereiten von Lebensmitteln«, hatte Ruth erklärt. »Ich frage mich, warum du nicht gleich Köchin wirst.«
»Was nicht ist, kann ja noch werden«, hatte Wanda erwidert. Ein bisschen ärgerte es sie schon, dass ihre Mutter nicht so schockiert über ihre neue Arbeitsstelle war, wie sie es sich vorgestellt hatte.
Sie zog sich ein letztes Mal die blütenweiße, gestärkte Schürze zurecht – demonstrativ hatte sie sie schon zu Hause umgebunden, statt dies wie die anderen Servicedamen erst im Laden zu tun – und schaute erwartungsvoll in Richtung Tür.
Nun arbeitete sie schon seit zweieinhalb Wochen hier. Bisher war jeder Tag wie eine große Wundertüte gewesen – man wusste morgens nie, was einen erwartete. Und was das Beste war: Mason Schraft schien mit ihr zufrieden zu sein. Gesagt hatte er zwar noch nichts, aber wann immer er an ihrer Theke vorbeikam, nickte er ihr freundlich zu, während er manche ihrer Kolleginnen nicht einmal eines Blickes würdigte. Lag das daran, dass sie weniger unter der Hektik litt als die meisten anderen Mädchen? Dass sie im größten Trubel die Übersicht behielt und nicht einmal in ihren ersten Tagen einen Fehler beim Aufnehmen der Bestellungen, beim Bedienen und Kassieren gemacht hatte? Oder besser noch: Hatten sich womöglich Kunden lobend über ihre Beratung geäußert? Davon, dass sie, Wanda Miles, aus einem der elegantesten Haushalte von ganz Manhattan stammte, konnten ihre Kunden nur profitieren, oder etwa nicht? Dass ihre Mutter eine der angesehensten Gastgeberinnen und selbst Kundin von Schraft’s war, legte doch ausreichend Zeugnis von Wandas Gespür für Kundenwünsche ab, oder etwa nicht? Wer konnte besser auf die wählerischen Damen der feinen Gesellschaft eingehen als jemand, der in deren Mitte aufgewachsen war?, hatte Wanda gegenüber Mister Schraft argumentiert, der befürchtet hatte, dass es den feinen Damen der Gesellschaft vielleicht gar nicht recht wäre, von ihr bedient zu werden. Doch letztendlich hatte er sich von Wandas Eifer breitschlagen lassen.
»Die Feste sind ja in dieser Saison so langweilig geworden! Kein Esprit mehr! Keine neuen Ideen! Ständig wird das wiedergekäut, was schon auf anderen Einladungen serviert wurde.« Monique Demoines, Frau von Charles Demoines, einem der einflussreichsten Broker vom Bankhaus Stanley Finch, fächerte sich theatralisch Luft zu. Fast angeekelt wanderte ihr Blick dabei über die Auslagen.
Wanda fuhr mit einem blitzsauberen Lappen über den Rand einer Platte mit gefüllten Eiern, um einen unsichtbaren Fussel zu entfernen. »Aber Gnädigste! Ich bin mir sicher, dass Sie nicht zu diesen Wiederkäuern gehören.«
Monique hielt in der Betrachtung ihrer perfekt lackierten Fingernägel inne. Bildete sie es sich ein, oder war Wandas Lächeln tatsächlich weniger beflissen, als sie es sonst bei Schraft’s gewöhnt war? Entdeckte sie gar einen Hauch Ironie darin?
»Genauso wenig wie deine Mutter«, erwiderte sie mit einem leichten Stirnrunzeln und seufzte. Dass die junge Miles neuerdings bei Schraft’s arbeitete, daran hatte sie sich immer noch nicht gewöhnt. Gott sei Dank würde Minnie, ihre eigene Tochter, eher tot umfallen, als sich hier zehn Stunden am Tag die Füße in den Bauch zu stehen! Aber galt nicht auch Ruth Miles – mochte ihre Gastfreundschaft noch so legendär sein – als ein wenig exzentrisch? Für Monique war jede Frau, die einen Adelstitel mit in die Ehe brachte und dann auf diesen verzichtete, mehr als das! Nun ja, der Apfel fiel bekanntlich nicht weit vom Stamm … Mit einem Seufzen erinnerte sie sich schließlich daran, warum sie eigentlich gekommen war.
»Deine Mutter kann sicher auch ein Lied davon singen: Zu viele Partys, zu viele Gäste, und niemand weiß mehr die Anstrengungen einer wahrhaften Gastgeberin zu schätzen.« Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. »Aber was nutzt das Jammern, sage ich immer. Tun muss man etwas! Tun!«
Wenn du keine anderen Sorgen hast, kannst du dich glücklich schätzen!, schoss es Wanda durch den Kopf. Laut sagte sie: »Es gibt Damen, die sind zur Gastgeberin geboren.« Sie straffte die Schultern. »Kann es sein, dass Sie sich für Ihre nächste Einladung etwas ganz Besonderes haben einfallen lassen? Dass sie womöglich schon einen kompletten Plan im Kopf haben? Sie wissen ja – wir bei Schraft’s sind Ihnen bei der Umsetzung jederzeit behilflich.« Wir bei Schraft’s – wunderbar!
Monique Demoines’ Schultern strafften sich. Die kleine Miles kannte sich aus! Wahrscheinlich hatte Ruth ihrer Tochter von einer ihrer Einladungen vorgeschwärmt. Sie machte sich in Gedanken eine Notiz, die Gästeliste für das bevorstehende Fest um Wandas Eltern zu erweitern, doch dann fiel ihr ein, dass sie vergeblich auf eine Einladung zu Ruths letzter Party gewartet hatte. Mit einem Wisch waren Stevens und Ruths Namen wieder ausradiert.
»Und ob ich einen Plan habe!«, sagte sie triumphierend. »Nicht nur im Kopf, sondern alles längst notiert. En détail, versteht sich.«
Monique begann in den Tiefen ihrer Handtasche zu kramen. Nach einiger Zeit schaute sie mit einem ungeduldigen Seufzer auf, einen Stapel zusammengefalteter Zettel in der Hand.
»Was ich vorhabe, wird ein kleines Beben unter meinen Gästen auslösen. Ja, ich gebe es zu: Ich möchte schockieren!« Sie spitzte ihre Lippen, als erwarte sie Wandas Widerspruch. Da dieser nicht kam, blätterte sie weiter in ihren Zetteln.
Wanda wartete geduldig.
»Natürlich will auch ich meine Gäste verwöhnen, aber in erster Linie möchte ich ihnen klarmachen, wie verwöhnt wir alle sind – nein, nein, ich nehme mich nicht aus! Wer kann sich denn bei all dem Überfluss noch an einer einzelnen Speise erfreuen? Sie als Gottes Gabe wahrnehmen?«
Sie machte eine weit ausholende Handbewegung, die Schraft’s Delikatessentheken einschloss.
»Man kann sagen, ich wage mich an eine allegorische Umsetzung der Vertreibung aus dem Paradies.« Andächtig hob Monique den Blick nach oben, als erwarte sie für diesen Geistesblitz hier und jetzt Gottes Lob.
»Ein kulinarisches Gleichnis sozusagen.« Wanda nickte angestrengt. »Das wird Ihre Gäste sicher aufs Äußerste beeindrucken!« Du liebe Güte – das war selbst für Monique Demoines starker Tobak!
»Hier ist er!« Mit einem Siegerlächeln reichte Monique ein zusammengefaltetes Papier über die Theke. Doch bevor Wanda danach greifen konnte, zog Monique es nochmals zurück.
»Damit wir uns verstehen … Ich erwarte höchste Diskretion. Gerade bei dieser Einladung darf nicht das Geringste nach außen dringen. Wenn du erst siehst, was ich vorhabe, wirst du verstehen, was ich meine …« Hektisch schaute Monique über ihre Schulter, als rechne sie mit einer Schar von Hyänen, die nur darauf lauerten, von ihrem Ideenschatz als Gastgeberin zu stehlen.
Wanda legte ihren Zeigefinger an die Lippen. »Ich werde schweigen wie ein Grab. Und ich werde noch etwas tun: Ein so brisantes Unternehmen verlangt schließlich auch außergewöhnliche Maßnahmen unsererseits.« Sie winkte Monique ein wenig näher heran. »Ich werde Ihre Bestellung gleich bei den Köchen – ohne den Umweg durch unsere Auftragsabteilung – abgeben! Ich werde auch dafür sorgen, dass niemand einen Blick auf die fertigen Speisen erhaschen kann. Spione lauern schließlich überall …«, flüsterte sie. Hah, wenn Mister Schraft wüsste, wie zuvorkommend sie auf eine seiner wichtigsten Kundinnen einging! Als wagte nicht einmal sie es, einen Blick auf Moniques Bestellung zu werfen, steckte sie den zusammengefalteten Zettel unbesehen in ihre Schürzentasche und knöpfte diese dann zu.
»Ihre Gäste werden eine Überraschung erleben, die sie nie wieder vergessen!«
*
Am anderen Ende der Stadt, im Frachthafen, wo täglich Hunderte von Transportkisten aus der ganzen Welt ausgeladen wurden, besiegelten zwei Männer ebenfalls ein Geschäft.
Während der kleinere, gedrungene Mann einen Umschlag in seine Jackentasche schob, schloss der größere der beiden mit einer energischen Bewegung seinen Attachékoffer.
»Ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit, Mister Sojorno«, sagte er. »Ihre Vorbereitungen sind uns eine große Hilfe. Nicht jeder Lagervorsteher würde sich so … kooperativ verhalten. Mein Vater und ich gehen davon aus, dass dies auch zukünftig so bleiben wird.«
Kooperativ – was soll dieser Mist, fragte sich der Angesprochene. Sie hatten ihn in der Tasche, und das wussten sie auch! Das Geld, das er für seine Dienste kassierte – auch wenn es ein erklecklicher Betrag war –, würde ihm hinter Gittern wenig helfen. Sich den Schweiß aus der Stirn wischend, schickte er ein kleines Stoßgebet gen Himmel zu Santa Lucia, auf dass es nie so weit kommen mochte. Dann schaute er sich nervös um.
»Ein Teil der Lieferung war schon …, na sagen wir einmal … ein wenig angeschlagen«, wisperte Sojorno. »Ich frage mich, was wäre, wenn die Luft einmal nicht ausreicht.«
Franco de Lucca runzelte die Stirn. »Nun, gewisse Transporte über so weite Strecken sind ein riskantes Geschäft, das wissen wir alle. Die klimatischen Transportbedingungen sind vor allem bei solchen … Spezialitätenlieferungen von entscheidender Wichtigkeit. Aber seien Sie unbesorgt. Unser Mann in Genua ist ein Meister seines Fachs. Solange sich auf der Überfahrt niemand von außen an den Kisten zu schaffen macht, reicht drinnen die Luft zum Überleben aus.«
Der andere nickte. Was Franco de Lucca sagte, klang beruhigend.
»Wann dürfen wir mit dem nächsten Auftrag rechnen?«
»Anfang kommender Woche«, antwortete sein Gegenüber, während er seinen Kalender nach dem nächsten Termin durchblätterte.
»So bald schon? Ich dachte, Signore würde erst zurück nach Genua …«
»Ich habe Sie nicht zum Denken engagiert, Mister Sojorno! Sollten Sie Schwierigkeiten damit haben, lassen Sie es mich wissen«, unterbrach der Conte de Lucca ihn. Seine eisblauen Augen ließen Sojorno unruhig von einem Bein aufs andere treten. Wie ein Tier, das die Vormachtstellung eines anderen im Rudel akzeptiert, zog er dabei sein Genick ein, als wolle er sich noch kleiner, noch unwichtiger erscheinen lassen. Statt einer Antwort schüttelte er nur den Kopf.
Der Blick des Conte wurde wieder erträglicher. »Ich habe gewusst, dass wir uns auf Sie verlassen können.« Nun lächelte er sogar.
Warum muss der liebe Gott seine Gaben nur so ungerecht verteilen?, fragte sich Sojorno, der sich durch das Lächeln des anderen plötzlich wie ein Auserwählter fühlte. Der junge Graf besaß alles, was er selbst nicht hatte und sich sehnlichst wünschte: einen makellosen Körper, den ein römischer Bildhauer nur unter Aufbietung all seiner Künste hätte schaffen können, eine olivbraune Gesichtshaut, auf der am Morgen frische schwarze Bartstoppeln von Männlichkeit und Unbezähmbarkeit sprachen, und Augen, die glänzen konnten wie glühende Steine – oder so kalt funkeln wie gerade eben. Sein Mund und die Kinnpartie wiesen die Spur von Sensibilität und Weichheit auf, die Frauen dahinschmelzen ließ. Madonna mia!
»Ich werde den ganzen Sommer über in New York bleiben. Mein Vater ist der Ansicht, dass es angesichts der vielen Lieferungen nicht schaden kann, wenn einer von uns persönlich nach dem Rechten sieht«, sagte Conte de Lucca, während er seinen Kalender verstaute.
Sojorno gelang es nur schwer, den Blick von seinem Gesprächspartner zu lösen. Franco de Lucca war ihm gegenüber nicht zu Erklärungen verpflichtet. Dass er dies dennoch tat, adelte Sojorno auf gewisse Weise.
»Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich bei den nächsten Lieferungen vermehrt um ›Spezialitätenlieferungen‹ handelt?« Vertraulich und mit einem Schuss Ironie nahm er das Wort auf, das sein Gegenüber benutzt hatte, als im nächsten Moment eine harte Hand seinen Adamsapfel gegen seine Luftröhre drückte.
»Dass wir uns verstehen, Sojorno – wir liefern italienischen Rotwein – mehr nicht!«
2
Die ersten zwei Tage auf dem Schiff verbrachte Marie in ihrer Kabine. Nicht, weil sie an Seekrankheit litt wie viele andere Passagiere, sondern weil sie stundenlang nichts anderes tat, als in dem englischen Wörterbuch zu lesen, das Sawatzky ihr geschenkt hatte. Lediglich zu den Mahlzeiten ging sie in den Speisesaal, verließ diesen jedoch wieder, bevor der Letzte sein Besteck aus der Hand gelegt hatte. Wenn sie fleißig Vokabeln lernte, würde sie bei ihrer Ankunft in New York wenigstens ein paar Brocken verstehen, rechtfertigte sie ihr Einsiedlerdasein. Obwohl der Sinn und Zweck ihrer Reise auch – oder sogar vor allem – darin lag, fremde Menschen kennenzulernen, war ihr im Moment gar nicht danach zumute. Sie musste ehrlich zugeben, dass ihr nach gar nichts zumute war und dass sie ihren Entschluss, ihre Schwester Ruth in Amerika zu besuchen, zutiefst bereute. Was mache ich hier eigentlich?, fragte sie sich, während sie mit gesenktem Kopf durch die schmalen Flure in den Unterleib des Schiffes huschte. Wie viel lieber würde sie stattdessen an ihrem Bolg sitzen und Glas blasen! Oder es zumindest versuchen …
Kaum hatte sie den Gedanken, gegebenenfalls einmal nach Amerika fahren zu wollen, Anfang April zum ersten Male ausgesprochen, hatte sie damit einen Stein ins Rollen gebracht, der nicht mehr aufzuhalten war: Statt auf Widerstand seitens ihrer Familie zu stoßen, hatten Johanna und Peter sie nämlich spontan zu der Reise ermutigt. Sie hätte schon lange eine Belohnung für ihre harte Arbeit verdient, sagten sie. Und ein bisschen frischer Wind um die Ohren würde ihr nur guttun. Aber wer soll meine Arbeit machen?, hatte Marie eingeworfen. Johanna hatte nur abgewinkt: Ein paar Wochen würden sie gut ohne sie zurechtkommen, vor allem, wenn sie ihre Reise in die flauen Sommermonate legte. Es würde völlig ausreichen, wenn sie irgendwann im Herbst zurückkäme, für die Erstellung des neuen Kataloges hatten sie schließlich bis nächsten Februar Zeit. Als Marie die hohen Kosten einer so langen Reise anführte, hatte Peter sie stirnrunzelnd gefragt, ob sie ihr dickes Sparbuch eines Tages mit ins Grab nehmen wolle. Außerdem würde sie bei Ruth doch freie Kost und Logis haben.
So war Marie gar nichts anderes übriggeblieben, als sich mit der Idee, Lauscha für einige Zeit zu verlassen, ernsthaft anzufreunden.
Magnus hatte sich wie meist aus der Diskussion herausgehalten. Wenn er im Stillen darauf gehofft hatte, Marie würde ihn zum Mitkommen auffordern, so ließ er sich seine Enttäuschung nicht anmerken, als dies nicht geschah.
Wenn Marie ehrlich war, war die Aussicht, seinem treu ergebenen Hundeblick für ein Weilchen entfliehen zu können, für sie mindestens so verführerisch gewesen wie die Aussicht auf New York mit seinen großstädtischen Abwechslungen. Und so war sie allein nach Sonneberg aufs Amt gegangen, um sich einen Reisepass ausstellen zu lassen.
Doch nun, allein in der Enge ihrer Kabine, konnte Marie nicht mehr verstehen, wie sie jemals so gemein hatte denken können. Sie kam sich vor wie jemand, der sich umdreht und plötzlich seinen Schatten vermisst.
Mit dem Wörterbuch unterm Arm ging sie in einen der Aufenthaltsräume, die für die Passagiere der zweiten Klasse vorgesehen waren. Sie wählte ein Sofa in der hintersten Ecke des Raumes und ließ sich dort mit dem Gesicht zur Wand nieder. Vielleicht würde hier die Sehnsucht nach der Heimat weniger präsent sein.
Sie war gerade dabei zu lernen, wie man nach dem Weg fragte und was man zu sagen hatte, wenn man sich verlaufen hatte, nämlich »Excuse me, Sir, but I lost my way«, als sie ein leinengestärktes Rascheln vernahm, dem ein Plumps aufs Sofapolster neben ihr folgte.
Was für ein Tölpel setzte sich, ohne sie zu fragen …
Ärgerlich schaute Marie auf und blickte in ein rundes, strahlendes Gesicht.
Eine schneeweiße, pummelige Hand streckte sich ihr entgegen.
»Entschuldigen Sie meine Manieren – ich habe mich Ihnen ja noch gar nicht vorgestellt! Mein Name ist Georgina Schatzmann, aber Sie dürfen mich ruhig Gorgi nennen – das tun nämlich alle. Ich bin auf dem Weg zur Hochzeit meiner Schwester, und wenn meine bisherigen Beobachtungen mich nicht täuschen, dann sind Sie und ich die beiden einzigen allein reisenden Damen an Bord. Da wäre es doch nett, wenn wir uns ein wenig näher kennenlernen würden, habe ich mir gedacht und mir die Augen nach Ihnen ausgeguckt.« Sie kicherte. »Aber jetzt habe ich Sie ja gefunden, nicht wahr?«
Leider!, ging es Marie durch den Kopf. Während sie noch über eine höfliche, aber bestimmte Abfuhr nachgrübelte, redete die andere unbekümmert weiter.
»Vielleicht halten Sie mich für ein wenig aufdringlich, aber ich habe so schreckliches Reisefieber, müssen Sie wissen! Die Reise, die Hochzeit, New York – ich habe das Gefühl, als müsste ich vor Aufregung platzen!«
Als Marie in das runde Gesicht ihrer Nachbarin schaute, schien ihr diese Gefahr gar nicht so abwegig: Die Augen weit aufgerissen, blinzelte Georgina Schatzmann, genannt Gorgi, sie unter flatternden Lidern an. Ihre von feinen Äderchen durchzogenen Wangen hoben und senkten sich wie ein Mahlwerk, nicht ganz weiße Zähne kauten gleichzeitig auf einer ausgeprägten Unterlippe. Alles zusammen sah fast schon tragikomisch aus.
»Ich heiße Marie Steinmann, und ich bin auch auf dem Weg zu meiner Schwester. Allerdings ist diese schon seit Ewigkeiten verheiratet«, hörte Marie sich sagen.
»Das gibt’s doch nicht! Steinmann und Schatzmann – sogar unsere Namen ähneln sich!« Gorgi schüttelte den Kopf. »Wenn das nichts zu bedeuten hat …«
Zur Freude der anderen nickte Marie heftig. Das bedeutete, dass sie ihre Englischlektüre in den Wind schreiben konnte!
In der Tat erwies sich Georgina Schatzmann fortan als so anhänglich wie ein Hündchen, das froh war, endlich ein Zuhause gefunden zu haben: Zur Essenszeit platzierte sie sich so vor Maries Kabine, dass diese nicht anders konnte, als mit ihr in den Speisesaal zu gehen. Auch zwischen den Mahlzeiten gelang es Gorgi immer wieder, Marie in einem der Aufenthaltsräume aufzuspüren. Nach dem dritten Tag gab sich Marie angesichts von so viel Beharrlichkeit geschlagen: Wenn sie die Zeit auf dem Schiff schon nicht in Ruhe verbringen konnte, dann wollte sie wenigstens das Beste aus der erzwungenen Gesellschaft machen. Und so fragte sie Gorgi, die von Beruf Lehrerin war, ob sie nicht bereit wäre, Marie Vokabeln abzufragen. Freudig stimmte diese zu.
Dank Gorgis drolliger Art, für schwierige Wörter Eselsbrücken zu bauen, machten Maries Englischstudien schon bald erstaunliche Fortschritte. Sich in einer fremden Sprache unterhalten zu müssen, andere Menschen nicht zu verstehen – davor hatte sie die meiste Angst gehabt. Doch nun sah es fast danach aus, als hätte sie sogar eine besondere Begabung für die englische Sprache. Zumindest behauptete Gorgi das nach einer Weile und schlug im selben Moment vor, zum vertraulichen »Du« überzugehen – wo sie doch nun schon auf gewisse Art Freundinnen waren.
Warum nicht, antwortete Marie schulterzuckend – schließlich war diese Anrede in Amerika ohnehin gang und gäbe!
Von da an wurden ihre Gespräche etwas vertraulicher. Als Gorgi erfuhr, dass Marie eine Glasbläserin war, die Christbaumschmuck herstellte, kannte ihre Begeisterung keine Grenzen mehr.
»Steinmann-Baumschmuck – warum bin ich nicht gleich auf diese Verbindung gekommen! Deine Glaskugeln hängen nämlich jedes Jahr an unserem Weihnachtsbaum! Ganz besonders liebe ich die kleinen silbrigen Zapfen und Nüsse, meine Mutter jedoch mag eher die großen Figuren wie die Weihnachtsmänner und Engel. Und so streiten wir jedes Mal, wo welches Teil hingehängt wird.« Sie lachte ihr herzliches Lachen, während ihre Augen noch runder wurden. »Jedes Jahr nach dem ersten Advent gehen wir bei uns in Nürnberg ins Kaufhaus am Rathaus und schauen, was es Neues an Steinmann-Schmuck gibt. Natürlich kaufen wir jedes Mal ein paar Teile! Aber sag, wie um alles in der Welt kommst du nur auf diese vielen schönen Ideen?«
Marie lächelte. »Die meisten Ideen bekomme ich einfach geschenkt«, offenbarte sie freimütig. »Ich muss nur durch den Wald laufen, einen Spaziergang entlang der Lausche machen – das ist ein kleiner Fluss bei uns zu Hause – und dabei eine besonders geformte Blüte entdecken, und schon möchte ich sie in Glas verwandeln.«
»Wie du das sagst …« Gorgis Augen glänzten bewundernd. »Als ob du eine Zauberin wärst.«
Marie lächelte dünn. »Aber eine, die ihre Zauberkraft verloren hat.«
Als sie Gorgis Stirnrunzeln sah, sagte sie hastig: »Genug über zu Hause gesprochen! Warum zeigst du mir nicht, welche Kleider du für den Aufenthalt in der Großstadt gekauft hast?«
Sie konnte und sie wollte nicht über ihre Glasbläserei sprechen. Sie wollte nicht einmal an die letzten Wochen denken, die sie am Bolg verbracht hatte. Wie eine Anfängerin war sie sich dabei vorgekommen! Hatte den Rohling in ihrer Hand angeschaut, als wäre es ein Ding aus einem anderen Universum. Keine Bewegung war dabei wie selbstverständlich aus ihrem Handgelenk geflossen, keine neue Form entstanden. Während sie runde Kugeln blies, um nicht ganz untätig dazusitzen, war ihre Panik gewachsen – bis zu dem Punkt, da sie fluchtartig den Raum verließ. Später hatte sie den anderen erzählt, es wäre die Suppe vom Vorabend gewesen, die sie nicht vertragen hatte. Wem hätte sie sagen sollen, dass sie ihre eigene Unzulänglichkeit keinen Moment länger ertragen konnte?
Mit geheucheltem Interesse schaute sie sich nun Gorgis neue Kleider an. Doch sosehr sie sich auch bemühte, sie konnte an dem unförmigen, mausgrauen Zeltkleid, das Gorgi zur Hochzeit ihrer Schwester tragen wollte, nichts Schönes finden. Spontan kramte sie eine ihrer selbstgefertigten Glasperlenketten aus der Tasche und hielt sie in den Kleiderausschnitt.
»Schau mal, wie der graue Stoff zusammen mit deiner Perlenkette plötzlich glänzt! Das ist ja die reinste Zauberei!« Hingebungsvoll berührte Gorgi das Schmuckstück.
»Nein, nur Glas«, gab Marie lächelnd zurück. »Ich schenke sie dir!«
Gorgi bedankte sich mit einer wuchtigen Umarmung.
Dann wollte Marie wissen, wie es dazu gekommen war, dass gerade Georgina die Reise antreten durfte und nicht einer ihrer beiden älteren Brüder, von denen sie so viel erzählte, oder ihre Eltern selbst.
Gorgi grinste. »Mutter hätte schon gewollt … Aber Vater glaubt, ohne ihn würde die Eisenwarenhandlung keinen Tag überleben. Und meine Brüder hat Mutter nicht schicken wollen. Wahrscheinlich befürchtet sie, auf die Frage, wie es in Amerika war, lediglich ein gebrummtes ›Ganz nett‹ zu hören zu bekommen. Während sie bei mir sichergehen kann, dass ich mindestens eine Woche brauchen werde, um ihr alles zu erzählen!«
»Eine Woche? Ob das reicht?« Skeptisch hob Marie die Brauen.
Statt ihr den Scherz übelzunehmen, prustete Gorgi los. Eigentlich machte es ziemlich viel Spaß, mit Gorgi zusammen zu sein, stellte Marie beinahe erstaunt fest.
»Es hört sich so an, als sei deine Familie sehr nett«, sagte sie.
»Ist sie auch«, erwiderte Georgina. »Trotzdem bin ich froh, sie für eine Weile nicht zu sehen. Diese ewig besorgten Blicke, nur weil immer noch kein Ehemann für mich in Sicht ist! Was kann ich denn dafür, dass der liebe Gott mich mit mehr Fülle als Anmut ausgestattet hat?« Hilflos ließ sie ihre plumpen Arme auf ihre ebenso plumpen Schenkel fallen.
»Wenn ich so schlank und hübsch wäre wie du, wäre ich auch schon längst verheiratet!«, seufzte sie.
»Bin ich doch gar nicht!«, konterte Marie.
»Wieso? Ich dachte, du und dieser Magnus …?«
»Wir leben zwar zusammen unter einem Dach, aber verheiratet sind wir nicht. Ich weiß, dass sich das seltsam anhört, und das ist es mit Sicherheit auch«, fügte sie in Anbetracht von Gorgis irritiertem Gesichtsausdruck hinzu. »Aber irgendwie hat sich eine Hochzeit zwischen uns nicht ergeben. Ich … hatte nie das Bedürfnis, Magnus zu heiraten.«
Gorgis Blick wurde nur noch verwunderter. »So etwas habe ich noch nicht gehört! Da müssen sich doch eure Nachbarn die Mäuler zerreißen, oder? Also, wenn ich einen hätte – ich würde schneller Ja sagen, als er bis drei zählen kann! Aber wer weiß, vielleicht finde ich ja in Amerika einen, der mich liebt.« Sie schloss für einen Moment die Augen, und ihr sonst so bewegtes Gesicht wurde still. »Weißt du, darauf freue ich mich am meisten: Endlich einmal nicht die dicke Georgina Schatzmann zu sein, die keinen Mann abkriegt. Sondern durch die Straßen von New York gehen zu können und dabei einfach nur eine Frau zu sein, die Spaß haben will! Eine x-beliebige Frau.«
Nachdenklich schaute Marie ihre neue Freundin an. Gorgi wusste genau, was sie von ihrer Reise erwartete. Wenn sie das nur auch von sich behaupten könnte!
Ehe die beiden Frauen sich versahen, näherte sich die Überfahrt ihrem Ende. »Wahrscheinlich liegt die ganze Hudsonbucht im Nebel«, hatte Gorgi am Vorabend ihrer Ankunft geunkt, doch der Morgen des fünfzehnten Juni war so klar, als hätte ihn jemand mit einem weichen Tuch blank poliert. Schon vor dem Frühstück gingen sie gemeinsam an Deck, jede eine Decke gegen die Morgenkälte über die Schultern geworfen. Zu ihrem Erstaunen trafen sie dort auf eine stattliche Anzahl Passagiere – alle wollten zu den Ersten gehören, die einen Blick auf die große Stadt werfen konnten.
Marie war komisch zumute. Spontan wünschte sie sich, die Schiffsfahrt würde noch ein wenig andauern. Als die ersten dunklen Umrisse am Horizont das Ende des Ozeans ankündigten, war sie froh, Gorgi mit ihrem enthusiastischen Gesichtsausdruck neben sich zu haben.
… nur eine Frau sein, die Spaß haben will.
Konnte das genauso für sie gelten?
Auch auf dem Immigranten-Deck unter ihnen drängte sich Schulter an Schulter. Zwölf Tage lang waren die Menschen wie Vieh im Bauch des Schiffes zusammengepfercht gewesen – ohne Frischluft, ohne ausreichende Nahrung –, nun rückte ihre neue Heimat unaufhaltsam näher. Was kommen sollte, war Beginn und Ende zugleich, Abschied und Ankunft. Erwartungsvolle Anspannung vibrierte in der kalten Morgenluft.
Plötzlich kam Bewegung in die Versammelten.
»Da ist sie!« – »Da ist sie!«
»Schaut alle nach links!«
»Schnell, kommt hier herüber, sonst verpasst ihr sie!«
Aufgeregte Rufe waren zu hören, Hände fuchtelten in der Luft, Finger zeigten alle in dieselbe Richtung, als ob dort jemand stünde, den sie kannten und der sie begrüßen wollte. Binnen einer Minute drängten sich alle auf der linken Seite des Decks, so dass man das Gefühl bekommen konnte, der Schiffsleib würde sich schräg legen.
»Die Lady of Liberty! Schau, wie sie ihre goldene Fackel zum Gruß in die Höhe reckt!« Aufgeregt puffte Gorgi Marie in die Seite, ohne ihren Blick von der berühmtesten Statue der Welt zu nehmen. Ihre Umrisse glitzerten scharfkantig in der Morgenluft, und den Blick zur alten Heimat gerichtet, kündete sie verheißungsvoll von der Freiheit in der Neuen Welt.
Als von Marie keine Reaktion kam, drehte Gorgi sich zu ihr um. »Was ist, warum weinst du denn?«
Marie schüttelte den Kopf, nicht sicher, ob sie einen Ton herausbringen würde.
»Hör auf, du Heulsuse! Sonst fange ich auch noch an«, drohte Gorgi scherzhaft und knuffte Marie abermals in die Rippen. »Freu dich doch an diesem Anblick! Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass man so grandios begrüßt wird!«
»Das ist es ja«, schniefte Marie. »Ich habe das Gefühl, noch nie in meinem Leben etwas so Schönes gesehen zu haben.«
Gorgi legte Marie einen Arm um die Schultern. Sie grinste spitzbübisch. »Warte ab – das ist erst der Anfang!«
3
Nur ein paar Schritte von dem Ort entfernt, wo in New York Geld gemacht und wieder verloren wurde, lag die Brooklyn Bar. Sie wurde vor allem von hemdsärmeligen Bankern und Brokern frequentiert. Manchmal lud einer von ihnen seine Sekretärin ein mitzukommen, doch alles in allem sah man nur wenig weibliche Gäste. Auf diesen Umstand bildete sich der Besitzer der Bar, Mickey Johnson, ziemlich viel ein. »Wo können Männer heutzutage noch ungestört einen über den Durst trinken? Schließlich ist kein Ort mehr vor den Frauen sicher!«, lamentierte er des Öfteren. Wenn er einen Rock durch seine schmuddelige Tür kommen sah, bedachte er dessen Trägerin in der Regel mit einem unfreundlichen Blick.
Ganz gleich, ob an einem Tag Geld gemacht oder verloren worden war – gegen Abend war Mickeys Tresen stets so voll, dass die Gläser Bier, die der Ire in Windeseile zapfte, von den Gästen weitergereicht werden mussten – das Serviermädchen wäre einfach nicht mehr durchgekommen. Und ganz gleich, ob es ein guter oder ein schlechter Tag gewesen war, bei Mickey war es stets unglaublich laut, der Alkoholkonsum beträchtlich und der Zigarettenqualm dichter als der Nebel, der allmorgendlich über der Bucht hing. Jemand, der nur zufällig hier vorbeikam und, angelockt von den vielen Besuchern, beschloss, auf ein Bier hineinzugehen, hätte nie zu unterscheiden vermocht, welche Art von Tag die New Yorker Börse gesehen hatte. Mickey jedoch brüstete sich damit, dies allein am Schweißgeruch der Männer feststellen zu können: Freudige Erregung roch anders als nervenzehrendes Durchhalten oder gar panischer Angstschweiß.
Harold Stein hatte gerade den ersten Schluck Scotch getrunken, als er Wanda durch die Tür kommen sah. Seit sie angefangen hatte zu arbeiten, hatten sie es sich zur Gewohnheit gemacht, sich jeden Mittwoch nach Geschäftsschluss hier zu treffen. Meistens war er jedoch eine Stunde früher da als sie.
Mit hoch gerecktem Kinn, die Augen stur geradeaus, bahnte sie sich einen Weg durch die wild gestikulierenden Männer. Obwohl sie eisiger dreinschaute als eine nahende Schlechtwetterfront, war ihr die Bewunderung eines jeden einzelnen Mannes im Raum sicher, die von Mickey inklusive. Kaum sah er Wanda an seiner Theke vorbeirauschen, ließ er seine Biergläser stehen und schenkte Anislikör in ein hohes, schmales Glas, das er sodann dem nächstbesten Gast reichte. »Weitergeben! Der Lady dahinten!«, befahl er und verfolgte den Weg des Glases mit Argusaugen.
Wie kam es nur, dass Wanda Menschen für sich einnehmen konnte, ohne etwas dafür tun zu müssen?, wunderte sich Harold nicht zum ersten Mal. Charme allein reichte dafür nicht aus, Schönheit auch nicht – obwohl Wanda beides im Übermaß besaß. War es ihr Lachen, das so gelöst und einzigartig klang, dass sich alle im Raum danach umdrehten? Ihre Art, alles, auch die kleinsten Dinge des täglichen Lebens, mit Begeisterung zu tun? Für Harold war es eine Gabe, für die er noch keine Bezeichnung gefunden hatte und um die er sie manchmal – besonders dann, wenn er einem schwierigen Kunden gegenübersaß – beneidete. Für Wanda wäre es sicher ein Leichtes gewesen, den Schweinezüchter aus Oregon von der Investition in Silver International zu überzeugen – er jedoch hatte den misstrauischen Ochsen trotz größter Bemühungen ohne Abschluss gehen lassen müssen.
Aus dem Augenwinkel heraus registrierte Harold die begehrlichen Blicke der anderen Gäste, als Wanda auf die schmale Bank ihm gegenüber rutschte. Diese weißblonden Haare nur einmal kurz berühren zu dürfen! Den Duft nach Jugend und Pfirsich aus der Nähe zu verspüren! Einen Arm um die schlanke, biegsame Taille zu legen oder mit einem Finger die elegante Linie ihres Nackens nachzufahren – die Luft in Mickeys Bar war plötzlich mit einer anderen Sehnsucht erfüllt als der nach der nächsten Börsenhausse.
Noch halb im Stehen nahm Wanda einen Schluck vom Anislikör, der kurz vor ihr den Tisch erreicht hatte. Ihr Blick war düster und verschlossen.
Dass ihre alberne weiße Schürze nicht über ihrem Arm hing, registrierte Harold sofort. Und das, obwohl sie direkt von der Arbeit kam? Es fiel ihm nicht schwer, sich den Rest zusammenzureimen. Nun, ihr betörendes Lachen würde er heute gewiss nicht hören!
»Und was war es diesmal?«, fragte er. »Ich gehe doch recht in der Annahme, dass deine Zeit bei Schraft’s abgelaufen ist?« Wanda runzelte die Stirn. »Woher …« Doch statt ihre Frage auszuformulieren, stieß sie hervor: »Die Schweinsfüße von Monique Demoines!«
»Die was?«
»Eine verwechselte Bestellung. Nein, eigentlich stimmt das gar nicht. Hätte Monique nicht so einen Zinnober um ihr Fest gemacht und –« Wanda winkte geringschätzig ab. »Wie die sich aufgeführt hat, lachhaft war das, lachhaft! Alles nur wegen eines Missverständnisses.«
Ihr Gehabe konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie eine tiefe Demütigung erfahren hatte – zu verletzt war dafür ihr Blick, zu verbissen ihr Mund.
Harold hob die Brauen. Der letzte Job, den Wanda verloren hatte, war der bei »Arts and Artists« gewesen, einer modernen und äußerst schicken Kunstgalerie. Wenn er sich richtig erinnerte, war auch dort ein »Missverständnis« der Grund für ihren Rausschmiss gewesen: Als sie – gerade erst zwei Wochen im Dienst – einen heruntergekommenen Typen dabei erwischte, wie er Skulpturen in eine Tasche packte, hatte sie ihn für einen Dieb gehalten und Zeter und Mordio geschrien. Dass just in diesem Moment zwei Polizisten an der Galerie vorbeiliefen, die den Kerl trotz dessen lautstarker Proteste gleich mit aufs Revier nahmen, war Wandas Untergang gewesen: Der vermeintliche Dieb hatte sich als ein bekannter Bildhauer herausgestellt, der in Absprache mit dem Galeristen seine eigenen Kunstwerke hatte austauschen wollen.
Wandas Augen funkelten, ob vor Wut oder zurückgehaltener Tränen konnte Harold nicht mit Bestimmtheit sagen.