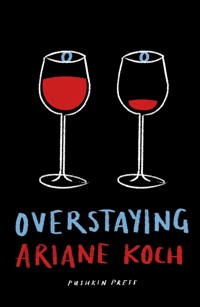13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau fristet ihr Dasein in einem zu großen Haus in einer zu kleinen Stadt neben einem dreieckigen Berg. Als dort ein Gast auftaucht, nimmt sie ihn kurzerhand bei sich auf. Der Gast ist ihr so vielversprechend neu wie fremd und wird schnell zum einnehmenden Mittelpunkt, aber auch Opfer inquisitorischer Machtfantasien. Bis er den Fängen der Hausherrin schließlich entkommt und sie selbst, wieder allein, eine lang ersehnte Reise antritt und nun ihrerseits zur Gästin wird.
Die Aufdrängung ist ein wunderbar eigensinnig erzählter Roman, der Fragen nach dem Bekannten und Unbekannten, nach Herkunft und Heimat, nach Assimilation und Integration, nach Privatsphäre und Gastfreundlichkeit stellt. Ein Debüt, dessen Lust am Fabulieren und Fantasieren mitreißt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
3Ariane Koch
Die Aufdrängung
Roman
Suhrkamp
5Die Aufdrängung
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Die Aufdrängung
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
7Der Gast sitzt am Tisch und isst kleine Mandarinenschnitze. Wenn Dinge übermäßig klein sind, dann muss ich das Gesicht verziehen und eine Hand auf mein Herz – oder dorthin, wo ich es vermute – legen. Man hat mich immer problemlos von aller Bösartigkeit abbringen können, indem man mir Miniaturen vorführte.
Der Gast ist ganz fein, so fein, dass er fast auseinanderweht. Ich habe es erst nicht bemerkt, weil er es gut zu verstecken weiß. Wer so fein ist wie der Gast, ist sehr gefährdet. Er könnte leicht in die Fänge irgendwelcher Wahnsinnigen geraten. Mein Urgroßvater zum Beispiel war anerkannter Sektenführer. Es ist mir leider nicht vergönnt gewesen, ihn persönlich kennenzulernen. So bleibt mir nur ein einziges Foto von ihm, das ihn an einem Schreibtisch sitzend zeigt, die Haare streng gescheitelt, den Blick in eine visionäre Zukunft gerichtet. Im Weiteren fasziniert mich, dass die Predigten, die er zum Besten gegeben hat, frei improvisiert gewesen sein sollen, indem er die Heilige Schrift auf das Rednerpult fallen ließ, worauf sie durch die gütige Hand des Herrn an einem auserwählten Ort aufgesprungen sei und somit den zu predigenden Inhalt vorgegeben habe.
Mein Urgroßvater hätte vielleicht gesagt, es müsse vertraut werden in die Seite, die beim Fall des Heiligen Buches aufgeschlagen werde, und man sei ja eben doch nur ein Knecht des Herrn, dem nichts anderes übrig bleibe, als dessen Willen geschehen zu lassen.
8Neben der Kleinstadt, in der ich zu liegen gekommen bin wie in einem Sarkophag, steht ein großer Berg, der einer Pyramide ähnelt, aber nicht wie das tatsächliche Weltwunder von innen zu besichtigen und außerdem von Schnee bedeckt ist. Man kann, wenn man denn unbedingt will, den Berg hochsteigen. Ich persönlich sehe mittlerweile davon ab, die Aussicht ist mir verleidet. Man sieht weniger weit, als mir lieb wäre, ich präferiere, zu des Berges Füßen zu verharren. Manche ängstigen sich vor dem Schatten des Berges.
In der Kleinstadt kenne ich alle, aber tue meistens so, als kenne ich keinen. Ich habe schon an fast jeder Straßenecke etwas erlebt, unterschiedliche Zeitschichten haben sich übereinandergelagert. Man tummelt sich in der Rondellbar, die sich gleich neben meinem Haus befindet. Ursprünglich hätte sie nur hundert Tage geöffnet sein sollen, daraus wurden Tausende. Die Kellner wechseln wöchentlich, einer ist schrecklicher als der nächste, aber alle haben die Haare streng nach oben gebunden, und auch sonst kann man sagen, dass es hier nie etwas Interessantes zu sehen gegeben hat. Ich habe immer gewusst, ich bin undankbar. Meine Eltern haben es mir früh prophezeit, und ich habe es nie abgestritten.
Der Gast war Neuland, tauchte aus dem Nichts auf. Er stieg aus dem Zug, schwenkte seine Koffer, und so trafen sich unsere Blicke. Es ist mir nicht klar, ob er selber die wahnsinnige Idee hierherzukommen hatte. Ich stand auf der anderen Seite des Bahnsteigs, war im Begriff abzureisen. Zumindest trieb ich mich am Bahnhof herum und verschaffte mir einen Überblick über die Destinationen, 9die ich potentiell hätte bereisen können. In einen Zug eingestiegen bin ich jedoch nie.
Ich kann es nicht leugnen: Der Gast kam mir bekannt vor, als ich ihn durch meine goldgerahmten Brillengläser zum ersten Mal anstierte – oder war er es, der mich warm durch seine Brillengläser fixierte, auf der anderen Seite des Bahnsteigs stehend, während wir wussten, dass wir aus entgegengesetzten Richtungen gekommen waren, so wie wir auch morgen oder spätestens übermorgen wieder in entgegengesetzte Richtungen fahren würden? Es ist dieser Blick des Gastes gewesen, der sich mir eingeprägt hat und den ich seit diesem Moment in den Blicken der anderen Menschen suche und manchmal finde, heute beim Moderator einer philosophischen Gesprächssendung, wie er damit einen jungen französischen Schriftsteller fixierte.
10Im Radio sagten sie, dass die Tiere im Zoo nicht mehr an den Menschen gewöhnt seien und schon bei der kleinsten menschlichen Bewegung in Flucht verfielen, allen voran die Flamingos. Die Vorstellung, dass Menschen den Zoo durchstreiften, während die Tiere das Weite suchten, gefiel mir.
Dann folgte ein Interview mit dem touristischen Leiter der Kleinstadt – in die ich unfreiwillig hineingeboren worden bin und in der ich nicht zu sterben vorhabe –, dass der Tourismus angekurbelt werden müsse, indem man den kleinen Ort als Großstadt präsentiere. Diese Aussage erschien mir so unsinnig, dass ich daraufhin nichts zu tun wusste. Auf der Theke der Rondellbar, die mit einer Marmorattrappenfolie überzogen ist, waren großzügig Krumen eines Croissants verteilt. Diese glitzerten golden in der Sonne. Der Berg, sagte der touristische Leiter weiter, sei zwar eine große Attraktion, aber die Bergbahn lottere bereits, die Gondeln schwankten bedrohlich, es sei eine baldige Renovierung vonnöten.
Ich verkehrte nicht schon immer mittags in der Bar, aber das kürzliche Auftauchen des Gastes hatte mich an jenem Morgen aus dem Haus treten und die Suche nach ihm aufnehmen lassen.
Draußen gingen Menschen, die ich nur als Silhouetten wahrzunehmen im Stande war, durch die Straßen. Ich beobachtete eine resignierte Mutter, deren Kind tobsüchtig an ihrer Hand zog. An der Marmortheke sitzend, die Beine übereinandergeschlagen, stellte ich mir vor, in der Kleinstadt wohnten nur winzige Menschen, die mit winzigen Fahrrädern herumfahren würden und aus winzigen 11Kaffeetassen Ristretti kippen. Auch die Rondellbar könnte ich problemlos in die Hand nehmen, herumdrehen und von allen Seiten betrachten, die am Tresen Sitzenden versuchten, sich kreischend daran festzuhalten, ihre winzigen Getränke wären bereits in die Tiefe gestürzt, als Tröpfchen auf meinen Jeanshosen verteilt. Die nunmehr Hängenden starrten mich mit großen kleinen Augen an, wenn ich das Rondell in der Mitte auseinanderrisse wie einen Donut. Ich stellte mir vor, dass die Kleinstadt immer kleiner würde, auf einen winzigen Punkt zusammenschrumpfen, nur ich bliebe groß, so dass ich keinen Platz mehr darin fände. Dann fiel mir ein, dass dies bereits der Fall war.
Es lief nun ein Bericht im Radio über die zunehmende Gewalt gegenüber Pflegepersonal. Der Kellner stellte das Radio leiser, und die Stimmen drifteten weg.
12Die Menschen liegen unter den Vordächern, manchmal in Schlafsäcken, manchmal in Zelten, manchmal in Schlafsäcken in Zelten. Das Gepäck halten sie meist in Straßenlöchern verstaut, die mit kleinen Falltüren versperrt sind. Wie oft habe ich sie aus den Löchern kriechen sehen, unförmige Gepäckstücke hinter sich herauszerrend. Die Menschen haben die Farben der Häuser angenommen, vor denen sie liegen, sind grau wie der Asphalt, während ihre Zelte und Schlafsäcke in Neonfarben durch die ganze Stadt leuchten. Im Winter gibt es eine Equipe in orangen Schutzwesten, die Menschen ohne fixes Domizil aufsucht und ihnen Lebensmittel bringt, manchmal auch Reinigungstücher.
Es gibt eine Frau, die mir schon öfter aufgefallen ist. Des Tags trägt sie tadellose Kleidung, einen hellgrauen Mantel, und hastet – als ginge sie zur Arbeit – die Straße hinunter. Bei Einbruch der Dunkelheit legt sie sich in abgewetzten Trainingshosen in den Schlafsack und schaut stumpf daraus hervor, mir ins Gesicht, und ich schaue in ihr Gesicht, wenn ich einmal wieder die Straße überquere, von der Rondellbar zu meinem Haus oder umgekehrt. Wir sagen nichts, haben nur diesen gemeinsamen Blick.
Am Ende der Straße – dort, wo die Frau manchmal ihren temporären Schlafplatz errichtet – gibt es ein Möbelgeschäft, spezialisiert auf Sofas. Das Möbelgeschäft könnte sich sogar Sofageschäft nennen, so dicht an dicht stehen sie im Schaufenster. Die Öffnungszeiten sind bis in die späten Abendstunden verlängert worden, damit auch die Berufstätigen es aufzusuchen die Zeit finden. Häufig ge13hen Paare hinein, sitzen Sofa um Sofa Probe, gehen wieder hinaus, mit verwunderten Gesichtern über den abgeschlossenen Kauf. Schon bald wird der Watteberg zu ihnen nachhause geliefert. Bald wird ein Transporter vor ihrem Haus halten. Bald werden zwei Typen den Watteberg aus dem Transporter hieven, werden ihn die Treppen hinauftragen, dabei überall anstoßen. Bald steht der Watteberg in der Wohnung des Paars, das sich ungläubig darauf niederlässt, darin versinkt.
Ich würde es manchmal bevorzugen, ein bisschen weniger gute Augen zu haben. Aber dann hätte ich vielleicht den Gast nicht gesehen, wie er die ihm fremden Münzen in einen der Lichtkegel am runden Bartresen der Rondellbar hielt. Wir saßen uns in sicherer Distanz gegenüber, nippten stundenlang an je einem Bier und dann am nächsten. Der eine auf der einen Seite des Rondells, die andere auf der anderen. Die Blickachse führte quer durch den Kreis hindurch, verband uns beide Punkte miteinander, durchstach den Mittelpunkt, den Kellner, der von einem Fuß auf den anderen trat. Vielleicht war es nicht das erste und auch nicht das letzte Mal, dass ich in der Rondellbar derlei Linien zog. Überhaupt schläft niemand mehr in dieser Stadt, die meisten sitzen am Tresen, schlürfen Alkohol aus Zinnbechern und überlegen sich, mit wem sie in welcher Diagonale eine Affäre anfangen könnten. Oft ahne ich die zukünftigen Verbindungslinien der Sesshaften, die potentiellen Schnittpunkte der Sekanten. Wenn einer sich mir zu nähern versucht, so gehe ich gewöhnlich einfach in Gegenrichtung um den Kreis herum, so dass wir uns nie erreichen und stets gleich weit voneinander 14entfernt bleiben. Ab und zu schicken nämlich auch mir fremde Männer Post, in der zu lesen ist, dass sie mich gesichtet hätten und zwar nicht kennen, aber dass ihnen mein Lächeln zugesagt habe, von dem sie sich sicher seien, dass es ihnen gegolten habe. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, jemals gelächelt zu haben.
15Der Gast ging herum wie ein Fliegenfänger, an dessen klebrigem Papier die Insekten haften bleiben. Er suchte offensichtlich eine Unterkunft, nur schien er es noch nicht zu wissen. Er tigerte um die Rondellbar herum, die Gassen hinab, den Berg hinauf.
Auf jeden Fall war mir ein bisschen unheimlich zumute.
Ich sah ihn plötzlich überall, so als gäbe es außer ihm keine anderen Menschen, als würde er für immer mit schwingendem Gepäck durch die Stadt streunen und den größer werdenden Wolkenriss, durch den das Mondlicht brach, begutachten. Seine Silhouette schimmerte derweilen silbern.
Ich legte mein Fernglas für einen Moment nieder, damit sich das Bild auf meiner Netzhaut einbrennen konnte wie ein verglühender Blitz am Nachthimmel.
16Ich habe ein sehr großes Haus, obwohl man es von außen nicht denken würde. Mein Haus ist riesig, wenn auch nicht so groß wie der Berg, der sich scharf gegen das Licht abzeichnet. Mein Haus gehört mir nicht, ich beaufsichtige es nur, damit es nicht auseinanderfällt. Irgendwann werden meine Geschwister das Haus übernehmen. Irgendwann werde ich aus meinem Haus ausziehen müssen, vertrieben werden, nämlich dann, wenn meine Geschwister ihr Begehren nach dem Haus anmelden. Meine Geschwister haben das Geld, um zu sagen, dass ihnen mein Haus gehören soll. Meine Geschwister können Großgrundbesitzer werden, während ich die Wächterin einer Ruine bin. Meine Geschwister werden in mein Haus einziehen und es renovieren und umbauen, werden es zu einem anderen machen, als es jetzt ist. Vielleicht wird es noch größer und höher werden, bestimmt aber prunkvoller. Bestimmt bekommt es eine andere Farbe.
Überhaupt ist mir dieses Haus durch die Zeit hindurch ein immer anderes gewesen.
Als meine Eltern vor etlichen Jahren mit mir und meinen Geschwistern hier einzogen, installierte ich eine kleine Seilbahn zum Nachbarshaus und tauschte mit dem Nachbarskind Briefe aus. Manchmal zeigten wir uns auch Gegenstände, indem wir sie ans Fenster hielten – ein stilles Gespräch aus an der Scheibe auf und ab tanzenden Dingen. Ich erkannte beispielsweise einen Eisbären aus Plüsch, dann eine Schere. Ich antwortete mit einem Esel aus Plüsch und einem undefinierbaren Gestrüpp, das ich im Kindergarten hergestellt hatte. Als ich größer wurde, schnitt ich das Seil durch, welches auf die Hecken hinab17stürzte und nur mehr wie eine zittrige Linie durch die Gärten führte. Ich habe das ungute Gefühl, dass es keinen Anlass dazu gegeben hatte, der Kontakt zum Nachbarskind blieb jedoch für immer abgebrochen.
Auch die Katzen kamen und gingen, wurden überfahren, wurden fett, wurden kastriert. Ich erinnere mich an Rambo, Cäsar und Napoleon. Mal hatte der eine, dann der andere die Herrschaft über die Gärten, stolzierte mit erhobenem Schwanz durch das Laub. Die Reviergrenzen waren ständig umkämpft, der Geruch von Katzenpisse lag in der Luft – und auch die Versuche meiner Eltern, die Katzenklos mittels Aussaat von Pfeffer zu verschieben, scheiterten.
Heute sind alle tot. Ihre Leben vergingen in den Gärten.
Ich bin noch da. Hausiere wie eine Grabwächterin zwischen den Dingen, die nicht mir gehören und zunehmend zerfallen. Es ist nicht ratsam, sich zu sehr an den Wänden abzustützen. Von der Fassade fallen Steine, und der Vorgarten ist bedeckt mit Laub, mit Dreck, mit Schnee.
18Wenn es nach mir ginge, so bräuchte ich gar kein Haus, keine Baukunst im Allgemeinen, weil ich es ja doch nicht zu schätzen weiß. Man könnte mir auch einfach etwas hinstellen und behaupten, es sei ein Haus, und ich würde es glauben. Ich habe nie ein Auge für Architektur gehabt, obwohl ich im ausgefallensten Haus der ganzen Stadt wohne. Es ist eine regelrechte Blindheit, die ich gegenüber Gemäuern habe. Der Verputz meiner Fassade musste mir auch erst vor die Füße fallen, damit ich überhaupt bemerkte, dass es an meinem Haus einen Verputz gibt. Ich sehe qua Blindheit direkt durch das Gemäuer hindurch auf die Insassen, man kann es sich in etwa wie ein zur Seite hin geöffnetes Puppenhaus vorstellen.
An die Insassen eines Hauses kann ich mich – anders als an das Bauwerk selbst – stets hervorragend erinnern. An ihre Farblichkeit, ihre Gewänder, ihre Art, die Treppen hinunterzusteigen oder vom Tisch aufzustehen und den Herd anzuschmeißen. Ich muss zugeben, dass ich nur selten Menschen in mein Haus lasse, und dennoch ist es die Erinnerung an ihr Dasein, die sich als Spur durch die Räumlichkeiten zieht. Meine Eltern sind zwar weggegangen, aber ihre Art, sich in der Architektur zu befinden, ist geblieben.
19Mein Großvater hatte einst ein Puppenhaus gebaut, in dem es elektrisches Licht samt Lichtschaltern gab. Wenn ich früher bei meinen Großeltern zu Besuch war, gehörte es zu einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, die winzigen Lichtschalter ein- und auszuknipsen, die Puppenstube mit den winzigen Steh- und Deckenlampen samt gemusterten Lampenschirmen zu erhellen und wieder zu verdunkeln. Die Puppen ließ ich unberührt. Ich erinnere mich, dass ich sie in ihren Holzbetten unter den Bettdecken liegen ließ, sie sollten schlafen. Die Lichtschalter gingen irgendwann kaputt, schließlich hatte mein Großvater nebst mir neun weitere Enkelkinder, die mindestens ebenso besessen darauf herumdrückten.
Ich frage mich, was es ist, das den Menschen Kleines lieben lässt. Ich befürchte, es hat etwas damit zu tun, dass auch seine Jungen (Kinder) klein sind und von den Größeren betreut werden müssen, weil sie sonst verhungerten.
20Es gibt die, die ein Haus wollen, aber keines haben, und es gibt die, die ein Haus haben, aber keines wollen. Es gibt die mit hässlichen Häusern, und es gibt die mit anderen Unterkünften, zum Beispiel einem Wohnwagen, einem Zelt oder einem Schlafsack. Die Grenzen zwischen den Domizil-Kategorien sind fluid, so wie Grenzen im Allgemeinen. Man könnte aber sagen, dass jemand, der temporär eine – nicht ihm gehörende – häusliche Unterkunft in Anspruch nimmt, einerseits diese fluide Grenze beschreitet und also andererseits ein Gast genannt werden kann.
Ich hatte einmal einen Freund, der sich daran erfreute, dass ich ständig Sätze mit einerseits und andererseits begann, ohne die Begriffe korrekt zu verwenden. Anstatt gegensätzliche Ansichten kundzutun, addierte ich damit frei die immer gleiche Meinung.
Einerseits ist ein Rondell eine militärische Einrichtung, andererseits ein Wehrbau, von dem aus sich der Feind aus sicherer Distanz beobachten lässt, zum Beispiel mit einem Fernglas. Wenn man einerseits keine Lust auf den Feind hat beziehungsweise auf sein Sich-Nähern, so lässt er sich andererseits vom Rondell aus mit Pfeilen beschießen. Wer auf dem Rondell steht, hat den Überblick über all seine Feinde oder Untertanen, falls er denn welche hat. Vom Rondell aus lässt sich gut so tun, als hätte man welche, auch wenn man keine hat. Man kann um das Rondell herum beliebig Wassergräben hinzufügen. Ein Rondell ist denjenigen zu empfehlen, die sich größer fühlen können müssen.
Der Kellner innerhalb des Rondells tut gerade so, als höre er meine Bierbestellung nicht.
21Dort, wo der Gast hergekommen ist, ist er jetzt nicht mehr. Dort, wo er war, ist jetzt nur noch ein Nicht-Gast. Dort, wo der Gast nicht mehr ist, hat es jemand mit einer Leere zu tun, vielleicht einer pulsierenden Leere. Jemand sieht sich mit der Abwesenheit des Gastes konfrontiert. Jemand ist vielleicht verwundert, vielleicht traurig, vielleicht froh darüber.
Alles, was der Gast hier zu viel sein könnte, ist er vielleicht irgendwo zu wenig. Hier hat nichts gefehlt. Hier hat niemand auf einen Gast gewartet. Hier gibt es alles bereits im Überfluss.