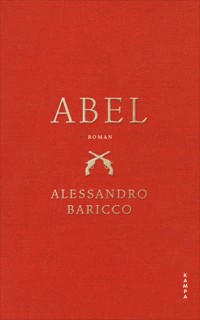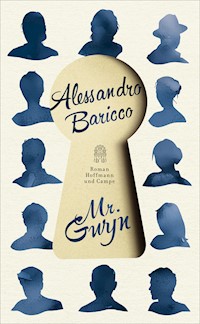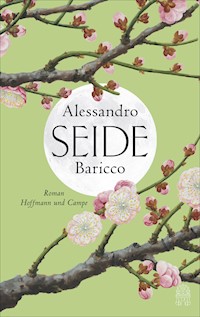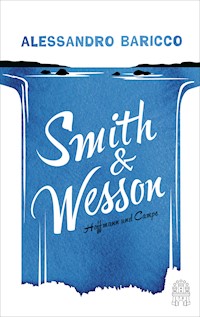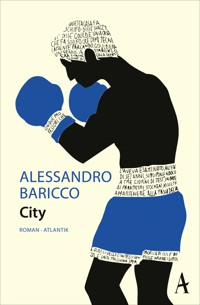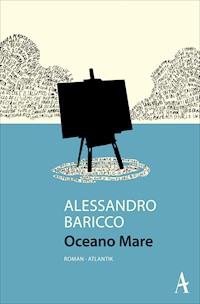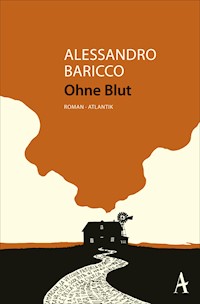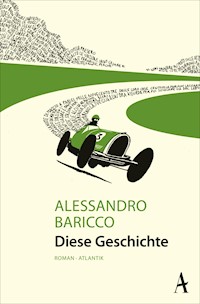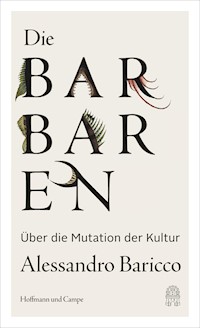
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Stecken wir mitten in einem epochalen Umbruch ähnlich dem der Aufklärung, jetzt, da die Computerisierung und Kommerzialisierung fast aller Lebensbereiche unsere kulturellen Errungenschaften nach und nach verschlingen? Ja, meint Alessandro Baricco und nimmt diesen Befund zum Anlass, so unvoreingenommen wie originell darüber nachzudenken, was die weitgreifende Popularisierung von Kulturphänomenen und unser tägliches Eintauchen ins Netz für unsere Art, die Welt zu erfahren, bedeuten. Geistreich, humorvoll und unterhaltsam entfaltet er eine hellsichtige Analyse unserer Zeit, die zum Weiterdenken anstiftet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Alessandro Baricco
Die Barbaren
Über die Mutation der Kultur
Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki
Hoffmann und Campe
Dieser Text hat eine besondere Entstehungsgeschichte. Ich habe ihn zwischen Mai und Oktober 2006 in einem für meine Verhältnisse ziemlich besessenen Rhythmus geschrieben. Alle fünf, sechs Tage wurde eine Folge in der Zeitung veröffentlicht, mit der ich zusammenarbeite, La Repubblica. Wenn ich vorgehabt hätte, ein normales Sachbuch zu schreiben, hätte ich wahrscheinlich eine andere Sprache benutzt, hätte mehr argumentiert, mehr reflektiert, und da ich die Möglichkeit gehabt hätte, nachträglich zu korrigieren, hätte ich den Aufbau des Gedankengangs sorgfältiger gestaltet. Aber ich hatte Lust zu dieser Art Live-Arbeit vor den Augen der Leser, bei der es mir eher auf die Notwendigkeit des Denkens ankam als auf die Besonnenheit, die für eine Veröffentlichung nötig ist.
Hier sind jene dreißig Folgen nun in der strengeren Form eines echten Buches gesammelt, es ist für die Leser gedacht, die sie nicht verfolgen wollten oder konnten, als sie entstanden. Ich habe wenig korrigiert und fast nichts verändert, denn ich wollte, dass der Text das bleibt, was er ursprünglich war, mit all seinen Schwächen, seiner unvorsichtigen Eile und seiner freimütigen Barbarei. Auf diese Weise scheint er mir tatsächlich das zu sein, was er sein sollte: die Erinnerung an eine ungewöhnliche kleine Unternehmung.
AB
November 2006
Beginn
Es sieht nicht so aus, aber dies ist ein Buch. Meine Überlegung war, dass ich gerne ein Buch in Fortsetzungen schreiben würde, die in der Zeitung erscheinen, mitten zwischen den Innereien der Welt, die tagtäglich dort hindurchgehen. Mich faszinierte die Anfälligkeit des Unternehmens: Es ist ein ungeschütztes Schreiben, man steht auf einem Wachturm, alle beobachten einen, der Wind weht, die Leute gehen vorüber, haben viel zu tun. Und du hockst dort oben, kannst weder korrigieren noch umkehren oder den Entwurf ändern. Es kommt so, wie es kommt. Und am nächsten Tag wird der Salat in der Zeitung eingewickelt oder ein Malerhütchen daraus gemacht. Vorausgesetzt, man macht noch Hütchen aus Zeitungspapier – Schiffchen an der Küste ihrer Gesichter.
Von Zeit zu Zeit, und beileibe nicht nur bei der Arbeit, sucht man sich irgendeine Notlage. Das ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, etwas Authentizität zurückzugewinnen.
Jedenfalls möchte ich keine falschen Erwartungen wecken, also erkläre ich, dass dies kein Roman ist. Fortsetzungsromane interessieren mich überhaupt nicht. Darum wird es ein Essay sein, und zwar im buchstäblichen Sinne, mithin ein Versuch, schreibend zu denken. Ich möchte einiges von dem, was ringsum passiert, verstehen. Mit »ringsum« meine ich den winzigen Ausschnitt der Welt, in dem ich mich bewege: Menschen, die studiert haben, Menschen, die studieren, Erzähler, Leute aus den Medien, dem Theater, Intellektuelle und dergleichen. In vieler Hinsicht eine grässliche Welt, doch letztendlich ist dies die Gegend, wo die Ideen weiden, und hier wurde ich ausgesät. Den Kontakt zum Rest der Welt habe ich seit geraumer Zeit verloren, was nicht schön ist, aber wahr. Man muss sich schon gewaltig anstrengen, um die eigene Erdscholle zu verstehen, da bleibt nicht viel Kraft für den Rest des Feldes.
Aber vielleicht steckt ja in jeder Scholle, wenn man sie zu lesen weiß, das ganze Feld.
Wie ich schon sagte, es gibt dort etwas, das ich verstehen möchte. Erst dachte ich an folgenden Titel für das Buch: Die Mutation. Doch ich habe niemanden gefunden, dem dieser Titel auch nur annähernd gefiel. Na gut. Aber es war ein präziser Titel. Damit meine ich, dass er genau das beim Namen nennt, was ich verstehen möchte: worin die Mutation besteht, die ich um mich herum beobachte.
Kurz zusammengefasst, würde ich sagen: Alle spüren, dass eine unbegreifliche Apokalypse kurz bevorsteht. Und überall läuft dieses Gerücht um: Die Barbaren kommen. Ich sehe, wie hervorragende Geister die Ankunft der Invasoren beobachten, indem sie den Horizont des Fernsehens fixieren. Tüchtige Lehrer ermessen von ihren Pulten aus am Schweigen ihrer Schüler das Ausmaß der Ruinen, die eine – freilich für niemanden sichtbare – Horde bei ihrem Durchzug hinterlassen hat. Und über allem, was geschrieben oder gedacht wird, schwebt der verstörte Blick von Exegeten, die entsetzt von einer Welt erzählen, die von kultur- und geschichtslosen Räuberbanden geplündert worden ist.
Die Barbaren, da sind sie.
Nun herrscht in meiner Welt zwar ein Mangel an intellektueller Redlichkeit, aber nicht an Intelligenz. Sie sind nicht alle verrückt geworden. Sie sehen etwas, was da ist. Mir will es allerdings nicht gelingen, das, was da ist, so zu sehen wie sie. Es überzeugt mich nicht.
Mir ist bewusst, dass es sich um das normale Duell zwischen den Generationen handeln könnte, die Alten, die sich dem Eindringen der Jüngeren widersetzen; die etablierte Macht, die ihre Positionen verteidigt, indem sie aufstrebende Kräfte der Barbarei beschuldigt, und dergleichen Dinge, die schon immer vorkamen und die wir unzählige Male erlebt haben. Doch dieses Mal scheint es anders zu sein, denn dieses Duell geht sehr weit. Gewöhnlich kämpft man um die Kontrolle strategischer Punkte auf der Landkarte. Hier aber scheinen die Angreifer etwas viel Radikaleres, Grundlegenderes zu tun: Sie verändern die Landkarte. Vielleicht haben sie sie sogar schon verändert. So muss es in den seligen Zeiten gewesen sein, als zum Beispiel die Aufklärung entstand, oder in den Tagen, in denen die ganze Welt plötzlich die Romantik in sich entdeckte. Das waren keine Truppenverschiebungen und auch keine Söhne, die ihre Väter umbrachten. Es waren Mutanten, die eine Landschaft durch eine andere ersetzten und dort ihre Lebenswelt gründeten.
Vielleicht ist das jetzt einer dieser Momente. Und diejenigen, die wir Barbaren nennen, sind eine neue Spezies, die Kiemen hinter den Ohren hat und von nun an unter Wasser leben will. Klar, dass wir mit unseren kleinen Lungen von außen den Eindruck einer drohenden Apokalypse haben müssen. Wo sie atmen, sterben wir. Und wenn wir sehen, dass unsere Kinder sehnsüchtig das Wasser betrachten, fürchten wir um sie und stürzen uns blind auf das Einzige, was wir sehen können – den Schatten einer nahenden Barbarenhorde. Inzwischen ist den oben erwähnten Kindern unter unseren Fittichen das Atmen bereits zur Last geworden, sie kratzen sich hinter den Ohren, als wäre da schon etwas, das freigesetzt werden müsste.
An dieser Stelle bekomme ich Lust zu verstehen. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch mit diesem seltsamen Asthma zu tun, das mich immer häufiger überfällt, und der merkwürdigen Neigung, lange unter Wasser zu schwimmen, doch ohne dass mir jene rettenden Kiemen wachsen würden.
Wie auch immer. Ich würde mir diese Kiemen gerne von nahem ansehen. Das Tier erforschen, das sich von der Erde zurückzieht und zum Fisch wird. Ich möchte die Mutation beobachten, nicht, um ihren Ursprung zu erklären (das übersteigt meine Möglichkeiten), sondern um sie wenigstens skizzieren zu können. Wie ein Naturforscher früherer Zeiten, der die neue Spezies, die er auf der kleinen australischen Insel entdeckt hat, in sein Notizheft zeichnet. Heute habe ich mein Notizheft aufgeschlagen.
Ihr versteht nichts? Begreiflich, das Buch hat ja noch nicht einmal begonnen.
Ein Buch ist eine Reise für geduldige Wanderer.
Bücher beginnen oft mit einem Ritual, das ich sehr liebe und das darin besteht, ein Motto auszuwählen. Gemeint ist dieser kurze Satz oder das Zitat, das man auf die erste Seite setzt, gleich nach dem Titel und der eventuellen Widmung, und das als Wegzehrung, als Segensspruch dient. Als Beispiel hier das Motto eines Buches von Paul Auster:
»Der Mensch hat nicht ein und dasselbe Leben. Er hat viele Leben hintereinander, und das ist die Ursache seines Unglücks.« (Chateaubriand)
So klingen sie oft. Und egal, was für einen Schmarren sie behaupten, du glaubst es. Sie sind apodiktisch, um es in der Sprache derer zu sagen, die mit den Lungen atmen.
Ich mag die Mottos, die das Feld abstecken. Also solche, die einem ungefähr zu verstehen geben, auf welchem Feld dieses Buch spielen wird. Der große Melville ließ sich ein bisschen hinreißen, als es darum ging, das Motto für Moby Dick auszusuchen, und kam schließlich auf vierzig Zitate. Hier das erste:
»Und Gott schuf große Walfische.« (Genesis)
Und hier das letzte:
»Oh, der uralte Wal in Sturm und Wind / Im Weltenmeere ruht, / Ein Riese an Macht, wo Macht ist Recht, / Ein König der endlosen Flut!« (Walfängerlied)
Ich glaube, das sollte zu verstehen geben, dieses Buch enthalte die ganze Welt, von Gott bis zu den Fürzen der Matrosen von Nantucket. Wenigstens war das das nette kleine Programm von Melville.
Die reine Seele! würde Vonnegut sagen, mit Ausrufezeichen.
Und so habe ich für dieses Buch vier Mottos ausgesucht. Einfach nur, um die Grenzen des Spielfelds zu ziehen. Hier das erste, es stammt aus einem sehr schönen Buch, das vor kurzem in Italien erschienen ist. Geschrieben hat es der Historiker Wolfgang Schivelbusch, der Titel lautet Die Kultur der Niederlage (das sind Titel, denen ich als Fan des FC Turin nicht widerstehen kann). An einer Stelle heißt es:
»So alt wie die Geschichte der städtischen Hochkulturen ist deren Furcht, von Barbarenhorden überfallen und ausgelöscht zu werden. Das Bild der Versteppung, des von Nomaden verwüsteten Gartens und der verfallenen Paläste, in denen Fellachen ihre Ziegen hüten, hat die Dekadenzliteratur von der Antike über Edward Gibbon bis Oswald Spengler und Gottfried Benn fasziniert.«
Schreibt das ab und bewahrt es auf.
Das zweite Motto findet ihr in der nächsten Folge.
Was für ein irrer Wind hier oben auf diesem Wachturm.
Mottos
Mottos 1
Das zweite Motto dieses Buches kommt aus weiter Ferne. 7. Mai 1824. Beethoven stellt in Wien die Neunte Symphonie vor. Was an diesem Tag wirklich passierte, ist eine Geschichte, die ich früher oder später gerne erzählen würde. Hier nicht, dies ist nicht der geeignete Ort. Aber ich verspreche euch, dass ich es irgendwann tun werde, denn Verstehen ist wichtig. »Wie viel, in einem Moment geboren oder gestorben!«, sagt Roxane im Cyrano, aber es trifft auch auf den Abend zu, an dem Menschen zum ersten Mal die Ode an die Freude hörten (wenige Menschen, denn viele hatten sich nach der Hälfte des Konzerts erschöpft aus dem Staub gemacht). Das sind so Momente. Früher oder später muss man sich wirklich entschließen, sie zu erzählen. Doch jetzt nicht.
Nicht jetzt, aber eines möchte ich doch sagen, denn ich glaube, es hat mit den Barbaren zu tun, und zwar, dass Beethoven an dem Abend in einem grünen Frack ins Konzerthaus ging, er hatte keinen in einer dezenteren, seriöseren Farbe, also musste er diesen grünen Frack anziehen, und als er aus dem Haus ging, war seine größte Sorge, was man zu seinem dramatisch grünen Frack sagen würde, aber sein Sekretär, der Schindler hieß, beruhigte ihn, er müsse sich keine Sorgen machen, weil es im Konzerthaus sicherlich dämmrig sei, also würden die Leute wahrscheinlich gar nicht bemerken, welche Farbe sein Frack habe, der in diesem Fall grün war.
Genauso geschah es. Und wenn ich beim zwanzigsten Kapitel dieses Buches angekommen bin, wird es mir leichter fallen, euch zu erklären, wie wichtig diese Anekdote ist. Das wird erst in ein paar Monaten sein, vermute ich, aber dann werdet ihr diesen Satz mühelos verstehen: Es ging auch darum, wie sie gekleidet waren. Versprochen.
Jedenfalls war es nicht das, was ich sagen wollte. Ich war beim zweiten Motto. Die Neunte von Beethoven erklang also zum ersten Mal, und es ist merkwürdig, wie sie aufgenommen wurde. Von den Leuten, den Kritikern, allen. Es war nämlich einer jener Momente, in denen manche Menschen Kiemen hinter ihren Ohren entdecken und sich vorsichtig mit dem Gedanken vertraut machen, dass es ihnen unter Wasser vielleicht weitaus besser gehen würde. Sie befanden sich auf der Schwelle einer wahnsinnigen Mutation (wir haben sie dann Romantik genannt, und wir stecken noch heute darin). Es ist deshalb sehr wichtig, sich anzusehen, was die Leute in dem Moment damals sagten und dachten. Hier also das, was ein Londoner Kritiker ein Jahr später schrieb, als er die Neunte endlich lesen und hören konnte. Ich muss vorausschicken, dass er kein Dummkopf war, er schrieb für eine angesehene Zeitschrift mit dem Titel The Quarterly Musical Magazine and Review. Ich gebe wieder, was er schrieb, und es soll mein zweites Motto sein:
»Eleganz, Reinheit und Maß, welches die Prinzipien unserer Kunst waren, haben nach und nach vor dem frivolen, affektierten neuen Stil kapituliert, den die heutigen Zeiten mit ihrem Talent zur Oberflächlichkeit angenommen haben. Köpfen, die durch ihre Erziehung und aus Gewohnheit an nichts anderes zu denken vermögen als an Kleidung, Mode, Klatsch, Romanlektüre und unmoralische Ausschweifungen, fällt es schwer, die erleseneren und weniger fieberhaften Freuden der Wissenschaft und Kunst zu genießen. Für solche Köpfe schreibt Beethoven und scheint damit einen gewissen Erfolg zu haben, wenn ich den Lobeshymnen auf sein neues Werk glauben darf, die ich von allen Seiten höre.«
Voilà.
Wenn ich daran denke, dass die Neunte heutzutage eines der höchsten und trutzigsten Bollwerke jener Festung ist, die die Barbaren angreifen werden, muss ich lächeln. Diese Musik ist Flagge, Hymne, erhabenstes Festungswerk geworden. Sie ist unsere Kultur. Nun, es hat eine Zeit gegeben, in der die Neunte das Banner der Barbaren war! Sie und die Romanleser – alles Barbaren! Als sie am Horizont auftauchten, eilten die Leute, ihre Töchter und den Schmuck zu verstecken! Das sind Schicksalsschläge. (Nebenbei bemerkt: Wie ist es dazu gekommen, dass man heute Menschen, die KEINE Romane lesen, für Barbaren hält?)
Apropos die Neunte, hört euch das an. Warum haben CDs genau diese Größe und enthalten exakt diese Anzahl Minuten Musik? Schließlich hätte man die CD, als man sie erfand, auch ein bisschen größer oder kleiner machen können, warum also genau dieses Maß? Antwort: 1982, als es bei Philips um die Frage der Größe ging, dachten sie sich: In eine CD muss die gesamte Neunte Symphonie von Beethoven reinpassen. Seinerzeit brauchte man dafür einen Träger von 12 Zentimetern. So entstand die CD. Noch heute richtet sich, sagen wir, eine CD von Madonna nach der Dauer dieser Symphonie.
Merkwürdig, nicht? Ist das aber auch wahr? Ich weiß es nicht. Ich habe es in einer französischen Zeitschrift gelesen, die L’Echo des Savanes heißt und in der man auf jeder dritten Seite nackte Frauen und Comics findet. Wenn du im Zug fährst, umgeben von Menschen, ist es reichlich mühsam, diese Zeitschrift zu lesen, vor allem, wenn du katholisch erzogen wurdest. Auf ihrem Gebiet ist sie jedenfalls eine angesehene Zeitschrift, obwohl ich nicht sagen könnte, was ihr Gebiet eigentlich ist. Es geht mir um Folgendes: Auch wenn sie nicht der Wahrheit entspricht, ist die Anekdote von Philips doch bezeichnend für etwas sehr Wahres, nämlich den absolut totemistischen Charakter der Neunten. Und das sagt diese Anekdote in einer schlüssigen Kurzform, die ich in Dutzenden Büchern ohne nackte Frauen nicht gefunden habe. Das gefällt mir, und es hat mit diesem Buch zu tun. Was ist das für eine neue Form von Wahrheit, die vielleicht nur ausgedacht ist, aber so exakt daherkommt, dass sie jede Überprüfung überflüssig macht? Und warum ausgerechnet dort, zwischen Brüsten und Ärschen? Wenn ich es schaffe, werde ich im dritten Kapitel dieses Buches auf diese Frage zurückkommen. Ich muss nur noch rauskriegen, wovon die ersten beiden Kapitel handeln werden.
Immer mit der Ruhe. Ich tue nur so. Einen Plan habe ich durchaus. Zum Beispiel weiß ich, dass ich das letzte Kapitel auf der Großen Chinesischen Mauer schreiben werde.
Na gut. Kommen wir zum dritten Motto.
Mottos 2
Kleine Zusammenfassung: Dies ist ein Buch in Fortsetzungen, ein Essay über die Ankunft der Barbaren. Im Moment bin ich noch bei der ersten Seite, nämlich der, auf der die Mottos stehen. Zwei habe ich schon abgehakt, jetzt geht es um das dritte. Das dritte Motto verdanke ich Walter Benjamin. Und hier muss ich kurz ausholen.
Walter Benjamin, das schreibe ich für die, die ihn nicht kennen, war ein Deutscher (darum wird er bitte nicht Bendschämin ausgesprochen, als hätte er in Connecticut gelebt). Er wurde 1892 in Berlin geboren und starb 48 Jahre später durch Selbstmord. Man könnte von ihm sagen, er sei der größte Literaturkritiker in der Geschichte der Literaturkritik gewesen. Aber das hieße, die Dinge arg verkürzt darzustellen. In Wirklichkeit war er einer, der die Welt studierte. Das Denken der Welt. Dafür benutzte er meistens die Bücher, die er las, denn sie erschienen ihm als vorzügliche Eingangstür zum Geist der Welt. Doch im Grunde wusste er ebenso gut alles andere zu benutzen, ob es die Magie der Fotografie war oder die Werbung für Büstenhalter oder die Topographie von Paris oder was die Leute aßen.
Er schrieb viel, wie besessen, aber es gelang ihm praktisch nie, ein ordentliches, vollständiges und abgeschlossenes Buch zu verfassen. Sein Nachlass besteht aus einer ungeheuren Menge Notizen, Essays, Aphorismen, Rezensionen, Artikeln und Inhaltsverzeichnissen von nie geschriebenen Büchern. Genug, um einen Herausgeber in den Wahnsinn zu treiben. Er lebte in der Trauer darüber, dass es nirgendwo eine sichere Anstellung und ein festes Gehalt für ihn gab: Universitäten, Zeitungen, Verleger und Stiftungen machten ihm zwar viele Komplimente, sahen aber nie eine Möglichkeit, dauerhaft mit ihm zusammenzuarbeiten. Also fand er sich damit ab, fortwährend in Geldnot zu leben. Wenigstens habe ihm dieser Zustand ein Privileg verschafft, sagte er, nämlich jeden Morgen aufzustehen, wann es ihm passte. Es muss aber auch erwähnt werden, dass er die meiste Zeit sehr unglücklich über seine Lage war. Und noch etwas: Er war Jude und Marxist. Für einen Juden und Marxisten war Nazideutschland nicht gerade der geeignetste Ort, um in Frieden alt zu werden.
Es gibt bei ihm eine Besonderheit, die im Rahmen dieses Buches wie die wichtigste klingt. Das ist nicht leicht zu erklären, also setzt euch hin, und wenn ihr euch nicht setzen könnt, unterbrecht die Lektüre und lest weiter, sobald ihr all eure Neuronen benutzen könnt. Also: Er versuchte nicht, zu verstehen, was die Welt war, sondern immer, was die Welt bald werden würde. Was ihn an der Gegenwart faszinierte, waren die Anzeichen für Mutationen, die diese Gegenwart auflösen würden. Ihn interessierten Verwandlungsprozesse; Zeiten, in denen die Welt in sich selbst ruhte, waren ihm völlig egal. Von Baudelaire bis zur Reklame – alles, worüber er sich beugte, wurde zur Prophezeiung einer zukünftigen Welt und zur Ankündigung einer neuen Kultur.
Ich versuche, genauer zu sein: Verstehen bedeutete für ihn nicht, den Untersuchungsgegenstand durch eine Definition auf der bekannten Landkarte der Wirklichkeit unterzubringen, sondern zu erahnen, wodurch dieser Gegenstand die Landkarte so verändern würde, dass sie nicht wiederzuerkennen war. Er genoss es, den Stützpunkt zu finden und zu studieren, den eine Kultur braucht, um sich um die eigene Achse zu drehen und zu einer neuen, früher unvorstellbaren Landschaft zu werden. Mit dem größten Vergnügen beschrieb er diese titanische Bewegung, die für die meisten Menschen unsichtbar war, für ihn aber ganz offensichtlich. Er fotografierte das Werden, und auch darum gerieten seine Fotos sozusagen immer ein bisschen verwackelt, waren also unverwertbar für Institutionen, die ein festes Gehalt zahlen, und objektiv eine Zumutung für ihre Betrachter. Er war der absolute Meister einer sehr speziellen Kunst, die früher Prophetie hieß und die man heute passender definieren müsste als die Kunst, Mutationen einen Augenblick bevor sie sich ereignen, zu entschlüsseln.
Und so einer sollte nicht unter den Mottos dieses Buches auftauchen?
Hier also das dritte Motto. (Ihr könnt jetzt wieder aufstehen und euch entspannen.) Ich habe oft gedacht, wie nützlich, wie wahnsinnig nützlich jemand wie er nach dem Krieg gewesen wäre, als alles in die Luft geflogen war und wir begonnen haben, das zu sein, was wir jetzt sind. Es ist grausam, dass er nicht das Fernsehen kennenlernen durfte, Elvis, die Sowjetunion, das Tonband, das Fastfood, JFK, Hiroshima, die Mikrowelle, die legale Abtreibung, John Patrick McEnroe, Armani-Jacken, Spiderman, Papst Johannes und einen Haufen Dinge mehr. Könnt ihr euch vorstellen, was er mit so einem Material gemacht hätte? Gut möglich, dass er uns alles viele Jahre früher erklärt hätte (immer auf eine etwas verwackelte Weise, zugegeben). Er war einer, der 1963 zum Beispiel ohne große Mühe die Reality-Show hätte vorhersehen können. Aber so kam es nicht. Benjamin brachte sich in einem gottverlassenen Städtchen an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien um. Das war im September 1940. Er hatte sich endlich dazu entschlossen, vor dem Kriegsdelirium der Nazis zu fliehen, und sein Plan war, bis nach Portugal zu kommen, um dann, allerdings widerwillig, nach Amerika zu gehen. Er bekam Ärger wegen seines Visums. Man hielt ihn an der Grenze fest und spannte ihn ein bisschen auf die Folter. In der Nacht überlegte er, dass Warten nichts für ihn sei. Und machte Schluss mit einer tödlichen Dosis Morphium. Am nächsten Tag kam sein Visum an, fix und fertig, mit Stempel. Er hätte sich in Sicherheit bringen können. Ein Ende wie bei Shakespeare.
Manchmal fragt mich mein Sohn (und ich falle immer wieder darauf herein): Wenn ein Starker und ein Kluger kämpfen, wer gewinnt? Eine gute Frage. Die Nobelpreisträgerin in Medizin Rita Levi Montalcini gegen den Wrestling-Kämpfer John Cena, wer gewinnt? Meist antworte ich: Rita Levi Montalcini, denn das ist die politisch korrekte Antwort, und wie aus Wochenblättern hervorgeht, bin ich ein Gutmensch. Aber hier stimmt die Antwort nicht, in Benjamins Fall gewann der Stärkere. Er war der Klügste, den es gab. Und verlor. Nichts zu machen.
Das Motto habe ich nicht vergessen, ich komme gleich darauf zurück. Ich muss oft daran denken, was wir mit Benjamins Tod verloren haben, weil ich weiß, dass es ihm, obwohl er ein höllisch gebildeter Mensch war, nichts ausgemacht hätte, sich mit Spiderman oder McDonald’s zu beschäftigen. Ich will damit sagen, dass er als einer der Ersten wusste, dass man die DNA einer Kultur nicht nur in den erhabensten Höhenflügen ihrer Gefühle, sondern auch, wenn nicht vor allem, in ihren scheinbar unbedeutendsten Entgleisungen entziffert. Im Verhältnis zur Kultur war er nicht bigott, er war durch und durch laizistisch. Darin stellt er zweifellos ein Vorbild dar. In seiner Fähigkeit, den Nerv der Welt aus Baudelaire ebenso wie aus einem Handbuch über das Gärtnern abzuleiten (das tat er wirklich), liegt eine Positionsbestimmung, die wie eine endgültige Lektion klingt. Für mich ist sie in einem Bild zusammengefasst, fast ein frame, ein Einblick wie ein Blitz, der mich hinterrücks in einer Buchhandlung in San Francisco überfiel. Ja, um nichts zu verschweigen, es war tatsächlich die Buchhandlung von Ferlinghetti, der mythische Laden City Lights.
Ich blätterte dort in Büchern, bloß aus Spaß am Blättern, und plötzlich stolpere ich über die amerikanische Ausgabe von Benjamins Schriften. In Wirklichkeit ist das ein Monstrum, aber zufällig gab es dort davon nur zwei Bände. Ich schlage sie auf und blättere. Die Amerikaner (wie die Italiener übrigens auch) haben sich aus dem Riesendurcheinander seiner Papiere herausgewunden, indem sie einfach eine Auswahl in chronologischer Ordnung veröffentlichten.
Das Jahr, das ich in der Hand hielt, war 1931. Ich habe das Inhaltsverzeichnis gesucht, denn allein schon die Abfolge der Titel seiner Schriften ist eine Lektion.
Kritik der neuen Sachlichkeit
Hofmannsthal und Aleco Dossena
Karl Kraus
Die Kritik als Grundwissenschaft der Literaturgeschichte
Deutsche Briefe
Theologische Kritik
Ich packe meine Bibliothek aus
Franz Kafka
Kleine Geschichte der Photographie
Paul Valéry
Ich las und genoss. Die Einkaufsliste eines Genies. Dann stand da:
Das Erdbeben von Lissabon
Der destruktive Charakter
Reflexionen zum Rundfunk
Sieh mal an, das Radio, dachte ich, als ich zum nächsten Titel kam. Und das war ein Titel, auf den ich vielleicht seit Jahren wartete, den in Benjamins Inhaltsverzeichnissen zu finden ich wahrscheinlich seit Jahren geträumt hatte, ohne ihn je zu finden, aber auch ohne je ganz die Hoffnung zu verlieren. Und hier ist er.
Micky-Maus
Mittlerweile gerate ich ja schon in Rührung, wenn ich mir die Chroniken von Narnia anschaue, aber damals, in Ferlinghettis Buchladen, da war ich wirklich gerührt. Micky Maus. Es gibt ein Fragment von Benjamin mit dem Titel: Micky-Maus. Ich meine, dieser Mann hat Proust übersetzt, hat Baudelaire besser verstanden als irgendjemand vor ihm, hat ein epochales Buch über das deutsche Barocktheater geschrieben (eigentlich wusste nur er, was das war), verbrachte seine Zeit damit, Goethe umzukrempeln wie eine Socke, Marx auswendig zu zitieren, liebte Herodot, schenkte seine Ideen Adorno, und als der richtige Moment kam, dachte er, dass man, um die Welt zu verstehen – um die Welt zu verstehen, nicht um ein nutzloser Gelehrter zu sein – gut daran täte, wen zu verstehen? Micky Maus.
Und hier ist es, das dritte Motto.
»Micky-Maus« (W. Benjamin).
Nur so, schlicht und einfach, wie es mir an jenem Tag in San Francisco erschien.
»Micky-Maus« (W. Benjamin).
Es soll mir eine Verpflichtung sein. Dies wird ein Buch, das vor nichts zurückschreckt.
(Und wenn ihr jetzt nicht alles geben würdet, um zu erfahren, was Benjamin über Micky Maus geschrieben hat, dann ist euch nicht mehr zu helfen. Mit einer gewissen Genugtuung darf ich sagen, dass es diesen Text, wenn ich nicht irre, in der italienischen Ausgabe nicht gibt. Wenn ihr ihn also lesen wollt, müsst ihr auf die nächste Folge warten. Da werde ich ihn bringen, als Bonusmaterial, haha.)
Mottos 3
Ich habe es versprochen, also muss ich euch den kleinen Text zu lesen geben, den Walter Benjamin Micky Maus gewidmet hat. Erwartet nicht zu viel. Es ist bloß eine Seite aus einem Tagebuch, also Notizen, die er für sich selbst gemacht hat, einfach nur, um nichts zu vergessen. Außerdem muss es für ein Genie wie Benjamin sehr viel schwerer gewesen sein, Disney zu verstehen als, sagen wir, Goethe. Da fällt mir ein, was Glenn Gould gesagt hat, um zu erklären, warum er Rock ’n’ Roll nicht mochte: »Was zu einfach ist, kann ich nicht verstehen.« So waren diese Genies.
Bleibt die Tatsache, dass Benjamin sich ein Nachdenken über Micky Maus sehr gut hätte ersparen können, aber er hat darüber nachgedacht, und das ist, wie gesagt, eine Lektion, und das, was er schrieb, eine Art fetischistisches Fundstück. Ich gebe es hier vollständig wieder:
Aus einem Gespräch mit Gustav Glück und Kurt Weill. Eigentumsverhältnisse im Micky-Maus-Film: hier scheint zum ersten Mal, daß einem der eigne Arm, ja der eigne Körper gestohlen werden kann.
Der Weg eines Akts im Amt hat mehr Ähnlichkeit mit einem von jenen, die Micky-Maus zurücklegt, als mit dem des Marathonläufers.
In diesen Filmen bereitet sich die Menschheit darauf vor, die Zivilisation zu überleben.
Die Micky-Maus stellt dar, daß die Kreatur noch bestehen bleibt, auch wenn sie alles Menschenähnliche von sich abgelegt hat. Sie durchbricht die auf den Menschen hin konzipierte Hierarchie der Kreaturen.
Diese Filme desavouieren, radikaler als je der Fall war, alle Erfahrung. Es lohnt sich in einer solchen Welt nicht, Erfahrungen zu machen.
Ähnlichkeit mit dem Märchen. Niemals seitdem sind die wichtigsten und vitalsten Ereignisse unsymbolischer, atmosphärenloser gelebt worden. Der unermessliche Gegensatz zu Maeterlinck und zu Mary Wigman. Alle Micky-Maus-Filme haben zum Motiv den Auszug, das Fürchten zu lernen.
Also ist nicht »Mechanisierung«, nicht das »Formale«, nicht ein »Mißverständnis« hier für den ungeheuren Erfolg dieser Filme die Basis, sondern daß das Publikum sein eignes Leben in ihnen wiedererkennt.
Ich gebe zu, das Ganze ist ziemlich unverständlich. Aber es gibt mindestens zwei Sätze, die ich sehr mag. Den ersten und den letzten. Der erste ist bedeutsam, weil er erklärt, worüber zwei Genies wie Benjamin und Kurt Weill redeten, wenn sie sich trafen – sie redeten über Walt Disney (na ja, vielleicht nicht immer, aber einmal wenigstens).
Der letzte rührt mich mit seiner Aufrichtigkeit, denn ich sehe darin die ganze riesige Maschinerie der marxistischen Weltanschauung heroisch vor dem letzten amerikanischen Scheiß niederknien, im erhabenen Bemühen, dessen Erfolg zu verstehen, ähnlich einem Elefanten, der versucht, durchs Loch des Spülbeckens zu schlüpfen. Ich sehe Benjamin vor mir, der es noch einmal liest, die Brille abnimmt und, während er das Licht ausmacht, denkt: Na ja, war vielleicht ein bisschen weit hergeholt, oder?
Ende des Benjamin-Einschubs.
Das vierte und letzte Motto dieses Buches stehle ich einem anderen großen Meister. Cormac McCarthy. Die Zeit vergeht, aber unser guter alter Faulkner für den Hausgebrauch schreibt in seinem Unterschlupf in El Paso immer noch ein Meisterwerk nach dem anderen. Sein letztes in Italien erschienenes Buch heißt No Country for Old Men. Der Meister muss sich überlegt haben, dass die Zeit für Poesie und Visionen vorbei ist, darum hat er seine Geschichte sorgfältig ausgetrocknet, und als er beim Knochen angekommen war, hat er ihn uns vor die Füße geworfen. Beim Leser entsteht folgender Eindruck: Du wolltest ihn besuchen, um ihn zu fragen, was er über die Welt denkt, aber er hat nicht mal über den Bretterzaun geguckt, sondern dich gleich mit einer Gewehrsalve empfangen. Du hast dich umgedreht und bist weggegangen.