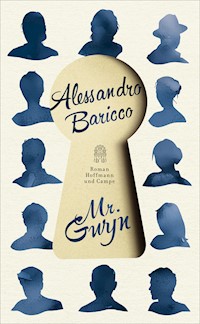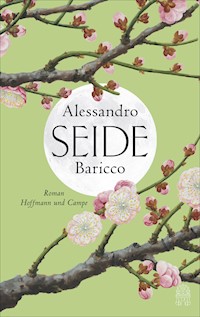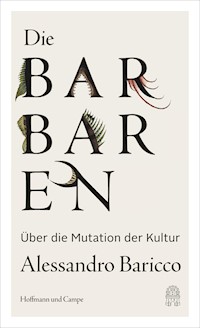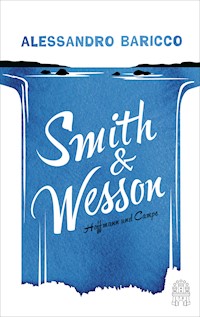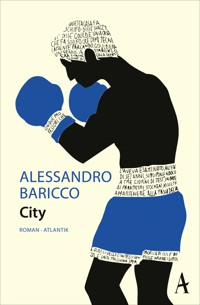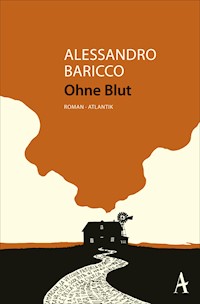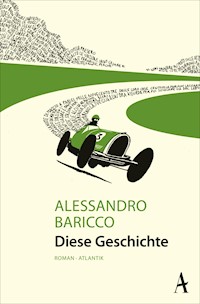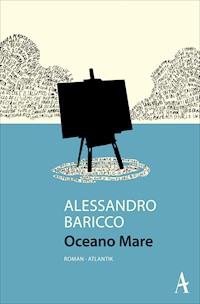
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gestrandet in einer abgelegenen Pension am Meer treffen Menschen zusammen, die vom Leben gezeichnet sind und unterschiedlicher nicht sein könnten: Ein einsamer Maler, der das Meer mit Meerwasser malt, ein seltsamer Wissenschaftler, der die Wellen erforscht, um die Grenzen des Ozeans festzulegen, ein junges Mädchen, das an einer seltsamen Krankheit leidet. Über philosophisch anregende Gespräche versuchen sie, ihre jeweiligen Sehnsüchte - nach Liebe, Erkenntnis oder gar Vollkommenheit - zu stillen. Jenseits jeglicher zeitlichen oder räumlichen Einordnung erzählt dieses poetische Märchen von den vielen Facetten des Lebens, die von unendlicher Liebe und Angst bis hin zu Hoffnungslosigkeit und sogar Hass reichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Alessandro Baricco
Oceano Mare
Roman
Aus dem Italienischen von Karin Krieger
Atlantik
Für Molli, meine geliebte Freundin
Erstes BuchPension Almayer
1
Sand so weit das Auge reicht zwischen den letzten Hügeln und dem Meer – dem Meer – in der kalten Luft eines Nachmittags, der fast vergangen ist, und gesegnet vom Wind, der stets von Norden bläst.
Der Strand. Und das Meer.
Es könnte die Vollkommenheit sein – Bild für göttliche Augen –, eine Welt, die sich ereignet und nichts weiter, das stumme Sein von Wasser und Erde, abgeschlossenes und exaktes Werk, Wahrheit – Wahrheit – doch wieder einmal ist es das rettende Körnchen des Menschen, das den Mechanismus dieses Paradieses verklemmt, eine Kleinigkeit, die allein genügt, die ganze große Maschinerie unerbittlicher Wahrheit zum Stillstand zu bringen, ein Nichts, aber in den Sand gepflanzt, unmerklicher Riss auf der Oberfläche dieser heiligen Ikone, winzige Ausnahme, auf die Vollkommenheit des unermesslichen Strandes gesetzt. Von weitem betrachtet wäre er nur ein schwarzer Punkt – im Nirgendwo das Nichts eines Menschen und einer Staffelei.
Die Staffelei ist an dünnen Seilen mit vier Steinen im Sand verankert. Sie schwankt unmerklich im Wind, der stets von Norden bläst. Der Mann trägt hohe Stiefel und eine weite Seemannsjacke. Er steht vor dem Meer und dreht einen dünnen Pinsel zwischen den Fingern. Auf der Staffelei eine Leinwand. Er ist wie ein Wachposten – das muss man verstehen –, er steht da, um dieses Stück Welt vor der stillen Invasion der Vollkommenheit zu schützen, ein kleiner Sprung, der diese großartige Kulisse des Seins zersplittert. Denn so ist es immer, es genügt der Schatten eines Menschen, um den Frieden dessen zu zerschlitzen, was im nächsten Augenblick hätte Wahrheit werden können und stattdessen unvermittelt Erwartung und Frage wird durch die schlichte und unendliche Macht dieses Menschen, der Schlitz und Spalt ist, eine kleine Pforte, durch die in Strömen Geschichten zurückkehren und der riesige Vorrat dessen, was sein könnte, unendlicher Riss, wunderbare Wunde, Weg tausendfacher Schritte, wo künftig nichts mehr wahr sein kann, aber alles sein wird – gerade so, wie die Schritte jener Frau sind, die in einen violetten Mantel gehüllt und mit bedecktem Kopf langsam über den Strand kommt, an der Brandung des Meeres entlang, und die die nunmehr verlorene Vollkommenheit des großen Gemäldes von rechts nach links durchkreuzt, während sie die Entfernung, die sie von dem Mann und seiner Staffelei trennt, verkürzt, bis sie auf wenige Schritte an ihn herangekommen ist und dann direkt neben ihm steht, wo sie ein winziges Anhalten wird – und schweigend ein Schauen.
Der Mann dreht sich nicht einmal um. Er sieht weiter unverwandt auf das Meer. Stille. Von Zeit zu Zeit taucht er den Pinsel in eine Kupferschale und deutet auf der Leinwand ein paar leichte Striche an. Die Borsten des Pinsels hinterlassen den Hauch eines sehr blassen Schattens, den der Wind augenblicklich trocknet, sodass er das vorherige Weiß wieder zutage treten lässt. Wasser. In der Kupferschale ist nur Wasser. Und auf der Leinwand nichts. Nichts, was man sehen kann.
Wie immer bläst der Wind von Norden, und die Frau wickelt sich fest in ihren violetten Mantel.
»Plasson, seit etlichen Tagen schon arbeiten Sie hier draußen. Warum nur schleppen Sie all diese Farben mit sich herum, wenn Sie nicht den Mut haben, sie zu verwenden?«
Das scheint ihn aufzurütteln. Das hat gesessen. Er dreht sich um und betrachtet das Gesicht der Frau. Doch als er spricht, tut er es nicht, um zu antworten:
»Bitte, bewegen Sie sich nicht.«
Dann führt er den Pinsel zum Gesicht der Frau, zögert einen Augenblick, setzt ihn an ihre Lippen und lässt ihn langsam von einem Mundwinkel zum anderen gleiten. Die Borsten färben sich karminrot. Er sieht sie an, taucht sie kurz ins Wasser und schaut wieder auf das Meer. Auf den Lippen der Frau bleibt die Spur eines Geschmacks zurück, der sie unwillkürlich denken lässt: »Meerwasser, dieser Mann malt das Meer mit dem Meer.« – Es ist ein Gedanke, der ein Frösteln verursacht.
Sie hat sich längst umgedreht und geht mit der präzisen Kette ihrer Schritte schon wieder über den unermesslichen Strand, als der Wind über die Leinwand fährt, um einen Tupfen aus rosarotem Licht zu trocknen, der nackt auf dem Weiß schwimmt. Man könnte stundenlang dastehen und dieses Meer betrachten und diesen Himmel und überhaupt alles, doch von dieser Farbe würde man nichts finden. Nichts, was man sehen kann.
In dieser Gegend kommt die Flut, bevor es dunkel wird. Kurz davor. Das Wasser umschließt den Mann und seine Staffelei, es packt sie sanft, aber mit Bestimmtheit, sie harren aus, alle beide, unerschütterlich, wie eine Insel im Kleinformat oder wie ein Wrack mit zwei Köpfen.
Plasson, der Maler. Jeden Abend kurz vor Sonnenuntergang, wenn ihm das Wasser schon bis zum Herzen steht, holt ihn ein kleines Boot ab. So will er es. Er steigt ins Boot, legt die Staffelei und alles hinein und lässt sich nach Hause bringen.
Der Wachposten zieht ab. Seine Pflicht ist getan. Die Gefahr gebannt. Mit dem Sonnenuntergang verlischt die Ikone, der es wieder einmal nicht gelungen ist, heilig zu werden. Alles wegen dieses Männchens und seiner Pinsel. Und jetzt, da es fort ist, bleibt keine Zeit mehr. Das Dunkel stoppt alles. Es gibt nichts, was im Dunkeln wahr werden kann.
2
… nur selten, und so, dass manche sich bei ihrem Anblick in diesen Momenten leise sagen hörten:
»Sie wird daran sterben«
oder:
»Sie wird daran sterben«
oder auch:
»Sie wird daran sterben«
und sogar:
»Sie wird daran sterben.«
Ringsumher Hügel.
Mein Land, dachte der Baron von Carewall.
Es ist nicht direkt eine Krankheit, es könnte eine sein, doch es ist etwas Schwächeres, wenn es einen Namen hat, muss er hauchzart sein, man spricht ihn aus, und schon ist er verflogen.
»Als sie ein kleines Mädchen war, kommt eines Tages ein Bettler vorbei und stimmt ein Klagelied an, das Klagelied erschreckt eine Amsel, die auffliegt …«
»… erschreckt eine Taube, die auffliegt, und es ist das Schwirren der Flügel …«
»… die schwirrenden Flügel, ein belangloses Geräusch …«
»… es wird zehn Jahre her sein …«
»… die Taube fliegt an ihrem Fenster vorbei, nur kurz, einfach so, und sie schaut von ihren Spielen auf, und ich weiß nicht, sie war von Entsetzen gepackt, von einem blanken Entsetzen, ich meine, sie war nicht wie jemand, der Angst hat, sie war wie jemand, der im Begriff ist zu sterben …«
»… das Schwirren der Flügel …«
»… jemand, der ihr die Seele raubte …«
»… glaubst du mir?«
Sie glaubten, dass sie heranwachsen und alles vorbeigehen würde. Doch inzwischen legten sie den ganzen Palast mit Teppichen aus, weil sie natürlich vor ihren eigenen Schritten erschrak, weiße Teppiche überall, eine Farbe, die nicht wehtat, geräuschlose Schritte und blinde Farben. Die Wege im Park waren kreisrund, mit der einzigen kühnen Ausnahme einiger Alleen, die sich in weichen gleichmäßigen Kurven dahinschlängelten – Psalmen –, und das ist schon klüger, denn man braucht wahrlich nicht viel Feingefühl, um zu verstehen, dass jeder tote Winkel ein möglicher Hinterhalt ist und zwei sich kreuzende Straßen eine perfekte geometrische Grausamkeit, die ausreicht, um jeden zu erschrecken, der wirklich empfindsam ist, und erst recht sie, die eigentlich keine empfindsame Seele besaß, sondern genau genommen von der Empfindsamkeit einer unkontrollierbaren Seele besessen war, die in irgendeinem Augenblick ihres heimlichen Lebens – eines winzigen Lebens, denn sie war ja klein – für immer ausgebrochen war und dann auf unsichtbaren Wegen wieder in ihr Herz, in ihre Augen, in ihre Hände und alles zurückgekehrt war wie eine Krankheit, die eine Krankheit nicht war, sondern etwas Schwächeres, wenn es einen Namen hat, muss er hauchzart sein, man spricht ihn aus, und schon ist er verflogen.
Darum waren die Wege im Park kreisrund.
Auch die Geschichte von Edel Trut soll nicht vergessen werden, von Edel Trut, die in der Seidenweberei im ganzen Land nicht ihresgleichen hatte und deshalb vom Baron gerufen worden war, an einem Wintertag, da der Schnee kindshoch lag, bei einer Kälte wie aus dem Jenseits, dort hinzugelangen war die Hölle, das Pferd dampfte, die Hufe aufs Geratewohl im Schnee, und hinten der Schlitten kurz vor dem Abdriften, wenn ich in zehn Minuten nicht da bin, sterbe ich vielleicht, so wahr ich Edel heiße, ich sterbe, und noch dazu ohne je zu erfahren, was zum Teufel mir der Baron denn so Wichtiges zeigen muss …
»Was siehst du, Edel?«
Der Baron steht vor der langen fensterlosen Wand im Zimmer der Tochter und spricht leise, mit altertümlicher Sanftheit.
»Was siehst du?«
Stoffe aus Burgund, hochwertige Sachen, und Landschaften, wie es viele gibt, eine gute Arbeit.
»Das sind nicht irgendwelche Landschaften, Edel. Oder sie sind es zumindest nicht für meine Tochter.«
Seine Tochter.
»Es ist so etwas wie ein Rätsel, aber man muss versuchen, zu verstehen, indem man mit Einfallsreichtum ans Werk geht, und vergessen, was man weiß, sodass der Phantasie keine Grenzen gesetzt sind, während sie weit in die Dinge vordringt, bis zu erkennen ist, dass die Seele nicht immer ein Diamant ist, sondern manchmal ein Seidentuch – das kann ich verstehen –, denk dir ein durchsichtiges Seidentuch, ein Nichts könnte es zerreißen, sogar ein Blick, und denk dir die Hand, die es aufnimmt, eine Frauenhand – ja –, sie bewegt sich langsam und hält es mit den Fingern fest, aber festhalten ist schon zu viel, sie hebt es auf, als sei sie keine Hand, sondern ein Windstoß, und sie umschließt es mit den Fingern, als seien es keine Finger, sondern … – als seien es keine Finger, sondern Gedanken. Einfach so. Dieses Zimmer ist jene Hand, und meine Tochter ist ein Seidentuch.«
Ja, ich verstehe.
»Ich will keine Wasserfälle, Edel, sondern den Frieden eines Sees, ich will keine Eichen, sondern Birken, und diese Berge dort hinten müssen Hügel werden und der Tag ein Sonnenuntergang, der Wind eine Brise, die Städte Dörfer, die Schlösser Gärten. Und wenn schon Falken darauf sein müssen, sollen sie wenigstens fliegen, und weit in der Ferne.«
Ja, ich habe verstanden. Nur eines noch: Was ist mit den Menschen?
Der Baron schweigt. Er betrachtet nacheinander alle Figuren auf dem riesigen Gobelin, als wollte er ihre Meinung dazu hören. Er geht von einer Wand zur anderen, doch niemand sagt etwas. Das war zu erwarten.
»Edel, gibt es eine Möglichkeit, Menschen zu machen, die nichts Böses tun?«
Das muss sich im entscheidenden Augenblick auch Gott gefragt haben.
»Ich weiß nicht. Aber ich werde es versuchen.«
Monatelang wurde in Edel Truts Werkstatt mit den Kilometern von Seidengarn gearbeitet, die der Baron kommen ließ. Sie arbeiteten in aller Stille, weil, wie Edel sagte, die Stille in das Motiv des Gewebes einfließen sollte. Es war ein Garn wie jedes andere, nur dass man es nicht sehen konnte, aber es war da. So arbeiteten sie in aller Stille.
Monatelang.
Dann, eines Tages, hielt ein Karren vor dem Palast des Barons, und auf dem Karren lag Edels Meisterwerk. Drei riesige Stoffballen, die so schwer wogen wie die Kreuze bei einer Prozession. Sie trugen sie die Freitreppe hinauf und dann die Flure entlang und von Tür zu Tür bis tief ins Innere des Palastes, in das Zimmer, das sie erwartete. Einen Augenblick, bevor sie ausgerollt wurden, flüsterte der Baron:
»Und die Menschen?«
Edel lächelte.
»Wenn schon Menschen darauf sein müssen, sollen sie wenigstens fliegen, und weit in der Ferne.«
Der Baron wählte das Licht des Sonnenuntergangs, um seine Tochter an die Hand zu nehmen und sie in ihr neues Zimmer zu führen. Edel sagt, sie trat ein und errötete sofort vor Erstaunen, und der Baron fürchtete einen Augenblick, die Überraschung könnte zu heftig sein, doch nur einen Augenblick, denn sogleich machte sich die unwiderstehliche Stille jener Seidenwelt bemerkbar, in der ein mildes Land lieblich ruhte und kleine in der Luft schwebende Menschen mit gemächlichen Schritten das Blassblau des Himmels durchmaßen.
Edel sagt – und das wird sie nie vergessen können –, dass sie sich lange umschaute und dann, als sie sich umdrehte, lächelte.
Sie hieß Elisewin.
Sie hatte eine wunderschöne Stimme – samtig –, und wenn sie ging, schien es, als glitte sie durch die Luft, sodass man den Blick nicht von ihr wenden konnte. Bisweilen gefiel es ihr, einfach loszulaufen, einem unbekannten Ziel auf diesen entsetzlichen weißen Teppichen entgegen, sie hörte auf, der Schatten zu sein, der sie war, und lief los, aber nur selten, und so, dass manche sich bei ihrem Anblick in diesen Momenten leise sagen hörten …
3
Zur Pension Almayer gelangte man zu Fuß, wenn man den Weg bergab von der Kapelle Saint Amand nahm, aber auch in der Kutsche auf der Straße von Quartel oder mit dem Fährboot, das flussabwärts fuhr. Professor Bartleboom gelangte durch Zufall dorthin.
»Ist das die Pension Frieden?«
»Nein.«
»Die Pension Saint Amand?«
»Nein.«
»Der Gasthof zur Post?«
»Nein.«
»Der Goldene Hering?«
»Nein.«
»Gut. Haben Sie ein Zimmer frei?«
»Ja.«
»Ich nehme es.«
Das große Buch mit den Unterschriften der Gäste lag aufgeschlagen auf einem Holzpult bereit. Ein frisch gemachtes Bett aus Papier, das auf die Träume fremder Namen wartete. Die Feder des Professors glitt genüsslich zwischen die Laken.
Ismael Adelante Ismael Prof. Bartleboom
Mit Schnörkeln und allen Schikanen. Eine runde Sache.
»Der erste Ismael ist mein Vater, der zweite mein Großvater.«
»Und der hier?«
»Adelante?«
»Nein, der nicht … dieser hier.«
»Prof.?«
»Ja.«
»Professor? Das heißt Professor.«
»Was für ein blöder Name.«
»Das ist kein Name … Ich bin Professor, ich unterrichte, verstehen Sie? Ich gehe durch die Straße, und die Leute sagen Guten Tag, Professor Bartleboom, Guten Abend, Professor Bartleboom, aber es ist kein Name, es ist das, was ich tue, ich unterrichte …«
»Es ist kein Name.«
»Nein.«
»Gut. Ich heiße Dira.«
»Dira.«
»Ja. Ich gehe durch die Straße, und die Leute sagen Guten Tag, Dira, Gute Nacht, Dira, wie schön du heute bist, Dira, was für ein schönes Kleid du hast, Dira, hast du nicht zufällig Bartleboom gesehen, nein, er ist in seinem Zimmer, erster Stock, das letzte am Ende des Korridors, hier sind die Handtücher, bitte, man hat einen Blick aufs Meer, ich hoffe, das stört Sie nicht.«
Professor Bartleboom – von diesem Augenblick an einfach Bartleboom – nahm die Handtücher.
»Fräulein Dira …«
»Ja?«
»Gestatten Sie mir eine Frage?«
»Und die wäre?«
»Wie alt sind Sie eigentlich?«
»Zehn.«
»Ah, ja.«
Bartleboom – seit kurzem Exprofessor Bartleboom – nahm seine Koffer und wandte sich zur Treppe.
»Bartleboom …«
»Ja?«
»Man fragt ein junges Mädchen nicht nach seinem Alter.«
»Das stimmt, entschuldigen Sie.«
»Erster Stock. Das letzte am Ende des Korridors.«
Im Zimmer am Ende des Korridors (erster Stock) gab es ein Bett, einen Schrank, zwei Stühle, einen Ofen, einen kleinen Schreibtisch, einen Teppich (blau), zwei vollkommen gleiche Bilder, einen Waschtisch mit Spiegel, eine Truhe und ein Kind: auf dem Sims am (offenen) Fenster sitzend, mit dem Rücken zum Zimmer und im Leeren baumelnden Beinen.
Bartleboom machte sich mit einem dezenten Hüsteln bemerkbar, nur so, um einen Laut von sich zu geben.
Nichts.
Er trat ins Zimmer, stellte die Koffer ab, ging an die Bilder heran, um sie sich anzuschauen (beide vollkommen gleich, unglaublich), setzte sich auf das Bett, zog sich mit offenkundiger Erleichterung die Schuhe aus, stand wieder auf, betrachtete sich im Spiegel, stellte fest, dass er immer noch er war (man kann nie wissen), warf einen Blick in den Schrank, hängte seinen Mantel hinein und ging dann zum Fenster.
»Gehörst du zum Mobiliar, oder bist du nur zufällig hier?«
Der Junge rührte sich keinen Millimeter vom Fleck. Aber er antwortete.
»Mobiliar.«
»Aha.«
Bartleboom kehrte zum Bett zurück, band seine Krawatte auf und legte sich hin. Wasserflecke an der Decke wie in Schwarzweiß gemalte Tropenblumen. Er schloss die Augen und schlief ein. Er träumte, dass man ihn holte, weil er für das Riesenweib im Zirkus Bosendorf einspringen sollte, und als er in die Arena trat, erkannte er in der ersten Reihe seine Tante Adelaide, eine vornehme Frau von allerdings zweifelhaften Sitten, die zuerst einen Piraten küsste, dann eine Frau, die ihr Ebenbild war, und schließlich die hölzerne Statue eines Heiligen, der aber so sehr Statue nicht war, da er plötzlich loslief und direkt auf ihn, Bartleboom, zukam, wobei er etwas schrie, was nicht gut zu verstehen war, was aber gleichwohl den Unwillen des ganzen Publikums heraufbeschwor, sodass er, Bartleboom, gezwungen war, Reißaus zu nehmen, und überdies auf den mit dem Zirkusdirektor vereinbarten hochheiligen Lohn verzichten musste, 128 Heller, um genau zu sein. Er erwachte, und der Junge war immer noch da. Er hatte sich allerdings umgedreht und sah ihn an. Ja, er sprach sogar mit ihm.
»Sind Sie jemals dort gewesen, im Zirkus Bosendorf?«
»Wie bitte?«
»Ich habe Sie gefragt, ob Sie jemals im Zirkus Bosendorf waren.«
Bartleboom setzte sich kerzengerade im Bett auf.
»Was weißt du denn vom Zirkus Bosendorf?«
»Nichts. Nur dass ich ihn gesehen habe, er ist letztes Jahr hier durchgekommen. Mit Tieren und allem. Das Riesenweib war auch dabei.«
Bartleboom überlegte, ob es angebracht sei, ihn nach Tante Adelaide zu fragen. Sie war zwar schon seit Jahren tot, doch dieser Junge schien es faustdick hinter den Ohren zu haben. Zu guter Letzt beschränkte er sich lieber darauf, aufzustehen und ans Fenster zu treten.
»Wenn es dir nichts ausmacht, ich brauche ein bisschen frische Luft.«
Der Junge auf dem Fensterbrett rückte ein wenig beiseite. Kühle Luft und Nordwind. Vorn, bis ins Unendliche, das Meer.
»Was machst du die ganze Zeit hier oben?«
»Ich halte Ausschau.«
»Da gibt es nicht viel zu sehen …«
»Soll das ein Witz sein?«
»Na gut, da ist das Meer, einverstanden, aber das Meer ist doch immer so, immer gleich, Meer bis zum Horizont, wenn man Glück hat, kommt ein Schiff vorbei, es ist ja nicht das Ende der Welt.«
Der Junge schaute auf das Meer, schaute wieder zu Bartleboom, schaute erneut auf das Meer, schaute wieder zu Bartleboom.
»Wie lange bleiben Sie hier?« erkundigte er sich.
»Ich weiß nicht. Ein paar Tage.«
Der Junge kletterte vom Fensterbrett, ging zur Tür, blieb auf der Schwelle stehen und sah Bartleboom eine Weile unverwandt an.
»Sie sind sympathisch. Wenn Sie abreisen, sind Sie vielleicht ein bisschen weniger dumm.«
In Bartleboom wuchs die Neugier, zu erfahren, wer diese Kinder erzogen hatte. Ein Phänomen, ganz offenbar.
Abend. Pension Almayer. Das Zimmer im ersten Stock am Ende des Korridors. Schreibtisch, Petroleumlampe, Stille. Eine graue Weste mit Bartleboom darin. Zwei graue Pantoffeln mit seinen Füßen darin. Ein weißes Blatt auf dem Schreibtisch, Feder und Tinte. Er schreibt. Bartleboom. Er schreibt.
Meine Angebetete,
ich bin endlich am Meer. Ich verschone Sie mit den Strapazen und Mühen meiner Reise. Was zählt, ist, dass ich jetzt hier bin. Die Pension ist gastlich – einfach, aber gastlich. Sie liegt auf einem kleinen Hügel direkt am Strand. Abends kommt die Flut, und das Wasser reicht fast bis an mein Fenster. Es ist wie auf einem Schiff. Es würde Ihnen gefallen.
Ich war noch nie auf einem Schiff.
Morgen beginne ich mit meinen Studien. Der Platz scheint mir ideal zu sein. Ich mache mir keine Illusionen über die Schwierigkeit meines Vorhabens, doch Sie, Sie allein auf der Welt, wissen, wie entschlossen ich bin, das Werk zu vollenden, das zu planen und zu beginnen an einem Glückstag vor zwölf Jahren mein Ehrgeiz war. Es wird mir ein Trost sein, Sie in Gedanken gesund und fröhlich vor mir zu sehen.
Ich habe tatsächlich nie zuvor darüber nachgedacht, aber ich war wirklich noch nie auf einem Schiff.
In der Einsamkeit dieses abgeschiedenen Ortes begleitet mich die Gewissheit, dass Sie in der Ferne nicht die Erinnerung an den aus dem Gedächtnis verlieren, der Sie liebt und für immer bleibt Ihr
Ismael A. Ismael Bartleboom
Er legt die Feder aus der Hand, faltet das Blatt zusammen und steckt es in einen Umschlag. Er steht auf, nimmt eine Mahagonischatulle aus seinem Koffer, klappt den Deckel auf und lässt den Brief hineinfallen, offen und ohne Anschrift. In der Schatulle liegen Hunderte gleicher Kuverts. Offen und ohne Anschrift.
Er ist achtunddreißig Jahre alt. Bartleboom. Er denkt, dass er eines Tages irgendwo auf der Welt einer Frau begegnen wird, die seit jeher seine Frau ist. Zuweilen bedauert er, dass das Schicksal darauf besteht, ihn mit so viel rücksichtsloser Hartnäckigkeit warten zu lassen, doch mit der Zeit hat er gelernt, die Dinge mit großer Seelenruhe zu betrachten. Fast jeden Tag seit nunmehr vielen Jahren nimmt er die Feder zur Hand und schreibt an sie. Er hat keine Namen und keine Adressen für die Kuverts, doch er hat ein Leben zu erzählen. Und wem, wenn nicht ihr? Er denkt, dass es schön sein wird, wenn sie sich begegnen und er ihr eine Mahagonischatulle voller Briefe in den Schoß stellen und sagen wird:
»Ich habe auf dich gewartet.«
Sie wird die Schatulle öffnen und vielleicht einen Brief nach dem anderen langsam durchlesen, und während sie einen kilometerlangen Faden blauer Tinte zurückverfolgt, wird sie die Jahre – die Tage, die Augenblicke – an sich nehmen, die dieser Mann ihr bereits geschenkt hat, noch bevor er sie kannte. Oder sie wird die Schatulle ganz einfach ausschütten und angesichts dieser wunderlichen Lawine von Briefen erstaunt und lächelnd zu diesem Mann sagen:
»Du bist verrückt.«
Und sie wird ihn für immer lieben.
4
»Pater Pluche …«
»Ja, Baron.«
»Meine Tochter wird morgen fünfzehn Jahre alt.«
»…«
»Es ist jetzt acht Jahre her, seit ich sie in Ihre Obhut gegeben habe.«
»…«
»Sie haben sie nicht geheilt.«
»Nein.«
»Sie muss heiraten.«
»…«
»Sie muss aus diesem Schloss heraus und die Welt sehen.«
»…«
»Sie muss Kinder bekommen und …«
»…«
»Kurz, sie muss doch endlich einmal zu leben beginnen.«
»…«
»…«
»…«
»Pater Pluche, meine Tochter muss gesund werden.«
»Ja.«
»Finden Sie jemand, der sie heilen kann! Und bringen Sie ihn her!«
Der berühmteste Arzt des Landes hieß Atterdel. Viele hatten gesehen, wie er Tote auferweckte, Leute, die in der Tat mehr tot als lebendig waren, mit einem Bein schon im Grab und endgültig aufgegeben, und er hatte sie aus der Hölle zurückgeholt und sie dem Leben wiedergegeben, was, wenn man so will, auch eine heikle und manchmal sogar unangebrachte Geschichte war, doch man muss einsehen, dass dies sein Beruf war, und niemand verstand so viel davon wie er, weshalb jene also wiederauferstanden, mit dem Segen aller Freunde und Verwandten, die nun gezwungen waren, mit allem wieder von vorn zu beginnen und Tränen und Erbschaften auf einen günstigeren Zeitpunkt zu verschieben, beim nächsten Mal denken sie vielleicht beizeiten daran und wenden sich an einen normalen Doktor, an einen von denen, der sie umbringt und basta, nicht wie dieser hier, der sie wieder auf die Beine bringt, nur weil er der berühmteste Arzt im ganzen Land ist. Und der teuerste obendrein.
So dachte Pater Pluche über Doktor Atterdel. Nicht, dass er viel Vertrauen zu Ärzten gehabt hätte, das nicht, doch bei allem, was Elisewin betraf, war er verpflichtet, mit dem Kopf des Barons zu denken und nicht mit seinem eigenen. Und der Kopf des Barons dachte, dass, wo Gott versagt, die Wissenschaft Erfolg haben könnte. Gott hatte versagt. Jetzt war Atterdel an der Reihe.
Er kam mit einer schwarzglänzenden Kutsche ins Schloss, was etwas trübselig, doch auch sehr effektvoll war. Mit schnellen Schritten stieg er die Freitreppe hinauf und fragte, als er bei Pater Pluche angekommen war, beinahe ohne ihn anzusehen:
»Sind Sie der Baron?«
»Warum nicht.«
Das war typisch für Pater Pluche. Es gelang ihm nicht, sich zu beherrschen. Nie sagte er, was er hätte sagen sollen. Vorher fiel ihm immer etwas anderes ein. Nur einen Augenblick vorher. Aber das war mehr als genug.
»Dann sind Sie also Pater Pluche.«
»Genau.«
»Sie waren es, der mir geschrieben hat.«
»Ja.«
»Nun, Sie haben eine merkwürdige Art zu schreiben.«
»Inwiefern?«
»Es war nicht nötig, alles in Reimen zu schreiben. Ich wäre auch so gekommen.«
»Sind Sie sicher?«
Hier, beispielsweise, wäre es angebracht gewesen, zu antworten: »Entschuldigen Sie, es war ein dummes Spiel«, und tatsächlich kam dieser Satz wunderbar ausformuliert in Pater Pluches Kopf, schön geradlinig und sauber, aber einen Augenblick zu spät, jene Winzigkeit, die genügte, um sich von tief unten eine dumme Bö von Worten entschlüpfen zu lassen, die sich, kaum dass sie an die Oberfläche der Stille gelangt war, im unbestreitbaren Glanz einer Frage kristallisierte, die vollkommen fehl am Platze war.
»Sind Sie sicher?«
Atterdels Blick wanderte hoch zu Pater Pluche. Es war mehr als ein Blick. Es war eine medizinische Untersuchung.
»Ich bin sicher.«
Das ist das Gute an den Wissenschaftlern: Sie sind sich sicher.
»Wo ist dieses Mädchen?«
»Ja … Elisewin … So heiße ich. Elisewin.«
»Ja, Herr Doktor.«
»Nein, wirklich, ich habe keine Angst. Ich spreche immer so. Meine Stimme ist so. Pater Pluche sagt, dass …«
»Danke.«
»Ich weiß nicht. Die merkwürdigsten Dinge. Aber es ist keine Angst, keine richtige Angst … es ist ein bisschen anders … die Angst kommt von außen, das habe ich begriffen, du bist da, und die Angst kommt über dich, es gibt dich, und es gibt sie … so ist das … sie ist da, und ich bin auch da, aber was mit mir geschieht, ist, dass ich plötzlich nicht mehr da bin, nur sie ist noch da … die aber keine Angst hat … ich weiß nicht, was es ist, wissen Sie es?«
»Ja, mein Herr.«
»Ja, mein Herr.«
»Es ist ein bisschen wie das Gefühl zu sterben. Oder zu verschwinden. Das ist es: zu verschwinden. Es ist, als würden dir die Augen aus dem Gesicht gleiten und deine Hände die Hände eines anderen werden, und dann denkst du, was ist mit mir?, und dabei klopft dein Herz zum Zerspringen, es lässt dir keine Ruhe … und überall an deinem Körper scheinen sich Teile abzulösen, du spürst sie nicht mehr … kurz, du bist im Begriff zu vergehen, und dann sage ich mir, du musst etwas denken, du musst dich an einen Gedanken klammern, wenn ich es schaffe, mich in diesen Gedanken hineinzuducken, dann geht alles vorbei, man muss nur aushalten, aber das Problem ist, dass … und das ist wirklich entsetzlich … das Problem ist, dass da keine Gedanken mehr sind, nirgendwo in dir, kein einziger Gedanke mehr, sondern nur noch Gefühle, verstehen Sie?, Gefühle … und das stärkste von allen ist ein höllisches Fieber, ist ein unerträglicher Modergestank, der Geschmack des Todes hier in der Kehle, ein Fieber, und ein Würgegriff, etwas Beklemmendes, ein Dämon, der dich packt und dich in Stücke reißt, eine …«
»Entschuldigen Sie.«
»Ja, manchmal ist es viel … leichter, ich meine, ich fühle zwar, wie ich verschwinde, aber sanft, ganz sacht … das sind die Gefühle, Pater Pluche sagt, das sind die Gefühle, er sagt, ich habe nichts, was mich vor den Gefühlen schützt, und so ist es, als würden die Dinge direkt in meine Augen dringen und in meine …«
»In meine Augen, ja.«
»Nein, daran erinnere ich mich nicht. Ich weiß, dass es mir nicht gutgeht, aber … Manchmal gibt es Dinge, die mich nicht erschrecken, ich meine, es ist nicht immer so, neulich Nacht war ein entsetzliches Gewitter, Blitze, Sturm … doch ich war ruhig, wirklich, ich hatte weder Angst noch sonst etwas … Dann wieder genügt eine Farbe, jawohl, oder die Form eines Gegenstandes, oder … oder das Gesicht eines Menschen, der vorbeigeht, das ist es, die Gesichter … Gesichter können fürchterlich sein, nicht wahr?, es gibt bisweilen so wahre Gesichter, es kommt mir vor, als würden sie mich anspringen, es sind Gesichter, die schreien, verstehen Sie, was ich meine?, sie schreien dich an, es ist entsetzlich, es gibt keine Möglichkeit, sich zu schützen, es gibt keine … Möglichkeit …«
»Die Liebe?«
»Pater Pluche liest mir manchmal Bücher vor. Die tun mir nicht weh. Mein Vater möchte das zwar nicht, aber … nun ja, es sind auch … aufregende Geschichten dabei, verstehen Sie?, mit Leuten, die töten, die sterben … aber ich könnte mir alles anhören, solange es nur aus einem Buch stammt, das ist seltsam, ich kann sogar weinen, und es ist angenehm, dieser Todesgestank ist nicht im Weg, ich weine, das ist alles, und Pater Pluche liest weiter, und es ist sehr schön, aber das darf mein Vater nicht wissen, er weiß es nicht, und vielleicht ist es besser, wenn …«
»Natürlich liebe ich meinen Vater. Warum?«
»Die weißen Teppiche?«
»Ich weiß nicht.«
»Ich habe meinen Vater einmal im Schlaf gesehen. Ich ging in sein Zimmer, und da habe ich ihn gesehen. Meinen Vater. Er schlief völlig zusammengerollt wie ein Kind, auf der Seite, die Beine angezogen und die Hände zu Fäusten geballt … das werde ich nie vergessen … mein Vater, der Baron von Carewall. Er schlief wie ein Kind. Können Sie das verstehen? Wie stellt man es an, keine Angst zu haben, wenn sogar … wie stellt man es an, wenn selbst …«
»Ich weiß nicht. Hier kommt nie jemand vorbei …«
»Manchmal. Ich merke es, ja. Sie reden leise, wenn sie mit mir zusammen sind, und es ist, als würden sie sich auch … langsamer bewegen, als hätten sie Angst, etwas zu zerbrechen. Aber ich weiß nicht, ob …«
»Nein, es ist nicht schwer … es ist anders, ich weiß nicht, es ist, als wäre man …«
»Pater Pluche sagt, dass ich eigentlich ein Nachtfalter werden sollte, doch dann ist etwas schiefgegangen, und ich bin hier gelandet, aber das war eigentlich nicht der richtige Platz für mich, und so ist jetzt alles ein bisschen schwer, es ist normal, dass mir alles weh tut, ich muss viel Geduld haben und warten, es ist natürlich eine komplizierte Angelegenheit, einen Schmetterling in eine Frau zu verwandeln …«
»Ja, einverstanden.«
»Aber es ist so etwas wie ein Spiel, es ist nicht wirklich wahr und auch nicht wirklich falsch, wenn Sie Pater Pluche kennen würden …«
»Natürlich.«
»Eine Krankheit?«
»Ja.«
»Nein, ich habe keine Angst. Davor habe ich keine Angst, wirklich nicht.«
»Ich werde es tun.«
»Ja.«
»Ja.«
»Dann leben Sie wohl.«
»…………………………«
»Mein Herr …«
»Mein Herr, verzeihen Sie …«
»Mein Herr, ich wollte sagen, ich weiß, dass es mir nicht gutgeht, und manchmal schaffe ich es nicht einmal, aus dem Haus zu gehen, und schon das Laufen ist für mich zu …«
»Ich wollte sagen, dass ich es will, das Leben, ich würde wer weiß was tun, um es zu bekommen – alles, was davon zu haben ist, so viel, dass man verrückt daran werden kann, egal, dann werde ich eben verrückt, aber das Leben will ich nicht versäumen, ich will es wirklich, mag es auch zum Sterben weh tun, leben, ja, leben will ich. Ich werde es schaffen, nicht wahr?«
»Nicht wahr, ich werde es schaffen?«
Denn die Wissenschaft ist sonderbar, ein sonderbares Tier, das seinen Schlupfwinkel an den abwegigsten Orten sucht und nach peinlich genauen Plänen zu Werke geht, die von außen nur als unergründlich und bisweilen sogar als komisch gewertet werden können, erscheinen sie doch wie ein leeres Umherstreifen, obgleich sie geometrische Jagdwege, mit gelehrter Kunstfertigkeit ausgesäte Fallen und strategische Schlachten sind, vor denen man gelegentlich ein wenig erstaunt dasteht, wie auch Baron von Carewall dasteht, als jener schwarz gekleidete