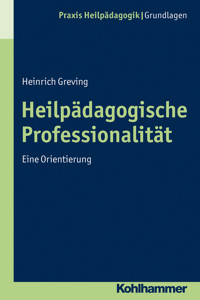Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Barrierefreiheit in einer Klinik bedeutet viel mehr als nur stufenloser Zugang und bodengleiche Duschen. Auch in Bezug auf sprachliche Fähigkeiten, ganz unterschiedliche Formen von individuellen Beeinträchtigungen oder bereits durch persönliche Eigenschaften können Barrieren einen reibungslosen Behandlungs- und Arbeitsablauf erschweren. Das Werk betrachtet das Thema ganzheitlich sowohl aus dem Blickwinkel der Heilpädagogik als auch aus Sicht der Architektur und bietet Umsetzungshilfen und Lösungskonzepte. Die Inhalte beziehen sich vorrangig auf die Patienten, gelten jedoch auch für alle Krankenhausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Geleitwort
1 Einleitung
2 Grundlagen
2.1 Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK)
2.2 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)
2.2.1 Der neue und erweiterte Begriff zur Behinderung im SGB IX
2.2.2 Grundlagen der ICF
2.3 Das Bundesteilhabegesetz (BTHG)
2.4 Teilhabe
2.5 Barrierefreiheit
2.6 Fazit im Hinblick auf die Konzeptbausteine
3 Konzeptbausteine – Teil 1: (Heilpädagogische) Grundlagen im Praxisbezug Klinik
3.1 Geschichtlich relevante Entwicklungen
3.2 Vom Objekt zum Subjekt: Person(en)zentriert
3.3 Ganzheitlichkeit in Verbindung mit dem Universellen Design
3.4 Netzwerke, Verknüpfungen, Problembereiche und Perspektiven
3.5 Krisen und damit verbundene Probleme
4 Konzeptbausteine – Teil 2: Zur barrierefreien Architektur
4.1 Das Krankenhaus als öffentliches Gebäude
4.1.1 Anforderungen
4.1.2 Baurechtliche Vorgaben
4.2 Planung und Umsetzung
4.2.1 Die DIN 18040 als technische Baubestimmung
4.2.2 Die Normenreihe der DIN 18040
4.2.3 Das Konzept Barrierefreiheit
4.3 Nutzung
4.3.1 Genesungsort
4.3.2 Der barrierefreie Arbeitsplatz
5 Fazit: Interdisziplinäre Verknüpfungen, Konsequenzen und Aussichten
Literaturverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Die AutorInnen
Heinrich Greving, geb. 1962, Prof. Dr. phil. habil., Dipl.-Heilpädagoge, Dipl.-Pädagoge, arbeitet seit 1999 hauptberuflich als Professor für Allgemeine und Spezielle Heilpädagogik an der Katholischen Hochschule NRW, Abteilung Münster, Studiengang Heilpädagogik; sowie seit 2013 als Privatdozent an der Universität Hamburg. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind hierbei u. a.: Professionalisierung der Heil- und Behindertenpädagogik, Lebenswelten von Menschen mit Beeinträchtigung sowie Beratung und Organisationsentwicklung im Sozial- und Gesundheitswesen.
Ilona Hülsmanns Schwerpunkt der Arbeit liegt seit der Erzieherausbildung Ende 1998 auf dem Bereich »erwachsene Menschen mit sog. Behinderungen« in Organisationen der Eingliederungshilfe im Sinne der Inklusion, der Partizipation und des Empowerment. Nach dem Abschluss Heilpädagogik B.A. war sie in Projektstellen als Inklusionsbeauftragte der Kliniken Lörrach tätig, wodurch sich die beratende Tätigkeit bezüglich des Neubaus des Zentralklinikums im Sinne des Universellen Designs entwickelte. Im April 2021 wurde die Projektstelle in eine unbefristete Stabstelle umgewandelt. Zudem bestehen Dozententätigkeiten an der Pflegeschule Lörrach, Theresia-Scherer-Schule Herten, sowie der Katholischen Hochschule NRW, Abt. Münster. Des Weiteren ist sie als Landesfachgruppensprecherin im Fachbereich »erwachsene Menschen mit sog. Behinderungen« in Baden-Württemberg für den Berufs- und Fachverband Heilpädagogik e. V. (BHP) tätig.
Renate Schedler, geb. 1971, Innenarchitektin, Dipl.Ing. (FH), ist seit 2012 im Bereich Krankenhausbau tätig. Bis 2021 entwickelte sie Planungen für Krankenhausneu- und Umbauten bei der sander.hofrichter architekten GmbH, u. a. für den Campus Lübeck des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, das Klinikum Stuttgart und den Neubau des Zentralklinikums in Lörrach. Als Sachverständige für barrierefreies Planen und Bauen vertiefte sie dort seit 2018 den Planungsschwerpunkt Barrierefreiheit. In ihrer aktuellen Tätigkeit beim Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung LBB in Rheinland-Pfalz betreut sie im Rahmen der Landesförderung beratend und prüfend Neu- und Umbauten von Krankenhäusern.
Heinrich Greving
Ilona Hülsmann
Renate Schedler
Die barrierefreie Klinik
Grundlagen und Konzeptbausteine
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-040508-0
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-040509-7epub: ISBN 978-3-17-040510-3
Geleitwort
Die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung für alle Menschen entspricht einem der wichtigsten sozialen Grund- und Menschenrechte. Auf die Gewährleistung einer umfassenden Gesundheitsversorgung haben sich die Staaten Europas in der Europäischen Sozialcharta des Europarats und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in der Grundrechtecharta der EU verpflichtet.
Vor diesem Hintergrund erscheint es überraschend, dass der Zugang zu Einrichtungen der Gesundheitsversorgung in Deutschland weiterhin für behinderte Menschen in vielen Fällen mit Barrieren und Einschränkungen verbunden ist. Insofern stellt die Barrierefreiheit in Krankenhäusern und Kliniken eine Kernherausforderung dar, die eine vertiefte Auseinandersetzung erfordert. Für diese Auseinandersetzung wesentlich ist die Beschaffenheit des Krankenhaus- und Kliniksektors mitsamt seinen Grundlagen der Finanzierung, dem Leistungsrecht von Patienten, den Professionen und Professionsentwicklungen im Beschäftigtenbereich sowie der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Akteure, die in diesem System agieren.
Die Heilpädagogik, deren Geschichte auch durch eine zwischenzeitlich starke medizinische Prägung gekennzeichnet ist, hat im heutigen Gesundheitsversorgungssystem – anders als es der Wortklang ihres Namens vermuten lassen würde – Exotenstatus. Als Disziplin und Profession sind vor allem die Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) und der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX) die Aktionsfelder, in denen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen heute tätig sind. Mit Blick auf die Herausforderungen in Bezug auf barrierefreie Krankenhäuser und Kliniken stellt die Heilpädagogik jedoch eine Kerndisziplin dar, gehören die Identifikation von Barrieren und das Treffen von Vorkehrungen zum Abbau bzw. zur Vermeidung eben dieser Barrieren zu ihren Identitätsmerkmalen. Um das Ziel von Barrierefreiheit in Krankenhäusern und Kliniken zu erreichen, ist ein umfassender Handlungsansatz notwendig. Ein Teil dieses umfassenden Ansatzes ist die Etablierung heilpädagogischer Professionalität.
So richtig Entwicklungen sind, verstärkt medizinisch-therapeutische Professionalität in klassisch pädagogische Felder wie der Frühförderung einziehen zu lassen, so wichtig und dringend ist die Einbeziehung heilpädagogischer Kompetenzen in den Krankenhaus- und Klinikbereich, um die Versorgungsmöglichkeiten und die Versorgungsqualität von behinderten Menschen zu verbessern. Die Aufgaben für heilpädagogisch qualifiziertes Personal dürfen sich dabei nicht auf die reine Assistenz eines behinderten Menschen im Krankenhaus bzw. einer Klinik beschränken. Vielmehr steht die gesamte Organisationsentwicklung mitsamt Beratungsangeboten für behinderte Patientinnen und Patienten und deren Angehörige sowie entsprechender Schulungs- und Beratungsangebote für das Personal im Mittelpunkt.
Es ist notwendig, in Bezug auf barrierefreie Krankenhäuser und Kliniken über die Verrechtlichung hinaus zu denken und Kompetenzen zu vernetzen, um das Grundrecht einer sicheren und adäquaten Gesundheitsversorgung für behinderte Menschen garantieren zu können.
Es braucht jetzt Krankenhäuser und Klinken als Leuchttürme und Vorbildmodelle, die Barrierefreiheit mit ihren verschiedenen Dimensionen zur Priorität erklären und diese nicht nur auf dem Papier beschreiben, sondern in der täglichen Klinikpraxis leben. Ganzheitliche Perspektiven auf den Menschen und universelles Design in baulichen Fragen, verstehensorientierte Haltungen gegenüber den Patientinnen und Patienten und damit eine Steigerung der Arbeitsatmosphäre insgesamt, neue Perspektiven auf Gesundheit und Lebensqualität trotz Beeinträchtigungen – all diese Effekte stellen die großen Chancen dar, die mit Streben nach Barrierefreiheit in Krankenhäusern und Kliniken verbunden sind. Es ist Zeit, die Herausforderungen anzugehen.
Kai-Raphael TimpeBerlin, im Januar 2022Berufs- und Fachverband Heilpädagogik (BHP) e.V.
1 Einleitung
Heinrich Greving, Ilona Hülsmann, Renate Schedler
In diesem Grundsatzband zur Entwicklung einer barrierefreien Klinik werden zuerst prinzipielle Themen dargestellt. Diese werden dann, im Hinblick auf konkrete Konzeptbausteine erweitert, sodass für die Leserin und den Leser eine nachvollziehbare Leitlinie und Konzeption entsteht, wie eine barrierefreie Klinik geplant und somit letztlich auch verwirklicht werden kann.
In einem ersten Schritt werden die Grundlagen zur Barrierefreiheit in Bezug auf Klinikneubauten erörtert (▶ Kap. 2). Hierzu zählt die »UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung« (UN-BRK), sowie die »Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit« (ICF) und das hierauf aufbauende deutsche Recht im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Um diese drei rechtlichen Grundlegungen zu erweitern und auszubauen, werden dann einige Hinweise zur Teilhabe, bzw. zur Inklusion ausgegeben. Dieses Kapitel schließt mit grundlegenden methodologischen Hinweisen zur Barrierefreiheit in Organisationen.
In einem zweiten Kapitel werden dann die relevanten Aspekte einer heilpädagogischen Methodologie und Konzeption in Bezug auf die Ausgestaltung einer barrierefreien Klinik ausgeführt (▶ Kap. 3). Zuerst werden hierzu grundlegende Inhalte zum Menschenbild und zur (heilpädagogischen) Methodologie erörtert. Auf diesem Hintergrund wird die holistische, bzw. ganzheitliche Sichtweise beschrieben – hierbei wird es vor allem darum gehen, das universelle Design im Hinblick auf folgende Unterpunkte zu konkretisieren: Personenzentriertheit, Individualität, Aufklärung, geschichtlicher Kontext, Umgang mit Krisensituationen, Verknüpfungen mit unterschiedlichen Raum- und Handlungssituationen im Rahmen der Klinik sowie der Erweiterung der (konkreten) Perspektiven in Bezug auf unterschiedliche Formen von Beeinträchtigung. Dieses Kapitel schließt ab mit Hinweisen zur Problembewältigung.
Im dritten Kapitel werden dann Konzeptbausteine im Rahmen der Architektur und Innenarchitektur benannt und weiter ausgeführt (▶ Kap. 4). Folgende Themen werden hierbei bearbeitet: In einem ersten Abschnitt wird ein Überblick über die baurechtlichen Rahmenbedingungen gegeben, in denen sich die Planung eines Krankenhauses bewegt. In ihren Bauordnungen beschreiben die Länder, was Barrierefreiheit im baulichen Sinn für sie bedeutet und wie diese im Bau umzusetzen ist. Gegenüber gestellt werden hier das Soll des Baurechts und das Soll eines barrierefreien Krankenhauses in Verbindung mit den Anforderungen der Patienten. Im Idealfall ergänzt sich beides. Die DIN 18040 als Werkzeug der Planung wird erläutert und in Zusammenhang mit den Anforderungen eines Krankenhausbaus gebracht. Aber welche weiteren Mittel sind hierfür heranzuziehen und wie verpflichtend ist deren Umsetzung aus Sicht der Gesetzgebung?
Diese Gedanken sollen im Rahmen dieser Einleitung ein wenig ausgeführt werden:
Barrierefreiheit beginnt bereits bei der Gebäudestruktur. Einfache Gebäudestrukturen unterstützen die Orientierung und können dabei helfen, ergänzende Maßnahmen zu reduzieren. Ob es sich dabei um Menschen mit Einschränkungen handelt oder nicht spielt dabei keine Rolle.
Diese Fragen der Architektur sind nicht neu und bilden bei vielen Entwürfen einen Schwerpunkt der Konzeption. Aus dem Blickwinkel der Barrierefreiheit heraus erhalten sie jedoch eine zusätzliche Wichtigkeit, die hier hervorgehoben werden soll. Wie muss ein Bauwerk sein, damit es von Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt genutzt werden kann? Wie kann das Krankenhausgebäude die darin stattfindenden Prozesse auch im Hinblick auf die barrierefreie Interaktion zwischen Mitarbeitern und Patienten unterstützen?
Im Krankenhaus als einem Ort, an dem sich Personen mit und ohne Einschränkungen treffen, seien sie durch Akuterkrankungen entstanden oder von Dauer, müssen mehr als in jedem anderen Gebäudetyp alle Sinne angesprochen werden, damit es barrierefrei funktionieren kann. Aufgrund dieser heterogenen Nutzerstruktur wird dort Barrierefreiheit von allen Personen wirklich erlebt. Wie kein anderer Gebäudetyp ist daher das Krankenhaus in der Lage, ein umfassendes Verständnis von Barrierefreiheit in die Öffentlichkeit zu tragen und weitreichende Akzeptanz zu schaffen, die immer noch nicht selbstverständlich ist.
Viele Komponenten der barrierefreien Planung sind häufig bereits selbstverständlicher Bestandteil von Gebäuden, ohne dass sie von den Nutzern als ausdrücklich barrierefrei wahrgenommen werden. In der Regel werden sie von der Öffentlichkeit als komfortabel bewertet. So sind z. B. schwellenlose Gebäudezugänge nicht mehr wegzudenken, die Höhenlage von zu planenden Gebäuden wird von Beginn an darauf ausgerichtet. Dies ist nur ein einfaches Beispiel, das zeigt, dass Barrierefreiheit in der Architektur gebauter Komfort für alle sein kann.
Denn Patienten sind auch Kunden. Diese Aussage schließt alle Personengruppen ein, die ein Krankenhaus aufsuchen. Zusätzlich zur Versorgung impliziert dies einen Servicegedanken, der in zeitgemäßen Krankenhäusern etabliert werden soll. Die Architektur reagiert darauf, indem sie ein räumliches Angebot schafft, das den Anforderungen dieser Kunden gerecht wird.
Im Detail werden im Krankenhaus sensible Bedürfnisse freigelegt, für die bauliche Lösungen zu entwickeln sind. So kann die besondere Situation im Krankenhaus dabei helfen, universelles Design unterstützend voranzutreiben. Beschrieben werden in diesem Abschnitt beispielhaft Maßnahmen, die ergriffen werden, um Sinneseinschränkungen oder/und -ausfälle kompensieren zu können. Eines der bekannteren Mittel dafür sind z. B. bodengebundene Leitsysteme.
Ein weiterer Baustein der barrierefreien Planung ist die Beachtung der Bedürfnisse von motorisch eingeschränkten Personen. Hier gilt z. B. der Rollstuhl und dessen notwendige Bewegungsflächen als Maß der Dinge. Auch hierzu werden Beispiele gezeigt.
Zu Kontroversen führt häufig auch die Frage der Assistenz. Wieviel Unterstützung durch Dritte ist erlaubt/gewollt, um der Absicht der Barrierefreiheit zur Sicherstellung eigenständiger Handlung nicht entgegenzuwirken? Wie sehen das davon betroffene Personen? Auch hierzu wird konkret Stellung bezogen.
Nicht außer Acht zu lassen ist der barrierefreie Arbeitsplatz im Krankenhaus. Eine umfassende, barrierefreie Gestaltung aller Arbeitsplätze kann Auswirkungen auf deren räumliche Abmessungen haben (z. B. Bewegungsflächen von Rollstühlen) und muss daher frühzeitig abgestimmt werden. Hierfür ein Bewusstsein zu schaffen erspart nachträglichen planerischen Aufwand und Kosten, worauf wir in diesem Abschnitt eingehen möchten. Wie weit geht der barrierefreie Arbeitsplatz im Krankenhaus, was ist möglich? Bleibt die Barrierefreiheit auf Büroräume beschränkt? Wie kann ein barrierefreier Operationssaal aussehen, der auf die körperlichen Einschränkungen des ärztlichen Personals oder der Pflegekräfte eingeht? Wie sieht die gelebte Praxis in diesem Bereich aus?
Dieser Band schließt ab mit bilanzierenden und gleichzeitig weiterführenden Gedanken zu interdisziplinären Verknüpfungen, Konsequenzen und Aussichten in Bezug auf die konsequente und kohärente Realisierung einer barrierefreien Klinik.
2 Grundlagen
Heinrich Greving
In diesem einführenden Kapitel zur Barrierefreiheit in Kliniken und Krankenhäusern werden in einem ersten Schritt die (zumeist und zuvörderst) rechtlichen Grundlagen erläutert. Der argumentative Weg führt hierbei von den grundlegenden Ausführungen in der UN-Behindertenrechtskonvention über die Konkretisierungen hierzu in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit über die Differenzierung im deutschen Recht zum Bundesteilhabegesetz hin zu Konkretisierungen in Bezug auf die Teilhabe. Eine Spezifizierung erfährt diese Argumentation dann im Hinblick auf die Barrierefreiheit in Kliniken, sowie auf die sogenannten »Diagnosis Related Groups« (DRG). Dieses Kapitel endet mit einem Fazit im Hinblick auf die dann in den Kapiteln 3 und 4 ausdifferenzierten Konzeptbausteine zu einer Umsetzung und Konkretisierung der Barrierefreiheit in Krankenhäusern. Der argumentative Weg in diesem Grundlagenkapitel führt somit vom Allgemeinen und Weltrechtlichen hin zum Spezifischen, also zur Spezifizierung dieser Grundlagen im Hinblick auf die Barrierefreiheit von Kliniken.
2.1 Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK)
Die sogenannte UN-Behindertenrechtskonvention (welche mit vollem Titel »Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung« heißt; diese Bezeichnung wird jedoch im Rahmen dieses Textes abgekürzt als: UN-BRK) stellt Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar (Aichele 2014). Im Fokus dieses, von der UNO-Generalversammlung verabschiedeten, Übereinkommens stehen somit Menschen mit Beeinträchtigungen, welche durch die Gesellschaft Behinderungen erfahren. An dieser Stelle wird schon zum ersten Mal und recht zielführend das soziale Modell von Behinderung wahrnehmbar (▶ Kap. 2.2). Das Ziel dieser Konvention besteht in der gleichberechtigten Rechtsausübung aller beteiligen Menschen und das weltweit. Beeinträchtigungen bzw. die soziale Zuschreibung der Behinderungen in diesem Kontext werden somit als Bereicherung und als Bestandteil einer menschlichen Vielfalt betrachtet.
Sämtliche Statistiken der letzten zwanzig Jahre verweisen darauf, dass ungefähr 10 % aller Menschen in Deutschland im medizinischen Sinne beeinträchtigt und sogar weit über 15 % weltweit Behinderung erfahren (so z. B. im sogenannten World Report of Disability im Jahre 2011). Aber auch aktuelle Zahlen verweisen auf eine ähnliche Dimension der Ausgestaltung der Zahlen von Beeinträchtigungen und Behinderungen.
Wie entstand nun die UN-Behindertenrechtskonvention?
Schon im Jahr 1993 entwickelte die UN Rahmenbestimmungen für die Herstellung von Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung. Diese wurden als UN-Standard-Rules bezeichnet. Eine UN-Studie aus dem Jahr 2002 mit dem Titel »Human Rights and Disability« von Gerard Quinn und Theresia Degener verdeutlichte schon vor 20 Jahren die Notwendigkeit einer Behindertenrechtskonvention und verwies auf die weltweite Ausgestaltung einer ebensolchen. Dann ging es relativ schnell: Im Dezember 2001 setzte die UNO ein Ad-hoc-Komitee zur Konventionsprüfung ein. Zwei Jahre später, im Dezember 2003, wurde ein Ausschuss damit beauftragt eine Konvention zu erarbeiten. Hierbei war schon relevant, dass Menschen mit Behinderung in den jeweiligen Regierungsdelegationen mitwirken sollten. Für Deutschland hat Theresia Degener (Professorin an der Evangelischen Hochschule in Bochum) daran mitgearbeitet. Im Januar 2004 hat diese Arbeitsgruppe einen ersten Entwurf vorgelegt. Im August 2006 hat diese Ad-hoc-Kommission bzw. dieses Ad-hoc-Komitee die Arbeit in seiner 8. Sitzung relativ schnell beendet, sodass im Dezember 2006 die UNO-Vollversammlung diese Konvention verabschieden konnte. Am 3. Mai 2008 trat dann das »Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung« in Kraft. Dieses ist aktuell von 182 Staaten und der Europäischen Union durch Ratifizierung und Beitritt bzw. durch formale Bestätigung als völkerrechtlicher Vertrag gekennzeichnet. Am 01. 01. 2009 wurde das Ratifikationsgesetz in Deutschland verabschiedet und seit dem 26. März 2009 gilt die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland.
Diese Konvention kann als »Konvention der Superlative« (Aichele 2011, S. 11) gekennzeichnet werden. Es ist somit das erste große Menschenrechtsdokument im 21. Jahrhundert. Es enthält 50 Artikel und ein Zusatzprotokoll. Es ist zudem die Konvention, die von der UNO am schnellsten verhandelt wurde und die auch am schnellsten die meiste Zustimmung aller beteiligten Staaten erhielt. Der schon in den 1990er Jahren von Menschen mit Beeinträchtigung entwickelte Slogan »Nichts über uns ohne uns!« wurde hierbei berücksichtigt, sodass mit Bezug auf Aichele festgestellt werden kann, dass in einer UN-Konvention noch nie so stark die Zivilgesellschaft einbezogen worden ist.
Um was handelt es sich jetzt bei der UN-Behindertenrechtskonvention konkret?
Grundlegend kann man sagen, dass es keine Spezialkonvention ist, sondern dass diese Konvention eine Konkretisierung der bereits anerkannten Menschenrechte vornimmt. Sie ist hierbei die Grundlage für eine Gesellschaftspolitik: Weg von einer Politik der Fürsorge – hin zu einer Politik der Rechte (Aichele 2011, S. 13). In dieser Konvention wird somit ein zutiefst ausgestalteter Menschenrechtsansatz deutlich: Selbstbestimmung und Inklusion können hierbei als ethischer Kern dieser Konvention betrachtet werden (Graumann 2016, S. 53). Selbstbestimmung und Inklusion werden auf diesem Hintergrund, also aus menschenrechtlicher Sicht, thematisiert und bilden zwei normative Grundprinzipien, welche den gesamten Vertragstext der Konvention prägen. Detailliert eingeführt und differenziert dargestellt werden sie vor allem in dem Artikel 12 (zur Geschäftsfähigkeit und zur Einwilligungsfähigkeit als gleiche Anerkennung vor dem Recht) und dem Artikel 19 (welcher sich mit der Unabhängigkeit und der Inklusion in der Gemeinschaft beschäftigt).
Mit dem Artikel 12 verpflichten sich somit sämtliche Vertragsparteien darauf
»(...) die rechtliche Handlungsfähigkeit aller Menschen mit Behinderung anzuerkennen. Das heißt, dass behinderte Menschen nicht nur gleichberechtigt mit anderen Menschen als Träger von Rechten anzuerkennen sind, sondern dass darüber hinaus auch davon ausgegangen werden muss, dass sie selbstbestimmt entscheiden und rechtlich verantwortlich handeln können. Darin kann eine ›radikale Abkehr‹ von jeder Form der Bevormundung, Entmündigung und Fremdbestimmung gesehen werden. In Frage steht damit insbesondere, inwiefern stellvertretende Entscheidungen über persönliche Angelegenheiten von Menschen mit Behinderung überhaupt noch gerechtfertigt werden können.« (Graumann 2016, S. 54)
An dieser Stelle wird schon einmal deutlich, dass sämtliche Regularien und Gestaltungen (damit auch Raumgestaltungen) daraufhin ausgerichtet werden müssen, dass Menschen mit Behinderung aktiv und selbstbestimmt in diesen Räumen leben und diese mitgestalten können – dieses verweist schon in einem ersten Schritt auf eine konsequente Umsetzung der Barrierefreiheit in jedweden Organisationen.
Der Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention legt dann dar, dass alle Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. mit sozial zugeschriebenen Behinderungen, das grundlegende Recht auf eine unabhängige Lebensführung und auf eine volle und gleichberechtigte Einbeziehung in die Gesellschaft haben. Dieses Recht zu einer konsequenten Umsetzung der Inklusion muss somit von allen Vertragspartnern
»(...) umfassend geachtet, geschützt und gefördert werden. Das heißt, Vorschriften, die Menschen mit Behinderung nötigen, in Komplexeinrichtungen oder anderen segregierenden Institutionen zu leben, zu lernen, zu arbeiten oder ihre Freizeit zu verbringen, widersprechen der UN-BRK. Unter Bezug auf die Konvention wird gefordert, alle Barrieren zu beseitigen, die Menschen mit Behinderung Zugang zu ›normalen‹ Lebens- und Arbeitsumfeldern bislang verwehren.« (Graumann 2016, S. 55)
Auch in diesem Artikel wird noch einmal sehr deutlich, dass es um eine konsequente Umsetzung der Barrierefreiheit geht. Die hierin angesprochene Modifikation bzw. sogar Abschaffung von Sondereinrichtungen kann an dieser Stelle nicht weiter diskutiert, auf diese soll nur kurz verwiesen werden. Relevant ist allerdings, dass in allen Organisationsformen – und somit auch in solchen der Kliniken – barrierefreie Gestaltungsräume geschaffen werden, welche konsequent dazu beitragen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen ihr Leben in normalen Lebens- und Arbeitsumfeldern gestalten können. Das Leben als Patientinnen und Patienten, als Mitarbeiterinnen und als Mitarbeiter in diesen Kliniken ist somit durch die strukturelle und architektonische Ausgestaltung dieser Kliniken so zu konkretisieren, dass dieses gezielt möglich wird. – Hierin eingeschlossen ist infolgedessen auch eine konsequente Umsetzung der Wahlfreiheit von Menschen mit Beeinträchtigungen: Sie können und sollen in den Räumen, in denen sie leben und arbeiten frei wählen können, wie sie dieses konkret realisieren möchten. »Darin ist insbesondere eingeschlossen, dass alle gemeindenahen Dienste und Infrastrukturen zukünftig so gestaltet werden müssen, dass Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang dazu haben« (Graumann 2016, S. 55) – und dieses bezieht sich dann natürlich auch auf die Dienste des Gesundheitswesens.
Zentral für die Umsetzung der Barrierefreiheit ist nun allerdings vor allem auch der Artikel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention. Dieser beschreibt das Recht von Menschen mit Beeinträchtigung auf die Wahrnehmung des erreichbaren Höchstmaßes an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund eben dieser Beeinträchtigung und Behinderung.
»Diese Regelungen wiederholen und bekräftigen die bereits für jedermann aufgestellten Regelungen des Artikels 12 des UN-Sozialpakts, des Artikels 24 der UN-Kinderrechtskonvention, des Artikels 12 der UN-Frauenrechtskonvention. Im Rahmen dieser Gesundheitssorge ist durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten, dass behinderten Menschen Zugang zu Gesundheitsdiensten, einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, die die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern berücksichtigen, haben.« (Behindertenrechtskonvention, 2021)
Da die Relevanz dieses Artikels für die Ausgestaltung der Barrierefreiheit unabdingbar ist, soll dieser Artikel nun im Gesamten wiedergegeben werden:
»Artikel 25 – Gesundheit
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten, einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, haben. Insbesondere
1.stellen die Vertragsparteien Menschen mit Behinderungen eine unentgeltliche oder erschwingliche Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard zur Verfügung wie anderen Menschen, einschließlich sexual- und fortpflanzungsmedizinischer Gesundheitsleistungen und der Gesamtbevölkerung zur Verfügung stehender Programme des öffentlichen Gesundheitswesens;
2.bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsleistungen an, die von Menschen mit Behinderungen speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt werden, soweit angebracht, einschließlich Früherkennung und Frühintervention, sowie Leistungen, durch die, auch bei Kindern und älteren Menschen, weitere Behinderungen möglichst geringgehalten oder vermieden werden sollen;
3.bieten die Vertragsstaaten diese Gesundheitsleistungen so gemeindenah wie möglich an, auch in ländlichen Gebieten;
4.erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Gesundheitsberufe die Verpflichtung auf, Menschen mit Behinderungen eine Versorgung von gleicher Qualität wie anderen Menschen angedeihen zu lassen, namentlich auf der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger Aufklärung, indem sie unter anderem durch Schulungen und den Erlass ethischer Normen für die staatliche und private Gesundheitsversorgung das Bewusstsein für die Menschenrechte, die Würde, die Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schärfen;
5.verbieten die Vertragsstaaten die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in der Krankenversicherung und in der Lebensversicherung, soweit eine solche Versicherung nach innerstaatlichem Recht zulässig ist; solche Versicherungen sind zu fairen und angemessenen Bedingungen anzubieten;
6.verhindern die Vertragsstaaten die diskriminierende Vorenthaltung von Gesundheitsversorgung oder -leistungen oder von Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten aufgrund von Behinderung.«
Der Artikel 26 folgt hierauf und stellt die Grundlagen und Konsequenzen im Rahmen der Habilitation und Rehabilitation von Menschen mit Beeinträchtigungen dar. Da auch dieser Artikel für die Entwicklung einer Barrierefreiheit in Kliniken bedeutsam ist – gerade auch in Bezug auf eine interdisziplinäre Vorgehensweise und Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen – soll auch dieser hier vollständig wiedergegeben werden:
»Artikel 26 – Habilitation und Rehabilitation
(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, einschließlich durch die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen, um Menschen mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geistige, soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren. Zu diesem Zweck organisieren, stärken und erweitern die Vertragsstaaten umfassende Habilitations- und Rehabilitationsdienste und -programme, insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit, der Beschäftigung, der Bildung und der Sozialdienste, und zwar so, dass diese Leistungen und Programme
1.im frühestmöglichen Stadium einsetzen und auf einer multidisziplinären Bewertung der individuellen Bedürfnisse und Stärken beruhen;
2.die Einbeziehung in die Gemeinschaft und die Gesellschaft in allen ihren Aspekten sowie die Teilhabe daran unterstützen, freiwillig sind und Menschen mit Behinderungen so gemeindenah wie möglich zur Verfügung stehen, auch in ländlichen Gebieten.
(2) Die Vertragsstaaten fördern die Entwicklung der Aus- und Fortbildung für Fachkräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Habilitations- und Rehabilitationsdiensten.(3) Die Vertragsstaaten fördern die Verfügbarkeit, die Kenntnis und die Verwendung unterstützender Geräte und Technologien, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, für die Zwecke der Habilitation und Rehabilitation.«
Dieser hier in Kürze skizzierte Menschenrechtsansatz der Behindertenrechtskonvention definiert also auch völkerrechtliche Grundlagen und Inhalte. Die UN-Behindertenrechtskonvention besteht somit aus zwei völkerrechtlichen Verträgen: Der Konvention als solche und dem so genannten Fakultativprotokoll. »Das Fakultativprotokoll ist eine Art Zusatzprotokoll und stellt in 18 Artikeln verschiedene Verfahrensweisen bereit, wie individuelle bzw. kollektive Menschenrechtsverletzungen von der UN-BRK überprüft werden können« (Degener 2016, S. 11).
Eine gesundheitliche Beeinträchtigung ist nun nicht mehr die Begründung, dass Menschen mit Beeinträchtigung diskriminiert bzw. ausgeschlossen werden können. Dieser soziale Ansatz zur Betrachtung von Behinderung zieht sich wie ein sehr dichter roter Faden durch die UN-BRK. Hierzu Degener ausführlich:
»Darin liegt ihr revolutionärer Charakter. Zu den 8 Prinzipien, aus denen sich der Geist der UN-BRK weiter ergibt, gehören die Achtung vor der Menschenwürde, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie der Selbstbestimmung, die Nichtdiskriminierung, die Partizipation und Inklusion, die Achtung der Diversität behinderter Menschen und die Anerkennung dieser Diversität als Teil menschlicher Vielfalt, die Chancengleichheit, die Barrierefreiheit, die Geschlechtergerechtigkeit und die Achtung der sich entwickelnden Fähigkeiten von behinderten Kindern und ihre Identität. Diese acht Prinzipien gelten für alle weiteren Bestimmungen der UN-BRK. Sie müssen insbesondere bei der Interpretation und Umsetzung der einzelnen Menschenrechte, die in der UN-BRK enthalten sind, mitgedacht werden.« (Degener 2016, S. 13/14)
Die Verpflichtungsträger, also die staatlichen Stellen einigen sich darauf, Achtungs-, Schutz- und Gewährleistungspflichten für alle Menschen vorzuhalten und im Rahmen aller Ausgestaltungen, aller Artikel zu konkretisieren (Aichele 2011, S. 14). Zu den menschenrechtlichen Prinzipien gehören hierbei vor allem die Partizipation, die Nichtdiskriminierung und die Inklusion – wie in dem längeren Zitat von Degener deutlich wird. Die Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention definiert demzufolge ein weltweit verändertes Verständnis von Behinderung (hierauf wird in den nächsten Kapiteln dieses Buches noch konkreter eingegangen werden), welches darauf ausgerichtet ist, paternalistische Grundannahmen, die immer auch einmal wieder auf den Prinzipien von Barmherzigkeit und Fürsorge begründet sind, konsequent in Frage zu stellen und zu negieren (Degener 2016, S. 15). Und – wie oben schon kurz skizziert: »Dieses neue Verständnis kam nicht aus dem Nichts, es wurde jahrzehntelang durch politische Interessenvertretungen der Behindertenbewegung und kritischer Mediziner_innen und Pädagog_innen auf nationaler und internationaler Ebene errungen.« (Degener 2016, S. 15/16).
Es wird somit deutlich, dass sich mit der Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2006 durch die Vereinten Nationen und auch mit dem Inkrafttreten und der Implementation dieser Konvention in Deutschland das soziale Modell von Behinderung zu einem menschenrechtlichen Modell von Behinderung weiterentwickelt hat (Degener 2016, S. 17). Die UN-Behindertenrechtskonvention richtet daher die Orientierung aller Beteiligten und Handelnden vorrangig auf die Aufmerksamkeit der Lebenslagen von Menschen mit besonderer Verletzlichkeit und Fragilität. Es ist demnach deutlich, dass sämtliche Strukturmodelle und Organisationsentwicklungsprozesse im Rahmen der sogenannten Eingliederungshilfe und vor allem auch des Gesundheitswesens daraufhin ausgerichtet werden müssen, die Menschen umfassend in den Blick zu nehmen und ihre jeweiligen inhaltlichen und strategischen Prozesse barrierefrei – und zwar konsequent barrierefrei – zu gestalten. Hierbei sind vor allem besondere Maßnahmen bei akuter Rechtsbedrohung einzunehmen, insbesondere zur Achtung und zum Schutz der Rechte dieser Personen – und das bezieht sich natürlich auch auf die architektonische Gestaltung aller beteiligten Organisationen.
Die zentrale Leitnorm dieser Menschenrechtskonvention ist somit die Inklusion: Dieses menschenrechtliche Prinzip zielt auf eine unbedingte Zugehörigkeit ab – aller Menschen von Anfang an und immer. Es versucht die Möglichkeit einer gesellschaftlichen Teilhabe aller Beteiligten für eben diese erfahrbar zu machen (Aichele 2011, S. 19). Dieser Inklusionsdiskurs soll infolgedessen auf alle Organisationen ausstrahlen – dieses führte zum Beispiel zu mehr oder weniger konsequenten Umsetzung der Inklusion im Bereich der Kindertagesstätten- und Bildungsarbeit in Deutschland. Phänomene der Entsolidarisierung sowie der sozialen Ausgrenzung und der Gegnerschaft einer inklusiven Gesellschaft, werden hierdurch eine konsequente Absage erteilt (Aichele 2011, S. 21). Ebenfalls werden mögliche Missverständnisse so z. B., dass dem deutschen Gesetzgeber durch diese Konvention eben keine legislativen Pflichten aufgebürdet werden, bzw. dass diese Konvention keine juristische Wirkung für das Handeln einzelner Bundesländer beinhalten würde, eine konsequente Absage erteilt (Degener 2016, S. 21 – 24). Es wird demnach deutlich, dass bei der Ausgestaltung und Entwicklung sämtlicher Organisationsformen im Bereich des Sozial- und Gesundheitswesens die UN-Behindertenkonvention nicht nur mitgedacht, sondern dass diese als grundlegende Voraussetzung in Anspruch genommen werden muss. Dieser Menschenrechtsansatz, welcher den Inklusionsansatz intensiv vertieft, geht also davon aus, dass es zu einem konsequenten strukturellen Wandel in allen Organisationsformen des Sozial- und Gesundheitswesens kommen muss. Sämtliche Träger sind hierbei angehalten, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit eine barrierefreie Gestaltung dieser Organisationen stattfinden kann.
Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Bezug auf diese Organisationsformen muss also geradlinig diese Strukturen in den Fokus nehmen. Vor allem die unterschiedlichen Schnittstellen zwischen den juristischen und baurechtlichen, bzw. architektonischen und dann pragmatischen Themenfeldern im Bereich der Ausgestaltung der Organisationen des Sozial- und Gesundheitswesens sind hierbei zentral. Es muss daher zu einem systematischen Abbau von Barrieren kommen – welcher zumindest häufig in den Köpfen beginnt und an den Mauern der Einrichtungen noch längst nicht endet. Unterschiedliche Wissens- und Erfahrungsbereiche, welche sich mit der Barrierefreiheit beschäftigen (▶ Kap. 2.5) sind hierbei mit einzubeziehen (Aichele 2011, S. 29).
Auf diesem argumentativen Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention ist demzufolge festzustellen, dass in einer konsequent inklusiv ausgerichteten Gesellschaft die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen deutlich besser konkretisiert und verwirklicht werden können. Insofern ist Inklusion eine menschenrechtliche Leitnorm für alle Prozesse, welche Staat und Gesellschaft thematisieren. Dieser Menschenrechtsansatz geht weit über eine klassische methodische oder methodologische Umsetzung von Inklusion hinaus. Inklusion ist somit ein menschenrechtsbegründeter Handlungs- und Gestaltungsauftrag, welcher sämtliche kommunale und überkommunale Gemeinschaftsprozesse definiert (Aichele 2011, S. 35). Des Weiteren wird hiermit sehr deutlich – und das wird in den nächsten Kapiteln dieses Buches noch weiter differenziert werden – dass das Menschenrechtsmodell von Behinderung das medizinische Modell, welches ausschließende Sonderwelten – und dieses auch in Kliniken und Krankenhäusern – definiert hat, konsequent ablöst. Dieses
»(...) entwickelt das soziale Modell von Behinderung, nachdem Behinderung als sozial konstruiertes Phänomen zu verstehen ist weiter, indem der volle Menschenrechtskatalog auf den Kontext von Behinderung zugeschnitten wird. (...) Besondere Verantwortung haben Leistungserbringer wie die Diakonie im Hinblick auf die Umsetzung. (...) Die Vorgaben der UN-BRK hat der Ausschuss in seinen abschließenden Bemerkungen zum ersten deutschen Staatenbericht im April 2015 präzisiert: Sonderwelten, Stellvertretung und Zwangsbehandlung sind abzuschaffen und durch Inklusion, unterstützte Entscheidungsfindung und menschenrechtsbasierte Krisenintervention zu ersetzen.« (Degener 2016, S. 42/43)
Sämtliche Staaten, die somit das »Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen« unterzeichnet und ratifiziert haben, verpflichten sich also dazu, »(...) den Paradigmenwechsel von wohltätigkeits- zur rechtebasierten Ansätzen sowohl in der Behindertenpolitik als auch in der praktischen Arbeit mit Menschen mit Behinderung herbeizuführen« (Graumann 2016, S. 69). Und »ohne eine ›Kultur der Inklusion‹ wird eine konsequente Umsetzung der UN-BRK nicht gelingen können« (Graumann 2016, S. 70).
Eine stetige und geradlinige Umsetzung eben dieses Menschenrechtsansatzes im Rahmen einer Inklusion, welche dann zur Barrierefreiheit führen muss, ist daher für alle Kliniken und Krankenhäuser eine paradigmatische, juristische und architektonische Aufgabe, welche sich bis in die pragmatischen Bereiche von Fort- und Weiterbildung, sowie der Kommunikation zwischen allen beteiligten Gruppen in diesen Kliniken und Krankenhäusern ziehen muss.
Erste konkrete Hinweise zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention erfolgten dann und erfolgen bis dahin in der Umsetzung dieser im Rahmen der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit von Behinderung und Gesundheit (ICF) – diese wird im nachfolgenden Kapitel konkretisiert werden (▶ Kap. 2.2). Darüber hinaus erfolgte eine Implementation der UN-Behindertenrechtskonvention in einer komplett neuen Gestaltung der deutschen Sozialgesetzbücher, so vor allem im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes – dies wird in Kapitel 2.3 dieses Buches intensiver beschrieben werden (▶ Kap. 2.3).
2.2 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)
In diesem Kapitel wird die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit Behinderung und Gesundheit erläutert (WHO 2005; LWL 2019, S. 6 f.). Die Entwicklung und Gestaltung dieser internationalen Klassifikation stellt einen Durchbruch der Bezeichnung und Beschreibung sowie der Diagnose unterschiedlicher Krankheitsverläufe und Beeinträchtigungen dar, welche weltweit dazu geführt hat, eben diese (nämlich Beeinträchtigungen und Erkrankungen) deutlich anders wahrzunehmen, als dies noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Auf diesem Hintergrund wird die ICF in diesem Kapitel nun auf folgenden Ebenen beschrieben:
·
Der neue Behinderungsbegriff im SGB IX
·
Grundlagen der ICF
·
Klassifikation der ICF
Mit Bezug primär auf eine grundlegende Publikation des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Münster (welcher hierzu im Jahr 2019 eine umfassende Beschreibung vorgelegt hat) werden diese Begrifflichkeiten nun weiter differenziert.
2.2.1 Der neue und erweiterte Begriff zur Behinderung im SGB IX
Grundsätzlich ist festzustellen, dass z. B. im Jahr 2021 rd. 7,9 Mio. Menschen mit einer amtlich anerkannten (Schwer-)Behinderung in Deutschland lebten (Destatis 2021). Weiterhin bleibt festzuhalten, dass die Weltgesundheitsorganisation in ihrem Weltbehindertenreport im Jahr 2011 festgestellt hat, dass ca. 1 Mrd. Menschen mit Behinderung weltweit leben – das sind ca. 15 % der Weltbevölkerung (WHO 2011). Dieses ist deswegen in hohem Maße relevant, da beschrieben und definiert werden muss, wann ein Mensch mit einer Behinderung lebt oder was diese Behinderung nun tatsächlich und konkret auszumachen scheint. Im Wechsel einer Veränderung dieses Welt- und Menschenbildes zum Thema Beeinträchtigung ist es sehr zentral anzumerken, dass es inzwischen weltweit ein gemeinsames Grundverständnis zu geben scheint – bzw. dieses angestrebt wird – dass Menschen mit Behinderung ein relevanter Teil der Gesellschaft sind. Wobei auf diesem Hintergrund längst nicht klar ist, was Behinderung tat-sächlich zu meinen scheint. Dieser veränderte Behinderungsbegriff (▶ Kap. 2) führt dazu, bzw. soll dazu führen, dass Menschen mit Behinderung immer Teil der Gesellschaft sind. Hierbei ist die Teilhabe an dieser Gesellschaft ein Grundrecht und kein Recht auf Fürsorge. Es ist also schon an dieser Stelle wahrnehmbar, dass sich der Behinderungsbegriff radikal verändert (hat).
Auf diesem Hintergrund bleibt dennoch festzustellen, dass die Diskurse in der Heilpädagogik schon seit dreißig Jahren davon ausgehen, dass Behinderung durch unterschiedliche Perspektiven wahrgenommen, definiert und beschrieben werden kann (▶ Kap. 3.1). So gab und gibt es nach wie vor die medizinische (defizitorientierte) Perspektive der Behinderung, welche diese – nämlich die Behinderung – den jeweils betroffenen Menschen zuweist. Zudem gibt es die soziale Perspektive, welche davon ausgeht, dass Behinderung durch unterschiedliche Zuschreibungen und Konstruktionsprozesse der Gesellschaft entsteht bzw. hierzu beim Betroffenen ein sehr reales Bewusstsein seiner Behinderung durch gesellschaftliche Prozesse entstehen lässt (Kobi 2004, Greving und Gröschke 2000, Jantzen 2020).
Der im Grundgesetz in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 formulierte Anspruch: »Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden« versucht dieses soziale Verständnis von Beeinträchtigung juristisch näher zu fassen. Dennoch geht auch dieser Gesetzestext von einer eher personenspezifischen und subjektspezifischen Darstellung und Erfassungsweise von Behinderung aus. Behinderung wird in diesem Kontext eben nicht als zugeschriebenes Merkmal, sondern als ontogenetisches, also in der Person verortetes, Merkmal einer einzelnen ganz spezifischen Person gesehen.
Es ist somit relevant festzustellen, dass die Definition einer behinderungsbedingten Benachteiligung (also in diesem Kontext das soziale Modell von Behinderung) u. a. von einem deutlich aktuell vorherrschenden Verständnis von Behinderung in der jeweiligen Gesellschaft und Kultur abhängt (so ist es aktuell so, dass eine geistige Beeinträchtigung in Europa schwerer wiegt als eine Sinnesbeeinträchtigung; in manchen Ländern Afrikas ist dieses genau anders herum der Fall). Und dieses Verhältnis verändert sich und modifiziert sich permanent.
Wurde somit Behinderung über viele Jahrhunderte und bis weit in das 20. Jahrhundert hinein als subjektorientiertes Personenproblem des einzelnen Menschen verstanden – diese Menschen mit Beeinträchtigung (also mit Behinderung) hierbei als abhängig und hilfebedürftig angesehen wurden und dementsprechend einen Anspruch auf Versorgung und Unterstützungsleistungen des Staates hatten – verändert sich dieses Verständnis im Rahmen der UN- Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung, sodass diese feststellt, dass diese Menschen einen Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben und auf eine konsequente soziale Teilhabe an allen Funktionsbereichen der Gesellschaft haben. Also: mit Bezug auf die UN-Behindertenrechtskonvention lässt sich festhalten, »(...) dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern.« (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 2017, S. 5). Also entsteht Behinderung erst auf dem Hintergrund einer dann doch jeweils subjektiven Beeinträchtigung im Kontext des Zusammenwirkens einer Person mit den jeweiligen gesellschaftlichen Themen und Strukturen.
Wie schon im vorangegangenen Kapitel festgestellt wurde, wird somit im SGB IX der Behinderungsbegriff neu gefasst:
»Menschen mit Behinderung sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.« (SGB IX)
Weitergehend werden im SGB IX Beeinträchtigungen als solche definiert, welche auf körperlicher, seelischer, geistiger oder auf Sinnesebene wahrnehmbar sind, wenn genau diese, nämlich der körperliche Zustand und der Gesundheitszustand des betroffenen Menschen, von demjenigen Zustand abweichen, welcher für das Lebensalter genau dieses Menschen zu erwarten wäre.
Mit dieser Veränderung des Begriffes der Beeinträchtigung greift der deutsche Gesetzesgeber das bio-psycho-soziale Modell auf, an dem sich die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) orientiert (▶ Kap. 2.2.2). Es werden somit kritische und negative Wechselwirkungsprozesse zwischen dem Menschen und seinem möglichen Gesundheitsproblem (welches in der ICD beschrieben wird) und den jeweiligen Kontextfaktoren, welche sich auf die funktionale Gesundheit (so wie diese in der ICF definiert wird) auswirken beschrieben. Genau diese funktionale Gesundheit steht im Mittelpunkt der Beschreibung der ICF (Schuntermann 2011, S. 251 – 256). Man kann somit behaupten, dass die ICF zum einen einen allgemeinen Behinderungsbegriff unterscheidet, welcher sich auf jedwede Form von Beeinträchtigung von funktionaler Gesundheit bezieht, und auf der anderen Seite einen speziellen Begriff von Behinderung definiert, welcher als Ergebnis der negativen und problematischen Wechselwirkung zwischen einem Menschen mit einem ganz spezifischen Gesundheitsproblem und seinen Kontextfaktoren entsteht, welche sich wiederum auf die Teilhabe in einem ganz bestimmten Lebensbereich auswirken (LWL 2019, S. 8).
Relevant ist somit ein Wechselwirkungsansatz, welcher als zentrales Merkmal des Grundverständnisses von Behinderung (in diesem Fall des konsequent soziologischen Verständnisses von Behinderung) bezeichnet werden kann. Behinderung entsteht somit auf dem Hintergrund einer Einschränkung und Beeinträchtigung eines Menschen durch soziale Prozesse auf der Voraussetzung seiner physiologischen oder neurologischen Ausstattung. Dieses mag an einem sehr einfachen Beispiel deutlich werden: Ein Mensch mit einer Sehbehinderung, besser mit einer Beeinträchtigung des Sehens, ist nicht behindert, wenn diese durch eine gute Brille seine Beeinträchtigung ausgleicht. Er bleibt allerdings behindert, wenn ihm aufgrund von Kostenfragen (da die Krankenkassen vor einiger Zeit beschlossen haben, dass eine Brille als Modeaccessoire zu betrachten ist) oder aber auch von sozialstrukturellen Fragen der Weg zu einer Brille verwehrt bleibt – wie dieses z. B. bei vielen Tausend Menschen in Afrika oder Asien immer noch der Fall ist. Es mag aber auch in einem weiteren Beispiel deutlich werden: Ein Mensch mit Autismus-Spektrum-Störungen wird möglicherweise durch die Gesellschaft behindert, wenn diese seine kommunikativen Möglichkeiten eben nicht als Kommunikation, sondern als Verhaltensbesonderheiten, als herausforderndes Verhalten oder sogar als Aggression wahrnimmt. Ist dieses nicht der Fall ist eine Teilhabe an gesellschaftlichen Funktions- und Kommunikationsprozessen dieses Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen möglicherweise in keinem Fall problematisch.
Des Weiteren wird an dieser Stelle deutlich, dass Behinderung deshalb entsteht (bzw. gesellschaftlich konstruiert wird), weil die Einstellungen der Menschen, welche nicht mit Behinderung oder Beeinträchtigung in einer Gesellschaft leben, genau diese Barrieren entstehen lassen, welche dann wiederum dazu führen, dass die soziale, aber auch die technische und die funktionelle Umwelt für diese Menschen Barrieren entstehen lassen – so wie dieses in den beiden vorangegangenen Beispielen deutlich geworden ist, in denen es um finanzielle, strukturelle und kommunikative Ausprägungen und Wahrnehmungen dieser Menschen ging.