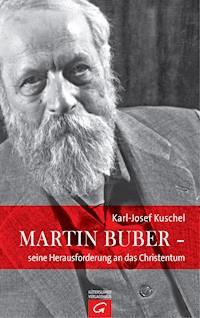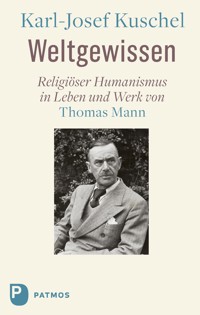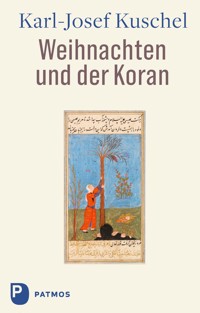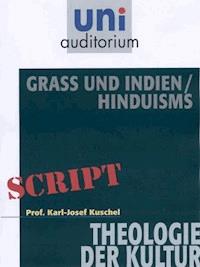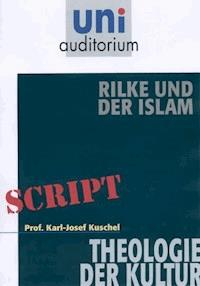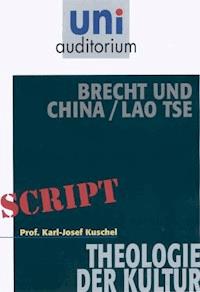Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Eine wissenschaftliche und persönliche Summe: Karl-Josef Kuschel fasst in diesem Band seine zwei Jahrzehnte währenden Studien zum Thema Bibel und Koran zusammen: neu bearbeitet und vor allem um die Erträge der neuesten Forschungen zum Koranverständnis erweitert. Gründliches Basiswissen ist Voraussetzung für eine Kultur des Austausches zwischen Juden, Christen und Muslimen, die auf wechselseitigem Respekt gründet und Vertrauen wachsen lässt. Zu diesem Ziel, vom konfrontativen hin zu einem vernetzten Denken zu finden, ist das Buch des engagierten Gelehrten selbst ein wichtiger Beitrag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 877
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl-Josef Kuschel
Die Bibel im Koran
Grundlagen für das interreligiöse Gespräch
Patmos Verlag
Inhalt
Worum es geht:Bibel und Koran: Neue Herausforderungen
Prolog:»Wir Kinder Abrahams«: Helmut Schmidt trifft Anwar as-Sadat 10 Erkenntnisse im Interesse des Dialogs der Religionen
»Alles wirkliche Leben ist Begegnung«
Die Urerfahrung: Eine Nachtfahrt auf dem Nil
Erkenntnis 1: Der Sinai – Ursprungsraum des Monotheismus
Erkenntnis 2: Abraham – Vater des Glaubens für drei Religionen
Erkenntnis 3: Gemeinsame Propheten
Erkenntnis 4: »Ihr Europäer wisst das alles nicht«
Erkenntnis 5: Weltfrieden -Weltethos – Weltdemographie
Erkenntnis 6: Durch einen Muslim die Ringparabel voll begriffen
Erkenntnis 7: Ein spiritueller Ort für drei Religionen
Erkenntnis 8: Ein Friedensstifter wird ermordet
Erkenntnis 9: Führer zum Frieden – trotz allem
Erkenntnis 10: »Ich habe ihn geliebt«
Erster TeilWie den Koran im Gegenüber zur Bibel verstehen? Erfahrungen eines Christenmenschen
1. Warum Christen sich mit dem Koran schwertun
Juden und Christen als »Schriftbesitzer«?
»Bestätigung« früherer Offenbarungen?
Massive Kritik an bisheriger Bibelauslegung
Worin Bibel und Koran grundverschieden sind
Die Bibel – wie ein Buchgebirge: Einsichten mit Thomas Mann
Der Koran – wie ein Polyeder: Einsichten mit Jacques Berque
Und ein verwegener Seitenblick auf James Joyce
2. Der Koran als Hör-Erlebnis
Den Koran wie eine Partitur hörbar machen
Koranrezitation als »sakramentaler« Vorgang
Warum eine »poetische« Koranübersetzung zwingend ist
In der Tradition von Hammer-Purgstall, Goethe und Rückert
Koranübersetzungen im Vergleich
Zur Rhetorik des Koran: Sure 55
Mohammed – ein Dichter? Zum Verhältnis von Poet und Prophet
3. Konsequenzen für den Umgang mit dem Koran
Plädoyer für eine vorkanonische Koranlektüre
Den Koran polyphon-dramatisch verstehen
Den Koran kommunikativ-diskursiv verstehen
Den Koran geschichtlich- kontextuell verstehen
Der Koran – eine umstrittene Botschaft
Muslimische Stimmen für ein neues Koranverständnis
Und die »Gewaltstellen«?
Muslime wider den Missbrauch ihrer Religion
Das Dokument der 138 (2007)
Der Brief an al-Bagdadi und ISIS (2014)
Das Manifest vom Brandenburger Tor (2015)
Die Marrakesch-Erklärung (2016)
4. Mekka: Ein neuer Glaube kämpft um seine Durchsetzung
Ein städtisch-multireligiöses Milieu
Wer waren die Anhänger Mohammeds?
Kernbotschaft I: Die Schöpfungswerke sind Zeichen Gottes
Die Kernbotschaft II: Gott hat Macht über Leben und Tod
Kernbotschaft III: Gericht mit doppeltem Ausgang
Konsequenzen für ein sozial verantwortliches Leben
Wie die Propheten und der Prediger aus Nazaret
Mohammed – der angefeindete Prophet
5. Medina: Ein Glaube wird eine neue Religion
Mohammeds »Unabhängigkeitserklärung«
Der Bruch mit den jüdischen Stämmen
Die Lage der Christen im Umfeld des Koran
Scharfe Abgrenzung: Kreuz, Gottessohnschaft, Trinität: Sure 4
Militärische Konfrontation mit Christen: Sure 9
Bleibender Zwiespalt im Verhältnis zu Christen: Sure 5
6. Mekka, Jerusalem und zurück: Überbrückte Welten
Die chronologische Abfolge der Suren
Was der Koran unter Propheten versteht
Welche biblischen Gestalten im Koran?
Statt Blutsbande spirituelle Vorfahren der Bibel
Ausrichtung auf eine imaginäre sakrale Topographie
Zehn Voraussetzungen für einen Dialog Bibel – Koran
Interreligiös vernetztes Denken einüben
Zweiter TeilAdam: Gottes Risiko Mensch
I. Adam und die Schöpfung: Biblische Bilder
1. Ein polyphones Testament
»Adam« – Ur-Mensch, jeder Mensch
Lesen mit literarischem Blick
2. Kontrastive Bilder vom Menschen
Dem Chaos abgetrotzte Ordnung: Schöpfungsbericht I
Vom Umgang mit dem Chaos: Schöpfungsbericht II
3. Kontrastive Bilder von Gott
Polyphonie ohne Harmonie
Gottgewolltes Risiko Mensch
II. Adam und die Schöpfung: Koranische Bilder
1. Grundthema: Stolz und Sturz des Menschen
Gericht über die Reichen und Gewissenlosen
Beschwörende Erinnerungsarbeit: Sure 95
Dramatisches Menschenbild: Sure 82
2. Schon der erste Mensch – verführt und vertrieben: Sure 20
Wie damals so heute
Menschsein als nachparadiesische Existenz
Die Freiheit der Gnade Gottes
3. Von der »Göttlichkeit« des Menschen: Sure 15
Wesen mit Gottesgeist
Rebellion und Vertreibung des Teufels
4. Die Signatur adamitischer Existenz: Sure 7
Jüdische Parallelen
Gottesentfremdung ohne Gotteszynismus
Was heißt: Menschen sind »Kinder Adams«?
5. Der Mensch als Stellvertreter Gottes: Sure 2
Was in Medina anders wird
Die Konstituierung einer eigenen religiösen Identität
Die Menschenskepsis der Engel
Gott geht das Risiko Mensch ein
»Statthalter Gottes«: Biblische und koranische Konvergenz
6. Adams Söhne oder: der erste Brudermord
Abgründige Geschichten in Bibel und Koran
Welche Rolle spielt Gott?
Eine Exempelgeschichte zur Mordprophylaxe
Unschätzbarer Wert jedes menschlichen Lebens
Dritter TeilNoach: Untergang und Neuanfang
I. Vernichtung und ein Bund mit der Schöpfung: Noach in der Bibel
1. Vom Brudermord zum Schöpfungsmord
Tief ist der Brunnen der Vergangenheit
Noach als Idealbild des ersten Menschen
2. Gottes Reue über seine Schöpfung
Noach bleibt stumm
Vor der Flut – nach der Flut
3. Gebote für Mensch und Gott
Töten ist Brudermord
Gottes Bund mit der Schöpfung
4. Weltdrama als Familiendrama
Noachs Fluch und Segen
Die Menschheit als Völkerfamilie
II. Gerichtswarnung und eine neue Glaubensgemeinschaft: Noach im Koran
1. Im Kampf wider die Verblendung: Sure 54
Der verlachte Noach: jüdische Parallelen
Noach als warnendes Beispiel: christliche Parallelen
Die Zeichen Gottes nicht verachten
2. Für was Noach kämpft: Sure 71
Dramatische Dialoge
Botschaft mit scharfem Profil
Wider den falschen Glauben
3. Gegen wen Noach kämpft: Suren 26/23
Wider die Oberen und Herrschenden
Wider die Götzendiener
4. Absage an Blutsbande: Sure 11
Der angefochtene Prophet
Rettung nur der Glaubenden
Nicht altes Blut, der neue Glaube zählt
5. Ein Prophet des »Islam« vor dem Islam
Eröffner biblischer Prophetie und erster Gesetzgeber
Dieselbe Sache einst und jetzt
Die Selbstlegitimation des Islam als Islam
Vierter TeilMose – und der »ewige Konflikt«: Gottesmacht gegen Menschenmacht
I. Exodus und Sinai: der Mose der Bibel
1. Die Monumentalisierung eines Menschen
Die große Komposition: Exodus – Wüste – Sinai
Mose und die Frage der Macht
2. Die Menschlichkeit eines Menschen
Sinnlichkeit und Sittlichkeit: Thomas Mann
Mühselige Erziehung des Menschengeschlechts
3. Im Widerstand gegen die Berufung
Mose wehrt sich gegen Gott
Das Volk wehrt sich gegen die Moral
Nie wieder einer wie Mose
II. Mit dem Gott gesprochen hat: Mose im Koran
1. Mohammed als neuer Mose
»Ist die Geschichte des Mose zu dir gekommen«?
Ein Lebensmuster füllt sich
Das schmerzlich erlebte Paradox
2. Prophet gegen Pharao
Gottes prekärer Auftrag
Theozentrische Angstüberwindung
Wider die Verblendung der Mächtigen
Wie Gott seine Macht demonstriert
Konflikte mit dem eigenen Volk: die Rolle Aarons
3. Befreiung aus den Fängen der Macht
Pharao als verblendeter Götze: Sure 26
Machtkampf in Mekka im Spiegel der Mose-Suren
Pharao als größenwahnsinniger Despot: Sure 40
Rettung aus Unterdrückung: Sure 28
Mose als fehlbarer, bedürftiger Mensch
Orientierung Jerusalem: Richtung des rituellen Gebets: Sure 10
4. Empfänger göttlicher Weisungen
Ein Land für die unterdrückten »Kinder Israels«
Mose als Fürsprecher des Volkes bei Gott
Eine erschütternde Begegnung mit Gott
5. Eine Lebensordnung für die Menschen: Sure 2
Im Konflikt mit den Juden Medinas
Die »Zehn Gebote« auch im Koran?
6. Der biblische und koranische Mose im Vergleich
Die Himmelfahrt Mohammeds und ein Gespräch mit Mose
Muslime errichten Mose ein Grab
Fünfter TeilJosef und seine Brüder: Entfeindungsgeschichten in Bibel und Koran
I. Eine Segensgeschichte trotz allem: der Josef der Bibel
1. Vom Fruchtbarkeitsdrama zum Familiendrama
Die Dramatik einer Geschichte
Ein glänzendes Stück Literatur
2. Israel in Ägypten: Erfahrungen mit dem Fremden
Die Stämme sollen ein Volk werden
Ein nichtkonfrontatives Ägypten-Bild
Josef – Muster gelungener Integration
Wann und wo ist die Geschichte entstanden?
3. Eine biblische Entfeindungsgeschichte
Trotz und in allem: Gottes Segen auf Josef
Josefs Tränen: Wandlung vom Rächer zum Bruder
Gottes Segen für Ägypter und Ägypten
Josef – der Gegen-Hiob
Der spirituelle Kern: Vergebung statt Vergeltung
II. Ein Zeichen für die, die fragen: der Josef des Koran
1. Eine Geschichte – zwei Fassungen
Parallele Grundstrukturen
Prosastücke hier – dramatische Szenen dort
Vergeschichtlichung hier – Entgeschichtlichung dort
Der ahnungslose und der ahnungsvolle Jakob
Der erschütterte und der unerschütterte Vater
2. Das Profil der koranischen Geschichte
Die Verführungsszene: Entlastung Josefs
Ein Seitenblick: Jusuf und Suleika
Die Damengesellschaft: Entlastung der Ägypterin
Traumdeutung der Mitgefangenen
Der König und die alte Frauengeschichte
Der Trieb zum Schlechten: Josefs Geständnis
3. Eine koranische Entfeindungsgeschichte
Eine Segens- und Glücksgeschichte – trotz allem
Einüben von »schöner Geduld«
Spiegelung der Konflikte in Mekka
Vorwegnahme des Prophetenkampfes
Der spirituelle Kern: Statt Vergeltung Vergebung
In Josef und seinen Brüdern liegen Zeichen
Sechster TeilMaria und Jesus: Zeichen Gottes für alle Welt
I. Johannes – ein Prophet
1. Noch einmal: die koranische Grundbotschaft
2. Die wundersame Geburt des Johannes: Mekka, Sure 19
3. Der lukanische und koranische Johannes im Vergleich
4. Der »Fall Johannes« – in Medina kritisch neu gelesen: Sure 3
5. Kein »Vorläufer«, Parallelfigur Jesu
II. Maria – Gottes Erwählte
1. Maria als Mutter Jesu: Sure 19
Gottes Geist erscheint Maria
Die lukanische und koranische Geburtsgeschichte im Vergleich
Rückzugsbewegungen Marias – Freiwerden für Gott
Zeugung spirituell, nicht sexuell
Marias Schwangerschaft – wie lange?
Palme und Quellwasser: Maria in Ägypten?
Wiederholung des Hagar-Schicksals
2. Die Geburt und Kindheit Marias: Sure 3
Maria als kritischer Spiegel für Juden
Frühchristliche Parallelen
Marias Erwählung durch Gott
Geistschöpfung und Jungfrauengeburt
Die einzige mit Namen erwähnte Frau im Koran
III. Jesus: Gesandter Gottes – Marias Sohn
1. Die Geburt Jesu als »Zeichen Gottes«: Sure 19
Gezeugt aus der Schöpferkraft Gottes
Ein Trostwort des Neugeborenen an seine Mutter
Was meint: Jesus ist ein »Diener Gottes«
Kein »unseliger Gewalttäter«
Gott nimmt sich kein Kind
In der Reihe der großen Propheten
2. Streit um Jesus: Sure 3
Was die Engel zu Maria über Jesus sagen
Wie der Koran die Wundertaten Jesu deutet
Eine kleine Summe des koranischen Jesusbildes
3. Nicht gekreuzigt, zu Gott erhöht: Sure 4,157
Der Kontext: Im Konflikt mit den Juden Medinas
Ein antichristlicher Angriff?
Kontroverse Auslegungen
Gott bewahrt seinen Gesandten vor dem Schandtod
Kreuzestheologie? Eine Herausforderung für den Dialog
4. Was Muslime und Christen eint und trennt
Jesus – das Zeichen Gottes in Person
Was Christen und Muslime unterscheidet
Wie der Koran Gleichnisse Jesu deutet
Gemeinsame Grundhaltungen vor Gott einüben
Epilog
Kairo, Juni 2009: Präsident Barack Obamas Vermächtnis10 Prinzipien einer Strategie der Entfeindung und Vertrauensbildung
Prinzip I: Selbstkritik im Lichte des je Anderen.
Prinzip II: Selbstkritik als Voraussetzung für glaubwürdige Fremdkritik
Prinzip III: Gemeinsame Interessen definieren
Prinzip IV: Positive Erfahrungen mit »den Anderen« benennen
Prinzip V: Die kulturellen Leistungen der Anderen beachten und achten
Prinzip VI: Partizipation von Muslimen am amerikanischen Leben
Prinzip VII: Gemeinsame Verantwortung in der Weltgesellschaft wahrnehmen
Prinzip VIII: An positive Botschaften aus den Heiligen Schriften erinnern
Prinzip IX: Bausteine eines Menschheitsethos bewusst machen
Prinzip X: Eine religionsübergreifende Dialogpraxis fördern
Jerusalem Mai 2014: Papst Franziskus’ Zeugnis im Geiste abrahamischer Pilgerschaft und Gastfreundschaft
Ein Friedensgebet mit Juden und Muslimen im Vatikan
Vorbild Abraham: Pilgerschaft als Aufbruch
Ein »geistliches Abenteuer«: Geprüftes Gottvertrauen
Zwei Lebensbewegungen im Vergleich: Odysseus und Abraham
Gastfreundschaft wie Abraham gewähren
Was heißt: Abrahamische Spiritualität leben
Chronologische Tabellen der Suren
Literatur
Und noch ein Wort zu diesem Buch
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Worum es geht:Bibel und Koran: Neue Herausforderungen
Dieses Buch ist nicht geschrieben für Bibelspezialisten und Koranexperten. Es ist geschrieben für Menschen, die das interreligiöse Gespräch suchen, oft aber nicht wissen, wo anfangen, wo einsetzen. Da kann ihnen die Tatsache entgegenkommen, dass der Koran, die Heilige Schrift der Muslime, Überlieferungen in großer Breite und Tiefe aufgenommen hat, die Juden und Christen aus ihrem eigenen normativen Schrifttum vertraut sind. Warum das so ist, warum und mit welchem Ziel solche Überlieferungen im Koran weder ignoriert oder gar polemisch verworfen, sondern integriert und zugleich weiter und neu gedeutet werden, davon zu berichten, ist Absicht dieses Buches. Wir wollen einen Prozess der Begegnung verfolgen, bei dem Altes auf Neues trifft, will sagen: bei dem jüdische und christliche Überlieferungen in einem anderen Kulturraum Jahrhunderte später nicht nur aufgenommen, sondern als Herausforderung begriffen werden, als Katalysator zur Ausbildung einer eigenen Glaubensidentität.
Originell ist die Fragestellung selber nicht. Forschungsgeschichtlich aber muss man dabei schon weit zurückgreifen, um an Arbeiten mit ähnlichem Interesse anknüpfen zu können. Das gilt insbesondere für Abraham Geiger (1810–1874), den Begründer der Wissenschaft des Judentums zu Beginn des 19. Jahrhunderts, und seine 1833 erschiene Preisschrift »Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen« (Neudruck mit einem Vorwort von Friedrich Niewöhner 2005), eine kleine, aber höchst materialreiche Studie, in der erstmals in dieser Weise der Einfluss biblischer und vor allem nachbiblisch-rabbinischer (»haggadischer«) Traditionen auf den Koran nachgewiesen wird. Das gilt auch für Josef Horovitz (1874–1931), von 1915 bis zu seinem Tod Professor für Semitische Sprachen am Orientalischen Seminar der Universität Frankfurt am Main, und seine 1926 erschienenen »Koranischen Untersuchungen«, eine bahnbrechende Arbeit zur biblischen, nachbiblischen und altarabischen Vorgeschichte des Koran unter Heranziehung epigraphischer Zeugnisse in den verschiedenen Sprachen der Arabischen Halbinsel. Und das gilt schließlich auch für die monumentale Studie »Biblische Erzählungen im Qoran«, die einer der brillantesten, aber leider ebenfalls viel zu früh verstorbenen Schüler von Horovitz, Heinrich Speyer (1898–1935), 1935 erstmals vorgelegt hat (Neudruck 1961). Da er jüdischer Herkunft ist, muss sein Werk, um überhaupt während der NS-Zeit erscheinen zu können, auf das Jahr 1931 zurückdatiert werden.
Dieses bis heute unübertroffene Quellenwerk kann die Einseitigkeit von Geigers Studie korrigieren, indem es zeigt, dass der Koran über alttestamentlich-jüdische hinaus auch christliche, gnostische und altarabische Einflüsse erkennen lässt, ohne dass Speyer diese in den Kontext der entsprechenden Suren oder in ein zeitgeschichtliches Szenario eingebettet hätte. Bezüge werden hergestellt, Quellen namhaft gemacht, Parallelen als »Übernahmen« ausgewiesen. Darin besteht die einzigartige Leistung dieses großen deutsch-jüdischen Forschers. Zugleich aber lässt Speyers Darstellung massive Wertungen erkennen. Mohammed habe »vieles missverstanden«, kann er zusammenfassend schreiben, »oft ähnlich lautende Berichte und Namen miteinander verwechselt oder verquickt und nicht Weniges missbilligt« (1961, 462). Ab-Wertungen dieser Art markieren die Grenze dieser bewundernswürdig gelehrten Arbeit. Weitere Einzelheiten zu Geiger, Horovitz und Speyer enthalten die lebens- und werkgeschichtlichen Beiträge in dem höchst instruktiven Band »›Im vollen Licht der Geschichte‹. Die Wissenschaft des Judentums und die Anfänge der kritischen Koranforschung«, hg. von Dirk W. Hartwigu. a., 2008).
Die heutige englisch- und deutschsprachige Forschung knüpft zwar an die drei genannten Arbeiten an, deutet aber das Verhältnis Bibel-Koran mit anderen Methoden und Interessen. Nicht mehr wertend entweder nach einer Defizithermeneutik (wie in christlicher Tradition) oder nach einer Überbietungshermeneutik (wie in muslimischer Tradition), sondern nach einer (wenn man so will) Alteritätshermeneutik. Will sagen: Der Koran wird nicht länger von der Bibel als exklusivem Maßstab her als »verzerrend«, »missverstehend« oder »defizitär« abgewertet und umgekehrt wird die Bibel nicht länger vom Koran als exklusivem Maßstab her für zum Teil verdorben und missverstanden erklärt, vielmehr werden beide zunächst in ihrer je eigenen Integrität respektiert und in ihrer »Andersheit« zu verstehen gesucht. Wie viel ist in der Vergangenheit an Polemik auf beiden Seiten investiert worden mit dem wechselseitigen Vorwurf des verzerrten, missverstehenden, willkürlich auswählenden Bibel- und Koranverständnisses. Der Prophet Mohammed habe Biblisches irgendwo auf seinen Reisen mitbekommen, missverstanden, verzerrt oder falsch wiedergegeben. So haben sich Christen die Abweichungen von ihren eigenen normativen Überlieferungen im Koran erklärt. Und umgekehrt: Die »Leute der Schrift«, Juden und Christen, hätten die Botschaft des letzten Gesandten Gottes deshalb abgelehnt, weil sie ihre eigenen Heiligen Schriften missverstanden, verzerrt wiedergegeben oder falsch ausgelegt hätten. Diese sind jetzt durch den Koran überholt und ersetzt (mehr dazu: Erster Teil, Kap. 1). Mit dieser Tradition der wechselseitigen religiösen »Maulkämpfe« (H. Heine), welche den je Anderen entweder gering schätzt oder triumphal zu überbieten trachtet, gilt es Schluss zu machen.
Für unvoreingenommene Leser/innen ist der Koran der Bibel nicht unterlegen oder umgekehrt der Bibel überlegen, sondern anders. Bibel und Koran sind Ur-Kunden mit je eigenem Profil und unverwechselbarer Autorität (mehr dazu: Erster Teil, Kap. 6: Zehn Voraussetzungen für einen Dialog Bibel–Koran). Man muss sich schon die Mühe machen, diese jeweilige Andersheit in ihrer je eigenen Komplexität zu verstehen, bevor dann in der Begegnung mit anderen Glaubenszeugnissen und Glaubensüberzeugungen eine argumentative Auseinandersetzung beginnen kann und beginnen darf, die zu einer begründeten Glaubensentscheidung herausfordert oder die eigene Glaubensentscheidung auf den Prüfstand stellt. Verstehenwollen der Andersheit des je Andern ist somit die Grundvoraussetzung für einen Dialog, bei dem jede Seite von der Erwartung getragen wird, dass im jeweiligen Gegenüber Fähigkeit und Bereitschaft vorhanden ist, diese Andersheit so umfassend wie möglich zu verstehen, bevor das eigene Glaubenszeugnis ins Spiel kommt. Drauflosbekennen ohne gründliche Kenntnisse vom je anderen ist kein Beitrag zum Dialog, sondern monologische Selbstbeschwörung mit dem Rücken zum je Anderen.
Forschungen zu Bibel und Koran sind heute in Bewegung geraten. So hat der an der University of Notre Dame lehrende amerikanische Islamwissenschaftler Gabriel Said Reynolds 2010 eine viel beachtete Studie unter dem programmatischen Titel »The Qur’an and Its Biblical Subtext« vorgelegt. Ihm geht es nicht länger um Quellen »hinter« dem Koran, sondern allein um den Text, dessen literarischer Stil höchst »allusive«, höchst »anspielungsreich« sei. Der Koran scheine, so Reynolds, nirgendwo direkt biblische oder andere Texte zu zitieren, stattdessen spiele er auf sie an, indem er gleichzeitig seine eigene religiöse Botschaft entwickle. Entsprechend wird der Koran verstanden als ein »Teil einer dynamischen und komplexen literarischen Tradition, nicht gekennzeichnet durch direkte Anleihen, sondern durch Motive, Topoi und Exegese« (S. 36). Die Schlüsselfrage dieser Studie ist somit nicht länger, was durch außerkoranischen Quellen in den Koran »übernommen« wurde, sondern »die Natur der Beziehung zwischen dem koranischen Text und seinem jüdischen und christlichen Subtext«. Deshalb sollte ein Studium des Koran »wach« sein »für das Gespräch, das der Koran mit früheren Texten führt, insbesondere für das vertraute Gespräch mit biblischer Literatur« (S. 36).
Dieser Wachheit ist auch Sidney H. Griffith verpflichtet, lange Jahre Professor für Early Christian Studies an der Catholic University of America in Washington D, C., als er 2013 seine Forschungen in seinem wegweisenden Buch »The Bible in Arabic« zusammenfasst und darin präzise zeigt, welche Bedeutung die Schriften der »Leute des Buches« (so die koranische Bezeichnung für Juden und Christen) in der Sprache des Islam gehabt haben: »Die Schriften von Juden, Christen und Muslimen«, schreibt Griffith, »sind miteinander verflochten (»intertwined«), nicht so sehr textlich, denn es gibt kaum irgendwelche Zitate der Bibel im Koran. Vielmehr sind sie verflochten in der Erinnerung an Erzählungen der Hebräischen Bibel im Neuen Testament, zusammen mit einigen Zitaten; in der Erinnerung an prophetische und apostolische Figuren der Tora, der Psalmen und des Evangeliums im Koran« (S. 214). Unter Bezugnahme auf das Werk von Reynolds (»Subtext«) versucht Griffith nachzuweisen, dass »die Haltung des Koran in Bezug auf die Bibel« oft »die eines Suchers nach schriftgestützter Garantie« ist, »indem man biblische Geschichten zitiert und Erinnerungen an prophetische Figuren evoziert mit dem Ziel, eine sehr entschiedene islamische Prophetologie zu favorisieren« (S. 26. Eig. Übers.).
Auch innerhalb der deutschsprachigen Forschung sind neue Ansätze entstanden. So setzt die an der Berliner Humboldt-Universität lehrende Arabistin und Koranwissenschaftlerin Angelika Neuwirth bei ihren umfangreichen Koranstudien ebenfalls text- und literaturwissenschaftlich an, bei Fragen der Textgenese, der literarischen Formen sowie der rhetorischen und stilistischen Mittel koranischer Selbstbehauptung in einem komplexen multikulturellen und multireligiösen Umfeld. Deutlicher und direkter als andere erklärt Neuwirth, der Koran sei bei aller unvergleichlichen inhaltlichen und sprachlichen Eigenständigkeit ein Text, »der wie die jüdischen und christlichen Grundschriften fest in der biblischen Tradition wurzele« (Koranforschung – eine politische Philologie, 2014, 1), ja, »das gesamte Corpus« sei »ein durch und durch biblisch durchwirkter Text« (S. 4). Das sind neue Töne in der Forschung, die wir wohl beachten wollen. Sie haben mit der alten Apologie, der Koran sei im Vergleich zur Bibel ein »epigonaler« Text, nichts mehr zu tun. Sie werden gestützt durch umfassende historischen Forschungen zum zeitgeschichtlichen Kontext des Koran, dokumentiert in dem monumentalen Quellenwerk des in New York lehrenden amerikanischen Historikers Robert G. Hoyland »Seeing Islam as Others Saw it. A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam« (1997), aufgeschlüsselt in Beiträgen umfangreicher Sammelbände wie »The Qur’an in its Historical Context«, herausgegeben von dem schon genannten amerikanischen Islamwissenschaftler Gabriel Said Reynolds (2008) oder »The Qur’an in Context« (2010), herausgegeben von Angelika Neuwirth, Nicolai Sinaiund Michael J. Marx.
Dabei setzen diese Forschungen ein Dreifaches voraus:
Erstens: In der Welt der ersten Hörer (Arabische Halbinsel Anfang des 7. Jahrhunderts) muss vor der koranischen Verkündigung ein »umfassender Wissenstransfer« stattgefunden haben, so dass »ein breites Spektrum biblischer und postbiblischer Traditionen der Hörerschaft Mohammeds bereits vertraut« gewesen ist (A. Neuwirth, Koranforschung, 2014, 9).
Zweitens: Das Aufgreifen biblischer Überlieferungen ist mehr als ein »Übernehmen« und »Verarbeiten«, es ist Ausdruck einer »live interaction zwischen dem Verkünder und seinen Hörern«. Der Koran ist nicht in einem luftleeren Raum entstanden. Seine ersten Hörer sind noch keine Muslime, was sie ja erst durch die Verkündigung des Propheten werden sollen. Sie sind »am ehesten als Individuen vorzustellen, die synkretistisch akkulturiert und in verschiedenen spätantiken Traditionen gebildet waren« (ebd., 8). Auf diese ihre gesellschaftlichen, kulturellen und geschichtlichen Prägungen reagiert der Koran und profiliert an ihnen seine spezifische Botschaft.
Drittens: Der Sprachgebrauch »die Bibel« im Koran ist ungenau und bedarf der Differenzierung. Denn die koranische Verkündigung setzt im 7. Jahrhundert ganz offensichtlich zwei Arten von Bibel voraus: eine durch die Rabbinen weitergedeutete jüdische Bibel und eine durch die Kirchenväter und die gesamtkirchlichen Konzilsbeschlüsse weitergedeutete christliche Bibel. Deren narratives Potential wird nicht einfach »übernommen«, sondern ausführlich verhandelt. Entsprechend reflektiert der Koran »den Prozess rigoroser Prüfung, Revision und letztendlich Supersession von grundlegenden jüdischen und christlichen, aber auch paganen Traditionen« (ebd., 9). Es ist somit »gerade die Bibel« gewesen, »deren Sinnpotential die koranische Gemeinde – durch einen langen Prozess der Verhandlung und partiellen Aneignung – in Stand setzte, ihre eigene Identität zu konstruieren – wie auch die christliche Religionsgemeinschaft sich zu ihrer Zeit aufgrund ihrer besonderen Bibellektüre eine neue Identität erschlossen hatte. Diese Identitätsbildung scheint aber im Fall der koranischen Gemeinde unter so verschiedenen Umständen geschehen zu sein, dass man von einer ›doppelten Bibelrezeption‹ sprechen muss« (ebd., 9).
Auch wir gehen in dieser Studie davon aus: Die Bibel tritt im Koran immer schon als »interpreted Bible« (S. H.Griffith) in Erscheinung. Denn der Koran ist kein einsam-erratischer Block in einer ansonsten buchstäblich wüstenleeren Landschaft, kein Text ohne Kontext, sondern muss, unbeschadet seiner Entstehung in einem Randgebiet der damaligen Welt, als Antwort unter anderem auch auf christliche und jüdische Herausforderungen seiner Zeit verstanden werden, als lebendiges, »polyphones Religionsgespräch«, ja als »Argumentationsdrama« (A. Neuwirth), das sich zwischen der muslimischen Gemeinde und den Vertretern der übrigen Traditionen abgespielt hat. Sind doch in der Tat im Koran zahlreiche biblische und nachbiblische Überlieferungen nicht nur »gespeichert« oder »übernommen«, sondern neu zum Leuchten gebracht. Neues Leben ist ihnen eingehaucht worden. Ein Doppelnarrativ lässt sich von daher rekonstruieren: Die koranische Verkündigung setzt zunächst dem lokal ererbten Selbstverständnis der Hörer ein neues, biblisches auf und stößt damit eine »Biblisierung« des arabischen Denkens an. Zugleich aber kehrt sie den Prozess wieder um und leitet eine »Arabisierung« oder »Islamisierung« biblischer Vorstellungen ein.
Das wird auch von anderen deutschen Forschern heute schärfer als früher gesehen. So erscheint für den Göttinger Islamwissenschaftler Tilmann Nagel der Koran »als ein Beleg für eine mannigfaltige religiöse Umwelt, in der unter anderem der besagte Erzählstoff in jüdischem, christlichem und heidnischem Milieu tradiert sowie charakteristischen Umbildungen unterzogen wurde, die wir im Koran und in der frühislamischen Literatur wiederfinden« (Der Koran und sein religiöses und kulturelles Umfeld, 2010, VII). Und auch der Jenaer Religionswissenschaftler Bertram Schmitz geht davon aus, dass die biblischen Geschichten zum »Grundwissen« der damaligen Hörer gehört haben müssen. Das erlaube es dem Koran, »sich häufig mit Anspielungen, Hinweisen und Stichworten zu begnügen, die bei den Hörern den jeweiligen Sachverhalt ins Gedächtnis rufen. Diese als selbstverständlich vorausgesetzte Kenntnis erlaubt es, mit den Motiven der biblischen Religionen gewissermaßen ›zu spielen‹, sie neu zu deuten, Wortspiele und Anklänge zu verwenden, gar sie zu ›persiflieren‹ … Gerade dieser letzte Punkt setzt jedoch eine möglichst weitgehende Kenntnis der jüdischen und christlichen biblischen Literatur voraus wie auch der außerkanonischen und der theologischen Literatur beider Religionen (also auch Kirchenväter und christliche Auslegungswerke einerseits, Talmud und Midraschim für das Judentum andererseits) bis zum 7. Jahrhundert sowie die Bereitschaft, sich auf Form, Stil und Denken des Qurans einzulassen« (Der Koran und sein religiöses und kulturelles Umfeld, 2010, 219).
In der Tat werden wir zeigen können: Biblische Überlieferungen werden so vermittelt, dass sie zu aktualisierten Spiegel- und Gegengeschichten werden für den durch den Verkünder angestoßenen und jahrelange hin und her wogenden Kampf zwischen altem und neuem Glauben. Durch narrative oder dramatische Reinszenierung jüdisch-christlicher Überlieferungen steht am Ende etwas unverwechselbar Eigenes: eine arabisch-muslimische Glaubensidentität unter Neu- und Weiterdeutung uralter Überlieferungen aus der Welt von Judentum und Christentum. Wie ist das alles zu erklären? Was fangen Menschen, die zwischen 610 und 632 auf der Arabischen Halbinsel leben, in Mekka und Medina zu Hause sind, mit Überlieferungen an, die weder aus ihrer Geschichte noch ihrer Gesellschaft noch ihrer Religion stammen? Die sie ohne Textstütze nur aus mündlichen Überlieferungen gekannt haben können, gab es doch im 7. Jahrhundert noch keine arabische Bibelübersetzung (mehr dazu: Erster Teil, Kap. 4: Ein städtisch-multireligiöses Milieu). Mekka, Jerusalem und zurück. Einen gewaltigen geistigen Transfer verlangt der Koran von ihnen. Im Interesse des Erwerbs interreligiöser Gesprächsbereitschaft und -fähigkeit fühlen wir uns herausgefordert, diesen Transfer nachzuvollziehen und für das heutige interreligiöse Gespräch fruchtbar zu machen.
Wir lassen uns dabei von einem Vers des Koran motivieren: »Ihr Menschen«, heißt die Aufforderung in Sure 49,13: Md1, »wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennt. Der Edelste vor Gott ist der unter euch am gottesfürchtigsten ist.« Im Koran ist damit diejenige Überzeugung bekräftigt, die zur Grundvoraussetzung jeder dialogischen Begegnung von Menschen unterschiedlichen Glaubens gehört: Alle Menschen ohne Unterschied der Rasse, der Klasse, der Nation oder des Stammes sind vom Ursprung her Teile der einen Menschheitsfamilie. Diese »Gleichheit des biologischen Ursprungs«, so ein heute maßgeblicher muslimischer Korankommentar zur Stelle, spiegelt sich »in der Gleichheit der menschlichen Würde« (Asad, 980). Will sagen: Allen äußerlichen Unterscheidungen liegt die wesentliche Einheit aller Menschenwesen zugrunde. Sie begründet den Auftrag, einander nicht zurückzustoßen oder zu beherrschen, sondern kennenzulernen – durch wechselseitige Bereitschaft, einander zu begegnen und voneinander zu lernen. Welch ungeahnte Folgen das haben kann, zeigt eindrücklich eine Szene, die im Mittelpunkt des folgenden Prologs steht. Sie hat es verdient, in Erinnerung zu bleiben.
Prolog:»Wir Kinder Abrahams«: Helmut Schmidt trifft Anwar as-Sadat 10 Erkenntnisse im Interesse des Dialogs der Religionen
»Sadat glaubte, dass Frieden Gottes Wille sei; er glaubte an das Gebot des Islam, eine gerechte und tolerante Gesellschaft zu errichten. Und Sadat beharrte darauf, dass Araber und Juden Brüder seien, Söhne Abrahams, die von Ismael und Isaak abstammten, und dass sie miteinander versöhnt werden sollten.«
Jehan Sadat, Meine Hoffnung auf Frieden, 2009
Wer sich zu Abraham bekennt, wendet sich – nolens volens – den jüdischen Wurzeln zu. Der Islam tut das in einem elementareren Sinn als das Christentum, indem er behauptet, die Religion Abrahams wiederhergestellt zu haben. Für das Christentum ist Abraham von großer Bedeutung wegen der Verheißung, die er empfangen hat und die besagt, dass in ihm alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Das Wort Gottes bleibt in Kraft. Auf welchem Wege verwirklicht sich die Verheißung? Für das Christentum ist Jesus der Abrahamssohn schlechthin, weil es in ihm die Verheißung verwirklicht sieht. Was bedeutet das für das Verhältnis des Christentums zu Judentum und Islam? Zumindest dies: im Judentum seine Wurzeln zu erkennen und im Islam jene zu sehen, die als Kinder Ismaels auch am Segen Abrahams teilhaben sollen.«
Joachim Gnilka, Bibel und Koran, 2004
»Aufklärung beginnt damit, den Menschen von den gemeinsamen Wurzeln der Religionen zu erzählen. Wenn ihnen die Gemeinsamkeiten bewusst gemacht werden, werden sie auch nicht mehr ununterbrochen Krieg miteinander führen. Der Frieden in der Welt hängt in hohem Maße davon ab, dass die Führer der Weltreligionen ihre Verantwortung für den Frieden wahrnehmen und dass sie ihre Gläubigen zu gegenseitigem Respekt und zur Toleranz aufrufen.«
Helmut Schmidt, Was ich noch sagen wollte, 2015
Ich steige ein mit einer Geschichte, die ich nicht vergessen kann, seit ich ihr zum ersten Mal begegnet bin. Erzählt hat sie unserer früherer Bundeskanzler Helmut Schmidt, der am 11. November 2015 in einem wahrhaft »biblischen« Alter von 96 Jahren verstorben ist. Es geht um die Begegnungen eines Mannes aus dem Westen mit einem bekennenden Muslim: dem damaligen ägyptischen Staatspräsidenten Anwar as-Sadat (1918–1981). In seinen »Erinnerungen und Reflexionen« unter dem Titel »Weggefährten« hat Helmut Schmidt sie 1996 öffentlich gemacht und die Wirkungen dieses Treffens in einem Kapitel mit dem programmatischen Titel »Wir Kinder Abrahams« ausführlich beschrieben. Ein Schlüsselerlebnis zum Thema »Judentum, Christentum und Islam als Faktoren einer Weltfriedenspolitik«. So prägend für den damaligen Bundeskanzler, dass Helmut Schmidt bei ungezählten anderen Gelegenheiten immer wieder darauf zurückkommt. Verwiesen sei nur auf seine beiden Sammelbände »Außer Dienst. Eine Bilanz«, 2008 (Teil VI: Religion, Vernunft, Gewissen) sowie »Religion in der Verantwortung. Gefährdungen des Friedens im Zeitalter der Globalisierung« von 2011. In mehr als einem Kapitel dieser beiden Bücher ist immer wieder aufs Neue von der Begegnung mit Sadat die Rede. »Ich werde nie ein stundenlanges Gespräch vergessen«, so etwa beginnen diese besonderen Erinnerungen. Oder: »Und während wir die Sterne am Himmel betrachteten, erklärte Sadat mir die gemeinsame Herkunft der drei monotheistischen Religionen«. Oder: »Mein persönliches Interesse am Islam und der Förderung des Dialogs wurde von Präsident Sadat entfacht«. Oder: »Dank Sadat las ich später im Koran, in der Bibel«. Hier bestätigt sich aufs Schönste, was Martin Buber (1878–1965) einmal in den Satz gefasst hat: »Alles wirkliche Leben ist Begegnung« (zu Buber: K.-J. Kuschel, Martin Buber – seine Herausforderung an das Christentum, 2015).
»Alles wirkliche Leben ist Begegnung«
Doch all diese Erinnerungen an Sadat stehen ausschließlich in einem interreligiösen und friedensethischen Zusammenhang. An keiner Stelle analysiert Helmut Schmidt die innerpolitische Rolle Sadats, die auch bei Nichtislamisten umstritten ist. Man lese als Gegengewicht den sehr persönlichen Lebensbericht des ägyptischen Islamwissenschaftlers Nasr Hamid Abu Zaid (1943–2010), der sich wegen seiner Koranauslegung nach heutigen hermeneutischen, sprachwissenschaftlichen und kommunikationstheoretischen Methoden den Vorwurf der Apostasie, des Glaubensabfalls vom Islam, zugezogen hatte. Das hatte unter anderem zur Folge, dass 1995 ein ägyptischer Richter seine Ehe mit einer Muslimin zwangsweise (will sagen: gegen seinen und seiner Frau Willen) für aufgelöst erklärt. Ein Nichtmuslim dürfe nicht mit einer Muslimin verheiratet sein. Ein Fall, der international für Empörung gesorgt hatte. Abu Zaid hatte Ägypten verlassen müssen, hatte aber an der Universität im holländischen Leiden weiterhin Islamwissenschaft lehren können.
In Ägypten hatte Abu Zaid miterlebt, wie Sadat 1970 nach dem überraschend frühen Tod von Präsident Gamal Abdel Nasser (1918–1970) als dessen Vizepräsident an die Macht gekommen war. Miterlebt, wie er 1972 in einem kühnen Schritt ca. 17 000 von seinem Vorgänger ins Land geholte sowjetische Militärberater ausgewiesen und 1973 mit der Armee gegen Israel militärisch einen Teilerfolg erzielt hatte. Miterlebt, wie Sadat sich politisch-ökonomisch dem Westen angenähert und die Nassersche sozialistische Planwirtschaft nach sowjetischem Vorbild durch einen privatwirtschaftlichen Kapitalismus abgelöst hatte. Miterlebt, wie 1977 auf Grund des Abbaus staatlicher Subventionen für Basisgüter die schwersten Unruhen in Ägypten seit der Revolution von 1952 ausgebrochen waren, später bekannt unter dem Titel »Brotunruhen«. Aber auch miterlebt, wie Sadat als Gegengewicht gegen seine innerägyptischen Gegner, die Nasseristen und Sozialisten, die bisher verfolgten und vielfach eingekerkerten Muslimbrüder aufgewertet hatte. 1980 hatte er sogar eine Verfassungsänderung zugelassen, der zufolge jetzt die Scharia die Hauptquelle des ägyptischen Rechts bildet. Abu Zaid? Er hatte die Folgen hautnah zu spüren bekommen. Für ihn ist klar: Es ist Sadat gewesen, der die politische Islamisierung Ägyptens gefördert und dessen Weiterentwicklung zu einem modernen, laizistisch-pluralistischen Staat blockiert hat. Als es dann 1981 zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und koptischen Christen kommt, wird Sadat dies zum Anlass nehmen, 1 500 Oppositionelle verhaften zu lassen, darunter linke Intellektuelle, koptische Geistliche, führende Muslimbrüder, aber auch Journalisten und Politiker.
Kurz: Sadat zu idealisieren, wäre ganz falsch. Ein Heiliger ist auch er nicht. Umgekehrt haben Abu Zaids persönlichen Erfahrungen mit dem Scharia-Gericht seinen Blick auf die Politik Sadats gänzlich verdüstert und ihn zu dem zynischen Pauschalurteil veranlasst, Sadat sei »ein Meister« darin gewesen, »die Religion für die politischen Ziele zu instrumentalisieren und mit ihren Symbolen in der Öffentlichkeit umzugehen«. Auch einen Seitenhieb auf die westliche Wahrnehmung Sadats kann sich dieser Kritiker nicht verkneifen: »In ihrer Haltung zu Sadat zeigten die westlichen Medien wieder einmal, dass sie im anderen nur die Facette sehen, die ihren Interessen entspricht. Aus westlicher Sicht war Sadat ein Staatsmann, der den Frieden wollte. Was er in Ägypten tat, interessierte niemanden. Niemand im Westen hat bemerkt, dass Sadat den religiösen Extremismus gefördert und den Frieden mit Israel erst nach den Hungerrevolten vom Januar 1977 entdeckt hatte« (Ein Leben mit dem Islam, 2001, 163).
Frieden mit Israel. Dass für Helmut Schmidt als einem in internationalen Verflechtungen denkenden Politiker dies das Entscheidende im Fall Sadat ist, leuchtet ebenfalls sofort ein. Er sieht Sadat vor allem aus der Perspektive der Außenpolitik, dies aber in einem gesamtstrategischen und geschichtlichen Zusammenhang. Wie sehr musste ihm, gerade als deutschem Politiker, angesichts der deutschen Geschichte an Frieden von Israel mit seinen arabischen Nachbarn gelegen sein! Und diese seine besondere Sensibilität für Verantwortung gegenüber der deutschen Geschichte prägt auch Schmidts Einstellung zu den Kirchen und zur Religion generell, wie die Studie von Rainer Hering über »Helmut Schmidt, die Kirchen und die Religion« 2012 eindrucksvoll belegt. Dabei sind Schmidts persönliche Begegnungen mit Sadat von besonderer Bedeutung. Es ist ja auch die ganz ungewöhnliche Geschichte eines christlich geprägten Deutschen und Europäers mit einem Ägypter und Afrikaner, der muslimisch geprägt ist.
Und diese Geschichte handelt vom Koran und dem Gemeinsamen und Trennenden der Religionen, ist aber erstens nicht von einem Religionsvertreter erzählt, sondern von einem Mann der international ausgerichteten praktischen Politik, zeigt zweitens geradezu modellhaft, dass konkrete Begegnungen grundlegende Veränderungen im Leben eines Menschen auslösen können, demonstriert drittens anschaulich, was interreligiöses Lernen im besten Sinn des Wortes bewirken kann und macht viertens klar, dass es einen unlösbaren Zusammenhang gibt zwischen Weltfrieden und Religionsfrieden. Interreligiöses Lernen ist kein Luxus, sondern ein unverzichtbares Postulat heutiger internationaler Friedensarbeit. Ich will bewusst diese Geschichte aufbewahren, gerade weil die politische Lage im Nahen Osten nach wie vor abgründig ist, viele Friedensinitiativen gescheitert sind und rund um Israel gegenwärtig die Hölle los ist. Die Schmidt-Sadat-Geschichte aber ist eine Geschichte des Gelingens und der Hoffnung. Sie hält in mir den Glauben wach, dass die Friedensglut unter der Asche verbrannter Hoffnungen immer noch glimmt. Und diese Glut will ich mit Helmut Schmidt am Leben halten.
Die Urerfahrung: Eine Nachtfahrt auf dem Nil
Der Hintergrund? Im Herbst 1977 hatte Sadat seine damals sensationelle Friedensreise nach Israel angetreten. Am 20. November hatte er vor dem israelischen Parlament, der Knesset, gesprochen. Ende Dezember 1977 war es dann in Ägypten zu einem Treffen zwischen Schmidt und Sadat gekommen, beide seit 1974 bzw. 1970 im Amt. Und dieses ihr Zusammentreffen hatte über das übliche Diplomatische hinaus unerwartete Konsequenzen. Ich dokumentiere Helmut Schmidts Text von 1996 zur Gänze, ziehe nach Sinnabschnitten Nummerierungen ein (A 1–10), um ihn so unter Heranziehung späterer Paralleltexte nachvollziehbarer interpretieren zu können. Der Text lautet:
(1) Einmal führten wir in Ägypten mehrere Tage lang ein Gespräch über religiöse Fragen. Wir fuhren zu Schiff nilaufwärts, schließlich bis nach Assuan. Die Nächte waren völlig sternenklar. Wir saßen stundenlang an Deck, hatten Unendlichkeit und Ewigkeit über uns und sprachen über Gott. Das Gespräch machte einen so tiefen Eindruck auf mich, dass ich Tag für Tag ein paar Notizen über Sadat Ausführungen niederschrieb. Hier sind sie, allerdings in meinen Worten und in meiner Reihenfolge.
(2) Die monotheistischen Religionen, so erklärte Sadat, haben ihre gemeinsamen geschichtlichen Wurzeln auf dem Sinai. Vielleicht reicht ihre Vergangenheit aber noch weiter bis weit in das ägyptische Alte Reich zurück, möglicherweise bis zu Osiris; vielleicht auch nur bis zu Echnaton (das ist Pharao Amenophis IV. im 14. Jahrhundert vor Christus, dessen Gemahlin Nofretete war), der den ursprünglichen Monotheismus wiederbeleben wollte. Der in den heiligen Schriften bezeugte Ursprung des Glaubens an den alleinigen Gott liegt allerdings bei Abraham, der ungefähr im gleichen Zeitalter gelebt haben muss wie Echnaton. Sowohl die Juden und Christen als auch die Muslime glauben, von Abraham abzustammen. Abraham (oder arabisch Ibrahim) gilt im Koran als ›Vater des Glaubens‹.
(3) Der erste der ganz großen gemeinsamen Propheten der Juden, der Christen und der Muslime war aber Moses, der am Berge Sinai die Gesetze (die zehn Gebote) aus Gottes Hand empfangen hat. Wir alle berufen uns auf ihn; übrigens ist Moses ein ägyptischer Name. Der Koran hat auch die meisten anderen Propheten des Alten Testamentes anerkannt: Noah, Abraham, Ismael, Isaak, Jakob, Joshua, David und andere, selbst Adam als allerersten. Ihnen hat sich Gott geoffenbart.
(4) Die Christen haben die jüdische Thora als Altes Testament anerkannt; ebenso der Koran, der überdies das christliche Neue Testament anerkannt hat. Ganz ausdrücklich spricht der Koran an mehreren Stellen von den Völkern der ›Schriftbesitzer‹ und gibt ihnen vor allen anderen Völkern eine bevorzugte Stellung, weil Bibel (Thora), Neues Testament und Koran alle drei den einen einzigen Gott bezeugen. Der Koran heißt die Gläubigen aller drei Religionen, ihren heiligen Schriften treu und gehorsam zu sein. Natürlich schließt das Isa von Nazaret (Jesus Christus) und das Evangelium ein.
(5) Ihr Europäer freilich wisst dies alles nicht. Ihr wisst auch nicht, dass Jesus nach koranischer Auffassung der zweitwichtigste aller Propheten war, nach ihm kam nur noch Mohammed, der steht allerdings über ihm. Freilich haben die Rabbiner, die christlichen Kirchen und auch der Islam vielerlei Keime zu gegenseitiger Feindschaft gelegt. Aber wir müssen jetzt endlich zurückgreifen auf die Gemeinsamkeit unseres Glaubens an den einen Gott. Dann wird der Friede zwischen allen drei Religionen möglich gemacht werden.
Soweit Sadats Gedanken während jener Nachtfahrt nilaufwärts, unter einem Sternenhimmel, wie er bei uns zu Hause eigentlich nur im August vorkommt. Sadats Besuch in Jerusalem lag damals bereits einige Wochen zurück, und natürlich sprachen wir auch darüber sehr ausführlich. Aber in jener Nacht waren die Gemeinsamkeiten der drei großen monotheistischen Religionen die Hauptsache.
(6) Sadat hoffte auf eine große friedliche Begegnung von Judentum, Christentum und Islam. Sie sollte symbolisch auf dem Berge Sinai stattfinden, dem Mosesberg, wie er im Arabischen genannt wird. Dort sollten nebeneinander eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee gebaut werden, um die Eintracht zu bezeugen. Tatsächlich hat Sadat 1979, zwei Jahre nach seiner Jerusalemreise, dort einen Grundstein für die Gotteshäuser gelegt. Als meine Frau und ich 1983 auf Mubaraks [Sadats Nachfolger als Staatspräsident] Einladung das Katharinenkloster besuchten, das seit der Zeit Justinians in grandioser Einsamkeit am Fuße des Mosesberges liegt, hörten wir von den griechisch-orthodoxen Mönchen und von ihrem Abt, Erzbischof Damian, Sadat sei oft zu Meditation und Gebet als ihr Freund dorthin gekommen. Man zeigte mir ein weit abseits gelegenes einfaches Haus, in dem er zu beten und zu schlafen pflegte. Ich habe das als eine posthume Bestätigung meiner längst vorher gewonnenen Überzeugung von der Solidität und Echtheit der religiösen Vorstellungen Sadats empfunden. Zugleich hat es mir einen tiefen Eindruck gemacht, als uns der Abt ein originales Schriftstück zeigte, in welchem der Prophet Mohammed dem christlichen Katharinenkloster seinen Schutz zugesagt hat (später sind andere Schutzbriefe dazugekommen, so von Napoleon und Wilhelm II.).
(7) Sadats Friedenswille entsprang dem Verständnis und dem Respekt vor den Religionen der anderen. Erst von ihm habe ich gelernt, Lessings Parabel von den drei Ringen voll zu begreifen. Sadat hat Lessing wohl kaum gekannt, aber er hat Lessings Mahnung nicht bedurft. Er war Soldat, er hatte Kriege erlebt und sogar geführt – aber jetzt wollte er den Frieden. Für mich waren viele von Sadats religionsgeschichtlichen Darlegungen neu, bei anderen fielen mir die sprichwörtlichen Schuppen von den Augen. Ich habe immer wieder Fragen gestellt; ich habe auch von der Symbiose zwischen Muslimen, Juden und Christen in Córdoba gesprochen. Bisweilen haben wir zu zweit aus dem Gedächtnis Geschichte rekonstruiert. Der Sinai hat seit den Tagen des Moses nicht nur die Ägypter gesehen, die ihn schon seit 5000 Jahren besitzen, er hat Juden, Hyksos, Hethiter, Perser , Römer, Araber, Türken und viele andere erlebt. Alle haben den heiligen Ort respektiert, an dem Moses das Zeichen des brennenden Dornbusches erblickte.
(8) ›So glaube jeder sicher seinen Ring, den echten‹, lässt Lessing seinen Nathan sagen und fährt fort: ›Gewiss, dass der Vater euch alle drei geliebt‹, komme euer Streben ›mit herzlicher Verträglichkeit …, mit innigster Ergebenheit in Gott‹. Ich habe Sadat damals sehr gedrängt, später einmal aus seiner Sicht ein Buch über die drei abrahamischen Religionen zu schreiben; es sollte nicht wissenschaftlich geschrieben sein, sondern so, dass die Völker es verstehen können. Dazu ist es nicht gekommen.
(9) Der Mord am 6. Oktober 1981 setzte allen Vorhaben und Visionen dieses ganz und gar ungewöhnlichen Mannes ein Ende. Er war von einer für Regierungschefs ungewöhnlichen Offenheit gewesen, und niemals vorher oder nachher habe ich mit einem ausländischen Staatsmann derart ausführlich über Religion gesprochen.
(10) Ich habe ihn geliebt. Wir waren bis auf zwei Tage gleichaltrig. Unsere nächtliche Unterhaltung auf dem Nil gehört zu den glücklichsten Erinnerungen meines politischen Lebens. (S. 341–344)
»Alles wirkliche Leben ist Begegnung«? Die Wahrheit dieses Satzes von Martin Buber war nie »wahrer« als bei der hier beschriebenen Szene. Plötzlich die Präsenz eines konkreten Gegenübers. Es ist nicht irgendjemand. Es ist der Präsident eines Schlüssellandes der Nahostpolitik. Soeben hatte dieser ein kühnes Zeichen seines Friedenswillens gesetzt, Voraussetzung für das nur ein Jahr später am 17. September 1978 abgeschlossene Friedensabkommen zwischen Israel unter Ministerpräsident Menachim Begin(1913–1992) und Ägypten im amerikanischen Camp David unter Vermittlung des damaligen amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter (Amtszeit: 1977–1981). Noch aber ist der Frieden in Nahost mehr als brüchig. Und angesichts hasserfüllter Feinde Israels von den Muslimbrüdern im eigenen Land angefangen bis zur PLO unter ihrem damaligem Führer Jassir Arafat (1929–2004) war Sadat mit seiner Friedensinitiative auch ein hohes persönliches Risiko eingegangen. Als »Verräter« war er in und außerhalb Ägyptens verunglimpft worden. Daran hatte auch der Friedensnobelpreis nichts geändert, den Sadat zusammen mit Begin 1978 erhalten hatte. Helmut Schmidt weiß das alles. Er hatte mit Sadat bereits über mögliche Attentate gesprochen. Ein Grund mehr, diesen Mann ob seines Mutes und seiner Tapferkeit Respekt zu zollen und ihm besonders aufmerksam zuzuhören.
Eine einzigartige Stimmung tut ein Übriges: die nächtliche Fahrt auf einem großen Strom (A 1). Jahrtausende hat dieser kommen und gehen sehen. Wiege einer uralten Kultur ist er geworden. Das hat selbst einen ansonsten kühl kalkulierenden und emotional beherrschten Mann hanseatischer Herkunft beeindrucken können. Der besondere Moment berührt auch ihn. Kopf und Herz geraten gleichzeitig in Schwingung. Über sich hat man den nächtlichen Sternenhimmel und damit »Unendlichkeit und Ewigkeit« und drüben an den Ufern zieht eine Jahrtausende alte Geschichte der Religionen und Kulturen vorbei, angefangen von Echnaton und Nofretete bis Abraham, Mose, Jesus und Mohammed. Undenkbar auch, dass bei dem Stichwort »Unendlichkeit und Ewigkeit über uns« Helmut Schmidt, der Liebhaber der Philosophie Immanuel Kants, nicht an den ersten Satz des Schlussworts zur »Kritik der praktischen Vernunft« (1788) gedacht haben wird: »Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.«
Eine Lebenserfahrung ist hier beschrieben, die ich selber vielfach gemacht habe. Oft sind es nicht Bücher, sondern Menschen, die einem im entscheidenden Moment neue Welten erschließen, neue Einsichten vermitteln, neue Horizonte eröffnen. Wie oft ist es zu »Vergegnungen« gekommen, dann die eine, alles entscheidende »Begegnung«, um noch einmal ein Wortspiel Martin Bubers aufzunehmen. Was aber ist einem Europäer wie Schmidt, 1918 in Hamburg geboren, durch die Begegnung mit einem Muslim wie Sadat klar geworden? Welche Einsichten hat er gewonnen? Zehn Grunderkenntnisse zu Sinn und Ziel eines Dialogs lassen die verschiedenen Texte erkennen. Zehn gute Gründe, warum das Gespräch mit dem Islam und seinen Überlieferungen auch heute mehr denn je notwendig ist.
Erkenntnis 1: Der Sinai – Ursprungsraum des Monotheismus
Juden, Christen und Muslime haben in ihrer Geschichte vielfach zur Spaltung der Menschheit beigetragen, haben Konflikte geschürt und Gewalt gegeneinander legitimiert. Ursprünglich aber kommen sie aus einer gemeinsamen Wurzel, das wird Helmut Schmidt bewusst. Und diese Wurzel gehört in einen Raum, um den Israel und Ägypten seit den Urzeiten des Exodus bis in die jüngste Zeit hinein erbitterte Kämpfe ausgetragen haben: zur Halbinsel Sinai (A 2). Undenkbar, dass Sadat bei allem geschichtlichen Wissen um diesen einzigartigen Raum das Stichwort »Sinai« nur historisch verstanden haben soll nach dem Satz: »der Sinai hat seit den Tagen des Moses nicht nur die Ägypter gesehen, die ihn schon seit 5000 Jahren besitzen …«. Kaum denkbar bei einem Mann, der vor wenigen Jahren erst, im Oktober 1973, einen erneuten Sinai-Feldzug gegen Israel geführt und dabei der israelischen Armee militärisch ein »Patt« und dann einen Waffenstillstand unter internationaler Vermittlung abgetrotzt hatte, so die schmähliche Niederlage ausgleichend, die Israel Ägypten im Sechs-Tage-Krieg 1967 zugefügt hatte. Neuen politischen Spielraum hatte ihm das eröffnet, gerade auch gegenüber Israel. Jetzt, im Gespräch mit Helmut Schmidt, heißt das Stichwort im Zusammenhang mit »Sinai« nicht Krieg und Eroberung, sondern »gemeinsame geschichtliche Wurzeln« der drei monotheistischen Religionen. Sadat blickt über den Tag hinaus, als Ägypter und als Muslim. Besser: Blickt durch die Oberfläche der Tagespolitik in die Tiefen der Geschichte. Bewusst bringt er nicht das zur Sprache, was die Religionen seit Urzeiten spaltet und wie eh und je die Völker gegeneinander hetzt, sondern das, was ihnen gemeinsam ist, was sie verbindet, und zwar vom Ursprung her. Warum? Mit welchem Interesse? Weil er tief davon überzeugt ist, dass allen Interessenkonflikten zum Trotz die Rückbesinnung auf die »gemeinsamen Wurzeln« zum Frieden und zur Zusammenarbeit motivieren kann, motivieren könnte.
Nicht zufällig fällt denn auch im Zusammenhang mit dem Monotheismus der Name eines ägyptischen Pharao: Amenophis IV., Echnaton (Regierungszeit ca. 1350 bis ca. 1335), Herrscher der 18. Dynastie des Neuen Reiches (A 2). Der Name »Echnaton« verweist auf ein dramatisches Ereignis der altägyptischen Geschichte: auf eine kultur- und religionsgeschichtlich bis dahin unerhörte Revolution »von oben«. Hatte dieser Pharao sich doch überraschend entschlossen, entgegen der uralten polytheistischen Religionspraxis in seinem Reich künftig nur noch einen Gott kultisch zu verehren: den Sonnengott Aton, dargestellt im Symbol der strahlenden Sonnenscheibe. Zur Verehrung dieses einen Gottes hatte Echnaton sogar eine neue Hauptstadt aus dem Wüstenboden stampfen lassen: Achet-Aton (»Horizont des Aton«), in der archäologischen Forschung heute unter dem Namen Tell el-Amarna bekannt, 300 Kilometer nördlich der bisherigen Hauptstadt Theben am Nil gelegen. Dabei hatte dieser Mann zusammen mit seiner Frau Nofretete keinen exklusiven Ein-Gott-Glauben im Blick, sondern »nur« die ausschließliche Verehrung eines Gottes, in klassischer religionswissenschaftlicher Terminologie somit keinen absoluten Monotheismus, sondern einen monolatrischen Henotheismus. Doch allein schon damit hatte Echnaton sich den erbitterten Widerstand der etablierten Priesterschaft zugezogen, deren Tempel- und Opferdienst für das Reich an Bedeutung verloren hatte. Sie rächt sich, indem sie nach Echnatons Tod nicht nur die alte Religionspraxis wieder einführt, sondern auch die Erinnerung an die Herrschaft dieses »Ketzer«-Pharaos auszutilgen versucht.
Hat aber das »monotheistische Vermächtnis« Echnatons möglicherweise untergründig weitergewirkt? Und ist es vielleicht in Moses, Anführer des Auszugs des Volks der Israeliten aus der Knechtschaft Ägyptens, wieder zutage getreten? Kein Geringerer als Sigmund Freud (1856–1939), der Vater der Psychoanalyse, hat in seiner letzten großen religionskritischen Schrift »Der Mann Moses und die monotheistische Religion« (1939) diese Überzeugung vertreten. Immerhin ist Mose, obwohl hebräischen Ursprungs, am ägyptischen Königshof aufgewachsen, wie uns das biblische Buch Exodus berichtet (Ex 1,8 – 2, 15), wird also mit ägyptischer Kultur und Religion bestens vertraut gewesen sein. Sadat hat nicht zufällig und nicht ohne Stolz auf dieses Faktum verweisen können: »übrigens ist Moses ein ägyptischer Name« (A 3). In der Tat steckt in »Mose« das altägyptische Wort für »Gebären«. Es taucht in zahlreichen Personennamen in Verbindung mit einem Gottesnamen auf wie zum Beispiel in den Namen der Pharaonen mit Namen Thutmosis, was man übersetzen kann mit »Der Gott Thot ist der, der ihn geboren hat«. Hinzu kommt, dass Mose im Verlauf von Berufung, Exodus, Wüstenwanderung und Sinai-Offenbarung zum Verehrer eines einzigen Gottes wird (»Jahwe«), dessen Weisungen er empfängt, die er an das von diesem Gott erwählte Volk weitergibt. So ist in der Religionsgeschichte der Menschheit gerade Mose zur Symbolfigur des Monotheismus schlechthin geworden: »Ich bin der Herr, dein Gott … Du sollst neben mir keine anderen Götter haben« (Ex 20,2f.). Ist also Mose der Widergänger von Echnaton, wie Freud es gesehen hat? (Einzelheiten zur heutigen Diskussion bei J. Assmann, Moses der Ägypter, 1998).
Erkenntnis 2: Abraham – Vater des Glaubens für drei Religionen
Auf diese umstrittene religionsgeschichtliche Frage geht Helmut Schmidt in seinen Aufzeichnungen nicht ein. Später wird er erklären, die Verbindung Echnaton-Mose sei »der einzige Punkt«, an dem er »Sadats Sicht nicht bestätigt gefunden habe« (Weggefährten, 1996, 349) Stattdessen notiert er sich die entscheidende Pointe dieser Überlegungen. Erstens: Die Heiligen Schriften von Juden, Christen und Muslimen bezeugen den »Ursprung des Glaubens an den alleinigen Gott«. Und zweitens: Dieser Ursprung liegt nach Bibel und Koran nicht bei Mose, sondern »bei Abraham« (A 2). Ob dieser »ungefähr im gleichen Zeitalter gelebt« hat wie Echnaton, ist auf Grund fehlender Quellen historisch ebenfalls unentscheidbar. Aber Tatsache ist: »Sowohl die Juden und Christen als auch die Muslime glauben von Abraham abzustammen« (A 2). Der Satz klingt harmlos, hat aber Gewicht und Folgen. Für eine Studie wie die unsrige hat er zentrale Bedeutung, der wir in aller Kürze nachgehen müssen.
Den Überlieferungen zufolge muss zwischen einer genealogischen und einer geistigen Abrahamskindschaft unterschieden werden Für Juden? Für Juden ist die Abstammung von Abraham schon genealogisch gegeben und zwar über die Linie Abraham–Isaak–Jakob mit seinen zwölf Söhnen als Väter der zwölf Stämme (mehr dazu im Fünften Teil). Juden verstehen sich von daher sowohl als Nachkommen Abrahams wie als Erben der Verheißungen Gottes an ihn: Bund und Land. Mit Abraham hat Gott einen »Bund« geschlossen (Gen 17) und seinen Nachkommen eine Zukunft als »großes Volk« angekündigt. Und äußeres Zeichen dieses Bundes ist die Beschneidung der Vorhaut männlicher Neugeborener (Gen 17,11–14), wie es erstmals Abraham praktiziert hat (Gen 17,23–27). Auf diese Weise tritt jeder Jude bis auf den heutigen Tag in den Bund ein, den Gott mit Abraham und seinen Nachkommen »auf ewig« (Gen 17,13) eingegangen ist.
Und zu dieser Zukunft gehört auch ein Jude besonderen Profils: Jesus aus Nazaret. Die christliche Ur-Kunde nennt ihn schon in ihrem allerersten Satz einen »Sohn Davids« und einen »Sohn Abrahams« (Mt 1,1). Wie auch anders? Er wurde geboren von einer jüdischen Mutter und ist wie jedes neugeborene männliche jüdische Kind am achten Tag nach der Geburt beschnitten worden (Lk 2,21). Er trägt damit wie alle Juden das Bundeszeichen an seinem Körper und hat damit Anteil an der Bundes- und Verheißungsgeschichte seines Volkes. Mehr noch: Auch Nichtjuden können »Kinder Abrahams« werden. Zwar nicht in einem genealogischen, wohl aber in einem geistigen, einem spirituellen Sinn. Das wird für den Völkerapostel Paulus wichtig, der ungezählte Menschen aus der Welt der Völker für den Glauben an Jesus als den gekreuzigten und auferweckten Sohn Gottes und Erlöser gewinnen kann. Denn für Paulus als Juden gibt es nur den einen Gott, den Gott, dem sich schon Abraham anvertraut hat. Indem aber Menschen aus den Völkern an die Auferweckung des Gekreuzigten zu neuem Leben bei Gott glauben, glauben sie »wie Abraham«, setzen ihr Vertrauen also auf den Gott Abrahams, einen Gott, »der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft« (Röm 4, 17; vgl. Hebr 11,19). Abraham ist damit Paulus zufolge für alle Glaubenden, Juden wie Nichtjuden, der »Vater vieler Völker« und damit »unser aller Vater vor Gott« (Röm 4, 17). Was umgekehrt bedeutet: Nichtjuden sind als Christusgläubige immer zugleich auch »Kinder Abrahams« dem Geiste nach.
Für Muslime? Auch für Muslime ist Abraham, arab. Ibrahim, der »Vater« ihres Glaubens, ihr Ur-Vater gewissermaßen. Warum? Weil dieser Abraham bereits in den Urzeiten der Geschichte wie kein anderer Gesandter Gottes gezeigt hat, was »islam« im tiefsten Sinn bedeutet: Glauben als unbedingtes Vertrauen des Menschen auf die Macht und Barmherzigkeit Gottes als Schöpfer, Erhalter und Richter allen Lebens. Ja, der Koran geht sogar so weit, den Islam durchgängig als »Religionsgemeinschaft Abrahams« (arab.: millat Ibrahim) geradezu zu definieren: »Wer hat bessere Religion, als wer sein Gesicht Gott zuwendet, dabei das Gute tut und Abrahams Religionsgemeinschaft folgt? Ein aus innerstem Wesen Glaubender! Gott hat sich Abraham zum Freund genommen«, liest man beispielsweise in der medinensischen (= Md) Sure 4, 125. Ähnlich: 6, 161 u. 16, 123: beide spätmekkanisch (= Mk III) sowie 2, 135 u. 3, 95 (beide Md).
Und Sadat? Dass Sadat auf Echnaton und den ägyptischen Mose verwiesen hat, ist seinem Nationalstolz als Ägypter geschuldet. Das ist das eine. Dass er aber als Muslim nicht nur Abraham erwähnt, sondern auch das Gemeinsame mit Juden und Christen betont, ist ein welt- und religionspolitisches Signal. Als Ägypter hatte er ja die erbitterte Feindschaft von Juden und Muslimen seit Gründung des Staates Israel vor Augen. Vier Kriege waren seither ausgefochten worden: der Unabhängigkeitskrieg 1948/49, der Suez-Krieg 1956, der Sechs-Tage-Krieg 1967 und der Jom-Kippur-Krieg im Oktober 1973. An Realismus fehlt es ihm nicht. Naive Versöhnungs-Illusionen macht er sich keine. Niemand weiß besser als er, dass sich Juden und Muslime, Israelis und seine arabischen Nachbarn bis an die Zähne bewaffnet gegenüber gestanden haben und stehen. Auch verfolgt Sadat mit seiner Friedenspolitik ganz nüchtern auch eigene politische und ökonomische Interessen: Er möchte die Kontrolle über den Suez-Kanal zurück und den Sinai wiedergewinnen, vor allem aber den Teufelskreis von immer neuen Kriegen durchbrechen, welche Ägyptens ökonomische Ressourcen aufzuzehren drohen. Der Militärhaushalt verschlingt Unsummen, die bei sozialen Projekten fehlen.
Dafür hatte sich Sadat vom feindseligen Klima in der arabischen Welt Israel gegenüber freigemacht und war damit ein hohes Risiko eingegangen, politisch und persönlich. Er hatte es gewagt, in diesen von Hass vergifteten Kontext ein Gegensignal zu setzen. Und der Rückgriff auf die Geschichte dient ihm zur Absicherung seiner Interessenspolitik, und dies keineswegs nur aus taktischen Gründen, wie Nasr HamidAbu Zaid unterstellt. Jedenfalls kann er Helmut Schmidt gegenüber glaubwürdig betonen: In historischer Tiefe gesehen gibt es vieles, was Juden und Muslime verbindet, die Christen eingeschlossen: der gemeinsame Glaube an den »alleinigen« Gott und ein Gottvertrauen, wie Abraham es vorgelebt hat (Einzelheiten: K.-J. Kuschel, Juden-Christen-Muslime, 1997, Teil VI). Wenige Seiten später in den »Weggefährten« von 1996 wird Helmut Schmidt noch genauer. Nach dem Tod Sadats hatte er »muslimische und jüdischen Gelehrte«, aber auch christliche Theologen befragt und »alle wesentlichen Darlegungen Sadats bestätigt« gefunden:
»In der Tat lehren alle drei monotheistischen Religionen die gleichen Geschichten von Adam, von Noach und von Abraham. Sie stimmen darin überein, dass Abraham der erste war, der statt vieler Götter nur den einen einzigen Gott gekannt hat; dass Gott sich ihm offenbart, einen ›Bund‹ mit ihm geschlossen und ihm das Land Kanaan versprochen hat – quasi eine Vorwegnahme des Bundes Gottes mit Mose auf dem Sinai. […]
Alle drei Religionen lehren die gleiche seltsame Geschichte, nach der Abraham zunächst mit Hagar, der ägyptischen Sklavin seiner unfruchtbaren Ehefrau, den Sohn Ismael zeugt [Gen 16,1–4.15], den er samt der Mutter verstößt [Gen 16,5f.], danach aber mit seiner bisher unfruchtbaren Ehefrau Sarah den Sohn Isaak [Gen 21,1–7]. Die Juden haben später ihre Abstammung von Abraham über Isaak begründet, die Muslime ihre Abstammung von Abraham über Ismael. Insofern besteht Übereinstimmung zwischen beiden Traditionen, auch darin, dass Gott seine schützende Hand über beide Söhne und deren Nachkommen gehalten hat.« (Weggefährten, 1996, 349)
Eine »seltsame Geschichte« in der Tat, diese Geschichte vom erstgeborenen Abraham-Sohn Ismael, den Abraham mit der ägyptischen Dienerin in seinem Haus, Hagar, gezeugt hat. Einer damaligen Sitte gemäß durchaus mit Zustimmung seiner Ehefrau Sara, da diese unfruchtbar zu sein scheint und Abrahams Nachkommenschaft gesichert werden sollte. So jedenfalls überliefert es die Tora im Buche Genesis (Gen 16,1–4). Und überliefert ist auch die Geschichte vom zweitgeborenen Sohn Isaak, dem Sara dann doch noch das Leben schenken kann, nachdem Ismael schon längst auf der Welt ist (Gen 21,1–7). Daraus aber entwickelt sich ein Bruder-Bruder-Drama, das in die Reihe der großen Brüderdramen gehört, von denen die Genesis voll ist: Kain und Abel, Esau und Jakob, Josef und seine Brüder, treiben Sara und Abraham mit Hagar doch ein übles »Spiel«. Hagar wird zweimal aus dem Haus gejagt, einmal noch vor und einmal nach Ismaels Geburt. Traumatische Urgeschichten im Verhältnis Juden und Muslime bis heute. Denn der mit Abraham geschlossene Bund Gottes (Gen 17) soll nicht über Ismaels, sondern über Isaaks Nachkommen weitergehen (Gen 17, 19. 21; 21, 10; 22, 15–18; 26, 3–5).
Das Erstaunliche aber? Dieselbe Tora berichtet uns, dass auf dem anderen Abraham-Sohn, Ismael, ausdrücklich der Segen Gottes ruht. Sein Name bedeutet im Hebräischen nicht zufällig »Gott (er)hört« (Gen 16, 11). Und in der Tat ist Ismael nicht nur der Erstgeborene Abrahams, er trägt auch ab dem Alter von 13 Jahren das Bundeszeichen der Beschneidung (Gen 17,23–26). Er und seine Nachkommen sind von vorneherein mit hineingenommen in den Bund Gottes mit seinem erwählten Volk. Dass er überhaupt lebt und dann überlebt, hat er nicht Sara und Abraham, sondern Gott allein zu verdanken, hatte die dann doch eifersüchtig gewordene Sara die bereits schwangere Hagar derart hart behandelt, dass sie in die Wüste flieht. Sie wäre mit ihrem noch ungeborenen Kind darin umgekommen, wären beide nicht durch Gottes Eingreifen gerettet worden (Gen 16,5–15). Jetzt bekommt Hagar ein erstes Zukunftsversprechen: »Deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann« (Gen 16,10). Mehr noch: Nach denselben Überlieferungen der Tora soll Ismaels Leben noch ein zweites Mal ausgelöscht werden, wird dieser Sohn doch nach der Geburt Isaaks zusammen mit seiner Mutter auf nochmaliges Betreiben Saras und mit Zustimmung Abrahams ein weiteres Mal buchstäblich in die Wüste geschickt. Vertrieben aus dem Haus, verstoßen um der Erbfolge willen. Wiederum aber greift Gott ein, sieht die Tränen der Hagar, »hört den Knaben schreien« (Gen 21,17), rettet Mutter und Kind und bekräftigt Abraham gegenüber sein Versprechen, auch den »Sohn der Magd«, wolle er »zu einem großen Volk« machen; auch er sei ja schließlich sein »Nachkomme« (Gen 21,13). Und auch Hagar bekommt vom Engel Gottes ihrerseits die Verheißung, ihr Sohn werde Gott »zu einem großen Volk machen« (Gen 21,18).
Daraus folgt: Nach dem Zeugnis der Tora geht zwar der Bund Gottes mit Abraham durch Isaak weiter, der einer der Stammväter des israelitisch-jüdischen Volkes werden wird, doch auf dem Abraham-Sohn Ismael, später Stammvater des Islam, ruht ausdrücklich der Segen Gottes und zwar nicht nur für ihn selber, sondern auch für seine Nachkommen: »Auch was Ismael angeht, erhöre ich dich«, hatte Gott zu Abraham bereits gesagt, nachdem feststeht, dass Isaak existieren und der Bund mit diesem weitergehen wird (Gen 17,19.21), »Ja, ich segne ihn und lasse ihn fruchtbar und sehr zahlreich werden. Zwölf Fürsten wird er zeugen, und ich mache ihn zu einem großen Volk« (Gen 17,20). Und diese zwölf Fürsten samt deren Siedlungsgebiet werden später noch namentlich genau verzeichnet (Gen 25,12–18). Die Nachkommen Ismaels bilden schon biblisch die Stämme Nordarabiens. Ob Ismael oder Isaak also, in beiden Fällen gilt, was Helmut Schmidt so auf den Punkt gebracht hat: »Gott hat seine schützende Hand über beide Söhne und deren Nachkommen gehalten.« In der Tat: Nach dem unzweideutigen Zeugnis der Tora will Gott selber, dass auch dieser Abraham-Sohn lebt und in seinen Nachkommen eine große Zukunft hat.
Gerade für Christen sind das noch gewöhnungsbedürftige Gedanken, vor allem, wenn man sie im Lichte der Existenz des Islam liest. Lange hat man denn auch die Ismael-Überlieferungen der Tora religionstheologisch ignoriert. Was geht uns Heidenchristen der verstoßene Ismael an, zumal der Apostel Paulus sich zum Fall Hagar negativ geäußert hat (Gal 4,21–31)? (Einzelheiten: Th. Naumann, Ismael – Abrahams verlorener Sohn, 2000). Doch mittlerweile gibt es Arbeiten, welche die Hagar-Ismael-Texte und die hier zutage tretende Theologie des Anderen im Interesse eines trilateralen Gesprächs von Juden, Christen und Muslimen konstruktiv herausgearbeitet haben (Einzelheiten bei: C. Nieser, Hagars Töchter, Der Islam im Werk von Assia Djebar, 2011, bes.: Fünfter Teil). Hier sind vor allem die amerikanische Exegetin Phyllis Trible und der deutsche evangelische Theologe Bertold Klappert zu nennen (P. Trible/L. M. Russel, Hrsg, Hagar, Sarah and their Children, 2006; B. Klappert, Abraham eint und unterscheidet, 2000).
Und in der Tat ist theologisch ernst zu nehmen, dass der Islam sich so programmatisch wie keine andere Religion als »millat Ibrahim«, als »Religionsgemeinschaft Abrahams« (Sure 16, 123: Mk III) bezeichnet und damit auf einen Ursprung zurückgreift, der noch vor Judentum und Christentum liegt. Einen reinen Ursprung der Gottesbeziehung, den der Islam nach Judentum und Christentum wiederherzustellen entschlossen ist. Denn für den Koran ist Abraham weder Jude noch Christ gewesen, sondern ein gottsuchender und gottvertrauender Mensch, der sich durch Beobachtung der unbeständigen, transitorischen Welt zum Glauben an den einen Gott durchgerungen hat. Ganz wie der Prophet Mohammed selber. Abraham kann damit als eine Art vorbildlicher Ur-Muslim verstanden werden. In späterer, medinensischer Zeit hat sich diese Überzeugung in den Versen verdichtet:
Ihr Leute der Schrift, warum streitet ihr über Abraham, wo die Tora und das Evangelium erst nach ihm herabgesandt worden sind?
Versteht ihr denn nicht?
Da habt ihr nun über etwas gestritten, wovon ihr Wissen habt. Doch warum streitet ihr über etwas, wovon ihr nichts wisst?
Gott weiß, ihr aber wisst nicht.
Abraham war weder Jude noch Christ, sondern ein aus innerstem Wesen Glaubender, gottergeben – Muslim –. Er gehörte nicht zu denen, die (Gott) Partner beigeben.
(Sure 3,65–67: Md)
Die Konsequenz daraus wird im gleich folgenden Satz gezogen: