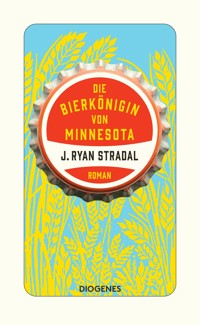
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diana ist Waise und lebt bei ihrer Großmutter. Neben der Schule bessert sie das Familieneinkommen durch gelegentliche Diebstähle auf. Als sie erwischt wird, ist die Strafe das Geschenk ihres Lebens: Sie darf ihre Schulden in einer Brauerei abarbeiten. Bald mischt Diana den Markt mit einzigartigen Craft-Bieren auf. Ein Lied auf das Leben und ein Roman über mutige Frauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
J. Ryan Stradal
Die Bierkönigin von Minnesota
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Kathrin Bielfeldt
Diogenes
Die Pie-Lady
Edith, 2003
Es war der 5. Juli 2003, und bisher war Edith Magnussons Tag gar nicht so übel verlaufen. Sie hatte gerade einen Erdbeer-Rhabarber-Pie aus dem Ofen geholt, hatte das Fenster geöffnet und war nun auf der Suche nach ihrem Lieblingsgeschirrtuch, als sie auf der weißen Zierleiste des Fensters einen Grashüpfer sitzen sah. Seit sie die Farm ihrer Eltern verlassen hatte, war so ein Anblick etwas Besonderes, und die Vorstellung, dass ein Vogel herabstürzen und ihn sich schnappen konnte, gefiel ihr gar nicht, also griff sie sich einen Holzlöffel und stupste das merkwürdige, friedliche Insekt sacht mit dem Stiel an. Wie gehofft, rettete es sich mit einem Sprung in den Garten. Sie atmete auf. Während Edith den Holzlöffel wusch und wegräumte, fragte sie sich, ob der Grashüpfer endlich einmal gesehen werden und sich nicht immer nur seiner Umgebung anpassen wollte, und fühlte sich prompt schlecht, weil sie ihn dabei gestört hatte. Edith hatte noch nie eine Auszeit von ihrer Umgebung genommen. Aber andererseits hatte sie auch noch nie das Bedürfnis danach verspürt. Hier lief es einigermaßen anständig, und wegen Dingen zu jammern, die sie nicht ändern konnte, lag ihr nicht, besonders in einer Welt, in der Nörgler nicht gerade händeringend gesucht wurden.
Sie hatte in New Stockholm, im Herzen Minnesotas, einen guten Job im Pflegeheim St. Anthony-Waterside, sechs Blocks von ihrem kleinen Dreizimmer-Haus entfernt. Edith hatte ihren Mann, Stanley, der sich momentan in Peterbilt, irgendwo in South Dakota, aufhielt. Sie hatte einen erwachsenen Sohn, Eugene, der gerade als unabhängiger Vertreter bei einer interessanten Firma namens Life Well angefangen hatte, die offenbar hochwertige Haushaltswaren direkt an Privatkunden verkaufte. Zudem hatte sie eine erwachsene Tochter, Colleen, die studiert hatte und trotz ihres Studienabbruchs recht gut klarkam. Colleen hatte einen Handwerker namens Mark geheiratet, ein freundlicher Mann, selbst wenn er nicht in die Kirche ging. Sie zogen Ediths einziges Enkelkind auf, ein intelligentes, aufgewecktes Mädchen, das Diana hieß und inzwischen tatsächlich fast schon ein Teenager war.
Sie wüsste nicht, was ein Mensch sonst im Leben noch brauchen sollte. Sie vermisste die Farm, auf der sie groß geworden war, das schon, vermisste ihre Eltern aus dem einen und ihre Schwester aus einem anderen Grund, doch es hatte keinen Sinn, Menschen oder Dingen aus der Vergangenheit nachzutrauern.
Edith war erst vierundsechzig Jahre alt, doch wenn sie hier und jetzt sterben würde, hätte sie die wichtigsten Gefühle erfahren, die jemand aus Minnesota, Mann oder Frau, am Ende seines Lebens erfahren haben konnte. Sie hatte ihr Bestes gegeben, und sie hatte sich nützlich gemacht. Sie half.
Doch das Leben war noch nicht fertig mit ihr, und über kurz oder lang würde ihr alles, was vor dem 5. Juli 2003passiert war, wie die Hintergrundmusik im Fahrstuhl vorkommen. Als die Musik verstummte und die Türen sich aufschoben, begegnete ihr als Erstes ihr Chef, ein Mann, den sie mochte und der in diesem Moment den Flur im Pflegeheim hinuntergelaufen kam, lächelte, ihren Namen rief und wie ein Kind mit einer Zeitungsseite wedelte.
Edith arbeitete in der Küche des Pflegeheims als Diätassistentin, seit siebenunddreißig Jahren wusch sie unermüdlich Geschirr ab, teilte Essen aus, deckte den Speisesaal ein und putzte ihn hinterher. Die meisten ihrer Kollegen arbeiteten hart, waren freundlich und bis auf die Knochen erschöpft; die Flure rochen nach gekochten grünen Bohnen und Babypuder, und Brendan Fitzgerald war der beste Chef, den sie je gehabt hatte, und bisher auch am längsten auf seinem Posten. Selbst nach fast zwanzig Jahren hatte er immer noch das gütige Charisma und die ruhige Autorität eines Fernsehmeteorologen. Er war außerdem Kettenraucher und sprach über die Heimbewohner nur als Zimmernummern, doch zumindest war er jedes Mal froh, Edith zu sehen, und so froh wie an jenem Tag hatte Edith ihn zuletzt erlebt, als er im Lotto fünfzig Dollar gewonnen hatte.
Brendans geöltes schwarzes Reagan-Haar schimmerte unter dem fluoreszierenden Licht wie ein glasierter Donut, und sein Bauch wippte über den Khakihosen. Er hielt eine Ausgabe des Twin City Talker in der Hand, eine dieser schicken Zeitungen für schicke Stadtmenschen. Edith hatte vor zwanzig Jahren mal eine Ausgabe durchgeblättert, sie für merkwürdig befunden und daher nie mehr gelesen. ESSEN SPEZIAL stand in großen Buchstaben auf dem Cover, und Brendan riss sie irgendwo in der Mitte auf.
»Haben Sie davon gehört?«, fragte er.
Edith erkannte eine Liste mit der Überschrift BESTE PIES.
Betty’s Pie, Two Harbors
Key’s Café and Bakery, St. Paul
St. Anthony-Waterside Pflegeheim, New Stockholm
»Unser Pflegeheim hat den drittbesten Pie Minnesotas«, sagte er und schüttelte zur Betonung die Zeitung.
»Also, das ist ja merkwürdig«, sagte Edith.
»Nein, ist es nicht. Es ist wegen der Enkelin von Nummer 8, die haben Sie doch hier schon gesehen, die mit dem pinkfarbenen Haar«, sagte Brendan und zeigte auf den Namen der Verfasserin. »Das ist sie. Ellen Jones. Gastrokritikerin!«
»Schön. Na, dann gehe ich besser mal wieder in die Küche«, sagte Edith.
»Ich werde es rahmen und in der Lobby aufhängen«, rief Brendan. »Das ist doch was, Edith! Der drittbeste Pie im gesamten Bundesstaat!«
Bereits in ihrem ersten Jahr im Pflegeheim hatte Edith begonnen, ihre eigenen Pies zu backen, nachdem sie festgestellt hatte, dass der Apple Cobbler – ein gekaufter, vorgefertigter Auflauf von einem Vertragslieferanten – ungewöhnlich oft in die Küche zurückkam, teilweise nicht angerührt, manchmal fehlten ein oder zwei Bissen, die sich halb zerkaut irgendwo anders auf dem Teller fanden. Einer der Bewohner, ein wunderbarer alter Muffelkopf namens Donald Gustafson, hatte den Kuchen mit einem Zettel zurückgeschickt, auf dem stand: SCHLUSS DAMIT.
Wenn man sieht, wie ein Mensch vom obersten Tritt einer Leiter fällt, denkt man auch nicht darüber nach, dass man sich die Arme brechen könnte, sondern streckt sie aus. Daran glaubte Edith.
Hätte sie gewusst, dass ihre Entscheidung eines Tages, Jahrzehnte später, alles verändern würde, was sie an ihrem Leben liebte, hätte sie es dennoch gemacht, denn aus der Küche des St. Anthony-Waterside kam der letzte Nachtisch, den seine Bewohner wahrscheinlich je essen würden. Wenn es nach Edith ginge, bekämen diese Menschen mindestens ein- bis zweimal pro Woche das Gefühl und den Geschmack von selbstgebackenem Pie auf der Zunge, oder zumindest den Duft in der Nase, während der Himmel sie von allem Sinnlichen auf dieser Welt entwöhnte. Das war das mindeste, was ein verflixter Mensch tun konnte.
Und wie es sich herausstellte, ging es tatsächlich nach ihr. Mit Hilfe von ein paar Extra-Dollar von Brendan und denen, die vor ihm auf dem Posten waren, als Zuschuss für die Zutaten servierte sie jetzt seit fast vierzig Jahren ihre selbstgebackenen Pies. Die meisten Bewohner fanden sie wohl ziemlich anständig, vielleicht einen Tick zu süß. Nicht, dass sie meckern würden. Edith wandte Brendan den Rücken zu. »Na, dann hoffen wir mal, dass sich die Aufregung bald wieder legt.«
»Lassen Sie uns hoffen, dass sie sich nicht legt! Das ist phantastisch! Sie sollten stolz sein!«
Brendan war noch immer nicht verheiratet und hatte keine Kinder, und jetzt, als Mann um die sechzig, würde das wohl auch nicht mehr passieren, also lebte er mehr denn je für seinen Job. Was jedoch nur dann ungünstig für Edith war, wenn es ihr Leben komplizierter machte. So wie jetzt.
Natürlich war Edith schon früher in der Zeitung gewesen. Ungefähr alle acht Jahre brachte der New Stockholm Explainer einen Artikel über sie, dessen Überschrift in etwa lautete »Pie-Lady serviert immer noch Kuchen«, zusammen mit einem Foto, auf dem sie stets verwirrt und alt aussah. Sie las die Artikel nie und bewahrte sie noch nicht einmal auf. Als am nächsten Tag gegen Mittag das Telefon klingelte, wusste sie, dass es Stanley sein und sie es ihm gegenüber nicht mal erwähnen würde.
Der Mann am anderen Ende der Leitung war jedoch sein Chef, Tom Clyde, und sie entschied, es auch ihm gegenüber nicht zu erwähnen.
»Edith«, sagte Mr. Clyde, »es hat einen Unfall gegeben. Also, zunächst einmal, Ihrem Mann geht es gut, er hat nur eine Gehirnerschütterung.«
Sie wusste, dass es Stanley gutging. Sie waren jetzt fast vierundvierzig Jahre verheiratet, und wenn er nicht mehr am Leben wäre, hätte sie das gespürt. Sie hätten ihn auf den Pluto schicken können, und sie wüsste, ob er es geschafft hätte. Aber ihr war auch klar, dass jederzeit etwas passieren konnte, und das schon bald.
»Was hat er jetzt wieder angestellt, Mr. Clyde?«
»Nun, er hat eine Wagenladung gefrorener Hamburger durch den Haupteingang eines Hardee’s in Sioux Falls gefahren. Normalerweise werden sie lieber über den Hintereingang beliefert, wurde mir gesagt.« Mr. Clyde hatte den gleichen trockenen Humor wie sein Cousin, Big Tom.
»Wurde jemand verletzt?«
»Gott sei Dank nicht. Ein paar Mülleimer und Picknicktische hätten wahrscheinlich lieber keine Bekanntschaft mit dem Lkw Ihres Mannes gemacht, aber das war’s auch schon.« Mr. Clyde seufzte und klang ein wenig traurig, als er hinzufügte: »Um ehrlich zu sein, das war seine letzte Fuhre, Ma’am. Werden ihn hier vermissen.«
»Nun, dann schicken Sie ihn nach Hause«, sagte sie, verabschiedete sich und legte auf.
Es war Mittagszeit, und draußen kehrten die morgendlichen Schatten wie müde Kinder zu ihren Müttern zurück. Eine Eintagsfliege warf ihren Pergamentkörper gegen das Fliegengitter, glücklich darüber, irgendwo zu sein. Edith stand allein zu Hause in der Küche, schnitt Obst und wartete darauf, dass sich ihr Leben erneut veränderte.
Am folgenden Tag brachte sie Stanley zu Dr. Nebel. Stanley verkündete stolz, er hätte Dr. Nebel in den letzten fünf Jahren nur einmal aufgesucht, so als bekäme er dafür eine Medaille. Nur ein Mal, abgesehen davon, dass sie Mitglieder desselben Elk Clubs waren. Wie sie dort miteinander redeten, wusste man nicht, aber in seiner kleinen, schlichten Praxis nahm Dr. Nebel kein Blatt vor den Mund. Frühes Stadium war das Einzige, was er aus reiner Freundlichkeit gesagt haben könnte. Stanley war erst fünfundsechzig, und für solche Sachen ist es immer zu früh, für sie beide. Er war immer stolz darauf gewesen, dass er seinen eigenen Truck reparieren konnte, er würde seinen CB-Funk-Namen vermissen – »Charlie Brown«, wegen seines kugelrunden Kahlkopfes –, und er würde die lächelnden Gesichter der Menschen vermissen, die er an Orten wie Casper, Pierre und Grand Junction kennengelernt hatte. Edith hatte schon vermutet, dass der Ruhestand für ihren Mann sehr plötzlich kommen würde, doch sie müsste sich nur einen Ruck geben, dann würde es schon gehen.
Stanley wäre von nun an jeden Tag zu Hause, und obwohl seine Rente nicht annähernd so hoch sein würde wie sein Lohn, kämen sie mit ein paar Abstrichen hier und da schon zurecht, sofern es keine Notfälle oder Überraschungen gab. Sie hatten mal neben einem Feuerwehrmann gewohnt, der jeden Abend betete, dass der nächste Tag langweilig wäre, und das konnte sie sehr gut nachvollziehen.
An jenem Abend waren vier Gäste im Speisesaal des St. Anthony-Waterside, ungefähr drei mehr als üblich an einem Wochentag, jedoch kein Grund zur Panik. Nur ihre beiden Pies musste sie in je zehn Stücke teilen.
Clarence Jones aus Nummer 8 hatte Besuch, seine Enkelin Mandy, die jene friedliche Erschöpfung von Lehrern und Krankenschwestern ausstrahlte, und ihr zwei Jahre alter Sohn Zach, Stammgäste. Mit seinen großen Augen und der Pomade im Haar sah der Junge aus wie eine kindliche Version von Ugarte aus Casablanca.
»Glückwunsch, dass Sie es auf die Liste des Talker geschafft haben«, sagte Mandy, obwohl es ihre eigene kleine Schwester gewesen war, die das geschrieben hatte. »Damit hatte ich nichts zu tun, glauben Sie mir.«
»Zum Glück scheint es niemand groß gelesen zu haben«, erwiderte Edith und wechselte schnell das Thema. »Ist es nicht schön, seinen Urenkel zu sehen?« In Ediths gesamter Familiengeschichte hatte es noch nie ein Urenkelkind gegeben, und für sie waren es kleine Wunder.
»Dieser Junge ist ein Kommunist«, sagte Clarence finster. Er war weniger nett als die meisten anderen Heimbewohner, aber Gott nimmt jeden, wie er ist, wie man so sagt, und Edith gab sich alle Mühe, das auch zu tun. »Dad ist nur sauer, weil er Zach eine Tüte Gummibärchen geschenkt und der sie an alle verteilt hat«, sagte Mandy.
»Diese Vollidioten brauchen sie nicht. Und, wissen Sie, was das andere Problem ist?«, fragte Clarence und starrte jetzt Edith an. »Ihre Kuchenstücke werden immer kleiner. Wenn ich schon weiterlebe, will ich größere Stücke Pie.«
»Ich auch«, sagte Amelia Bruch, die mit neunundneunzig der älteste Mensch des Countys war und immer noch alles aß, mit Ausnahme von Schwein, Weißbrot und Pommes.
»Ich seh mal, was ich tun kann«, sagte Edith und blickte über die glänzenden leeren Dessertteller im Speisesaal.
Am nächsten Tag stellte Edith fest, dass ihre Pie-Zutaten schneller zur Neige gingen als sonst. Sie würde den Mut aufbringen und Brendan erneut um mehr Zutaten bitten müssen, doch nicht, ehe sie das Beste aus dem gemacht hatte, was die Küche noch hergab. Ihre zwölfjährige Enkelin würde am Wochenende aus Hastings kommen, und da gab es andere Dinge vorzubereiten. Es war inzwischen Tradition, dass Diana im August, bevor die Schule wieder losging, eine Woche bei ihren Großeltern verbrachte. Der Unterschied war, dass Stanley jetzt das erste Mal die ganze Zeit zu Hause sein würde.
Von der Küche aus sah sie ihren Mann zur Tür schlurfen und sie mit der stürmischen Begeisterung eines kleinen Kindes an Weihnachten aufreißen.
»Ich dachte, ich hätte einen Wagen gehört«, sagte er und starrte einen Moment lang auf die leere Einfahrt, als könne er damit die Ankunft von Colleens altem blauen Dodge Omni erzwingen.
Als Diana schließlich eintraf, nahm Stanley sie mit auf einen Shirley-Temple-Cocktail in den Elks Club, kaufte ihr Cheddar-Pizza bei The Pizza Man, Sven Larsens neuem Restaurant, und schlug beim Abendessen vor, zum stillgelegten Flussarm in der Nähe des St. Anthony-Waterside zu fahren, wo es vor Mücken nur so wimmelte, um dort die Enten zu füttern, wenn sie nicht schon zu alt dafür wäre. »Nein, ich mag Enten immer noch, Grandpa«, sagte sie, und das fand Edith nett. Als Diana klein gewesen war, spielte sie zufrieden mit einer Pie-Form, die mit alten Schlüsseln und Würfeln gefüllt war; oder stand im Flur vor dem Bild des Farmhauses, aus dessen Fenstern jeweils ein anderes Familienmitglied sah, um sich für alle Namen auszudenken. Doch diese Zeiten waren längst vorüber. Das Highlight dieser Ferien war es, mit Stanley in die Videothek zu gehen. Stanley liebte Science-Fiction und Diana anscheinend gefühlvolle Romanzen, was angesichts der Filmtitel auf den DVD-Rücken für einige exotische Filmabende sorgen würde: Miss Daisy und ihr Chauffeur und Krull. Blade Runner und Magnolien aus Stahl. Zeit der Zärtlichkeit und eXistenZ. Soweit Edith wusste, schauten sie die Filme hintereinander weg und ertrugen gelassen die Entertainment-Auswahl des anderen.
Um diese Zeit herum hatte ihr liebenswerter, ruhiger Ehemann jedoch schon begonnen, sich zu verändern. Vor dem Zwischenfall im Hardee’s war er immer noch er selbst gewesen; ein Blumenstrauß, dem hier und da ein paar Blütenblätter fehlten. Doch nachdem er gezwungen wurde, in Rente zu gehen, schienen ganze Blüten zu fehlen.
Und nun kümmerte er sich den Großteil der Woche um ihr einziges Enkelkind, allein. Natürlich hätte es viel schlimmer laufen können, doch es gab Zwischenfälle. Am Dienstag nahm er einen frischgebackenen Laib Brot aus dem Ofen und verfütterte ihn an die Enten. Später wollte er eine Dose Chili con Carne zubereiten, vergaß jedoch den Topf auf dem Herd, bis der Rauchmelder ansprang. Am Donnerstag ging er mit Diana zu George Schmidt’s Gebrauchtwagenhandel, wo er einen alten Cadillac Eldorado anzahlte. Glücklicherweise rief ein Angestellter, der die beiden aus der Kirche kannte, Edith bei der Arbeit an, und sie rannte herüber und ließ die ganze Sache platzen. Trotzdem machte es sie traurig, das Geld, das sie nicht hatten, nicht doch für einen Wagen zu verjubeln, den sie nicht brauchten. Stanley hatte immer davon geträumt, einen Cadillac zu kaufen, aber es hatte für keinen von beiden je auch nur im Rahmen des Möglichen gelegen. Sie konnte ihm keinen Vorwurf machen, denn für ihn hatte es sich bestimmt wie seine letzte Chance angefühlt.
An jenem Abend passierte etwas noch Beängstigenderes. Er nahm Diana nicht nur mit in den Elks Club, wie vereinbart und für in Ordnung befunden, sondern kaufte dort außerdem noch ein Sixpack Bier, ging nach Hause und gab ihr eine Flasche.
Obwohl es Edith mehr als beunruhigte, dass er einer Zwölfjährigen Alkohol angeboten hatte, machte sie die spezielle Marke des Bieres regelrecht wütend. Es war ein Blotz – eine Marke, die sie in ihrem Haus nie mehr auch nur erwähnen wollten. Sie öffnete die restlichen drei Flaschen und kippte sie in die Toilette, nicht ins Spülbecken, damit das klar war. Diana weinte und behauptete, es sei ihre Idee gewesen, doch Edith wusste, dass sie ihren geliebten Opa nur in Schutz nehmen wollte.
Der Elks Club befand sich mitten in der Innenstadt, in einem majestätischen alten Ziegelsteingebäude, und Edith fand schon immer, dass jemand es abreißen solle, damit sie die Aussicht auf den Fluss genießen könnte, während sie bei der Post in der Schlange stand. Leider war das Gebäude denkmalgeschützt, weil es im achtzehnten Jahrhundert die städtische Brauerei gewesen war, als Kleinstädte im Mittleren Westen noch ihre eigenen Brauereien hatten. Solange sie jedoch in New Stockholm lebte, hatte es ein verstaubtes Antiquitätengeschäft namens Bygone But Not Forgotten beherbergt, eine Reihe verschiedener Restaurants – derzeit Sven Larsens besagtes The Pizza Man – und dann den Elks Club, bei dem Nichtmitglieder klingeln mussten, um hereingelassen zu werden.
Die Tür öffnete sich summend und sie stürmte los, bevor sie ihre Meinung noch ändern konnte. Der Elks Club besaß keine Fenster, und so konnte zumindest keiner ihrer Nachbarn draußen vorbeigehen und sich wundern, was zum Teufel sie dort drinnen machte.
Als sie die Bar betrat, drehte sich jeder im Umkreis von fünf Metern zu ihr um und starrte sie an – länger als ein kurzer Seitenblick, aber nicht lang genug für einen Gruß. Der Club war zur Hälfte gefüllt, großteils Männer und nur ein oder zwei Leute, die sie von der Arbeit, der Kirche, vom Einkaufen, von der Post oder irgendeinem anderen Punkt ihres winzigen Lebensradius her kannte. An den Wänden hing beleuchtete Bier-Reklame von Hamm’s, Schmidt, Grain Belt, Blatz, Blotz und Schlitz, von denen sie die meisten einmal probiert hatte, und das reichte dann auch. Früher hatte sie gern ab und zu ein Glas Ripple getrunken, doch das wurde nicht mehr produziert, und der Speisekarte hinter der Bar zufolge kostete ein einfaches Glas Weißwein so viel wie ein Pfund Rinderhack, das sie zu Hause für das Abendessen zubereitet hatte, also kein Gedanke daran.
Eine Wolke lauter Männerstimmen hing gleichgültig über diesem netten Song von Otis Redding, So I guess I’ll remain the same, der aus der Jukebox erklang.
Die Barkeeperin war eine untersetzte Frau mit viel Make-up, und sie schien genau zu wissen, wer Edith war und weshalb sie da war.
»O mein Gott«, sagte die Barkeeperin und legte Edith eine gebräunte, schmuckverzierte Hand auf den Arm. »Stanley hat Ihrer Enkelin ein Bier gegeben, nicht wahr?«
Edith brauchte nur zu nicken.
»Ich verspreche, dass wir ihm keinen Alkohol mehr zum Mitnehmen verkaufen. Ist doch so, oder, Mort?«
»Jep«, sagte Mort von irgendwo.
»Ich danke Ihnen«, erwiderte Edith. Das Lokal roch nach Pizza, aber Edith sah nirgendwo welche.
»Nein, ich danke Ihnen«, sagte die Barkeeperin und drückte Ediths Arm. Diese gefühlsbetonte Frau war offenbar nicht in der Gegend aufgewachsen, oder wenn, dann bei Menschen, die nicht von hier stammten. »Meine Mom liebt Ihre Pies. Wenn ich sie besuche, muss ich immer früh genug gehen, damit sie einen guten Tisch erwischt.«
»Ist ’n echt guter Pie!«, sagte Mort von irgendwo.
Big Tom Clyde grinste sie vom Barhocker aus an. »Stand auch in der Zeitung, oder? Bester Pie des Bundesstaates, hab ich gehört.«
»Drittbester«, korrigierte Edith.
»Nun ja«, meinte die Barkeeperin mit erhobenen Augenbrauen.
»Wie kommen wir an ein Stück von diesem Pie?«, fragte Big Tom. »Wissen Sie, ich hab noch nie darüber nachgedacht, aber, könnten wir was zahlen, um mit unseren Eltern im Speisesaal zu essen?«
Seit diesem unsäglichen Artikel hatten sie jeden Abend bereits vier oder fünf Gäste, und viel mehr konnte Edith nicht stemmen. »Das machen die Leute zwar selten, aber sicher, das geht.«
»Großartig«, sagte die Barkeeperin lächelnd. »Das sagen wir weiter.«
Ende der darauffolgenden Woche musste Brendan sich bereits Klappstühle aus der Kapelle borgen, um an »Edith’s Pie-Tagen« alle Gäste unterbringen zu können. Die Leute riefen an, um zu hören, ob sie im Hause sei, und erkundigten sich nach ihrem Dienstplan. Leute, die ihre Angehörigen vorher nie im Pflegeheim besucht hatten, tauchten nun regelmäßig auf und blieben lange. Mindestens drei Mal rief jemand bei der Rezeption an und versuchte, einen Tisch fürs Abendessen zu reservieren. Ein Lkw-Fahrer aus West Fargo, dessen Tante Heimbewohnerin war, rief an, um zu fragen, wo er seinen Sattelzug abstellen könnte. Von da an mussten viele Mitarbeiter, die mit dem Wagen zur Arbeit kamen, am Straßenrand parken.
Keine zwei Wochen, nachdem sie es auf die verflixte Liste des Twin City Talker geschafft und gedacht hatte, der Trubel hätte sich längst gelegt, buk Edith in jeder ihrer Schichten vier Pies. Aber es hatte auch wirklich Gutes mit sich gebracht. Das Fünf-Uhr-Abendessen im St. Anthony-Waterside hatte sich von gut beleuchteten, aber stillen fünfunddreißig Minuten in ein ausgelassenes gesellschaftliches Ereignis verwandelt, bei dem Menschen allen Alters noch Stunden, nachdem die Sonne bereits untergegangen und die Küche geschlossen war, an den Tischen saßen. Edith machte sich Sorgen, wie das empfindliche soziale Gefüge des St. Anthonys auf die plötzlichen Veränderungen reagieren würde. Selbst nach fast vierzig Jahren erinnerte es sie an die Highschool. Sie hatte schnell herausgefunden, dass es Cliquen gab und beliebte Leute und dass diejenigen, die in New Stockholm aufgewachsen waren, die Platzhirsche waren und dazu neigten, jene, die von woanders kamen, auszuschließen. Für diese Menschen hatte Edith früher ihre Kinder mitgebracht, damit auch sie mal Besuch bekamen. Es waren mehr, als man meinte. Die Kinder mochten es, denn weder Ediths Eltern noch die von Stanley waren noch am Leben, und so hatten sie plötzlich Dutzende Omas und Opas, die sie munter und unbekümmert mit Süßigkeiten und Aufmerksamkeit verhätschelten. Doch Edith legte Wert darauf, dass die Kinder nicht nur nahmen, sondern auch gaben. »Ich werde euch beiden beibringen, wie man Cribbage spielt«, sagte sie ihnen auf dem Heimweg.
Jetzt, Jahrzehnte später, kamen dutzendweise Verwandte. Ob sie nun mit den Reportern sprach oder nicht – sie tat es nicht –, erschien ihr Name auf einmal in der Minneapolis Star Tribune: »Bleibt der beste Pie Minnesotas ein gutgehütetes Geheimnis?«; in der St. Paul Pioneers: »Abgelegenes Pflegeheim ein kulinarischer Tipp«; die Duluth News Tribune: »Ein Stück Minnesota: Kleinstadtbewohnerin serviert schlichte Pies«; und, sehr zu ihrer Sorge, schon wieder der Twin City Talker, der offensichtlich seine vorherige Rangfolge revidiert hatte und nun herumposaunte: »Minnesotas umkämpfteste Tischreservierung: Edith Magnusson bäckt den besten Pie des Bundesstaates und warum Sie keinen abbekommen.«
Eine Reporterin des Wadena Pioneer Journal wagte sich am weitesten vor und tat so, als hätte sie Interesse an einem Heimplatz für einen Angehörigen und würde sich gern einmal umsehen. Als sie in die Küche kam, wo Edith zwischen blitzendem Edelstahl und Dampf gerade einen Pie-Deckel vorbereitete, schoss sie ein Foto und fragte dann, ob Edith die Unterseite des Deckels mit Eiweiß bepinselte, damit er knusprig würde.
Edith durchschaute den Trick sofort und sagte: »Euch Leuten sage ich überhaupt nix über irgendwas«, und ein stämmiger Ex-Marine namens Edgar Caquill, der in der Küche als Aushilfe arbeitete, während er seinen Abschluss als Rechtspfleger machte, ließ die Reporterin, ohne auch nur ein Wort zu sagen oder die Frau anzufassen, wissen, dass das Interview nun beendet sei.
»Ich traue den Medien nicht«, sagte Edith zu Edgar. »Sie wollen alle so tun, als sei ich berühmt. Danke für deine Hilfe. Diese Knallköpfe.«
Edgar antwortete nur mit einem Nicken, und sie nickte zurück.
Brendan Fitzgerald jedoch war begeistert. Er kümmerte sich um die Interviews, rahmte die Zeitungsartikel ein und hängte sie im Foyer auf, er erwarb sogar ein rotes Samtband für die Warteschlangen, mit denen er rechnete. Und die bildeten sich in der Tat. Selbst als Brendan jedem Besucher sechs Dollar für ein Stück Pie abknöpfte – in Ediths Augen ein unerhörter Betrag –, wand sich die Schlange freundlicher, hungriger Leute bis vor die Tür.
Edith half dem Personal, all die zusätzlichen Stühle, Tischdecken und Gedecke aufzubauen und wieder abzuräumen, was ihren Arbeitstag noch verlängerte. Trotzdem schien es nie schnell genug zu gehen. Mehr als einmal musste Edith einem Nörgler einen strafenden Blick zuwerfen. Eines Abends fragte ein Jugendlicher in einem Packers-Trikot laut, wie lange er denn noch auf seinen Pie warten müsste.
Zwei Leute hinter dem Packers-Jungen in der Schlange stand Tom Clyde: »Siehst du die Frau, die die Stühle da aufstellt? Die bäckt hier die Pies! Also, etwas mehr Respekt, bitte! Sie ist ganz alleine, verdammt!«
»Danke«, sagte Edith zu Tom.
»Entschuldigung«, sagte der Packers-Junge und konnte ihr dabei nicht in die Augen sehen.
»Ich sorge dafür, dass du ein Stück bekommst«, sagte Edith. »Wen besuchst du denn?«
Der Junge schien über die Antwort kurz nachdenken zu müssen. »Öhm, Lulu«, sagte er.
Edith schüttelte den Kopf. »Ach, einer von denen bist du.«
Da man jemanden im Pflegeheim kennen musste, um Zutritt zu erhalten, und das St. Anthony-Waterside seit kurzem die meisten Besucher in ganz Minnesota und den vier umliegenden Bundesstaaten hatte, befanden sich bestimmte Heimbewohner nun stets in Gesellschaft von sechs oder sieben sogenannten entfernten Verwandten, alten Freunden oder ehemaligen Nachbarn. Lulu Kochenhofer war die Erste, die aus ihrem Torwächter-Status Profit schlug und wissen ließ, dass sie für lediglich zwei Dollar jeden als Verwandten bezeichnen würde. Ende Oktober brach sie mit 52 Nichten, 49 Neffen und 100 Enkelkindern drei langjährige St.-Anthony-Waterside-Rekorde.
Stanley war geistig immer noch so weit da, dass ihn das alles nicht sonderlich beeindruckte. »Sie scheffeln Geld und beuten dich aus«, sagte er und drehte seine Gabel in einer Schale buttriger Spaghetti.
»Hab ich bemerkt«, erwiderte Edith. Er war schneller gekränkt denn je, was sie irritierte. Sie hatten nicht viel, aber sie kannte sehr wohl Leute, denen es noch schlechter ging. »Ach, übrigens, vergiss nicht, dass du morgen früh einen Termin bei Dr. Nebel hast.«
»Es ist kein Weltuntergang, um etwas zu bitten, das dir zusteht«, sagte er. »Ist ja nicht so, als könnten wir es nicht gebrauchen.«
Stanley hatte aus guten Gründen keinen Zugang mehr zum Scheckbuch, aber vermutlich hatte er recht. Vor zwei Monaten, als Edith per Post den letzten Gehaltsscheck ihres Mannes und seine erste Arztrechnung erhielt, sah sie Schwierigkeiten auf sie zukommen. Aber selbst wenn ihre Ersparnisse langsam weniger würden, waren sie doch genau dafür gedacht gewesen, oder? Und es gab nicht viel, was Edith im Nachhinein anders gemacht hätte. Sie hatten nie ein Haus kaufen können, das stimmte schon, aber ihre Tochter konnte aufs College, selbst, wenn sie es nicht hatte beenden können. Edith bedauerte keinen Familienurlaub und kein Weihnachtsgeschenk. Doch ihr war schon seit einer Weile klar, dass mehr Geld reinkommen musste, damit es noch eine Weile reichte, und dass es an ihr lag, dafür zu sorgen.
»Ich habe schon einen Plan, Stanley«, erklärte sie ihm, und das hatte sie. Sie war sich nur nicht sicher, ob sie ihn durchziehen könnte.
Sie versuchte, nicht darüber zu grübeln, wie anders ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie die Hälfte der Farm erhalten hätte, die ihr zugestanden hatte. Sicher, ihr Vater hatte Helen immer lieber gehabt, aber er war ein fairer, vernünftiger Mann gewesen. Helen musste ihn manipuliert haben, damit er sein Testament änderte; eine andere Erklärung gab es nicht. Sie war bei ihm gewesen, als es mit ihm zu Ende ging, hatte es die ganze Zeit so geplant. Alt und krank, wie er war, hatte man ihn sicher leicht reinlegen können.
Genau wie für ihre Nachbarn und Freunde hätten diese zwanzigtausend Dollar für das Leben von Edith und Stanley einen unvorstellbaren Unterschied gemacht. Es war schwer, sich nicht zu fragen, ob Helen es je bereut hatte. Edith würde jedenfalls niemals diejenige sein, die das Schweigen zwischen ihnen brach. Wenn Helen so mit ihrer Schwester umging, dann verdiente sie es nicht, eine zu haben.
Während ihre Schwester nun irgendwo in Saus und Braus lebte, durchforstete Edith am Nachmittag die Lokalzeitung nach den Wörtern Teilzeit und abends im Kleingedruckten. Sie hoffte, dass ihr noch genug Zeit bliebe, um Stanleys Mahlzeiten zuzubereiten, damit er nicht wieder Dosen-Chili kochen würde und irgendwann das Haus abfackelte.
»Mach dir um mich keine Gedanken«, sagte Stanley. »Ich muss den Herd ja nicht benutzen. Außerdem sollte ich derjenige sein, der das Abendessen zubereitet. Schließlich bin ich den ganzen Tag zu Hause.«
Das war süß von ihm, aber sie wollte nicht, dass er sich irgendetwas Scharfem oder Heißem näherte. Er hatte all die Jahre Vollzeit gearbeitet, damit sie nur halbtags arbeiten konnte, und nun war sie an der Reihe. Sie musste einfach. Abgesehen von ihren Kindern, waren sie beide alles, was sie hatten.
Sie breitete Stellenanzeigen auf dem abgeschabten grünen Esszimmertisch aus, und einen kurzen Moment lang wünschte sie sich, wieder einen Vater, eine Mutter und eine Schwester zu haben, doch nichts davon wurde gerade angeboten, und das war auch gut so, denn wenn ihre Schwester etwas wie Es war nicht mein Fehler, bitte sprich wieder mit mir in die Zeitung gesetzt hätte, wären Edith die Tränen gekommen.
Doch solche Gedanken konnte sie sich gerade nicht leisten. Wichtiger war, dass in dieser Woche noch nicht einmal halbwegs passende Stellen für sie angeboten wurden und sie erst in sieben Tagen wieder auf die Suche gehen konnte, und wenn es nächste Woche keine gab, sie weitere sieben Tage warten musste. Sie tröstete sich kurz damit, dass sparsames Haushalten eines ihrer beiden großen Talente war. Stanley nannte sie eine Zauberin, doch an der Sache war nichts Geheimnisvolles. Geld war für sie wie der Asphalt für einen Motorradfahrer. Je mehr man davon sah, desto weiter kam man, doch ein einziger Fehler konnte einen den Kopf kosten. Diesen Fehler würde sie jetzt nicht machen.
»Brendan, mir ist da etwas aufgefallen«, sagte Edith am Freitagmorgen zu ihrem Boss. Es fiel ihr schwer, ihn direkt anzusehen, doch in diesem kleinen Büro gab es kaum eine Alternative außer dem Kalender von Far Side und einem Foto von Brendan, nur ihm allein, ohne Hemd in einem Boot, vor langer Zeit an einem sonnigen Ort, wie er eine Regenbogenforelle hochhielt. »Wissen Sie, es kommen in letzter Zeit schrecklich viele Leute hierher, nur, um die Pies zu essen.«
Brendan strich sich über das Kinn. »Ja, das kann man wohl laut sagen.«
Ihre Hände waren bereits schweißnass. »Und ich bin die Einzige, die sie bäckt.«
»Ich weiß.« Er lächelte. »Und das finde ich wirklich fabelhaft. Sie leisten unglaublich tolle Arbeit.«
»Ich habe gehört, Sie haben am Dienstag dreihundertfünfzig Dollar eingenommen.«
Er nickte. »Dreihundertvierundfünfzig, um genau zu sein. Und nicht ich, sondern das Pflegeheim. Dank Ihnen. Und das war sogar unser schwächster Abend bisher.«
Sie spürte das Blut in ihrem Kopf entweder hinein- oder hinausrauschen, so genau konnte sie das nicht sagen. Vielleicht sollte sie einfach wieder gehen und darauf vertrauen, dass er schon die richtigen Schlüsse ziehen würde.
Stattdessen packte sie eine Stuhllehne. »Das nenne ich ein unerwartetes Einkommen.«
»Ja, und wir brauchen es, wissen Sie, um im Foyer ein Oberlicht einzubauen. Ich möchte, dass zukünftige Bewohner hereinkommen und sagen, wow, hier bin ich richtig! Momentan wirkt es noch etwas düster. Finden Sie nicht auch?«
»Ich weiß nicht.« Sie ging nicht mehr durchs Foyer, seit dort lauter gerahmte Zeitungsartikel von ihr und ihren Pies hingen. Das machte sie benommen. Um diese Unterhaltung jetzt zügig und zufriedenstellend zu Ende zu bringen, musste sie wohl gröbere Geschütze auffahren. »Wie Sie wissen, ist mein Mann vor einiger Zeit in Rente gegangen, und nun suche ich einen zweiten Job, damit wir finanziell über die Runden kommen.«
»Oh, wow«, sagte Brendan. »Das ist ganz schön viel für jemanden in Ihrem Alter. Zwei Jobs. Besonders, wenn Sie schon für einen den ganzen Tag auf den Beinen sein müssen.«
Genau in diesem Augenblick hätte sie sagen können, dass sie sich auch nach einem vollkommen anderen Job umsehen könnte, doch sie hielt sich zurück. »Oh, es wird nichts Besonderes sein. Alles, was ich brauche, sind ein paar zusätzliche Dollar.«
Sie starrte auf den Cartoon-Kalender. Es war ein Bild von zwei Männern auf Kamelen in der Wüste. Sie konnte die Bildlegende nicht lesen und hatte keine Vorstellung, was es bedeuten könnte. Vielleicht ging es um Einsamkeit und wie schön es war, einen Freund zu haben. Sie hörte das leise Knarren von Brendans Stuhl, als er sich bewegte.
»Hey!«, sagte Brendan. »Wissen Sie was? Nehmen Sie keinen zweiten Job an. Wie wäre es, wenn ich Ihnen einfach fünfzig Cent pro Stunde mehr gebe? Ich weiß nicht, warum ich nicht eher darauf gekommen bin.«
Edith atmete aus. Es war nicht ganz so viel, wie sie brauchte, doch es war eine Gehaltserhöhung, und das war ihr Ziel gewesen. Sie hatte sich heute Morgen vorgenommen, mit mehr als elffünfzig pro Stunde aus diesem Büro zu gehen, und das hatte sie erreicht. Es war die zäheste und langwierigste Gehaltsverhandlung ihres Lebens gewesen. Nun, wo es vorbei war, konnte sie Brendan auch wieder ansehen.
»Danke. Und wenn Sie bitte auch weiterhin die Zutaten auf der Liste einkaufen würden.«
»Darüber wollte ich noch mit Ihnen reden«, sagte er und sah sich um wie jemand, der im Bus eingeschlafen war, aber seine Haltestelle doch noch nicht verpasst hatte. »Das wird langsam ziemlich aufwendig. Wenn es zum Beispiel keine Haroldson-Äpfel gibt, wäre es viel einfacher und billiger, nur die McIntosh zu nehmen.«
»Haralson«, sagte Edith. »Mein Fehler, ich hätte deutlicher machen sollen, wie wichtig sie sind. Wie ich schon sagte, fahre ich dafür zu McBroom Orchards.«
»Ich weiß, und das bedeutet pro Strecke fünfundvierzig Minuten Fahrt. Ich bezweifle, dass viele Leute den Unterschied merken.«
»Nun, nur mit besonders guten Äpfeln bäckt man besonders gute Pies«, sagte Edith. Sie war ein bisschen verärgert oder vielleicht nur frustriert. War ihm das denn nicht klar? »Wir sind nicht durch billige Zutaten in die Zeitung gekommen. Wenn es so ein Aufwand für Sie ist, geben Sie mir eine Gehaltserhöhung von einem Dollar fünfzig, und ich kaufe die Äpfel selbst.« Sie war so erbost, dass sie gar nicht merkte, was sie da gerade gesagt hatte. Sie wusste noch nicht einmal, woher die Summe von einem Dollar fünfzig gekommen war, doch nun war es raus. Sie hatte gerade um das Dreifache an Gehaltserhöhung gebeten, das er ihr angeboten hatte. Sie konnte es noch zurücknehmen, bevor sie ausgelacht wurde. Sie sah, wie er den Mund öffnete, und versuchte, ihm ins Wort zu fallen.
»Tut mir leid –«
Er sah nicht auf und schien sie nicht gehört zu haben. »Nein, ich verstehe, was Sie meinen«, unterbrach er sie und rieb sich das Kinn. Er schien etwas durchzurechnen, gab dann jedoch auf. »Hört sich gut an, denke ich.«
»Wie bitte?«
»Ein Dollar fünfzig ist in Ordnung, wenn es mir die ganze Fahrerei erspart.«
Ja. Er hatte ja gesagt.
Sie lächelte und durfte noch nicht mal sagen, weswegen. Sie fühlte sich wie ein Kind allein in einer Eisdiele. Sie hatte gerade eine Gehaltserhöhung von einem Dollar fünfzig pro Stunde bekommen, nur, um Äpfel zu kaufen. Was Brendan nicht wusste, war, dass sie die McBrooms seit Jahren kannte und sie ihr immer einen Sonderpreis machten. Manchmal tauschten sie sogar ein paar Tüten Äpfel gegen einen von ihren Pies – sofern es kein Apple Pie war. Und manchmal schenkten sie ihr die Äpfel auch einfach.
»Danke« war alles, was sie sagen konnte.
Als sie ihm die Hand entgegenstreckte, versuchte sie, nicht allzu breit zu lächeln.
Was Brendan gesagt hatte, war natürlich nicht ganz falsch. Bei so vielen Besuchern war es schon möglich, dass einige Leute es gar nicht bemerkt hätten, wenn Ediths Apple-Pies keine Haralsons enthielten, oder es ihnen egal war. Bei manchen von ihnen wurde zu Hause vielleicht auch nie gebacken, vom Unterschied zwischen Haralson und McIntosh mal ganz abgesehen. Aber das hieß trotzdem nicht, dass Edith nicht auch für sie ihr Bestes gab. Und viele Leute würden es bemerken, nicht nur die Zeitungsleute, sondern, viel wichtiger, andere Frauen wie sie. Edith hatte immer ihre Lauscher aufgestellt, immer bereit, ihre Entscheidungen zu erklären oder zu verteidigen, wenn Frauen aus Brainerd, Willmar oder St. Cloud glaubten, ihre Rezepte oder Backmethoden mit Edith teilen zu müssen. Edith würde eher den Mann einer anderen Frau übernehmen als ihr Pie-Rezept, und sie hatte den besten Mann der Welt, na also.
Dann, eines Tages, kam ein Gast, der Ediths Arbeit verstand und wirklich zu würdigen wusste. Sie hieß Amy O’Brien. Sie war ungefähr Mitte vierzig, trug jedoch keinen Ehering und war gebräunt und hübsch, auf diese etwas einschüchternde Art, wie die sogenannten aktiven Mütter schicker Vororte gebräunt und hübsch waren. Doch diese Frau wirkte warmherzig und begeisterungsfähig. Nachdem sie sich vorgestellt hatte, schaute sie Edith in die Augen und sagte, dass dies der beste Pie wäre, den sie je gegessen hätte.
Das war sehr wahrscheinlich, aber dennoch schön zu hören, dachte Edith und erwiderte den Blick. »Danke.«
»Gute Mischung aus Schmalz und Butter für einen knusprigen Teigdeckel«, sagte Amy. »Und der Rhabarber, das ist Macdonald, nicht wahr?«
»Ja, genau«, erwiderte Edith überrascht. »Aber ich benutze manchmal auch Victoria und Canada Red.« Sie hatte seit Jahren nicht das Vergnügen gehabt, mit jemandem über Rhabarbersorten zu sprechen, und ihr ging das Herz auf. »Aber den Macdonald nehme ich für die Pies am liebsten.«
»Ich auch. Mein Vater hatte ihn angebaut, um die Rehe aus dem Garten fernzuhalten. Hat nicht funktioniert. Aber seitdem liebe ich die Sorte. Ich treibe sogar meine Victoria-Pflanzen vor, weil ich es kaum abwarten kann.«
»Ich auch.« Abgesehen von ihrer Mutter und ihr selbst war Amy der erste Mensch, den Edith kennenlernte, der das Wachstum seiner Rhabarberpflanzen im Frühjahr beschleunigte.
»Mein Gott, tut mir leid, jetzt fachsimple ich hier herum«, sagte Amy. »Wie auch immer, ich liebe Ihren Pie. Er ist so herrlich fruchtig.«
Nun, so mögen ihn die Leute, dachte Edith. »Genau so soll er sein.«
»Wissen Sie, ich helfe zurzeit unten in Nicollet Falls in einer Bäckerei aus, und ich kann Ihnen sagen, solche Pies wie diesen hätten wir gern. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie mal runterkämen und wir uns noch ein bisschen unterhalten könnten.«
Diese intelligente, nette und hübsche Frau, mit der sie gerade die beste Unterhaltung seit Jahren geführt hatte, war also eine professionelle Bäckerin, und sie mochte Ediths Pies.
Noch vor einem Jahr hätte Edith das alles abgetan, ohne auch nur einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden, doch vor einem Jahr hatte Stanley noch einen Job und brauchte weder einen Arzt noch Untersuchungen oder Medikamente. Vor einem Jahr hätte Edith noch nicht mal die Möglichkeit aus Amys Worten herausgehört, sie hätte gar nicht darauf geachtet. Und dennoch wäre sie überrascht gewesen, weil sie bei ihrer Antwort nicht an ihren Mann dachte, nicht ein bisschen, zumindest noch nicht.
»Wie wäre es nächste Woche?«
»Für Sie habe ich die ganze Woche Zeit.« Amy lächelte. »Schaffen Sie es am Montag um zehn?«
In diesem Augenblick hatte Edith seit Jahrzehnten das erste Mal das Gefühl, Helen zu verstehen. Es machte ihr Angst, denn während Edith sprach, verstand sie nicht nur, wie ihre Schwester glücklich sein konnte, sondern auch, dass sie womöglich traurig war.
»Ja«, hörte Edith sich selbst sagen.
Eine junge Bierbrauerin
Helen, 1959
Ihr erstes Bier trank Helen Calder im Juli 1959, mit fünfzehn, hinter der Scheune, zusammen mit den Sarrazin-Jungs. Ihr Onkel Moritz und Tante Petunia waren den ganzen Weg von Knife River her zu Besuch gekommen und hatten den Kühlschrank bis obenhin mit Flaschen gefüllt, so dass ein paar weniger gar nicht auffallen würden, hofften die Kinder. Nachdem alle Erwachsenen vorne im Garten waren, begingen Helen, Chesley und Linton ihren Diebstahl.
Gerade, als sich die Kühlschranktür wieder schloss, tauchte Helens schlaksige zwanzigjährige Schwester Edith in der Küche auf und konnte die verdächtigen Ausbuchtungen unter ihren Hemden gar nicht übersehen.
»Da seid ihr ja«, sagte Edith.
»Wir wollten rausgehen und uns die Kühe angucken«, sagte Helen, was letztlich sogar der Wahrheit entsprach. Edith erwiderte nichts und sah Helen mit einem Blick an, unvoreingenommen, als betrachte sie einen Wasserfall, ein Lagerfeuer, etwas Wildes, das sich entsprechend seinen eigenen, schlichten Regeln verhielt, unempfänglich für ihre Meinung oder Kontrolle.
Helen, Chesley und Linton schlichen sich hinaus, jeder mit einer eiskalten Flasche auf dem Bauch, die Arme beim Gehen gekreuzt, um ihr Diebesgut an Ort und Stelle zu halten. Helen blickte zurück zum Haus, wo Edith hinter der Fliegengittertür stand. Sie sah ihnen zu, als säßen sie in einem Riesenrad, das sich ohne sie in Gang gesetzt hatte. Helen fühlte sich fast schlecht, doch das Problem war, dass Edith nie in Schwierigkeiten geriet und nie etwas tat, das sie für riskant hielt. Ihre Vorstellung von Spaß war, Muffins zu verzieren. Doch vielleicht wartete Edith die ganze Zeit nur auf eine Einladung. Sie wollte gerade ihren Namen rufen als Chesley, der kräftige fünfzehnjährige Sohn von Milchbauern, Helens Hand schnappte und sie, nicht unsanft, weiterzog.
»Edith sagt besser nichts«, mahnte er.
»Wird sie nicht«, sagte Helen, und was ihre Schwester betraf, hatte sie immer recht.
»Wann heiratet sie?«, fragte der Jüngere, der zwölfjährige Linton, der von allen Linty genannt wurde. Die Jungs waren fasziniert und verblüfft über die Hochzeit, da Edith noch bis vor kurzem ihre Babysitterin gewesen war.
»Heute in fünf Wochen«, sagte Helen und rannte vorneweg.
»Gehst du hin?«, fragte Linty. Ihn beschäftigte es besonders, dass eine Frau, die sich immer um ihn gekümmert hatte, nun ihr eigenes Leben begann, und er erwartete von den anderen Unterstützung für seinen Widerstand. »Ich nämlich nicht.«
Helen schaute sich zu dem pummeligen kleinen Jungen in seiner Latzhose um, nur drei Jahre jünger als sein schlanker energischer Bruder Chesley, und doch lagen Welten dazwischen. »Natürlich. Sie ist meine Schwester.«
Chesley sagte: »Ich habe gehört, sie zieht weg von hier.«
»Sie kann tun, was sie will, ist mir egal«, sagte Helen, während sie gemeinsam durchs Gras rannten und Chesley an ihr vorbeilief. Die Wahrheit war, dass es ihr doch etwas ausmachte. Ihre Schwester war freundlich und intelligent, und wenn sie etwas geduldiger gewesen wäre, hätte sie einen besseren Fang gemacht als nur einen Lastwagenfahrer. Stanley Magnusson war ein netter Kerl, sicher, aber er war einfach nur der Erste gewesen, der Edith vor zwei Jahren gefragt hatte, ob sie mit ihm ausgehen wolle, als brauche es nicht mehr für ein ganzes Leben mit ihrer Schwester.
Vor ihnen blieb Chesley im Schatten eines alten Schuppens stehen. Das niedergetrampelte Gras dort zeugte davon, wie begehrt diese Stelle war. Vor ihnen erstreckte sich eine endlose unschuldige Wiese; ihren Eltern, dem Haus, der Straße und dem ganzen Rest der langweiligen Erwachsenenwelt hatten sie den Rücken gekehrt.
»Ich werde auch von hier weggehen, wisst ihr«, informierte sie die Jungs.
»Hm.« Chesley verzog das Gesicht. »Warum?«
Sie blickte hinüber zu Chesley und seinem schüchternen kleinen Bruder, in ihren unförmigen Klamotten und schmutzigen Stiefeln inmitten einer windgepeitschten Farm, die Gebäude ausgeblichen, der Geruch von Mist in der heißen Brise. Sie starrte hinaus auf die Milchkühe der Sarrazins, die am Präriegras einer Weide zupften, so weit und eben, dass der Horizont in der Hitze flirrte.
»Was denkst du denn?«, erwiderte sie und griff nach der Bierflasche unter ihrem Hemd.
Als Chesley die Flasche seines Bruders, dann ihre und dann seine eigene öffnete und die Kronkorken einsteckte, wirkte er traurig. »Du willst nicht hierbleiben und heiraten, so wie deine Schwester, hm?«
»Na ja, ich will zuerst aufs College«, sagte sie. »Aber vielleicht komme ich wieder.«
»Ich wette, das wirst du«, sagte Chesley und lehnte sich gegen die Scheune, einen Daumen durch die Gürtelschlaufe und die Bierflasche an der Hüfte, als wäre er James Dean, und hier und jetzt war seine Pose nah genug dran. »Diese Stadtjungs werden dich durchkauen und wieder ausspucken.«
Helen war sich sicher, dass er keine Ahnung hatte, was er da redete, sondern nur etwas nachplapperte, was seine Mum zu irgendwem gesagt hatte, doch sie wollte den Augenblick nicht mit einem Streit ruinieren. Als Chesley und Linty ihren ersten Schluck Bier hinunterkippten, gleichmütig, so, wie sie es bei anderen Männern gesehen hatten, starrte Helen auf das Fitger’s-Etikett der feuchten Flasche.
Das hier war Bier, das Getränk, nach dem ihr Vater sich am Ende eines heißen Tages sehnte. Das hier war das, von dem ihre Mutter behauptete, es würde Helen leichtsinnig machen, und sie würde davon so enden wie ein paar Mädchen aus dem Ort, die stillschweigend von der Schule genommen wurden. Das war das Zeug, von dem ihr abstinenter schwedischer Großvater behauptete, nur ein Tropfen davon schicke sie direkt in die Hölle. Und wie jeder normale Mensch war sie genau deswegen fasziniert. Jetzt hielt sie endlich eine Flasche dieser geheimnisvollen, magischen Flüssigkeit in den Händen.
Sie erschlug eine Mücke auf ihrem Arm und nahm dann einen winzigen Schluck, denn sie glaubte an die Hölle. Sie lehnte ihren verschwitzten Kopf gegen die Scheunenwand und spürte, wie das Bier auf ihre Zunge traf.
Boah, dachte sie.
Ihr Körper flatterte vor Angst, die nichts mit den Warnungen ihrer Familie oder mit Chesley zu tun hatte oder mit sonst irgendetwas, das sie kannte oder sich vorstellen konnte. Sie spürte es in ihrem Mund, hinter den Augen, in ihrem Blut und an Stellen, die noch nie jemand berührt hatte. Es war nicht nur, weil sie etwas Verbotenes tat, das vielleicht sogar dazu führte, dass sie schließlich doch mit Chesley herumknutschen würde, wie sie es sich millionenfach vorgestellt hatte, genau wie er, das wusste sie. Sie hatte Angst, weil es sich so gut anfühlte. Sie hatte Angst, weil es keinen Sinn ergab, dass es ihr schmeckte, und obwohl auf dem Etikett »Duluth, Minnesota« stand, war es so umwerfend, es hätte genauso gut von einem anderen Planeten stammen können.
Es erinnerte sie daran, was damals, mit sieben, auf dem Jahrmarkt passiert war. Eine Frau mit schwarzem Cowboyhut führte Tricks mit einem Lasso vor. Sie war wunderschön, ernst, und vertraute ihrem Körper vollkommen. Sie hätte eine Figur aus einem Comic oder eine Göttin sein können. Als die Frau einen Freiwilligen suchte und Helen anlächelte, erstarrte sie und schüttelte den Kopf, und die Frau wählte stattdessen irgendeinen dummen Jungen aus. Doch Helen sah trotzdem zu und hatte wohl einige Minuten dort gestanden, bevor sie bemerkte, dass ihre Eltern und ihre Schwester schon längst ohne sie weitergegangen waren. Hier bist du also hingerannt, sagte ihre Mutter, als sie sie gefunden hatten, doch Helen war nirgendwo hingerannt. Sie war dort, wo sie sein wollte. »Greif nach den Sternen, Schätzchen«, sagte die Lasso-Frau, als Helen sich ein letztes Mal zu ihr umdrehte.
Und jetzt hatte sie wieder einen Blick in jene andere Welt geworfen, und die Frage war nicht mehr, ob sie je die Hand ihres magischen Gesandten ergreifen würde, sondern, ob sie ihre eigene ausstrecken und einen von ihnen zu sich heranziehen sollte.
Dann rülpste einer der beiden Jungs, der andere lachte, und sie öffnete die Augen – sie hatte gar nicht bemerkt, dass sie sie überhaupt geschlossen hatte –, und Chesley fragte: Na, wie findest du’s? Einen kurzen Moment konnte ihr Verstand kein einziges Wort formulieren, doch dann kam ihr ein Ausdruck in den Sinn, mit dem ihre Lieblingslehrerin Miss McKinley mal ihren Skiurlaub in Lutsen beschrieben hatte: erquickend. Sie wollte sich vor den Jungs jedoch keine Blöße geben, also nickte sie nur.
Sie nahm einen größeren Schluck und spürte das kopflastige wärmende Ziehen des Alkohols und machte sich Gedanken darüber, ob sie nun zur Trinkerin würde. Obwohl es zu Hause nie Thema gewesen war, wusste sie, dass es auf beiden Seiten der Familie Alkoholprobleme gab. In diesem Augenblick hätte sie jedoch ein ganzes Sixpack in zwei Minuten leeren können, nur um zu sehen, wohin das führte.
Linty schmeckte das Bier überhaupt nicht, doch er zwang es sich mutig weiter in den Mund, verzog bei jedem Schluck das Gesicht und bemühte sich, es zu genießen. »Es ist spritzig und erfrischend«, sagte er blinzelnd.
»Blödsinn, Linty«, sagte Chesley. Er runzelte die Stirn, als das Bier seine Lippen berührte, und verriet sich damit. Doch er konnte besser verbergen als sein kleiner Bruder, dass es nicht sein Ding war. »Wow, hab meins schon halb ausgetrunken. Trinkst du deins noch, Helen?«
Sie hielt die leere Flasche hoch, Öffnung nach unten. Er nahm sie ihr behutsam aus der Hand, hielt sie gegen die Sonne und drehte sie.
»Boah«, war alles, was er sagte.
»Wow, das Bier hat ihr geschmeckt«, sagte Linty, schüttete sich etwas von seinem auf den sonnengebräunten Arm und verrieb es auf der Haut. »Schaut mal, ist gut gegen Mücken.«
»Ha, damit machst du sie besoffen«, sagte Chesley.
Helen schnappte sich die Flasche des kleineren Jungen. »Hör auf, es zu verschwenden! Wenn du es nicht willst, gib es mir.« Die Worte waren ihr herausgerutscht, noch bevor sie überlegen konnte, ob sie sich wie ein Suffkopp anhörte. »Oder ich teile sie mir mit deinem Bruder.«
»Ich trink sie aus«, sagte Linty, nahm ihr die Flasche wieder ab und hielt sie sich an den Mund. Helen sah zu, wie das kostbare Bier sich an den Lippen des Jungen sammelte und an seinem rosigen Kinn hinunter auf die Latzhose tropfte. Sie schluckte die Wut über diese Verschwendung herunter.
Obwohl sie in zwei Monaten in die zehnte Klasse kam und annahm, dann auch endlich am Wochenende zu Partys eingeladen zu werden, vermutete sie, dass es noch eine Weile dauern würde, bis sie wieder ein Bier bekäme. Sie kannte Familien, die an Feiertagen freizügig den Alkohol mit ihren Kindern teilten, und sie hatte von Jungs gehört, die von ihren Vätern am Abend nach der Jagd, dem Angeln oder harter Arbeit ein Bier angeboten bekamen, doch sie hatte noch nie von einem Mädchen gehört, dem irgendwer ein Bier anbot, außer Jungen, die sie betrunken machen wollten. Kein Wunder, dass die älteren Mädchen so ein verklemmtes Verhältnis dazu hatten.
Chesley könnte ihr aushelfen. Das tat er immer. Nachdem sie die leeren Flaschen bei den Kiefern verbuddelt hatten, legte sie ihm eine Hand auf die Schulter.
»Lass uns noch eine holen. Nur noch eine.«
»Ich will nicht erwischt werden«, sagte er und säuberte seine schmutzigen Hände im Gras.
»Komm schon.« Sie hielt seine Hand und rieb mit dem Daumen über die Knöchel. »Lass uns noch eine holen, jetzt gleich.«
Seine Hand erwiderte den Druck, und er sah ihr ins Gesicht. »Gehst du wirklich aufs College?«
»Nicht, wenn du es nicht willst«, sagte sie, und in diesem Moment hätte das fast gestimmt.
Das Beste und das Schlimmste an Chesley Sarrazin war, dass er in dem Wissen aufwuchs, eines Tages eine Molkerei zu erben. Also zog er auch nie eine andere Zukunft für sich oder für die Frau, die er heiraten würde, in Betracht. Diejenigen, die diese Zielgerichtetheit nicht nachvollziehen konnten, ignorierte er. Und Helen musste zugeben, dass er damit nicht falschlag.
Er nickte und ließ ihre Hand los, als er hinüber zum Haus schaute. »Man könnte uns sehen«, sagte er und ging vorneweg, ohne sich noch mal umzudrehen, als rechnete er fest damit, dass sie ihm folgen würde.
Helen begann, sich in Geduld zu üben. Auf Teenager-Partys gab es meist nur kleine Flaschen Schnaps, Obstbrand, Kirschlikör oder kanadischen Whiskey oder ein ähnlich mieses Gesöff, was nur dazu diente, die anderen abzufüllen. Aus einem solchen Grund Alkohol zu trinken war für Helen dasselbe, wie ein Rind zu schlachten, um den Hund zu füttern, doch diese Teenager waren gelangweilt, hatten nur wenig Besseres zu tun und taten deswegen das, was Generationen vor ihnen schon getan hatten.
Auf Hochzeiten gab es in Minnesota grundsätzlich Bier, und sie fragte sich, ob sie auf der Hochzeit ihrer Schwester an welches rankommen könnte. Dort würde sie sowieso niemand beachten. Sie war zu alt, um Blumen zu streuen – die Aufgabe fiel Stanleys vierjähriger Nichte zu –, und Ediths vier Brautjungfern waren die anderen Mädchen der Starting Five aus ihrer Highschool-Basketballmannschaft. Helen wäre gern extra spät gekommen, damit alle mitbekamen, wie sträflich man sie vernachlässigt hatte, doch das war schwierig, wenn die Eltern einen fuhren.
Die Hochzeit ihrer Schwester war eine ziemlich trostlose Angelegenheit. Der einzige Schmuck in der Kirche waren am Geländer befestigte Kunstblumen. Das Kirchenheft passte auf ein einziges Faltblatt, und zu essen gab es nur Schweinebraten und Salate, die von den Kirchenfreundinnen ihrer Mutter gestiftet worden waren. Alles wirkte so verdammt erschwinglich. Ihre eigene Hochzeit stellte Helen sich völlig anders vor.
»Wo gibt es etwas zu trinken?«, fragte Helen ihren Vater.
Er zeigte auf einen Tisch am hinteren Ende des Kirchenkellers, auf dem eine langweilige weiße Tischdecke lag. »Die Bowle und die Wassergläser sind noch nicht aufgestellt. Du hättest zu Hause noch etwas trinken sollen.«
»Gibt es noch etwas anderes außer Bowle und Wasser?«
»Wieso?«, fragte ihr Vater.
Ihre Mutter stand plötzlich da und zog an Helens Arm. »Deine Schwester möchte dich sehen.«
Gut. Edith würde es wissen.
Ihre Schwester war in einem Büro seitlich des Eingangs versteckt worden, damit Stanley sie nicht vor der Zeremonie sehen würde. Edith sah in ihrem Kleid eigentlich ganz hübsch aus. Zumindest besser als sonst. Für das zweitgrößte Mädchen der Schule war es vermutlich nicht so einfach, ein anständiges Hochzeitskleid zu finden.
»Da bist du ja«, sagte Edith, beugte sich vor und streckte Helen eine weiße Blüte entgegen. »Damit die Leute wissen, dass du zur Familie gehörst.«
»Das können die sich schon denken«, erwiderte Helen, als Edith ihr die Blume am Sommerkleid befestigte. »Oh, und Dad möchte wissen, ob es auch Bier gibt.«
Edith stöhnte. »Jetzt schickt er schon dich, um mich zu nerven. Na ja, dafür ist es eh zu spät.«
»Oh, was ist passiert?«, fragte Helen, bemüht, eher gelangweilt als neugierig zu wirken.
»Stanleys Bruder und seine Frau wären nicht gekommen, wenn es Alkohol gegeben hätte.«
Helen biss sich auf die Zunge. Was für ein miserabler und jämmerlicher Reinfall diese Hochzeit werden würde. Bestimmt war sie ein Kandidat für die mieseste Hochzeit aller Zeiten. Nicht, dass sie das ihrer Schwester gegenüber äußern konnte, doch einen Kommentar konnte sie sich nicht verkneifen.
»Das ist das Dümmste, was ich in meinem ganzen Leben je gehört habe«, sagte Helen. »Wie kann man nur eine Hochzeit ohne Bier feiern? Wie kann man es allen anderen auf der Feier verbieten, nur, weil man es selbst nicht mag?«
»Er ist sein Bruder, und es ist wichtig, dass er dabei ist.« Edith sah Helen aus zusammengekniffenen Augen an wie jemand, der einen Fleck auf einem brandneuen Mantel entdeckt hatte. »Warum interessiert dich das so?«
»Interessiert mich nicht, ich frage für Dad.«
»Du willst dir wieder eins klauen, oder?«
»Nein«, sagte Helen so überzeugend wie möglich.
Ediths Gesicht sah liebevoll aus, fast schon mitleidig. Dann sagte sie: »Du bist nicht alt genug«, und das war’s dann.
Die Hochzeit selbst war blöd und dauerte ewig. Ihre Mutter weinte, als die Ehegelübde abgelegt wurden, aber das tun alle Mütter, dabei konnte man die Gelübde nicht mal richtig hören. Helen sah den miesen Bruder, auf dessen Konto der Schwachsinn mit dem Bier ging, und er wirkte mit seinen dicken Brillengläsern und dem runden Kahlkopf wie ein widerlicher Kerl.
Hinterher gingen die ungefähr sechzig Gäste, fast ausnahmslos Verwandte und die meisten davon alt, im Gänsemarsch hinunter in den Keller, aßen den trockenen Schweinebraten und schwatzten, in erster Linie über das Wetter und über Abwesende. Chesley und Linty waren nicht dabei, niemand in Helens Alter war dabei, und zu allem Überfluss wurde ihr die unerfreuliche Aufgabe übertragen, eine Gruppe kleinerer Jungs im Auge zu behalten. Edith hatte noch nie so glücklich ausgesehen, und Helen wusste genau, warum. Sie konnte jetzt endlich von hier abhauen.
Eines Abends, nach dem Homecoming-Footballspiel für die Ehemaligen, draußen auf dem Mathiowetz Field, wo ihre Highschool 28 zu 6 gegen Hinckley verloren hatte und damit besser abschnitt als erwartet, ging Helen gerade mit Chesley und zwei anderen über den Parkplatz, als ihnen ein Typ in einer Collegejacke entgegenkam.
»Hey, Mann«, sagte der Junge zu Chesley. »Gehst du zu Dean Travis’ Party?«
Dean Travis war unendlich cool, ein Sportler aus der Oberstufe, der bei seinem Vater lebte, einem Geschäftsreisenden, der an den Wochenenden öfter mal unterwegs war. Unter derart magischen Umständen schmiss Dean seine Partys, auf denen das Bier angeblich in Strömen floss.
»Klar«, sagte Helen.
»Ich weiß nicht«, sagte Chesley. »Kommt auf Toby an. Er fährt.«
Toby Chamberlains Vater war der ortsansässige Ford-Händler, weswegen Toby ein Auto besaß und immer derjenige war, der fuhr und sich obendrein noch den Wünschen der Mehrheit beugte. Das Problem war nur, dass sie heute gemeinsam mit Lucy Koski unterwegs waren, in die Toby dermaßen verknallt war, dass selbst Lucy es merkte.
Toby war ein intelligenter, höflicher und gutaussehender Typ, und es gab nichts, was auf seinen merkwürdigen Frauengeschmack schließen ließ. Im Grunde hatte man bei Lucy die spaßfreiesten Seiten Ediths in einen Körper von halber Größe, aber zehnfacher Lautstärke gestopft. Weil ihre Mütter Freundinnen waren, kannten sich Helen und Lucy schon seit der Geburt. Die Leute glaubten, sie seien beste Freundinnen, nur weil sie beide niedliche Mädchen waren, die ihr ganzes Leben immer wieder gemeinsam irgendwo auftauchten, doch sie duldeten sich eher, weil die Nähe der anderen sowieso unvermeidlich war. Dieses eher erzwungene Bündnis ging nach beinahe sechzehn Jahren daran zu Bruch, dass Lucy nichts trank, weil es gegen das Gesetz verstieß.
»Warum fahren wir nicht zu mir und spielen Karten?«, fragte Lucy, als alle im Auto saßen.
»Hört sich gut an«, sagte Toby und startete den Wagen.
»Lucy, du musst ja nichts trinken, aber komm doch wenigstens mit. Sei nicht so eine Spaßbremse.«
Lucy drehte sich auf ihrem Sitz um und funkelte Helen böse an. »Das tut nichts zur Sache. Meine Mum würde mich umbringen, wenn sie herausfände, dass ich auch nur eine Minute in diesem Haus war. Und sie würde es sicher auch deiner Mutter erzählen.«
Es stimmte, Dean und sein Vater hatten bei den Spießern in der Gegend nicht den besten Ruf, doch seine Partys waren quasi eine öffentliche Veranstaltung. Es war nicht Deans Schuld gewesen, dass beim letzten Mal eins von den besoffenen Kids vom Dach gesprungen und sich das Bein gebrochen hatte.
»Ist mir egal, wenn ich Ärger kriege«, sagte Helen. »Schieb es einfach auf mich.«
»Manchen von uns macht es aber was aus, okay? Es geht nicht nur um dich, Helen. Ich wette, Tobys Dad würde auch nicht wollen, dass er auf diese Party geht.«
Toby lachte, als er wendete, die Lichter der Stadt und Dean Travis’ Haus hinter sich ließ und auf die ländliche Dunkelheit zusteuerte. »Nope.«
»Toby, dann setz mich doch einfach bei Dean ab. Ich komm schon irgendwie nach Hause«, sagte Helen, doch Toby wurde noch nicht mal langsamer.
»Und wenn dir dann was passiert, ist es meine Schuld«, sagte Toby.
Helen blickte durch das Heckfenster in die Richtung von Dean Travis’ wundersamem Haus, das inzwischen schon über vier Kilometer weit weg, im Grunde aber unerreichbar war. Sie warf Chesley einen bösen Blick zu. Er seufzte.
»Eine tolle Hilfe bist du.«
»Toby ist der Fahrer«, sagte er und wandte den Blick ab. »Ich mach’s wieder gut.«
»Wir brauchen kein Bier, um heute Abend Spaß zu haben, stimmt’s, Toby?«, sagte Lucy und lächelte Helen dann auf eine Art an, wie Leute lächeln, wenn sie eine Fliege totgeschlagen hatten. Diese Menschen waren ihre besten Freunde, aber sie fühlte sich bei ihnen wie das einsamste Mädchen der Welt.
Zwei Tage später wollte sie gerade mit ihren Eltern frühstücken.
»Ich habe fast vergessen, dich zu fragen, Helen«, sagte ihr Vater und faltete die Zeitung. »Was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag?«
»Ein Bier«, sagte Helen. Sie hatte es gar nicht sagen





























