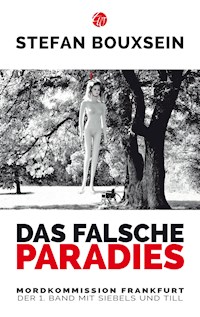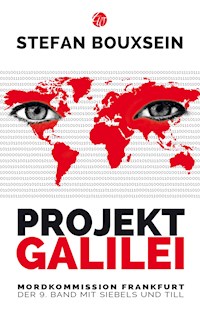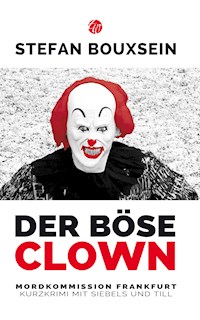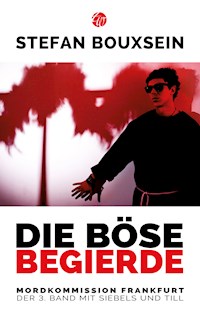
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Traumwelt Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mordkommission Frankfurt
- Sprache: Deutsch
Nackt sitzt er im Blut der Toten. Er ist ein Mönch und spricht kein Wort. Nachdem ihre Großmutter verstorben war, sollte die Tote eigentlich die Nachfolge in der Führungsspitze des familiengeführten Konzerns einnehmen. Die Großmutter war lange Zeit die unangefochtene Patriarchin im Unternehmen gewesen. Kurz vor ihrem Tod verfasste die alte Dame ihre Biographie, in der sie ein gut behütetes Geheimnis offenbarte. Ihre Lebensgeschichte hinterließ sie einem Mann, der noch nie zuvor von ihr gehört hatte. Und dessen Leben damit eine dramatische Wendung nahm. Siebels und Till ermitteln im Benediktiner-Orden und bei der Familie der Ermordeten. Aber eine Klausel im Testament der Großmutter stellt nicht nur die Kommissare vor ein großes Rätsel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Bouxsein
Die böse Begierde
Kriminalroman
Der Autor
Stefan Bouxsein wurde 1969 in Frankfurt/Main geboren. Studium der Verfahrenstechnik und des Wirtschaftsingenieurwesens an der FH Frankfurt. Seit 2006 verlegt er seine Bücher im eigenen Traumwelt Verlag.
Bisher erschienen von Stefan Bouxsein:
Krimi-Reihe mit Siebels und Till:
Das falsche Paradies, 2006
Die verlorene Vergangenheit, 2007
Die böse Begierde, 2008
Die kalte Braut, 2010
Das tödliche Spiel, 2011
Die vergessene Schuld, 2013
Die tödlichen Gedanken, 2014
Die Kronzeugin, 2015
Projekt GALILEI, 2018
Seelensplitterkind, 2021
Der böse Clown (Kurzkrimi), 2014
Außerdem:
Kurz & Blutig (Vier Kurzkrimis), 2015
Humor: Idioten-Reihe mit Hans Bremer:
Der nackte Idiot, 2014
Hotel subKult und die BDSM-Idioten, 2016
Erotischer Roman von Suann Bonnard:
Die schamlose Studentin, 2017
Mein perfekter Liebhaber, 2019
Erfahren Sie mehr über meine Bücher auf:
www.stefan-bouxsein.de
© 2021 by Traumwelt Verlag
Stefan Bouxsein
Johanna-Kirchner-Str. 20 · 60488 Frankfurt/Main
www.traumwelt-verlag.de · [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung:
Nuilani – Design und Kommunikation, Ralf Heller
www.nuilani.de · [email protected]
Titelbild: Adobe Stock
ISBN 978-3-939362-08-1
4. Auflage, 2021
1
Er war allein im Oratorium. Allein mit Gott. Seine Knie sanken auf den kalten, kahlen Boden. Seine Stirn presste sich auf den nackten Beton. Seine Hände waren gefaltet, die Arme ausgestreckt. Er spürte weder den harten Boden noch die Kälte. Er war hin- und hergerissen zwischen Schuld und Vergebung, zwischen Sünde und Buße. Er versuchte sich zu beruhigen, ging in sich, wie so oft in seinem Leben. In seinem Inneren brannte ein Feuer. Schluchzend flüsterte er sein Gebet.
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Er fühlte sich nun in der Lage, endlich den braunen Ledereinband zu öffnen. Vor drei Tagen war dieser eingetroffen und in der Obhut des Abtes geblieben. Drei Tage Bedenkzeit hatte er vom Abt auferlegt bekommen. Drei Tage, die er mit innigem Gebet verbringen sollte. Danach musste er entscheiden, ob er den Einband in Empfang nehmen wollte oder ob der Abt das Geheimnis seiner Herkunft mit ins Grab nehmen sollte. Er hatte gebetet und gefastet. Dann hatte er seinen Entschluss gefasst.
Das Anschreiben, das auf dem braunen Ledereinband gelegen hatte, hatte er schon vor drei Tagen gelesen. So viel hatte ihm der Abt zugestanden. Es waren nur ein paar Zeilen. Zeilen, die seinen Glauben auf das Tiefste erschüttert hatten. Eine Ahnung hatte er schon immer gehabt. Eine Ahnung, die tief in ihm verankert war. Nun sollte aus der Ahnung Gewissheit werden. Er hatte die Wahrheit in den Händen und er fürchtete sich davor. Noch einmal faltete er seine Hände. »Gott steh mir bei«, flüsterte er. Dann öffnete er den braunen Ledereinband und fing an zu lesen.
Mein Leben, Wilhelmine Arenz
Heute ist der 15. Februar des Jahres 2007. Es ist mein 87. Geburtstag und es drängt mich, mein Leben niederzuschreiben. Viel Zeit habe ich nicht mehr, vielleicht noch ein halbes Jahr, vielleicht noch ein Jahr, vielleicht aber auch nur noch wenige Tage oder Wochen. Das Schreiben fällt mir schwer, die Finger gehorchen nicht mehr, es ist nicht die Gicht, die mir zu schaffen macht, es ist einfach das Alter.
Ich will nicht jammern, will mich nicht beklagen und will auch keine Anklage erheben mit der Niederschrift meines Lebens. Ich will nur ein wenig Klarheit in das Dunkel bringen, will meinen Nachkommen die Chance geben, das Schlechte zu meiden und das Gute zu leben.
Je älter ich werde, desto deutlicher erscheinen mir wieder meine Kindheit und meine frühe Jugend vor meinem geistigen Auge. Geboren wurde ich als Wilhelmine Güttlicher in einem kleinen Dorf in Ostpreußen als viertes von sechs Kindern. Das Leben zu jener Zeit war hart und voller Entbehrungen und doch war es rückblickend eine wunderbare Zeit gewesen. Eine Zeit der Unschuld und eine Zeit der Hoffnung. Es war eine Zeit der Umwälzungen, der große Krieg war vorüber, die Menschen suchten nach Orientierung und waren froh, wenn sie die hungrigen Kinder in der Familie ernähren konnten.
Seit meinem zwölften Lebensjahr war ich das Arbeiten vom frühen Morgen bis in die Abendstunden gewöhnt. Als ich älter wurde, wuchs mein Verlangen, das Haus, den Hof und meine Familie zu verlassen und ein neues Leben zu beginnen. Mein eigenes Leben.
Ich war 16 Jahre alt, als ich Fritz kennen lernte. Fritz war zwei Jahre älter als ich und kam aus dem Nachbardorf. Sein erster zärtlicher Kuss begleitete mich nächtelang in meinen Träumen. Ich konnte es kaum erwarten, meine kindliche Unschuld zu verlieren. Meine Hoffnungen auf ein neues glückliches Leben an der Seite von Fritz wuchsen mit jedem geträumten Traum.
Im Mai 1938 gab ich Fritz das Versprechen, ihm treu zu sein bis in den Tod. Ich war neunzehn und sah in den strahlenden Augen meines Bräutigams eine rosige Zukunft. Auch ein anderer Mann nährte meine Hoffnung auf ein besseres Leben. Adolf Hitler ging in großen Schritten voran und wir folgten ihm bedingungslos.
20. Dezember 2007, 11:55 Uhr
Siebels saß rauchend hinter dem Steuer und fuhr auf der Friedensbrücke über den Main. Zu seiner Linken ragten die gläsernen Bankentürme in den klaren blauen Himmel. Sein Kollege Till saß neben ihm und faselte etwas von Glühwein und Weihnachtsmarkt, aber Siebels hörte nur mit halbem Ohr zu. Eigentlich wäre heute sein erster Urlaubstag gewesen und eine Fahrt mit Sabine in die Rhön stand auf dem Programm. Eine Woche Urlaub abseits der Stadt, vielleicht mit etwas Schnee, war durch den Anruf von Staatsanwalt Jensen vor einer halben Stunde zunichtegemacht worden. Till hatte zur gleichen Zeit mit seiner Freundin Johanna vor dem Computer gesessen und sich die Last-Minute-Angebote für einen Trip auf die Kanarischen Inseln angeschaut. Jetzt saßen beide missmutig nebeneinander. Siebels schwieg eisern und Till versuchte die Situation mit Galgenhumor zu meistern.
»Klären wir halt schnell noch einen Mord auf, kippen uns anschließend auf dem Weihnachtsmarkt ein paar Becher Glühwein rein und hauen dann ab, ich zum Strand und du in die Rhön.«
Siebels fuhr Richtung Commerzbank-Arena und bog dann auf der Kennedyallee links ab. Sein Ziel war die Villa Liebig, deren Einfahrt er gerade passierte. Zwischen der Einfahrt und der Villa lag noch ein weitläufiges, parkähnliches Grundstück. Am Eingang der Villa standen zahlreiche Streifenwagen. Polizisten warteten dort und tranken heißen Tee aus Thermoskannen. Weiß-rote Absperrbänder waren rings um die Villa angebracht, ein Leichenwagen stand mit geöffneter Heckklappe auf der Zufahrt. Siebels brachte seinen BMW zwischen zwei Streifenwagen zum Stehen und betrachtete sich die Szenerie, bevor er endlich seinen optimistischen Beifahrer eines Besseren belehrte.
»Erstens: Wenn Jensen uns in allerletzter Sekunde aus dem Urlaub zurückpfeift, handelt es sich wieder mal um einen ganz heiklen Fall. Zweitens: Leiche in Villa bedeutet Ermitteln mit Fingerspitzengefühl. Das wird uns Meister Jensen bestimmt gleich höchstpersönlich erörtern. Und drittens: Sowie das Ding aufgeklärt ist, buche ich mit Sabine was Nettes auf Kuba oder Jamaika. In der Rhön sind wir nämlich auf keinen Fall sicher genug vor Jensen und neuen Fällen.«
Die beiden stiegen aus dem Wagen, zeigten den frierenden Polizisten ihre Ausweise und gingen Richtung Villa, von wo ihnen plötzlich Jensen entgegeneilte.
»Da sind Sie ja endlich meine Herren. Es tut mir leid, dass aus Ihrem Urlaub jetzt nix geworden ist, aber hier handelt es sich wirklich um einen sehr heiklen Fall. Da kann ich unmöglich auf meine besten Leute verzichten.«
Siebels und Till tauschten einen vielsagenden Blick aus.
»Was ist denn passiert?«, brummte Siebels.
»Ein Mord!«, entfuhr es Jensen.
»Wie schrecklich«, amüsierte sich Siebels. »Daher haben Sie uns herbestellt, weil wir von der Mordkommission sind. Und ich habe mir schon wer weiß was gedacht.«
Siebels erntete einen bösen Blick vom Staatsanwalt. »Was da drin passiert ist, das ist eine böse Sauerei. Die Lage ist ernst und Sie sollten es auch sein. Bevor Sie reingehen, schlüpfen Sie aber in die Überzieher. Die Kollegen von der Spurensicherung sind noch mit der Sicherung von Spuren beschäftigt.«
Siebels verkniff sich jeden weiteren Kommentar, was ihm nicht leichtfiel, und ließ sich die Plastikhüllen reichen, die er und Till sich über die Schuhe zogen, bevor sie die Villa betraten.
»Die Leiche liegt im ersten Stock«, klärte Jensen sie auf. »Bevor Sie sich das anschauen, lassen Sie sich besser erst mal von dem Gerichtsmediziner erklären, was passiert ist. Oben wimmelt es noch von Kriminaltechnikern und Spurenleuten. Hier unten müssten sie aber bald fertig sein.«
Siebels betrachtete sich die kleinen Blutspritzer auf den Bodenfliesen im Eingangsbereich. Fotos wurden geschossen, Proben von den Fliesen gekratzt, auf Türklinken nach Fingerabdrücken gesucht.
»Guten Tag, Herr Kommissar«, meldete sich eine vertraute Stimme.
»Ach nee«, entfuhr es Siebels, als er den Gerichtsmediziner die Treppe vom ersten Stock herunterkommen sah. »Der alte Doktor Petri treibt immer noch sein Unwesen.«
Petri kam Siebels mit ausgestreckter Hand entgegen und begrüßte ihn mit einem kräftigen Händedruck.
»Ich bin noch gar nicht so alt, ich sehe nur so aus. Kommen Sie, gehen wir in die Küche und trinken erst mal einen Tee mit Rum. Die Haushälterin wartet dort, sie hat die Leiche gefunden.« Bevor sie in die Küche eintraten, begrüßte Petri auch Till, den er noch gar nicht zur Kenntnis genommen hatte.
»Guten Tag, junger Mann. Wie ich höre, sind Sie immer noch der schlechteste Schütze im ganzen Revier.«
»Ja, aber ich übe viel, es kann nur besser werden«, entgegnete Till.
Siebels verdrehte gespielt genervt seine Augen. »Ständig ruft Schneider bei mir an und beschwert sich über den Kerl«, verriet er Petri. Schneider war Ausbilder auf dem Schießstand im Polizeipräsidium. Bei den regelmäßigen Schießübungen mussten die übenden Beamten auf Leinwände zielen, die plötzlich aus dem Nichts aufzutauchen schienen. Auf den Leinwänden waren Motive abgebildet, die es zu treffen galt oder auch nicht. Mal erschien ein harmloses Reh am Waldrand, mal ein vermummter Bankräuber, mal ein kleines Kind auf einem Spielplatz. Der Schütze musste blitzschnell erkennen, ob es einen Grund zum Schießen gab oder nicht. Wenn es einen gab, musste er möglichst zielsicher einen Schuss abfeuern. Till hatte eine Lieblingsleinwand. Sie zeigte eine ältere grauhaarige Frau, die von zwei bewaffneten Männern in Schach gehalten wurde. Sowie diese Leinwand vor Till hochschnellte, jagte er der Oma ein paar Kugeln in den Kopf. Er nannte sie Oma bin Laden, die Mutter aller Terroristen. Schneider hatte allerdings keinen Sinn für den Humor von Till und beschwerte sich regelmäßig bei Siebels über dessen schießuntauglichen jungen Kollegen.
In der Küche saß die Haushälterin und wurde von einem Sanitäter betreut. Man sah ihr an, dass sie unter Schock stand. Trotzdem ging Petri auf sie zu und fragte, ob sie einen Tee mit Rum für ihn und die beiden Beamten von der Kriminalpolizei zubereiten könnte. Sie nickte stumm und stand auf.
»Für uns beide bitte ohne Rum«, bat Siebels.
»Der kann jetzt nicht schaden, Dienst hin oder her«, widersprach Petri.
»Na gut«, gab Siebels nach. »Dann bitte auch für mich mit Rum. Eigentlich bin ich ja auch im Urlaub.«
»Wenn schon kein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, dann wenigstens Rum im Tee«, warf Till dazwischen, um das Gewissen des gewissenhaften Siebels zu beruhigen.
Die Haushälterin servierte den Tee. »Das ist Frau Bromowitsch«, stellte Petri sie vor. »Vielleicht sollten Sie sich einen Moment hinlegen, Frau Bromowitsch. Meine Kollegen von der Mordkommission werden nachher bestimmt noch Fragen an Sie haben.«
Frau Bromowitsch nickte wieder stumm und der Sanitäter führte sie aus der Küche.
Petri, Siebels und Till schlürften ihren Tee und betrachteten sich durch das Küchenfenster die frierenden Streifenbeamten.
»Was ist hier eigentlich passiert?«, wollte Till endlich wissen.
Petri nickte und fing an zu erzählen. »Vielleicht ist Ihnen der Name Liebig ein Begriff?«
»Klar«, sagte Till. »In Frankfurt gibt es eine Liebigstraße, ein Liebig-Gymnasium und ein Liebieg-Café. Wird ein berühmter Dichter oder Maler gewesen sein.«
»Da ist unser junger Kriminalist auf der falschen Spur«, gab Petri zurück. »Die Örtlichkeiten, von denen Sie sprechen, wurden entweder nach dem deutschen Chemiker Justus von Liebig oder nach dem Fabrikanten Heinrich Baron von Liebieg benannt. Letzterer ist Namensgeber für das Liebieghaus am Schaumainkai. Die Villa Liebig, in der wir uns hier befinden, hat ihren Namen von seinen Bewohnern. Hermann und Eva Liebig. Die beiden haben weder mit dem Chemiker noch mit dem Baron etwas zu tun. Sie befinden sich übrigens im Urlaub. Man versucht gerade, sie ausfindig zu machen.«
»Und wer ist jetzt ermordet worden?«, wollte Siebels wissen.
»Magdalena Liebig, die Tochter.«
»Und warum sollte uns der Name Liebig ein Begriff sein?«, kam Till wieder auf den Ausgangspunkt zurück.
»Nun ja«, begann Petri nachdenklich. »Vielleicht fangen wir anders an. Arenz. Sagt Ihnen dieser Name etwas?«
»Die Arenz-Werke?«, fragte Siebels.
»Volltreffer. Die Arenz-Werke. Eines der größten deutschen Unternehmen, das noch in Familienbesitz ist. Wahrscheinlich erinnern Sie sich, dass Wilhelmine Arenz erst vor einigen Wochen gestorben ist. Das ging durch alle Medien.«
»Ja, jetzt dämmert es mir«, gab Siebels zurück. »Hermann Liebig ist der Sohn aus erster Ehe von Wilhelmine Arenz. Ist er nicht der oberste Mann bei den Arenz-Werken?«
Petri schüttete sich noch etwas Rum in seinen Tee. »Hermann Liebig leitet die Arenz-Werke. Aber er ist nur Angestellter. Jedenfalls war er es bis zum Tod seiner Mutter. Bis dahin hat das Unternehmen mehrheitlich Wilhelmine Arenz und deren Kindern aus zweiter Ehe, Peter und Klara Arenz, gehört.«
»Wir haben es hier also mit Millionären zu tun?«, fragte Till.
»Sagen wir besser mit Milliardären. Oder noch besser mit Multi-Milliardären.«
»Da wird uns Jensen keine einzige ruhige Minute über Weihnachten lassen«, stöhnte Siebels.
»Das glaube ich auch«, pflichtete Petri ihm bei.
»Na, dann schießen Sie doch endlich mal los.«
»Nun ja«, begann Petri zögerlich. »Die Leiche von Magdalena Liebig liegt im Schlafzimmer ihrer Eltern. Sie wurde mit einem Messerstich getötet. Das war eine blutige Angelegenheit. Der Stich ging genau in die Halsschlagader. Das Blut muss nur so gespritzt haben. Sie werden es ja gleich sehen.«
»War es ein Einbruch? Hat es einen Kampf gegeben?«
»Nach meinen Kenntnissen gibt es keine Einbruchsspuren. Ob es zum Kampf kam, muss noch geprüft werden. Und wenn es einen gegeben hat, bleibt noch die Frage, wer mit wem gekämpft hat.«
»Was soll das denn wieder heißen?«
Petri räusperte sich. »Die Haushälterin hat nicht nur die Leiche gefunden. Neben der Leiche saß ein Mann auf dem Fußboden in ihrem Blut.«
»Der Täter? Warum sagen Sie das denn erst jetzt?«
»Es ist eher unwahrscheinlich, dass er der Täter ist. Jedenfalls hatte er kein Messer.«
»Vielleicht hat er sie umgebracht, ist dann spazieren gegangen, hat das Messer entsorgt und ist wieder zurückgekommen?«, warf Till ein.
»Auch eher unwahrscheinlich. Aber das müssen Sie mit der Spurensicherung klären. Die waren sich jedenfalls ziemlich sicher, dass er das Haus zwischenzeitlich nicht verlassen hat. Er saß übrigens nackt in ihrem Blut. Sie war auch nackt, als sie abgestochen wurde.«
»Wo ist er denn? Und was sagt er?« Siebels war ziemlich durcheinander.
»Er ist zur Untersuchung im Krankenhaus. Gesagt hat er nichts. Er war völlig apathisch. Es könnte sein, dass er einfach nur unter Schock stand, als ich eingetroffen bin. Aber ich befürchte, der Kerl hat tiefergreifende psychische Störungen. Er hatte einen völlig irren Blick. Deswegen habe ich veranlasst, dass er schnellstmöglich in der Psychiatrie unter die Lupe genommen wird.«
»Ist ja gleich um die Ecke«, besänftigte Till Siebels, der gerade anfangen wollte, sich über das Vorgehen in diesem Fall aufzuregen.
Die Psychiatrie war tatsächlich nur einige hundert Meter von der Villa entfernt. Trotzdem hätte Siebels sich gerne am Tatort ein Bild von dem Mann gemacht.
»Der läuft Ihnen nicht weg und gesagt hätte er ohnehin nichts, darauf mein Wort«, versprach Petri. »Vier Streifenbeamte haben ihn begleitet und passen auf ihn auf. Und jetzt sollten wir nach oben gehen. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Eine Botschaft wurde auch hinterlassen. Ob sie vom Täter stammt oder von dem Mann, der jetzt in der Psychiatrie ist, klären die Kollegen von der Spurensicherung. Natürlich vorausgesetzt, der Kerl ist wirklich nicht der Täter.«
2
Der Abt hatte ihm eine Einzelzelle zugewiesen, damit er sich in aller Abgeschiedenheit mit dem auseinandersetzen konnte, was ihm so unverhofft zuteilgeworden war. Sein Körper sollte rein sein, damit er einen klaren Geist habe, hatte der Abt verordnet. Und er sollte viel beten. Beten und fasten.
Er trank einen Schluck Wasser, aß ein trockenes Stück Brot und schlug seinen braunen Ledereinband auf.
Mein Leben, Wilhelmine Arenz
Nach unserer Hochzeit zogen Fritz und ich in das nahe gelegene Königsberg. Fritz fand dort eine Wohnung und Arbeit in einer Fabrik. Abends saßen wir gemeinsam vor dem Radio, dem Hochzeitsgeschenk seiner Eltern. Wir lauschten den Stimmen, die aus dem Radio kamen. Man sprach über uns. Über Ostpreußen, das seit dem Versailler Vertrag mitten in Polen lag und keine direkte Verbindung zum Deutschen Reich mehr hatte. Hitler wollte Danzig zurückhaben. Hitler wollte Ostpreußen mit einer exterritorialen Eisenbahn an das Reich anbinden. Fritz war begeistert von Hitler und seine Begeisterung übertrug sich auf mich. Wir lauschten den Stimmen aus dem Radio und wussten, dass die ganze Welt auf uns schaute. Als die deutsche Armee im September 1939 endlich die polnische Grenze überschritt, lagen Fritz und ich uns jubelnd in den Armen. Nur wenige Wochen später berichteten die Stimmen aus dem Radio aus Warschau, wo am 3. Oktober die deutsche Siegesparade stattfand. Sie beschrieben uns die siegreichen deutschen Soldaten, die zwischen zerschossenen Häusern, umgestürzten Straßenbahnwagen und anderen Barrikaden im Gleichschritt marschierten, den Arm zum Gruß erhoben. Heil Hitler!, ertönte es tausendfach in unserem bescheidenen Wohnzimmer. Mir machte das beschriebene Bild der Verwüstung Angst. Bei Fritz hatte es eine vollkommen andere Wirkung. Er wollte Polen brennen sehen und beschwor das neue Deutsche Reich. An diesem Tag beschloss Fritz, Soldat zu werden.
Alles war gut. Das Deutsche Reich hatte Ostpreußen wieder in sich aufgenommen. Die deutsche Armee war unbesiegbar, der Führer unsterblich und Fritz voller Tatendrang und Manneskraft. Die Nacht nach der Siegesparade in Warschau war die Nacht, in der Fritz mich schwängerte.
20. Dezember 2007, 12:05 Uhr
Im Schlafzimmer der Eheleute Liebig tummelten sich drei Kollegen von der Spurensicherung mit übergezogenen Plastikanzügen. Siebels blieb am Türrahmen stehen. Das Erste, was ihm auffiel, war die Botschaft, von der Petri gerade gesprochen hatte. Mit blutverschmiertem Finger war sie auf die Spiegelfront des Kleiderschrankes geschrieben worden.
Cavendum ergo ideo malum desiderium quia mors secus introitum delectationis posita est.
»Mein Latein beschränkt sich leider auf das medizinische«, bedauerte Petri. »Das hier klingt auf jeden Fall religiös.«
»Ein religiös motivierter Mörder?« Siebels drehte sich zu Petri um. »So was gibt es entweder im Kino oder in Amerika, aber doch nicht mitten in Frankfurt.«
»Jetzt anscheinend schon. Irgendwann kommt ja alles mal von den Amis hier drüben an«, sinnierte Petri. »Am besten fragen Sie mal einen Fachmann aus der Kirche, da wird Ihnen bestimmt geholfen.«
»Schreib das mal auf«, wies Siebels Till an.
»Wir haben sie!« Die Stimme kam von unten und war die von Jensen.
»Wen haben wir?«, brüllte Siebels zurück.
Hastig kam Jensen die Treppe herauf. »Na, die Liebigs natürlich. Sie befinden sich auf einer Reise in Kalifornien. Jetzt machen sie sich aber unverzüglich auf den Rückweg.«
»Das kann ja noch etwas dauern«, antwortete Siebels. »Jetzt rede ich erst mal mit der Haushälterin und dann fahren wir in die Psychiatrie. Ich kann es kaum erwarten, mir diesen Kerl anzuschauen, der seelenruhig mit irrem Blick im Blut der Toten gesessen haben soll.«
Die Blicke von Siebels und Till wanderten von dem blutbeschmierten Spiegel des Kleiderschrankes durch den Raum. Die tote Magdalena Liebig lag auf dem elterlichen Bett. Der dunkelbraune Parkettboden war überall mit Blut verschmiert. Siebels schätzte sie auf Mitte vierzig. Er fragte sich, warum eine Frau in diesem Alter nackt auf dem Bett der Eltern getötet wurde. Sie war etwas mollig, aber nicht dick.
»Wo sind denn ihre Klamotten?«, fragte Till den Chef der Spurensicherung.
»Die waren im ganzen Haus verteilt. Darum haben wir uns zuerst gekümmert. Alles genau dokumentiert und fotografiert. Unten vor der Eingangstür lag der Rock. Die Bluse fanden wir auf der untersten Treppenstufe. Strumpfhose im Flur, Slip im Schlafzimmer unter dem Fensterbrett.«
»War etwas zerrissen?«
»Nein. Sieht nicht so aus, als hätte sie einer gegen ihren Willen ausgezogen.«
»Hatte sie Geschlechtsverkehr?«
»Das fragen Sie besser Petri.«
Siebels drehte sich um, Petri stand am anderen Ende des Flurs und schaute aus dem Fenster. Siebels gesellte sich zu ihm. Von hier aus hatte man freien Blick auf die Pferderennbahn.
»Geschlechtsverkehr?«
»Ja.«
»Vergewaltigung?«
»Eher nein.«
»Danke.«
»Gerne.«
Siebels ging zurück zur Leiche und zur Spurensicherung. »Habt ihr hier noch was von dem Mann gefunden, der in ihrem Blut gesessen hat?«
»Nee, der war schon weg, als wir eintrafen.«
Siebels fluchte innerlich. Wenigstens auf die Spurensicherung hätte der alte Petri warten können, bevor er den Kerl in die Klapse verfrachtet hatte. Er ging wieder den Gang zurück zu Petri.
»Der Mann, der war nackt?«
»Ja.«
»Wo waren seine Klamotten?«
»Keine Klamotten.«
»Keine Klamotten? Sicher?«
»Wir haben nichts gefunden. Es sei denn, er hat seine Kleider in den Kleiderschrank ihrer Eltern gehängt. Das wurde noch nicht überprüft, soweit ich weiß.«
»Sehr merkwürdig. Haben Sie ihn nackt in die Klinik einliefern lassen?«
»Mein Mantel. Ich habe ihm meinen Mantel gegeben.«
»Sie sind ein Samariter.«
»Ich weiß. Tut mir leid, dass ich Ihnen die Arbeit erschwere mit meiner eigenmächtigen Entscheidung, den Kerl einliefern zu lassen. Aber Staatsanwalt Jensen hat darauf bestanden, dass Sie und Ihr Kollege Krüger den Fall übernehmen. Und Sie beide waren ja offiziell schon im Urlaub. Es ist bereits ein paar Stunden her, dass wir den Mann oben aufgefunden haben. Er saß da, als die Haushälterin kam. Das war so gegen neun. Die ersten Polizeibeamten kamen zehn Minuten später. Sie waren nicht in der Lage, den Mann vom Fußboden wegzuholen. Sie hatten Angst vor ihm. Stellen Sie sich vor, die Beamten stehen mit gezogenen Waffen vor einem Mann, der regungslos im Blut von Frau Liebig sitzt. Er nahm von den Beamten gar keine Notiz. Angeblich hat er etwas vor sich hin gebrummt. Aber niemand verstand, was er sagte. Wenn sie ihn anfassen wollten, bekam er Schreianfälle. Ich musste ihn fortschaffen lassen. Das ging erst, als ich ihm eine Beruhigungsspritze gegeben hatte. Vier Mann mussten ihn dazu festhalten.«
Siebels nickte nachdenklich. »Vielleicht kann uns ja die Haushälterin etwas über ihn erzählen. Kommen Sie mit nach unten, wenn ich sie befrage?«
»Ja, gerne. Anschließend möchte ich Sie sowieso begleiten, wenn Sie in die Klinik fahren. Der Mann interessiert mich.«
Siebels beauftragte Till, herauszufinden, was auf dem Spiegel im Schlafzimmer geschrieben stand, bevor er sich mit Petri nach unten zu Frau Bromowitsch begab. Till schaute den beiden ratlos hinterher und dann noch ratloser auf seinen Zettel, auf dem er die Wörter notiert hatte.
3
Er saß in seiner Zelle und betrachtete sich den braunen Ledereinband. Vorsichtig berührte seine Hand das Leder und strich sanft darüber. Er konnte sich diesem Buch nicht entziehen. War es Teufelswerk, das er so zärtlich streichelte? Er verwarf den Gedanken und öffnete den Band.
Mein Leben, Wilhelmine Arenz
Seit Dezember 1939 war ich als Aushilfsschwester im Krankenhaus tätig. Oberschwester Hildegard hatte sich meiner angenommen und mich dazu ermutigt, die Ausbildung zur Krankenschwester anzutreten. Ich stimmte zu.
Im Januar 1940 erlebte ich das erste Mal, wie Fritz von einem Krampfanfall heimgesucht wurde. Am Tag zuvor war er schriftlich bis auf Weiteres vom Einsatz bei der Wehrmacht befreit worden. Man hatte ihn auf eine Liste gesetzt und wieder zurück in die Fabrik geschickt. Die Fabrik war jetzt wichtig für den Führer und Fritz war wichtig für die Fabrik. Fritz war Schlosser und hielt die Maschinen in Gang. Mit den Maschinen wurden früher Blechdosen hergestellt, seit Dezember 1939 produzierte die Fabrik allerdings nur noch Munition für die Truppen. Die Maschinen liefen Tag und Nacht. Wenn eine Maschine ausfiel, musste Fritz sie reparieren. Der Bedarf war enorm. Fritz erzählte mir manchmal, wie viel sie an einem Tag fabrizierten, und ich fragte mich im Stillen, wo diese ganzen Patronen verschossen werden sollten.
An jenem Januartag kam Fritz erst spät abends von der Fabrik nach Hause. Er ging erst ins Bad und dann ins Schlafzimmer. Ich wartete in der Küche mit der fertigen Kartoffelsuppe auf ihn und da er nicht kam, rief ich nach ihm. Als er nicht antwortete, schaute ich nach. Mein Schrecken war groß, als ich ihn auf dem Bett entdeckte. Er lag auf dem Rücken, die Augen starr an die Decke gerichtet. Seine Arme und Beine zuckten schnell und unkontrolliert. Ich sprach ihn an, flehte ihn an, fragte ihn, was er habe. Er nahm mich nicht zur Kenntnis. Lag da und zuckte wild. Etwa zwei Minuten lang ging das so, dann beruhigten sich seine Beine und Arme langsam wieder. Bis er ganz ruhig im Bett lag. Seine Augen bewegten sich wieder. Er drehte seinen Kopf zu mir und sah mich an. Ich fragte ihn, was sei. Nichts, gab er mir zur Antwort. Ich solle mir keine Gedanken machen. Er blieb noch einen Moment liegen, dann kam er und aß seine Suppe. Erst viel später habe ich erfahren, dass der Vorgesetzte von Fritz, Eduard Propofski, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hatte, um Fritz vom Dienst bei der Wehrmacht fernzuhalten.
20. Dezember 2007, 12:45 Uhr
Während Till vor die Tür ging, um frische Luft zu schnappen und sich zu überlegen, wie er die lateinische Botschaft am schnellsten übersetzt bekam, setzten sich Siebels und Petri in einem der Gästezimmer der Villa mit der Haushälterin Frau Bromowitsch zusammen. Sie schien sich vom ersten Schock etwas erholt zu haben, es war wieder Farbe in ihr blasses Gesicht zurückgekehrt.
»Geht es Ihnen wieder etwas besser?«, erkundigte Siebels sich rücksichtsvoll. Erneut antwortete sie nur mit einem stummen Nicken.
»Wie lange arbeiten Sie schon für die Familie Liebig?«, erkundigte sich Siebels.
»Seit über vierzig Jahren.«
»Das ist eine lange Zeit. Was genau sind Ihre Aufgaben? Sind Sie jeden Tag hier?«
»Von Montag bis Samstag, ja. Sonntags habe ich frei. Ich mache viel. Kümmere mich um den Haushalt. Ich putze, sauge, wasche und kaufe ein.«
»Der Mann, den Sie heute Morgen im Zimmer gesehen haben, kennen Sie den?«
»Nein. Den habe ich noch nie gesehen.«
»Wohnte Magdalena Liebig hier bei ihren Eltern im Haus?«
Frau Bromowitsch nickte wieder stumm zur Bestätigung.
»Wie alt war sie?«
»Magdalena war fünfundvierzig Jahre alt.« Frau Bromowitsch fing leise an zu schluchzen.
»Hat sie immer hier gewohnt? Ist sie ledig?«
»Ja, sie ist ledig und sie hat immer hier bei ihren Eltern gewohnt.«
»Hatte sie einen Freund?«
»Nein, keinen Freund. Sie war krank. Deswegen wohnte sie auch noch in ihrem Elternhaus. Hier fühlte sie sich sicherer. Nicht so einsam. Ihre Eltern sind zwar selten zu Hause, aber wenigstens in den Nächten war Magdalena unter ihrer Obhut. Am Tag war ich da und Dr. Breuer kam auch regelmäßig und schaute nach ihr. Dr. Breuer ist der Hausarzt der Familie.«
»Was für eine Krankheit hatte Magdalena?«
Wieder schluchzte Frau Bromowitsch und Petri reichte ihr ein Taschentuch. Sie schniefte in das Tuch, schaute dann mit Tränen in den Augen zu Siebels. »Magdalena litt unter epileptischen Anfällen. Früher war es ziemlich schlimm. In den letzten Jahren ist es besser geworden. Sie bekam neue Medikamente. Aber trotzdem wurde sie immer wieder von schlimmen Anfällen heimgesucht.«
Siebels schaute verwundert zu Petri. Laut Petri hatte der unbekannte nackte Mann epileptische Anfälle gehabt, als die Polizei eintraf.
»Hatte Magdalena Kontakt zu anderen Menschen, die unter der gleichen Krankheit litten?«
Wieder ging der Antwort ein stummes Kopfnicken voraus. »Ja, Magdalena besuchte seit Jahren eine Selbsthilfegruppe. Einmal im Monat ging sie dorthin. Das tat ihr gut. Dort konnte sie über ihre Probleme sprechen. Nicht nur über die Krankheit.«
»Könnte der nackte Mann aus dieser Gruppe stammen?«
Jetzt schaute sie Siebels stumm an, ohne dabei zu nicken. Nach einer Weile zuckte sie mit den Schultern. »Es wäre möglich. Ich habe im Laufe der Jahre einige ihrer Freunde aus dieser Gruppe kennen gelernt. Aber diesen Mann nicht. Ich kann es aber nicht ausschließen.«
»Es gab keine Einbruchsspuren im Haus. Wir gehen zunächst davon aus, dass Magdalena den Mann kannte und hereingelassen hat. Spricht Ihrer Meinung nach etwas dagegen?«
»Magdalena war ängstlich und scheu. Sie hätte keine fremden Männer ins Haus gelassen. Wenn er nicht gewaltsam eingedrungen ist, muss Magdalena ihn gekannt haben. Vielleicht gehört er wirklich zur Gruppe. Das fragen Sie am besten Dr. Breuer.«
»Ja, das werden wir tun. Sie haben sicherlich seine Telefonnummer und Adresse?«
»Ja, natürlich.«
»Erzählen Sie mir aber zuerst bitte ganz genau, wie das heute Morgen war, als sie hergekommen sind.«
»Ich kam kurz vor neun. Alles war normal. Ich habe erst geläutet. Drei Mal kurz hintereinander. Das mache ich immer so, wenn Magdalena allein im Haus ist. Sie weiß dann, dass ich es bin. Ich warte immer noch einen Moment und schließe dann mit meinem Schlüssel auf. Nachdem ich heute aufgeschlossen hatte, habe ich meinen Mantel an die Garderobe gehängt und laut guten Morgen gerufen. Normalerweise kommt dann von irgendwoher im Haus eine fröhliche Antwort. Heute Morgen blieb es aber still. Ich dachte, sie wäre vielleicht im Bad. Aber dann sah ich die Kleidungsstücke von ihr herumliegen. Sie ist eigentlich sehr ordentlich. Das machte mich stutzig. Ich rief wieder nach ihr. Es kam keine Antwort. Erst dann entdeckte ich die roten Flecken. Ich sah mich genauer um. Ich hatte keine Zweifel daran, dass es Blutspuren waren. Ich schaute erst in das Zimmer von Magdalena. Aber das war leer und das Bett unbenutzt. Dann ging ich nach oben. Ich machte Licht im Flur und sah dann deutlich die Blutspuren aus dem Schlafzimmer ihrer Eltern. Die Tür war zu. Ich öffnete sie. Zuerst sah ich Magdalena auf dem Bett liegen. Ich schrie. Dann erst entdeckte ich diesen nackten Mann. Zuerst sah ich ihn im Spiegel. Oben auf dem Spiegel standen diese Wörter und unter diesen Wörtern sah ich das Spiegelbild des Mannes. Er saß neben dem Bett an die Wand gelehnt. Ich schrie wieder. Er saß mit weit aufgerissenen Augen da und starrte auf den Spiegelschrank. Ich glaube, er starrte auf das, was da geschrieben stand. Dann bin ich runter gerannt. Fast wäre ich die Treppen herabgestürzt. Ich hatte Angst, dass der Mann mir hinterherrennt. Aber er blieb im Zimmer. Ich wählte die Notrufnummer und rannte mit dem schnurlosen Telefon aus dem Haus. Bis nach vorne zur Straße. Dort habe ich auf die Polizei gewartet und das Haus im Auge behalten. Die Polizei war schnell da. Erst ein Wagen, dann kam noch einer. Dann kamen viele. Alle mit Sirene und Blaulicht. Es war wie in einem Film. So unwirklich. Verstehen Sie das?«
»Ja, das verstehe ich sehr gut. Seit wann sind Herr und Frau Liebig außer Haus?«
»Seit zehn Tagen. Herr Liebig hat einen geschäftlichen Termin in den USA. Anschließend wollte er mit seiner Frau über Weihnachten und Sylvester seinen Urlaub dort verbringen. Die beiden machen ja selten Urlaub. Immer sind sie für die Firma da. Außerdem wollten sie Magdalena nicht über einen längeren Zeitraum alleine lassen. Manchmal sind sie mit Magdalena verreist. Aber immer nur für ein paar Tage, meistens an die Ostsee. Das Klima dort tat Magdalena gut. Ihren Eltern natürlich auch.«
»Erzählen Sie mir bitte etwas mehr über die Familie. Über die Familie Liebig und die Familie Arenz. Wer gehört alles dazu? Wer hat welche Aufgaben im Unternehmen?«
Till hatte sich zu den Streifenbeamten vor der Villa gesellt und noch einen heißen Tee ohne Rum mit ihnen getrunken. Nach einer kurzen Unterhaltung betrachtete er sich wieder den Zettel, auf dem er die Worte vom Spiegel notiert hatte. Kurz entschlossen rief er seine Freundin Johanna an. Johanna hatte ihr Medizinstudium vor einigen Wochen beendet. Ihr musste er jetzt sowieso schonend beibringen, dass der geplante Trip in die Sonne auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste. Da konnte er sie gleich nach ihren lateinischen Kenntnissen fragen. Er hielt sein Handy einige Minuten reglos in der Hand, bevor er ihre Nummer wählte. Das schlechte Gewissen plagte ihn. Nachdem er und Johanna in der Vergangenheit einige Krisen durchlebt hatten und die Beziehung eigentlich schon gescheitert war, hatten die beiden sich nach einer kurzen Trennung doch noch einmal zusammengerauft. Seit einem halben Jahr waren sie wieder ein Herz und eine Seele und Till spielte mit dem Gedanken, seiner Johanna an Weihnachten auf einer sonnigen Insel einen romantischen Heiratsantrag zu machen. Immerhin war sie angehende Ärztin und er könnte auch bald befördert werden. Jedenfalls wenn Schneider vom Schießstand bald in den vorzeitigen Ruhestand ging und seine Beurteilungen dort wieder besser wurden. Auf keinen Fall würde er aufhören, Jagd auf Oma bin Laden zu machen. So viel stand für ihn fest. Das war eine Frage der Ehre. Er rief Johanna an und kam ohne Umwege auf den Spiegelspruch zu sprechen. Mühsam las er ihr die Worte auf seinem Notizblock vor. Johanna hatte keine Ahnung, wovon er sprach. Till erzählte von Dr. Petri, nach dessen Meinung es etwas Religiöses sein müsste.
»Etwas Religiöses?«, fragte Johanna zweifelnd nach. »Und warum fragst du dann mich?«
»Ich dachte, du hast Abitur und kannst Latein. Mediziner müssen doch Latein können. So wie Polizisten die Verkehrsregeln kennen müssen.«
»Wie du bereits richtig erkannt hast, bin ich Medizinerin. Bauchspeicheldrüse kann ich vielleicht auf Latein, aber dein kavendum Dingsbums ist weder eine Drüse noch ein Knochen noch sonst was Medizinisches. Probiere es mal in der katholischen Kirche, da spricht man auch Latein.«
»Danke für den Tipp. Urlaub wird übrigens ausfallen müssen. Jedenfalls für dieses Jahr. Aber den holen wir so schnell wie möglich nach. Versprochen.«
»Dein Versprechen in Jensens Ohr. Wenn ich den Job im Krankenhaus bekomme, wird das so schnell nix. Würde es dich stören, wenn ich jetzt ohne dich fliege?«
»Wie jetzt? Wieso ohne mich?«
»Mit einer Freundin. Ihr Mann kann auch nicht. Frauenurlaub.«
»Du willst mich über Weihnachten alleine hierlassen? Bei der Kälte?«
»Exakt. Du musst doch wieder einen Mörder jagen und hast sowieso keine Zeit. Wahrscheinlich bist du mit Steffen die ganzen Feiertage auf Achse. Oder etwa nicht?«
»Na ja. Schaut leider nicht gut aus. Tote in Villa. Reiche Leute, heikler Fall.«
»Also buche ich den nächsten Flug. Das wird jetzt eh schon schwierig genug, noch etwas Erschwingliches zu bekommen.«
»Na gut. Du hast es dir verdient. Erzähle mir heute Abend, was du gebucht hast. Wahrscheinlich wird es spät. Bye.«
»Ich mache Spaghetti, wenn du kommst. Ciao.«
Heiratsantrag ade, dachte Till und hatte im gleichen Moment eine Idee, die ihn gedanklich wieder voll auf den Fall Liebig zurückkatapultierte. Er tippte die Nummer der Auskunft in sein Handy und ließ sich mit der katholischen Telefonseelsorge in Frankfurt verbinden. Kurz darauf sprach er mit einer Frau, die ihn nach seinem Problem fragte.
»Cavendum ergo ideo malum desiderium quia mors secus introitum delectationis posita est«, las er stockend von seinem Zettel ab.
»Do you speak German?«, fragte die Frau am anderen Ende der Leitung.
»Yes. Only German. This is my problem.«
»Why is this your problem?«
»Weil ich kein Latein kann. Ich dachte, Sie sind die katholische Kirche und können mir helfen.«
»Ich bin Frau Lehmann. Bitte blockieren Sie nicht die Leitung, wenn Sie keine Hilfe benötigen. Andere Menschen haben wirklich Probleme und hoffen auf ein offenes Ohr. Gerade jetzt um die Weihnachtszeit.«
Till sprach daraufhin Klartext, stellte sich als Kriminaloberkommissar Krüger vor und fragte, wo er mit seinem lateinischen Text vorstellig werden könnte.
»Da gehen Sie am besten in die Innenstadt, in die Liebfrauenkirche. Dort fragen Sie nach Bruder Jakobus. Er ist dort im Kapuzinerkloster tätig. Er kann Ihnen bestimmt weiterhelfen.«
Till bedankte sich und ging zurück in die Villa. Er war mittlerweile bis auf die Knochen durchgefroren und bemitleidete die Polizisten, die untätig herumstanden. Anscheinend wurden sie nicht mehr benötigt, bekamen aber auch keinen Befehl zum Abmarsch. Vielleicht befürchtete Jensen noch einen Presseauflauf, der abgewehrt werden musste.
4
Nach Tagen der Einsamkeit verspürte er das Verlangen nach Gemeinschaft. Er suchte die Nähe zu Gott in seinen Brüdern. Der Abt hatte das Zeichen schon gegeben, die Brüder versammelten sich und er schloss sich ihnen an, so wie er es seit Jahrzehnten Tag für Tag hielt. Bruder Johannes empfing ihn mit einem wohlwollenden Lächeln auf den Lippen. Er reihte sich ein. Stand wieder dort, wo sein Platz war. Die Brüder stimmten die Feierlichkeiten an. Die Vigil, die erste Gebetszeit des Tages, hatte begonnen. Die Brüder ließen ihre Stimmen ertönen und priesen den Herrn mit einem Lied Davids, dem dritten Psalm.
»Herr, ich kann sie nicht mehr zählen, so viele sind es, die sich gegen mich stellen, so viele, die schadenfroh von mir sagen: Dem hilft auch Gott nicht mehr! …«
Eine Träne lief ihm die Wange herunter, während seine Stimme im Chor der Mönche den Schutz Gottes herbeiflehte. Der Gottesdienst nahm seinen Verlauf, die Brüder sangen »Ehre sei dem Vater« und fuhren fort mit Psalm 94 mit Antiphon. Weiter mit einem Hymnus des Ambrosius, dann sechs Psalmen mit Antiphonen, anschließend der Versikel. Dann sprach der Abt den Segen und alle Brüder setzten sich auf die Bänke. Der erste Bruder unter ihnen erhob sich zur Lesung. Der Abt hatte zuvor das Buch aufgeschlagen. Danach folgte die zweite Lesung, dieses Mal durch Bruder Johannes. Danach die dritte und letzte Lesung. Zwischen den Lesungen sangen die Brüder drei Responsorien. Nach den Lesungen folgten sechs weitere Psalme, die mit »Halleluja« gesungen wurden. Jetzt war er an der Reihe. Er war eins mit sich und den Brüdern und den altehrwürdigen Mauern, die ihn umgaben. Auswendig trug er seine Lesung aus den Apostelbriefen vor. Der Gottesdienst endete mit dem Bittgebet der Litanei.
Nach dem Gottesdienst nahm der Abt ihn beiseite. Wie er selbst hatte dieser fast sein ganzes Leben in den Mauern des Klosters verbracht, war ohne Eltern unter der Obhut Gottes aufgewachsen. Nachdem sie ein paar Schritte gegangen waren, sprach der Abt zu ihm. »Du weißt, mein lieber Bruder, man soll der Schweigsamkeit zuliebe bisweilen sogar auf gute Gespräche verzichten. Es steht geschrieben, dass vollkommenen Jüngern das Reden nur selten erlaubt sei, wegen der Bedeutung der Schweigsamkeit. Doch sind wir weit davon entfernt, vollkommen zu sein. Darum bitte ich dich, komm zu mir, wenn deine Seele nach einem aufbauenden Gespräch verlangt. Du warst noch ein Säugling, als du zu den Schwestern in das Kloster gekommen bist und ein Knabe von vier Jahren, als wir dich in unserer Mitte aufgenommen haben. Jetzt bist du ein gottesfürchtiger Diener des Herrn und erfährst all das, wonach die Seele des Waisen sich ein Leben lang sehnt. Nimm es als Geschenk Gottes und sieh in mir den Vater, den du nie hattest. Den Vater, dem der Sohn die Fragen stellt, die er im Herzen trägt. Du bist mir willkommen zu jeder Zeit, sei es am Tag oder in der Nacht.«
Wortlos nahm er die Hand des Abts und küsste sie. Dann ging er seines Weges. Zurück in seine Zelle. Zurück zu dem braunen Ledereinband. Zurück zu seinen Wurzeln.
20. Dezember 2007, 14:00 Uhr
Till fand Siebels und Petri mit Frau Bromowitsch in einem der vier kleineren Zimmer im Untergeschoss. Frau Bromowitsch fing gerade an, über die Familie zu erzählen.
»Das Unternehmen, die Arenz-Werke, wurde von Walter Arenz in der Nachkriegszeit gegründet. Die Werke gingen aus einer Schlosserei hervor, die der Vater von Walter Arenz bereits betrieben hatte. Nach dem Krieg sammelte Walter Arenz Schrott aus den Trümmern im zerbombten Frankfurt und verarbeitete ihn in seiner Schlosserei weiter. Als Schmied und Schlosser stellte er her, was gebraucht wurde. Bald schon vergrößerte er sein Geschäft und spezialisierte sich auf Fahrradrahmen, die er in großen Stückzahlen produzieren ließ. 1950 heiratete Walter Arenz Wilhelmine Liebig. Sie war Kriegswitwe und hatte einen Sohn, Hermann, den Walter Arenz aber nicht adoptierte. So blieb der Name Liebig erhalten. 1952 brachte Wilhelmine Peter zur Welt und ein Jahr später die Tochter Klara. Hermann Liebig wuchs mit seinen Halbgeschwistern auf. Peter und Klara kamen später in ein Schweizer Internat, als sie etwa fünfzehn Jahre alt waren. Das Unternehmen von Walter Arenz wuchs in den fünfziger Jahren rasant. Er verarbeitete Blech in großen Mengen und belieferte bald die Industrie in ganz Deutschland. Ende der Fünfziger beschäftigte er bereits 300 Leute in mehreren Fabriken. In den sechziger und siebziger Jahren avancierte er zu einem Hauptlieferanten der Automobilindustrie. Hermann Liebig war nach seinem Studium in das Unternehmen eingetreten und entpuppte sich als tüchtiger Geschäftsmann. Bereits als junger Student arbeitete er in der Firmenleitung mit. Außer ihm waren seine Mutter Wilhelmine und Walter Arenz mit der Führung des Unternehmens befasst. Wilhelmine kümmerte sich in erster Linie um die Buchhaltung und die Finanzen. Hermann war maßgeblich für die fortschreitende Automatisierung in den Werken zuständig und schaffte somit den Grundstein für weiteres Wachstum. Er war die treibende Kraft im Unternehmen, trotzdem bevorzugte Walter Arenz seine eigenen Kinder und hatte oft Streit mit Hermann. Peter Arenz studierte auf Drängen seines Vaters Betriebswirtschaft, Klara Arenz setzte ihren eigenen Kopf durch und studierte Journalistik. Walter Arenz starb 1973 im Alter von 58 Jahren. Die Firma gehörte fortan Wilhelmine sowie Peter und Klara. Hermann wurde geschäftsführender Direktor, erbte aber keine Unternehmensanteile von seinem Stiefvater. Wilhelmine kümmerte sich weiter um die Finanzen und gründete eine Holding, in der die Firmenaktivitäten gebündelt wurden. In den achtziger und neunziger Jahren investierte Hermann Liebig in Indien. Gemeinsam mit seiner Mutter verbrachte er ein halbes Jahr in Bombay. Sie bauten dort eine große Fabrik und kauften später mehrere Unternehmen in Europa und in den USA auf. Das erwies sich als sehr klug. Das Unternehmen wuchs ständig weiter. Heute ist es ein weltweiter Konzern mit einem internationalen Management, an dessen Spitze Hermann und Eva in der Holding sitzen.«
»Sie wissen aber viel über die geschäftlichen Dinge«, staunte Siebels. Frau Bromowitsch lächelte verlegen. »Ja, ich weiß das meiste von Magdalena. Sie hat oft mit mir darüber gesprochen, wenn wir die Zeit miteinander hier im Haus verbracht haben. Sie war von Wilhelmine als ihre Nachfolgerin vorgesehen worden. Aber die Krankheit ließ das nicht zu.«
»Seit wann arbeitet Eva Liebig im Unternehmen mit?«, fragte Siebels weiter.
»Schon sehr lange. Kurz nach Magdalenas Geburt stellten die Ärzte fest, dass sie an einer schweren Form von Epilepsie litt. Eva Liebig konnte mit der Krankheit ihrer Tochter nicht umgehen. Sie fühlte sich überfordert. Wilhelmine stellte mich damals als Kindermädchen für Magdalena und deren Halbschwester Sarah ein. Sarah war zwei Jahre älter als Magdalena und stammte aus der ersten Ehe von Hermann Liebig. Sarahs Mutter war bei der Geburt gestorben und Hermann hatte nach einer kurzen Trauerzeit Eva geheiratet. Sarah und Magdalena waren ein Herz und eine Seele. Aber Eva fühlte sich zunehmend nutzlos im Haus. Wilhelmine nahm Eva eines Tages mit in die Firma. Sie wollte ihr einfach mal etwas Abwechslung bieten. Eva war aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Wilhelmine, sie lernte viel von ihr und bildete sich in Abendkursen weiter. Gegen den Willen von Walter setzte Wilhelmine Eva einige Jahre später offiziell als Mitglied der Firmenleitung ein. Eva wurde dann Anfang der siebziger Jahre Personalchefin und wechselte zirka zehn Jahre später in das Marketing. Walter Arenz blieb zwar bis zu seinem Tod 1973 die oberste Instanz im Unternehmen, konnte sich aber selten durchsetzen, wenn Wilhelmine, Eva und Hermann anderer Meinung waren als er. Die Familie Liebig war immer dominierend bei den Arenz-Werken. Das ist bis heute so geblieben.«
»Das ist sehr interessant«, murmelte Siebels und überlegte, ob das alles etwas mit dem Mord an Magdalena Liebig zu tun haben könnte.
»Wie sind denn die Verhältnisse im Unternehmen seit dem Tod von Wilhelmine Liebig?«, wollte Siebels wissen.
»Schwierig«, seufzte Frau Bromowitsch. »Hermann und Eva führen die Geschäfte. Aber Peter und Klara Arenz halten fast die Hälfte der Anteile am Unternehmen. Und die Liebigs sind jetzt beide 67 Jahre alt. Es gab viel Streit in der Zeit nach Wilhelmines Ableben. Aber über die jüngsten Ereignisse kann ich Ihnen leider nicht mehr viel erzählen. Da sprechen Sie am besten mit Dr. Jürgens. Er ist der Anwalt der Familie. Seine Kanzlei kümmert sich auch um die Vermögensverhältnisse der Familie.«
Siebels bedankte sich vorerst für die ausführlichen Informationen und notierte sich noch die Adressen des Anwalts und des Hausarztes Dr. Breuer sowie die von Sarah Liebig und Peter und Klara Arenz.
»Was macht eigentlich Sarah Liebig?«, erkundigte sich jetzt noch Till.
»Sarah ist Künstlerin. Sie malt.«
»Das schwarze Schaf der Familie?«, erkundigte sich Siebels.
»Oh nein. Sarah ist eine sehr begabte Malerin und wird von allen sehr geschätzt. Als Malerin und als Mensch.«
Die Spurensicherung hatte ihre Arbeit beendet und die Männer vom Bestattungsunternehmen kamen ins Haus.
»Auf direktem Weg in die Gerichtsmedizin«, gab Dr. Petri ihnen Anweisung.
»Ich hätte noch eine Bitte«, kam Siebels nochmals auf Frau Bromowitsch zu. »Könnten Sie bitte mit unseren Kollegen von der Spurensicherung noch einmal alle Räume nach der Kleidung des fremden Mannes absuchen? Sie wissen doch sicherlich, was Herrn Liebig gehört und was eventuell zu dem nackten Mann gehören könnte?«
»Ja, natürlich«, versicherte die Haushälterin, die wieder zu schluchzen anfing, als der Leichnam die Treppe heruntergebracht wurde.
In der Jackentasche von Siebels erklang eine Mundharmonika. Die Melodie von »Spiel mir das Lied vom Tod« ertönte genau in dem Moment, als der Sarg mit Magdalena Liebig an ihm vorbeigetragen wurde. Das Handy war nagelneu. Sabine hatte es ihm gestern geschenkt, weil sein Altes den Schleudergang bei der Kochwäsche nicht vertragen hatte. Der Klingelton mit der Bonanza-Melodie auf seinem alten Handy hatte bei den Kollegen immer für Erheiterung gesorgt. Jetzt starrte sogar Till ihn entsetzt an. Dummerweise stand auch Jensen nur zwei Meter von ihm entfernt und schaute mit offenem Mund abwechselnd zu Siebels und zu dem Sarg, der gerade durch die Villa der Eingangstür getragen wurde. Frau Bromowitsch schluchzte daraufhin noch lauter. Siebels stammelte eine Entschuldigung, fischte umständlich nach dem Handy und nahm verärgert den Anruf entgegen. Es war Sabine.
Jensen ging kopfschüttelnd davon und Petri reichte der Haushälterin ein frisches Taschentuch.
»Hallo mein Schatz«, meldete sich Sabine fröhlich.
»Vielen Dank für den pietätlosen Klingelton«, brummte Siebels missgelaunt.
»Gefällt er dir nicht?«
»Doch doch. Suuuper. Vor allem, wenn im gleichen Moment ein Mordopfer an mir vorbeigetragen wird. Das macht Eindruck auf die Angehörigen.«
»Ups. Sorry. Sollte ein Witz sein. Hätte ich das geahnt ...«
»Vergessen wir es«, schlug Siebels vor. »Weihnachtsurlaub ist leider gestrichen. Das Mordopfer. Du weißt schon. Ein heikler Fall.«
»Ja. Deswegen rufe ich auch an. Ich habe gerade gebucht. Sieben Tage Teneriffa.«
»Ja, wie jetzt? Ich kann nicht, sagte ich doch eben.«
»Eben. Deswegen habe ich gebucht. Morgen früh um fünf geht der Flieger. Ich fliege zusammen mit Johanna.«
»Aha.« Siebels kratzte sich am Kopf und schaute zu Till hin. »Ist das eine Verschwörung? Polizistenfrauenweihnachtsboykott? Nehmt ihr Frau Jensen auch mit?«
»Nee, Frau Staatsanwalt bleibt hier. Ist ja keine Polizistenfrau. Vielleicht backt sie euch ein paar Plätzchen, wenn Johanna und ich am Pool liegen und uns von muskulösen Animateuren die Rücken eincremen lassen.«
»Baby, dein Rücken gehört mir. Und der Rest auch.«
»Wow. Mein kleiner Brummbär verwandelt sich in einen Supermacho. Ich sollte öfter mal mit Johanna was unternehmen.«
»Vielleicht sollte ich mich doch besser auf meine alten Tage noch mal umorientieren und Till heiraten. Der steht mir wenigstens immer treu zur Seite«, säuselte Siebels.
Till stand neben ihm und hörte neugierig zu. Mit zwei auf die Schläfe ausgestreckten Fingern deutete er an, dass er sich lieber erschießen würde.
»Ich muss Schluss machen. Schreibt uns mal eine Postkarte. Frohe Weihnachten, meine Süße.«
»Hallo? Was heißt hier Frohe Weihnachten? Morgen früh fahrt ihr zwei uns gefälligst zum Flughafen. Dann kannst du mir ein frohes Fest wünschen.«
»Um fünf?«
»Nein. Um vier. Um fünf geht doch schon der Flieger.«
»Na dann. Bis später.« Siebels steckte sein Handy wieder ein und wendete sich Petri zu. »Unsere Weiber hauen ab. Die fliegen in die Sonne und wir haben einen nackten Mann am Hals. Ist das gerecht?«
»Tut mir wirklich leid, dass der nackte Mann keine Frau ist«, gab Petri sein Bedauern kund.
»Du musst morgen früh unsere Frauen um vier Uhr zum Flughafen bringen«, gab Siebels Till Anweisung.
»Ach, Johanna fliegt mit Sabine?«
»Jepp.«
»Ich bringe sie zum amerikanischen Militärflughafen nach Wiesbaden. Da können sie eine Maschine nach Afghanistan nehmen.«
»Manchmal hast du richtig gute Ideen. Hattest du auch schon eine zum Spiegelspruch?«
»Logisch. Bruder Jakobus. Der ist Mönch, der kann Latein, den finden wir in der Innenstadt, in der Liebfrauenkirche.«
»Wir nicht. Du. Ich fahre mit Dr. Petri zum nackten Mann. Wir treffen uns später im Präsidium. Lass dich von einer Streife hinfahren.«
5
Er hatte sich nach dem Gottesdienst und dem Gespräch mit dem Abt wieder in seine Zelle zurückgezogen. Ganz bewusst hatte er eine der kleinen Kammern gewählt. Nur ein schmales Bett und ein kleiner Tisch standen in dem Raum. Auf dem Tisch lag der braune Ledereinband, den er auf dem Bett sitzend anstarrte. Durch das kleine Fenster fiel das Sonnenlicht. Er versuchte, sich das Gesicht der Frau vorzustellen, die diese Zeilen für ihn verfasst hatte. Das Gesicht der Frau, wie es im Jahr 1940 ausgesehen haben mochte. Als sie 20 Jahre alt und schwanger war. Er versuchte, sich vorzustellen, wie sie am Abend mit ihrem Mann Fritz vor dem Radio saß und den Stimmen lauschte, die vom Krieg berichteten.
Er spürte eine Veränderung in sich. Sein Körper fing an, sich zu verkrampfen. Viele Jahre hatte er dieses Leiden nicht mehr gespürt. Nun war es anscheinend mit dem braunen Ledereinband zurückgekommen. Er verließ seine Zelle und machte sich auf die Suche nach Bruder Thimotheus. Schlurfend ging er durch die Gänge des Klosters und trat in den Klostergarten ein. Wie er es sich gedacht hatte, fand er den alten Mönch in dessen Kräutergarten. Bruder Thimotheus war mittlerweile fast 90 Jahre alt und kannte die Heilwirkung Hunderter von Kräutern. Für jedes Leiden wusste er den heilenden Tee zu kreieren. Es gab keine Kranken im Kloster dank des Kräutergartens, in dem er nun vor dem alten Mönch stand.
»Die Krämpfe kommen wieder«, sagte er nur.
Der Alte schaute auf. »Hast du es schon mit Beten versucht, lieber Bruder?«
Er schüttelte traurig den Kopf. »Was soll ich Gott anrufen, wenn er mich doch zu dir schickt.«
»Gottes Wege sind unergründlich«, gab der Alte zur Antwort. »Es wundert mich, dass dein Leiden nach so langer Zeit erneut auftritt. Ist etwas geschehen? Betrübt etwas deine Seele? Hast du dein Gleichgewicht verloren?«
»Ja, Bruder. Es ist etwas geschehen. Ich habe das Gefühl, als wäre ich plötzlich wieder dort, wo ich einst herkam. Draußen in der Welt.«
»Nun gut. Komm mit mir. Die Kräuter sind bereits in meiner Kammer. Ich will dir deinen Tee bereiten. Aber trinke ihn mit Bedacht. Nur eine kleine Dosis der heilenden Kraft für den Anfang.«
Die beiden Mönche gingen langsamen Schrittes zurück hinter die Mauern des Klosters. Er hatte große Angst, dass es wieder schlimmer werden würde. So wie früher, als er noch ein Knabe war. Als er zuckend auf dem Boden lag und keine Kontrolle über seinen Körper mehr hatte. Einige der alten Mönche hatten damals Angst vor ihm. Sie sahen den Teufel in seinem Leib. Manchmal verlor er sein Bewusstsein. Bruder Thimotheus nahm sich seiner an und probierte verschiedene Kräuter an ihm aus. Keines schien zu helfen. Doch eines Tages kam Thimotheus mit einer großen Kanne Tee, die eine neue Kräutermischung enthielt. Nachdem er die ganze Kanne ausgetrunken hatte, fühlte er, wie seine Muskeln sich etwas entspannten. Er trank den Tee fortan jeden Tag und seine Anfälle wurden erträglicher, die Abstände zwischen den einzelnen Anfällen immer größer und größer. Bis sie gar nicht mehr auftraten. Thimotheus setzte die Dosis der heilenden Kräuter nach und nach zurück, bis der Tee gar nichts mehr von dem heilenden Kraut enthielt. Sein Patient blieb trotzdem fortan von weiteren Anfällen verschont. Er galt als geheilt.
Sie gingen in die Zelle von Thimotheus, wo zahlreiche getrocknete Kräuter an den Wänden hingen. Es roch wie in einem Zaubergarten. Der alte Mönch bereitete schnell den heilenden Tee und gab seinem Bruder zu trinken.
»Ich danke dir und danke Gott für die Weisheit, die er dir in die Wiege gelegt hat. Doch ich fürchte mich ein wenig. Du bist nun schon 90 Jahre alt und erfreust dich noch bester Gesundheit. Doch auch dein Leben ist nur von begrenzter Dauer. Darum möchte ich dich mit reinem Herzen bitten, mir das Rezept des heilenden Tees zu verraten.«
»Nun trinke erst einmal, mein lieber Bruder. Werde gesund und stark und finde das Gleichgewicht deiner Seele wieder. Nur der Kranke benötigt die Medizin. So bete, dass du gesund bleibst und verlasse dich nicht auf die Kräuter, sondern allein auf Gott. Aber fürchte dich nicht. Wenn Gott mich zu sich ruft, so bleibt das Geheimnis der heilenden Kräfte, die Gott in die Natur gelegt hat, in unserem Orden zurück. Hunderte Rezepte sind niedergeschrieben. Unser ehrwürdiger Abt ist in jedes Geheimnis eingeweiht. Er hat bereits einen treuen und gottesfürchtigen Bruder aus unserer Mitte auserkoren, der nach mir kommt und alles so hält, wie ich es gehalten habe. Nichts geht verloren.«
»So soll es sein, denn es ist der weise Ratschluss des Allmächtigen«, antwortete er und ging mit der Kanne zurück in seine Zelle.
Dort trank er noch eine Tasse des frisch gebrühten Kräutertees, bevor er den braunen Ledereinband zur Hand nahm und sich mit dem Niedergeschriebenen befasste.
Mein Leben, Wilhelmine Arenz
Nun war er da, der Weltkrieg. Immer mehr junge Männer verwandelten sich in Soldaten und zogen an die Front. Im Mai nahmen sie Holland, Belgien und Luxemburg ein, wir hörten es im Radio. Die deutsche Armee kämpfte tapfer und siegreich, zerschlug die neunte französische Armee bei Giraud. Die Stimme von Hitler wurde lauter und lauter in unserem Radio. Und tausendfach erschallte die Antwort des deutschen Volkes. Heil Hitler. Auch Fritz wollte endlich an die Front, wollte kämpfen und siegen. Ich sah ihn immer traurig an, wenn er mit großen Augen davon schwärmte, endlich mit der Wehrmacht gegen den Feind zu marschieren. Heil Hitler. Niemand konnte die Deutschen aufhalten. Nur das Zucken, von dem Fritz jetzt häufiger befallen wurde, beeinträchtigte ihn. Doch davon wollte er nichts wissen. Es dauerte ja nie länger als ein paar Minuten. Ich hatte bei meiner Arbeit im Krankenhaus Schwester Hildegard davon erzählt und um Rat gefragt. Schwester Hildegard hatte sich entsetzt umgesehen, als ich ihr die Symptome schilderte. Sie gab mir zu verstehen, dass ich kein Wort mehr davon sagen sollte. Dann nahm sie mich mit in eine Kammer, abseits von dem normalen Krankenhausbetrieb, wo uns niemand hören konnte. Mein Fritz habe Epilepsie, verriet sie mir. Ich nickte nur, ich hatte schon davon gehört. Doch was sie mir dann erzählte, traf mich bis ins Mark. Die SS-Oberärzte hätten vom Führer den Auftrag bekommen, Epilepsie-Erkrankte zu sterilisieren. Sie würden der Rassenreinheit schaden und dürften sich nicht vermehren, denn es sei eine erbliche Krankheit. In meinem Bauch wuchsen die Zwillinge heran. Die Kinder von Fritz, die er nach Hitlers Willen gar nicht hätte zeugen dürfen. Schwester Hildegard beschwor mich, alles Menschenmögliche zu tun, um das Leiden von Fritz geheim zu halten. Auf keinen Fall dürfe er zur Wehrmacht. Wenn er dort einen Anfall bekäme, würden sie ihn fortschaffen.
Ich ahnte, dass der Chef von Fritz von diesen Anfällen wusste und Fritz nur deshalb unentbehrlich war für die Fabrik. Doch wie lange konnte das gut gehen? Und wie sollte ich ihm erklären, dass sein geliebter Führer ihn zur Zwangssterilisation verdammen wollte? Die Rassengesetze waren streng. Nicht nur Fritz war in höchster Gefahr. Auch das beginnende Leben in meinem Leib wurde von dieser Krankheit und unserem Führer bedroht. Ich musste meine Familie schützen. Ich ging heimlich in die Fabrik und sprach mit Propofski, dem Chef von Fritz. Es war riskant, doch ich musste das Risiko eingehen, wenn ich Fritz vor sich selbst und vor dem Führer beschützen wollte.
20. Dezember 2007, 15:10 Uhr
Die Stationen der Uni-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie lagen in der Nähe des Niederräder Mainufers, nicht weit von der Villa Liebig entfernt. Petri hatte sich auf der Fahrt bereits telefonisch angekündigt. Nun stand er mit Siebels am Empfang, sie warteten auf Professor Dr. Rübsam. Petri klärte Siebels über die Arbeit der Stationen auf. »Man ist hier in der Lage, alle psychiatrischen Störungen medizinisch und diagnostisch zu erfassen. Die verschiedenen Stationen haben unterschiedliche Schwerpunkte. Gerontopsychiatrische Störungen werden auf Station 93-1 behandelt, depressive Störungen auf der 93-5. Die 93-11 kümmert sich um Alkoholabhängigkeiten, auf der 93-3 wird überwiegend psychotherapeutisch behandelt. Auf Station 93-13 werden schizophrene Psychosen behandelt. Unser nackter Freund wurde auf Station 93-7 gebracht, eine Aufnahmestation zur Intensiv- und Notfallbehandlung psychiatrischer Patienten aller Diagnosen. Dort wird man ihn unter die Lupe nehmen und dann entscheiden, wie es mit ihm weitergeht.«
»Eine Aussage auf dem Präsidium wäre eine tolle Sache«, erwiderte Siebels. »So wie es aussieht, war er dabei, als Magdalena Liebig abgestochen wurde. Wir können auch noch nicht ganz ausschließen, dass er sie ermordet hat. Ich hoffe, Ihr Psycho-Kollege beeilt sich mit seiner Diagnose und verfrachtet ihn dann direkt weiter zu meinen Händen.«
»Da kommt Professor Rübsam.« Petri ging dem Mann im weißen Kittel entgegen. Er stellte dem Professor den Hauptkommissar vor und erkundigte sich nach dem Befinden des Patienten. Siebels schätzte den Professor auf Anfang fünfzig. Er hatte eine hohe Stirn, trug eine goldumrandete Brille auf seiner dünnen Nase und war von schlaksiger Gestalt.