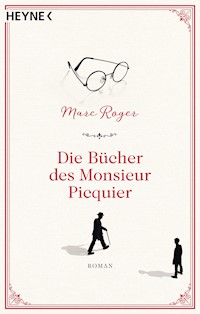
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Eine bezaubernde Hommage an die Literatur und die Freundschaft
„Der alte Buchhändler“ – so nennen ihn die Pfleger hinter vorgehaltener Hand. Denn Monsieur Picquiers winziges Zimmer im Seniorenheim ist vollgestopft mit Tausenden von Büchern. Sie sind seine Schätze, sein wertvollster Besitz. Doch Parkinson und Grüner Star machen es ihm unmöglich, darin zu lesen. Da bietet sich eines Tages der Hilfskoch Grégoire als sein Vorleser an. Ihm ist alles recht, um für eine Zeitlang dem harten Dienst in der Küche zu entgehen. Was als Zweckgemeinschaft beginnt, wächst rasch zu einer engen Freundschaft, die Picquier aus seiner Einsamkeit erlöst und Grégoire den Mut gibt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Ähnliche
Das Buch
»Der alte Buchhändler« – so nennen ihn die Pfleger hinter vorgehaltener Hand. Denn Monsieur Picquiers winziges Zimmer im Seniorenheim ist vollgestopft mit Büchern. Sie sind seine Schätze, sein wertvollster Besitz. Dreitausend von ihnen hat er aus seiner geliebten Buchhandlung retten können, als er diese aufgeben musste. Doch Parkinson und grüner Star machen es ihm unmöglich, darin zu lesen.
Der achtzehnjährige Grégoire hat mit Büchern nichts am Hut. Er ist früh durchs System gefallen und schließlich ohne Ausbildung als Hilfskoch im örtlichen Seniorenheim gelandet. Als er auf Monsieur Picquier trifft, versteht er dessen Bücherbesessenheit zunächst nicht. Trotzdem besucht er den alten Mann regelmäßig und beginnt ihm schließlich vorzulesen. Die erblühende Freundschaft eröffnet den beiden neue Welten – für Grégoire eine ungeahnte Fülle an Geschichten und Wissen. Für Monsieur Picquier den Kontakt zu seinen Mitmenschen, den er schon längst aufgegeben hatte.
Ein ergreifender Roman, der Mut macht und Hoffnung weckt.
Der Autor
Marc Roger tritt als Vorleser auf und organisiert Lesungen in Buchhandlungen und Bibliotheken in ganz Frankreich. 2014 erhielt er den Coup de Cœur des Grand Prix Livres Hebdo für seine herausragende Rolle als Literaturvermittler. Die Bücher des Monsieur Picquier ist sein erster Roman.
MARCROGER
Die Bücher des Monsieur Picquier
Aus dem Französischen von Ursula Held
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe »Gregoire et le vieux libraire« erschien erstmals 2019 bei Albin Michel, Paris.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Copyright © 2019 by Marc RogerCopyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenRedaktion: Joscha FaralischUmschlaggestaltung: Nele Schütz Design/Margit Memminger unter Verwendung von shutterstock/Photology/Miracel VaartSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN: 978-3-641-25212-0V002www.heyne.de
Für Corinne
»… dass man Bücher nur schafft, um über den eigenen Atem hinaus sich Menschen zu verbinden und uns so zu verteidigen gegen den unerbittlichen Widerpart alles Lebens: Vergänglichkeit und Vergessensein.«
Buchmendel (1929), Stefan Zweig
»Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne. – Mit jedem Kind, das man unterrichtet, gewinnt man einen Menschen.«
Écrit après la visite d’un bagne (1881), Victor Hugo
1
Bevor ich hochgegangen bin, haben sie mir alles genau erklärt. Nicht vertraulich tun. Nicht duzen. Du siezt sie, und du sprichst sie mit Madame oder Monsieur an, immer gefolgt vom Familiennamen. Schau auf ihre Medikamentenschachteln, da stehen Name, Zimmernummer und kryptische Hinweise für das Pflegepersonal, aber die müssen dich nicht interessieren.
Seit einem Monat arbeite ich in der Küche, jetzt teile ich zum ersten Mal Essen aus. 11 Uhr 17. Zimmer 28, zweite Etage. Joël Picquier. Das Pflegeheim, die Résidence Les Bleuets, ist ein lang gezogenes Gebäude am Kanalufer. An der geschlossenen Zimmertür klebt eine Aufschrift, in kursiver Schrift: Pauca meæ. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich stelle den Wagen an der Wand ab und raste mit dem Fuß die Bremsen ein. Ich klopfe an. Drei Mal. Gut hörbar. Und sofort antwortet eine heisere und trotzdem wache, überraschte Stimme:
»Ah, schon? Einen Moment bitte.«
Ich warte ein paar Sekunden. Auf dem Wagen stehen noch vier weitere Essen. Unter den durchsichtigen Warmhaltedeckeln hat sich eine Kondensschicht gebildet. Ich habe die Ohren aufgestellt und höre, wie eilig Papier zusammengeräumt wird.
»So! Na ja! Gut! Komm rein …«
Ich öffne die Tür. Als er mich sieht, kneift er die Augen zusammen, zögert – und dann, als er sicher ist, dass ich nicht die übliche Hilfskraft bin:
»Ah, ein Neuer? Ist Béatrice etwa krank?«
»Nein. Aber ich glaube, ihrer kleinen Tochter geht es nicht gut. Sie hat sich einen Tag freigenommen. Freut mich, Sie kennenzulernen, Monsieur Picquier. Mein Name ist Grégoire.«
»Na schön. Stell es da hin.« Er deutet auf eine freie Ecke des Tisches, der ansonsten mit Büchern und Papieren belegt ist. »Wundere dich nicht, dass ich dich duze. Ich duze hier alle.«
»Das stört mich nicht.«
Mit dem Teller in den Händen betrete ich das Zimmer.
Es ist wie in einer Schachtel. Einer Höhle. Die vier Wände sind von oben bis unten mit Büchern zugepflastert. Acht Quadratmeter. Zwischen Tisch, Bett, Stuhl, Sessel, Kommode, Wandschrank und Nachttisch bleibt nur ein schmaler Gang frei, gerade groß genug für zwei Dreifuß-Gehhilfen. Im Eingang, inzwischen also hinter mir, lehnt ein zusammengeklappter Rollstuhl an der Wand, gleich neben der Falttür zur Duschecke mit Waschbecken und WC. Das Fenster ist zur Hälfte bedeckt mit Post-its und Zeitungsausschnitten, die ich aus der Ferne nicht entziffern kann, es lässt das Licht aus dem Uferpark nur tröpfchenweise herein. Fast wie in einem Sarg, so steht der alte Mann vor mir, er erscheint mir wie maßgeschneidert für den kleinen Raum. Ein Graf auf seinem Gut, tadellos gekleidet. Und das nicht aus Selbstgefälligkeit oder Überheblichkeit, sondern um seine Selbstachtung zu bewahren, so versichert er allen, die darüber staunen. Er trägt feine, dunkle Baumwollsocken und schwarze Ledermokassins. Eigentlich bevorzugt er Schnürschuhe, aber da machen seine Hände nicht mehr mit.
Die Kollegen haben mich vorgewarnt, aber deswegen bin ich nicht weniger erstaunt. Entsetzt eigentlich. Alles ist sauber und ordentlich, da gibt es nichts zu meckern, und trotzdem ersticke ich. Der Geruch von Putzmittel und altem Papier, die Heizung, ich weiß auch nicht. Ich bekomme keine Luft. Den alten Mann amüsiert das.
»Beeindruckend, nicht wahr? Schau dich ruhig um.« Er nähert sich dem Teller, nimmt den Wärmedeckel ab und schaut darunter. »Und, was hat der Maître heute zusammengeköchelt?«, witzelt er, als er zwei halb mit Püree bedeckte Fleischscheiben erblickt.
Vom Teller steigt Dampf auf und erinnert mich an die drei Gerichte, die im Flur auf mich warten.
»Guten Appetit, Monsieur Picquier. Sobald ich fertig bin, schaue ich noch einmal bei Ihnen vorbei.«
»Nimm dich in Acht vor den alten Hühnern! Vor dem Fuchs haben sie Angst, aber Rotschöpfe mögen sie. Dein Gesichtchen ist ganz nach ihrem Geschmack.«
Mein Gelächter klingt wenig überzeugend.
»Das ist Altenhumor, daran musst du dich gewöhnen!«
Das habe ich.
Obwohl wir die Bewohner offiziell mit dem Familiennamen anreden sollen, machen wir uns untereinander gerne ein bisschen lustig. Wir benutzen alle möglichen Spitznamen, um gute oder schlechte Eigenschaften hervorzuheben. Die meisten sind wenig schmeichelhaft, manche aber klingen liebevoll, fast poetisch.
Monsieur Picquier heißt bei allen nur »der alte Buchhändler«, und dabei schwingt diese seltsame Hochachtung mit, die man vor Menschen hat, die man als besonders wahrnimmt, ohne genau zu wissen, woher diese Besonderheit kommt. Es ist wie eine Legende, die wir Aushilfen uns weitererzählen. Monsieur Picquier, der alte Buchhändler.
Vor sieben Jahren hat er alles verkauft. Dort, wo jetzt ein Quickburger ist, war früher die Buchhandlung L’Ittéraire Bis. Aber die habe ich nie gekannt.
2
Ich bin gerade achtzehn geworden. Nach Collège und Lycée ging es für mich sofort ans Arbeiten. Ich hab die Kurve nicht gekriegt. Eigentlich ist es ganz einfach: Laut Statistik bestehen achtzig Prozent das Abitur. Aber ich bin unbemerkt auf die Seite der zwanzig Prozent gerutscht. Ich weiß nicht mal, ob ich in diesen Statistiken überhaupt auftauche. Die Lehrer haben mich jedenfalls nie wahrgenommen. Egal, welches Fach gerade dran war, Grégoire Gélin war abwesend anwesend. Wie einer, der durch Wände gehen kann.
Schon in der achten, als das mit der Berufsvorbereitung losging, habe ich Panik geschoben. All diese Berufe, für die man diesen oder jenen Studiengang braucht … keine Ahnung, aber für mich war das, als würde mir eine Tür nach der anderen vor der Nase zugeschlagen. Ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen:
»Diese Berufsberater haben keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich würde Bäume mögen, und da hat er vorgeschlagen, ich sollte Forstwirtschaft studieren. Dafür braucht man aber ein naturwissenschaftliches Profil, und Mathe kapiere ich nicht. Was soll ich denn machen?«
Meine Mutter meinte darauf ganz pragmatisch:
»Geh arbeiten, so wie ich in deinem Alter!«
Die Stadtverwaltung suchte Aushilfen, aber das Grünflächenamt war eine Pleite. Mir hätte es dort gefallen können, ehrlich, draußen sein ist mein Ding, aber mein Job bestand aus Rasenmähen und Laubblasen, den ganzen Tag, und am Ende habe ich noch Hundekacke und kaputte Flaschen eingesammelt. Ich hatte schnell die Nase voll. Meine Mutter kennt Monsieur Théron, den Beigeordneten für Soziales, er hat dann seine Beziehungen spielen lassen, seinen direkten Draht zur Leitung von Les Bleuets. In meinem Arbeitsvertrag heiße ich »Hilfskraft für Krankenhausdienste«. Fünfunddreißig Stunden die Woche. Madame Masson, die Leiterin des Pflegeheims, hat mein Gehalt selbst festgelegt. Ein klein bisschen weniger als der Mindestlohn, um meinen Status als Ungelernter zu unterstreichen. Ich habe ohnehin keine Wahl. Meine Mutter meinte zu mir:
»Endlich habe ich mal ein bisschen Luft!«
Mit meinem Lohn beteilige ich mich an den Haushaltskosten. Das ist die offizielle Seite. Ich selbst nenne mich APDAM – ahnungsloser Praktikant, der alles macht. Der alte Buchhändler sagt dazu »Faktotum«. Inzwischen kann ich darüber lachen.
In der Küche bin ich an einem 1. Februar gelandet. Die brauchten unbedingt jemanden, also bin ich hin. Draußen war es kalt, so um die drei, vier Grad, mehr nicht. Drinnen das absolute Dampfbad, siebenundzwanzig Grad, das heißt, kurz vor Mittag, als Jean-Mi, der Küchenchef, das Tagesgericht fertig hatte, waren es sicher dreißig. Einen Monat arbeite ich jetzt da und habe in dieser Zeit vor allem gelernt, dass man in Küchen bestimmt keine ruhige Kugel schiebt.
Sechzig Gerichte, mittags und abends. Vierzig im Speisesaal, zwanzig auf den Zimmern. Es gibt zwei Küchenhilfen, Marie-Odile und Chantal, denen ich, so gut es geht, zuarbeite, indem ich schweißgebadet zwischen Vorratsraum und ihren Arbeitsplatten hin und her renne. Mir gefällt es. Ich schäle Kartoffeln und wasche Salat. Wir hören Radio auf Partylautstärke. Wir reden dummes Zeug, aber oftmals schimpfen die beiden auch:
»Vier müssten wir sein! Immer wird hier runtergespart, die saugen uns aus.«
Weil ich der Neue bin, muss ich die Misere bezeugen. Aber es stimmt, wenn ein, zwei Leute mehr da wären, würde es das Arbeitspensum erleichtern. Besonders nach dem Essen, wenn alles sauber gemacht und weggeräumt werden muss, zwischen den ratternden, dampfenden Geschirrspülern. Das ist echt hart. Am Ende sind wir durchnässt und stinken so übel, dass man kotzen möchte.
Im Speisesaal sind es sieben, vier Frauen und drei Männer, die sich je nach Bedürftigkeit verteilen. Ich habe gesehen, dass vier Bewohner gefüttert werden. Die anderen schlagen sich, so gut es geht, alleine durch. Und nach dem Essen: Was soll ich sagen? Mich erinnert das an die Schulkantine und das Chaos, das wir immer veranstaltet haben, wenn es Erbsen gab. Aber was man da macht, strengt auch den Kopf an. Entweder du hast Mitgefühl, oder du hast keins. Es gibt alte Leute, die einfach zumachen, die sich an jedem Bissen verschlucken, die sich wegen nichts beklagen – wenn man es dann noch schafft, Späße zu machen und freundlich zu bleiben, dann läuft es. Wenn man aber ungeduldig wird, kann man sehr schnell verletzend werden oder gar übergriffig, wie sie es nennen. Und das hat nichts mit Bösartigkeit oder so zu tun: Man hält es einfach nicht mehr aus, ständig seine Bewegungen und seinen Tonfall zu kontrollieren. Wenn es richtig schlimm wird, rufen wir einen Kollegen, der einspringt, und dann geht man erst mal raus und versucht, mit einer Zigarette oder einem Kaffee runterzukommen. Wenn es dieses Miteinander nicht gäbe, würde die Stimmung ganz schnell kippen. Denn über uns steht die Pflegeleitung, die uns pausenlos einhämmert:
»Vergessen Sie nicht, dass Sie mit Menschen zu tun haben!«
»Vergessen Sie nicht, dass wir auch Menschen sind!«, erwidern dann manche, die einfach nicht mehr können.
Für die Essen auf den Zimmern gibt es fünf Kräfte, die je vier Bewohner versorgen. Die Hölle. Hier wird nicht mehr mit dem Löffel, sondern mit dem Trichter gefüttert. Monsieur Picquier gehört zu denen, die auf dem Zimmer essen. Er könnte auch runter in den Saal gehen, aber seine Parkinson-Krankheit schränkt ihn immer mehr ein. Vor allem aber ist es sein Wunsch, die Mahlzeiten allein zu sich zu nehmen. Das »Gegröle« im Speisesaal deprimiert ihn, meint er. Und versichert gleichzeitig, dass das nicht arrogant oder herablassend gemeint ist, sondern dass er sich einfach seelisch nicht dazu in der Lage fühlt.
»Wenn man immer weniger wird, so wie ich«, meint er. »Und dabei noch klar sieht, dann leidet man weniger, wenn man allein ist. Der Anblick der anderen hält einem unweigerlich den eigenen Verfall vor Augen.«
Vor drei Jahren, als sein behandelnder Arzt die Krankheit zum ersten Mal diagnostizierte, wollte er es erst nicht glauben. Doch dann häuften sich die Symptome, und elf Monate später war er gezwungen, die Entscheidung zu fällen, die ihm sein Arzt schon nahegelegt hatte. Haus, Auto und Buchhandlung, er hat alles verkauft, um das Pflegeheim bezahlen zu können, zweitausendfünfhundert Euro monatlich alles inklusive. Besonders traurig fand er, sich von Tausenden Büchern trennen zu müssen. Als ich wieder in sein Zimmer komme, nachdem ich mich um das Essen seiner Flurnachbarn gekümmert habe, höre ich zu, wie er von seiner Bibliothek erzählt wie von einem geliebten Menschen, der gerade verstorben ist. Mit einer kreisförmigen Bewegung seines rechten Arms deutet er auf die Zimmerwände, und mit kummervoller, verzweifelter Stimme erklärt er mir die Aufschrift an der Tür.
»Pauca meæ, das ist Latein und bedeutet: ›Das Wenige, das mir von ihr bleibt‹. Das, was du hier siehst, ist nur ein Zehntel dessen, was mir auf der Welt am meisten bedeutet hat. Es war grauenvoll, mich für diese dreitausend entscheiden zu müssen, sie den anderen vorzuziehen. Ein Schmerz, als würde man amputiert. Hast du schon mal von Phantomschmerz gehört?«
»…«
»Das abgetrennte Körperteil juckt und kribbelt, aber du kannst dich nicht kratzen. Ein Albtraum. Stell dir das mal vor! Siebenundzwanzigtausend Bücher, die ich nicht mehr in die Hand nehmen kann!«
Wie soll ich mir das vorstellen? Ich kann ihm ja nicht sagen: »Bücher? Bei mir zu Hause gibt es kein einziges.« Also erwidere ich mitfühlend, ohne groß zu überlegen:
»Sie sprechen über Ihre Bücher, als wären sie Ihre Familie oder Ihre Freunde.«
»Ja, genau so ist es.«
»Monsieur Picquier, würden Sie mir Ihren Teller geben? Ich muss weiter, die Mädels aus der Küche haben gesagt, ich soll mich beeilen.«
»Ja, ganz recht. Aber komm gerne wieder. Ich laufe nicht weg.«
Immer wenn ich kann, schaue ich bei ihm vorbei. Nicht sehr lange, denn nach der Arbeit bin ich komplett erledigt. Aber der alte Buchhändler in seinem Zimmer wirkt auf mich wie ein Magnet. Es ist wirklich komisch, aber einmal am Tag muss ich zu ihm. Mir ist schon klar, dass ich von kaum etwas eine Ahnung habe, ich ziehe ja ganz enge Kreise zwischen der Arbeit in Les Bleuets und der Zeit zu Hause mit meiner Mutter. Er aber ist ein richtiger Kopf, ein ganzes Leben voller Bücher, eine riesige Erfahrungsquelle. Aber was suche ich da eigentlich? Was tue ich bei diesem alten Mann, zwischen lauter Büchern? Übrigens hüte ich mich, die Bücher anzufassen oder gar aufzuschlagen. Vielleicht aus Angst? Ich weiß es nicht. Sicher ist das mein Schultrauma. Der alte Buchhändler spricht mich nicht darauf an. Aber ich bin ja nicht blöd, ich merke wohl, was er vorhat. Er lässt ein Buch herumliegen, damit ich den Titel sehen kann. Einen Titel, der mich neugierig machen könnte, glaubt er. Es ist wie ein Spiel: Ich lasse ihn in der Annahme, dass Lesen mich null interessiert, und er tut so, als habe er Wichtigeres zu tun, als mich umzustimmen. Was ist da falsch gelaufen in der Schule, dass ich zwei Jahre danach noch vor dem zurückschrecke, was sie am besten verkörpert: Bücher, die mich zugleich faszinieren und anwidern. Mir widerstrebt es, auch nur eines von ihnen durchzublättern. Monsieur Picquier würde sich freuen, das weiß ich. Aber so schnell werde ich nicht weich. Es ist wie ein stilles Abkommen. Der Status quo ist uns nicht unangenehm und hält mehrere Wochen, bis dieser unüberlegte, selbstgefällige Satz fällt:
»Monsieur Picquier, Sie sagen mir doch immer, dass ein Tag, an dem man nicht liest, ein nutzlos verbrachter Tag ist. Aber seit ich Sie kenne, habe ich Sie nie lesen sehen.«
»…«
Ich muss etwas wirklich Dummes gesagt haben. Sein Schweigen dauert mindestens dreißig Sekunden. Ich wage nicht, ihn anzuschauen.
»Es muss dir nicht leidtun. Dein Einwand ist nicht besonders zartfühlend, aber er ist gerechtfertigt. Es hat einen ganz einfachen Grund, warum ich nicht mehr lese: Ich kann es nicht. Sieh mal, wie meine Hände zittern. Ich weiß, du denkst jetzt, ich könnte das Buch auf ein Pult legen, aber außerdem lassen mich meine Augen im Stich. Der grüne Star hat gewonnen. Da hilft nichts mehr, keine Tropfen und kein Laser, nicht einmal Großschrift. Ich habe es versucht. Aber mit dem Lesen ist es vorbei. Was bleibt, ist die Musik.«
Ich bin unfähig, irgendetwas zu sagen oder zu tun, ich bewege mich nicht, mache mich so klein wie möglich. Monsieur Picquier hebt die rechte Hand zu dem CD-Spieler, den er neben seinem Sessel platziert hat, drückt auf Play und dreht die Lautstärke auf. Über das Display schiebt sich eine grüne Digitalschrift: Mahler, 5. Symphonie, Adagietto. Der Tod. Musik zum Weinen. Wie kommt das? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich ist das öder Alte-Leute-Kram. Und trotzdem erwischt es mich kalt. Mein Herz stockt. Vor allem schäme ich mich.
»Grégoire?« Monsieur Picquier ist mein betrübter Hundeblick nicht entgangen. »Grégoire, sag mal, kannst du lesen?«
»…«
»Wir sprechen darüber, wenn du wiederkommst. Lass mich jetzt allein.«
3
Ich brauche zwei Tage, um das zu verdauen, um mir die Szene tausendmal vorzuspielen und zu meinen Gunsten umzuschreiben, damit ich nicht so erbärmlich erscheine. Irgendwann gehe ich wieder zu ihm, ich klopfe wie gewohnt an seine Tür und warte. Auf sein »Herein!« betrete ich das Zimmer. Er sitzt in seinem Sessel. Ich gehe auf ihn zu und reiche ihm unterwürfig die Hand.
»Monsieur Picquier, was ich da letztes Mal gesagt habe, war nicht richtig. Ich möchte mich deswegen entschuldigen.«
Ich habe ihn offenbar geweckt. Er hebt den Kopf, seine Augen lächeln mich an, dann hält er mir eine zitternde Hand entgegen, die meine ungemein sacht schüttelt. Seine Haut. Wie das Seidenpapier in einer Schachtel mit Luxusparfüm.
Er streckt die eingesunkenen Schultern und setzt sich auf.
»Grégoire, ich nehme deine Entschuldigung an. Die zwei Tage, an denen du nicht da warst, haben mir mehr zugesetzt, als du denkst.«
Mit einem Mal sehe ich klar.
»Monsieur Picquier, ich möchte ehrlich zu Ihnen sein. Lesen ist überhaupt nicht mein Ding, und was mein Arbeitspensum betrifft …«
Er unterbricht mich:
»Da erzählst du mir nichts Neues.«
»Also …«
»Also was?«
»Die Direktorin mag Sie doch sicher, oder?«
»Ja, das darf ich wohl behaupten.«
»Also, ich habe folgenden Vorschlag: Ich lese Ihnen eine Stunde am Tag vor, das wäre doch genial, oder? Damit helfe ich Ihnen aus der Klemme, und mir kommt es auch entgegen, denn dann habe ich eine Stunde weniger in der Küche. Nur eine Stunde! Monsieur Picquier, würden Sie die Direx fragen?«
Meine Stimme klingt flehend und zweifelnd zugleich, ich möchte ihm gefallen, na klar, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, mich zwischen Pest und Cholera zu entscheiden und mich zu etwas zu verpflichten, das ich doch immer verabscheut habe. Aber der alte Mann stellt sich all diese Fragen nicht. Sein Gesicht hellt sich auf.
Sobald er kann, begibt sich Monsieur Picquier nach unten ins Büro der Heimleitung. Ein Ereignis. Madame Masson kann es kaum fassen.
»Monsieur Picquier, Sie hier? Was für eine Überraschung!«
Wir haben Mai.
»Gleich schneit es noch!«
Sie schiebt die beiden Stühle weg, die ihrem Schreibtisch gegenüberstehen. Der alte Buchhändler rollt seinen Rollstuhl bis an die Tischplatte und legt seinen Unterarm darauf. So kann er der Heimleiterin direkt in die Augen sehen.
»Meine liebe Catherine, es geht um Grégoire …«
»Ah, Grégoire, der kleine Charmeur? Ich höre.«
»Ich weiß, die Dienstpläne sind eng geknüpft, aber …«
Monsieur Picquier zaudert.
»Wenn Grégoire ab und zu in der Küche fehlen würde, sagen wir eine Stunde am Tag …«
Wieder hält er inne.
»Dann?«, hakt sie ungeduldig nach.
»Dann könnte er mir vorlesen!«
»Monsieur Picquier? Grégoire? Sie scherzen wohl. Der arme Junge weiß ja nicht mal, was ein Buch ist.«
»Darum kümmere ich mich, Catherine. Ich bitte doch sonst nie um etwas.«
Catherine Masson, eine Frau Mitte vierzig, absolut selbstsicher und absolut sicher in ihren täglichen Entscheidungen, gönnt sich tatsächlich eine nachdenkliche Pause.
»Sie bringen mich da in die Bredouille, Monsieur Picquier. Wenn es nur um Sie ginge – Ihnen würde ich den Gefallen ja tun, gerne sogar, doch was Grégoire betrifft, da sieht es schlecht aus, dann habe ich morgen das Küchenteam auf der Matte stehen. Jean-Michel und die Damen werden schimpfen.«
»Lassen Sie sie schimpfen.«
Und wie sie schimpfen. Marie-Odile, Jean-Mi und Chantal beschweren sich lauthals. Die Direktorin bleibt hart. Weniger meinetwegen, ich bin nur ihr Angestellter. Vielmehr seinetwegen, Monsieur Picquier ist schließlich ihr Kunde.
»Sie müssen wissen, Grégoire, dass Ihnen dieses Privileg – denn das ist es, ein absolutes Privileg – jederzeit wieder entzogen werden kann. Die Arbeitskraft ist zu kostbar.«
»Das weiß ich, Madame Masson. Natürlich.«
Innerlich jubiliere ich – »Monsieur Picquier, sie ist einverstanden!« Ich klopfe eilig an, kaum dass er zurück in seinem Zimmer ist. Triumphierend verkünde ich:
»Sie ist einverstanden, Monsieur Picquier! Sie ist einverstanden!«
Ich vollführe einen kleinen Siegestanz um den alten Mann, dessen Hände ein wenig zittern.
Wir einigen uns darauf, unsere erste Stunde am ersten Montag im Juni abzuhalten, dann kann sich das Küchenteam noch ein wenig darauf einstellen. Zwei Wochen lang ziehen sie eine Fresse, es hagelt Gemeinheiten und böse Kommentare.
»Der Bubi ist auf Kuschelkurs!«
Keine Ahnung, ob damit ich und Masson oder ich und der alte Buchhändler gemeint sind. Aber das ist mir auch egal. Ich sage mir: »Halt lieber den Mund, die können dir den Buckel runterrutschen. In zwei Wochen bist du eine Stunde weniger in der Küche.«
Die große Frage ist, wie wir vorgehen wollen. Der alte Buchhändler hat sicher einen Plan. Ich verhehle nicht, wie gespannt ich bin. Welches Buch wird er auswählen? Wird er sich erinnern, was ihn selbst als junger Leser besonders bewegt hat, oder wird er ein Buch aussuchen, von dem er meint, dass es mir besonders gefallen könnte? Oder kann er beides verbinden? Der alte Buchhändler ist mit allen Wassern gewaschen, ich bin sicher, er wird beides in einem Buch vereinen.
4
Erster Montag im Juni. Zimmer 26. 16 Uhr 50. Monsieur Picquier erwartet mich. Unten in der Küche werden noch die Gemüsevorräte aufgefüllt. Jean-Michel lässt nicht locker, bis zur letzten Minute nicht. Wir haben 17 Uhr vereinbart. Da tönt aus dem Radio der Nachrichten-Jingle, und er grummelt:
»Hau schon ab, du Verräter.«
Schürze und Haube landen im Knäuel in meinem Fach. Die blauen Gummistiefel Made in China behalte ich an. Ich haste die Treppe hinauf zu meinem Retter. Die Tür ist nur angelehnt.
»Komm herein! Ich habe schon auf dich gewartet. Es ist alles bereit.«
Er sitzt in seinem Sessel, die Unterarme auf den Lehnen. Ein Sphinx. Er bittet mich, mich hinzusetzen. Ich bleibe stehen. Ohne ein Wort, nur mit einer Kopfbewegung, deutet er auf das Buch auf dem Tisch. Ich strecke die Hand danach aus. Ich zögere.
»Worum geht es da?«
»Lies den Klappentext.«
Ich fasse mir ein Herz. Ich nehme das Buch, sehe mir Titel und Autor an. Ich drehe es um. Am Tisch stehend, nur wenige Schritte vom alten Buchhändler entfernt, lese ich »Umschlagseite vier«, wie er es nennt. Konzentriert wie nie. Er unterbricht mich:
»Bitte laut! Ich dachte, du sollst einem alten Mann vorlesen, der es selbst nicht mehr hinkriegt. So lautet die Abmachung.«
»Ja, da haben Sie recht.«
Ich lache gekünstelt. Der Druck steigt. Lauter schlechte Erinnerungen kommen hoch. »Gélin, fortfahren!« In der Schule sollten wir nacheinander laut vorlesen, jeder war zwei bis drei Minuten an der Reihe. Eine halbe Stunde lang wechselten sich die Schüler in zufälliger Reihenfolge ab, die nur der Willkür des Lehrers entsprang und uns zwang, ständig auf der Hut zu sein, falls unser Name aufgerufen würde. »Gélin, fortfahren!« Es klappte immer. Ich war woanders. Irgendein Wort im Text ließ mich abtauchen, ich fantasierte einfach weiter, aber natürlich nie im Sinne des Lehrers. »Gélin!«
»Grégoire, hörst du mich?«
Die sanfte Stimme des alten Buchhändlers holt mich aus meinen Gedanken.
»Entschuldigen Sie, ich setze mich lieber, dann geht es besser. Soll ich näher heranrutschen, oder geht es so?«
»Fang nur an! Ist perfekt so.«
Ich lege los: »Der Fänger im Roggen von J. D. Salinger erscheint hier in einer Neuübersetzung, die dem Leser Gelegenheit gibt, die Abenteuer des weltberühmten jungen Helden wiederzuentdecken. Drei Tage vor Weihnachten wird der sechzehnjährige Holden Caulfield der Schule verwiesen …« 304 Seiten. Ich muss schlucken. Das fängt ja gut an.
»Wie viele Sitzungen brauchen wir wohl dafür?«
Monsieur Picquier gibt sich gelassen.
»Nicht mehr als zehn. Mach dir keine Sorgen, wir haben alle Zeit der Welt! Ich höre.«
Er schließt die Augen, lehnt den Kopf zurück, atmet tief ein und verkündet: »Ich bin bereit.«
Ich komme da nicht mehr raus. »Erstes Kapitel. Wenn ihr das wirklich hören wollt, dann wollt ihr wahrscheinlich als Erstes wissen, wo ich geboren bin und wie meine miese Kindheit war …«1 Meine Stimme klingt unsicher. Ich werfe einen Blick auf das Gesicht des alten Mannes. Er wirkt heiter, ruhig. Die Augen sind geschlossen. Immerhin schläft er nicht. Ich räuspere mich. Seine Lider flattern.
»Grégoire Gélin, fortfahren!«, flüstert mir eine Stimme zu.
Am Anfang bleibe ich bei den Eigennamen hängen. Die Geschichte spielt in den USA. Monsieur Picquier rät mir, einfach alles so auszusprechen, wie ich meine. Und um die korrekte englische Aussprache wollen wir uns später kümmern. Das Buch gefällt mir auf Anhieb. Dieser Junge, der sich mit dem Establishment anlegt, das bin ich. Wie er da in seinem Geschichtsaufsatz lauter Mist über die alten Ägypter schreibt, das ist einfach stark. Oder wenn er von seinen großspurigen Mitschülern erzählt, und wie einer von ihnen, während ein stinkreicher Stifter in der Schulkapelle eine Rede hält, einen Riesenfurz loslässt. Ich muss so lachen, dass ich nicht mehr weiterlesen kann. Monsieur Picquier wischt sich über die Augen. Eine Stunde ist schon vorbei. Ich muss los, wenn ich keinen Ärger bekommen will. Ziemlich stolz verkünde ich:
»Drei Kapitel, Monsieur Picquier. Nicht schlecht, oder?«
Erstaunt über meine eigene Leistung, lasse ich die zwanzig gelesenen Seiten über den Daumen springen. Der alte Buchhändler sieht mich an. Ich zapple wie ein junges Fohlen.





























