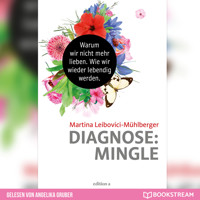Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition a
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Art von Burnout, die unser Gesundheitssystem immer öfter diagnostiziert, gibt es in Wirklichkeit nicht. Das Phänomen Burnout ist eine Erfindung der Gesellschaft, die sich damit nicht dem wahren Problem stellen muss: Wir haben die Kontrolle und Reglementierung der Lebendigkeit auf die Spitze getrieben. Burnout-Patienten sind Vorreiter eines Systemcrashs, doch wir sehen die Warnung nicht. Die Gesundheits- und Wellnessindustrie verdient viel Geld mit der Diagnose Burnout, doch sie macht alles nur noch schlimmer. Denn Ruhe, Entspannung und Ausgliederung aus der Arbeitswelt sind der falsche Weg. Work, pray, love!, empfiehlt die renommierte Ärztin und Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger zur Vorsorge und Heilung: Wir müssen das, was Leben ausmacht, das Dynamische, Unvorhergesehene, Herausfordernde, wieder zulassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martina Leibovici-Mühlberger: Die Burnout-Lüge
Alle Rechte vorbehalten © 2013 edition a, Wienwww.edition-a.at
Lektorat: Anatol Vitouch, Christine Schäffer
Cover und Gestaltung: Hidsch Druck: Theiss (www.theiss.at)
eBook-ISBN 978-3-99001-080-8
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
Inhalt
Einleitung
Meine eigene Geschichte mit Burnout
Burnout – aber wovon reden wir hier eigentlich wirklich? Der apokalyptische Reiter am Horizont
Process in progress
Wenn der Vorhang fällt
Wer einmal auf die schiefe Bahn kommt, wird immer schneller
Interdependenz – das dynamische „misfit“
Die Mär vom schlechten Menschenmaterial und der miesen Organisationskultur
Der Eisberg taucht auf
Gesellschaft des Sinnverlusts – Gesellschaft der Entfremdung – Burnout-Gesellschaft
Wer nicht mitspielen kann, wird vom Spielfeld geschickt. Ein Leben im Hinterhof.
Das Geschäft mit der Angst
Wenn aus einem potentiellen „Burnout-Fall“ ein Systemkritiker mit Stil wird
Und wo sind wir heute in unserer schönen, neuen, bunten Welt angekommen?
Das falsche Konzept der Menschwerdung als wahrer Hintergrund: Menschwerdung über Angst, Kontrolle und Machtgier
Was wirklich hilft und was es Zeit ist zu tun: Menschwerdung über Mut, Vertrauen und Kooperation
Wie wir das leben können, was wir sind und trotzdem nicht verhungern
Love – Work – Pray oder: Was der Mensch zum sinnerfüllten Leben braucht
Love: Liebe ist kein Gefühl sondern eine Haltung
Work: Eine neue Art von von Arbeitsbegriff und Unternehmenskultur
Pray: Sich aufgehoben fühlen, ganz ohne Kontrolle
Nachwort
Einleitung
Wenn ich heute nach einem langen Praxistag im Auto säße und mir überlegte, ob ich nun zumindest einem neuen Cabrio einen guten Schritt näher wäre, wenn mich beim Aussteigen aus dem Flugzeug nach einer intensiven Konferenz, bei der ich mit Vortrag oder Workshop aktiv beitragen konnte, ein Gefühl von sinnloser Ausgelaugtheit befiele, oder aber, wenn mir nach der Klausur mit meinem Team die vor uns liegenden Aufgaben als unüberwindbar erschienen, dann wüsste ich, dass etwas wirklich grob falsch in meinem Leben liefe. Dann wüsste ich, um es mit der gängigen Modediagnose zu belegen, – und Einrasterung ist dieser Gesellschaft heilig – dass nun auch ich einem sogenannten „Burnout“ nahe bin.
Ich wüsste allerdings auch, ganz entgegen der allgemeinen Meinung, dass es nicht die Arbeitsbelastung ist, die gerade im Begriff ist, mir das Leben abzugraben. Arbeitsbelastung macht müde. Das ist ein normaler Prozess und für sich genommen nichts Pathologisches. Sehr viel Arbeit hat also die Potenz, einen sehr müde zu machen. Ist ja auch irgendwie logisch. Dann muss man eben schlafen gehen, statt sich noch die Nächte mit hippen Veranstaltungen oder, in der Schmalspurversion, mit seinen Lieblingsserien um die Ohren zu schlagen. Und mehr, seien wir ehrlich, gibt es zum Thema Arbeitsbelastung nicht zu sagen. Dafür haben, zumindest in jenen Ländern, in denen das Burnout auf Basis der herbeigeredeten arbeitsbedingten Ausbeutung als zunehmende Seuche grassiert, tonnenweise Arbeitsschutz- und Ruhebestimmungen gesorgt. Eine Paradoxie, an der alle medial die Arbeitswelt vorverurteilende Berichterstattung geflissentlich vorbeiblickt. Gerade in jenen postmodernen, wohlregulierten und wohlsituierten Gesellschaften der westlichen Hemisphäre gibt es ja wohl im Vergleich zu einem vom Arbeitsschutz nahezu „unbelasteten“ Dritt- oder Viertwelt-Industriebetrieb beim Thema Arbeitsbelastung und Ausbeutung wirklich beim besten Willen nichts mehr zu bemängeln. Schon ein nur wenig kritischer Blick auf die eigene Elterngeneration, die Burnout nicht wirklich kannte, legt nahe, dass es sich hier nur um das Spiel einer gesamtgesellschaftlichen Wehleidigkeit handeln kann.
Das würde allerdings, in oben genanntem Szenario, trotzdem nichts an meinem Problem „mich knapp vorm Zusammenbruch zu fühlen“ ändern. Zugegeben, da fühlt man sich in der ersten Sichtung seines Zustands dann nicht besonders arbeitsfähig, was wiederum für die rasch auf den Plan tretenden Vertreter der Helferindustrie im Kreisbeweisschluss die Pforte öffnet, um scheinbar schlüssig die Arbeitsbelastung lautstark als Verursacher und Übel zu brandmarken. Im Gegensatz dazu würde in der hypothetischen Fallstudie meines eigenen Burnouts die Tatsache glatt unter den Tisch fallen, dass ich mich, mein Menschsein und meinen Sinn, genauso wie dies die meisten um mich herum tun, bereits vor Längerem verraten habe, dass ich mir selbst und allem um mich herum also schon lange entfremdet bin. Denn die Konsequenzen der Anerkennung dieses Faktums wären weitreichend und beängstigend für eine auf Konsum, Kontrolle und Überregulation alles Lebendigen ausgerichtete Gesellschaft, wenn wir den Mut fänden, hier wirklich hinzuschauen.
Gerade deswegen setzt ein so ideologisches wie reflexhaftes Räderwerk im Umgang mit Burnout und seinen aufziehenden Gefahrenzeichen ein: Wenn mein Zustand als Besorgnis erregend, aber noch nicht wirklich desaströs einzustufen wäre, dann würde man mir mit sonorer Stimme im Ton sakraler Offenbarung dringend zu mehr „Work-Life-Balance“ raten, gute Freunde würden mir vom „gesunden Egoismus“ vorschwärmen, und alle wären der Ansicht, dass Arbeit und Verantwortung dringend zu reduzieren sind. Dann könnte ich mich noch eine Weile mit gut abgesteckten Boxenstopps in einem Wellnesstempel über Wasser halten und mir am Wochenende einen kleinen Shoppingkick als kurzfristigen Energiebooster verpassen. Exklusive Hobbys wie Drachenfliegen oder Heliskiing könnten eventuell auch noch helfen. Oder es stünde mir noch der Weg offen, Städtereisen zu sammeln, teure Uhren oder auch nur Swatches, wenn meine Praxis weniger gut ginge. Und dann blieben noch verkokste Sexpartys, die man mir angesichts der Bedrohung durch den völligen Zusammenbruch wohl durchaus nachsehen würde. Wenn ich Glück hätte, käme ich damit bis in die Pension. Wenn nicht, würde ich eben mittendrin zusammenbrechen und aufwändig auf Kur geschickt, ohne mich je meinem eigentlichen Thema der narzisstischen Sinnleere stellen zu müssen. So oder so – ich bliebe auf dem Kurs einer Gesellschaft, die mit der Burnout-Lüge gut vorgesorgt hat, weil alle mitspielen und viele daran verdienen.
Lange Zeit bin ich der Burnout-Lüge selbst aufgesessen, ja, ich war als Ärztin sogar ihr Handlanger. Ich habe mit großer Anteilnahme das Schicksal der überarbeiteten Gutmenschen mitbeklagt, Patienten ausufernd auf meinen Schoß genommen, sie darin bestätigt, dass sie schwerst erkrankt und unbedingt schonungsbedürftig wären, und habe mit ihnen Pläne zum unbedingten Erstarken ihres persönlichen Egoismus und einer drastischen Reduktion der Arbeitsbelastung ausgearbeitet. Verweigerung von Belastung und Einsatz, Dienst nach Vorschrift, Widerstand gegen die allgegenwärtige Ausbeutung durch die Arbeitswelt oder Familie. Dabei habe ich nur Symptome bekämpft, mitgeholfen, einen Plan für ein Überleben auf niedriger Ebene zu schaffen, angepasst zu bleiben. Die eigentlichen Ursachen aber habe ich damit weiter besichert und stabilisiert.
Meine eigene Geschichte mit Burnout
… ist eine sehr alte. Als ich Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts Medizin studierte, hatte der deutsch-amerikanische Psychoanalytiker Herbert Freudenberger die psychologisch interessierte Kollegenschaft gerade mit einer ersten Veröffentlichung zu einem von ihm in Sozialberufen zunehmend beobachtbaren, frappierenden Phänomen aufhorchen lassen.
Sozialarbeiter, Psychologen, Krankenschwestern oder Vertreter anderer helfender Berufe, die über Jahre hinweg hoch engagiert ihren Berufspflichten nachgekommen waren, verloren plötzlich gänzlich ihren Elan, entwickelten eine zynische Einstellung zu ihren Klienten und verfielen in einen Zustand von Antriebslosigkeit und emotionaler wie physischer Erschöpfung, bis hin zu vollständiger Apathie. Mit dem Begriff „Burnout“ war ein Wortbild geschaffen, das die Gemüter zu erhitzen vermochte und zu näherer Begriffsbestimmung drängte. Zahlreiche verbale Beschreibungsversuche tauchten auf, die alle letztendlich einem bemühten Gestammel glichen.
Entweder waren sie zu unspezifisch, um der notwendigen Trennschärfe gegenüber anderen Syndromen gerecht zu werden oder aber zu spezifisch und eingrenzend, sodass jedem durch Fallpraxis mit der Materie Vertrautem sogleich ein waschechter „Burnout“-Patient einfiel, der in diesem Modell durch die Maschen rutschen würde. Irgendwie einigten sich der Boulevard und eine Burnout-Forschung, die, beurteilt man sie nach Kriterien wie Validität, bereits ganz unten auf recht wackeligen Beinen steht, darauf, dass es sich beim Burnout um einen arbeitsbezogenen Zustand von physischer, emotionaler und mentaler Erschöpfung handelt, einer drastischen Überarbeitung also, die von Depersonalisation und eklatantem Leistungsabfall gekennzeichnet wird.
Wir, die wir uns bereits als intellektuelle Speerspitze einer neuen Ärztegeneration sahen, die sich weigerten, das Seelenleben des Menschen weiterhin strikt von den körperlichen Vorgängen sowie den auftretenden Krankheitsprozessen getrennt zu sehen, waren von diesem seltsamen Syndrom fasziniert. Trotz meiner in jüngerem Lebensalter noch ausgeprägten Respekthaltung gegenüber Wissenschaft und Forschung kann ich mich sehr klar an das sichere Gefühl erinnern, dass sich in den gängigen angebotenen Deutungen immer nur ein begrenzter Abschnitt reflektierte. Das Ding war größer. Da steckte mehr dahinter als der simple Zusammenbruch unter zu großem Arbeitsdruck, wie man es gerne auf eine Kurzformel brachte. Das war wirklich spannend. Die meisten von uns hatten sich, was zum damaligen Zeitpunkt ohne Internet noch mehr einer Geheimoperation glich und heute über Knopfdruck zu haben ist, über diverse Quellen ein MBI (Masłach Burnout Inventory) als Fragebogen – gemeinsam mit dem weniger verbreiteten TM (Tedium Measure) die Bibel der Burnout-Forschung – gecheckt, um auf eigene Faust und im heroischen Selbstversuch die Burnout-Gefährdung zu erheben. Mir kamen schon damals ziemliche Zweifel. Meine Frage, WIE es zur Auswahl und Erstellung der einzelnen Items kam, wurde nie zufriedenstellend beantwortet, und auch in meinem eigenen Ergebnis zeigten sich, sooft ich es auch wiederholte, nur Anomalien.
Als Werkstudentin, die aus einer kleinen Beamtenfamilie aufgebrochen war, um den unserer Generation vorgegebenen Olymp der Akademisierung zu erklimmen, musste ich mir mein Studium ziemlich vollständig selbst finanzieren. Das bedeutete zumindest einen Tag in der Woche Meinungsforschung als Straßenbefragung, durch deren Lenkung wir in der Folge entschieden, ob die Bürger unseres Landes zum Beispiel für die revolutionäre Form des Mozarttalers konsumreif waren. In den Wochenendnächten schlüpfte ich dann ins Kostüm der Barfrau, ersparte mir damit das Ausgehen und hatte dennoch eine Menge Spaß. Ich lernte auf diese Weise unwahrscheinlich viele Leute sowie verschiedene Drinks kennen und verdiente entsprechend Kohle. Den Rest der Zeit widmete ich mehr meiner Medizinorientierung, indem ich in einer Privatklinik für zwei arabische Querschnittpatienten als Pflegerin arbeitete. Der eine war bei der Falkenjagd vom Pferd gestürzt, dem anderen war ein Kamel, das er angefahren hatte, aufs Autodach gefallen. Beide hatten reges Interesse am Ausschnitt meiner Dienstbluse, waren aber sonst kooperativ und ziemlich aufwändig mit ihren Gebetsritualen versorgt, sodass mir in den Umlagerungspausen jede Menge Zeit blieb, um mich auf meine Rigorosen vorzubereiten. Die meisten meiner Kommilitonen waren, die Theorie der Überarbeitung vor Augen, der sicheren Ansicht, dass mich meine achtzig bis neunzig Arbeitsstunden pro Woche pfeilgerade von der Seite der Burnout-Beforscher auf die Seite derer befördern müssten, die diesem Syndrom in absehbarer Zeit erliegen. Aus meinem Blickwinkel schien jedoch das krasse Gegenteil der Fall zu sein. Es fühlte sich an, als nähme ich mein Leben immer mehr in Besitz. Obwohl ich zugeben muss, dass mich, obrigkeitsgläubig wie ich mit dem Rest meiner Generation grundsätzlich erzogen worden war, immer wieder Zweifel über meine eigene Befindlichkeit befielen, ich mich sozusagen belauerte, ob nicht der Hintergrund meiner täglichen Arbeitsmotivation bereits den Abgrund einer aufflammenden Ausgebranntheit bereithalten würde. In der Zwischenzeit erlernte ich praktischerweise, wie sich effizient in Salamischeibchen schlafen lässt, was mir für meine spätere Facharztausbildung sehr zugute kam. Ich begann, zunehmende Faszination für dieses schillernde Phänomen Burnout zu entwickeln.
Ich arbeitete in jenem Trakt, der die voraussichtlichen Langzeitpatienten beherbergte. Unter Titeln wie Neurasthenie, psychovegetativer Kollaps oder auch Managersyndrom residierten in den mehr einem Hotelambiente ähnelnden Krankenzimmern auch immer wieder Patienten mit bemerkenswerten Geschichten ihres persönlichen Zusammenbruchs. Wir behandelten sie zuallererst mit der obligaten Durchuntersuchung, die über jede Körperöffnung das Innerste nach außen zu kehren trachtete, um so eine somatische Ursache und damit rational nachvollziehbare Erklärung zu finden. Manche erwiesen uns den Gefallen, dass sie alle Zeichen einer chronischen Gastritis hatten, litten unter erhöhten Blutdruckwerten oder aber zeigten in ihrer Anamnese hartnäckige Verdauungsprobleme oder unterschiedlichste Formen von Darmentzündungen. Einige Fälle von Tinnitus legten ebenfalls nahe, dass hier das Ohrgeräusch nicht die Ursache sondern eine Begleitreaktion eines anderen, viel tiefer liegenden Prozesses sein musste, der den betroffenen Menschen in seiner Gesamtkonstruktion in Frage zu stellen vermochte.
Bei den meisten jedoch waren die Symptome ein wirres Bündel von Befindlichkeitsstörungen und Ausdruck eines langandauernd hochgefahrenen und aus der Regulation gefallenen Stresssystems. Unisono ließen sich Schlafstörungen, Unruhezustände, zunehmende Ängste, den erlebten Anforderungen nicht mehr entsprechen zu können, feststellen. Dazu kamen Versuche, sich mit Aufputschmitteln fit zu machen und abends mit Alkohol und Schlafmitteln aus dem überdrehten Zustand wieder herunterzuholen. Irgendwann stand dann der Zusammenbruch als Endausbaustufe dieser Entwicklung ins Haus.
Wenn das somatisch orientierte Behandlungsarsenal erschöpft war, wurden die Neurologen und Psychiater zugezogen, die den Medizinschrank der Psychopharmaka aufschlossen, Schlafkuren, Arbeitskarenz und entsprechende langfristige medikamentöse Einstellung propagierten. Und ich durfte unbeachtet und – ich gebe es offen zu – von meiner Neugierde getrieben unbehelligt, da unter dem Schutz einer sehr einfühlsamen Stationsschwester, mit den Patienten Gespräche führen. Nicht, weil man sich davon irgendetwas versprach, sondern weil man es ganz sicher für bedeutungslos hielt. Wir bewegten uns damals schließlich in einer Zeit, in der Psychotherapie noch den Nimbus von Unanständigkeit hatte und nahezu jeder gestandene Psychiater, dem sein Ruf als ernstzunehmender Mediziner wichtig war, darauf achtete, lautstark einen weiten Bogen um dieses unseriöse Ding zu ziehen. Abgesehen von wenigen Mutigen, denen allerdings viel zu verdanken ist, wurde mit den neuen Ansätzen von Gestalttherapie, Psychodrama, Gesprächspsychotherapie, Gruppendynamik oder gar Körpertherapie nur heimlich kokettiert. Fürs „Reden“ gab es schließlich den Gewerbeschein „psychologische Beratung“, den jeder, vom Andenkenverkäufer über die berufene Hausfrau bis zum Tierpfleger, anstandslos lösen konnte.
Meine Faszination war perfekt, wenn ich unseren Patienten lauschte, während sie eine immer andere und trotzdem auf magische Weise immer gleiche Geschichte ihres Verfalls beschrieben. Meine Ratlosigkeit allerdings auch. Was war mit diesen Menschen geschehen, die jetzt vielfach wie ein Schatten ihrer selbst auf unseren Gängen herumschlichen, sich wie Frischoperierte nur mit Begleitung bis in den Garten vorkämpften und einen zu ihren Laborparametern so widersprüchlich hoffnungslosen Gesichtsausdruck trugen. Das waren doch vielfach Menschen, die es, wie man so sagte, in ihrem Leben zu etwas gebracht hatten, Manager, Schauspieler, Wissenschaftler, Ärzte, Rechtsanwälte mit großen Kanzleien, Unternehmer oder solche aus der Klasse von Reich und Schön. Was konnte schon in so einem Leben so schief gehen, dass sie alle meinten, einfach nicht mehr weitermachen zu können? Oder waren hier vielleicht endogene, möglicherweise genetische Faktoren im Spiel, die bei Erreichung irgendeiner unsichtbaren Zeitmarke magisch darüber entschieden, ob der eine einer langanhaltenden Arbeitsbelastung gewachsen war, während der andere davon in unverhinderbarer Weise arrodiert und durch die Arbeitswelt zur Strecke gebracht wird? Ging es darum, Menschen mit Schutzfaktor von jenen mit einem Gefährdungsfaktor unterscheiden zu lernen, um dies eventuell in die Berufs- und Karriereplanung mit einbeziehen zu können? War es vielleicht an der Zeit, der bitteren Wahrheit ins Auge zu blicken, dass sich schlichtweg nur „Träger des egoistischen Gens“, (Dawkins vulgärevolutionistische Haltung war damals als Erklärungsmodell äußerst en vogue) für Spitzenpositionen eigneten?
Auch heute bin ich der festen Überzeugung, dass es „Schutzfaktoren“ gegen Burnout gibt, die immunisieren. Allerdings finden sich diese nicht auf einem gefällig niederzunagelnden Genlocus, sondern in einem auf den ersten Blick komplex anmutenden, jedoch grundsätzlich jedem zugänglichen Mindset begründet.
Die Krux an der Sache liegt darin, dass es massive Interessen gibt, alles so zu belassen, wie es ist. Personalisiertes Burnout, das heißt der persönliche Zusammenbruch von einzelnen Personen, ist der Gesellschaft lieber, als die wirklichen Ursachen zuzugeben. Aber Burnout ist nicht das Ausbrennen von einzelnen Individuen, die – das dürfen wir uns dann in der Gewichtung aussuchen – entweder persönlich zu wenig belastbar sind oder von einem inadäquaten Anforderungsberg erschlagen worden sind, obwohl es immer so aussieht. Das ist nur die Burnout-Lüge, die unsere Gesellschaft erfunden hat. Die Sache geht viel tiefer, erwächst direkt aus unserem innersten Betriebssystem, und dort soll nach Möglichkeit keiner hinschauen, hinfühlen oder gar hindenken. Die Burnout-Lüge soll uns vom eigentlichen substantiellen Problem des drohenden Systemkollaps ablenken, dem Gesellschaftsburnout und seinen wirklichen Gründen. Der einzelne Burnout-Patient ist sensibler Protagonist und „blinder Seher“ der zu Grunde liegenden, unsere Zukunft vernichtenden tektonischen Verschiebungen im Untergebälk unserer tragenden Gesellschaftsstruktur. Er wird belächelt oder bedauert und rasch in den Hinterhof eines mechanistisch-reduktionistischen Medizinsystems geschickt. Dabei wird auch nicht darauf vergessen, ihn selbst noch vielfach zu kommerzialisieren.
Doch all dies war mir damals nicht einmal in Ansätzen klar. Auch ich erlag dem simplen Charme des Erklärungsmodells der Überarbeitung, das noch dazu von jedem Patienten durch seinen Bericht, sich den Arbeitsbelastungen nicht mehr gewachsen zu fühlen, Ohnmacht vor einem als unüberwindbar aufgetürmten Berg von Anforderungen zu empfinden, genährt wurde. Also entwarf auch ich mit meinen Klienten „Arbeitsbelastungsreduktionspläne“, Dienst nach Vorschrift, Modelle oder Delegationsstrategien, die, würden sie auch andere, die die Mehrarbeit zu tragen hatten, unter enormen Druck setzen, zumindest meine Klienten möglichst freispielen sollten.
Parallel dazu widmete ich mich der Fahndung nach Risikooder Schutzfaktoren und war vor allem an der Prozesshaftigkeit der Entwicklung des Burnout-Syndroms interessiert. Es erschien mir immer wie ein Eisberg, dessen oberste Spitze lange schon aus dem Wasser ragt und dessen gewaltige, verborgenen und erschreckenden Eismassen irgendwann schließlich von Geisterhand über die Wasseroberfläche gehoben werden, um dann den gesamten Lebensraum auszufüllen. Was war die Kraft, die das zustande brachte?
Das sollte mich noch einige Jahre mit weiteren tastenden Arbeitshypothesen in meiner Praxis beschäftigen…
Burnout – aber wovon reden wir hier eigentlich wirklich? Der apokalyptische Reiter am Horizont
Markus ist gerade 38 Jahre alt geworden und hat alles erreicht, was man sich in diesem Alter wünschen kann und worauf man nach einem Abschluss summa cum laude und entsprechenden Postgraduate-Studien an einer amerikanischen Eliteuniversität hoffen darf. Ein schmuckes Innenstadtappartement in Frankfurt, weil dort das Hauptbüro seines Dienstgebers, eine global operierende Unternehmensberatung, stationiert ist, jede Menge maßgeschneiderter Anzüge, den obligaten Sportwagen, Vorgesetzte, die ihn rund um den Globus hetzen und dabei große Stücke auf sein Verhandlungstalent, seine Lösungskompetenz und seine „behavioural flexibility“ halten. Sein innerbetriebliches strategisches Beziehungsmanagement ist großartig und immer am Puls der Zeit. Nie sieht man ihn mit den „falschen Leuten“ ein Bier nach Dienstschluss trinken, der sowieso weit in den Nachtstunden liegt. Markus ist ein Mann mit Zukunft, nicht nur mit genagelten Schuhen.
Markus ist aber seit einiger Zeit auch ein Mann mit einem Problem, das so ernste Dimensionen anzunehmen droht, dass mich dieser Strahlemann, der jederzeit bei einer Football-Mannschaft anheuern könnte, nach einem Vortrag anspricht und um einen Termin in meiner Praxis bittet. In dem, was ich gerade beschrieben habe, würde er sich zu genau abgebildet wiederfinden, um noch weiter wegsehen zu können. Jedes Telefonat wäre schon längst eine Qual für ihn, jede Auslandsreise ein Martyrium, und das, wo er zumindest zweimal die Woche nach Wien und von dort oft noch weiter in den SO-europäischen Raum fliegen müsse. Zumindest hätten wir auf diese Weise keine Probleme bei der Terminfindung, wenn ich flexibel mit Randzeiten sein könnte, meint er. Außerdem würde ich das Ganze dann ja sozusagen gleich „live“ erleben und behandeln können.
Er befürchtet nämlich, dass er sich so etwas wie eine Flugneurose zugelegt hat. Er durchläuft immer ärger werdende Panikattacken, sobald er in den Flieger steigt. Bis jetzt ist es ihm gelungen, das Ganze zu verbergen, aber wenn er sein Grundgefühl beschreiben müsste, so ist es, als würde seine gesamte Energie aus ihm herausfließen. Er fühlt sich zunehmend leer, ausgehöhlt. Schon morgens beim Aufwachen kommt ihm der Tag wie ein unüberwindbarer Berg vor, der drohend vor ihm steht. Hartnäckige Rückenschmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule quälen ihn nahezu den ganzen Tag und haben ihm das Jogging verleidet. Aber auch das scheint bereits egal, er findet sowieso nicht die Kraft, sich dazu aufzuraffen. Eigentlich möchte er sich nur mehr verstecken, mit niemandem reden müssen, die Decke über den Kopf ziehen, keine Präsentationen mehr halten oder Verhandlungen führen und dabei noch souverän wirken. Natürlich hat er sich mit Aufputschmitteln beholfen und in den letzten Monaten auch eindeutig zu viel Koks konsumiert, aber dieses Sinnlosigkeitsgefühl, das aus der Tiefe in ihm aufzusteigen droht, ist so unerträglich …
Und da ist dann noch die Sache mit Sabine, ursprünglich eine bequeme erotische Freundschaft in Wien, ohne feste Bindungsabsicht mit wechselseitigem Einverständnis der sexuellen Gebrauchskultur schwer beschäftigter Karrieremenschen. Sabine ist jetzt schwanger und hat ihn davon in Kenntnis gesetzt, dass sie mit 36 Jahren und im Hinblick auf das Karriereplateau, das sie erreicht hat, den Zeitpunkt für günstig hält und das Kind bekommen wird. Gleichzeitig damit hat sie ihn, Markus, entsorgt-fairerweise ohne weiteren Alimentationsanspruch. Er ist also ein Samenspender ohne weitere Verwendung. Wenn er es genau bedenkt, hatte gerade damit sein Zustand eine dramatische Wendung zum Negativen erfahren …
Manuela ist eine bildhübsche junge Frau. Nur dieser etwas leere Gesichtsausdruck, der auf eine langfristige Psychopharmakaeinstellung hinweist, um möglichst emotionsbereinigt durch den Alltag zu kommen, rückt ihre äußere Erscheinung und Geschichte in ein Licht, das die Ereignisse der letzten Monate glaubwürdig erscheinen lässt. Sie hat es nämlich von außen betrachtet total fein getroffen, das große Los gezogen, wie alle ihre Freundinnen sicher neidvoll zugeben müssten. Manuela ist mit Paul verheiratet, der knappe fünfzehn Jahre älter als sie, dafür ein Immobilienmagnat der Wiener Innenstadt ist. Sie genießt mit ihm und ihren beiden Kindern ein sorgenfreies Leben. Eine Nanny, eine Haushälterin und ein Gärtner bilden eine stabile entlastende Organisationsstruktur, Paul ist für Männer seiner Finanzklasse vergleichsweise aufmerksam und, von situativen Ausrutschern abgesehen, treu, und Manuela kann sich neben der Betreuung ihrer Kinder und dem Gesellschaftsleben mit Paul der eigenen Instandhaltung ohne wesentlicher Einschränkung widmen. Wie kann also jemand mit einem derartig sorgenfreien Leben von zunehmenden Überforderungsgefühlen, gehäuften Attacken von Herzrasen, die von den besten Internisten vermessen und als nicht somatisch begründet attestiert sind, gravierenden Schlafstörungen, die ohne entsprechende Medikation unbeherrschbar anmuten, und einem generellen Gefühl steigenden Lebensüberdrusses berichten. Burnout – oder doch eher „Bore-out“, aber vielleicht liegt das ja nicht zu weit voneinander entfernt. In den letzten Wochen ist es Manuela erst um die Mittagszeit gelungen, ihr Bett zu verlassen und die Morgentoilette zu bewältigen. Wenn die beiden Kinder aus der Schule gebracht wurden, löste deren Lebendigkeit und Wunsch nach Kommunikation nur Verzweiflung bei ihr aus. Paul hatte, was als ein durchaus ernstzunehmendes Problem gesehen werden muss, bereits mehrere Abendveranstaltungen ohne sie wahrnehmen müssen, da sie der Gedanke, auf so viele fremde Menschen zu treffen, in unstillbare Weinkrämpfe gestürzt hatte.
Dabei fühlt sich Manuela nicht wirklich deprimiert. Ihr vorherrschendes Gefühl ist einfach totale Erschöpfung, bleierne Gliedmaßen, unendliche Müdigkeit, als wäre sie ihr ganzes Leben durch eine Wüste geirrt und würde jetzt nicht mehr können. Endlos lange ist ihr unerklärliches Verhalten für Paul sicher nicht mehr tragbar, so denkt sie selbst …
Process in progress
Friedrich ist ein 46-jähriger, etwas ängstlich strukturierter Postbeamte. Ein hartnäckiges, feinschlägiges Zwinkern hat sich in seinem rechten Oberlid eingenistet. Es mutet fast so an, als würde er mit mir in eine Art nonverbalen konspirativen oder gar auffordernden Dialog treten wollen, während er seine Geschichte erzählt. Aber Friedrich ist alles andere als zu Scherzen oder Anmache aufgelegt. Immer wieder blickt er sich hastig nach imaginärer Bedrohung in meinem Sprechzimmer um, um dann wieder den Kopf wie eine Schildkröte zwischen seinen hochgezogenen Schultern zu verstecken. Begonnen hat alles, wie er zu diesem Zeitpunkt unseres ersten Anamnesegesprächs noch glaubt, mit dieser verdammten Umstrukturierung und seiner damit unvermeidlichen Versetzung von der Paketverwaltung zum Schalterdienst. Die Verantwortlichkeit für die Kassaführung stresst ihn so, dass er in einem Kreislauf von Angst, Schlaflosigkeit und Auslieferungsgefühlen versinkt. Längst hasst er alle Schalterkunden aufs Tiefste. Er fühlt sich von ihnen feindselig beobachtet und von ihrer Ungeduld unter Druck gesetzt. Dazu kommt, dass er sich, immer schon zur körperlichen Selbstbeobachtung neigend, physisch sehr angegriffen fühlt. Ein Infekt löst den anderen ab. Den ganzen Winter und Frühling über leidet Friedrich unter nie wirklich ausheilenden grippalen Infekten, die er dem Schalterdienst zuschreibt. Aber auch im Frühsommer wird es nicht besser. Das grundsätzliche Gefühl von Schwäche, Auslieferung und hohem Stress schon am Morgen zu Arbeitsbeginn sind ihm zu viel. Immer wieder muss er unter den verschiedensten Vorwänden und körperlich vielgestaltigen, diffusen Beschwerdebildern, die eine ausgedehnte ergebnislose Gesunden-Untersuchung nach sich ziehen, Pausen im Rahmen von Krankenständen einlegen.
Dann wird bei seiner Frau, die eine besonders stützende Funktion für seine Persönlichkeit übernommen hatte, eine chronische Autoimmunerkrankung festgestellt. Der Fokus der Aufmerksamkeit verschiebt sich zwangsweise. Aufwändige Untersuchungen, Krankenhausaufenthalte, eine Operation und ein längerer Kuraufenthalt folgen. Friedrich allein zu Haus erlebt eine völlige Dekompensation seiner Beschwerden. Abends konsumiert er größere Mengen Alkohol, um seine Ängste vor dem nächsten Tag niederkämpfen zu können. Auf der Fahrt mit der U-Bahn zum Arbeitsplatz häufen sich plötzlich auftretende Attacken von Panik und Atemnot, die ihn zwingen, vorzeitig auszusteigen. Schließlich kommt es bei ihm zu einem Gesamtzusammenbruch, der eine achtwöchige Stationierung auf einer neurologischen Abteilung nach sich zieht. Jetzt sitzt er zur Nachbetreuung bei mir …
Sonja ist 44 Jahre alt und Verkaufstrainerin in der hausinternen Schulungsakademie eines internationalen Wäschekonzerns. Eine große, schlanke Frau mit grundsätzlich äußerst gepflegtem Auftreten, das jedoch nun einige Zeichen von „Verwilderung“ trägt und gerade noch von der Selbstverständlichkeit jahrelanger Disziplin vor dem Abrutschen in die Ungepflegtheit bewahrt wird. Disziplin in ihrer eisernen Form zählt sicher zu Sonjas lebensbestimmenden Grundkompetenzen.
Als sie nach einer kargen, von Verlusterlebnissen geprägten Kindheit als Lehrmädchen für den Einzelhandel in den Konzern eintritt, erscheint ihr dies die erste wirkliche Chance in ihrem Leben auf Anerkennung und eine selbständige Zukunft. Die Dienstkleidung verleiht ihr Zugehörigkeit, ihre Filialleitung schätzt sie wegen ihres unermüdlichen Einsatzes, ihrer schnellen Auffassungsgabe und hohen Teamfähigkeit. Rasch gelingt ihr – entsprechend der Politik des Konzerns, Identifikation mit dem Unternehmen zu honorieren – der Aufstieg zur Leitung einer eigenen Filiale an einem prestigereichen, stark frequentierten Standort. Als Führungsverantwortliche zeigt sie auffallende Umsicht und ist bei ihren Mitarbeiterinnen wegen ihrer stark prosozialen Haltung enorm beliebt. Es wundert niemanden, dass Sonja in das kleine Entwicklungsteam geholt wird, dem auf Vorstandsbeschluss der Auftrag zuteil wird, eine interne Schulungsakademie aufzubauen. Sonja ist in ihrem Element und wirft sich mit einer weiteren Kollegin und einer älteren Vorgesetzten voll Elan in die Gestaltung dieser Aufgabe. Inzwischen ist sie 34 Jahre alt, bei ihren Schwestern und Freundinnen hat sich längst Nachwuchs eingestellt, und auch Sonjas Ehemann Bernhard fühlt sich für die Vaterrolle bereit.
Doch der Moment scheint Sonja äußerst ungünstig für Schwangerschaft und nachfolgende Karenz, wenn sie das Entwicklungsprogramm für das Verkaufspersonal ins Kalkül zieht, das es umzusetzen gilt. Das bleibt auch so, sodass sie, als sie zwei Jahre später durch einen Verhütungsfehler schwanger wird, gegen den Protest ihres Mannes und aus dem Gefühl heraus, ihre Kolleginnen und die ganze Aufbauarbeit sonst zu verraten, eine Abtreibung vornehmen lässt. Sie tut das, obwohl sie ihren eigenen Kinderwunsch stark wahrnimmt und nachfolgend monatelang unter Alpträumen und Schlafstörungen leidet. Längst lebt Sonja nur mehr für ihre beruflichen Ziele. Ein zunehmender Energiemangel, der im krassen Gegensatz zur Forderung steht, als Trainerin eine stets perfekte, optimistische und mitreißende Aura zu besitzen, höhlt sie zunehmend aus. Sie zieht sich von ihren Freunden zurück, erlebt sich von ihnen missverstanden. In der Beziehung kommt es zu einem beginnenden Abrücken der Partner von einander. Als sie anlässlich ihres vierzigsten Geburtstags auch das Thema „Kinder“ für abgeschlossen erklärt, entsteht ein endgültiger Riss in der Paarbeziehung. Es wird noch knapp zwei Jahre dauern, bis ihr Mann sie eines Abends mit der Eröffnung überrascht, dass eine andere Frau von ihm schwanger sei und er nun die Scheidung möchte. In der Zwischenzeit hatte sich zwischen dem Ehepaar eine Decke zunehmenden Schweigens über den darunter liegenden Schwelbrand gebreitet.
Der Konzern expandiert und Sonja fällt die Personalentwicklung in den neuen Filialen im Ausland zu. Ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere, den sie allerdings nur mehr mit Medikamenten und verschiedenen Aufputschmitteln durchhält. Abends, in den immer gleichen Hotelzimmern, befällt sie ein dumpfes Sinnlosigkeitsgefühl, das sich nur mit großen Mengen von Alkohol dämpfen lässt. Zu diesem Zeitpunkt verlässt sie ihr Mann endgültig. Nur die zufälligerweise von ihrer Vorgesetzten gegebene Versprechung, ihr die Leitung der Schulungsakademie zu übergeben, die diese selber wegen einer soeben diagnostizierten Krebserkrankung zurücklegen muss, scheint sie vor dem Absturz in den gähnenden Abgrund zu retten.
Doch der Vorstand entscheidet anders. Die inzwischen prestigeträchtige Schulungsakademie soll eine akademische Leitung erhalten. Sonja ist aus dem Rennen und muss sich einer jüngeren, in Führungsfragen unerfahrenen Vorgesetzten unterordnen. Das Verhältnis zwischen den Frauen ist von Beginn an starken Spannungen ausgesetzt. Sonja leidet das erste Mal in ihrem Leben unter Schwierigkeiten, sich für Ihre Arbeit zu motivieren. Sie verpasst ihre Flüge, reagiert unbeherrscht in den von ihr moderierten Gruppen, bekommt erstmalig negative Feedbacks zu ihrer Schulungstätigkeit und entwickelt hartnäckige Schlafstörungen. So kommt es, als Sonja einmal völlig übermüdet einnickt, zu einem durch einen Adventkranz verursachten Zimmerbrand, bei dem sie mittelgradige Verbrennungen an einer Hand und an einem Oberschenkel erleidet und hospitalisiert werden muss. Bereits während des Spitalsaufenthalts treten massive Angst- sowie Versagensgefühle auf. Der Gedanke, nach dem Krankenstand wieder in ihr Unternehmen zurückzukehren, erscheint ihr unerträglich. Weinattacken und ein nachfolgender gänzlicher psychischer Zusammenbruch führen noch während des Spitalsaufenthalts auf der Dermatologie zur Einleitung der psychiatrischen Behandlung.
Wenn der Vorhang fällt
Margret ist 46 Jahre alt und am Ende, wie sie gleich zu Beginn festhält. Ihr Blick spricht von Flucht vor einem unsichtbaren Feind, dem sie sich schon längst ergeben hat. Zur Konsultation kann sie nur in Begleitung ihres Mannes Robert erscheinen, der drei Jahre älter als Margret ist und die Terminvereinbarung an ihrer Stelle getroffen hat. Sie hätte, so erklärt sie, das nicht mehr geschafft. Auch besteht sie darauf, dass Robert sie ins Sprechzimmer begleitet, ein Wunsch, den er ihr etwas widerstrebend erfüllt.
Etwa zur Mitte der Sitzung schicke ich ihn hinaus. Es wird deutlich, dass Robert von der Situation mit Margret bereits sehr konsumiert ist, ihm das Ganze selber schon gehörig zugesetzt hat und ganz dringend etwas geschehen muss, weil er sonst nicht mehr weiter mitspielt. Dabei wirken die beiden auf den ersten Blick wie ein durchschnittliches Paar in den mittleren Jahren. Ein Paar, das sich einen gewissen Lebenswohlstand und fast schon Unabhängigkeit von den beinahe erwachsenen Kindern erarbeitet haben könnte, in gesicherten beruflichen Positionen ohne Turbulenzen untergebracht erscheint und dessen größte Herausforderung nun in einer optimalen Gestaltung dieser mittleren Jahre liegen könnte. Auch wenn vieles diesen ersten Eindruck zu bestätigen scheint, ist es bei näherer Betrachtung doch ganz anders und beinhaltet viel mehr als eine Krise zwischen Margret und Robert.
Dabei war Margret, die Frau, die mir jetzt mit fettigen, ungewaschenen Haaren gegenübersitzt, eigentlich immer eine „brave“ Frau gewesen. Genauso, wie sie zuvor ein „braves“ Kind war, das seinen Eltern wenig Probleme bereitet und nach der Matura rasch begriffen hatte, dass es viel aussichtsreicher ist, in den Staatsdienst einzutreten, statt ihrem brennenden Interesse für Pflanzen mit einem Botanikstudium oder ähnlich wirren Ideen nachzugeben. Das bestätigte sich auch durch die recht frühe Ehestandsgründung mit Robert und die rasch aufeinanderfolgenden Geburten der beiden ersten Söhne, die heute beide sehr erfolgreich studierten. Als Finanzbeamtin trug Margret zwar unspektakulär und freudlos, jedoch planbar und zuverlässig zum Familieneinkommen bei, seit der jüngere Sohn in die Schule eingetreten war.
Erwartungen zu erfüllen, war immer Margrets oberste Maxime. Das lässt sie nach außen zielorientiert bis ehrgeizig sowie genau und zuverlässig wirken und bereitet ihr im Inneren beständigen Stress. Im Amt nimmt sie eher eine Außenseiterposition ein. Ihre Rolle als „Finanzprüferin von Unternehmen“ setzt ihr enorm zu. Nirgends fühlt sie sich willkommen, beständig hat sie das Gefühl, dass man ihr ausweichen, etwas vor ihr verbergen will. Ihre Arbeitsbelastung steigt beständig an, da es ihr äußerst schwer fällt, sich gegen Kollegen abzugrenzen, ebenso der „Erfolgsdruck“ und die Vorgabe, unnachgiebig zu sein. Die Organisation des Familienlebens lastet zusätzlich nahezu vollständig auf ihren Schultern, die Erziehung von inzwischen drei Söhnen inklusive. Robert hat seinerseits mit dem Thema Abgrenzung keine Probleme, seine Hobbys sind ihm heilig und, wie Margret meint, wichtiger als sie. Als der jüngste Sohn eine sehr schwierige Pubertät durchlebt, in der Maturaklasse vorzeitig ohne Abschluss von der Schule geht und sie dafür von Robert wegen ihrer Nachgiebigkeit als Verantwortliche gesehen wird, beginnt ihr Leben aus den Fugen zu geraten. Der Finanzdruck, um die Kreditraten für das Einfamilienhaus, die Lebenskosten der drei noch wirtschaftlich abhängigen Söhne und die Erhaltung von Roberts Segelboot, das an der kroatischen Küste ankert, zu bestreiten, ist die Eintrittspforte für einen Kreislauf von Ängsten, Schlafstörungen und zunehmenden Überforderungsgefühlen. Im Amt fühlt Margret sich ihren Anforderungen nicht mehr gewachsen. Ihre Genauigkeit, ja ihr Perfektionsstreben, konsumiert zu viel Zeit. Sie beginnt, offene Akte mit nach Hause zu nehmen, ursprünglich, um diese in der Freizeit zu bearbeiten. Doch daraus wird nichts. Auch daheim scheinen die Wogen des Unerledigten immer mehr über ihr zusammenzuschlagen. Ein Gefühl von