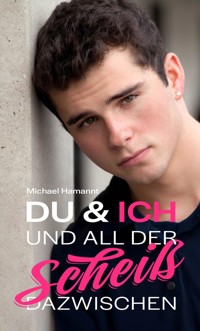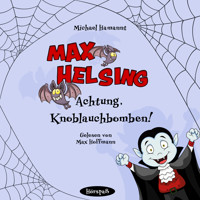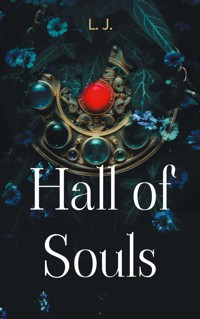11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Dämonenkriege-Reihe
- Sprache: Deutsch
Als der Dämonenjäger Ryk bei einem Einsatz seine beiden Gefährten an einen Dämon verliert, den es seit Hunderten von Jahren eigentlich gar nicht mehr geben dürfte, schwört er Rache. Währenddessen gelingt es der Gestaltwandlerin Catara, den wegen Mordes an seinem Vater angeklagten Thronprinzen Ishan aus dem Kerker zu befreien. Doch damit beginnen die Probleme für die beiden erst, denn all die dunklen Vorkommnisse sind nur die Vorboten eines drohenden Kriegs, der die Welt der Schwebenden Reiche in ihren Grundfesten erschüttern wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1056
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Ryk starrte in die Schwärze unter dem Portal. Nichts. Nur die dumpfe Vorahnung, dass dort etwas lauerte. Er griff nach seinem Seelenfeuer. Die Magie loderte auf, jagte durch seinen Körper und berauschte ihn für einen Moment wie ein Schluck hochprozentiger Branntwein. Er kniff die Augen zusammen und konzentrierte sich auf das Portal. Seltsam. Trotz seiner Magie vermochte er die Dunkelheit nicht zu durchdringen. So etwas war noch nie vorgekommen …
Einst herrschte Krieg zwischen Dämonen und Menschen. Nur durch ein besonderes Opfer der Ersten Magier konnte eine Barriere zwischen den Welten errichtet werden, und seitdem herrscht Frieden in den Schwebenden Reichen. Fast scheinen die Menschen ihre wahren Feinde vergessen zu haben – Fürsten schmieden Ränke, die einen Prinzen den Vater und den Thron kosten. Und eine Assassine macht sich in einem fernen Königreich auf den Weg, mächtige Gegenspieler zu töten.
In dieser unsicheren Zeit wird der Dämonenjäger Ryk bei einem scheinbar ganz gewöhnlichen Auftrag urplötzlich von einem Humanos angegriffen. Menschendämonen wie ihn dürfte es in den Schwebenden Reichen gar nicht geben. Magie verhindert ihren Übertritt durch die Barriere. Dennoch ist er da und tötet Ryks Jagdgefährten. Getrieben von dem Wunsch nach Rache schwört Ryk, den Dämon zu finden und zu vernichten. Zusammen mit seiner ehemaligen Komplizin macht er sich auf die Suche nach dem dunkelsten Geheimnis der Schwebenden Reiche …
Spannung, Abenteuer und eine magische Welt – Die Dämonenkriege ist ein Meisterwerk der epischen Fantasy.
Der Autor
Michael Hamannt studierte Germanistik, Philosophie, Ur- und Frühgeschichte, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Er arbeitet als freier Schriftsteller und liest in seiner Freizeit fantastische Romane und Thriller, schaut gerne gute DVDs und trifft sich mit Freunden zu Spieleabenden. Ein besonderes Faible hat er für Schottland mit seinen grünen Highlands, alten verwunschenen Wäldern und faszinierenden Mythen. Außerdem ist er verrückt nach Katzen und süchtig nach Espresso. Die Dämonenkriege ist sein erster Fantasyroman.
Michael Hamannt
Roman
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 03/2018 Redaktion: Martina Vogl Copyright © 2018 by Michael Hamannt Copyright © 2018 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren und Verlagsagentur, München Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT GbR, München, unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock Karten: Andreas Hancock Satz: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-20394-8V002www.heyne.de
ERSTER TEIL JAGD
»Die Val’kai, von den meisten Menschen aufgrund ihres abscheulichen Aussehens und ihrer Brutalität schlicht Dämonen genannt, sind Geschöpfe der Magie und entstammen der Gegenwelt. Einer magischen Dimension, die einstmals von lebenden Göttern beherrscht wurde.«
Auszug aus »Die Diener der Götter«,
Rupert Grimbogg,
Magier & Chronist,
49 v. d. Zweiten Dämonenkrieg – 23 n. d. Zweiten Dämonenkrieg
PROLOG
Ostwald, Xe’Neridian
16. Apris, 1026 n. d. Zweiten Dämonenkrieg
Der Morgen war von einem verräterischen Rot. Die Sonnenstrahlen sickerten durch das Blätterdach des Waldes und tropften wie wässriges Blut vor Ryks Füße. Ein Omen, hätte sein seliger Onkel gesagt. Ryk jedoch glaubte nicht an so etwas. Er glaubte an die Jagd, an seinen Auftrag und daran, dass man sich als Dämonenjäger keine Fehler leisten durfte.
Vor einem Tag hatte ihn der Hilferuf aus der Gemeinde Imres, einem kleinen Holzfällerdorf am Westsaum des Waldes, erreicht. Eine Gruppe von sieben Männern war aufgebrochen, um nach frischen Beständen des Arnbaumes zu suchen. Nur einer von ihnen hatte es zurückgeschafft. Schwer verwundet und halb wahnsinnig vor Angst. Aufgrund seiner Verletzungen war der Dorfvorsteher von einem Angriff durch ein Rudel Reißer ausgegangen und hatte sich daraufhin an Ryk gewandt. Es war kaum mehr als ein Routineauftrag, mit ernsthaften Schwierigkeiten rechnete er nicht. Reißer brachen in dieser Gegend immer mal wieder durch die magische Barriere. Gut bezahlt wurde es trotzdem, denn Arnholz war in den Schwebenden Reichen sehr gefragt und damit für die Bewohner von Imres eine profitable Einnahmequelle.
Ryk schloss die Linke fester um den Schaft der Armbrust, während sich der Zeigefinger der anderen Hand eng an den Abzug schmiegte. Sein Blick, den er wie seine übrigen Sinne für die Jagd magisch geschärft hatte, durchforstete die Schatten zwischen den Bäumen. Die Magie fächerte die Dunkelheit für ihn auf und offenbarte ihm deren wahre Farben: wabernde Violett- und Blautöne, durchzogen von Schlieren aus öligem Schwarz.
Er hielt inne, neigte den Kopf zur Seite und lauschte auf die Geräusche, die von überallher an seine Ohren drangen. Das Wispern der Blätter. Vogelrufe. Pfoten, die durch gefallenes Laub huschten. Ryk war eins mit der Jagd. Eins mit dem Wald, den er in all seinen Facetten roch: die würzige Erde, die Blätter, den Kot der Tiere und einen leichten Verwesungsgeruch. Nichts Ungewöhnliches für diese Jahreszeit. Durch die Sohlen seiner Stiefel spürte er den Nachhall von Corrs und Jailars Schritten, seine beiden Gehilfen, die links und rechts von ihm gegangen und nun ebenfalls stehen geblieben waren. Was er hingegen vermisste, war das Stampfen von Klauen, die in wilder Hatz den Boden aufrissen. Nichtsdestotrotz gab es in diesem Teil des Waldes deutliche Hinweise auf die Anwesenheit von Reißern – oder Dämonen, wie die Val’kai im Volksmund genannt wurden. Da waren Pfotenabdrücke im Schlamm und Kratzspuren in der Rinde, wo sie ihre Krallen gewetzt hatten.
»Wo stecken die verfluchten Biester?«, fragte Jailar mit angespannter Stimme.
Ryk zuckte zusammen. Aufgrund seiner geschärften Sinne hatten die Worte für ihn so laut geklungen, als hätte der Junge sie ihm direkt ins Ohr gebrüllt. Mit gerunzelter Stirn sah er zu ihm hinüber. Es war nicht das erste Mal an diesem Morgen, dass Jailar gesprochen hatte, obwohl Ryk Schweigen angeordnet hatte. Als er jedoch die Nervosität des Jungen bemerkte, verflog sein Ärger.
Jailar war groß und kräftig, hatte dunkelblondes Haar und war in Braun und Grün gekleidet. Die Farben des Jägers. Seine Augen, die sonst aufmerksam dreinschauten, waren furchtsam geweitet. Schweißperlen glänzten auf seiner Stirn, und er umklammerte das Kurzschwert in seiner Hand so fest, dass die Fingerknöchel weiß hervortraten. Jailar war gerade einmal neunzehn und arbeitete erst seit Kurzem für ihn. Als er sich um die Stelle bewarb, hatte er einen ganz passablen Eindruck gemacht. Als Sohn eines Schwertschmieds war er nicht nur im Herstellungsprozess von Waffen geschult, sondern auch in deren Umgang. Er hatte schnelle Reflexe und schien kühn – oder auch närrisch – genug, um sich freiwillig für den Posten als Gehilfe eines Dämonenjägers zu melden. Und dennoch wirkte er in diesem Augenblick, als wäre er lieber an jedem anderen Ort der Schwebenden Reiche als hier im Ostwald. Andererseits war es sein erster Einsatz.
»Sicher sind sie längst weitergezogen«, murmelte Corr. Ryk wandte sich seinem zweiten Gehilfen zu. Einem Mann mit einer zottigen braunen Haarmähne, der sich mit der Geschmeidigkeit eines Wolfs durch das Unterholz bewegte. Die dunklen Augen funkelten wachsam in seinem wettergegerbten, von Lachfältchen und Narben durchfurchten Gesicht. Corr war schon so lange in Ryks Diensten, dass er ihn als Freund betrachtete.
»Ja, macht ganz den Eindruck«, stimmte Ryk zu. »Im Umkreis von einer Viertelmeile kann ich keinen einzigen Dämon spüren.« Er sandte die Magie, die seine Sinne verstärkte, in das Energiezentrum nahe seines Herzens zurück. Hier saß die Quelle seiner Macht: das Seelenfeuer. Oder Ori’vah, wie die Magier es nannten. Wie jedes Mal, wenn die Magie versiegte, hatte Ryk das Gefühl, als würde die Welt von einem Wimpernschlag auf den anderen von ihm abrücken, ihn von all ihrer Farbenpracht, all den vielzähligen Geräuschen und wundersamen Gerüchen ausschließen. Allzu blass und trist erschien ihm der Wald daraufhin, weshalb er seine Magie am liebsten sofort wieder entfacht hätte. Sie war jedoch zu kostbar, um sie leichtfertig zu vergeuden, solange ihnen keine unmittelbare Gefahr drohte. Und sie zu regenerieren, kostete viele Stunden Ruhe und Schlaf.
Ryk atmete gerade tief durch, als Jailar sagte: »Hört ihr das auch?«
Es war ein Summen wie von einem Insektenschwarm. Ryk hatte es bereits vorhin vernommen, zunächst aber ignoriert, da er sich ganz auf die Suche nach den Dämonen konzentrieren wollte.
Corr deutete mit der Spitze seines Bogens nach vorne: Zwischen den Bäumen schimmerte eine Lichtung hindurch. »Es scheint von dort zu kommen.«
»Die Holzfäller aus Imres«, sagte Ryk düster. »Sehen wir uns das mal an!« Er schob sich durch das Unterholz auf die Lichtung zu, dicht gefolgt von seinen Gehilfen.
Fliegen. Hunderte Fliegen. Doch mehr noch als ihre Gegenwart verriet Ryk der stärker gewordene Verwesungsgestank, dass sie die vermissten Männer gefunden hatten. Das Gras war vielerorts niedergedrückt und dunkel von getrocknetem Blut. Vereinzelte, nicht näher definierbare Fleischbrocken verrotteten in der Sonne, und als er nähertrat, sah er, dass sich eine Armee von Maden an ihnen labte.
»Der Dorfvorsteher hatte recht«, brummte Ryk. »Das ist das Werk von Reißern.«
Corr blickte sich um und schüttelte den Kopf. »So viel Blut, verdammte Scheiße!« Er spuckte aus. »Das stammt nicht nur von einem Mann.«
Es war unmöglich zu sagen, um wie viele der Holzfäller es sich handelte. Wahrscheinlich alle sechs. Die Reißer, oder Ahka’ri, wie diese Dämonenart in der Sprache der Val’kai hieß, hatten einfach zu wenig von ihnen übrig gelassen. Selbst die Knochen hatten sie mit ihren Raubtiergebissen geknackt und verschlungen. Es gab nur eine einzige Leiche, die noch halbwegs als Mensch erkennbar war: ein blutiger Rumpf, dem der Kopf und sämtliche Gliedmaßen fehlten. Er lag in der Mitte der Lichtung. Der Boden ringsherum war mit einer rotschwarzen Kruste überzogen. Als die drei sich dem Toten näherten, stob eine Wolke aus Purpurfliegen auf.
Jailar fuhr sich mit der Hand über den Mund. »Was … was ist hier passiert?« Im nächsten Moment wirbelte er herum, stolperte zum Rand der Lichtung und übergab sich in einen Riggbusch.
Corr warf Ryk einen Blick zu, der so viel sagte wie: Hab ich dich nicht gewarnt? Ryk verdrehte die Augen und folgte Jailar. Der Junge war blass und zitterte am ganzen Körper. Bei allen Dämonen der Gegenwelt, hatte er sich tatsächlich so sehr in ihm geirrt? Aber vielleicht genügte es ja, wenn er dem Jungen ein wenig gut zuredete. »Hör mal, Jailar«, sagte Ryk und legte ihm eine Hand auf die Schulter, »wenn du es in diesem Beruf zu etwas bringen willst, musst du dir schon ein dickeres Fell zulegen. Du wirst noch viel Schlimmeres …«
Jailar übergab sich ein weiteres Mal, während Corr herangeschlendert kam und hämisch den Daumen in die Höhe reckte. Ryk seufzte in sich hinein. Die niederen Val’kai verstand er problemlos. Sie waren instinktgesteuerte Kreaturen, getrieben von Hunger und Blutdurst. Seine eigene Art bereitete ihm dagegen sehr viel größere Schwierigkeiten. Menschen verbargen ihre wahren Gefühle oft hinter Masken. Oder hielten sich für etwas, das sie nicht waren. Doch wenn sie sich nicht einmal selbst durchschauten, wie sollte dann er, der nichts weiter als ein Dämonenjäger war, es können? Natürlich änderte das alles nichts an der Tatsache, dass er die Verantwortung für den Jungen übernommen hatte, als er ihn einstellte. »Schau mich an, Jailar. Jetzt mach schon!« Ryk nickte zufrieden, als der Junge den Kopf hob. »Warum wolltest du für mich arbeiten?«
»Weil … weil du der Beste bist.«
»Und warum ist das so?«
Jailar biss sich auf die Unterlippe. »Du hast mehr Dämonen getötet als jeder andere.«
»Und?«
»Du bist immer noch am Leben.«
Ryk lachte. »Das ist wahr, Junge. Doch was mich wirklich zum Besten macht, geht über bloße Erfahrung hinaus.« Er tippte sich an die Stirn. »Instinkt! O ja, ohne den hätten die Dämonen mich schon vor langer Zeit erledigt. Und diesem Instinkt verdankst du es, dass du heute hier bist. Glaub mir, ich hätte dich nicht genommen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass du es in dir hast, diesen Biestern gehörig in den Arsch zu treten.«
Bei diesen Worten leuchteten Jailars Augen auf. Farbe kehrte in sein Gesicht zurück, und er grinste sogar ein wenig.
Corr schüttelte den Kopf, was der Junge zum Glück nicht sah. Vermutlich würde er am Ende wieder einmal recht behalten. Ein guter Schwertkämpfer war noch lange kein guter Dämonenjäger. Und trotzdem: Verdiente nicht jeder eine zweite Chance, sich zu beweisen?
Plötzlich seufzte Jailar und sah beschämt von ihm zu Corr. »Ihr beide müsst mich ja für das totale Weichknie halten.«
»Unsinn! Wer keine Furcht kennt, ist in unserem Beruf schon so gut wie tot«, wischte Ryk seine Worte beiseite. Das stimmte nicht ganz, doch der Junge war auch so schon verunsichert genug.
»Apropos tot«, warf Corr mit einem Blick auf die blutigen Überreste ein. »Auch wenn für diese Männer hier jede Hilfe zu spät kommt, sollten wir versuchen herauszufinden, in welche Richtung die Dämonen unterwegs sind. Es gibt in der Gegend mehrere Dörfer, die einem Angriff hilflos ausgeliefert wären.«
Ryk nickte. »Teilen wir uns auf. Bleibt aber in Hörweite. Nur für alle Fälle.«
»Wonach suchen wir?«, fragte Jailar.
»Nach allem, was uns in irgendeiner Weise verraten kann, in welche Richtung die Reißer weitergezogen sind.«
»Was ist mit den Holzfällern?«, fragte Corr.
»Der Wald wird sich um sie kümmern.« Ryk sah zum Himmel auf. Die Sonne stand inzwischen ein gutes Stück über den Wipfeln, dennoch herrschte am Rande der Lichtung weiterhin Zwielicht. Bevor er Corr und Jailar losschickte, überprüfte er ein letztes Mal die Umgebung mithilfe seiner Magie. Seine Sinne schärften sich, und der Verwesungsgestank drang mit Übelkeit erregender Intensität auf ihn ein. Ryk unterdrückte ein Würgen und konzentrierte sich aufs Sehen und Hören. Die Schatten unter den Bäumen wurden durchscheinend. Der Wind trug den Flügelschlag eines Sorals an seine Ohren. Die Erde flüsterte von einem fernen Bach und von Kleingetier, das im Unterholz unterwegs war.
»Nichts«, sagte er nach einer Weile und kehrte zu seiner normalen Wahrnehmung zurück. »Also gut, ruft, wenn ihr etwas findet.«
Seine Gehilfen gingen in entgegengesetzte Richtungen davon. Ryk sah ihnen kurz nach. Corr war ein erfahrener Jäger. Es gab nicht viel, was ihn aus der Ruhe bringen konnte. Der Junge mochte sich immer noch als Problem herausstellen. Offenbar versuchte er, seine Schwäche von vorhin zu überspielen, indem er einen besonders entschlossenen Schritt an den Tag legte. Nun, man würde sehen.
Ryk wandte sich gen Süden, wo der Wald am dunkelsten war, und tauchte in den Schatten unter den Bäumen ein. Schon bald blieben das Summen der Fliegen und der Verwesungsgeruch hinter ihm zurück. Dankbar atmete er durch. Die Luft war hier schwer vom Duft des Arnbaums, dessen Rinde von bernsteinfarbenem Harztränen überzogen war. Erschaffen von den Ersten Magiern war sein Holz das einzige, das den Temperaturen der Feuerflüsse widerstehen konnte, was es für die Menschen in den Schwebenden Reichen so wertvoll machte.
Er war noch nicht weit gekommen, als sich vor ihm zwischen den Bäumen ein dunkler, riesenhafter Umriss herausschälte. Ryk näherte sich ihm vorsichtig. Es war eine Ruine. Mauern aus schweren grauen Felsblöcken, auf denen Flechten, Moos und wilder Efeu wuchsen. Zwar war er schon früher in der Gegend unterwegs gewesen, jedoch stets weiter nördlich, weshalb er dieses Gemäuer heute zum ersten Mal sah. Die Architektur und die Art, wie die Steine behauen waren, deuteten darauf hin, dass es aus der Zeit vor dem Ersten Dämonenkrieg stammte und damit weit über dreitausend Jahre alt war. Vermutlich sogar noch älter. Solche Ruinen waren selten. Eine völlig unbekannte zu entdecken – sie war definitiv auf keiner Landkarte verzeichnet, die er studiert hatte –, löste bei Ryk, der den Geheimnissen der Vergangenheit ebenso nachspürte wie den Val’kai, eine Gänsehaut aus. Was mochten diese Mauern nicht alles gesehen haben? Er legte die Handfläche auf den Stein und wünschte sich, er könne zu ihm sprechen.
Ein paar Herzschläge später zog er die Hand zurück. Gut möglich, dass die Ruine den Val’kai als Unterschlupf gedient hatte, weshalb es nicht schaden konnte, einen Blick hineinzuwerfen. Er folgte der Außenmauer auf der Suche nach einem Eingang. Seinerzeit musste es ein stattliches Bauwerk gewesen sein. Es gab zahlreiche großflächige Fenster, die jedoch schon vor langer Zeit ihr Glas eingebüßt hatten. Um sie als Einstieg zu nutzen, lagen sie zu hoch.
Als er sich dem Ende der Mauer näherte, bemerkte er die Überreste von Zwillingstürmen, die sich bis hinauf in die Baumwipfel schoben. Sie bestätigten seine Vermutung, dass es sich um die Überreste einer Kathedrale handelte. Eine Art Tempel, den die damaligen Menschen errichtet hatten, um zu einem längst vergessenen Gott zu beten. Er verzog abfällig die Mundwinkel. Wenn der Krieg mit den Val’kai die Menschheit eines gelehrt hatte, dann, dass es keine Götter gab.
Ryk hatte die Längsseite der Kathedrale abgeschritten und bog mit erhobener Armbrust um die Ecke. Vor ihm führte eine Steintreppe hinauf zu einem Portal. Ein düsteres Loch, das dem Eingang zu einer Höhle ähnelte. Er packte die Armbrust fester und hielt darauf zu. Tiefe Risse durchzogen die Stufen, in deren Ecken Moos zwischen Laubresten aus dem letzten Herbst wuchs. Ryks aufmerksamem Blick entging nicht, dass das Moos an einigen Stellen aufgerissen war, als hätte sich Krallen hineingebohrt. Die Reißer waren hier gewesen. Nur, wohin waren sie verschwunden?
Ryk setzte den Fuß auf die unterste Stufe und … Er zuckte zurück, als die Magie wie die plötzliche Hitze einer Stichflamme über sein Gesicht hinwegfuhr. Sie fühlte sich fremdartig an und doch auf beunruhigende Weise vertraut. Was hatte das zu bedeuten? Ein zweiter Magier? Nein, das wäre ein anderes Gefühl, und der Orden hätte ihn informiert, wenn er jemanden in sein Revier geschickt hätte. Aber es konnte auch kein Reißer sein, denn niedere Dämonen beherrschten keine Magie.
Ryk starrte in die Schwärze unter dem Portal. Keine Regung. Nichts. Nur die dumpfe Vorahnung, dass dort etwas lauerte. Er griff nach seinem Seelenfeuer. Die Magie loderte auf, jagte entlang der Energiebahnen seines Körpers in seinen Kopf und berauschte ihn für einige Sekunden wie ein Schluck hochprozentigen Branntweins. Das Gefühl ebbte allerdings rasch wieder ab.
Ryk kniff die Augen zusammen und konzentrierte sich auf das Portal. Seltsam. Trotz seiner Magie vermochte sein Blick die Dunkelheit nicht zu durchdringen. Er blinzelte ungläubig. Niemals zuvor war so etwas vorgekommen.
Kurz spielte er mit dem Gedanken, nach Corr und Jailar zu rufen. Nur würde er dadurch demjenigen – wer oder was auch immer sich im Inneren der Kathedrale verbarg – verraten, dass er über seine Anwesenheit Bescheid wusste. Keine gute Idee. Stattdessen erklomm er die nächste Stufe und stutzte, als die Magie aus dem Inneren dieses Mal noch heißer, wenn auch durch seine eigene gedämpft, über sein Gesicht und seine Hände leckte. Er riss die Augen auf. Es musste sich um ein magisches Schild handeln, von dem seine geschärften Sinne abgelenkt wurden! Wie konnte das sein? Die Menschen beherrschten eine solche Magie schon lange nicht mehr. Das würde ja bedeuten … ein Humanos? Unmöglich, dachte er. Seit Jahrhunderten war es keinem von ihnen mehr gelungen, die Barriere zu durchdringen.
Er musste sich irren. Es konnte gar nicht anders sein.
Als ein Knacken hinter ihm im Unterholz ertönte, fuhr er herum. Bloß ein Yagafuchs, der durchs Dickicht der Bäume schlich. Ryk atmete erleichtert auf, drehte sich wieder um … und starrte in zwei weißglühende Augen, die auf ihn zustürzten. Ryk drückte den Abzug der Armbrust und warf sich zur Seite, doch er war zu langsam. Messerscharfe Klauen drangen durch das Leder seiner Jacke, zerfetzten sein Hemd und schlitzten ihm die Brust auf.
Die Wucht dieses Angriffs schleuderte ihn die Treppe hinab, sodass er mit dem Hinterkopf gegen einen Baumstamm krachte und augenblicklich das Bewusstsein verlor.
Als er wieder zu sich kam, lag er mit dem Gesicht im Dreck. Der Dämon! Ryk fuhr hoch und sackte mit einem unterdrückten Aufschrei wieder zusammen, als sein linker Arm unter ihm nachgab. »Verdammte Scheiße«, fluchte er zwischen zusammengebissenen Zähnen. So, wie es sich anfühlte, war seine Schulter ausgekugelt.
Sobald der Schmerz ein wenig nachgelassen hatte, kämpfte er sich in eine sitzende Position und sackte schwer keuchend mit dem Rücken gegen den Baum. Für einen Moment schloss er die Augen. Wieso zur Hölle lebte er überhaupt noch? Nicht, dass er sich beklagen wollte.
Ryk öffnete die Augen wieder, sah sich um und entdeckte den Dämon ein Stück rechts von ihm. Ein großer roter, regloser Fleischberg. Demnach hatte der Bolzen getroffen. Glück im Unglück, dachte Ryk und zog sich an dem Baum empor. Seine Brust brannte dort, wo ihn die Klaue des Dämons erwischt hatte, als würde ihm jemand die Haut mit Sand von den Knochen schmirgeln. Als er endlich auf den Beinen war, betrachtete Ryk seinen linken, schlaff herabhängenden Arm einen Augenblick lang mitleidig, bevor er die Schulter gegen den Stamm rammte. Es knirschte. Der Schmerz trieb ihm die Tränen in die Augen, aber wenigstens war das verfluchte Gelenk wieder in seine Position gerutscht. Probeweise bewegte er den Arm leicht vor und zurück und stieß dabei zischend den Atem aus.
Ryk war einer der wenigen, die alle fünf Zweige der Magie beherrschten. Andernfalls wäre er vom Orden niemals in den Rang eines Dämonenjägers erhoben worden. Doch ausgerechnet seine Heilkräfte waren von all seinen Fähigkeiten am schwächsten ausgeprägt, weshalb er für Notfälle wie diesen immer vorsorgte. Aus einer Gürteltasche holte er ein Stück getrocknete Traumwurz hervor, schob es sich zwischen die Zähne und kaute darauf herum. Ein bittersüßer Geschmack breitete sich in seinem Mund aus. Nur Augenblicke später setzte die Wirkung ein, und der Schmerz in Schulter und Brust wurde zu einem dumpfen Pochen.
Ryk blickte sich um. Seine Armbrust lag wenige Schritte entfernt. Er hob sie auf, wobei ihm leicht schwindelte, als er sich vorbeugte. Nachdem er sie nachgeladen hatte, näherte er sich dem Dämon. Es war ein Reißer und damit ein Animalia, ein Tierdämon. Dennoch war er sicher, vorhin die Magie eines Humanos gespürt zu haben.
Der Bolzen, der in der Kehle des Dämons steckte, ließ keinen Zweifel daran, dass er tot war. Ryk ging um ihn herum. Der Reißer besaß Ähnlichkeit mit einem xe’neridianischen Berglöwen. Er hatte einen breiten Brustkorb, der in einen schmalen Hinterleib auslief. Und Tatzen, die mit einem einzigen Hieb Knochen zertrümmern konnten. Muskelwülste zeichneten sich unter der felllosen roten Haut ab. Ryks Blick glitt zurück zum Portal der Kathedrale. Der Zauber, der darüber lag, hatte das Biest vor ihm verborgen. Das mochte bedeuten, dass noch mehr von ihnen in der Nähe waren, geschützt durch die Magie eines Humanos, eines Menschendämons. Er musste Corr und Jailar unbedingt warnen.
Ein Schrei gellte durch den Wald. Der Junge!
Ryk rief seine Magie, die sich zurückgezogen hatte, als er bewusstlos geworden war. Sie schoss in seine Glieder, härtete seine Knochen, stärkte seine Sehnen und Muskeln. Er rannte los, und die Bäume flogen nur so an ihm vorüber. Dabei lief er schneller als jeder gewöhnliche Mensch, schneller noch als ein Pferd.
Wieder schrie Jailar, doch dieses Mal riss der Schrei abrupt ab. In Ryk verkrampfte sich etwas. Nicht der Junge! Er sprang über einen Baumstumpf hinweg. Ohne langsamer zu werden, stürzte er sich in ein Brombeerdickicht, das ihm Gesicht und Arme zerkratzte. Auf der anderen Seite wäre er fast über den Kadaver eines Reißers gestolpert. Ein Pfeil steckte im linken Auge der Bestie. Den Schaft schmückten blaugrüne Federn. Corr! Schwer atmend sah Ryk sich um. Wohin? Als er ein Fauchen vernahm, lief er in die Richtung, aus der das Geräusch kam, setzte über einen Bach hinweg, kletterte auf dem gegenüberliegenden Ufer die Böschung hinauf und rannte so lange weiter, bis er auf eine Lichtung stieß. Abrupt blieb er stehen.
Die Rodung war kleiner als die, auf der sie die Überreste der Holzfäller entdeckt hatten, und vollständig in die Schatten der umstehenden Bäume getaucht. Jailar lag keine drei Schritte von Ryk im Gras – begraben unter dem Leib eines toten Reißers. Der glasige Blick des Jungen verriet Ryk, dass er zu spät kam. Er ballte die Fäuste. Seine Hände fühlten sich mit einem Mal eiskalt an. Jailar hatte ihm vertraut, und er hatte ihn geradewegs in sein Verderben geschickt.
»Da bist du ja endlich!«, brüllte Corr.
Ryk riss sich von Jailars Anblick los. Sein Gehilfe befand sich in der Mitte der Lichtung, ungefähr zehn Schritte von ihm entfernt, und wurde von zwei Reißern gleichzeitig bedrängt. Corrs Gesicht war angespannt, seine dunklen Augen loderten vor Zorn. Er hatte sich Jailars Schwert geschnappt, nachdem ihm die Pfeile ausgegangen sein mussten. Seine Arme zitterten vom ungewohnten Gewicht der Waffe.
Die Bestien umkreisten ihn mit gesenkten Köpfen und rissen bei jedem Schritt mit ihren Pranken das Erdreich auf. Nicht auch noch Corr! Bitte nicht auch noch Corr! Ryk löste sich aus seiner Erstarrung und schrie auf. Einer der Reißer warf den Kopf herum und brüllte wie zur Antwort. Ryk stürmte ihm entgegen und drückte den Abzug seiner Armbrust. Der Bolzen schoss davon. Im Laufen warf Ryk die Waffe von sich und zerrte ein Messer aus seinem Gürtel. Derweil durchschlug der Bolzen, den Ryk abgefeuert hatte, den Knochenwulst über den Augen des Dämons und trat an der Rückseite des Schädels wieder aus. Die mit Magie aufgeladene Spitze glühte noch, als der Reißer zusammenbrach.
Ryk lachte und schleuderte der zweiten Kreatur sein Messer entgegen. Die Klinge leuchtete auf, als sie in die Schulter des Dämons fuhr und dort Muskeln, Sehnen und Knochen durchtrennte. Mit einem Jaulen knickte der Reißer ein, woraufhin Corr vorsprang und ihm Jailars Schwert in den Nacken trieb. Gurgelnd stürzte der Dämon auf die Seite und zuckte noch einmal mit den Pranken, bevor er still liegen blieb. Zur Sicherheit, oder vielleicht auch nur, um seine Nerven zu beruhigen, stieß Corr ein weiteres Mal mit dem Schwert zu. Danach rammte er es vor sich ins Erdreich.
Ryk starrte seinen Gehilfen an. Die Magie gab ihm nach wie vor das Gefühl, mit bloßen Händen Bäume ausreißen zu können. »Was ist passiert?«
»Das wüsste ich gern von dir!«, knurrte Corr. »Der Junge ist tot, und ich wäre auch fast draufgegangen!«
Ryk funkelte ihn an. »Glaubst du, ich wollte, dass das hier geschieht? Verdammt, ich bin selbst nur knapp davongekommen.« Er wischte sich mit der Hand den Schweiß vom Gesicht und fügte ein wenig gefasster hinzu: »Etwas hat meine Magie blockiert, darum konnte ich die Reißer nicht wahrnehmen.«
»Blockiert?«, hakte Corr nach. »Wovon redest du?«
Ryk sah ihn an. »Ich rede von einem Humanos.«
Einen Moment lang wirkte Corr sprachlos, was selten vorkam. Dann hatte er sich auch schon wieder unter Kontrolle. »Du nimmst mich auf den Arm!« Als Ryk jedoch nur müde den Kopf schüttelte, wurde Corr blass. »Bist … bist du dir sicher?«
»Gesehen habe ich ihn nicht, nur seine Magie gespürt. Natürlich könnte ich mich irren.« Immerhin hatte er noch nie einem Menschendämon gegenübergestanden. Aber er wusste auch, wie sich die Macht eines anderen Magiers anfühlte, und konnte daher ausschließen, dass der Zauber, der auf der Kathedrale lag, von einem Menschen stammte.
»Was machen wir jetzt?«
»Wir ziehen uns nach Imres zurück«, entschied Ryk. »Die Dorfbewohner müssen erfahren, was aus den Holzfällern geworden ist. Sie sollen die anderen Dörfer warnen. Und danach trommeln wir Verstärkung zusammen und kehren zurück.« Er fuhr sich mit der Hand über den Mund. Seit Jahrhunderten hatte keiner mehr gegen einen Humanos gekämpft. »Falls die alten Berichte stimmen, können wir es nicht allein mit dem Dämon aufnehmen.«
Corr nickte. »Hoffen wir nur, dass die Pferde noch dort sind, wo wir sie zurückgelassen haben.« Sein Gesicht verdüsterte sich. »Was ist mit Jailar? Wir können ihn nicht so liegen lassen.«
»Wir können, und wir werden«, sagte Ryk. »Und jetzt komm!« Er holte seine Armbrust, die ein Stück hinter ihm im Gras lag. Dabei vermied er jeden Blick auf den toten Jungen.
Als Corr zu ihm aufschloss, hielt er wieder Jailars Kurzschwert in der Hand.
Sie nahmen den Weg, auf dem Ryk gekommen war, und tauchten erneut in den Wald ein. Trotz der Bedrohung, die ihnen im Nacken saß, liefen sie nicht, sondern konzentrierten sich darauf, sich möglichst lautlos durch das Unterholz zu bewegen. Zum Lager war es ein gut einstündiger Fußmarsch. Sie hatten die Pferde dort gelassen, weil sie sie bei der Spurensuche bloß behindert hätten. Obwohl es kräftezehrend war, hielt Ryk sein Seelenfeuer aufrecht, um die Umgebung mit geschärften Sinnen zu erkunden.
Falls der Humanos in ihrer Nähe war, so verbarg er sich mithilfe seiner Kräfte vor ihm. Ryk hätte es ihm nur zu gerne gleichgetan, aber die Magier der Schwebenden Reiche hatten diese Fähigkeit schon vor Jahrhunderten verloren.
Gerade hatten sie den Bach überquert, über den Ryk vorhin hinweggesprungen war, als Corr fluchend stehen blieb. »Sieh dir das an!« Er deutete mit der Schwertspitze vor sich auf den Boden der Böschung, wo sich im Erdreich der Abdruck eines nackten Fußes abzeichnete.
Ryk ging in die Hocke. »Sechs Zehen«, murmelte er und fuhr mit dem Zeigefinger die Ränder des Abdrucks ab. Die Erde fühlte sich weich und feucht an, demnach musste er ganz frisch sein. Er schauderte. Menschendämonen besaßen sechs Zehen. Damit war auch der letzte Zweifel ausgeräumt. »Er muss ganz in der Nähe sein.«
»Denkst du, er beobachtet uns?«
Ryk erhob sich, und sein Blick glitt über das sie umgebende Grün. Sein Wissen über Menschendämonen stammte noch aus seiner Zeit an der Akademie, aus Büchern, uralten Aufzeichnungen und Geschichten. Wie zuverlässig es war, konnte er nicht sagen. Niemand konnte das. Fest stand nur, dass sie im Gegensatz zu den Tierdämonen über Magie geboten und als aggressiv und verschlagen galten. Außerdem hieß es, dass sie niedere Dämonen kontrollieren konnten. »Er könnte die Reißer vorausgeschickt haben, um uns zu testen.«
»Dann kennt er jetzt unsere Stärken und Schwächen.«
»Du sagst es. Also rasch weiter!«
Kurz darauf passierten sie die Arnbäume, die nahe der Lichtung mit den Leichen der Holzfäller wuchsen. Da Ryk noch immer keine verdächtigen Bewegungen oder Geräusche ausmachen konnte, rief er seine Magie in das Energiezentrum nahe seines Herzens zurück. Vielleicht würde er sie später noch brauchen.
Zum bestimmt hundertsten Mal innerhalb der letzten Minuten fragte er sich, wie der verfluchte Humanos die Barriere hatte passieren können? So etwas war seit dreihundert Jahren nicht mehr vorgekommen. Animalia verschlug es regelmäßig in die Schwebenden Reiche. Aus diesem Grund gab es auch Dämonenjäger wie Ryk, die sich dieses Problems annahmen.
In der Regel stolperte die niedere Dämonenbrut zufällig über Risse und Löcher in der Barriere und wurde dann unfreiwillig herübergezogen. Die Menschen der Schwebenden Reiche glaubten, dass diese Übergänge durch spontane und unkontrollierte Magieentladungen entstanden, die eine kurzzeitige, örtlich begrenzte Schwächung der Barriere zur Folge hatte. Eine Lüge, aber eine notwendige, da die Wahrheit die Bevölkerung nur beunruhigt hätte. Ein Humanos konnte einen solchen Übergang unmöglich benutzen, dafür war vor langer Zeit gesorgt worden. Wenn er es dennoch versuchte, würden sich die Kräfte hinter der Barriere wie ein ausgehungertes Wolfsrudel auf ihn stürzen und den Dämon töten. Es war die Magie der Menschendämonen, auf die die Barriere reagierte. Und dennoch hatte einer von ihnen sie überwunden.
»Ryk.«
Corrs Stimme drang an sein Ohr. »Hm.« Ryk kniff gerade die Augen zusammen. Hatte sich dort drüben hinter den Riggbüschen nicht etwas bewegt?
»Ryk, verdammt!« Zwei Worte, kaum mehr als ein Zischen, doch durchdrungen von einem so mächtigen Entsetzen, dass sich ihm die Nackenhaare sträubten. Ryk fuhr herum und erstarrte.
Corr war aschfahl. Jailars Schwert lag vor ihm auf der Erde. Hinter ihm stand der Humanos. Der Dämon presste eine Klaue an die Kehle seines Gehilfen. Blut trat an den Stellen aus, wo die Spitzen seiner Krallen die Haut ritzten. Den haarlosen Schädel, über den sich eine kränklich blasse Haut spannte, hielt der Dämon leicht schräg. Er musterte Ryk über Corrs Schulter hinweg aus unnatürlich großen schwarzen Augen, in denen winzige goldene Lichtflecken tanzten.
»Was macht ein Humanos in den Schwebenden Reichen?«, fragte Ryk und bemühte sich darum, jegliche Anspannung aus seiner Stimme zu verbannen. »Wie bist du hierhergelangt?«
Die Nüstern des Dämons, zwei schmale Schlitze direkt unter seinen Augen, blähten sich auf. Ansonsten blieb er jedoch stumm.
Ryks Gedanken überschlugen sich. Was sollte er tun? Krampfhaft versuchte er, sich an die Schriften aus seiner Zeit an der Akademie zu erinnern. Irgendetwas, das ihm weiterhelfen mochte. Sein Studium lag allerdings schon fast zwei Jahrzehnte zurück, und Corrs Leben bedroht zu sehen, war auch nicht gerade hilfreich. Das Einzige, was ihm einfiel, war, dass ein Humanos auf der Jagd angeblich niemals Gefangene machte. Nur warum lebte Corr dann noch?
»Ich weiß, dass du mich verstehst«, sagte er und hoffte, dass er damit recht hatte. »Warum gibst du meinen Freund nicht frei, und dann reden wir beide in Ruhe weiter.« Der Dämon zeigte immer noch keine Reaktion. »Ich könnte ein Portal in die Gegenwelt für dich öffnen, wenn es das ist, was du willst. Du könntest auf der Stelle zurückkehren.« Eine Lüge – zumindest eine halbe –, nur konnte der Humanos das nicht wissen. Irgendetwas musste er schließlich wollen, sonst hätte er längst angegriffen. »Komm schon, rede mit uns!« Ryk registrierte, wie sich Corrs Rechte langsam dem Jagdmesser nährte, das an seinem Gürtel hing, während er weiter auf den Val’kai einsprach. »Sag mir, was du willst, und ich werde sehen, was ich für dich tun kann.«
Vielleicht war es Zufall. Vielleicht hatte Ryk seinen Freund auch durch irgendeine unbewusste Regung oder einen Blick verraten. Mit einer einzigen schnellen Bewegung zerfetzte der Dämon Corr die Kehle. Ein Schwall Blut spritzte aus der Wunde. Corr fiel auf die Knie und stürzte dann vornüber ins Gras, wo er noch kurz zuckte, bevor er reglos liegen blieb.
Nein! Für einen Moment war Ryk wie erstarrt. »Du … du verdammtes Drecksvieh hast meine Freunde getötet!«
»Das Gleiche könnte ich von dir sagen.« Die Stimme des Dämons klang rau, wie bei einem Kranken, der mit wunder Kehle sprach. Er verstand ihn also doch. Und er beherrschte sogar ihre Sprache. »Warum jagst du uns?«
Sollte das ein Witz sein? Ryk betrachtete seinen Gegner genauer. Jetzt, da er nicht länger von Corr verdeckt wurde, wirkte der Dämon weit weniger beeindruckend. Er war groß, dürr und nackt. Allerdings ohne erkennbare Geschlechtsmerkmale. Seine Haut, die sich wie bei einem Verhungernden straff über die Rippen spannte, leuchtete schwach in der Morgensonne. Tätowierungen von blassgoldener Färbung zogen sich über seinen Oberkörper. Runen, die den Namen des Val’kai und seine Kastenzugehörigkeit verrieten. Das Muster war jedoch zu komplex, um es auf die Schnelle zu entschlüsseln, und das bereitete Ryk Sorgen.
Je aufwendiger die Tätowierungen eines Humanos waren, desto höher stand er im Ansehen seines Volkes – und Ansehen war bei ihnen gleichbedeutend mit Macht. Ohne seinen Gegner aus den Augen zu lassen, zog Ryk einen seiner magisch aufgeladenen Dolche aus seinem Gürtel. »Ich werde dich jetzt töten«, sagte er und fachte, noch während er sprach, das Seelenfeuer in seinem Inneren an.
Die Nüstern des Val’kais blähten sich erneut auf, und zwischen seinen Lippen schoss seine Zunge hervor. Sie war lang, blau und besaß wie eine Schlange eine gespaltene Spitze. »Ah, ich schmecke Magie.«
»Die du gleich zu spüren bekommen wirst!«
Der Dämon entblößte zwei Reihen nadelspitzer Zähne. »Nur zu, Mensch.«
Ryk stürzte sich auf seinen Gegner. Es war von Anfang an ein ungleicher Kampf. Trotz Ryks gesteigerten Reaktionsvermögens wich der Humanos jedem seiner Angriffe mühelos aus. Ryk stach, schlug und trat mit übermenschlich schnellen Attacken zu – doch der Dämon belächelte ihn bloß. Seine Bewegungen waren grazil und anmutig, als wäre es für ihn vielmehr ein Tanz denn ein Kampf. Und wenn er einmal selbst zuschlug, so traf er immer. Zwar konnte Ryk einige wenige Angriffe abschwächen, indem er die Klauen des Humanos mit den Unterarmen abfing, aber er stöhnte dabei jedes Mal vor Schmerz auf. Die Gewalt hinter den Schlägen des Dämons hätte die Knochen eines gewöhnlichen Menschen schlichtweg zertrümmert. Nur dank seiner Magie hielt Ryk sich überhaupt noch auf den Beinen. Allerdings wäre auch das bald vorbei. Er spürte bereits, wie seine zusätzliche Kraft zu schwinden begann. Er hatte zu viel Magie in zu kurzen Abständen verbraucht und keine Zeit gehabt, sein Seelenfeuer zu regenerieren.
Ryk schrie auf, als ein Hieb des Dämons ihm den linken Oberarm brach.
»Was denn? War das schon alles?«, höhnte der Humanos. »Ich dachte, du wolltest mich töten. Oder war das bloß Geschwätz?«
Ryk bleckte die Zähne, presste den verletzten Arm gegen den Körper und machte einen Ausfallschritt nach rechts. Dabei zielte er mit dem Messer auf die Brust des Dämons. Mitten in der Bewegung wechselte er jedoch die Richtung, tauchte unter der vorschießenden Klaue hinweg und erwischte den Val’kai am Oberschenkel. Blut strömte über die weiße Haut. Der Dämon fauchte.
»Damit … hast du wohl … nicht gerechnet, was?« Ryk hätte gerne noch mehr gesagt. Aber im Gegensatz zu seinem Gegner war er vollkommen aus der Puste. Sein Hemd unter der Jacke klebte wie eine zweite Haut an ihm.
»Wie leichtsinnig von mir.« Der Val’kai berührte mit der Rechten seine Wunde. Wieder fühlte Ryk diese fremdartige und zugleich vertraute Magie, bei der sich ihm die Nackenhaare sträubten. Ein Heilzauber, erkannte er instinktiv. Auf der Stelle verebbte der Blutstrom. Die Wundränder zogen sich zusammen. Nicht einmal eine Narbe blieb am Oberschenkel des Val’kai zurück. In dem Moment wurde Ryk klar, dass er sterben würde.
»Hast du es endlich begriffen, Mensch?« Die Zunge des Dämons schnellte zischelnd hervor. »Ihr seid schwach geworden über die letzten tausend Jahre. Früher hätte ich mit einem Magier kein so leichtes Spiel gehabt.«
Ryk spuckte aus. Es war vorbei, trotzdem würde er weiterkämpfen. Wenn er schon sterben musste, dann wenigstens mit der Waffe in der Hand. Seine Magie war fast aufgezehrt, aber er konnte das Seelenfeuer noch ein wenig länger am Brennen halten, wenn er ihm von seiner Lebensenergie zuführte. Der Preis dafür musste ihn nicht länger kümmern. In Kürze wäre er ohnehin tot.
Erneut strömte die Magie durch seinen Körper, schenkte ihm Stärke und Schnelligkeit. Mit einem Aufschrei warf Ryk sich auf den Feind. Er oder der Dämon.
Der Humanos schien jedoch nicht daran interessiert, ihn jetzt schon zu töten. Wieder wich er aus, indem er im letzten Augenblick zur Seite tänzelte und Ryk einen Schlag in den Rücken verpasste. Ryk stolperte vor, konnte den Sturz aber noch einmal abfangen. Er wirbelte herum und … starrte direkt in die Fratze des Dämons. Sofort riss er den Dolch hoch. Der Val’kai musste damit gerechnet haben. Er packte Ryks Hand und trieb die Kralle am Ende seines Daumens tief in das Fleisch unterhalb von Ryks Handgelenk.
Ryk schrie auf und ließ die Waffe fallen.
»Enttäuschend.« Der Val’kai schlug ihm mit der Rückhand ins Gesicht. Ryk taumelte zurück. Durch die Wucht des Schlages wurde die linke Hälfte seines Gesichts taub, das Auge begann bereits zuzuschwellen und tränte so stark, dass er damit kaum mehr etwas sah.
»Das Messer ist mit Magie aufgeladen.« Der Val’kai drehte die schimmernde Klinge, die er vom Boden aufgehoben hatte, in seinen Klauen hin und her. Wie konnte das sein?, fragte sich Ryk. Der Zauber darin hätte ihn vor Schmerz aufkreischen lassen müssen.
»Willst du etwa schon aufgeben?«, fragte der Dämon spöttisch, als er vor ihm in die Knie sank.
Ryk zitterte und fühlte sich so hilflos wie ein Neugeborenes. Er war ausgebrannt. Sein Körper zu sehr geschunden, um der Magie das wenige an Lebensenergie zu überlassen, was noch übrig war.
Der Humanos schlug ein weiteres Mal zu. Ryk fiel auf den Rücken. Er versuchte, wieder hochzukommen, aber selbst sein gesunder Arm gehorchte ihm nicht länger. Der Dämon grinste und bemerkte Ryks Blut an seiner Klaue. Seine Zunge schoss vor und leckte darüber. »Jetzt stelle ich hier die Fragen!« Schon hockte er auf Ryks Brust und nagelte ihn durch sein Gewicht an den Boden. Er war sehr viel schwerer, als seine ausgemergelte Gestalt vermuten ließ. »Für wen arbeitest du, Magier?«
Ryk starrte in die lidlosen schwarzen Augen des Dämons. »Leck mich!«
Der Val’kai beugte sich zu ihm herab. Wenn ich erst mit dir fertig bin, Mensch, wirst du mir gar nicht genug erzählen können.
Ryk hörte die Worte, obwohl die Lippen des Dämons sich nicht bewegt hatten. Wie war das möglich?
Weil du mir gehörst!, echote die Stimme seines Gegners durch seine Gedanken, begleitet von einem wilden rhythmischen Pochen – dem Herzschlag des Dämons! Und Ryk begriff, dass der Humanos ein Blutlenker sein musste und sich in seinem Kopf befand. Der Gedanke löste Panik bei ihm aus. Ryk wollte das Biest abschütteln, aufspringen und davonlaufen, aber seine eigene Schwäche und das Gewicht der Kreatur hielten ihn am Boden fest. »Nein«, keuchte er. »Nein!«
Der Dämon lachte. Wehre dich nur, Magier, helfen wird es dir nicht. Die Zunge stieß vor und leckte lasziv über Ryks Gesicht. In Kürze werde ich alles wissen, was ich über diese Welt wissen muss. Lange dünne Tentakel aus pulsierendem rotem Licht bohrten sich in Ryks Geist, umschlangen seine Erinnerungen und zerrten und saugten voll Verlangen daran.
Das durfte, nein, das konnte Ryk nicht zulassen! In einem letzten Kraftakt rammte er die Stirn in die Fratze seines Gegners. Der Humanos riss fauchend den Schädel zurück, während sich aus seinen Nüstern ein Schwall dunklen Blutes auf Ryk ergoss. Im selben Moment verstummte der Herzschlag in seinen Gedanken. Der Blutlenker war aus seinem Kopf verschwunden.
Der Dämon kreischte auf und schlang, außer sich vor Wut, seine Klauen um Ryks Hals. Es war so weit. Er würde sterben. Was immer noch besser war, als wenn der Dämon ihn gezwungen hätte, sein Wissen und die Geheimnisse der Dämonenjäger preiszugeben. Er spuckte dem Biest ins Gesicht, um seinen Zorn weiter anzufachen. Der Dämon bleckte die Zähne und drückte zu.
Ryk schloss die Augen, ließ los und stürzte in die erlösende Dunkelheit.
1
Arville, Xe’Neridian
23. Junet, 1026 n. d. Zweiten Dämonenkrieg
Ishan con Femen, Kronprinz des sharigorischen Königshauses, verzog missmutig die Mundwinkel. Seit Beginn der Verhandlungen hatte er Großfürst Gregorius Thamaryn keinen Moment lang aus den Augen gelassen. Der Herrscher über das mächtige Reetac und Oberhaupt des Fünferbundes trug eine unverhohlen gelangweilte Miene zur Schau, während er sich auf einem Stuhl aus Arnholz fläzte, in dessen Rückenlehne ein stilisierter, mit Blattgold überzogener Baum geschnitzt war, das Wahrzeichen des Inselreiches Xe’Neridian, dessen Regent zu dieser Zusammenkunft geladen hatte. Es war eine viel zu hohe Ehre für jemanden wie Thamaryn, wie Prinz Ishan fand. Seiner Meinung nach gehörten der Großfürst und der ganze Rest des Fünferbundes in das tiefste Kerkerloch, das Xe’Neridian aufzubieten hatte.
Insgesamt gab es siebzehn dieser prächtigen Stühle, die in einem weiten Kreis im Zentrum der Ratshalle aufgestellt waren. Auf ihnen thronten die Regenten der Schwebenden Reiche. Zumindest jene, die der Einladung gefolgt waren. Männer und Frauen, gekleidet in kostbare Gewänder in den Farben ihrer Häuser. Die juwelenbesetzten Ringe an ihren Fingern zeugten von ihrer Macht und ihrem Reichtum. Grimmig blickten sie in die Runde, und sie hatten allen Grund dazu. Der Anlass für das Treffen, das es in dieser Größenordnung seit annähernd einem Jahrzehnt nicht mehr gegeben hatte, war ernst und besorgniserregend. Rüstete der Fünferbund doch seit einiger Zeit zum Krieg.
Hinter den Regenten, entlang der Wände der Halle, saßen auf Sitzbänken ihre Ratgeber. Sie schauten nicht weniger übellaunig als ihre Herren und Herrinnen drein. Einzig Großfürst Thamaryns Berater waren seine Gedanken nicht anzusehen, denn er verbarg sein Antlitz im Schatten einer Kapuze, die zu einem dunklen, mit kostbaren Silberstickereien versehenen Umhang gehörte. Die anderen Ratgeber waren von ihm abgerückt, was Ishan nur zu gut nachvollziehen konnte. Auch bei ihm löste der Anblick dieser gesichtslosen Erscheinung Unbehagen aus, weshalb er den Blick rasch wieder von ihr ab- und ihn stattdessen seinem Vater zuwandte.
König Varras con Femen, der Wortführer der Freien Reiche, die das politische und militärische Gegengewicht zum Fünferbund bildeten, sprach sich gerade mit Inbrunst für eine Erneuerung der Handelsbeziehungen zwischen beiden Parteien aus. Er stand innerhalb des Kreises, den die Regenten mit ihren Thronen bildeten, und drehte sich mal in die eine, dann wieder in die andere Richtung, um nicht den Eindruck zu vermitteln, einer Seite den Vorzug zu geben.
Als Einziger unter den anwesenden Fürsten, Herzögen und Grafen trug er den Titel eines Monarchen. Vor über tausend Jahren hatten die Ersten Magier die Schwebenden Reiche unter den tapfersten Männern und Frauen aufgeteilt, die im Zweiten Dämonenkrieg mit ihnen gegen die falschen Götter der Val’kai gekämpft hatten. Zur Belohnung für ihren Mut hatten sie sie zu den Anführern ihrer Völker ernannt. Einen König hatte es damals noch nicht gegeben. Sharigor, über das das Hohe Haus der con Femen dieser Tage regierte, war erst zwei Jahrhunderte später aus einem Zusammenschluss der Inselwelten Celzar, Rhuk und Fhey erwachsen. Es galt als das mächtigste unter den Freien Reichen und verfügte über ein stehendes Heer, mit dessen Stärke es keines der anderen Inselreiche alleine hätte aufnehmen können. Mit dieser Sicherheit im Rücken konnte Varras con Femen es sich zweifelsfrei leisten, als der sechsundzwanzigste König in einer langen Reihe von weisen, großzügigen und gütigen Herrschern aufzutreten. Nichtsdestotrotz war er mit einem wachen Verstand ausgestattet und gab sich zumeist bodenständig.
Heute war er in ein farbenfrohes sharigorisches Festgewand gekleidet, über dem er eine rote, mit Goldfäden durchwirkte Robe trug. Als einziges Zeichen seiner Königswürde hatte er einen Goldreif aufgesetzt, der fast vollständig von seinem dichten schlohweißen Haar verdeckt wurde und den er eigens zu seiner Krönung vor rund dreißig Jahren hatte anfertigen lassen.
»… Handel mit Gütern stellt zweifelsohne eine wirtschaftliche Bereicherung für uns alle dar«, erklärte er in diesem Moment mit seiner wohlklingenden Baritonstimme. »Auf diese Weise kommt jeder von uns in den Genuss von Rohstoffen und Waren, die wir selbst nicht besitzen oder herstellen können …«
Die Worte waren geschickt gewählt, das musste Ishan seinem Vater lassen. So harmlos sie klangen, erinnerten sie doch jeden der Regenten daran, wie groß die Abhängigkeit der Inselwelten voneinander war. Nicht jedes Reich verfügte über ausreichend große Wälder, über eigene Steinbrüche, Eisenminen, Salzvorkommen oder genug Ackerboden, um das eigene Volk zu ernähren, und war daher auf den Handel mit seinen Nachbarn angewiesen.
Indirekt deutete sein Vater damit auch die Folgen eines Handelsembargos für den Fünferbund an, falls dieser sich tatsächlich zu einem kriegerischen Akt gegen die Freien Reiche und die wenigen neutralen Inselwelten hinreißen ließe, wie von vielen befürchtet wurde.
Nicht ohne Grund, wie Ishan meinte. Den Spähern seines Vaters zufolge hatte sich die Anzahl von Kriegsschiffen auf den Feuerflüssen rund um Reetac in den letzten Monaten drastisch erhöht. Auch häuften sich Berichte von verschwundenen Handelsschiffen aus Onques, Norsah und Caldoraq, die in den Südwesten der Schwebenden Reiche unterwegs gewesen waren, wo der Fünferbund besonders großen Einfluss besaß. Bisher waren weder die Schiffe noch die Besatzungen wieder aufgetaucht. Natürlich wiesen Thamaryn und seine Verbündeten jede Schuld von sich und machten die Lichterstürme dafür verantwortlich.
Nein, sagte sich Ishan, durch Reden würde sein Vater dem Fünferbund keinen Friedenspakt abringen. Worte waren wie Samen. Sie keimten nur, wenn sie auf fruchtbaren Boden fielen. Und den suchte man bei Thamaryn und seinen Verbündeten vergeblich. Diese Heuchler wollten Krieg. Zusätzliche Privilegien und Handelsrechte würden sie niemals zufriedenstellen. Ihnen ging es um Macht. Vermutlich sah sich Thamaryn bereits als Imperator der Schwebenden Reiche. Prinz Ishan wettete, dass dieser Tyrann sich sogar schon eine passende Krone hatte anfertigen lassen. Er warf Thamaryn einen feindseligen Blick zu, den dieser aber nicht zu bemerken schien.
Widerwillig musste er sich eingestehen, dass er die Ergebenheit und Loyalität von Thamaryns Anhängern zumindest bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen konnte. Der Großfürst war der geborene Anführer: stolz und unbeugsam. Gut aussehend obendrein. Hochgewachsen, breitschultrig, mit der typisch goldbraunen Haut eines Reetacianers. Sein Haar, eine blonde Löwenmähne, schimmerte im Sonnenlicht, das durch die Bogenfenster in seinem Rücken auf ihn fiel. Seine Augen, die von der Farbe des Abendhimmels waren, blickten allerdings kalt und herrisch drein. Ein Mann, vor dem man eher das Knie beugte, als sich ihm entgegenzustellen.
Aber das war nicht immer so gewesen. Aus seinen Kindertagen erinnerte Ishan sich an eine schüchterne, zurückhaltende Version dieses Mannes, der ganz unter der Fuchtel seiner Frau gestanden hatte. Erst mit ihrem Tod hatte sich …
Beifall und Gemurmel rissen Ishan aus seinen Gedanken. Sein Vater hatte seine Rede beendet. Auch Thamaryn applaudierte, wenn auch zurückhaltend. Gleiches galt für seine Verbündeten: Baron Telrys vom Eisenreich Rifta, Graf Roadan, Regent des Waldreichs Dagoras, und Herzog Belfane vom Flussreich Ipstat zeigten kaum eine Gemütsregung. Anders als Herrin Sharala, Herrscherin über das Wüstenreich Sataou. Die dunkelhäutige grazile Schönheit sah mit gerunzelter Stirn zu Ishan herüber. Der Prinz hatte in den vergangenen Tagen viel Zeit damit verbracht, sie zu betrachten. Herrin Sharala zählte zu den schönsten Frauen der Schwebenden Reiche. Dass sie rund zehn Jahre älter als er selbst war, machte sie nur noch interessanter. Wie bedauerlich, dass sie der Feind war.
»Was für eine bewegende Rede, König Varras«, erklärte Fürst Elorien, ein kleiner Mann mit dünnen braunen Haaren und nervösen Händen, die pausenlos an seinem Wams herumzupften. »Große Worte eines großen Mannes …«
Elorien war der Regent des Inselreiches Xe’Neridian und ihr Gastgeber. Da er weder den Freien Reichen noch dem Fünferbund angehörte, war sein Palast von allen Beteiligten als neutraler Boden akzeptiert worden. Seit vier Tagen kamen die Regenten nun schon jeden Morgen in seiner Ratshalle zusammen, redeten von Frieden, Einheit und Handel und vermieden es dabei tunlichst, über das zu sprechen, was sie überhaupt erst zusammengeführt hatte. Die Furcht vor einem Krieg. Jede Frau und jeder Mann in diesem Raum wusste, dass der Fünferbund schon vor einer geraumen Weile damit begonnen hatte, seine Truppen und Flotten aufzurüsten. Dennoch schwiegen sie.
Worauf warten Vater und die anderen?, fragte Ishan sich. Warum konfrontierten sie Thamaryn nicht mit ihrem Wissen? Fehlte ihnen der Mut dazu? Natürlich verstand er, dass sie keinen Krieg wollten. Wer wollte das schon? Er war sich jedoch sicher, dass sie bei Thamaryn nichts erreichen würden, indem sie ihm die Vorzüge des Friedens und einer florierenden Handelsallianz anpriesen. Das Einzige, was bei einem Mann wie ihm Eindruck machen würde, wäre eine Machtdemonstration. Sie mussten ihm zeigen, dass sie keine Angst vor ihm hatten. Die meisten Menschen verhielten sich nicht anders als Wölfe. Der Schwächere ordnete sich stets dem Stärkeren unter.
Ishan verschränkte die Arme vor der Brust und sah zum hundertsten Mal an diesem Morgen zu Herrin Sharala hinüber. Die dünnen Seidengewänder und Schleier, die sie heute trug, ließen nicht viel Raum für Fantasie. Erneut drehte sie ihm den Kopf zu, und ihre Blicke begegneten sich. Einen Herzschlag lang versank er in der samtigen Dunkelheit, dann bemerkte er, wie sich ihre Lippen zu einem überheblichen Lächeln kräuselten. Verstimmt wandte er sich ab und betrachtete stattdessen die Intarsien der Wand- und Deckenverkleidungen. Im durch die Fenster einfallenden Sonnenlicht schimmerten sie bernsteinfarben vor dem Hintergrund der dunklen Vertäfelung. Dazwischen hingen mit Stickereien versehene Gobelins, die tiefe Wälder, stolze Feuerreiter und Jagdszenen zeigten. Der Palast von Fürst Elorien war ein Hort des Luxus.
Nichtsdestotrotz konnte er mit der Größe und Pracht des sharigorischen Königspalastes nicht mithalten. Dort gab es endlose Flure und Treppen, Hallen über Hallen und Säulen, die wie dagorasische Riesenbäume emporwuchsen, um Decken zu stützen, die sich wie eigene kleine Himmelsgewölbe über den Palastbewohnern spannten. All das war aus kostbarstem weißem Marmor gefertigt und versehen mit Reliefs von Fabelwesen, wie es sie nur in der alten Welt gegeben hatte. Einige von himmlischer Schönheit und über alle Maßen erhaben, andere hässlich und beängstigend wie die Dämonen der Gegenwelt. Plötzlich musste Ishan lächeln. Als Kind hatte er sich immer vorgestellt, wie er selbst einmal gegen die Dämonen kämpfen würde. Jetzt, wo er erwachsen war, sah es so aus, als ob die wahren Ungeheuer, die den Frieden dieser Welt bedrohten, zusammen mit ihm in diesem Kreis saßen.
Endlich schien Fürst Elorien die Lobeshymnen auf seinen Vater beendet zu haben. »Vielleicht wäre nun ja der richtige Zeitpunkt für ein paar Erfrischungen?« Fragend blickte er in die Runde. Seine wässrig grauen Augen blinzelten nervös. »Oder lieber später? Wir könnten natürlich …«
»Jetzt lasst die Erfrischungen schon auftragen!« Thamaryn hatte seine Maske der Gleichgültigkeit abgestreift und starrte ihren Gastgeber gereizt an.
Der Wolf zeigt seine Zähne, dachte Ishan.
Elorien, der blass geworden war, klatschte in die Hände, woraufhin sich die Türen der Halle öffneten und Diener mit Getränken und Speisen hereinschwärmten, um sie den Regenten und deren Beratern anzubieten, die bisher wie Schatten im Hintergrund ausgeharrt hatten.
Die Atmosphäre wurde daraufhin gelöster. Schon immer hatten Trank und Speise diese Wirkung auf Menschen gehabt. Ishan nahm sich einen Kelch mit xe’neridianischem Honigwein, leerte ihn in einem Zug und ließ den Diener sogleich nachschenken. »Gut gesprochen!« Er prostete seinem Vater zu, der sich neben ihm niedergelassen hatte.
»Nun, das wird sich erst noch zeigen«, erwiderte der König mit unbewegter Miene.
Ishan zuckte die Schultern. Wenn sein Vater in dieser Stimmung war, ließ man ihn am besten in Ruhe. Er wandte sich von ihm ab und beobachtete die übrigen Regenten, die auf ihren Thronen saßen und sich an den dargebotenen Köstlichkeiten labten. Einige der zuvor grimmigen Gesichter zeigten nun ein Lächeln. Es wurde sogar gescherzt. Doch dann meldete sich Baron Telrys zu Wort. Einer von Thamaryns Männern. Sein Haar war stahlgrau und kurz geschnitten wie das eines Soldaten.
»Auch wenn wir Eure Gastfreundschaft zu schätzen wissen, Elorien«, sagte er mit einer Stimme, die wie eine Klinge durch die Geräusche und Stimmen im Saal schnitt, »sollten wir den eigentlichen Grund unseres Hierseins nicht aus den Augen verlieren.« Es wurde sehr still in der Halle, als Telrys sich nun an Varras wandte. »Eure Rede war ohne Frage sehr schön, Majestät, und dennoch nicht aussagekräftiger als die müßigen Plaudereien der vergangenen Tage.«
Ausrufe der Empörung wurden unter den Regenten der Freien Reiche laut, die gut zwei Drittel der Anwesenden ausmachten. Telrys, der den Platz zwischen Herzog Belfane und Thamaryn besetzte, während zur Linken des Großfürsten Herrin Sharala und Graf Roadan saßen, reagierte mit einem süffisanten Lächeln.
»Sagt, was Ihr uns zu sagen habt«, fügte Telrys an Ishans Vater gerichtet hinzu. »Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt dafür.«
Der König bedachte ihn mit einem durchdringenden Blick. »Es ist bedauerlich, wenn Ihr den Frieden als ›zeitraubende Angelegenheit‹ betrachtet, Baron. Wir hoffen dennoch, dass Ihr unserem Angebot offen gegenübersteht. Zuvor würden wir jedoch gerne …«
»Nein, alter Mann«, unterbrach ihn Thamaryn barsch. »Es wurde genug geredet, und ich bin des Wartens leid. Wie Telrys bereits sagte: Kommt endlich zur Sache!«
Ishan sprang von seinem Stuhl auf, wobei er die Hälfte seines Weins verschüttete, und funkelte den Großfürsten erzürnt an. »Die korrekte Anrede lautet ›Eure Majestät‹.«
Thamaryn hob eine Braue. »Wen haben wir denn hier? Den kleinen Kronprinzen.« Im nächsten Moment wurde seine Miene hart. »Hat dir niemand beigebracht, dass du zu schweigen hast, wenn sich Erwachsene unterhalten?«
Ishan ballte die Faust. Mit seinen achtzehn Jahren mochte er der Jüngste in dieser Runde sein, aber deswegen besaß sein Wort keinen geringeren Wert. »Wie könnt Ihr es wagen?« Er spürte die Hand seines Vaters auf seinem Unterarm und schüttelte sie ab. »Ihr kommt hierher, beleidigt uns und unseren Gastgeber und glaubt, wir würden dies einfach hinnehmen?«
»Ich glaube es nicht nur, ich weiß es.« Thamaryn lehnte sich in seinem Stuhl zurück, hob das Kinn leicht an und ließ den Blick durch den Saal schweifen. »Ich sehe die Angst in Euren Gesichtern und höre sie in Eurem Schweigen, darum überlasst Ihr das Reden auch einem Diplomaten. Ihr alle hier fürchtet, dass ein einziges falsches Wort zum Krieg führen könnte, und so verbergt Ihr Euer Betteln um Frieden hinter leeren Versprechungen.« Sein Kopf ruckte herum. »Varras, ich halte Euch für einen fähigen Mann und starken Regenten. Lassen wir die Spielchen sein. Frieden ist ein kostbares Gut, aber wir …«
Ishans Kelch landete mit einem Knall auf dem Boden, der ihm sofort die Aufmerksamkeit aller bescherte. »Denkt Ihr, wir wissen nicht, was in Reetac vor sich geht, Großfürst?«, platzte es aus ihm heraus. »Ihr habt Eure Streitkräfte und Eure Flotte massiv ausgebaut. Das Gleiche gilt für Eure Verbündeten. Niemand, der auf Frieden aus ist, würde so etwas tun.«
»Und das streite ich auch gar nicht ab, Prinz Ishan«, erwiderte Thamaryn. »Doch geschah es lediglich zu unserer eigenen Sicherheit, zur Abschreckung unserer Feinde.«
»Welche Feinde?«, erwiderte Ishan. Trotz seines Zorns musste er sich eingestehen, dass dieser Drecksack Thamaryn genau wusste, was er tat. Erst spielte er mit den Ängsten der Regenten, nur um ihnen gleich darauf die Hoffnung auf anhaltenden Frieden wie eine Ware feilzubieten. Und sie waren auch noch dumm genug, darauf hereinzufallen. Begriffen sie denn nicht, dass er nur mit ihnen spielte? Dann lag es wohl an ihm, Thamaryn dazu zu bringen, sein wahres Gesicht zu zeigen.
»Mach jetzt nichts Dummes, Ishan. Ich kenne diesen Blick«, ermahnte ihn der König leise. »Sei vernünftig und …«
»Es geht nicht anders.« Er riss sich von seinem Vater los, der ihn erneut am Unterarm gepackt hatte, stand auf und ging zielstrebig auf Thamaryn zu. Wenige Schritte vor ihm blieb er stehen. Unglücklicherweise war Thamaryn ein großer Mann, sodass er, als er ebenfalls aufstand, auf Augenhöhe mit Ishan war. Es hätte ihm besser gefallen, auf ihn herabzublicken.
»Was denn, Prinz«, sagte der Großfürst, »hast du eben nicht schon zur Genüge bewiesen, dass du das Reden besser anderen überlassen solltest?«
»Ihr seid ein Lügner, Thamaryn! Sharigor weiß von Euren Truppenverschiebungen und den Plänen, Kellwyn anzugreifen. Oder habt Ihr geglaubt, das vor uns verheimlichen zu können? Ihr werdet uns nicht länger zum Narren halten!«
Um ihn herum und in seinem Rücken verfielen die Regenten der Freien Reiche in erregtes Gemurmel. Er hörte das Knarzen ihrer Stühle, das Rascheln ihrer Gewänder, als sie sich einander zuwandten. Sie hatten nichts von Thamaryns Plänen bezüglich Kellwyn gewusst. Wie sollten sie auch? Der Späher, der ihm und seinem Vater diese Information zugetragen hatte, war erst heute Morgen kurz vor Beginn der Gespräche im Palast eingetroffen, sodass keine Zeit geblieben war, die anderen davon zu unterrichten. Sollten einige von ihnen deshalb pikiert sein, wäre das ein Übel, das Ishan bereit war, in Kauf zu nehmen. Viel wichtiger war, dass sie endlich begriffen, um was für einen Mann es sich bei Gregorius Thamaryn wirklich handelte. Ishan reckte das Kinn vor und bedachte den Großfürsten mit einem Lächeln. Jetzt hatte er diesen Drecksack!
Thamaryn musterte ihn einige Augenblicke lang schweigend, bevor er in schallendes Gelächter ausbrach. »Du musst noch viel lernen, Ishan con Femen«, sagte er, nachdem er sich wieder beruhigt hatte. »Selbst wenn es wahr wäre, was du behauptest, und ich bestreite, dass dem so ist, ist es mehr als dumm, deinem Feind gegenüber preiszugeben, welche Einsichten du in seine Pläne hast.« Ein harter Zug bildete sich um seinen Mund. »Verleumdung, mein Prinz, ist eine üble Sache. Kriege wurden schon für sehr viel geringere Vergehen begonnen. Oder hast du Beweise für deine Behauptungen?«
Ishan starrte ihn an, während sich in seinem Magen ein eisiges Gefühl ausbreitete. Natürlich hatte er keine Beweise, sondern nur das Wort des Spähers. Er kniff die Augen zusammen. Wie er Thamaryn hasste! In diesem Moment hätte er ihm am liebsten seine arrogante Nase gebrochen. Stattdessen biss er die Zähne zusammen und schüttelte den Kopf.
Ausrufe des Zorns brandeten durch die Halle und echoten in Ishans Ohren wieder. Plötzlich kam er sich sehr dumm vor. Er senkte den Blick zu Boden. Was hatte er nur angerichtet? Durch seinen Auftritt hatte er die Position der Freien Reiche gegenüber dem Fünferbund erheblich geschwächt.
Thamaryn wandte sich König Varras zu, der sich von seinem Platz erhoben hatte und neben Ishan getreten war. »Ihr habt einen Hitzkopf zum Sohn, alter Mann, dem es deutlich an Respekt mangelt.«
Der König neigte leicht den Kopf. »Ich muss mich für meinen Sohn entschuldigen, Großfürst.« Er legte Ishan eine Hand auf die Schulter, um ihn zu seinem Stuhl zurückzuführen. Dabei bohrten sich seine Finger so fest in die Kuhle unter seinem Schlüsselbein, dass Ishan zusammenzuckte. Sein Kopf fuhr zu seinem Vater herum, und er erschrak angesichts der Wut in seinen Augen.
»Einen Moment noch.« Der Schlag kam unerwartet und traf Ishan mit solcher Wucht, dass er zu Boden geworfen wurde. Der Großfürst blickte kalt auf ihn herab. »Und dir, kleiner Prinz, rate ich, dass du den Mund hältst, bevor du noch etwas sagst, das wir am Ende alle bereuen!«
In Ishans Ohren rauschte es. Wie konnte dieser Bastard es wagen, ihn, den Kronprinzen von Sharigor, zu schlagen? Er starrte hasserfüllt zu ihm auf, während er sich mit dem Handrücken das Blut von der Lippe wischte. »Wie zum Beispiel, dass Ihr Eure eigene Frau im Schlaf erdrosselt habt, weil sie Euch einen Versager im Bett nannte? Oder hat sie doch eher Schlappschwanz gesagt, Thamaryn?« Er rang sich trotz der Schmerzen ein Lächeln ab. »Die Gerüchte sind da nicht ganz eindeutig.«