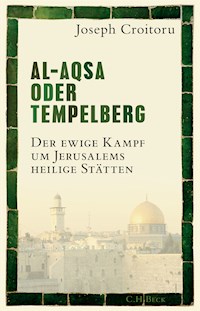Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Deutschen stehen seit Jahrhunderten in regem Austausch mit der islamischen Welt. Und doch sind sie hin- und hergerissen zwischen Faszination und Verachtung. Für Joseph Croitoru öffnet sich dieser Zwiespalt schon im Zeitalter der Aufklärung. Bei Staatsmännern wie Friedrich dem Großen, Denkern wie Herder und Autoren wie Lessing finden sich Klischees, die uns noch heute begegnen: Luxus und Reichtum, Falschheit und Faulheit. Die Aufklärung war aber doch mit dem Anspruch angetreten, sich des eigenen Verstandes zu bedienen? Dieses Buch ist ein Appell, in der Auseinandersetzung mit dem islamischen Orient endlich den Maximen der Aufklärung gerecht zu werden – was heute dringender nottut denn je.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 696
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Deutschen stehen seit Jahrhunderten in regem Austausch mit der islamischen Welt. Und doch sind sie hin- und hergerissen zwischen Faszination und Verachtung. Joseph Croitoru zeigt, wie sich dieser Zwiespalt schon im Zeitalter der Aufklärung öffnet. Bei Staatsmännern wie Friedrich dem Großen, Denkern und Schriftstellern wie Lessing, Gottsched, Herder und Wieland finden sich Klischees, die uns noch heute begegnen: Fanatismus und Grausamkeit, Falschheit, Faulheit und Lüsternheit. Es verblüfft, wie sehr die schon damals heftigen Debatten über den Islam den gegenwärtigen ähneln. Dass unser Verhältnis zum islamischen Orient noch immer von jenem Konfrontationsdenken mitbestimmt ist, das wir längst überwunden glaubten, muss zu denken geben.
Hanser E-Book
JOSEPH CROITORU
Die Deutschen und der Orient
Faszination, Verachtung und die Widersprüche der Aufklärung
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Einleitung
KAPITEL 1
Friedrich der Große als Trendsetter: Neue Orientpolitik und osmanenfreundliche Gesinnung
Der roi philosophe blickt kritisch auf die Instrumentalisierung der Religion – auch im Orient
Der islamische Prophet – ein »Betrüger«
Voltaires islamfeindliches Theaterstück Mahomet findet Beifall am preußischen Hof
Marquis d’Argens – noch ein islamkritischer Gesinnungsgenosse des Preußenkönigs
Neue Pfade: Friedrich II. sucht Verbündete im Orient und betreibt muslimfreundliche Medienpolitik
Preußens mühsame Annäherungsversuche an die Hohe Pforte
Berlin setzt auf die Käuflichkeit der Osmanen
Der Kriegsherr in Not: Friedrich II. besingt die Türken als letzte Hoffnung
Vorurteile scheinen bestätigt: Die osmanische Gesandtschaft in Berlin fasziniert und irritiert
Der orientalische Gast wird zur Last: »Mamamouchi«
»Die Türken sind habgieriger als die Juden«
Wider den kriegslüsternen Türkenfeind Voltaire: Friedrich II. als Anwalt der Osmanen
KAPITEL 2
Lessings Bemühungen um ein positiveres Orientbild – preußischer Zensurdruck als Motor, der Publikumsgeschmack als Bremse
Der junge Lessing: Spielerische Reflexion über okzidentale Orientklischees
Lessing in Berlin: Aufwertung des Islam im Zeichen der orientfreundlichen Politik Friedrichs II.
Als Übersetzer von Friedrichs II. Hofgast Voltaire: Gerühmte Toleranz des Islam als Christentumskritik
Lessings beschönigende Darstellung der von ihm übersetzten Geschichte der ArabervonMarigny
Rettung des Cardanus – vorsichtiges Plädoyer für ein differenziertes Muhammad-Bild
Letzte Berliner Orientepisode: Die Fragmente Phatime/Fatime
Als Dramaturg und Theaterkritiker in Hamburg: Lessings Orientbild zwischen aufklärerischem Anspruch und Anpassungszwängen
Bibliothekar in Wolfenbüttel: Wiederaufleben der Orientbeschäftigung in einem neuen aufklärerischen Umfeld
Der Fragmentenstreit: Islamthematik wird für Kritik an der christlichen Orthodoxie instrumentalisiert
Nathan der Weise: Interreligiöse Verbrüderung triumphiert über christlichen Fanatismus
KAPITEL 3
Von der Vernunft zur Empfindung: Der arabische Orient wird zum poetischen Faszinosum – und das reale Arabien wird entdeckt
Zwei Leipziger Streiter für das dichterische Erbe Arabiens: »Literaturpapst« Gottsched und der Arabist Reiske
Poetische Schönheit im Koran: Der Vorstoß des Göttinger Orientalisten Johann David Michaelis
Das Studium des Arabischen aus dem Griff der Theologen befreien: Reiske leistet Pionierarbeit
Orient als Konversationsthema: Gottsched und Reiske begegnen Friedrich dem Großen im besetzten Leipzig
Reiskes Proben der arabischen Dichtkunst und seine Verteidigung Muhammads
Das Interesse am Arabischen wächst: Frorieps Arabische Bibliothek als Zeichen eines Gesinnungswandels
Zwischen Faszination und Ablehnung: Aufklärungskritiker Hamann und der junge Herder blicken auf den islamischen Orient
Wider die Koranbegeisterung: Michaelis’ Kehrtwende und die Debatte um die erste deutsche Koranübersetzung
Zaghafte Annäherung: Der junge Goethe und sein Dramenfragment zu Muhammad
Muhammad als Dichter bewundert: Boysens Koranübersetzung und Gleims koraninspirierte Dichtung Halladat
Wie viel Poesie ist im Koran? Boysens Übersetzung begeistert und entzweit
Das neue Araberbild – Carsten Niebuhrs Arabienreise
Rezeption von Niebuhrs Beschreibung von Arabien
KAPITEL 4
Die Türkei wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit: Die deutsche Öffentlichkeit zwischen Türkenhass und Osmanen-Apologetik
Deutsche Debatten über das Osmanische Reich im Vorfeld des russisch-österreichischen Türkenkriegs (1787–1792)
Der türkeifeindliche Bestseller des Baron von Tott
Der russisch-österreichische Türkenkrieg bricht aus: Niebuhrs Beitrag zur Debatte um die Lage des Osmanischen Reiches
Die preußische Sicht auf den Türkenkrieg unter dem Gebot der Zurückhaltung
Die Berliner Blätter über den Türkenkrieg
Österreich tritt in den Krieg ein
Um Ausgewogenheit und Relativierung bemüht: Die Berliner Presse über das Kriegsgeschehen im Jahr 1788
Anderswo in Preußen wird über den Krieg öffentlich polemisiert: Dichter Gleim spitzt seine Feder gegen die Türken
Antitürkische Ressentiments und aufkeimender Philhellenismus in Gleims Umfeld
Scharfe Kritik an Gleim und am Türkenkrieg aus dem preußischen Halle
Angriff aus dem Süden Deutschlands gegen die Türkeiapologeten
Das »großherrliche Leckermaul«: Bürgers Münchhausen wird im Kriegsjahr 1788 mit Türkenklischees gewürzt
Dem Volk aufs Maul geschaut – eine Antikriegsschrift aus dem Berliner Untergrund
KAPITEL 5
Die Risse werden tiefer: In Preußen steht man zu den andernorts verschmähten Türken
Preußische Publizistik und die Kriegsjahre 1789 und 1790
Wielands Teutscher Merkur und der Türkenkrieg: Balanceakt zwischen Differenzierung und islamkritischer Polemik
Tendenziöse Auswahl zuungunsten des Propheten Muhammad: Übersetzungsauszüge aus Edward Gibbons Universalgeschichte
Die Debatte über Muhammad reißt nicht ab
Wielands finsteres Islambild: Im Goldnen Spiegel entrinnt der Sultan knapp einer »dschihadistischen« Erziehung
Fortsetzung des Goldnen Spiegels: Der verbannte Hofphilosoph Danischmend bekämpft weiter die Eiferer und wird fast selbst zum islamischen Despoten
Schach Lolo: ein verkommener Sultan aus dem Figurenarsenal des Goldnen Spiegels als Parabel über Machtmissbrauch
Wielands Oberon überspitzt mit blutigen Gewaltszenen Klischees über Muslime
Osmanenkritischer Kommentar zum Türkenkrieg: Das Schauspiel Theodora oder die Ankunft der Türken im Teutschen Merkur
KAPITEL 6
Preußens Einsatz für den Frieden zwischen Eigennutz und Türkenfreundlichkeit
Der steinige Weg zur preußisch-türkischen Allianz von 1790
Friedrich Wilhelm II. wird als Friedensstifter besungen
Der osmanische Gesandte Ahmed Azmi wird in Berlin hofiert – und inspiriert
Preußen kommt um einen Kriegseintritt gegen Russland an der Seite der Pforte herum
Nachwort
Anmerkungen
Bibliographie
Personenregister
Einleitung
In der aktuellen Debatte über den Islam sind seine Kritiker schnell dabei, sich auf die Errungenschaften der Aufklärung zu berufen. Damals habe, so das gängige Argument, eine kritische Auseinandersetzung mit religiösen Dogmen stattgefunden, die ihresgleichen in der islamischen Welt suche. Wie aber stand es eigentlich in dem so gerühmten Zeitalter der Aufklärung um das Verhältnis der Deutschen zum islamischen Orient? Mit dieser Frage haben sich bislang nur interessierte Fachleute und auch die nur fragmentarisch befasst. Auch in der Öffentlichkeit besteht nach wie vor ein Wissensdefizit, gerade was die düstere Sichtweise auf den islamischen Orient in jener angeblich von Vernunft und Toleranz so durchdrungenen Epoche betrifft. Diese Lücke will das vorliegende Buch schließen helfen, zumal die Ambivalenzen, die unseren heutigen Blick auf die islamische Welt prägen, weitgehend derselben europäisch-christlichen Abwehrhaltung entspringen, gegen die schon vor 250 Jahren deutsche Aufklärer mit mäßigem Erfolg ankämpften. Dass sich die alten Ressentiments über die Jahrhunderte bis heute hartnäckig gehalten haben, hat in jüngster Zeit am deutlichsten der Einzug einer offen antiislamischen Partei in den Bundestag vor Augen geführt.
Wenngleich sich das friderizianische Preußen als erster deutscher Staat gegenüber der islamischen Welt zu öffnen begann, so hatte die seit etwa der Mitte des 18. Jahrhunderts betriebene Annäherung doch einen janusköpfigen Charakter. Dies rührte nicht zuletzt daher, dass die Schriftsteller und Gelehrten, die sich den Ideen der Aufklärung verschrieben hatten, in der Regel stark von einer christlich-religiösen Erziehung geprägt und häufig auch theologisch ausgebildet waren. Zum religiösen Allgemeingut gehörte auch der Betrugsvorwurf gegen den Propheten Muhammad, mit dem man dem Islam absprach, eine Offenbarungsreligion zu sein.
Die Auffassung, dass der Stifter des Islam ein Betrüger gewesen sei, teilte auch der für seine religiöse Toleranz bekannte Preußenkönig Friedrich der Große, dessen Verhältnis zu den Türken im ersten Kapitel nachgegangen wird. Während am Hof des um ein Militärbündnis mit Konstantinopel bemühten preußischen Monarchen über die »Pfaffen« aller Couleur schonungslos hergezogen wurde, herrschte in der Öffentlichkeit das Diktat eines islamfreundlichen Tons, dem sich auch die preußische Presse zu unterwerfen hatte.
Die Pressepolitik Friedrichs II. war wohl der Ansporn für den Schriftsteller Gotthold Ephraim Lessing, dem Kapitel 2 gewidmet ist, sich ab 1751 als junger Kulturredakteur der hofnahen Berlinischen privilegierten Zeitung intensiv dem Thema islamischer Orient zuzuwenden und in seinen Pressebeiträgen zum Anwalt der Muslime zu machen. Auch wenn er in seinem Essay Rettung des Hier. Cardanus (1754) schon bald Kritik an der Hetze gegen den islamischen Religionsstifter übte, ging er dennoch nicht so weit, Muhammad vom Vorwurf des Betrugs freizusprechen. In seinen Hamburger Jahren als Dramaturg und Theaterkritiker sah er sich gar gezwungen, Zugeständnisse an den Publikumsgeschmack zu machen und seine Kritik an den antiislamischen Vorurteilen der Zeitgenossen zu zügeln. Später, als herzoglicher Bibliothekar von Wolfenbüttel, stand Lessings Beschäftigung mit dem Thema Islam im Zeichen der Theologie. Sein 1779 veröffentlichtes dramatisches Gedicht Nathan der Weise war auch die Summe seiner langjährigen Auseinandersetzung als Kritiker mit orientalisierenden zeitgenössischen Theaterstücken, die vor Stereotypen über Muslime nur so strotzten – wovon übrigens auch Lessings zu seinen Lebzeiten unveröffentlicht gebliebene frühe Dramenfragmente Giangir und Phatime/Fatime nicht ganz frei waren.
Obwohl der Nathan seiner Zeit voraus war, hinkte er ihr doch auch hinterher. Denn mittlerweile hatte sich das Verhältnis der deutschen Öffentlichkeit zum islamischen Orient erheblich gewandelt, und auch ihr Wissenshorizont hatte sich erweitert. Schon zu der Zeit, als Lessing Redakteur in Berlin war, hatte sein Erzfeind Johann Christoph Gottsched begonnen, sich ebenfalls als Aufklärer in Sachen Orient zu inszenieren. Mit dieser bislang unbeachteten Facette der publizistischen und verlegerischen Tätigkeit des Leipziger »Literaturpapstes« setzt das dritte Kapitel ein. Obgleich Gottscheds Schriften von seiner Gespaltenheit gegenüber dem islamischen Propheten Muhammad zeugen, bot er in seinen Zeitschriften dem Arabisten Johann Jacob Reiske ein wirksames Forum, um für eine unvoreingenommene Öffnung gegenüber der arabischen Literatur zu werben. Reiskes Bemühungen um eine Neubewertung der Kulturleistungen der Araber wurden zwar erst später angemessen gewürdigt. Aber Reiskes Essays und Übersetzungen aus dem Arabischen wirkten auf den konservativen und weit einflussreicheren Göttinger Orientalisten Johann David Michaelis inspirierend. Wenngleich der Göttinger, allerdings nur in jungen Jahren, den Propheten Muhammad als Dichter und den Koran als poetisches Werk schätzte, bestritt er doch von Anfang an vehement dessen Offenbarungsanspruch.
Jener Zwiespalt zwischen ästhetischer Faszination und religiöser Verachtung, wie er sich bei Michaelis zeigte, kennzeichnete Anfang der 1770er Jahre auch die heftige Diskussion, die sich an den ersten deutschen Übersetzungen des Koran aus dem Arabischen entzündete. Im Osten tobte damals der russisch-türkische Krieg (1768–1774), der eingefleischte deutsche Türkenhasser einem Sieg Russlands und der Zerschlagung des Osmanischen Reichs entgegenfiebern ließ. Zu ihnen gehörte auch der Frankfurter Pastor und Orientalist David Friedrich Megerlin, der 1771 als erster den Koran aus dem Arabischen ins Deutsche übertrug und damit den Beweis erbringen wollte, dass der Islam bekämpft werden müsse. Auf Megerlins Übersetzung wurde auch der junge Goethe aufmerksam, der sich damals gerade mit dem islamischen Propheten befasste – dass er damit einer neuen Mode folgte, der sich in jenen Jahren etliche deutsche Schriftsteller anschlossen, wird hier zum ersten Mal beleuchtet. In der entscheidenden Phase aber der öffentlichen deutschen Auseinandersetzung mit dem Islam in dieser Zeit spielte Goethe, dessen wegweisender West-östlicher Divan erst fast ein halbes Jahrhundert später erschien (1819), allenfalls eine Nebenrolle.
Einen Höhepunkt erreichte die deutsche Islamdebatte 1773 im Streit über die Koranübersetzung des Quedlinburger Oberhofpredigers und Orientalisten Friedrich Eberhard Boysen, der die heilige Schrift des Islam auch als poetisches Werk rühmte – sich aber, um seine Kritiker zu beschwichtigen, letztlich gezwungen sah, in gewohnter Manier Muhammad als Lügenpropheten zu denunzieren. Angeregt von Boysens Übersetzung, verfasste der mit ihm befreundete Halberstädter Dichter Johann Wilhelm Ludwig Gleim sein Lehrgedicht Halladat, die erste vom Koran inspirierte deutsche Dichtung, die als solche erst in jüngerer Zeit von der Forschung entdeckt wird. Nur wenig bekannt ist Gleims anderes Gesicht als Türkenfeind, der bald deren Vertreibung aus Europa lauthals fordern wird.
Trugen Boysens Koranübersetzung und die kurz zuvor erschienene Beschreibung von Arabien (1772) des deutschen Orientreisenden Carsten Niebuhr dazu bei, tief verwurzelte Vorurteile über Muslime aufzuweichen, lebten die antitürkischen Ressentiments schon bald wieder auf. Auch infolge des russisch-türkischen Kriegs wandte sich nun der Blick der deutschen Öffentlichkeit wieder verstärkt dem Osmanischen Reich zu. Das rege Interesse am Zustand und künftigen Schicksal des Osmanenstaats wurde, wie im vierten Kapitel geschildert, von der Presse wie von etlichen deutschen Schriftstellern und Verlegern bedient. Während tendenziell außerhalb der Einflusssphäre Preußens wieder massiv gegen die Türken gehetzt wurde, nahmen sie preußische Autoren, Berlins türkeifreundlichem Kurs folgend, in Schutz.
Der Riss, der damals durch die deutsche Öffentlichkeit ging, vertiefte sich noch, als der russisch-österreichische Krieg gegen das Osmanische Reich (1787–1792) ausbrach, in dem sich Preußen, nun von Friedrich Wilhelm II. regiert, zunächst neutral verhielt. War die Berliner Presse in ihrer Kriegsberichterstattung, die in Kapitel 5 untersucht wird, bemüht, das Gebot der Neutralität zu wahren, stimmten preußische Dichter Lobgesänge auf die Osmanen an. Preußens Apologeten der Türken schrieben jetzt in Zeitschriften und Untergrundschriften gegen das antitürkische Kriegsgeschrei an, das sich vor allem im Süden Deutschlands erhob – in einer Schärfe, die der heutiger Debatten kaum nachstand. Wieder flammte die Diskussion um den Islam und seinen Propheten auf. Selbst berühmte deutsche Aufklärer wie der Religionsphilosoph Johann Gottfried Herder rückten nicht ab von ihrem finsteren Islambild, zu dessen Aufrechterhaltung auch Christoph Martin Wieland als Schriftsteller und Verleger das Seine beitrug.
Wie ambivalent selbst Berlins Verhältnis gegenüber der inzwischen mit ihm verbündeten Pforte blieb, veranschaulicht das sechste und letzte Kapitel. In Preußen, das den Türken als Friedensvermittler – dabei auch eigene Interessen verfolgend – zur Seite stand, besang man euphorisch Friedrich Wilhelms II. Verdienste um den Frieden. Den 1791 mit seinem Gefolge in der preußischen Hauptstadt weilenden osmanischen Gesandten Ahmed Azmi überhäufte man zwar mit Ehrenbezeugungen, aber der Besuch aus der Türkei wurde dem Hof auch bald lästig. Dies umso mehr, als der Preußenkönig der in Aussicht gestellten Verpflichtung, Sultan Selim III. im Krieg gegen Russland militärisch zu unterstützen, nicht nachzukommen gedachte. Zu einem gemeinsamen Kriegseinsatz von Deutschen und Türken sollte es erst eineinviertel Jahrhunderte später im Ersten Weltkrieg kommen.
Betrachtet man aus heutiger Warte das Verhältnis der Deutschen zum islamischen Orient in der Zeit der Aufklärung, so erstaunt nicht nur, wie sehr er die deutsche Öffentlichkeit damals beschäftigte und auch spaltete. Auch verblüfft immer wieder die Ähnlichkeit zwischen den damaligen und den gegenwärtigen Islamdebatten. Dass unser Verhältnis zur islamischen Welt noch immer von jenem Konfrontationsdenken, das wir längst überwunden glaubten, mitbestimmt ist, müsste zu denken geben.
KAPITEL 1
Friedrich der Große als Trendsetter: Neue Orientpolitik und osmanenfreundliche Gesinnung
Der roi philosophe blickt kritisch auf die Instrumentalisierung der Religion – auch im Orient
Unter den Herrschern seiner Zeit hatte sich Friedrich II. von Preußen dem aufklärerischen Vernunft- und Toleranzpostulat in besonderem Maße verschrieben. Seine Selbstverpflichtung zu religiöser Toleranz änderte aber nichts daran, dass er von Religionsvertretern, gleich welcher Couleur, grundsätzlich wenig hielt. Dieser Umstand sollte auch nicht ohne Einfluss auf das Orientbild des Preußenkönigs bleiben, der für die künftige Entwicklung Deutschlands in vielerlei Hinsicht die Weichen stellte – nicht zuletzt auch durch seine auf eine Annäherung an das Osmanische Reich abzielende Orientpolitik. Dass die, wie sich zeigen wird, von Ambivalenz geprägte Orientwahrnehmung Friedrichs des Großen im Gegensatz zu seiner meist gut dokumentierten Orientpolitik bis heute weitgehend unbeachtet geblieben ist, erstaunt umso mehr, als der islamische Osten auch in friderizianischer Zeit ein maßgebender Machtfaktor in Europa und somit auch für Deutschland politisch von entscheidender Wichtigkeit war: Denn die Türken hielten damals nicht nur den Balkan, sondern auch Teile der heutigen Ukraine besetzt, so dass sich das Osmanische Reich bis an die Grenzen zu Polen und zum Habsburgerreich erstreckte. Ein Großteil der Mittelmeerküste war in osmanischer Hand.
Auch diese geopolitische Konstellation dürfte ein Grund für die damalige Beliebtheit jener meist fiktiven Reisebeschreibungen und Abenteuererzählungen gewesen sein, in denen der Held die Mittelmeerländer und den Orient bereist. Auch der junge Friedrich gehörte zu den begeisterten Lesern von Fénelons Telemach,1 den die Suche nach seinem noch nicht aus dem Trojanischen Krieg heimgekehrten Vater Odysseus auch in orientalische Gefilde führt. Vor allem die farbenprächtige Schilderung der Schauplätze hatte es dem damals Neunjährigen angetan – einmal die dort beschriebenen Mittelmeerländer zu bereisen soll einer seiner sehnlichsten Wünsche gewesen sein. Dass die Abenteuer des Odysseus-Sohnes bei dem preußischen Kronprinzen einen derart nachhaltigen Eindruck hinterließen, resultierte wohl nicht zuletzt auch daher, dass ihm der Vater das Reisen selbst in späteren Jahren verwehrte.2
Auffallend ist die besondere Affinität, die Friedrich zu jenen zeitgenössischen Literaten empfand, mit denen er gerade auch bezüglich der Sicht auf die islamische Welt eine gemeinsame Sprache zu sprechen schien. Zu nennen sind hier vor allem zwei Mitglieder der legendären »Tafelrunde von Sanssouci«: der große französische Aufklärer Voltaire und der französische Schriftsteller und Philosoph Marquis d’Argens, die Friedrich beide zu sich an den Hof holte. Während Voltaire, der den wiederholten Einladungen des Preußenkönigs erst im Juli 1750 folgte und dem Gastland keine drei Jahre später für immer den Rücken kehrte, weilte d’Argens vom Winter 1741/42 an über ein Vierteljahrhundert am preußischen Hof, wo er als Kammerherr des Königs und Direktor der Historisch-philologischen Klasse der Berliner Akademie der Wissenschaften wirkte und zu den intimsten Vertrauten Friedrichs des Großen gehörte.
Das enge Band zwischen dem Preußenkönig und seinen beiden französischen Günstlingen beruhte offenkundig auch auf der grundsätzlichen Ablehnung jeder politischen Instrumentalisierung von Religion sowie dem Abscheu gegen jegliche Form religiösen Fanatismus, der häufig an Figuren von Religionsverkündern oder Priestern festgemacht wurde. Erst vor diesem Hintergrund wird das Verhältnis Friedrichs des Großen zum Islam verständlich. Schon in seiner Kronprinzenzeit teilte er nur bedingt die in Europa damals weitverbreitete Neigung, Orient mit Despotismus gleichzusetzen, wovon nicht zuletzt sein 1739 verfasster Anti-Machiavell zeugt, in dem der preußische Thronfolger die staatspolitischen Grundsätze des italienischen Staatsmannes und Philosophen widerlegte und für eine freiheitliche, von den Prinzipien aufgeklärter Humanität geleitete Herrschaft plädierte. Was die Herrschaftsverhältnisse im Orient anbelangte, so reichte Friedrich das Vorhandensein eines despotischen Regierungssystems als alleinige Erklärung für das politische Überleben der islamischen Reiche nicht aus. Machiavelli sähe, kritisierte er im vierten Kapitel seiner polemischen Schrift,
die Dinge nur von einer Seite an: er hält sich lediglich an die Verfassung der Regierungen und scheint zu glauben, die Macht des türkischen und persischen Reiches beruhe nur auf der Oberherrlichkeit eines einzelnen Hauptes über knechtlich unterjochte Völker, weil er nur die Vorstellung eines festgegründeten, uneingeschränkten Despotismus kennt, als des sichersten Mittels für einen Fürsten, ungestört zu herrschen und seinen Feinden kraftvoll zu widerstehen.3
Der preußische Thronfolger war der Überzeugung, dass noch weitere, nicht weniger entscheidende Faktoren zum Machterhalt der muslimischen Herrscher beigetragen hatten, den er vor allem auch auf die orientalische Mentalität zurückführte:
Von jeher erkannte man als die Seele der orientalischen Menschheit den Sinn der Beharrung bei der Lebensweise und den Sitten der Vorzeit, wovon sie niemals abgeht.4
Außerdem war Friedrich der Auffassung, dass die islamische Religion diese Traditionsverbundenheit noch verstärkte:
Ihre Glaubenslehre, eine andere als die der Europäer, verpflichtet sie obendrein, niemals eine Unternehmung von sogenannten Ungläubigen zum Nachteil ihrer angestammten Herren zu begünstigen und gewissenhaft jeglichen Eingriff in ihren Glauben, jeglichen Umsturz ihrer Regierung zu verhüten.5
Auch schien ihm die Macht islamischer Potentaten weniger in der Religion selbst begründet als vielmehr in deren politischer Instrumentalisierung. Und zwar vor allem in dem Umstand, dass die muslimischen Völker absichtlich im Zustand politischer wie religiöser Unaufgeklärtheit gehalten würden:
Auf diese Weise sichert die Sinnlichkeit ihrer Glaubensvorstellungen und die Unwissenheit, die nicht zuletzt sie so unverbrüchlich an ihren alten Sitten festhalten läßt, den Thron ihrer Herren wider die Begehrlichkeit der Eroberer. Ihre Denkweise verbürgt zuverlässiger die Dauer ihrer mächtigen Monarchie als ihre Staatsleitung.6
Für allmächtig gegenüber ihren Untertanen hielt der Verfasser des Anti-Machiavell die türkischen Sultane indessen nicht, weil sie – wie einst etwa die römischen Kaiser von ihren Prätorianern – viel zu sehr von ihrer Militärelite abhingen. Und in ebendieser Abhängigkeit sah er auch den Grund dafür, dass sie der politischen Entwicklung in Europa weit hinterherhinkten:
Die Türkischen Kaiser sind nur darum dem Erdrosseln so sehr ausgesetzt, weil sie diese [europäische] Staatskunst noch nicht einzuführen verstanden haben. Die Türken sind Sklaven des Sultans, und der Sultan Sklav der Janitscharen. Im christlichen Europa aber muß ein Fürst alle Stände seiner Unterthanen gleich gut behandeln, ohne solche Unterschiede zu machen, die einen Neid erregen würden, welcher ihm selbst fürchterlich werden könnte.7
Der islamische Prophet – ein »Betrüger«
Während Voltaire, mit dem der Kronprinz seit 1736 einen regen Briefwechsel pflegte, das auf Französisch verfasste Manuskript des Anti-Machiavell redigierte,8 las und kommentierte Friedrich dessen im Entstehen begriffene Tragödie Mahomet, deren zum Teil mehrfach überarbeitete Akte der Schriftsteller ihm regelmäßig übersandte. Seine Begeisterung für das Stück wurde noch zusätzlich angefacht, als ihm Voltaire bei ihrer ersten persönlichen Begegnung, die wenige Monate nach Friedrichs Herrschaftsantritt auf Schloss Moyland bei Kleve stattfand,9 das noch nicht vollendete Drama vortrug.
Er [Voltaire] hat uns Mahomet I deklamiert, eine seiner bewunderungswürdigen Tragödien; wir waren außer uns vor Entzücken, und ich konnte ihn nur bewundern und schweigen,10
schwärmte der junge König gegenüber seinem Vertrauten Charles Jordan, und man darf wohl annehmen, dass er die prophetenfeindliche Einstellung des französischen Aufklärers teilte. Seine Geringschätzung gegenüber dem islamischen Propheten unverblümt zum Ausdruck bringen sollte der preußische Monarch aber erst in seinem in den vierziger Jahren verfassten und später immer wieder überarbeiteten historischen Werk Geschichte meiner Zeit, das allerdings erst nach Friedrichs Tod erschien und wo zu lesen steht:
(…) Mohammed war nicht fromm, sondern nur ein Betrüger, der sich der Religion bediente, um sein Reich und seine Herrschaft zu begründen.11
Den Religionsstifter des Islam als Betrüger und falschen Propheten zu diffamieren war im Deutschland der Aufklärung eine gängige Haltung, die sich bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts hielt.12 Dazu beigetragen hatte nicht zuletzt auch die 1697 veröffentlichte, ganz in der Tradition antiislamischer Konfrontationstheologie stehende Muhammad-Biographie des englischen Geistlichen Humphrey Prideaux.13 Diese extrem islamfeindliche und äußerst wirkungsvolle Schrift, die nur ein Jahr später in französischer Sprache herausgegeben wurde,14 hatte offenbar auch in Deutschland so viel Aufsehen erregt, dass 1699 in Leipzig gleich zwei deutsche Übersetzungen erschienen – die eine unter dem programmatischen Titel: Constantinopolitan[ischer] oder Türckischer Kirchen-Staat, in welchem die vornemste Glaubens-Puncten des Alcorans, wie nicht weniger der gantze mahometanische Gottesdienst nebst des falschen Propheten Mahomets Leben in einer Erzehlung vorgestellet wird.15
Friedrich dürfte Prideaux’ gehässiges Pamphlet, das als eine der Hauptquellen von Voltaires Mahomet gilt,16 gekannt haben, zumal er nachweislich im Besitz des Bayleschen Dictionnaire historique et critique17war, wo dem Leser die Lektüre von Prideaux’ Werk, auf dem Bayles Artikel über den Propheten des Islam basierte, wärmstens empfohlen wurde.18 Dass der preußische Monarch den französischen Philosophen und Schriftsteller außerordentlich schätzte, ist weithin bekannt, und so leuchtet es ein, dass er dessen 1697 herausgegebenes Historisches und kritisches Wörterbuch häufig frequentierte. Darauf zumindest deutet die Notiz des Historikers Bogdan Krieger, der in seiner 1913 erschienenen systematischen Einteilung der Bücher Friedrichs des Großen zu dem Nachschlagewerk vermerkte: »scheinbar vom König viel benutzt, mit vielen Lesezeichen und Hinweiszetteln«.19
Tatsächlich liefert Bayles »Mahomet«-Artikel einen weiteren Anhaltspunkt für den religionskritischen Gesamthintergrund des Muhammad-Bildes von Friedrich und Voltaire. Denn der Vorwurf der Gewalt trifft dort nicht nur den islamischen Propheten, sondern auch die christlichen Kirchen.20 Und für Kirchenmänner hatte der Preußenkönig ja bekanntlich generell nicht viel übrig. Er hielt sie nicht nur für machtbesessen und somit politisch gefährlich, sondern auch für geldgierig. Seine Schriften strotzen geradezu vor entsprechenden Äußerungen, und schon in seiner Kronprinzenzeit hatte Friedrich aus seiner Geringschätzung des Klerus kein Hehl gemacht. Davon zeugen etwa die folgenden Zeilen aus Kapitel 26 seines Anti-Machiavell, wo er ausdrücklich auch vor Religionskriegen warnt:
Die weltliche Regierung mit Kraft emporhalten, Jedermann Gewissensfreiheit zugestehn, stets König sein und nie den Priester machen: Dies sind die wahren Mittel, den Staat vor den Stürmen sicher zu erhalten, welche der dogmatisierende Geist der Theologen beständig zu erregen sucht.21
Voltaires islamfeindliches Theaterstück Mahomet findet Beifall am preußischen Hof
Es war nicht zuletzt die ihnen eigene Art der Kleruskritik, die den Preußenkönig und den französischen Aufklärer zu Geistesverwandten machte, wozu der Briefwechsel über Voltaires Mahomet wesentlich beitrug. Am 10. April 1741 in Lille uraufgeführt, sollte das Stück trotz seines triumphalen Publikumserfolgs nach nur wenigen Vorstellungen in Paris im August 1742 wieder abgesetzt werden. Kirchliche Würdenträger, vor allem Jansenisten, warfen dem Verfasser vor, sein Angriff sei in Wirklichkeit nicht gegen den islamischen Propheten, sondern gegen Jesus Christus, also gegen die christliche Kirche, gerichtet.
Schauplatz des Trauerspiels ist Mekka, aus dem Mahomet einst von Scheich Zopire als Unruhestifter und Betrüger verbannt wurde. In Medina mittlerweile als Prophet anerkannt, will er nun in seine Geburtsstadt zurückkehren und unterbreitet Zopire mehrere großzügige Friedensangebote, die der Herrscher von Mekka jedoch allesamt ablehnt. Er sieht in Mahomet, den er auch für den Tod seiner beiden Kinder verantwortlich macht, nach wie vor nur einen skrupellosen Machtmenschen, der mit brutaler Gewalt dem Volk seine Lehre aufzuzwingen versucht. Weil sich der Scheich nicht umstimmen lässt, beschließt der Prophet, ihn zu beseitigen, wobei er sich ohne Skrupel seines ihm völlig ergebenen Sklaven Séide bedient. Unter Berufung auf den Willen Gottes wird Séide, der gleichzeitig auch Mahomets Nebenbuhler bei der von dem Propheten begehrten Sklavin Palmire ist, befohlen, Zopire zu töten. Nach langem Zögern führt Séide die schreckliche Tat schließlich aus. Nachdem sich herausstellt, dass Zopire in Wirklichkeit sein und Palmires Vater ist, wendet sich Séide gegen den Propheten, wird aber von dessen Heerführer Omar vergiftet. Séides Gifttod wird von dem Propheten als Gottesgericht hingestellt, und die Mekkaner bekennen sich zu ihm. Als aber Palmire daraufhin mit der Waffe des Bruders Selbstmord begeht, steht der islamische Prophet am Ende als »betrogener Betrüger« da.22
Das Stück kann gleichermaßen als allgemeine Kritik am machtpolitischen Missbrauch von Religion gelesen werden wie als gezielte Attacke gegen den Religionsstifter des Islam.23 Als Betrüger sah diesen bekanntlich auch Friedrich an. So ist es nur konsequent, dass er von Voltaires Tragödie begeistert war, zumal sie ihn in seiner Meinung über Priester und Propheten aller Art zu bestätigen schien. Beim Lesen habe er gedacht »weinen zu müssen«, schrieb Friedrich im Oktober 1739 ergriffen an Voltaire, der ihm zwei neue »Zopire-Akte« übersandt hatte. Er pries vor allem auch jene Szene als »exquisit«, die den islamischen Propheten noch einmal der Lüge überführt, indem er vorgibt, Séides Mord an Zopire, zu dem er ihn angestiftet hat, zu verdammen.
Spätestens jetzt hegte der preußische Kronprinz wohl keinerlei Zweifel mehr, in dem französischen Denker wahrhaftig einen Gesinnungsgenossen gefunden zu haben – jedenfalls ließ er im gleichen Brief alle Hemmungen fallen und schimpfte Moses einen »jüdischen Hochstapler«. Auch mussten sich Friedrichs Vorstellungen von den Lebensgewohnheiten der Muslime, zumindest was ihre Darstellung in dem Trauerspiel anbelangte, im Wesentlichen mit denen Voltaires gedeckt haben, lobte er den Dichter an gleicher Stelle doch für seine hervorragende »Veranschaulichung von Sitten«.24 Dass Friedrichs Bewunderung für das Stück mit jeder weiteren Lektüre wuchs, offenbart auch sein vom März 1740 datierender Brief an den französischen Philosophen, in dem er enthusiastisch erklärte, dass der Mahomet, den er bewundere, so fanatisch er auch sei, seinem Verfasser viel Ehre einbringen werde.25
Marquis d’Argens – noch ein islamkritischer Gesinnungsgenosse des Preußenkönigs
Dieser Grundkonsens in Sachen Religions- und Kleruskritik hat wohl mit den Ausschlag gegeben, dass Friedrich sich beharrlich bemühte, Voltaire zu sich zu holen. Jener dürfte auch die enge Verbundenheit des Preußenkönigs mit dem französischen Schriftsteller Marquis d’Argens begründet haben, den er – noch vor Voltaire – an seinen Hof lud und im Winter 1741/42 zu seinem Kammerherrn machte.26 Maßgeblich hierfür sollen nicht zuletzt d’Argens’ Jüdische Briefe gewesen sein, deren Lektüre Friedrich schon in seiner Kronprinzenzeit tief beeindruckt hatte.27 In Form einer fiktiven Korrespondenz zwischen einem durch verschiedene Länder Europas reisenden Juden aus Konstantinopel und seinen beiden jüdischen Briefpartnern werden hier politische, kulturelle, religiöse und philosophische Fragen der Zeit verhandelt. Es war wohl vor allem der deutlich antiklerikale Unterton des an die Tradition des pseudo-orientalischen Briefromans anknüpfenden Werks, mit dem Friedrich sich besonders identifizierte.28
Orient und Okzident treffen auch in den fiktiven Memoiren des als Ahmed Pascha bekannten Claude Alexandre de Bonneval aufeinander. Der dem Marquis d’Argens zugeschriebene pseudo-historische Roman29 widmet sich einer der schillerndsten Figuren der Zeit30. Nach einer glänzenden militärischen Laufbahn in Europa wegen seiner Ausschweifungen mehrfach zum Tode verurteilt, begnadigt und schließlich verbannt, bot der französische Offizier seine Dienste den Osmanen an und ließ sich in Konstantinopel nieder. Bonneval trat zum muslimischen Glauben über und machte schon bald als militärischer und politischer Berater bei der Pforte Karriere. Der französische Konvertit wurde zum Wegbereiter einer Politik, die auf eine grundlegende Veränderung der europäischen Mächtekonstellation abzielte,31 und zwar nicht zuletzt auch durch eine Annäherung Konstantinopels an Preußen – nicht unähnlich den Bestrebungen Friedrichs des Großen, der Bonnevals Werdegang nachgewiesenermaßen kannte32 und bald als erster deutscher Monarch die Osmanen in das strategische Kalkül seiner innereuropäischen Expansionspolitik einbeziehen sollte.
Doch noch einmal zurück zu den Jüdischen Briefen, die keinen Zweifel daran lassen, dass ihr Urheber die Priester aller drei Offenbarungsreligionen als Betrüger zu entlarven trachtete. Das hohe Ansehen der Mönche, heißt es da, rühre her aus »Heucheley und Betrug«, wobei d’Argens ihren Einfluss darauf zurückführte, dass das »Volk«, der »schwache Pöbel«, »aller Orten gleich leichtgläubig« sei. Dieser Umstand träfe auch auf die »Mahometaner« zu, die ihren »Heiligen und Dervisen« eine »knechtische Ehrfurcht« entgegenbrächten.33
Solche Sätze, in denen auch die zeitgenössische Vorstellung von der devoten Unterwürfigkeit der Orientalen mitschwingt, hätten ohne weiteres auch von Friedrich selbst stammen können. Allerdings war, was die Kenntnis über den islamischen Orient anbelangte, der Marquis seinem königlichen Gönner wohl weit überlegen, da er nicht nur über literarische, sondern auch über reale Orienterfahrung verfügte. In den Jahren 1723/24 hatte nämlich der junge d’Argens als Sekretär des französischen Gesandten Marquis d’Andrezel eine Reihe arabischer Länder am Mittelmeer bereist und sich auch etwa ein halbes Jahr in Konstantinopel aufgehalten.34 Sein aus konkreter Erfahrung resultierendes Wissen über den osmanischen Orient dürfte der preußische Monarch ebenso geschätzt haben wie die von ihm offensichtlich von einem nahen Vertrauten fast schon erwartete Respektlosigkeit gegenüber Religionsvertretern und religiösen Tabus. Und dass d’Argens in Bezug auf den islamischen Osten offenbar beides auf besonders schrille Weise zu verbinden verstand, hatte sein Ansehen bei seinem preußischen Herrn wohl nur noch weiter gesteigert.
Ein Indiz dafür könnte die folgende, gleichermaßen kuriose wie bezeichnende Anekdote sein, die Friedrichs Französisch-Lektor Dieudonné Thiébault in seinen Erinnerungen Friedrich der Große und sein Hof35 über d’Argens zu erzählen wusste:
Kaum in Konstantinopel angekommen, beschloß er, in einer der Moscheen einem mohammedanischen Gottesdienste zuzusehen, vergeblich stellte man ihm vor, wie gefährlich ein solches Unternehmen wäre, denn wenn er entdeckt wurde, konnte er dem Tode nur dadurch entgehen, daß er den Turban nahm. Er bestach den Thürhüter der prachtvollen Hagia Sophia und machte mit ihm ab, daß er ihn beim nächsten großen Fest nachts einlassen und hinter einem großen Gemälde, im Hintergrunde der Tribüne, die sich gerade über dem Eingange befindet, verstecken sollte. Diese Tribüne war ein ziemlich sicherer Ort für den Marquis, weil sie für gewöhnlich verschlossen gehalten wurde. (…)
D’Argens sah also von seinem Platz aus ziemlich bequem alle Zeremonien der türkischen Religion mit an, aber sein Führer stand dabei große Furcht aus. Der französische Tollkopf konnte natürlich nicht ruhig in seinem Versteck bleiben, sondern trat jeden Augenblick mitten auf die Tribüne, um die Vorgänge in der Moschee besser sehen zu können. Der arme Türke schwitzte dabei vor Todesangst und beschwor hinter seinem großen Gemälde hervor den Marquis mit den ausdrucksvollsten Gebärden und Bewegungen, er möchte sich doch wieder zurückziehen. Die Angst des Muselmanns machte dem Malteserritter nur um so mehr Spaß, und veranlaßte ihn zu immer neuen Unvorsichtigkeiten.
Während der Gottesdienst in vollem Gange war, zog er plötzlich aus seiner Tasche eine Flasche Wein und ein Stück Schinken und begann in aller Gemütsruhe zu essen und zu trinken. Der Jünger Mahomeds war in Verzweiflung, aber was wollte er machen? Er mußte alles dulden, um nicht entdeckt und mit dem Tode bestraft zu werden. Er mußte sogar auf Verlangen des Marquis, der ihm drohte, er würde sich im Weigerungsfalle den Gläubigen in der Moschee zeigen, von dem Wein trinken und vom Schinken essen, und auf diese Weise seinen Glauben verletzen und den heiligen Ort entweihen. Der arme Kerl war eine Zeitlang wie versteinert; er glaubte, das Schwert seines Propheten hinge über seinem Haupte und müßte jeden Augenblick herabfallen. Als er aber sah, dass ihm nichts geschah, beruhigte er sich allmählich; er fand sogar Geschmack an seiner Sünde und als er endlich mit seinem Christenhund allein war, wurde das Frühstück in bester Laune zu Ende gebracht; man lachte über die überstandene Gefahr und trennte sich in gutem Einvernehmen.36
Auch wenn der Wahrheitsgehalt von Thiébaults Hofanekdoten immer wieder in Frage gestellt wurde, gibt es wenig Grund, daran zu zweifeln, dass diese infame Geschichte, die das aus Sicht des Protagonisten rigide Festhalten der Muslime an ihren Gebetsvorschriften verhöhnt, von d’Argens selbst stammte. Zumal er in seinen 1735 erschienenen Memoiren berichtete, während seines Aufenthalts in Konstantinopel die Türken beim Weintrinken und beim Verzehr von Schweinefleisch aufmerksam studiert zu haben.37 Auch wurde die Moschee-Anekdote in der Einleitung zu der neuen, posthum erschienenen Ausgabe der Erinnerungen des Marquis in voller Länge zitiert,38 was wiederum darauf schließen lässt, dass man ihm einen solchen Husarenstreich zumindest zutraute.
Tatsächlich verwies d’Argens in einem Brief an den König vom Juni 1761 mit einer so hintergründigen Ironie auf seine Moscheebesuche in Konstantinopel, dass man durchaus geneigt sein könnte, den Bericht über seine blasphemische Eskapade für wahr zu halten. Der nach mehrwöchiger Abwesenheit gerade nach Potsdam zurückgekehrte Marquis wunderte sich nämlich darüber, dass Zeitungsberichten zufolge ein muslimischer Gesandter den Preußenkönig in seinem Feldlager39 besucht hatte, und bezweifelte die Richtigkeit dieser Nachricht, weil doch
Ew. Majestät mir nicht ein Wort von diesem muselmännischen Gesandten sagen, ob ich gleich die Ehre habe, ein starker Anhänger des Heiligen Muhammed zu sein, und mit exemplarischer Devozion die sieben kaiserlichen Moskeen in Konstantinopel besucht habe.40
Worauf die Bemerkung »mit exemplarischer Devozion« anspielte, dürfte dem Empfänger geläufig gewesen sein.
Beißender Sarkasmus, wenn die Rede auf religiöse Bräuche oder Institutionen kam, scheint auch im engen Zirkel um Friedrich geherrscht zu haben, was selbst dem religiösen Autoritäten alles andere als freundlich gesinnten Voltaire auffiel. So sei der König von Preußen, wie er später in den Memoiren über seine Zeit am preußischen Hof zu Protokoll gab, »stets bei der Hand« gewesen, »wenn es galt, über Mönche und Prälaten herzufallen«.41 Gott sei zwar von dem beißenden Spott und der Verachtung, mit denen man an der Tafelrunde Friedrichs des Großen über den Aberglauben der Menschen so frei wie »nirgends auf der Welt« gesprochen habe, ausgenommen gewesen, »aber von denen, die in seinem Namen die Menschen getäuscht hatten, blieb keiner verschont«.42
Neue Pfade: Friedrich II. sucht Verbündete im Orient und betreibt muslimfreundliche Medienpolitik
Außerhalb der Hofgesellschaft war von dieser Freiheit hingegen wenig zu spüren. Hier waren strenge Grenzen gesetzt, vor allem dann, wenn es um öffentliche Äußerungen über mögliche muslimische Bündnispartner im Orient ging. Das galt insbesondere für die Presseberichterstattung über die öffentliche Inszenierung sich gerade im Land aufhaltender Vertreter islamischer Herrscher, die der Preußenkönig nunmehr für seine außenpolitischen Ambitionen einzuspannen suchte. Bis zum Ende der vierziger Jahre hatte für ihn kein Anlass bestanden, die Pforte oder die mit Russland verfeindeten Krimtataren als Bündnispartner in sein politisches Kalkül mit einzubeziehen. Friedrich, der im Zuge seiner Expansionsbestrebungen im Ersten Schlesischen Krieg (1740–1742) den Habsburgern Schlesien entrissen hatte, konnte diesen territorialen Gewinn auch im Zweiten Schlesischen Krieg (1744–1745) erfolgreich verteidigen. Allerdings hatte sein Vorstoß nach Osten zu nachhaltigen Irritationen innerhalb des europäischen Mächtegefüges geführt, zumal der Preußenkönig damit nicht nur den direkten Verlierer Österreich provoziert hatte, sondern auch Russland, das die von Preußen eroberten Gebiete zu seiner Einflusssphäre zählte. Und so musste er damit rechnen, dass sich Habsburger und Russen gegen ihn verbündeten.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Friedrich die beiden Großmächte mit einer Intensivierung der Beziehungen Preußens zu Konstantinopel keinesfalls verärgern wollen, weshalb er auch den Handels- und Allianzvertrag, um den sich die Türken in den Jahren 1747/48 bemüht hatten, abgelehnt hatte – an mehr als einer »guten Freundschaft« war ihm bis dahin nicht gelegen. Als sich 1749 jedoch die Gefahr eines gemeinsamen Angriffs von Russland und Österreich auf Preußen zusammenbraute, wendete sich das Blatt. Nun setzte Friedrich, der auf eine türkisch-preußische Militärallianz spekulierte, alles daran, die bestehenden Verbindungen zur Pforte zu vertiefen. Auch machte der preußische Monarch aus seinen Bündnisbestrebungen mit den muslimischen Gegnern seiner Widersacher kein Geheimnis. Im Gegenteil, zu Demonstrationszwecken setzte er gezielt auf wirkungsvoll inszenierte öffentliche Auftritte muslimischer Gesandter oder prominenter Besucher.43
So geriet im März 1749 auch der Besuch des gerade in Potsdam weilenden türkischen Janitscharenrittmeisters Said Effendi zu einer politischen Demonstration. Preußen befand sich in jenen Tagen außenpolitisch in einer äußerst prekären Lage, da ein Einmarsch der Russen im verbündeten Schweden unmittelbar bevorzustehen schien. Friedrich, der fürchtete, dass ein solcher einen gemeinsamen Angriff von Russland und Österreich auf Preußen nach sich ziehen könnte, ließ nichts unversucht, um die drohende Kriegsgefahr zu bannen: von der Sicherung der Unterstützung seines Verbündeten Frankreich über die Zusage der Nichteinmischung weiterer Nachbarländer bis hin zur Truppenmobilisierung an den östlichen Grenzen des Landes. In seiner Not ging der König nun auch auf den Vorschlag seines Verbündeten Frankreich ein, sich als Fürsprecher bei der Pforte zu verwenden, um sie dazu zu bewegen, Preußen im Kriegsfall durch einen Angriff auf Russland oder Österreich zu unterstützen.44
In dieser kritischen Situation kam Friedrich die Ankunft des türkischen Janitscharenrittmeisters wie gerufen, zumal zu jener Zeit auch noch der neue russische Gesandte von Gross in Berlin eintreffen sollte.45 Dem Türken, der lediglich in die Stadt gekommen war, um Pferde zu verkaufen – türkische Pferde waren damals beim Militär äußerst begehrt –, wurden so unverhofft königliche Ehren zuteil: Nicht nur, dass der preußische Monarch den muslimischen Besucher öffentlich auszeichnete, er ließ ihn tags darauf auch noch zum Kaffee bitten und am Abend zu dessen Unterhaltung ein »Intermezzo von einem türkischen Seeräuber« aufführen.46
Nicht lange nach dieser ostentativen Gunstbezeugung bevollmächtigte Friedrich im Mai 1749, als die Zeichen erneut auf Krieg standen, den französischen Gesandten in Konstantinopel, Graf Desalleurs, im Namen Preußens mit dem Diwan über ein Verteidigungsbündnis zu verhandeln. Dieses sollte sich ganz allgemein »wider benachbarte Puissances, von denen man Feindseligkeiten zu gewärtigen hat«,47 richten. Nach langen wechselvollen Verhandlungen traf im Juli des darauffolgenden Jahres in Berlin schließlich die Nachricht ein, dass sich die Pforte auf ein Bündnis mit Preußen nicht einlassen wollte. Damit waren Friedrichs Hoffnungen auf eventuelle gemeinsame militärische Aktionen mit den Türken erst einmal zerstoben – er gab sie aber keineswegs auf. Desalleurs, der von Friedrich auch mit einer nicht unerheblichen Summe für Bestechungsgelder ausgestattet worden war – die Rede war von 20.000 bis 30.000 Talern48 –, hatte damals übrigens durchblicken lassen, dass die preußisch-türkische Allianz nicht zuletzt an der »Sparsamkeit des Königs von Preußen«49 gescheitert war.50
Angesichts dieses Misserfolgs kam Friedrich die Ankunft des tatarischen Gesandten Mustapha Aga, der kurz darauf in Berlin eintraf, mehr als gelegen. Der Tatarenoberst war im Auftrag des Großkhans der Krimtataren und dessen Bruders, des Sultans von Budziak, unter einem Vorwand gekommen, um sich ein Bild über die Lage zwischen Preußen und Russland zu verschaffen. Er überbrachte dem preußischen Monarchen nicht nur die Freundschaftsversicherungen der beiden Machthaber, sondern auch ihr Anerbieten, Preußen im Falle eines russischen Angriffs »gegen Geldvergütung«51 mit Truppen zu unterstützen. Friedrich nutzte die Gelegenheit, um seine Gegner mit der Aussicht auf eine preußisch-tatarische Allianz in Unbehagen zu versetzen. »Es ist mir gar nicht leid«, schrieb er von Potsdam am 24. Juli 1750 an seinen für außenpolitische Angelegenheiten zuständigen Etatsminister Heinrich von Podewils in Berlin,
dass diese Schickung und die Ankunft dieses tartarischen Officiers etwas Lärm und gewissen Leuten Inquiétudes machet. Daher er auch, wenn Ich nach Berlin komme, denselben Mir nur publiquement oben bringen und präsentiren soll (…)52
So kam der Tatare nicht nur zu dem Privileg einer fast einstündigen Audienz beim König, sondern wurde auch noch demonstrativ in Anwesenheit der sich am Hof aufhaltenden Gesandten in dessen Kabinett geführt.53
Allerdings war Friedrich über den Umstand, dass die Berliner Gazetten von diesen Ereignissen nicht gebührend Notiz nahmen, dermaßen verärgert, dass er Anfang August in einer Kabinettsorder die sofortige Einsetzung eines neuen Zensors verfügte. Zur Begründung hieß es darin, dass die Zeitungsschreiber »allerhand anstößige und impertinente in publique affairen einschlagende Dinge mit einlauffen« ließen, »wie solches die exempel wegen des Tartarischen Emisaire und was sonsten unvernünfftiger weise ohnlengst, wegen der Turckischen Nation bey Gelegenheit des Said Effendi eingefloßen« beweisen würden.54 Den Zorn des Monarchen hatte wohl nicht nur die Tatsache entfacht, dass die Berlinischen Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen55 den Besuch des türkischen Janitscharenrittmeisters Said Effendi und dessen öffentliche Würdigung ignoriert hatten. Die Zeitung, die für gewöhnlich regelmäßig über das Geschehen im Osmanischen Reich berichtete, und zwar in einem auffallend sachlichen Ton, hatte zu allem Überfluss auch noch kurze Zeit später einen alles andere als osmanenfreundlichen Artikel veröffentlicht.
Er enthielt einen vom Herbst des Vorjahres stammenden Bericht eines christlichen Pilgers aus Bethlehem, der einen Fall religiöser Verfolgung von Christen im osmanisch beherrschten Syrien schilderte, der sich im Jahr 1747 zugetragen hatte. Um die katholische Gemeinde in Damaskus in Misskredit zu bringen, hatte ein dort lebender Grieche ihre Priester beim osmanischen Provinzgouverneur denunziert und behauptet, sie hätten die Messe in grüner Bekleidung verrichtet, einer Farbe, die »im gantzen Türckischen Reiche verboten, und niemanden, als den Nachkommen des Mahomets, zu tragen erlaubt« sei. Einer der Geistlichen wurde daraufhin ins Gefängnis geworfen und konnte erst nach langer Zeit »mit vielem Gelde, und recht grosser Mühe, erlöset« werden. Zudem hatten die »Türckischen Einwohner« von Damaskus den Bau einer vom Pascha bereits genehmigten Kirche mit einem derartigen »Tumult« sabotiert, dass man »genöthiget ward, nicht nur den Bau einzustellen, sondern auch eine gute Summa Geldes zu opfern, um die unruhigen Gemüther zu besänftigen«.56
Auch dem Besuch des tatarischen Gesandten Mustapha Aga schenkte die Zeitung zunächst kaum Aufmerksamkeit und erwähnte ihn nur beiläufig in ihrer Ausgabe vom 28. Juli. Dieses Mal allerdings musste sie ihr Versäumnis umgehend wiedergutmachen. Nur zwei Tage später entschuldigte sie sich, diesem Ereignis lediglich »Erwehnung gethan« zu haben, und rechtfertigte die Unterlassung damit, dass »man davon nicht recht unterrichtet gewesen« sei. Auch in den nächsten Ausgaben widmete sich das Blatt eingehend dem Tataren, der wie ein Staatsgast behandelt und herumgereicht wurde. Am 1. August etwa wurde die Leserschaft unter anderem darüber unterrichtet, dass der tatarische Oberst zwei Abende zuvor einem Konzert der Königlichen Kapelle im Sommer-Palais Monbijou der Mutterkönigin beigewohnt und darüber ein »ungemeines Vergnügen zu erkennen« gegeben habe.57 Offensichtlich sollte mit der ausführlichen Berichterstattung über den Aufenthalt des tatarischen Gesandten der Eindruck vermittelt werden, dass die Krimtataren nicht weniger hoch in der Wertschätzung des Königs stünden als die mit Preußen befreundeten europäischen Nachbarn.
Die wohlwollende Darstellung des Tatarenoberst dürfte Friedrich umso notwendiger erschienen sein, als dem muslimischen Besucher von Seiten der Hofgesellschaft wohl nicht immer der gebührende Respekt entgegengebracht wurde. Seine Empörung über dieses Verhalten schlug sich auch in den folgenden Versen der vermutlich im Winter 1750/51 verfassten Epistel An General Bredow. Über den Ruhm nieder, in der er beklagte, dass über Ruhm und Ansehen der Menschen selten Vernunft, sondern meist Dummheit entscheiden würde. Als erstes Beispiel für diesen unseligen Umstand führte er das Verhalten seiner Höflinge beim Besuch des tatarischen Gesandten an:
Aus Oczakow entsandte einst der Khan
Mustapha nach Berlin. Als wir ihn sahn,
Da reizten Bart und Kaftan unser Lachen.
Die Höflinge, die stets gern Witze machen
Und denen Moslims arg verdächtig schienen,
Verhöhnten ihre Sitten, ihre Mienen.
Sogar die Höflichsten verlachten die Tartaren,
Und keiner wußte, daß diese Barbaren,
So sehr auch Kleid und Brauch uns trennen mochten,
Einst China und die Perser unterjochten.58
Preußens mühsame Annäherungsversuche an die Hohe Pforte
Gleichwohl sollten seine Bemühungen um die weitere Intensivierung der Kontakte zu potenziellen muslimischen Bündnispartnern Friedrich zusehends in seiner Meinung bestärken, dass die Orientalen grundsätzlich käuflich seien – zumal der Preußenkönig in den nächsten fast eineinhalb Jahrzehnten notgedrungen Osmanen und Tataren immer stärker in seine Kriegs- und Verteidigungspläne einbeziehen und umwerben und zu diesem Zweck auch erhebliche Geldsummen aufwenden sollte. Mit der Auffassung, dass es vor allem eine Frage des Preises sei, die Gunst der Pforte zu erwerben, stand er im zeitgenössischen Europa keineswegs alleine da. Bestechung als Instrument europäischer Politik gehörte damals zu den diplomatischen Gepflogenheiten am Bosporus. Insbesondere nach dem Scheitern der Verhandlungen seines mit nicht genügend Bestechungsmitteln ausgestatteten französischen Mittelsmanns Desalleurs war Friedrich schnell klar geworden, dass er künftig weitaus tiefer in die Tasche greifen musste, wenn er mit seinen europäischen Gegnern in Konstantinopel konkurrieren wollte.
Allerdings nahm sein Plan, Türken wie Tataren dazu zu bewegen, Preußen durch Militäraktionen gegen seine Widersacher Russland und Österreich zu unterstützen, nur in dem Maße Gestalt an, wie Kriegsgefahr drohte. Die Eckpunkte dieser Strategie hatte Friedrich bereits in seinem 1752 verfassten ersten politischen Testament skizziert. Russland müsste, heißt es da,
während wir im Krieg mit Österreich und Sachsen sind, in einen mit den Türken verwickelt sein, und man müßte dem Wiener Hof so viele Feinde wie möglich auf den Hals ziehen, damit man nicht alle seine Kräfte zu bekämpfen hätte.59
Als er 1756 wegen seiner Annäherung an England nicht nur seinen alten Verbündeten Frankreich, sondern auch noch Schweden an die antipreußische Allianz verlor, setzte der König auf einen Präventivschlag gegen die Habsburger. Der Siebenjährige Krieg, der Preußen zeitweise in Existenzgefahr bringen sollte, brach aus.
Noch vor diesem Vorstoß entsendete Friedrich im Januar 1755 den ersten eigenen Gesandten nach Konstantinopel, nachdem gegen Ende des Vorjahres Desalleurs und kurz darauf auch Sultan Mahmut I. gestorben waren. Wegen seiner Türkeierfahrung wurde Gottfried Fabian Haude mit der Mission betraut und zum außerordentlichen Gesandten ernannt. Der Schlesier war ehemals als Handlungsgehilfe eines Breslauer Kaufhauses, dessen Inhaber die österreichisch-orientalische Handelsgesellschaft in Konstantinopel leitete, an den Bosporus gelangt. Später hatte er in österreichischen Diensten am Türkenkrieg teilgenommen und einige Zeit in osmanischer Gefangenschaft verbracht. Um seine wahre Identität vor der Pforte zu verbergen, erhielt Haude, der nach der Eroberung Schlesiens durch Preußen wieder in die Heimat zurückgekehrt war, den Namen Karl Adolf von Rexin.60
Der erste preußische Abgesandte hatte lediglich den Auftrag, das Terrain zu sondieren und auszukundschaften, ob die Türken prinzipiell für ein Bündnis mit Preußen zu gewinnen waren. Falls der Diwan an dem erst einmal anvisierten Handelsvertrag Interesse bekunden würde, sollte er auch versuchen, ihn zu einem eine Defensivallianz beinhaltenden Freundschaftsvertrag zu bewegen. Obgleich man in Konstantinopel dem Anliegen Preußens nicht grundsätzlich abgeneigt war, lehnte der Sultan einen Vertrag mit dem Preußenkönig ab.61
Als im Jahr 1756 für Preußen erneut akute Kriegsgefahr bestand, unternahm Friedrich einen weiteren Anlauf, mit den Türken über ein Bündnis zu verhandeln. Er schickte seinen Flügeladjutanten Marquis de Varenne an den Bosporus, der im Unterschied zu seinem Vorgänger Rexin die Vollmacht besaß, Verträge abzuschließen. Der neue Unterhändler war auch finanziell deutlich besser ausgestattet, weil, wie Friedrichs für außenpolitische Angelegenheiten zuständiger Kabinettsminister von Podewils konstatierte, »bei der Ottomanischen Pforte nothwendig allerhand Präsente und Corruptiones gemacht werden müssen«.62
Doch auch dieser Versuch lief ins Leere, weil Varenne wegen einer wetterbedingten Unterbrechung des Schiffsverkehrs nie am Bosporus ankam. Als dann auch noch der schwedische Gesandte in Konstantinopel erklärte, dass er dem preußischen Unterhändler jegliche Unterstützung verweigern werde, und der englische Abgesandte ebenfalls auf Distanz ging, trat Varenne Ende Januar 1757 unverrichteter Dinge die Rückreise an. Unterwegs traf er mit Rexin zusammen, den der König inzwischen erneut an die Pforte entsandt hatte. Dort war seit dem Ausbruch des Siebenjährigen Krieges die Lage für den preußischen Unterhändler noch schwieriger geworden, zumal Preußen in Konstantinopel nicht durch eine eigene Gesandtschaft vertreten und auf die Hilfe der diplomatischen Vertreter befreundeter Mächte angewiesen war. Friedrichs einstige europäische Allianzpartner gehörten inzwischen jedoch mehrheitlich zu seinen Kriegsgegnern und hintertrieben Rexins Anbahnungsversuche einer militärischen Kooperation mit den Türken. Die Mission zog sich hin, und Friedrich, der in einer preußisch-türkischen Militärallianz den einzigen Ausweg aus der für Preußen nun aussichtslos scheinenden Lage sah, schrieb Ende Dezember 1758 verzweifelt an Rexin:
Ich muß Euch also im Vertrauen, jedoch auch zugleich ganz natürlich sagen, daß, wenn es nicht geschiehet, daß die Pforte im kommenden Jahre entweder mit den Russen oder mit den Österreichern bricht, als welches Mir einerlei ist, Ich endlich succombieren und über den Haufen gehen muß (…) wenn die Türken still sitzen und in kommendem Jahre nicht agieren, so ist alles vergebens und aus mit uns (…).63
Berlin setzt auf die Käuflichkeit der Osmanen
Ähnlich sorgenvoll sollte sich der König auch in den kommenden Jahren immer wieder äußern, zumal die Bemühungen seines Gesandten in Konstantinopel trotz anfänglich ermutigender Nachrichten letztlich fruchtlos blieben. Vertrauend auf Rexins zunächst vielversprechende Berichte, die sich im Nachhinein jedoch als Fehleinschätzungen erwiesen, war Friedrich offenbar der Überzeugung, die Osmanen als Bündnispartner gewinnen zu können, wenn er in das Allianzprojekt noch mehr Geld investierte. Im Februar 1760 stockte er das Budget seines Gesandten um eine halbe Million Taler auf und entwarf voller Zuversicht einen umfassenden Angriffsplan, der gemeinsame militärische Aktionen mit Türken und Tataren vorsah.64
Die Realität sah freilich anders aus. In Konstantinopel hatte Rexin trotz der von Friedrich für »Corruption« zur Verfügung gestellten Mittel keine wirklichen Fortschritte erzielt. Der König, der nach wie vor alle Hoffnung auf einen kombinierten Angriff mit türkischen und tatarischen Truppen setzte, mahnte seinen Gesandten Ende März 1760 zwar zum vorsichtigen Umgang mit den Bestechungsgeldern und schärfte ihm ein, »das Geld mit einem sicheren und gewissen Effect und so zu sagen Zug um Zug« anzulegen.65 Gleichzeitig unterstrich er jedoch, zusätzlich noch mehrere 100.000 Taler investieren zu wollen, wenn diese sichtbare Ergebnisse zeitigten.66 In dem Glauben, dass ein türkisch-preußischer Bündnisvertrag bald zustande kommen würde, erhöhte Friedrich im Mai den Etat seines Gesandten sogar auf eine Million Taler, die dazu verwendet werden sollten, einflussreiche Personen bei der Pforte für die Sache Preußens zu gewinnen.
Rexin hatte die Instruktion, sich bei der Vergabe von Bestechungsgeldern nicht nur auf »den Grossvezier, andere Veziers, den Mufti, den Kanzler und dergleichen nöthige Personen« zu beschränken, sondern auch den Dolmetscher des Sultans und selbst Personen des Serail, die hilfreich sein könnten, mit einzubeziehen.67 Im gleichen Schreiben regte der Monarch auch an, unter Umständen zu versuchen, die Janitscharen dazu zu bewegen, den Krieg gegen Preußens Widersacher zu forcieren. Offenbar war Friedrich nach wie vor der Überzeugung, dass der osmanische Sultan – wie er schon im Anti-Machiavell behauptet hatte – in Wahrheit Sklave seiner Janitscharen sei. Rexin sollte vor allem den Janitscharenführern, die Tataren befehligten, den Krieg gegen Friedrichs Gegner schmackhaft machen, indem er ihnen nicht nur Geld, sondern auch die zu erwartende Kriegsbeute in Aussicht stellte.68
Der König schien nun offenbar mehr denn je von der Käuflichkeit der Orientalen überzeugt und gab seinem Gesandten für das Umwerben der türkischen Verhandlungspartner mit Geschenken immer konkretere Weisungen:
(…) und wenn es erst dazu kommen wird, dass Ich die Präsente vor den Sultan und vor den Grossvezier schicken werde, so werde Ich die Sultane favorite, auch die Mutter des Sultans, auch den Mufti nicht vergessen. Ihr müsset Euch nur unter der Hand und auf eine adroite Art erkundigen, was ihnen angenehm sein dörfte, und Mir solches melden; man hat Mir sagen wollen, dass ihnen auch zuweilen Nürenberger Puppenwerk Plaisir gemacht habe.69
Auch wenn Friedrich keine Kosten scheute, so blieben die preußischen Allianzbemühungen doch erfolglos, was er später in seiner Ende 1763 abgeschlossenen Geschichte des Siebenjährigen Krieges mit folgendem Umstand erklärte:
Trotz der riesigen Summen, die dem türkischen Hofe zuflossen, trotz aller möglichen Arten von Bestechung rückten die Verhandlungen keinen Schritt weiter; denn die Franzosen und Österreicher streuten mit derselben Verschwendung Geld und Geschenke aus, und die Türken kamen besser auf ihre Rechnung, wenn sie sich für ihr Nichtstun als für Taten bezahlen ließen.70
So war es wohl auch nicht zuletzt 40 Beuteln mit insgesamt 16.666 Talern zu verdanken, dass am 2. April 1761 der Preußen von der Pforte Ende des Vorjahres angebotene Freundschaftsvertrag in Konstantinopel endlich offiziell besiegelt wurde. Rexin hatte dem Großwesir diese Geldzuwendung zukommen lassen, um Schwierigkeiten, die sich noch kurz vorher ergeben hatten, auszuräumen.71 Allerdings beinhaltete das Abkommen nicht im Entferntesten die angestrebte preußisch-türkische Militärallianz, sondern bestand lediglich aus einer zwischen Mustapha III. und Friedrich II. abgeschlossenen Kapitulation, die den Untertanen beider Mächte volle Handelsfreiheit zusicherte. Der Vertrag, der Preußen am Bosporus die Ausübung der Konsulargerichtsbarkeit einräumte und preußischen Staatsangehörigen das Recht auf freie Religionsausübung garantierte, war für die späteren deutsch-osmanischen Vereinbarungen maßgebend und blieb bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Kraft.72
Rexin, der zur Vertragsunterzeichnung zu einer öffentlichen Audienz beim Großwesir einbestellt worden war, welcher auch der Sultan verkleidet beigewohnt hatte, berichtete von »der grossen Geldgier der türkischen Grossen, die sich alle auf grosse Geschenke gefasst machten«.73 Obgleich der preußische Monarch den Vertrag – für ihn nicht mehr als ein »simpler Freundschaftstractat«74 – lediglich als Grundlage für die anvisierte Defensivallianz ansah, sicherte er seinem Gesandten die Übersendung der angeforderten Geschenke und Dankesschreiben zu und forderte ihn energisch auf, mit Nachdruck auf dieses Ziel hinzuarbeiten.75 Kurz nach der Ratifizierung des Freundschaftsvertrags Anfang Juni 1761 kommentierte Friedrich gegenüber seinem Vertrauten Marquis d’Argens diesen Schritt mit den Worten:
Ich bin genöthiget gewesen, meine Zuflucht zu Treu und Glauben und zu der Menschlichkeit der Muselmänner zu nehmen, weil solche bei den Christen nicht mehr zu finden sind. Welche Vortheile mir aber auch dieses Bündniß gewähren mag, so müssen sie sich doch nicht mit der Hoffnung schmeicheln, daß es uns den Frieden bringen werde.76
Der Kriegsherr in Not: Friedrich II. besingt die Türken als letzte Hoffnung
Auch wenn sich die preußischen Truppen im Laufe des Jahres 1761 an der Ostfront weitgehend behaupten konnten, spitzte sich die Lage gegen Jahresende zu, da England aus dem Verteidigungsbündnis mit Preußen austrat und strategische Stellungen an Österreich und Russland verloren gingen.77 Angesichts der für Preußen nun hoffnungslos scheinenden Lage drängte Friedrich seinen Gesandten in Konstantinopel erneut, keine Kosten zu scheuen, um die Pforte dazu zu bewegen, seinen Widersachern den Krieg zu erklären.78 Zwischen Verzweiflung und Hoffnung schwankend – Letztere nährte eine Meldung über türkische Truppenbewegungen bei Adrianopel an der österreichischen Grenze –,79 griff Friedrich am 11. November in seinem Feldlager in Strehlen zur Feder und verfasste die erst nach seinem Tod veröffentlichte Epistel über die Bosheit der Menschen. Je vehementer sich in diesen Zeilen die Wut des Preußenkönigs über den Verrat der Europäer entlädt, desto idealisierter erscheinen die von ihm imaginierten türkischen Verbündeten, die er vor seinem geistigen Auge die Feinde Preußens überrennen sieht:
(…)
Da denn Europa keine Männer zeugt,
Da ich umsonst um euern Beistand flehe
Und ihr nur leere Worte für mich habt,
Verschmäh’ ich eure matte Hilfe denn.
Und auf des Orients sieggewohnte Söhne
Setz’ ich hinfort mein Hoffen und mein Sehnen,
Auf jenes Volk, dem Ruhm und Ehre ruft,
Des Unterdrückten Freund, des Drängers Geißel.
Nie hat des Wortbruchs niedre Schande noch
Die Mauern Solimans entweiht. – Seht dort
Am Hellespont die mächtge Heeresmacht,
Die, ihrem Eide treu, ins Kriegsfeld zieht.
(…)
Eilt denn herbei, Ihr tapfern Janitscharen,
Ihr schnellen Sieger, trefft und schlagt den Feind!
Pflückt neuen Lorbeer euch im Siegesfeld!
Schon fällt die bleiche Furcht den Gegner an.
Zu euern Füßen büßt er seine Tücke,
Und im Triumph sei unsere Schmach getilgt.
Mög’ euer edler Mut, vom Glück belohnt,
Dem halben Mond die Donau unterjochen;
Herbei und opfert mit verwegner Hand
Europens Frevel Asiens Tugenden. (…)80
Doch zurück auf den Boden der Tatsachen, wo in Berlin aufwendige Geschenke für einflussreiche Personen bei der Pforte vorbereitet wurden, deren Transport über Polen Friedrich von seinem Feldlager aus nicht nur penibel überwachte.81 Er stellte jetzt auch seinem Gesandten in Konstantinopel, der in der Bündnisfrage noch immer keinerlei Fortschritte erzielt hatte, einen zusätzlichen Mittelsmann namens Delon zur Seite und bewilligte weitere Bestechungsgelder. In seinem Brief vom 3. Dezember 1761 unterrichtete der König Rexin darüber, dass der zu seiner Unterstützung am Bosporus demnächst eintreffende Delon genaue Instruktionen mitbringen werde,
wie Ihr Euch meiner Meinung und Intention gemäss mit der Corruption bei denen Grossen von der Pforte nähern müsset, es sei nun der Grossvezier, Mufti, Kessedar Aga oder wie sie sonsten heissen, die nämlich der ganzen Sache das Gewicht geben können oder auch das Vertrauen von dem Sultan haben, um es zu einem wirklichen Bruch mit denen Oesterreichern und denen Russen bringen zu können: dass nämlich Ihr ihnen beibringen lasset, wie Ihr diesem oder jenem von ihnen einhundert-, zweihundert- oder dreimalhunderttausend Thaler offeriret, dergestalt, (…) dass der Krieg wirklich denen Oesterreichern und Russen öffentlich declariret wird.82
Er sei fest versichert, heißt es in dem Schreiben weiter, »daß wenn Ihr mit dem Beutel in der Hand gehen und Euch zugleich adroit und geschickt nehmen und nichts negligiren noch nachlässig tractieren Ihr ohnfehlbar und gewiss reussieren müsset«.83 In seiner Not war Friedrich nun sogar bereit, dem Sultan jährlich eine Million Taler Hilfsgelder zu zahlen, solange der Krieg andauerte.84
In dieser prekären Zeit kam es abermals zur persönlichen Begegnung zwischen dem preußischen Monarchen und einem muslimischen Unterhändler, als Mitte November ein tatarischer Gesandter bei ihm an der Ostfront eintraf. Er übermittelte Friedrich, der sich auch an den Großkhan der Krimtataren gewandt hatte, um ihn als Bündnispartner zu gewinnen, die Zusage seines Herrn, gegen Subsidienzahlungen in Russland und Österreich einzufallen. Im Dezember erschien noch ein weiterer Bote beim Preußenkönig und überbrachte die Nachricht, dass der Khan im März ein Korps von 40.00085 Kämpfern gegen Russland zusammenziehen werde.86
Mit den Umwälzungen in Russland im Frühjahr 1762 entstand jedoch eine neue Konstellation. Als nach dem Tod der russischen Zarin Elisabeth deren deutschfreundlicher Nachfolger Peter III. den Thron bestieg, wendete sich das Blatt unerwartet zugunsten Preußens. Der neue Zar und Friedrich wurden zu Bündnispartnern, womit für den Preußenkönig jedwede Militärallianz gegen Russland erst einmal obsolet geworden war. Friedrich versuchte nun mit allen Kräften auf den Tatarenkhan einzuwirken, damit er von dem ursprünglichen Plan, gegen Russland in den Krieg zu ziehen, ablasse und nur Österreich angreife. Doch trotz aller Verhandlungen und Geldgeschenke blieben die Anstrengungen Preußens, die Tataren dazu zu bewegen, die Waffen gegen die Habsburger zu ergreifen, erfolglos.
Die Erfahrung, die Friedrich mit den Türken gemacht hatte, die sich, wie er in seiner Geschichte des Siebenjährigen Krieges bitter konstatierte, letztlich für »ihr Nichtstun« hatten reichlich bezahlen lassen, schien sich nunmehr im tatarischen Fall wiederholt zu haben. Sein Kommentar geriet nun zur allgemeinen Reflexion über den orientalischen Charakter:
Der Pascha aber wurde mit Geschenken für sich und seinen Herrn heimgeschickt; denn bei jenen Völkern ist alles käuflich. Der Tartar hatte seine Handlungen und Dienste genau abgeschätzt: soviel mußte man ihm für eine günstige Antwort zahlen, soviel für das Zusammenziehen der Truppen, soviel für Demonstrationen, soviel für einen Brief an den Großherrn. Der einzige Unterschied zwischen dem Schacher der Orientalen und anderer Völker scheint mir der zu sein, daß jene sich ohne Erröten entehren und sich ihrer schändlichen Leidenschaft hingeben, die Europäer aber wenigstens einige Scham dabei heucheln.87
Wie doppelbödig sein Verhältnis zu Preußens potenziellen orientalischen Bündnispartnern war, zeigte sich nicht zuletzt auch in der plötzlichen Kehrtwende, die Friedrich nun in seiner Russlandpolitik machte und die in Konstantinopel großes Misstrauen erweckte. Dass seine Anknüpfungsversuche an den osmanischen Osten weniger auf Langfristigkeit angelegt, sondern schlicht aktuellen politischen Konstellationen geschuldet waren, zeigt auch die Tatsache, dass Berlin nach der Ermordung des Zaren ein halbes Jahr nach dessen Regierungsantritt wieder die Nähe zu Konstantinopel suchte, um den Expansionsbestrebungen Katharinas der Großen entgegenzutreten. Nach dem erneuten Zarenwechsel wurden vom Preußenkönig schon bald die Versuche wieder aufgenommen, mit dem Diwan über eine entsprechende Allianz zu verhandeln.
Vorurteile scheinen bestätigt: Die osmanische Gesandtschaft in Berlin fasziniert und irritiert
Die preußischen Bündnisbemühungen gipfelten in dem aufsehenerregenden Besuch des osmanischen Gesandten Ahmed Resmi Efendi, der im November 1763 mit einer 70-köpfigen Gefolgschaft in Berlin eintraf, wo er fast ein halbes Jahr verweilen sollte. Während Friedrich darauf hoffte, dass nun endlich die langerstrebte preußisch-osmanische Defensivallianz zustande käme, geriet in der preußischen Hauptstadt der spektakuläre Aufenthalt der exotischen Gesandtschaft zum gesellschaftlichen Ereignis der Saison. Die seltene Begegnung erlaubt nicht nur einen aufschlussreichen Blick auf das offizielle Orientbild im damaligen Preußen, sondern illustriert auch das ambivalente Verhältnis des preußischen Monarchen zu seinen türkischen Gästen. Denn während die Berliner Presse – wohl auch auf Weisung von oben – die osmanischen Besucher feierte und umschmeichelte,88 herrschte im internen Kreis um Friedrich ein sehr viel schrofferer und oftmals abschätziger Ton.
Dieser brach sich immer wieder auch in den Korrespondenzen Bahn. Schon vor Ahmed Resmis Eintreffen am preußischen Hof hatte sich der in Breslau residierende Provinzialminister Ernst Wilhelm von Schlabrendorff in einem Brief an Friedrichs Kabinettsminister Karl Wilhelm Finck von Finckenstein über die Freundschaftsgesten des orientalischen Besuchers beklagt: »Vorgestern Abend schickte er mir seine türkische Janitscharenmusik, welche abscheulich ist und wovon mir die Ohren wehe thun.«89 Auch wenn Schlabrendorff von dem Gesandten selbst nicht unbedingt einen schlechten Eindruck hatte: »Er scheinet sonst ein ganz billiger Mann zu sein« – an dessen Gefolgsleuten ließ er kaum ein gutes Haar:
das Gefolge aber bestehet größtenteils aus Lumpenvolk, welches alle Augenblick etwas neues verlangt und gar nicht zu befriedigen ist. Ihr Geiz gehet so weit, daß, da der Gesandte sich von jedermann sehen läßt und folglich die Zimmer jederzeit voller Volks sind, ein jeder beim Herausgehen ein Trinkgeld geben muß, welches öfters mit vielem Ungestüm gefordert wird.90