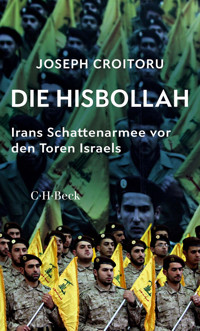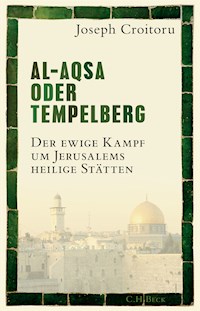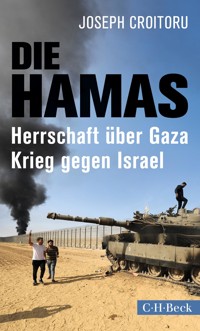
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 markiert einen tiefen Einschnitt in der Geschichte Israels. Joseph Croitoru erklärt konzise, wie die Hamas seit 2007 ihre islamistische Herrschaft im Gazastreifen etabliert hat. Sein Augen öffnendes Buch, das auf langjähriger Beobachtung der Hamas basiert, lässt den neuen, schrecklichen Krieg in Israel und Palästina besser verstehen. Die Leichtigkeit, mit der Kämpfer der Hamas und des Islamischen Dschihad im Oktober 2023 die Grenze zu Israel überwunden haben, und die Unzahl ihrer Raketen haben die Welt verblüfft. Wie konnten so viele schwere Waffen in das vermeintlich lückenlos, bis tief in den Boden, gesicherte Gebiet gelangen? Welche Ideologie und welche Unterstützer stecken hinter der Hamas? Joseph Croitoru beschreibt die Geschichte der „Islamischen Widerstandsbewegung“ (Hamas), die1987 aus der Muslimbruderschaft hervorgegangen ist und 2007 gewaltsam die Macht in Gaza übernommen hat. Er erläutert ihre unterschiedlichen Gesichter als Wohltätigkeitsorganisation, Regierungspartei und Terrorgruppe und zeigt, wie die palästinensische Bevölkerung von der rücksichtslosen Politik der rechtsgerichteten Netanjahu-Regierung in ihre Arme getrieben wird. Israel kann mit seinem massiven Gegenschlag die Herrschaft der Hamas über Gaza beenden, doch ob das auch das Ende der Hamas sein wird, bleibt fraglich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Joseph Croitoru
Die Hamas
Herrschaft über Gaza, Krieg gegen Israel
C.H.Beck
Zum Buch
Der Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 markiert einen tiefen Einschnitt in der Geschichte Israels. Joseph Croitoru erklärt konzise, wie die Hamas seit 2007 ihre islamistische Herrschaft im Gazastreifen etabliert hat und welche Organisationen und Staaten ihren Terror gegen Israel unterstützen. Sein Augen öffnendes Buch, das auf langjähriger Beobachtung der Hamas basiert, lässt den neuen, schrecklichen Krieg in Israel und Palästina besser verstehen.
Die Leichtigkeit, mit der Kämpfer der Hamas und des Islamischen Dschihad im Oktober 2023 die Grenze zu Israel überwunden haben, und die Unzahl ihrer Raketen haben die Welt verblüfft. Wie konnten so viele schwere Waffen in das vermeintlich lückenlos, bis tief in den Boden, gesicherte Gebiet gelangen? Welche Ideologie und welche Unterstützer stecken hinter der Hamas? Joseph Croitoru beschreibt die Geschichte der «Islamischen Widerstandsbewegung» (Hamas), die 1987 aus der Muslimbruderschaft hervorgegangen ist und 2007 gewaltsam die Macht in Gaza übernommen hat. Er erläutert ihre unterschiedlichen Gesichter als Wohltätigkeitsorganisation, Regierungspartei und Terror- gruppe und zeigt, wie die palästinensische Bevölkerung von der rücksichtslosen Politik der rechtsgerichteten Netanjahu- Regierung in ihre Arme getrieben wird. Israel kann mit seinem massiven Gegenschlag die Herrschaft der Hamas über Gaza beenden, doch ob das auch das Ende der Hamas sein wird, bleibt fraglich.
Vita
Joseph Croitoru, Historiker, Journalist und Buchautor, schreibt für die deutschsprachige Presse und den Rundfunk u.a. über den Nahostkonflikt, jüdische und islamische Geschichte sowie religiösen Fundamentalismus. Joseph Croitoru wurde 2021 mit dem Friedenspreis der Geschwister Korn und Gerstenmann-Stiftung ausgezeichnet.
Inhalt
Karte: Israels Kampf gegen Hamas
Einleitung
1. Die wechselvolle Geschichte des Gazastreifens bis nach dem Sechstagekrieg 1967
2. Die Muslimbrüder im Gazastreifen ergreifen die neue Chance
3. Scheich Jassins Muslimbrüder gründen die Islamische Widerstandsbewegung Hamas
4. Die Hamas opponiert gegen die Friedensbemühungen der PLO
5. Die Al-Aqsa-Intifada lässt die Hamas erstarken
6. Die Hamas kommt an die Macht
7. Mit Gewalt zur Alleinherrschaft im Gazastreifen
8. Das islamistische Regime in Gaza vertieft die palästinensische Spaltung
9. Israel und die Hamas im Modus Vivendi
10. Der Arabische Frühling wird islamistisch – und die Hamas rüstet auf
11. Der Gazakrieg 2014: «Starker Fels» gegen «Abgefressenes Getreidefeld»
12. Mäßigung nach Art der Hamas
13. Der «Große Marsch der Rückkehr» endet blutig am Grenzzaun
14. In Gaza werden aus militärischen Übungen Kriegsvorbereitungen
15. Während Israel über die «Justizreform» streitet, greifen Palästinenser in der Westbank Soldaten und Siedler an
16. Invasion aus dem Gazastreifen und das Massaker des 7. Oktober 2023
17. Israels Vernichtungskrieg gegen die Hamas
Ausblick
ANHANG
Abkürzungen
Anmerkungen
1. Die wechselvolle Geschichte des Gazastreifens bis nach dem Sechstagekrieg 1967
2. Die Muslimbrüder im Gazastreifen ergreifen die neue Chance
3. Scheich Jassins Muslimbrüder gründen die Islamische Widerstandsbewegung Hamas
4. Die Hamas opponiert gegen die Friedensbemühungen der PLO
5. Die Al-Aqsa-Intifada lässt die Hamas erstarken
6. Die Hamas kommt an die Macht
7. Mit Gewalt zur Alleinherrschaft im Gazastreifen
8. Das islamistische Regime in Gaza vertieft die palästinensische Spaltung
9. Israel und die Hamas im Modus Vivendi
10. Der Arabische Frühling wird islamistisch – und die Hamas rüstet auf
11. Der Gazakrieg 2014: «Starker Fels» gegen «Abgefressenes Getreidefeld»
12. Mäßigung nach Art der Hamas
13. Der «Große Marsch der Rückkehr» endet blutig am Grenzzaun
14. In Gaza werden aus militärischen Übungen Kriegsvorbereitungen
15. Während Israel über die «Justizreform» streitet, greifen Palästinenser in der Westbank Soldaten und Siedler an
16. Invasion aus dem Gazastreifen und das Massaker des 7. Oktober 2023
17. Israels Vernichtungskrieg gegen die Hamas
Ausblick
Personenregister
Karte: Israels Kampf gegen Hamas
Einleitung
Am 7. Oktober 2023 wurde das israelische Grenzgebiet zum Gazastreifen Ziel eines terroristischen Überfalls, dessen Ausmaß an Gewalt und Brutalität in Israels Geschichte beispiellos war. Etwa zweitausendfünfhundert bewaffnete palästinensische Terroristen stürmten, gefolgt von einem Mob aus mehreren Hundert Zivilisten, knapp ein Dutzend israelische Militärbasen und fast dreißig Gemeinden und richteten ein verheerendes Blutbad an. Die Invasoren konnten den Hightech-Grenzzaun, der in Israels militärischen und politischen Führungskreisen als unüberwindbar galt, an zahlreichen Stellen offenbar mit Leichtigkeit durchbrechen. Die israelische Selbstüberschätzung hatte auch dazu geführt, dass nahe der Grenze erstaunlich wenig Truppen stationiert waren. Hinzu kam, dass die Militärbasen wegen des jüdischen Feiertags «Freude der Thora» unterbesetzt waren. Die wenigen israelischen Verteidiger, ob Soldaten in den Militärstützpunkten oder in sogenannten Bereitschaftstrupps organisierte bewaffnete israelische Zivilisten, leisteten den Angreifern zwar Widerstand. Sie konnten das Massentöten aber nicht verhindern. Die Terroristen, Mitglieder der Qassam-Brigaden der Hamas, der Al-Quds-Brigaden des Islamischen Dschihad und weiterer Milizen aus dem Gazastreifen, erschossen und massakrierten mehr als dreihundert israelische Soldatinnen und Soldaten und rund fünfhundert Zivilisten in den angegriffenen Ortschaften. Mehr als dreihundertfünfzig von etwa viertausendvierhundert Besuchern eines Musikfestivals, das in Grenznähe gerade stattfand, wurden ebenfalls Opfer eines Massakers. Vom Festivalgelände, den Militärbasen und aus den überfallenen Gemeinden wurden rund zweihundertfünfzig Menschen nach Gaza verschleppt.
Die israelischen Sicherheitskräfte waren schnell alarmiert, trafen aber an den angegriffenen Orten erst spät ein. Während die israelische Luftwaffe unverzüglich mit massiven Bombardements auf den Gazastreifen begann, brauchten die angerückten Armee- und Polizeieinheiten viele Stunden und bisweilen mehrere Tage, bis sie die letzten Terroristen in der Grenzregion ausschalteten. Etwa tausend Angreifer sollen getötet worden sein. Das Entsetzen über den Massenmord schien die zutiefst gespaltene israelische Gesellschaft mit einem Schlag zu einen. Zu dem Ruf nach Vergeltung gesellte sich schnell das Verlangen nach Rache, wie sie der von vielen für das Sicherheitsversagen verantwortlich gemachte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch während der letzten Kämpfe im Grenzgebiet versprach. Die Hamas – Alleinherrscherin im Gazastreifen seit 2007 und Hauptdrahtzieherin des Massakers – zu vernichten, wurde zum erklärten Ziel eines neuen Kriegs: eine weitere Antwort auf jenen terroristischen Zermürbungskrieg, den die islamistischen palästinensischen Kampfmilizen mit säkularen Verbündeten schon seit Jahrzehnten gegen Israel und seinen Besatzungsapparat führen.
Den Frieden, den die noch von Jassir Arafat geführte Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) und Israel 1993 schlossen, lehnten diese Radikalen von Anfang an ab. Die Islamische Widerstandsbewegung (arabisches Akronym: HAMAS), deren Geschichte in diesem Buch erzählt wird, war Ende 1987 im Gazastreifen auch mit dem Ziel gegründet worden, jeglichen palästinensischen Dialog mit den israelischen Besatzern zu torpedieren. Sie schrieb sich die Vernichtung des Staates Israel auf die Fahnen, die von der säkularen Rivalin Fatah, der dominanten Kraft innerhalb der PLO, inzwischen aufgegeben worden war. Die Hamas bediente sich dafür eines islamistischen und dschihadistischen Vokabulars, das ihren Ursprung in der Bewegung der ägyptischen Muslimbrüder bezeugte. Gegen den Friedensprozess zog die Hamas aber nicht nur mit Kampfparolen ins Feld. Die Islamisten-Organisation setzte schon in den frühen Neunzigerjahren Selbstmordattentäter ein, die sich in Israel in Bussen und auf belebten Plätzen in die Luft sprengten. In der schockierten und in ihrer Selbstsicherheit zutiefst verletzten israelischen Gesellschaft ließen diese Terroranschläge ähnliche Rufe nach Vergeltung laut werden wie die heutigen. Solchen Rufen war Benjamin Netanjahu schon damals als Ministerpräsident gefolgt, als er die weitere Umsetzung der Oslo-Friedensverträge hinauszuzögern versuchte, aber schon nach drei Jahren abgewählt wurde. Hamas und Fatah, obgleich über das Verhältnis zu Israel zerstritten, kämpften in den Jahren der Al-Aqsa-Intifada zu Beginn des Jahrtausends für kurze Zeit Seite an Seite gegen ein zunehmend aggressives und wenig kompromissbereites Israel unter dem rechten Hardliner Ariel Scharon. Doch die Wege der beiden Rivalinnen trennten sich, als die Hamas 2006 die palästinensischen Wahlen gewann, die Macht mit der Fatah nicht teilen wollte und die säkulare Kontrahentin im Juni 2007 mit Gewalt aus dem Gazastreifen vertrieb.
Die Hamas, die zugleich politische Bewegung, Wohlfahrtsorganisation und Miliz ist, nutzte ihre Alleinherrschaft in Gaza, um die traditionell ausgerichtete palästinensische Gesellschaft des Gazastreifens noch weiter zu durchdringen und die militärischen Fähigkeiten ihrer Qassam-Brigaden auszubauen. Ihre Ziele, über alle Palästinensergebiete zu herrschen und nach Möglichkeit dem «zionistischen Wesen» ein Ende zu setzen, gab sie nicht auf, auch wenn sich ihre Anführer 2017 bereit erklärten, den vollständigen Rückzug Israels aus der Westbank als Grundlage für einen künftigen Dialog zu akzeptieren. Solche Signale der Mäßigung stießen jedoch in Israel, besonders bei Ministerpräsident Netanjahu, auf taube Ohren. In seiner langen Amtszeit rückte die israelische Parteienlandschaft immer weiter nach rechts. «Die Besatzung», wie Israel nicht nur von Palästinensern im Gazastreifen bezeichnet wird, festigte sich zunehmend, ob durch die strenge Abriegelung des Küstenstreifens oder den Ausbau der israelischen Siedlungen in der Westbank. Beides diente der Hamas und ihren verbündeten Milizen als Rechtfertigung dafür, Israel mit Raketen und das Grenzgebiet auch mit Mörsern zu beschießen. Jerusalem antwortete auf diesen wahllosen Beschuss immer wieder auch mit Bombardements von Wohngebieten im Gazastreifen. Sie wurden damit begründet, dass die Hamas Zivilisten und zivile Einrichtungen als Schutzschilde missbrauche, und kosteten zwischen 2008 und September 2023 schon rund dreitausendachthundert palästinensische Zivilisten das Leben. Auf israelischer Seite waren im gleichen Zeitraum knapp hundertachtzig zivile Todesopfer zu beklagen. Sollte etwa der brutale Terrorangriff des 7. Oktober diese Asymmetrie aufbrechen? Durch Israels vernichtenden Gegenschlag wird sie jedenfalls aufrechterhalten, obwohl er sich offiziell nur gegen die Hamas und ihre Verbündeten richtet.
1.
Die wechselvolle Geschichte des Gazastreifens bis nach dem Sechstagekrieg 1967
Der Gazastreifen ist ein schmales dicht bebautes Küstengebiet am östlichen Mittelmeer. Er liegt zwischen Israel, das ihn größtenteils umgibt, und Ägypten, an das er im Süden grenzt, und ist rund 40 Kilometer lang und zwischen 6 und 14 Kilometern breit. Insgesamt umfasst er etwa 365 Quadratkilometer und ist damit knapp halb so groß wie die Fläche Hamburgs. Abgeriegelt von der Außenwelt leben dort etwa zwischen 2,2 und 2,3 Millionen Menschen.
Der Küstenstreifen, bei dem es sich um eine der heute am dichtesten besiedelten Regionen der Welt handelt, blickt auf eine jahrtausendealte Siedlungsgeschichte zurück. Ihre Anfänge liegen in prähistorischer Zeit. Einen ersten geschichtlichen Höhepunkt stellte die Herrschaft der alten Ägypter dar, die dort vom späten 4. Jahrtausend bis um die Mitte des ersten Jahrtausends v. Chr. regierten. In dieser Epoche war das Gebiet vom späten zweiten vorchristlichen Jahrtausend an vor allem von den Philistern bewohnt, einem Volk phönizischer Herkunft, das dort einen Städtebund gründete und mit dem alten Ägypten und den Königreichen Israel und Juda in einer Art Dauerkonflikt lag.
Vermutlich wurde bereits unter Pharao Ramses III. ein Teil der Philister aus der Region vertrieben. Als der babylonische König Nebukadnezar II. im Jahr 604 v. Chr. das Gebiet eroberte, wurden viele von ihnen Opfer von Massenvertreibung und Versklavung. Etwa sechs Jahrzehnte später geriet Gaza unter die Herrschaft der Perser, und König Kyros II. gestattete den vertriebenen Bewohnern, zurückzukehren. Seine Nachfolger bauten den Ort zu einer Garnisonsstadt aus, die der persischen Armee als Basis für Militäroperationen gegen die Ägypter diente. Die persische Besatzung endete 332 v. Chr. mit der Erstürmung der Festung Gaza durch Alexander den Großen, die Teil seines Feldzugs gegen Darius III., den letzten Perserkönig des Achämidenreichs, war.
Nach dem Tod Alexanders stand die Region unter der Herrschaft der hellenistischen Seleukiden und später der Römer und der Byzantiner. In ihrer Bezeichnung für das Land Palastinoi oder Palaestina lebte die Erinnerung an die Philister weiter. Die arabisierte Form Filastin wird von den Muslimen, die das Gebiet um das Jahr 638 eroberten, bis heute verwendet. Die islamische Epoche, die fast tausenddreihundert Jahre währte, kennzeichneten wiederholte Umbrüche. Auslöser waren neben innerarabischen Konflikten auch die Eroberung durch die Kreuzritter, die Gaza nach ihren Vorstellungen umbauten, und der Angriff der Mongolen, die im Jahr 1259 die Stadt und ihre Umgebung verwüsteten. Ein Jahr später vertrieben die Mamluken die Mongolen aus dem Gebiet und kontrollierten es von Ägypten aus. Die Mamlukenherrschaft dauerte mit Unterbrechungen fast fünfhundert Jahre. Erst Napoleons Ägyptenfeldzug, der auch durch das Gebiet von Gaza führte, machte ihr 1798 ein Ende.
In den folgenden Jahrzehnten unterstanden Gaza und Umgebung der Kontrolle des osmanischen Gouverneurs von Ägypten, Muhammad Ali Pascha, der eine eigene, bis 1953 herrschende Dynastie gründete. Mit ihm gewann Ägypten eine relative Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Trotz siegreicher kriegerischer Auseinandersetzungen mit den Osmanen um Syrien und Palästina musste Muhammad Ali diese Gebiete schließlich 1841 räumen, da europäische Mächte, die um die Stabilität des Osmanischen Reiches fürchteten, militärisch interveniert hatten. Von da an bis zum Ersten Weltkrieg befand sich Palästina, darunter auch das Gebiet um Gaza, wieder unter direkter Verwaltung des Osmanischen Reiches. Allerdings unterhielt die Bevölkerung des Küstenstreifens weiterhin enge Beziehungen zu Ägypten, das seit 1882 unter britischer Kontrolle stand und somit auch den wirtschaftlichen Interessen Großbritanniens unterworfen war, etwa als Baumwoll-Lieferant. Wenig bekannt ist, dass das Gaza-Gebiet den Engländern damals Gerste für ihre Bierindustrie lieferte und damit einen erheblichen Teil zur palästinensischen Exportwirtschaft beitrug.
Im Ersten Weltkrieg marschierten die Briten von Ägypten aus in Palästina ein. Gerade in dem Gebiet um Gaza und besonders in der Stadt selbst trafen sie im Frühjahr 1917 auf harten Widerstand der gut vorbereiteten und vom verbündeten Deutschland unterstützten osmanischen Armee. Sie hatte sämtliche Einwohner zum Verlassen der Stadt gezwungen und die Evakuierung mit aller Härte durchgeführt. Der Großteil der Menschen wurde nach Syrien evakuiert – zu ihrem eigenen Schutz, wie es hieß.
Die kriegerischen Auseinandersetzungen, bei denen die Türken unterlagen, führten zu einer massiven Zerstörung Gazas. Die in Trümmern liegende Stadt wurde von den evakuierten arabischen Bewohnern, die nach dem Krieg dorthin zurückkehrten, wiederaufgebaut. Allerdings ging die Wiederbesiedlung unter der britischen Mandatsherrschaft, die bis 1948 andauerte, nur schleppend voran. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass die Engländer sofort eine Eisenbahn bauten, die entlang der Küste den Suezkanal mit dem 1909 gegründeten Tel Aviv verband und auch durch den Gazastreifen führte. 1922 hatte Gaza-Stadt nur etwas mehr als siebzehntausend Einwohner – weniger als die Hälfte des Vorkriegsstandes. Erst zu Beginn der Vierzigerjahre wurde nach der Errichtung eines neuen Stadtteils der Bevölkerungsstand der Vorkriegszeit wieder annähernd erreicht.
Zur gleichen Zeit, als im Ersten Weltkrieg die Briten kurz vor der Eroberung Gazas gestanden hatten, hatte sich ihre Regierung mit der Balfour-Deklaration solidarisch mit dem Ziel des Zionismus erklärt, dem jüdischen Volk in Palästina eine nationale Heimstatt zu schaffen. Der anfängliche Anschein, dies könne im Einvernehmen mit arabischen Interessen geschehen, erwies sich jedoch als trügerisch. Im UN-Teilungsplan für Palästina vom November 1947, der den Konflikt zwischen Arabern und Juden lösen sollte, war der Gazastreifen als Teil des künftigen arabischen Staates vorgesehen. Nach seiner Verabschiedung gaben die britischen Mandatsherren bekannt, das Land bis Mitte Mai 1948 zu verlassen, was auch geschah. Am 14. Mai wurde der israelische Staat ausgerufen. Unmittelbar danach erklärten mehrere arabische Länder dem eben gegründeten Staat den Krieg. Die Nachbarstaaten Ägypten, Syrien, Libanon und Jordanien hatten sich mit dem Irak und Saudi-Arabien zu einer Allianz zusammengeschlossen. Die Invasion ihrer Armeen sollte die Etablierung des Staates Israel verhindern. Ägypten nutzte die Gelegenheit, um das Gebiet um und südlich von Gaza zu besetzen, und startete von dort eine Offensive gegen jüdische Ortschaften im Norden und Osten. Die Israelis, denen es gelang, diese Angriffe erfolgreich abzuwehren, drängten die Ägypter zurück in den Gazastreifen, wobei sie selbst kleine Teile des Küstenstreifens eroberten: die im Norden gelegene Stadt Beit Hanun und Gebiete in der Nähe von Rafah, dem einzigen Grenzübergang zwischen Ägypten und Gaza.
Die Bezeichnung «Gazastreifen» (Gaza Strip) für die Region bürgerte sich erst mit den 1949 zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn geschlossenen Waffenstillstandsabkommen ein. Über seinen Status wurde noch bis 1950 mit Ägypten weiterverhandelt. Schließlich mussten die Israelis ihre in Gaza besetzten Gebiete an Ägypten abtreten, auch wenn damals der israelische Ministerpräsident David Ben Gurion den gesamten Küstenstreifen gerne Israel einverleibt hätte.[1]
Dramatische Folgen für den Gazastreifen, dessen Bevölkerung bis zum Krieg rund neunzigtausend Menschen zählte, hatte der Zustrom der rund zweihunderttausend palästinensischen Flüchtlinge, die aus ihren Ortschaften im südlichen Palästina geflohen oder von den Israelis vertrieben worden waren und nun in Gaza Zuflucht suchten. Die meisten von ihnen wurden in den acht palästinensischen Flüchtlingslagern untergebracht, die vom «Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten» (UNRWA) bis heute betreut und versorgt werden. Noch während des Krieges installierte sich im von Ägypten kontrollierten Teil des Gazastreifens die «All-Palästina-Regierung». Palästinensische Politiker hatten sie im September 1948 unter der Ägide der Arabischen Liga im ägyptischen Alexandria gegründet. Ihren Sitz nahm sie in Gaza-Stadt. Sie erhob zwar den Anspruch, ganz Palästina zu regieren, war aber politisch machtlos, da sie weder über finanzielle noch militärische Mittel, geschweige denn einen funktionierenden Verwaltungsapparat verfügte. 1959 löste die ägyptische Regierung sie schließlich auf. Jedoch annektierte Kairo den Gazastreifen nicht, sondern unterstellte ihn einer Militärverwaltung, die viele der dort lebenden Palästinenser als Fremdbesatzung empfanden.
Unter ägyptischer Kontrolle sollte der Gazastreifen bis zum Sechstagekrieg 1967 bleiben. Allerdings unterbrach dies im Herbst 1956 für kurze Zeit der Sinai-Krieg. Er wurde durch die Verstaatlichung der mehrheitlich britisch-französischen Suezgesellschaft durch den ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser ausgelöst. Ende Oktober griff die israelische Armee an der Seite Großbritanniens und Frankreichs Ägypten an und besetzte nicht nur den Gazastreifen, sondern auch die gesamte Sinai-Halbinsel. Auf Druck der Amerikaner musste sich Israel aber schon im Januar 1957 aus dem Sinai und zwei Monate später auch aus dem Gazastreifen zurückziehen.
Offenbar hegten die Israelis damals den Plan, auf Dauer im Gazastreifen zu verbleiben. Denn die israelische Militärbesatzung baute dort innerhalb kürzester Zeit einen eigenen Verwaltungsapparat auf. An die Spitze der Gemeinden stellte sie Kritiker der ägyptischen Besatzer und kontrollierte die städtische Verwaltung und die Wirtschaft. Die Banken in Gaza wurden geschlossen und an ihrer Stelle ein israelisches Geldinstitut eröffnet. Die Telefonleitungen und der Briefverkehr nach Ägypten wurden gekappt und ein israelisches Postamt eingerichtet. Bereits zu diesem Zeitpunkt strahlte das israelische Militärradio im gesamten Gazastreifen arabischsprachige Propagandasendungen aus, und in den Kinos liefen spezielle israelische Wochenschauen. Politisch verdächtige Lehrer wurden entlassen und eine Reihe ägyptischer Schulbücher verboten. Die Militärzensur sorgte dafür, dass in Israels Presse der Eindruck erweckt wurde, als seien den Palästinensern im Gazastreifen die israelischen Besatzer willkommen.
Außerdem erhob die Militärverwaltung umfangreiche Daten von der im Gazastreifen und besonders in den dortigen Flüchtlingslagern lebenden Bevölkerung. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse wurden in einem 140 Seiten starken Bericht zusammengefasst, der in Israel lange unter Verschluss war. In Vergessenheit geriet auch die Tatsache, dass Israel schon Ende 1956 und Anfang 1957 in dem besetzten Küstenstreifen zwei Siedlungen gegründet hatte. Eine der Siedlungen befand sich auf einem verlassenen Stützpunkt der ägyptischen Armee in Rafah, wo sich Angehörige der Besatzungsarmee als Siedler niederließen und eilig begannen, Landwirtschaft zu betreiben, während das israelische Militär zur gleichen Zeit dort lebende Beduinen auf die ägyptische Sinai-Halbinsel vertrieb. Erst 2010 wurden diese Vorgänge wieder öffentlich bekannt.[2]
Zudem wurden Pläne für den Bau weiterer Siedlungen ausgearbeitet. Ministerpräsident David Ben Gurion hatte, wie erst Ende 2016 bekannt wurde, bis zuletzt die Absicht verfolgt, den gesamten Sinai sowie den Gazastreifen zu annektieren. Gegenüber dem Ausland begründete die israelische Regierung ihren Anspruch auf das Gaza-Gebiet mit dem Argument, es habe vorher niemandem gehört – die Ägypter seien lediglich Besatzer gewesen. Von der israelischen Präsenz, so wurde behauptet, würden die Araber wirtschaftlich profitieren, und zur Untermauerung legte man den Vereinten Nationen sogar ein befürwortendes Schreiben von Gemeindevorstehern aus dem Gazastreifen vor.[3]
Die während der Suezkrise 1956/57 gesammelten Erfahrungen und erhobenen Daten kamen den Israelis sehr zugute, als sie 1967 im Sechstagekrieg den Gazastreifen erneut einnahmen und für Jahrzehnte besetzt hielten. Nach dem Friedensabkommen, das der israelische Ministerpräsident Menachem Begin und der ägyptische Präsident Anwar al-Sadat am 26. März 1979 in Washington unterzeichneten, gab Israel die Sinai-Halbinsel bis 1982 schrittweise an das Nachbarland zurück. Die Israelis behielten den Gazastreifen, aus dem sie sich nach 38 Jahren Besatzung erst 2005 ohne Absprache mit der palästinensischen Seite zurückzogen. Dort aber hatte sich die Situation inzwischen vor allem in demographischer Hinsicht grundlegend geändert. In dem Jahrzehnt von 1956/57 bis 1967 war die Bevölkerung im Gazastreifen auf schätzungsweise 450.000 Menschen gewachsen. Zusammen mit der arabischen Bevölkerung der Westbank, die seit dem Sechstagekrieg ebenfalls von Israel besetzt war, waren es 1967 rund eine Million Palästinenser, die unter israelischer Kontrolle lebten – während zur gleichen Zeit die Gesamtbevölkerungszahl im israelischen Kernland 2,7 Millionen betrug.
Bereits eine Woche nach Kriegsende im Juni 1967 plädierten Mitglieder der israelischen Regierung intern dafür, den Gazastreifen zu annektieren, was Israel aus diplomatischen Gründen jedoch nicht tat. Gleichwohl wurde das Militär angewiesen, das Gebiet so zu behandeln, als sei es Teil des israelischen Staates. Ganz oben auf der Agenda stand die Frage, wie die dort erheblich gewachsene Bevölkerungszahl reduziert werden könnte. Tatsächlich verließen schon im ersten Jahr etwas mehr als fünfzigtausend Bewohner den Gazastreifen in Richtung Jordanien und Ägypten. Welchen aktiven Anteil genau die Israelis daran hatten, ist bis heute nicht geklärt. Mittlerweile ist jedoch bekannt, dass sie versuchten, noch mehr Palästinenser dazu zu bewegen, das Gaza-Gebiet zu verlassen – etwa mit der Finanzierung einer Ausreise nach Jordanien. Der Erfolg hielt sich jedoch in Grenzen, weil Ägypten und Jordanien sich gegen Israels Transferversuche wehrten, von gezielter Vertreibung sprachen und die Grenzen bald schlossen.[4]
Unterdessen installierten die Israelis blitzschnell eine Militärverwaltung, zum Teil mit demselben Personal, das schon ein Jahrzehnt zuvor im Gazastreifen eingesetzt gewesen war. Auch wenn sie auf der Erfahrung der kurzen Besatzung von 1956/57 aufbauen konnten, waren sie jetzt doch mit weit größeren Sicherheitsproblemen konfrontiert. Denn die Palästinenser hatten sich mittlerweile nicht nur politisch organisiert. Die im Januar 1964 auf Initiative des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser in Kairo ins Leben gerufene «Palästinensische Befreiungsorganisation» (PLO) verfügte inzwischen über einen eigenen militärischen Arm, die «Palästinensische Befreiungsarmee», die vom ägyptisch kontrollierten Gazastreifen aus regelmäßig Anschläge gegen Israel verübte. Nach dem Sechstagekrieg 1967 zogen sich ihre Mitglieder in den Untergrund zurück. Nun, als Angehörige der von Jassir Arafat 1959 in Kuwait gegründeten «Palästinensischen Befreiungsbewegung» (Fatah), die nach seiner Wahl zum PLO-Vorsitzenden im Februar 1969 zur dominanten Kraft innerhalb der PLO wurde, kämpften sie gegen die israelischen Besatzer und verfolgten palästinensische Kollaborateure.
Israel bekämpfte den palästinensischen Untergrund mit aller Härte. 1969 wurde General Ariel Scharon Chef des Südkommandos der israelischen Armee. Schon im Jahr darauf betraute er den damals jungen Offizier Meir Dagan mit der Bekämpfung des palästinensischen Widerstands im Gazastreifen. Dagan, der vier Jahrzehnte später von Scharon als Ministerpräsident zum Chef des Geheimdienstes Mossad ernannt wurde, hatte in Gaza freie Hand und setzte auch auf den Einsatz von Killerkommandos. In weniger als zwei Jahren wurden hundertachtzig Palästinenser, die den Besatzern Widerstand leisteten, getötet und zweitausend inhaftiert.[5] Die Eindämmung des Terrors war auch eine Voraussetzung dafür, dass Israel 1972 im Gazastreifen mit dem Siedlungsbau beginnen und hauptsächlich im Süden Siedlungen errichten konnte. In den Neunzigerjahren waren es bereits mehr als zwanzig.
2.
Die Muslimbrüder im Gazastreifen ergreifen die neue Chance
Parallel zur rücksichtslosen Bekämpfung suchten die israelischen Besatzer nach Wegen, die Bevölkerung in Gaza gegen die säkulare linksorientierte Fatah aufzubringen, und setzten dabei auf deren Gegner im religiösen Lager. In der Annahme, dass sie die Beschäftigung mit dem Koran und die Frömmigkeit vom Terror abhalten würden, räumte man den Religiösen Freiheiten ein. Vor allem die dortigen Anhänger der ägyptischen Muslimbruderschaft, die 1928 in der am Suezkanal liegenden Stadt Ismailiya von dem Lehrer Hassan al-Banna gegründet worden war, verstanden die neuen Freiheiten für ihre Ziele zu nutzen. Die Muslimbrüder waren eine straff organisierte Bewegung, die sich die Re-Islamisierung der ägyptischen Gesellschaft und die Übernahme der Macht im Land auf die Fahnen geschrieben hatte. Deshalb gerieten sie bald in Konflikt mit der säkularen ägyptischen Regierung und mit Präsident Gamal Abdel Nasser, der sie unerbittlich verfolgte, als sie begannen Terroranschläge zu verüben. Schon vor der israelischen Staatsgründung hatten sie zum Heiligen Krieg gegen die Zionisten in Palästina aufgerufen und überdies während des arabisch-israelischen Krieges von 1948 eine Freiwilligeneinheit an die Front in Gaza entsandt.
Bereits in den Jahrzehnten davor hatten die Muslimbrüder zwei Dutzend Aktivistenzellen in Palästina gegründet, so auch in Gaza. Dort hatte der palästinensische Zweig der Muslimbruderschaft unter der repressiven ägyptischen Besatzung jedoch kaum Aktivitäten entfalten können, was sich nun unter der Kontrolle der Israelis grundlegend änderte. In Gaza begann der junge Palästinenser Ahmad Jassin, der sich 1955 den Muslimbrüdern angeschlossen hatte, die Aktivitäten der Bewegung neu zu beleben. Der 1936 geborene Lehrer stammte aus dem nördlich des Gazastreifens gelegenen, von den Israelis zerstörten palästinensischen Dorf al-Dschura und lebte im Flüchtlingslager Schati in Gaza. Dort hatte er schon vor 1967 in einer notdürftig eingerichteten Moschee ein Zentrum nach dem Vorbild der Muslimbrüder eröffnet, wo Koranunterricht erteilt und den Kindern im Ort Sportaktivitäten und Sommerlager angeboten wurden. Unter der israelischen Besatzung baute Jassin die Organisation weiter aus und sorgte dafür, dass im Gazastreifen, vor allem in den Flüchtlingslagern, weitere solcher Zentren entstanden.
Jassins Bewegung, die nunmehr weitgehend ungestört expandieren konnte, verfügte Anfang der Siebzigerjahre schon über eine größere zentrale Einrichtung in Gaza-Stadt: den al-mudschama al-islami, zu Deutsch «Islamisches Zentrum». Seine Arbeit war streng nach Bereichen gegliedert und in die Sektionen religiöse Leitung, Wohlfahrt, Erziehung, Soziales, Medizin und Sport unterteilt. 1979 wurde der Mudschama von den Israelis als gemeinnütziger Verein offiziell anerkannt und war bis zuletzt im gesamten Gazastreifen aktiv.[1] Von Anfang an war neben der religiösen Erziehung auch die Unterstützung der wirtschaftlich Schwachen ein Schwerpunkt seiner Arbeit.
Mitte der Siebzigerjahre begann der Einfluss von Arafats PLO in den Palästinensergebieten zu schwinden. Einer der Gründe war, dass die PLO-Milizen ab 1975 in den libanesischen Bürgerkrieg verwickelt wurden, wo sie zunächst einmal mit dem eigenen Überleben beschäftigt waren. Hinzu kam, dass in den Palästinensergebieten die Aktivisten der PLO von der israelischen Militärbesatzung erbarmungslos verfolgt wurden und die Israelis größtes Interesse an der Erstarkung der religiösen Konkurrenz hatten[2] – was nicht nur in Israel gerne unter den Tisch gekehrt wird. Auch Jassins Anhänger wollen bis heute nichts davon hören, mit den Israelis jemals gemeinsam Front gegen die säkularen Konkurrenten gemacht zu haben.
Vor diesem Hintergrund verwundert es kaum, dass es in den folgenden Jahren immer häufiger zu gewalttätigen innerpalästinensischen Auseinandersetzungen kam. Nicht zuletzt war es wohl auch die wohlwollende Zurückhaltung der Israelis, die die islamistischen Aktivisten im Gazastreifen ermunterte, ihre Ziele nun zunehmend mit Gewalt durchzusetzen. Bereits Anfang der Achtzigerjahre, als es an den palästinensischen Universitäten immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Säkularen und Islamisten kam, schlug die Rivalität von Fatah und Hamas in Gewalt um. Besonders im weitgehend isolierten Gazastreifen kam es zu einer starken Islamisierung. Zwischen 1967 und 1987 verdoppelte sich hier die Zahl der Moscheen auf über hundertfünfzig, wobei die meisten hinzugekommenen von Jassin und seinen Anhängern gebaut wurden.
Neben den immer härteren Repressionen durch die israelische Besatzung führte der wachsende Einfluss der Muslimbrüder zu einer deutlichen Radikalisierung der palästinensischen Gesellschaft. Jassins Bewegung bekam nun auch von islamistischer Seite starke Konkurrenz, und zwar durch die noch radikalere Organisation des Islamischen Dschihad, eine von Iran und der libanesischen Hizbullah unterstützte Splittergruppe, die sich mit Terrorakten gegen die israelischen Besatzer Respekt verschaffte. Auf diese Herausforderung antworteten Jassin und seine Anhänger 1983 mit der Gründung der ersten bewaffneten Kampfgruppe der palästinensischen Muslimbrüder Al-Mudschahidun al-Filastiniyun (Die palästinensischen Heiligen Krieger). Allerdings deckten die Israelis sie gleich auf, klagten ihre Mitglieder und auch Scheich Jassin des Terrorismus an und verurteilten sie zu langen Haftstrafen. Jassin hatte das Glück, 1985 bei einem israelisch-palästinensischen Gefangenenaustausch freizukommen. Schon bald rief er eine neue militante Untergrundzelle ins Leben, die Madschmuat al-Dschihad wa-l-Dawa (Gruppe für Dschihad und Propaganda), deren Mitglieder im Gazastreifen als islamische Sittenwächter auftraten. Sie sanktionierten unislamisches Verhalten, spürten mit den Israelis kollaborierende palästinensische Informanten auf und töten sie. Damit war der Grundstein für die künftigen Waffeneinsätze der palästinensischen Muslimbrüder gelegt.