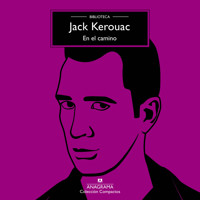9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Abenteuerroman, antikonsumistisches Manifest und zugleich «nature writing» at its best. Ein Klassiker der Beat-Literatur, zu Jack Kerouacs hundertstem Geburtstag am 12.3.2022 in neuer Übersetzung. Mal als blinder Passagier auf alten Güterzügen, mal zu Fuß in dünnen Stoffschuhen ist Ray Smith (Kerouac) unterwegs durch Kalifornien — ein wenig ziellos, bis er auf Japhy (Gary Snyder), den Dichterfreund und Zen-Buddhisten, trifft. Gemeinsam mit dem Jodler Morley brechen sie auf in die kaum berührte Natur der High Sierras, um die Lektion der Einsamkeit zu lernen. Sie dichten, sie wandern und meditieren, immer auf der Jagd nach dem Dharma und einem intensiven, sinnerfüllten Leben. Nur: Im wildromantischen San Francisco mit seinen Hipster-Partys, Poetry-Sessions, Trink-Marathons fällt es schwer, vom Weg der Askese nicht wieder abzukommen … Jack Kerouac zählt mit Allen Ginsberg und William S. Burroughs zu den führenden Stimmen der Beat Generation, die in den späten Fünfzigern des 20. Jahrhunderts eine der prägendsten subkulturellen Bewegungen der USA begründete. Unter dem damals zeitgemäßen Titel «Gammler, Zen und hohe Berge» in Deutschland berühmt geworden, schließt das im Original «The Dharma Bums» genannte Buch an Kerouacs Welterfolg «On the Road» an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Ähnliche
Jack Kerouac
Die Dharmajäger
Roman
Mit einem Nachwort von Matthias Nawrat
Über dieses Buch
Jack Kerouac zählt mit Allen Ginsberg und William S. Burroughs zu den führenden Stimmen der Beat Generation, die in den späten Fünfzigern des 20. Jahrhunderts eine der prägendsten subkulturellen Bewegungen der USA begründete. Unter dem damals zeitgemäßen Titel «Gammler, Zen und hohe Berge» in Deutschland berühmt geworden, schließt das im Original «The Dharma Bums» genannte Buch an Kerouacs Welterfolg «On the Road» an.
Mal als blinder Passagier auf alten Güterzügen, mal zu Fuß in dünnen Stoffschuhen ist Ray Smith (Kerouac) unterwegs durch Kalifornien — ein wenig ziellos, bis er auf Japhy (Gary Snyder), den Dichterfreund und Zen-Buddhisten, trifft. Gemeinsam mit dem Jodler Morley brechen sie auf in die kaum berührte Natur der High Sierras, um die Lektion der Einsamkeit zu lernen. Sie dichten, sie wandern und meditieren, immer auf der Jagd nach dem Dharma und einem intensiven, sinnerfüllten Leben. Nur: Im wildromantischen San Francisco mit seinen Hipster-Partys, Poetry-Sessions, Trink-Marathons fällt es schwer, vom Weg der Askese nicht wieder abzukommen …
Abenteuerroman, antikonsumistisches Manifest und zugleich «nature writing» at its best. Ein Klassiker der Beat-Literatur, zu Jack Kerouacs 100. Geburtstag am 12.3.2022 in neuer Übersetzung.
Vita
Jack Kerouac, am 12. März 1922 in Lowell/Massachusetts geboren, diente während des Zweiten Weltkriegs in der Handelsmarine, trampte später jahrelang als Gelegenheitsarbeiter kreuz und quer durch die USA und Mexiko und wurde neben William S. Burroughs und Allen Ginsberg der führende Autor der Beat Generation. Mit «On the Road» schrieb er eines der berühmtesten Bücher des 20. Jahrhunderts. Er starb am 21. Oktober 1969 in St. Petersburg/Florida.
Thomas Überhoff, geboren 1954, arbeitet hauptberuflich als Lektor und übersetzt gelegentlich, u.a. Bücher von Denis Johnson, Nell Zink, Rivka Galchen und Jack Kerouac.
Matthias Nawrat, 1979 im polnischen Opole geboren, siedelte als Zehnjähriger mit seiner Familie nach Bamberg um. Für seinen Debütroman «Wir zwei allein» (2012) erhielt er den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis; «Unternehmer» (2014), für den Deutschen Buchpreis nominiert, wurde mit dem Kelag-Preis und dem Bayern 2-Wortspiele-Preis ausgezeichnet, «Die vielen Tode unseres Opas Jurek» (2015) mit dem Förderpreis des Bremer Literaturpreises sowie der Alfred Döblin-Medaille. «Der traurige Gast» (2019) war unter anderem für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. 2020 erhielt Matthias Nawrat den Literaturpreis der Europäischen Union.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1958 unter dem Titel «The Dharma Bums» bei The Viking Press, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2022
Copyright © 1963, 2010 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg,
«The Dharma Bums» Copyright © 1958 by Jack Kerouac.
Die Übersetzung der zitierten Gedichte von Han-Shan stammt aus:Gedichte vom Kalten Berg, aus dem Chinesischen übertragen von Stephan Schuhmacher, Arbor Verlag, Freiburg im Breisgau 2015. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Brandon Colbert Photography/Getty Images
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-00268-5
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Han-Shan gewidmet
1
An einem Mittag im späten September 1955 sprang ich in Los Angeles auf einen Güterzug, ließ mich mit meinem Seesack unter dem Kopf und übergeschlagenen Beinen in einem offenen Waggon nieder und betrachtete die Wolken, während wir nordwärts in Richtung Santa Barbara rollten. Es war ein Bummelzug, und ich wollte in Santa Barbara am Strand übernachten und am nächsten Morgen entweder einen weiteren Bummelzug nach San Luis Obispo erwischen oder später den Sieben-Uhr-Expressgüterzug bis ganz nach San Francisco. Irgendwo in der Nähe von Camarillo, wo Charlie Parker durchgedreht und dann wieder genesen war, kletterte ein dünner kleiner alter Penner in meinen Waggon, als wir auf einem Nebengleis hielten, um einen vorfahrtsberechtigten Zug vorbeizulassen, und schien überrascht, mich dort zu sehen. Er richtete sich am anderen Ende ein, legte, mich im Blick, den Kopf auf seiner eigenen, jämmerlich kleinen Tasche ab und sagte nichts. Bald darauf, als der ostwärts fahrende Güterzug auf dem Hauptgleis vorbeigedonnert war, betätigten sie die Dampfpfeife, und wir fuhren an, während es kälter wurde und vom Meer her Nebel in die warmen Küstentäler zog. Nachdem der kleine Penner und ich erfolglos versucht hatten, uns auf dem kalten Stahl in Decken gehüllt warmzuhalten, standen wir beide auf, schritten, jeder an seinem Wagenende, hin und her, sprangen auf und ab und klopften uns mit den Händen warm. Ziemlich bald stoppten wir an einem kleinen Haltepunkt auf einem weiteren Nebengleis, und ich dachte mir, dass ich gut einen Krug Tokayer brauchen konnte, um die kalte Fahrt durch die Dämmerung bis Santa Barbara zu überstehen. «Passt du mal auf meinen Seesack auf, während ich schnell da rüberlaufe und eine Flasche Wein besorge?»
«Klar.»
Ich sprang an der Seite ab, rannte über den Highway 101 zu dem Laden und kaufte außer Wein noch etwas Brot und ein paar Süßigkeiten. Ich rannte zurück zu meinem Güterzug, der dann aber noch eine Viertelstunde an diesem nun wieder warmen, sonnigen Ort warten musste. Doch es war später Nachmittag und würde bestimmt bald wieder eisig werden. Der kleine Penner saß im Schneidersitz an seinem Ende vor einer kläglichen Mahlzeit, die aus einer Büchse Sardinen bestand. Ich bekam Mitleid mit ihm, ging rüber und sagte: «Wie wär’s mit ’nem bisschen Wein zum Aufwärmen? Und vielleicht magst du Brot und Käse zu deinen Sardinen.»
«Klar.» Er sprach von weit weg mit einer leisen, kehligen Stimme wie einer, der fürchtete oder nicht gewillt war, sich Geltung zu verschaffen. Den Käse hatte ich drei Tage zuvor in Mexico City gekauft, vor der billigen langen Busfahrt, dreitausend Kilometer über Zacatecas, Durango und Chihuahua bis zur Grenze in El Paso. Der Penner verzehrte ihn und das Brot und den Wein mit Genuss und Dankbarkeit. Ich freute mich. Ich erinnerte mich an die Zeile aus dem Diamant-Sutra, die besagt: «Übe Freigiebigkeit, ohne dir einen Begriff davon zu machen, denn Freigiebigkeit ist schließlich nur ein Wort.» Ich war damals sehr gläubig und praktizierte meine Andachten beinahe in Perfektion. Inzwischen bin ich mit meinen Lippenbekenntnissen etwas heuchlerisch geworden und auch ein bisschen müde und zynisch. Bin alt geworden und von nichts mehr zu begeistern … Aber damals glaubte ich wirklich an Freigiebigkeit und Nächstenliebe und Demut und Hingabe und stille Einkehr und Weisheit und Ekstase, und ich glaubte auch, ein Bhikkhu aus alten Zeiten in modernem Gewand zu sein, der die Welt durchwandert (für gewöhnlich das riesige Dreieck New York, Mexico City, San Francisco), um das Rad der Lehre oder des Dharma zu drehen und mir Verdienste als zukünftiger Buddha (Erwecker) und zukünftiger Held im Paradies zu erwerben. Ich hatte Japhy Rider noch nicht kennengelernt, das geschah erst eine Woche später, und auch noch nie irgendwas von «Dharmajägern» gehört, obwohl ich zu der Zeit selbst ein vollendeter Dharmajäger war und mich als religiösen Wanderer betrachtete. Der kleine Penner in dem offenen Güterwagen bekräftigte all meine Glaubenssätze, indem er sich vom Wein die Zunge lösen ließ und ins Reden kam und schließlich einen winzigen Zettel mit einem Gebet der heiligen Theresa herauszog, das verkündete, sie werde sich nach ihrem Tod auf der Erde zeigen, indem sie sie und alle lebendigen Kreaturen auf ihr vom Himmel herab für immer mit Rosen überschütte.
«Woher hast du das?», fragte ich.
«Ach, das hab ich vor ein paar Jahren in einem Lesesaal in Los Angeles aus einer Zeitschrift ausgeschnitten. Ich trag es immer bei mir.»
«Und hockst dich in Güterwagen und liest es?»
«Fast jeden Tag.» Viel mehr sprach er nicht, ging auch nicht näher auf die heilige Theresa ein, war sehr zurückhaltend hinsichtlich seines Glaubens und erzählte mir nur wenig über sein Privatleben. Er gehörte zur Sorte der stillen kleinen Penner, der man nicht mal auf der Skid Row groß Beachtung schenkt, geschweige denn auf der Hauptstraße. Wenn ihn ein Cop verscheuchte, legte er einen Zahn zu und verschwand, und wenn auf den Rangierbahnhöfen großer Städte bei der Ausfahrt eines Güterzuges Sicherheitsärsche unterwegs waren, würden sie den kleinen Mann, der sich in den Sträuchern verbarg und im Dunkeln aufsprang, wahrscheinlich nie erspähen. Als ich ihm erzählte, ich hätte vor, am nächsten Abend auf den Express-Zipper aufzuspringen, sagte er: «Ah, du meinst den Midnight Ghost.»
«Nennst du den Zipper so?»
«Du hast wohl mal auf dieser Linie gearbeitet?»
«Hab ich, als Bremser bei der Southern Pacific.»
«Na ja, wir Hobos nennen ihn den Midnight Ghost, weil du in L.A. draufspringst und dich bis zum Morgen in San Francisco keiner mehr zu Gesicht bekommt, so schnell ist das Ding.»
«Hundertzwanzig Stundenkilometer auf den Geraden, Alter.»
«Stimmt, aber nachts wird es mächtig kalt, wenn du dann nördlich von Gavioty und oben um Surf herum die Küste raufzischst.»
«Surf, richtig, und dann durch die Berge südlich von Margarita.»
«Margarity, stimmt, aber ich bin öfter mit dem Midnight Ghost gefahren, als ich zählen kann.»
«Wie viele Jahre warst du nicht zu Hause?»
«Bestimmt mehr, als ich zählen möchte. Ursprünglich komm ich aus Ohio.»
Aber der Zug fuhr los, der Wind wurde kalt und nebelfeucht, und die folgenden anderthalb Stunden verwendeten wir unsere ganze Kraft und unseren ganzen Willen darauf‚ nicht zu sehr zu bibbern und mit den Zähnen zu klappern. Ich kauerte mich hin und meditierte über die Wärme, die tatsächliche Wärme Gottes, um die Kälte abzuhalten; dann sprang ich auf und ab, schwang die Arme und Beine und sang. Der kleine Penner hatte mehr Geduld als ich; die meiste Zeit lag er nur da und käute mit verbittert verzogenen Lippen sein Essen wieder. Ich schnatterte mit den Zähnen und hatte blaue Lippen. Bei Anbruch der Dunkelheit sahen wir erleichtert die vertrauten Berge von Santa Barbara Gestalt annehmen; bald würden wir halten und uns in der warmen, sternenhellen Nacht über den Gleisen aufwärmen.
Am Bahnübergang, wo wir absprangen, verabschiedete ich mich vom kleinen Penner der heiligen Theresa und ging los, um die Nacht mit meinen Decken im Sand zu verbringen, ganz hinten am Strand am Fuß einer Klippe, wo die Cops mich nicht sehen und vertreiben würden. Ich röstete Hotdogs an frisch geschnittenen und angespitzten Stöcken über der Glut eines großen Holzfeuers, machte in dessen Kuhlen eine Dose Bohnen und eine Dose Käse-Makkaroni heiß, trank meinen frisch erworbenen Wein und begann jauchzend eine der angenehmsten Nächte meines Lebens zu verbringen. Ich watete ins Wasser, tauchte kurz darin ein, stand dann da und blickte zu dem prachtvollen Nachthimmel auf, zu Avalokiteshvaras zehnfach mit Wundern gespicktem Universum aus Dunkel und Diamanten. «Tja, Ray», sage ich freudestrahlend, «nur noch ein paar Kilometer. Hast du’s wieder mal geschafft.» Glücklich. Nur in Badehose, barfuß, mit wildem Haar im feuerroten Dunkel singen, Wein saufen, ausspucken, rumhüpfen und -laufen – so muss man leben. Ganz allein und frei im weichen Sand des Strandes mit dem Seufzen der See da draußen und den jungfräulichen, mütterlich zwinkernden Eileitern der warmen Sterne, die sich auf den fließenden Strömen im Bauch des Santa-Barbara-Kanals spiegeln. Und wenn deine Dosen glühend heiß sind und du sie nicht mit der Hand anfassen kannst, nimm einfach die guten alten Rangiererhandschuhe, und fertig ist die Laube. Ich ließ das Essen ein bisschen abkühlen, um mich weiter dem Wein und meinen Gedanken zu widmen. Ich setzte mich mit gekreuzten Beinen in den Sand und sann über mein Leben nach. Tja, nun, und machte das einen Unterschied? «Was wird mir noch alles widerfahren?» Dann ließ mir der Wein das Wasser im Mund zusammenlaufen, und bald musste ich mich über diese Hotdogs hermachen, biss sie direkt vom Stockende, und mampf, mampf, mit dem alten Reiselöffel tief in die leckeren Dosen, große Löffel voll heißer Bohnen und Schweinefleisch rausholen, oder Makkaroni in kochendheißer Sauce und vielleicht einem bisschen Sand drin. «Und wie viele Sandkörner gibt es hier an diesem Strand?», denke ich. «Ach, so viele wie Sterne am Himmel!» (mampf, mampf), und wenn das stimmt, «wie viele Menschen sind hier schon gewesen, ja wie viele Lebewesen überhaupt seit Anbeginn der anfanglosen Zeiten? Ach, hey, da müsste man wohl die Zahl der Sandkörner an diesem Strand und auf jedem Stern am Himmel in jedem einzelnen der zehntausend großen Chiliversen ausrechnen, und das ergäbe eine Zahl von Sandkörnern, die weder IBM noch Burroughs berechnen könnten, und Junge, Junge, ich habe keinen Schimmer (großer Schluck Wein), «ich habe keinen Schimmer, aber dann dürften es wohl ein paar Zigtrillionen Sextillionen unzählbarer, vom Glauben abgefallener welker Rosen sein, mit denen dich die süße heilige Theresa und der zarte kleine Alte in diesem Augenblick überschütten, und Lilien noch dazu.»
Dann, nachdem ich aufgegessen und mir die Lippen mit meinem roten Halstuch abgewischt hatte, spülte ich das Geschirr mit Salzwasser, trat gegen ein paar Klumpen Sand, spazierte auf und ab, trocknete und verstaute das Geschirr, steckte den Löffel wieder in den salzverkrusteten Seesack und rollte mich zu einer guten, verdienten Nachtruhe in meine Decken. Mitten in der Nacht wache ich auf, «waaa?, wo bin ich, was für ein Basketballspiel um die Ewigkeit spielen die Mädchen da mit mir im alten Haus meines Lebens; das Haus steht doch nicht in Flammen, oder?», aber es ist bloß das streifige Anrauschen der Wellen, die sich mit der Flut höher und dichter an mein Deckenbett heranbuckeln. «Ich werde so hart und alt wie eine Muschelschale», und ich schlafe wieder ein und träume, dass ich im Schlaf allein beim Atmen drei Scheiben Brot verbrauche … Ah, der arme Geist des Menschen und ein einsamer Mensch allein am Strand und Gott, der aufmerksam lächelnd zusieht, würde ich sagen … Und ich träumte von zu Hause vor langer Zeit in New England, meine kleinen Miezekatzen liefen tausend Kilometer im Bemühen, mir auf dem Weg durch Amerika zu folgen, und meine Mutter mit einem Seesack auf dem Buckel, und mein Vater rannte dem ewig flüchtigen, uneinholbaren Zug hinterher, und ich träumte und wachte in grauer Morgendämmerung auf, sah ihn, schnaubte (weil ich den ganzen Horizont hatte kippen sehen, als wäre ein Bühnenarbeiter schnell hingeeilt, um ihn wieder geradezurichten und mich glauben zu machen, dass er echt war), drehte mich um und schlief wieder ein. «Es ist alles eins», hörte ich meine Stimme in diese Leere hinein sagen, die im Schlaf ganz leicht zu umfassen ist.
2
Der kleine Penner der heiligen Theresa war der erste richtige Dharmajäger, den ich kennenlernte, und der zweite war gleich die Nummer eins unter den Dharmajägern, und in Wahrheit hatte er, Japhy Ryder, den Begriff überhaupt erst geprägt. Japhy Ryder war ein Bursche aus dem östlichen Oregon, mit Vater, Mutter und Schwester in einer Blockhütte tief im Wald aufgewachsen, ein Kind der Wälder, Holzfäller, Farmer, an Tieren und indianischen Überlieferungen interessiert, weshalb er, als er schließlich aufs College kam, so oder so schon ziemlich gut auf seine frühen Studien der Anthropologie und später der indianischen Mythen und der dazugehörigen Texte vorbereitet war. Schließlich lernte er Chinesisch und Japanisch, wurde Orientalist und entdeckte die größten aller Dharmajäger: die Zen-Verrückten aus China und Japan. Als idealistisch geprägter Junge aus dem Nordwesten begann er sich für den guten altmodischen IWW-Anarchismus zu interessieren und lernte, passend zu seiner Begeisterung für indianische Lieder und Volksmusik im Allgemeinen, Gitarre zu spielen und alte Arbeiterlieder zu singen. Zum ersten Mal sah ich Japhy in der folgenden Woche in San Francisco die Straße runterlaufen (nachdem ich die ganze Strecke von Santa Barbara rauf in einer einzigen langen, rasenden Fahrt getrampt war, mitgenommen hatte mich, als ob mir das jemand glauben würde, eine schöne, liebreizende, junge Blondine in einem schneeweißen schulterfreien Badeanzug, barfuß und mit einem Goldkettchen um den Knöchel, die einen nagelneuen zimtbraunen Lincoln Mercury fuhr und Benzedrin wollte, damit sie bis in die Stadt durchbrettern konnte, und, als ich sagte, ich hätte welches in meinem Seesack, «Abgefahren!» schrie) – ich sah Japhy also mit diesen merkwürdig ausgreifenden Bergsteigerschritten die Straße entlangkantern, einen kleinen Tornister auf dem Rücken, gefüllt mit Büchern, Zahnbürsten und was weiß ich, der sein Ausgehranzen für die Stadt war, im Gegensatz zu seinem großen, mit Schlafsack, Poncho und Kochtöpfen vollgestopften Rucksack. Er trug ein Ziegenbärtchen und sah mit seinen leicht schräggestellten grünen Augen seltsam orientalisch aus, so gar nicht wie ein Bohemien, und er war auch weit davon entfernt, einer zu sein (ein bloßer Mitläufer auf dem Gebiet der Künste). Er war drahtig, gebräunt, lebhaft, ganz «Wie geht’s?» und fröhliches Geplauder, sogar den Pennern auf der Straße rief er ein Hallo zu, und wenn ihm eine Frage gestellt wurde, kam die Antwort spontan aus der Eingebung oder aus der Hüfte, ich weiß nicht, woher, und immer sprühend und perlend.
«Wo hast du diesen Ray Smith aufgetan?», fragten sie ihn, als wir ins Place kamen, die Lieblingsbar der hippen Vögel von Beach.
«Ach, ich lese meine Bodhisattvas doch immer auf der Straße auf!», rief er und bestellte Bier.
Das war ein großer Abend, ein historischer in mehr als einer Hinsicht. Er und ein paar andere Lyriker (er schrieb auch Gedichte und übersetzte chinesische und japanische Lyrik ins Englische) sollten in der Six Gallery in der Stadt lesen. Vorher trafen sich alle in der Bar, um sich anzutörnen. Aber als sie da standen und saßen, fiel mir auf, dass er als Einziger nicht wie ein Dichter aussah, obwohl er wirklich einer war. Die anderen waren alle Hornbrille tragende Intellekto-Hipster mit ungebändigter schwarzer Mähne wie Alvah Goldbook oder zarte blasse hübsche Wortschmiede wie Ike O’Shay (im Anzug) oder jenseitig vornehm wirkende Renaissance-Italiener wie Francis DaPavia (der wie ein junger Priester aussieht) oder alte Anarcho-Knochen mit Strubbelhaar und Fliege wie Rheinhold Cacoethes oder dicke bebrillte schweigsame Riesenbabys wie Warren Coughlin. All diese hoffnungsvollen Poeten standen in ihren verschiedenen Aufzügen rum, mit an den Ellbogen durchgescheuerten Cordsakkos, abgetretenen Schuhen und Büchern, die ihnen aus den Taschen lugten. Japhy dagegen steckte in groben Arbeiterklamotten, die er sich gebraucht in Kleiderkammern besorgt hatte, damit er damit klettern, wandern, nachts draußen sitzen, Lagerfeuer machen und die Küste auf und ab trampen konnte. Außerdem hatte er in seinem Tornister ein lustiges grünes Tirolerhütchen, das er, für gewöhnlich mit einem Jodler, aufsetzte, bevor er dann tausend Meter aufwärts schnürte. Er trug Bergsteigerstiefel, teure italienische, sein ganzer Stolz, in denen er über den mit Sägemehl bestreuten Boden der Bar stapfte wie ein alter Holzfäller. Japhy war nicht groß, bloß ungefähr eins siebzig, aber kräftig, drahtig, beweglich und muskulös. Sein Gesicht war eine traurige Knochenmaske, aber seine Augen über dem Ziegenbärtchen funkelten wie die Augen dieser alten, kichernden chinesischen Weisen und glichen das Kantige seiner hübschen Gesichtszüge aus. Seine Zähne waren ein bisschen braun, vernachlässigt während seiner Jugend im Wald, aber nicht, dass es einem auffiel, wenn er weit den Mund aufriss und schallend über irgendeinen Witz lachte. Manchmal wurde er still und starrte nur traurig auf den Boden, wie ein Mann, der an irgendwas herumschnitzt. Manchmal war er voller Überschwang. Er nahm großen Anteil an mir und meiner Geschichte über den kleinen Penner der heiligen Theresa und auch an den Geschichten, die ich ihm über meine eigenen Erfahrungen als Hobo, Tramper und Wanderer in den Wäldern erzählte. Von Anfang an behauptete er, ich sei ein toller «Bodhisattva», was «großes weises Wesen» oder «großer weißer Engel» bedeutet, und ich würde die Welt mit meiner Offenheit zieren. Wir hatten auch denselben buddhistischen Lieblingsheiligen: Avalokiteshvara oder, im Japanischen, die elfköpfige Kwannon. Er kannte sich in allen Einzelheiten des tibetischen und chinesischen, des Mahayana-, Hinayana-, des japanischen und sogar des burmesischen Buddhismus aus, aber ich warnte ihn gleich, dass mich die Mythologie und all die Namen und nationalen Ausprägungen des Buddhismus nicht die Bohne interessierten, sondern allein die erste der vier edlen Wahrheiten des Shakyamuni: Alles Leben ist Leiden. Und vielleicht noch die dritte: Dieses Leiden kann überwunden werden, was ich damals nicht ganz glauben konnte. Denn ich hatte das Lankavatara-Sutra noch nicht verdaut, das zeigt, dass es auf der Welt nur den Geist gibt und deshalb alles möglich ist, also auch die Überwindung des Leidens. Japhys bester Kumpel war das bereits erwähnte Riesenbaby, der gute alte großherzige Warren Coughlin mit seinen hundert Kilo Dichterfleisch, von dem Japhy mir (indem er mir ins Ohr flüsterte) kundtat, dass mehr in ihm steckte, als das Auge verriet.
«Was denn?»
«Er ist mein bester alter Freund aus Oregon, wir kennen uns schon ewig. Zuerst glaubst du, er wäre langsam und dumm, aber in Wahrheit funkelt er wie ein Diamant. Du wirst schon sehen. Lass dich ja nicht von ihm einwickeln. Er legt dir beim kleinsten falschen Wort das Hirn in Knoten.»
«Wieso?»
«Er ist ein großer rätselhafter Bodhisattva, glaube ich, vielleicht eine Reinkarnation von Asanga, dem großen Mahayana-Gelehrten von anno dazumal.»
«Und wer bin dann ich?»
«Keine Ahnung. Vielleicht bist du Ziege.»
«Ziege?»
«Vielleicht bist du Matschgesicht.»
«Wer ist Matschgesicht?»
«Matschgesicht ist der Matsch in deinem Ziegengesicht. Was würdest du sagen, wenn einer die Frage gestellt bekäme: ‹Kann ein Hund die Buddha-Natur haben?›, und mit ‹Wuff!› antworten würde?»
«Ich würde sagen, ein ziemlicher Haufen alberner Zen-Scheiß.» Das bremste Japhy ein bisschen. «Hör zu, Japhy», sagte ich, «ich bin kein Zen-Anhänger, ich bin ein ernsthafter Buddhist, ein altmodischer verträumter Hinayana-Feigling aus den späten Mahayana-Zeiten», und so weiter in den Abend hinein, mit dem Argument, dass der Zen-Buddhismus nicht so sehr auf Nächstenliebe aus war wie auf die Verwirrung des Intellekts, damit dieser die Illusion im Kern aller Dinge besser wahrzunehmen lernte. «Das ist doch gemein», beklagte ich mich, «all diese Zen-Meister, die junge Leute mit dem Kopf in den Dreck stoßen, weil sie keine Antwort auf ihre blöden Worträtsel wissen.»
«Das tun sie, weil sie ihnen klarmachen wollen, dass Dreck besser ist als Worte, mein Junge.» Aber ich kann hier gar nicht (obwohl ich’s versuche) genau wiedergeben, wie scharfsinnig Japhy mir antwortete, konterte und mich mit seinen Worten einwickelte und die ganze Zeit auf Trab hielt und mir schließlich doch etwas in meinen kristallenen Dickschädel hämmerte, das mich meine Lebenspläne ändern ließ.
Jedenfalls folgte ich an diesem Abend, der, neben anderem Wichtigem, die Geburtsstunde der San Franciso Poetry Renaissance war, der ganzen Bande heulender Dichter zur Lesung in der Six Gallery. Alle waren da. Es war eine verrückte Nacht. Und ich selbst brachte den Laden in Schwung, indem ich die Runde machte und von dem etwas steif am Rande stehenden Publikum Dimes und Quarters einsammelte, um mit drei bauchigen Riesenflaschen kalifornischen Burgunders zurückzukommen, der alle beschickert machte, sodass gegen elf, als Alvah Goldbook blau und mit ausgebreiteten Armen sein Gedicht «Jaul» vortrug, nein, -jaulte, der ganze Saal schrie: «Mehr, mehr, mehr!» (wie bei einer Jam Session) und der alte Rheinhold Cacoethes, der Vater der Dichterszene von San Francisco, sich vor Glück die Tränen aus den Augen wischte. Japhy selbst las seine feinen Gedichte über Coyote, den Gott der nordamerikanischen Plateau-Indianer (glaube ich), oder zumindest der Indianer des Nordwestens, der Kwakiutl und was weiß ich. «Leckt mich!, sang Coyote, und lief davon!», las Japhy ins geneigte Publikum, und die Leute schrien vor Freude, denn das alles klang so rein und pur, der Fluch wie neugeboren. Er ließ auch zarte lyrische Passagen einfließen, etwa die über Beeren fressende Bären, die seine Tierliebe bewiesen, und großartig verrätselte Verse über Ochsen auf mongolischen Straßen, die von seiner Kenntnis der ostasiatischen Literatur zeugten, bis hin zu Xuanzang, dem großen chinesischen Mönch, der mit Räucherstäbchen in der Hand von China nach Tibet, von Lanzhou nach Kaschgar und dann in die Mongolei gewandert war. Danach ließ er seinem Kneipenhumor mit Versen über Coyote, der Leckereien bringt, freien Lauf. Und verbreitete seine anarchistischen Ansichten über die Amerikaner, die nicht zu leben wissen und in Vorstädten in Wohnzimmern hausen, in denen das Holz armer, mit Kettensägen gefällter Bäume verbaut ist (was auf seine Erfahrungen als Holzfäller oben im Norden zurückging). Seine Stimme klang tief, sonor und irgendwie trotzig, wie die von amerikanischen Helden und Volksrednern aus alter Zeit. Ich mochte das Ernste, Kraftvolle und menschlich Hoffnungsvolle an ihm, während die anderen Dichter entweder zu eklektisch daherkamen oder zu hysterisch und zynisch, um noch irgendwelche Hoffnungen zu hegen, oder zu abstrakt und hausbacken oder zu politisch oder, wie Coughlin, zu unverständlich (wenn er über «ungeklärte Prozesse» sprach, obwohl mir, als er sagte, dass die Offenbarung eine persönliche Angelegenheit sei, ein starker buddhistischer Glaube und sein Idealismus auffielen, die ihm Japhy in Zeiten ihrer Collegefreundschaft mitgegeben hatte, so wie ich meinen in der Dichterszene im Osten an Alvah und andere weitergegeben hatte, die weniger apokalyptisch gesinnt und stabiler gebaut waren als er, aber keinesfalls mitfühlender und emotionaler).
Unterdessen standen Trauben von Menschen in der abgedunkelten Galerie und lauschten, um jedes Wort dieser erstaunlichen Lesung mitzubekommen, während ich von Grüppchen zu Grüppchen spazierte, mich von der Bühne ab- und ihnen zuwandte und sie drängte, an der gluckernden Pulle zu nuckeln, oder ich lief zurück, setzte mich rechts neben die Bühne und kommentierte das Geschehen mit kleinen Wows und Jas und sogar mit anfeuernden Sätzen, ohne dass mich jemand dazu aufgefordert hätte, aber im allgemeinen Trubel hatte auch niemand was dagegen. Es war ein großartiger Abend. Der zarte Francis DaPavia las von zarten gelben oder pinken Dünndruckseiten, in denen er behutsam mit langen weißen Fingern blätterte, die Gedichte seines toten Kumpels Altman vor, der in Chihuahua zu viel Peyote gegessen hatte (oder an Polio gestorben war), aber keine seiner eigenen – eine an und für sich entzückende Geste, dem Gedenken an den jung verstorbenen Dichter gewidmet, die immerhin den Cervantes aus Kapitel sieben zu Tränen rührte, doch er las mit einem zarten, britisch klingenden Akzent, der mich insgeheim losprusten ließ, obwohl ich Francis später kennenlernte und mochte.
Unter den Leuten im Publikum stand auch Rosie Buchanan, eine junge Frau mit kurzgeschnittenen roten Haaren, knochig und hübsch, ein echter Feger und mit jedermann befreundet, der in Beach was zählte; früher war sie die Muse eines Malers gewesen, dann begann sie zu schreiben, und zu jener Zeit sprühte sie vor Elan, weil sie in meinen alten Kumpel Cody verliebt war. «Toll, was, Rosie?», rief ich, und sie nuckelte kräftig an meiner Pulle und strahlte mich an. Cody stand, die Arme um ihre Taille geschlungen, direkt hinter ihr. Zwischen den Lesungen erhob sich immer wieder Rheinhold Cacoethes mit seiner Fliege und seinem schäbigen alten Mantel und hielt mit spöttischer Stimme eine kleine, witzige Rede, um den nächsten Vortragenden anzukündigen, aber wie schon gesagt, als es halb zwölf wurde und alle Gedichte gelesen waren und die Leute rumliefen und sich fragten, was dort soeben vorgefallen war und was in der amerikanischen Dichtkunst als Nächstes passieren würde, wischte er sich die Augen mit seinem Taschentuch trocken. Und wir, die Dichter, scharten uns alle um ihn, fuhren dann mit mehreren Autos nach Chinatown rein, bestellten ein enormes, fantastisches Dinner, mit Stäbchen und von der chinesischen Karte, und debattierten mitten in der Nacht in einem dieser großartigen swingenden chinesischen Lokale von San Francisco lautstark über den Tisch hinweg. Zufällig war es Japhys Lieblingschinese, das Nam Yuen, und er zeigte mir, wie man bestellte und mit Stäbchen aß, und erzählte mir dabei Anekdoten über die fernöstlichen Zen-Verrückten und versetzte mich schließlich in ein derartiges Glück (wir hatten auch eine Flasche Wein auf dem Tisch), dass ich zu einem alten Koch rüberging, der im Kücheneingang stand, und ihn fragte: «Warum kam Bodhidharma aus dem Westen?» (Bodhidharma war der Inder, der den Buddhismus gen Osten nach China gebracht hatte.)
«Mir doch egal», sagte der alte Koch mit schweren Lidern, was ich Japhy erzählte, und der sagte: «Perfekte Antwort, absolut vollkommen. Jetzt weißt du, was ich mit Zen meine.»
Ich hatte noch eine Menge zu lernen. Vor allem aber, wie man mit Mädchen umging – auf Japhys unvergleichliche, zen-verrückte Weise, die ich in der folgenden Woche aus nächster Nähe erleben konnte.
3
Ich wohnte in Berkeley bei Alvah Goldbook in dessen kleinem, mit Rosen überwachsenem Gartenhaus hinter einem größeren Gebäude an der Milvia Street. Die morsche alte Veranda sackte nach vorn auf den Boden durch; unter Ranken stand ein hübscher alter Schaukelstuhl, auf dem ich jeden Morgen saß und mein Diamant-Sutra las. Der Garten war voll mit beinahe reifen Tomaten und Minze, Minze, alles roch nach Minze, dazu ein alter Baum, unter dem ich an jenen kühlen, vollkommen sternenklaren kalifornischen Oktoberabenden, die von nichts auf der Welt zu übertreffen sind, gern saß und meditierte. Wir hatten eine perfekte kleine Küche mit einem Gasherd, zwar ohne Kühlschrank, aber egal. Wir hatten auch ein perfektes kleines Bad mit Wanne und Warmwasser und einen großen Raum, in dem Kissen, Strohmatten und Matratzen zum Schlafen lagen und Bücher, Bücher, Hunderte Bücher überall von Catull über Pound bis Blyth und Platten von Bach und Beethoven (sogar ein swingendes Ella-Fitzgerald-Album mit Clark Terrys sehr interessantem Trompetenspiel) und ein guter Webcor-Plattenspieler mit drei Geschwindigkeiten, der laut genug war, dass man damit das Dach runterblasen konnte; das allerdings bestand nur aus Sperrholz, wie auch die Wände, deren eine ich in einem unserer zen-verrückten Räusche eines Nachts vor lauter Übermut mit der Faust durchschlug, und Coughlin kriegte das mit und schob den Kopf hindurch.
Ungefähr anderthalb Kilometer entfernt, eine ganze Ecke die Milvia runter und dann den Hügel zum Campus der University of California wieder rauf, hinter einem weiteren großen alten Gebäude an einer stillen Straße (Hillegass) wohnte Japhy in seiner eigenen Hütte, die unendlich viel kleiner war als unsere, etwa drei fünfzig mal drei fünfzig, mit kaum etwas drin außer typischen Japhy-Gerätschaften, die von seinem Glauben an das einfache Mönchsleben kündeten – keine Stühle, nicht mal ein sentimentaler Schaukelstuhl, sondern nur Strohmatten. In der Ecke stand sein berühmter Rucksack, darin die geputzten Töpfe und Pfannen, ineinander passend und mit einem blauen Halstuch zu einem kompakten Bündel verschnürt. Dann seine japanischen Pata-Holzsandalen, die er nie benutzte, und ein Paar schwarze japanische Strümpfe, in denen er weich über seine hübschen Strohmatten gehen konnte, Platz für vier Zehen auf der einen und für den großen auf der anderen Seite. Ein Stapel Orangenkisten war mit schönen, gelehrten Büchern gefüllt, einige in orientalischen Sprachen, all die großen Sutras samt Kommentaren, eine Gesamtausgabe von D. T. Suzuki und eine edle vierbändige Ausgabe japanischer Haikus. Überhaupt hatte er eine riesige Sammlung hochwertiger Lyrikbände. Wenn ein Dieb dort eingebrochen wäre – das Wertvollste wären die Bücher gewesen. Japhys Kleidung war komplett aus zweiter Hand, mit immer leicht abwesender, entrückter Miene in Kleiderkammern oder Läden der Heilsarmee gekauft: gestopfte Wollsocken, gefärbte Unterhemden, Jeans, Arbeitshemden, Mokassins und ein paar Rollkragenpullover, die er in den kalten Bergnächten auf den High Sierras in Kalifornien oder den High Cascades in Washington und Oregon übereinander trug, wenn er diese langen, unglaublichen, bisweilen Wochen dauernden Wanderungen mit nur ein paar Kilo Trockennahrung im Gepäck unternahm. Mehrere Orangenkisten ergaben einen Tisch, auf dem eines schönen Spätnachmittags, als ich bei ihm ankam, eine friedlich dampfende Tasse Tee stand, während Japhy daneben das weise Haupt über die chinesischen Schriftzeichen des Dichters Han-Shan beugte. Coughlin hatte mir die Adresse gegeben, und als Erstes sah ich Japhys Fahrrad auf dem Rasen vor dem Vorderhaus (in dem seine Vermieterin wohnte), dann die paar seltsam geformten Felsen und Steine, die er von seinen Bergwanderungen mitgebracht und so ausgelegt hatte, dass sie seinen eigenen «japanischen Teegarten» oder «Teehaus-Garten» bildeten, und die stilgerecht über seinem kleinen Domizil aufragende Kiefer.
Nie hat sich mir eine friedvollere Szene geboten als an diesem recht frischen, sich rötlich färbenden Spätnachmittag, an dem ich ohne weitere Umstände die schmale Tür aufmachte, reinschaute und Japhy hinten in der Hütte mit gekreuzten Beinen auf einem Paisleykissen auf der Strohmatte sitzen sah; er trug seine Lesebrille, was ihn alt, gelehrt und weise aussehen ließ, im Schoß sein Buch und neben ihm die dampfende Porzellantasse und die kleine Blechteekanne. Er sah gelassen auf, erkannte mich, sagte: «Ray, komm rein», und vertiefte sich wieder in die Schrift.
«Was machst du da?»
«Ich übersetze Han-Shans große ‹Gedichte vom Kalten Berg›, die vor tausend Jahren entstanden sind; Teile davon hat er an Felswände Hunderte Kilometer entfernt von irgendeinem lebendigen Wesen gekritzelt.»
«Wow.»
«Aber wenn du dieses Haus betrittst, musst du dir die Schuhe ausziehen, siehst du diese Strohmatten, die gehen durch Schuhe kaputt.» Also zog ich meine blauen Segeltuchschuhe mit den weichen Sohlen aus, stellte sie brav an die Tür, er warf mir ein Kissen zu, ich setzte mich im Schneidersitz an die Wand aus Holzlatten, und er bot mir eine Tasse heißen Tee an. «Hast du jemals das Buch vom Tee gelesen?», fragte er.
«Nein, was ist das?»
«Eine wissenschaftliche Abhandlung über das Teetrinken, in die alle in zweitausend Jahren gesammelten Erkenntnisse darüber eingeflossen sind. Manche der Beschreibungen, wie der erste, zweite und dann der dritte Schluck Tee wirken, sind wirklich wild und ekstatisch.»
«Diese Typen sind von Luft high geworden, was?»
«Schlürf deinen Tee, dann wirst du schon sehen; das ist ein guter grüner.» Er war wirklich gut, und sogleich fühlte ich mich ruhig und erwärmt. «Soll ich dir mal ein Stück aus diesem Gedicht von Han-Shan vorlesen? Dir was über ihn erzählen?»
«Klar.»
«Han-Shan war nämlich ein chinesischer Gelehrter, der die Nase von der Stadt und der Welt vollhatte und abgehauen ist, um sich in den Bergen zu verstecken.»
«Das klingt ja schwer nach dir selbst.»
«Damals konnte man das noch wirklich machen. Er lebte in einer Höhle in den Tiantai-Bergen nicht weit von einem buddhistischen Kloster in der Provinz Tang Hsiang, und sein einziger Freund unter den Menschen war der komische Zen-Verrückte Shi-te, der im Kloster Arbeit gefunden hatte und es mit einem Strohbesen ausfegte. Immer mal wieder kam Han-Shan in seinen Kleidern aus Rinde von seinem Kalten Berg runter, trat in die warme Küche und wartete auf eine Mahlzeit, aber keiner der Mönche gab ihm zu essen, weil er sich weigerte, dem Orden beizutreten und dreimal am Tag auf den Glockenschlag hin zu meditieren. Da siehst du, warum er bei einigen seiner Äußerungen – hör zu, ich schau hier in den chinesischen Text und les es dir vor», und ich beugte mich über seine Schulter und beobachtete, wie er aus den großen wilden Krähentritten der chinesischen Schriftzeichen las: «Ich steige, steige auf den Kalten Berg, die Reise will nicht enden, die Schlucht entlang über Steine, durch nebelfeuchtes Gras im weiten Tal, das Moos ist glitschig, nicht nur wenn es regnet, die Föhren knarren, doch es geht kein Wind, wer kann sich befreien aus den Verstrickungen der Welt, mit mir zu sitzen zwischen weißen Wolken.»
«Wow.»
«Natürlich ist das meine Interpretation, es sind fünf Zeichen pro Zeile, aber ich muss noch westliche Präpositionen, Artikel und so weiter einfügen.»
«Warum übersetzt du es nicht einfach so, wie es da steht, fünf Zeichen, fünf Wörter? Was bedeuten diese ersten fünf?»
«Das da steht fürs Klettern, das für hinauf, das für kalt, das für Berg und das für Pfad.»
«Dann übersetz doch ‹Erklimme Pfad zum Kalten Berg›.»
«Ja, aber was machst du mit den Zeichen für lang, Schlucht, ersticken, Lawine und Stein?»
«Wo steht das?»
«Das ist die dritte Zeile, es müsste ‹lange Schlucht erstickt Lawine Stein› lauten.»
«Das ist doch noch besser!»
«Tja, darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber es muss von den Sinologen hier an der Universität abgesegnet werden und im Englischen Sinn ergeben.»
«Junge, aber das ist doch großartig», sagte ich und sah mich in der kleinen Hütte um, «und du sitzt hier so ganz still in dieser stillen Stunde und studierst das ganz allein mit deiner Brille auf der –»
«Ray, du musst unbedingt bald mal mit mir auf einen Berg steigen. Wie wär’s mit dem Matterhorn?»
«Toll! Wo ist das?»
«Oben in den High Sierras. Wir könnten mit Henry Morley in seinem Auto hinfahren, unsere Rucksäcke mitnehmen und vom See aus losgehen. Dann packe ich in meinen die ganzen Lebensmittel und alles, was wir sonst so brauchen, und du leihst dir Alvahs kleinen aus und tust Wechselsocken, Schuhe und solches Zeug rein.»
«Was bedeuten diese Schriftzeichen hier?»
«Sie bedeuten, dass Han-Shan, nachdem er viele Jahre da oben herumgezogen ist, vom Berg herunterkommt, um seine Leute in der Stadt zu sehen, und er sagt: ‹Einst kam ich, auf dem Kalten Berg zu sitzen› und so weiter, ‹besuchte gestern meine Freunde und Verwandten, die Mehrzahl ging längst zu den Gelben Quellen› – die gelben Quellen bedeuten den Tod –, ‹morgens steh ich verwaistem Schatten gegenüber, ich kann nicht mit feuchten Augen lernen.›»
«Auch das klingt sehr nach dir, Japhy, mit feuchten Augen lernen.»
«Ich habe keine feuchten Augen!»
«Aber irgendwann stehen dir doch die Tränen in den Augen?»
«Irgendwann bestimmt, Ray … und schau hier: ‹Wie eisig kalt es hier im Gebirge ist, nicht erst in diesem Jahr›, er ist nämlich wirklich hoch oben, vielleicht drei- oder dreieinhalbtausend Meter, ganz weit oben, und er sagt: ‹Schartige Gipfel, unter ewigem Schnee erstarrt, düstere Wälder speien Nebelschwaden, Gras wächst erst nach der Ährenzeit, die Blätter fallen schon vor Herbstanfang, und doch bin ich so high wie ein Junkie –›»
«Wie ein Junkie!»
«So übersetze ich das, eigentlich sagt er, er sei so high wie der genussfreudige Städtebewohner unten, aber ich übertrage es eben in die Moderne.»
«Toll.» Ich erkundigte mich, warum Han-Shan Japhys Held war.
«Weil», sagte er, «er ein Dichter war, ein Mann der Berge, ein Buddhist, der sich der Meditation über die Essenz aller Dinge gewidmet hat, übrigens auch ein Vegetarier, obwohl ich ihm da nicht ganz folgen kann, weil ich denke, dass es ein bisschen haarspalterisch ist, in der heutigen Welt Vegetarier zu sein, denn alle empfindungsfähigen Wesen essen doch, was sie kriegen. Und er war ein Mensch, der die Einsamkeit liebte, der ganz allein losziehen, ein reines Leben führen und sich treu sein konnte.»
«Das klingt schon wieder sehr nach dir.»
«Auch nach dir, Ray. Ich habe nicht vergessen, was du mir erzählt hast über die Wälder in North Carolina und wie du da meditiert hast und so.» Japhy war sehr bedrückt und verhalten, noch nie hatte ich ihn derart still, melancholisch und nachdenklich erlebt, er sprach so zärtlich wie eine Mutter und schien von fern auf eine arme, sehnsuchtsvolle Kreatur (mich) einzureden, die es nach seiner Botschaft verlangte, ganz unaufgeregt und irgendwie richtig in Trance.
«Hast du heute schon meditiert?»
«Klar, ich meditiere immer gleich morgens vor dem Frühstück, und am Nachmittag meditiere ich noch mal ziemlich lange, wenn mich keiner unterbricht.»
«Wer unterbricht dich denn?»
«Ach, irgendwelche Leute. Manchmal Coughlin, und gestern kamen Alvah und Rol Sturlason, und dann gibt’s noch dieses Mädchen, das manchmal zum Yabyum-Spielen vorbeischaut.»
«Yabyum? Was ist das?»
«Du weißt nicht, was Yabyum ist, Smith? Das erzähl ich dir ein andermal.»
Er schien zu traurig zu sein, um über Yabyum zu reden; was das war, fand ich erst ein paar Abende später heraus. Wir sprachen noch eine Weile über Han-Shan und Gedichte an Felswänden, und als ich schließlich aufbrach, kam ihn sein Freund Rol Sturlason besuchen, ein großer, gutaussehender Blondschopf, der über seine bevorstehende Reise nach Japan mit ihm sprechen wollte. Dieser Rol Sturlason interessierte sich für den berühmten Ryoanji-Steingarten des Klosters Shokokuji in Kyoto, eigentlich nur alte Felsen, die so arrangiert sind, dass sie angeblich eine mystische Wirkung entfalten und jedes Jahr Tausende Touristen und Mönche anziehen, die auf die Steine im Sand starren und dabei ihren Geistesfrieden finden. Nie wieder habe ich so sonderbare und zugleich ernsthafte und tiefgründige Menschen getroffen. Rol Sturlason sah ich nie wieder, er reiste bald darauf nach Japan, aber ich kann nicht vergessen, was er über die Felsen sagte, als ich ihn fragte: «Wer hat sie denn da hingestellt, dass sie so großartig wirken?»
«Das weiß keiner, wohl irgendein Mönch oder mehrere Mönche vor langer Zeit. Aber das Arrangement hat eindeutig eine geheime Struktur. Nur durch Struktur können wir uns nämlich der Leere bewusst werden.» Er zeigte mir ein Bild von den Felsen in sauber geharktem Sand, die aussahen wie Inseln im Meer, als hätten sie Augen (Klüfte), und drumherum der von Schiebewänden eingefasste, architektonisch gegliederte Klosterhof. Dann zeigte er mir ein Diagramm des Felsenarrangements mit den genauen Umrissen der Steine und erklärte mir ihre geometrische Logik und all das, und er ließ die Worte «einsamer Individualismus» fallen und nannte die Steine «in den Raum stoßende Höcker», was sich auf irgendwelche Koan-Geschichten bezog, die mich aber weniger interessierten als er selbst und vor allem der wackere, freundliche Japhy, der auf seinem geräuschvollen Benzinkocher neuen Tee braute und uns die Tassen in fast völligem Schweigen mit einer orientalischen Verbeugung überreichte. Es war ziemlich anders als am Abend der Dichterlesung.
4
Aber gegen Mitternacht des Abends darauf trafen Coughlin, Alvah und ich uns und beschlossen, einen Vierliterkrug Burgunder zu kaufen und Japhy in seiner Hütte zu überfallen.
«Was er wohl heute Abend macht?», fragte ich.
Darauf Coughlin: «Ach, wahrscheinlich lernt er, oder er vögelt, wir werden’s ja sehen.» Wir kauften die bauchige Flasche ganz unten auf der Shattuck Avenue, liefen zu ihm rüber, und wieder sah ich sein armseliges englisches Fahrrad auf dem Rasen liegen. «Mit diesem Rad und seinem kleinen Tornister auf dem Buckel gurkt Japhy den ganzen Tag in Berkeley rum», sagte Coughlin. «Das hat er schon am Reed College in Oregon so gemacht. Auch da kannte ihn jeder. Damals haben wir riesige Weinpartys veranstaltet, mit einem Haufen Mädchen dabei, und am Ende sind wir alle aus den Fenstern gesprungen und haben in der ganzen Stadt Scheiße gebaut.»
«Er ist schon ein seltsamer Vogel», sagte Alvah und biss sich bewundernd auf die Lippen, und in dem Moment wirkte er selbst wie eine vorsichtige Interpretation unseres seltsam leise-lauten Freundes. Wir traten wieder durch die schmale Tür, ein Japhy im Schneidersitz sah von der Lektüre seines Buches auf, diesmal amerikanische Lyrik, und sagte, in komisch geziertem Ton, nichts weiter als «Ah». Wir zogen uns die Schuhe aus und tappten über die knapp zwei Meterchen Strohmatte, um uns zu ihm zu setzen, aber ich war der letzte beim Schuheausziehen und hielt den Krug in der Hand, und dann drehte ich mich, um ihn ihm zu zeigen, und plötzlich brüllte Japhy «Jaaaa!», sprang aus dem Schneidersitz heraus mit einem einzigen Satz auf mich zu und landete in Fechtposition, unversehens mit einem Messer bewaffnet, dessen Spitze mit einem kleinen, aber sauberen «Klink» gerade so eben den Krug berührte. Es war der erstaunlichste Sprung, den ich, außer vielleicht von irren Akrobaten, je im Leben gesehen habe, wie eine Bergziege, und es sollte sich ja noch herausstellen, dass er eine war. Zugleich erinnerte er mich an einen japanischen Samurai – das gellende Gebrüll, der Sprung, die kämpferische Haltung und seine gespielte Zornesmiene mit weit aufgerissenen Augen, die komische Grimasse, die er mir schnitt. Ich hatte den Eindruck, dass dies seine Art war, sich über die Unterbrechung seiner Studien zu beschweren und auch über den Wein, der ihn betrunken machen und seinen geplanten Leseabend ruinieren würde. Aber dann zog er kurzerhand selbst die Kappe vom Krug und trank einen großen Schluck, und wir ließen uns alle im Schneidersitz nieder und tauschten geschlagene vier Stunden lang unter lautem Geschrei Neuigkeiten aus – ein großer nächtlicher Spaß. Das ging ungefähr so:
Japhy: Na, Coughlin, du alte Socke, was hast du getrieben?
Coughlin: Nix.
Alvah: Was sind das hier für merkwürdige Bücher. Hm, Pound, du stehst auf Pound?
Japhy: Abgesehen davon, dass das alte Furzgesicht Li Tai-Pos Namen verballhornt hat, indem er die japanische Variante verwendete, und abgesehen auch von diesem ganzen anderen berühmten dummen Zeug war er schon ganz in Ordnung – eigentlich ist er mein Lieblingsdichter.
Ray: Pound? Wie kann man diesen anmaßenden Spinner als Lieblingsdichter haben?
Japhy: Trink noch ein bisschen Wein, Smith, du redest Quatsch. Wer ist dein Lieblingsdichter, Alvah?
Ray: Warum fragt eigentlich keiner mich nach meinem Lieblingsdichter, ich weiß nämlich mehr über Lyrik als ihr alle zusammen.
Japhy: Ach ja?
Alvah: Schon möglich. Hast du nicht Rays neuen Gedichtzyklus gelesen, den er in Mexiko geschrieben hat – «das Rad der zitternden Fleischeslust dreht sich in der Leere und speit Tics, Stachelschweine, Elefanten, Menschen, Sternenstaub, Narren und Unsinn aus …»
Ray: So ging das nicht!
Japhy: Wo wir gerade von Fleisch reden, habt ihr schon das neue Gedicht …
Und so weiter und so fort, bis das Ganze in ein wildes Fest mit Gequatsche und Geschrei und schließlich Gesang ausartete und alle sich vor Lachen auf dem Boden wälzten, und zum krönenden Abschluss torkelten Alvah, Coughlin und ich Arm in Arm das stille Collegesträßchen hoch, sangen aus voller Kehle «Eli Eli» und ließen den leeren Krug direkt vor unseren Füßen in tausend Scherben zerplatzen, während Japhy von seiner schmalen Tür aus lachend zusah. Aber wir hatten ihm seinen Leseabend vermasselt, und deshalb plagte mich so lange ein schlechtes Gewissen, bis er am Abend darauf plötzlich mit einem hübschen Mädchen vor unserem Häuschen auftauchte, reinkam und ihr sagte, sie solle sich ausziehen, was sie auch prompt tat.
5
Das stand im Einklang mit Japhys Theorien über Frauen und die Liebe. Ich vergaß zu erwähnen, dass an dem Tag, als der Felskünstler ihn spätnachmittags noch aufgesucht hatte, gleich danach ein Mädchen gekommen war, eine Blondine in Gummistiefeln und einem tibetischen Mantel mit Holzknöpfen, und im Gespräch, das sich entwickelte, hatte sie sich genauer nach unserem Plan erkundigt, das Matterhorn zu besteigen, und gesagt: «Kann ich mitkommen?», weil sie selbst ein bisschen was vom Bergsteigen verstand.
«Nor zu», sagte Japhy in diesem merkwürdigen Tonfall, den er fürs Komische verwendete, der schnarrenden, lauten, tiefen Imitation eines Holzfällers aus dem Nordwesten, den er kannte, eigentlich ein Ranger, der alte Burnie Byers, «nor zu, komm mit, dann vögeln wir dich auf dreitausend Metern», und so, wie er das sagte, klang es, obwohl ernst gemeint, so lustig und beiläufig, dass das Mädchen gar nicht schockiert, sondern eher erfreut war. Auf ähnliche Weise hatte er jetzt diese Princess in unser Häuschen gebracht. Es war ungefähr acht Uhr abends, Alvah und ich tranken in aller Ruhe Tee, lasen oder tippten Gedichte in die Schreibmaschine, und zwei Räder fuhren in unseren Garten: Japhy auf seinem, Princess auf ihrem. Princess hatte graue Augen, strohblondes Haar und war sehr schön und erst zwanzig. Ich muss dazusagen, dass sie verrückt nach Sex und Männern war, deshalb machte es keine besonderen Schwierigkeiten, sie zum Yabyum-Spielen zu bequatschen. «Du weißt also nicht, was Yabyum ist, Smith», sagte Japhy mit seiner dröhnenden Stimme, als er in seinen schweren Stiefeln mit Princess an der Hand hereingepoltert kam. «Princess und ich sind hier, um es dir zu zeigen, mein Junge.»