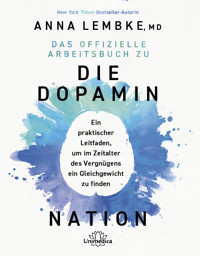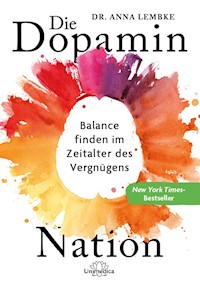
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Unimedica ein Imprint der Narayana Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was die Suche nach dem Dauer-Kick mit unseren Hormonen macht
In diesem Buch geht es um das Vergnügen – und um Schmerz. Es geht um den schmalen Grat des Gleichgewichts zwischen diesen beiden Zuständen, und warum es heute wichtiger ist denn je, diese Balance zu finden. Denn wir leben in einer Zeit noch nie dagewesener Dopamin-stimulierender Reizüberflutung: Sei es durch Drogen, Essen, soziale Medien, Glücksspiel, Shoppen, Sex oder der ständige Griff zum Smartphone, das zur digitalen Injektionsnadel unserer Zeit geworden ist. Die Vielfalt an Süchten ist überwältigend.
Die Autorin verpackt komplexe Neurowissenschaft in leicht verständliche Metaphern und erklärt, dass echte Zufriedenheit und Verbundenheit nur erreicht werden können, wenn wir die Kontrolle über unser Dopamin behalten. Die Erfahrungen ihrer Patienten sind dabei der fesselnde Stoff ihrer Erzählung. Deren Leidensgeschichten und Wege zur Erlösung machen Mut, unseren eigenen Konsum in den Griff zu bekommen. Dieses Buch zeigt, dass das Geheimnis der Balance darin liegt, Sehnsucht und Heilung miteinander zu verbinden.
Dr. Anna Lembke ist Professorin für Psychiatrie und Suchtmedizin an der Stanford University School of Medicine und Leiterin der Stanford Addiction Medicine Dual Diagnosis Clinic. Sie wurde mit zahlreichen Preisen für herausragende Forschung im Bereich psychischer Erkrankungen, ihre Lehrtätigkeit und innovative Behandlungsansätze ausgezeichnet.
„Brilliant … fesselnd, verstörend, überzeugend und klug dargelegt.“ – Beth Macy, Bestseller-Autorin von DOPESICK
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
DR. ANNA LEMBKE
DIE
DOPAMIN-NATION
Balance finden im Zeitalter des Vergnügens
Für Mary, James, Elizabeth, Peter und den kleinen Lucas
Inhaltsverzeichnis
Einführung | Das Problem
Teil I | Das Streben nach Vergnügen
Kapitel 1 | Unsere Masturbationsmaschinen
Die dunkle Seite des Kapitalismus
Das Internet und die soziale Ansteckung
Kapitel 2 | Auf der Flucht vor dem Schmerz
Mangelnde Selbstfürsorge oder eine psychische Erkrankung?
Kapitel 3 | Das Gleichgewicht zwischen Vergnügen und Schmerz
Dopamin
Genuss und Schmerz sind im gleichen Bereich des Gehirns angesiedelt
Toleranz (Neuroadaption)
Menschen, Orte und Dinge
Die Bezeichnung Gleichgewicht ist nur eine Metapher
Teil II | Selbstbindung
Kapitel 4 | Dopaminfasten
D steht für Daten
O steht für Objectives (Ziele)
P steht für Probleme
A steht für Abstinenz
M steht für Mindfulness (Achtsamkeit)
I steht für Insight (Einblick)
N steht für Nächste Schritte
E steht für Experiment
Kapitel 5 | Raum, Zeit und Bedeutung
Physische Selbstbindung
Zeitliche Selbstbindung
Kategoriale Selbstbindung
Kapitel 6 | Ein gestörtes Gleichgewicht?
Medikamente zur Wiederherstellung der Balance?
Teil III | Das Streben nach Schmerz
Kapitel 7 | Druck auf die Schmerzseite
Die Wissenschaft der Hormesis
Schmerzen, um Schmerzen zu behandeln
Süchtig nach Schmerz
Süchtig nach Arbeit
Das Urteil über Schmerzen
Kapitel 8 | Radikale Ehrlichkeit
Bewusstsein
Ehrlichkeit fördert enge menschliche Bindungen
Wahrheitsgetreue Autobiografien sorgen für Verantwortungsbewusstsein
Die Wahrheit zu sagen ist ansteckend – Lügen auch
Ehrlichkeit als Prävention
Kapitel 9 | Prosoziale Scham
Destruktive Scham
Die Anonymen Alkoholiker als Modell für prosoziale Scham
Prosoziale Scham und Kindererziehung
Fazit | Die Lektionen der Balance
Lektionen der Balance
Hinweis der Autorin
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Danksagungen
Stichwortverzeichnis
Über die Autorin
Impressum
EINFÜHRUNG
Das Problem
„Feelin’ good, feelin’ good, all the money in the world spent on feelin’ good.”
− J. B. Lenior
IN DIESEM BUCH GEHT ES UM VERGNÜGEN UND GENUSS. Und es geht um Schmerz. Vor allem aber geht es um die Beziehung zwischen Vergnügen und Schmerz und darum, dass es von entscheidender Bedeutung ist, diese Beziehung zu verstehen, um ein gutes Leben leben zu können.
Warum?
Weil wir die Welt von einem Ort, an dem Knappheit herrschte, in einen Ort verwandelt haben, an dem uns überwältigender Überfluss zur Verfügung steht: Drogen, Nahrung, Glücksspiel, Shopping, Textnachrichten, Sexting, Posten, Teilen und Folgen auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und so weiter – die stetig zunehmende Anzahl, Vielfalt und Intensität der heutzutage zur Verfügung stehenden, in hohem Maße belohnenden Stimuli ist atemberaubend. Das Smartphone ist eine Art moderne Heroinspritze, die eine vernetzte Generation rund um die Uhr mit digitalem Dopamin versorgt. Wenn Sie ihre Droge noch nicht entdeckt haben, werden Sie bald auf einer Webseite, auf die Sie stoßen, von ihr in Versuchung geführt werden.
In der Wissenschaft wird Dopamin als eine Art universelle Währung zur Messung des Suchtpotenzials eines beliebigen Erlebnisses oder einer Erfahrung verwendet. Je mehr Dopamin das Belohnungszentrum des Gehirns ausschüttet, desto größer das Suchtpotenzial des Erlebnisses oder der Erfahrung.
Neben der Entdeckung des Dopamins war eine der bemerkenswertesten Entdeckungen der Neurowissenschaft im vergangenen Jahrhundert die Erkenntnis, dass das Gehirn Vergnügen und Schmerz im gleichen Bereich verarbeitet. Und nicht nur das – Vergnügen und Schmerz funktionieren wie die zwei Waagschalen einer Waage.
Wir haben alle schon den Moment erlebt, in dem wir nach einem zweiten Stück Schokolade lechzen oder uns wünschen, ein gutes Buch, ein guter Film oder ein gutes Videospiel möge nie enden. In diesem Moment des Verlangens senkt sich im Gehirn die Waagschale des Schmerzes und gewinnt die Überhand über das Vergnügen.
Diesem Buch liegt die Absicht zugrunde, die neurowissenschaftlichen Mechanismen der Belohnung zu entschlüsseln und uns dadurch in die Lage zu versetzen, ein besseres und gesünderes Gleichgewicht zwischen Vergnügen und Schmerz zu finden. Aber Neurowissenschaft allein reicht nicht aus. Wir müssen auch auf die gelebten Erfahrungen von Menschen zurückgreifen. Wer könnte uns besser etwas darüber beibringen, wie man zwanghaften Überkonsum überwindet, als diejenigen, die dafür am anfälligsten sind: Menschen, die unter einer Sucht leiden.
Dieses Buch basiert auf wahren Geschichten meiner Patienten, die Opfer einer Sucht geworden sind und einen Weg gefunden haben, ihre Sucht zu überwinden. Sie haben mir erlaubt, ihre Geschichten zu erzählen, damit Sie von ihrer Weisheit profitieren können, so wie ich davon profitiert habe. Möglicherweise werden Sie einige dieser Geschichten schockierend finden, aber für mich sind diese Geschichten nur extreme Versionen dessen, wozu wir alle in der Lage sind und was uns allen widerfahren kann. Es ist, wie der Philosoph und Theologe Kent Dunnington geschrieben hat: „Menschen, die unter einer schweren Sucht leiden, gehören zu jenen Propheten unserer Zeit, die wir zu unserem eigenen Verderben ignorieren, weil sie uns vor Augen führen, wer wir wirklich sind.“1
Ob es Zucker oder Einkaufen, Voyeurismus oder das Rauchen elektrischer Zigaretten, das Posten in sozialen Medien oder stundenlanges Lesen der Washington Post ist – wir alle geben uns Verhaltensweisen hin, von denen wir wünschten, wir würden es nicht tun, oder denen wir uns in einem Ausmaß hingeben, das wir bedauern. Dieses Buch bietet praktische Lösungen dafür an, wie man in einer Welt, in der Konsum das alles bestimmende Leitmotiv unseres Lebens geworden ist, zwanghaften Überkonsum in den Griff bekommen kann.
Im Wesentlichen besteht das Geheimnis, das Gleichgewicht zu finden darin, die Erkenntnisse der Wissenschaft über das Verlangen mit den Erkenntnissen der Weisheit des Überwindens von Süchten zu kombinieren.
TEIL I
Das Streben nach Vergnügen
KAPITEL 1
Unsere Masturbationsmaschinen
ICH GING INS WARTEZIMMER, UM JACOB ZU BEGRÜßEN. Mein erster Eindruck? Freundlich. Er war Anfang sechzig, mittelschwer, hatte ein hübsches Gesicht mit weichen Zügen – alles in allem war er gut gealtert. Er trug die übliche Silicon-Valley-Uniform: Khakihose und ein lässiges Button-Down-Hemd. Er wirkte unauffällig. Nicht wie jemand mit Geheimnissen.
Als Jacob mir durch das kurze Labyrinth der Flure folgte, konnte ich sein Unbehagen spüren wie einen Schauer, der mir den Rücken hinunterlief. Ich erinnerte mich daran, wie unwohl ich mich früher fühlte, wenn ich Patienten in mein Sprechzimmer führte. Gehe ich zu schnell? Schwinge ich die Hüften? Sieht mein Hintern komisch aus?
Das scheint mir heute so lange her zu sein. Ich gebe zu, dass ich inzwischen eine abgehärtete Version meines früheren Ichs bin, stoischer, möglicherweise auch gleichgültiger. War ich damals, als ich weniger wusste und mehr empfunden habe, eine bessere Ärztin?
Wir erreichten mein Sprechzimmer, ich schloss die Tür hinter ihm und bot ihm einen der beiden gleich hohen, grün gepolsterten, sechzig Zentimeter auseinanderstehenden und für die Therapie vorgesehenen Stühle an. Er setzte sich. Ich setzte mich auch. Er nahm das Zimmer in Augenschein.
Mein Sprechzimmer ist dreimal 4,20 Meter groß und verfügt über zwei Fenster. Es gibt einen Schreibtisch, auf dem ein Computer steht, ein Sideboard voller Bücher und zwischen den Stühlen einen niedrigen Tisch. Der Schreibtisch, das Sideboard und der niedrige Tisch sind alle aus dem gleichen rötlich-braunen Holz gefertigt. Der Schreibtisch ist ein ausrangiertes Möbelstück meiner ehemaligen Fakultät. An der Innenseite, also da, wo es außer mir niemand sehen kann, hat er einen Riss – eine treffende Metapher für meinen Job.
Auf dem Schreibtisch liegen zehn einzelne Stapel Papiere, perfekt angeordnet wie die Falten einer Ziehharmonika. Mir wurde gesagt, dies erzeuge den Anschein von organisierter Effizienz.
Die Dekoration der Wände gleicht einem bunten Gemisch. Die obligatorischen Diplome, überwiegend nicht gerahmt. Aus Faulheit. Eine Zeichnung einer Katze, die ich im Müll meines Nachbarn gefunden und eigentlich wegen des Rahmens mitgenommen, aber dann behalten habe, weil mir die Katze gefiel. Ein bunter Wandteppich mit Motiven von Kindern, die in Pagoden und darum herum spielen, ein Erinnerungsstück an meine Zwanziger, als ich in China Englisch unterrichtete. Auf dem Wandteppich gibt es einen Kaffeefleck, den man jedoch nur sieht, wenn man weiß, wonach man sucht – wie bei einem Rorschach-Test.
Ansonsten gibt es allen möglichen Schnickschnack, überwiegend Geschenke von Patienten und Studenten, unter anderem Bücher, Gedichte, Aufsätze, Kunstwerke, Postkarten, Ansichtskarten aus Urlauben, Briefe und Cartoons.
Ein Patient, ein begnadeter Künstler und Musiker, schenkte mir ein selbst gemachtes Foto der Golden Gate Bridge, das er mit handgeschriebenen Musiknoten verziert hatte. Als er das Foto aufnahm, war er nicht mehr selbstmordgefährdet, aber es ist trotzdem ein düsteres Bild voller Grau- und Schwarztöne. Eine andere Patientin, eine hübsche junge Frau, der Falten zu schaffen machten, die nur sie sah und die keine noch so große Menge Botox zu glätten vermochten, schenkte mir einen Wasserkrug aus Ton, der groß genug war, um ihn mit Wasser für zehn Personen zu befüllen.
Links neben meinem Computer habe ich einen kleinen Druck von Albrecht Dürers Melencolia I. Auf dem Bild sitzt die personifizierte Melancholie als eine Frau gebeugt auf einer Bank, umgeben von verstreut herumliegenden Handwerkszeugen und Zeitmessinstrumenten: einem Richtscheit, einer Waage, einer Sanduhr, einem Hammer. Zu ihren Füßen wartet ihr ausgehungerter Hund, dem die Rippen aus seinem eingefallenen Leib herausragen, geduldig und vergeblich darauf, dass sie sich erhebt.
Rechts neben meinem Computer steht ein zwölf Zentimeter großer Engel aus Ton mit Flügeln aus Draht, der seine Arme zum Himmel emporstreckt. Zu seinen Füßen ist das Wort Mut eingraviert. Der Engel ist das Geschenk einer Kollegin, die ihr Büro ausgemistet hat. Ein übrig gebliebener Engel? Den nehme ich.
Ich bin dankbar für dieses eigene Sprechzimmer. Hier bin ich der Zeit enthoben, existiere in einer Welt der Geheimnisse und der Träume. Aber das Zimmer ist auch von Traurigkeit und Sehnsucht durchdrungen. Wenn meine Patienten wieder gehen, verbieten es mir die professionellen Regeln, Kontakt zu ihnen aufzunehmen.
So real unsere Beziehungen in meinem Sprechzimmer auch sind – außerhalb dieses Zimmers können sie nicht bestehen. Wenn ich meine Patienten im Supermarkt sehe, schrecke ich sogar davor zurück, sie zu begrüßen, um mich nicht zu einem menschlichen Wesen mit eigenen Bedürfnissen zu machen. Wie bitte, ich soll auch was essen?
Als ich vor vielen Jahren meine Facharztausbildung zur Psychiaterin absolvierte, sah ich meinen Ausbilder in Psychotherapie zum ersten Mal außerhalb seines Sprechzimmers. Er trug einen Trenchcoat und einen Filzhut à la Indiana Jones. Er sah aus, als wäre er gerade einem J. Peterman-Katalog entstiegen. Das Erlebnis war erschütternd.
Ich hatte ihm viele intime Details aus meinem Leben anvertraut, und er hatte mir Ratschläge erteilt, als wäre ich eine seiner Patientinnen. Ich hatte ihn mir nicht als einen Mann vorgestellt, der einen Hut trug. Für mich deutete das darauf hin, dass er seinem äußeren Erscheinungsbild eine große Bedeutung beimaß, was ganz und gar nicht zu dem idealisierten Bild passte, das ich mir von ihm gemacht hatte. Doch vor allem machte es mir bewusst, wie befremdlich es für meine eigenen Patienten sein könnte, mich außerhalb meines Sprechzimmers zu sehen.
Ich wandte mich Jacob zu und eröffnete das Gespräch. „Was kann ich für Sie tun?“
Andere Gesprächseröffnungen, die ich mir im Laufe der Zeit zurechtgelegt hatte, lauteten unter anderem: „Erzählen Sie mir – warum Sind Sie hier?“ oder „Was führt Sie heute zu mir?“ oder sogar: „Fangen Sie ganz von vorne an – wo auch immer das für Sie ist.“
Jacob sah mich an. „Ich hatte gehofft“, sagte er mit starkem osteuropäischem Akzent, „dass Sie ein Mann wären.“
In dem Moment wusste ich, dass er über Sex reden würde.
„Warum?“, fragte ich und gab mich ahnungslos.
„Weil es für Sie als Frau schwierig sein könnte, von meinen Problemen zu hören.“
„Ich kann Ihnen versichern, dass ich schon so gut wie alles gehört habe.“
„Tja, also“, legte er stammelnd los und sah mich schüchtern an, „ich bin sexsüchtig.“
Ich nickte und machte es mir auf meinem Stuhl bequem. „Fahren Sie fort.“
Jeder Patient ist ein ungeöffnetes Paket, ein ungelesener Roman, ein unerforschtes Land. Ein Patient hat mir einmal erzählt, wie sich Felsklettern anfühlt. Wenn er eine Wand hochklettere, so erzählte er mir, existiere für ihn nichts anderes als die unendliche Felswand und die endgültige Entscheidung, wohin er als Nächstes jeden einzelnen seiner Finger und Zehen setzen sollte. Das Praktizieren von Psychotherapie ist dem Felsklettern nicht unähnlich. Ich tauche in eine Geschichte ein, in das Erzählen und Wiedererinnern, und darüber hinaus spielt alles um mich herum keine Rolle mehr.
Ich habe viele Varianten von Geschichten über menschliches Leiden gehört, aber Jacobs Geschichte erschütterte mich. Am verstörendsten fand ich, was sie über die Welt aussagt, in der wir heute leben, über die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen.
Jacob legte direkt mit einer Erinnerung aus seiner Kindheit los. Ohne irgendwelches Vorgeplänkel. Freud wäre stolz auf ihn gewesen.
„Ich habe zum ersten Mal masturbiert, als ich zwei oder drei Jahre alt war“, sagte er. Die Erinnerung war für ihn sehr lebendig. Das konnte ich seinem Gesicht ansehen.
„In dem Moment fühlte ich mich, als wäre ich auf dem Mond“, fuhr er fort, „aber es war nicht wirklich der Mond. Da war jemand, der war wie Gott ... und ich hatte eine sexuelle Erfahrung, die ich nicht kannte ...“
Ich verstand es so, dass er mit Mond etwas wie Abgrund sagen wollte, gleichzeitig nirgendwo und irgendwo. Aber was hatte es mit Gott auf sich? Sehnen wir uns nicht alle nach etwas, das über uns selbst hinausgeht?
Als kleiner Schuljunge war Jacob ein Träumer: Knöpfe falsch zugeknöpft, Kreide an Händen und Ärmeln, er war der Erste, der während des Unterrichts aus dem Fenster starrte, und der Letzte, der nach der letzten Stunde das Klassenzimmer verließ. Als er acht Jahre alt war, masturbierte er regelmäßig. Manchmal allein, manchmal mit seinem besten Freund. Sie hatten noch nicht gelernt, sich zu schämen.
Doch nach seiner ersten Kommunion kam er zu der aufrüttelnden Einsicht, dass Masturbation eine „Todsünde“ ist. Von da an masturbierte er nur noch allein und suchte jeden Freitag den katholischen Priester der örtlichen Kirchengemeinde auf, zu der seine Familie gehörte, um zu beichten.
„Ich habe masturbiert“, flüsterte er durch das Gitterfenster des Beichtstuhls.
„Wie oft?“, fragte der Priester.
Jeden Tag.
Pause. „Mach es nie wieder.“
Jacob hörte auf zu reden und sah mich an. Wir tauschten ein kurzes verschwörerisches Lächeln aus, das dem anderen zu verstehen gab, dass man Bescheid wusste. Wenn so klar ausgesprochene Ermahnungen das Problem lösen würden, wäre ich meinen Job los.
Der kleine Jacob war fest entschlossen zu gehorchen und ein „guter“ Junge zu sein. Also ballte er die Fäuste und fasste sich da unten nicht an. Aber seine Entschlossenheit hielt immer nur zwei oder drei Tage an.
„Das war der Beginn meines Doppellebens“, sagte er.
Der Begriff Doppelleben war mir so vertraut wie einem Kardiologen der Begriff ST-Hebung, einem Onkologen der Begriff Stadium IV und einem Endokrinologen der Begriff Hämoglobin A1c. Mit dem Begriff Doppelleben ist gemeint, dass ein Abhängiger heimlich Alkohol oder Drogen einnimmt oder sich anderen zwanghaften Verhaltensweisen hingibt und dies vor den Augen anderer verbirgt, manchmal sogar vor sich selbst.
Als Teenager ging Jacob, wenn er aus der Schule kam, auf den Dachboden und masturbierte zu einer Zeichnung der griechischen Göttin Aphrodite, die er aus einem Schulbuch kopiert und zwischen den Holzdielen versteckt hatte. Später betrachtete er diesen Lebensabschnitt als eine Zeit der Unschuld.
Mit achtzehn zog er zu seiner älteren Schwester in die Stadt und studierte dort an der Universität Physik und Maschinenbau. Seine Schwester war tagsüber bei der Arbeit und somit nicht zu Hause, weshalb er zum ersten Mal in seinem Leben über lange Zeiträume hinweg allein war. Er fühlte sich einsam.
„Also beschloss ich, eine Maschine zu bauen.“
„Eine Maschine?“, hakte ich nach und setzte mich ein wenig aufrechter hin.
„Eine Masturbationsmaschine.“
Ich hielt kurz inne. „Verstehe. Wie funktionierte sie?“
„Ich habe einen Metallstab mit einem Plattenspieler verbunden. Das andere Ende habe ich mit einer offenen Metallspule verbunden und diese mit einem weichen Tuch umwickelt.“ Er zeichnete ein Bild, um mir die Konstruktion zu demonstrieren.
„Dann habe ich das Tuch und die Spule um meinen Penis gelegt“, sagt er und betonte das Wort Penis, als ob es zwei Wörter wären: pen wie das englische Wort für Stift und ness wie Loch Ness, in dem das Monster haust.
Ich verspürte den Drang zu lachen, aber nach einem kurzen Moment der Reflektion wurde mir bewusst, dass dieser Drang etwas anderes überdecken sollte: Ich hatte eine Befürchtung. Die Befürchtung, dass ich ihm, nachdem ich ihn eingeladen hatte, sich mir zu offenbaren, nicht würde helfen können.
„Wenn der Plattenspieler sich drehte, bewegte sich die Spule hin und her“, sagte er. „Ich konnte die Geschwindigkeit, mit der sich die Spule bewegte, regulieren, indem ich die Geschwindigkeit des Plattenspielers einstellte. Es gab drei verschiedene Geschwindigkeiten. Auf diese Weise konnte ich mich bis kurz vor den Höhepunkt bringen ... viele Male, ohne zum Orgasmus zu kommen. Außerdem habe ich gelernt, dass ich den Höhepunkt hinauszögern konnte, wenn ich gleichzeitig eine Zigarette rauchte, also wendete ich diesen Trick an.“
Mit dieser Methode der minimalen Anpassung war Jacob in der Lage, stundenlang einen Zustand kurz vor dem Orgasmus aufrechtzuhalten. „Das macht sehr süchtig“, sagte er und nickte.
Mit seiner Maschine masturbierte Jacob mehrere Stunden am Tag. Der Genuss, den er dabei verspürte, war durch nichts zu übertreffen. Er schwor sich, damit aufzuhören. Er versteckte die Maschine hoch oben in einem Schrank oder nahm sie komplett auseinander und warf die Teile allesamt weg. Aber einen oder zwei Tage später holte er die Teile aus dem oberen Schrankfach oder aus dem Mülleimer, baute die Maschine wieder zusammen und fing von vorne an.
***
Vielleicht sind Sie von Jacobs Masturbationsmaschine angewidert, so wie ich es war, als ich zum ersten Mal von ihr hörte. Vielleicht betrachten Sie sie als eine Art extremer Perversion, die sich jenseits jeglicher alltäglicher Lebenswirklichkeit befindet und für Sie und Ihr Leben wenig oder gar keine Relevanz hat.
Doch wenn wir das tun, versäumen Sie und ich eine Gelegenheit, etwas zu verstehen, das für die Art und Weise, in der wir heutzutage leben, eine entscheidende Rolle spielt: In gewisser Weise geben wir uns alle unseren eigenen Masturbationsmaschinen hin.
Im Alter von ungefähr vierzig Jahren entwickelte ich eine ungesunde Begeisterung für Liebesromane. Meine Einstiegsdroge war Twilight, ein Fantasy-Liebesroman über Teenager-Vampire. Es war peinlich genug, diesen Schmöker zu lesen, geschweige denn zuzugeben, dass er mich in den Bann zog.
Twilight traf genau den Nerv zwischen Liebesgeschichte, Thriller und Fantasy, die perfekte Fluchtmöglichkeit für mich, als ich die Schwelle meiner Lebensmitte überschritt. Ich war nicht allein. Millionen Frauen meines Alters lasen und liebten Twilight. An und für sich war es nicht ungewöhnlich, dass ich von einem Buch in den Bann gezogen wurde. Ich habe mein ganzes Leben lang gerne Bücher gelesen. Was danach passierte, war allerdings anders als sonst. Etwas, das ich mir aufgrund meiner bisherigen Vorlieben und Lebensumstände nicht erklären konnte.
Als ich Twilight beendet hatte, verschlang ich jeden Vampirroman, den ich in die Finger bekam, und ging dann über zu Werwölfen, Feen, Hexen, Geisterbeschwörern, Zeitreisenden, Sehern, Gedankenlesern, Feuerbeherrschern, Wahrsagern, Edelsteinbearbeitern ... Sie verstehen schon, worauf ich hinauswill. Irgendwann reichten mir zahme Liebesgeschichten nicht mehr, also stürzte ich mich auf immer anschaulichere und erotischere Versionen der typischen „Junge-trifft-Mädchen-Träume“.
Ich erinnere mich daran, dass ich ziemlich schockiert war, wie einfach es war, in unserer örtlichen Bibliothek in den Regalen mit der ganz normalen Unterhaltungsliteratur Bücher mit anschaulichen Sexszenen zu finden. Es bereitete mir Sorgen, dass meine Kinder Zugang zu diesen Büchern haben könnten. Das anzüglichste Buch, das ich in unserer örtlichen Bibliothek im Mittleren Westen, wo ich aufgewachsen war, entdeckt hatte, war Bist du da, Gott? Ich bin’s, Margaret gewesen.
Die Dinge eskalierten, als ich mir auf Betreiben meines technisch versierten Freundes einen E-Book-Reader zulegte. Ich musste nicht mehr darauf warten, dass Bücher aus einer anderen Bibliothek eintrafen, oder Bücher mit anzüglichen Umschlägen hinter medizinischen Fachzeitschriften verstecken, vor allem wenn mein Mann und meine Kinder in der Nähe waren. Jetzt konnte ich mit zwei Wischbewegungen und einem Klick jedes Buch, das ich wollte, sofort auf meinem E-Book-Reader haben, überall und zu jeder Zeit: im Zug, auf einer Flugreise, beim Friseur. Ich konnte Im Bann des Vampirs von Karen Marie Moning genauso leicht verschwinden lassen wie Schuld und Sühne von Dostojewski.
Kurz gesagt: Ich wurde eine Dauerleserin kitschiger Erotikromane. Sobald ich ein E-Book durchhatte, nahm ich mir das nächste vor. Anstatt mit anderen Menschen Kontakt zu pflegen, las ich; anstatt zu kochen, las ich; anstatt zu schlafen, las ich; anstatt meinem Mann und meinen Kindern Aufmerksamkeit zu schenken, las ich. Ich schäme mich, es zu offenbaren, aber einmal nahm ich meinen E-Book-Reader sogar mit zur Arbeit und las zwischen dem Besuch einzelner Patienten.
Ich hielt nach immer billigerem Lesestoff Ausschau, bis hin zu Büchern, die gar nichts kosteten. Amazon weiß – wie jeder gute Drogendealer – wie wirksam Gratisproben sind. Hin und wieder entdeckte ich ein wirklich gutes Buch, das zufällig nicht teuer war, aber die meisten waren wirklich furchtbar, mit abgedroschenen Handlungssträngen, leblosen Figuren, voller Druckfehler und grammatischer Fehler. Aber ich habe sie trotzdem gelesen, weil ich immer stärker auf der Suche nach einer ganz speziellen Art von Erlebnis war. Wie ich dorthin gekommen war, spielte immer weniger eine Rolle.
Ich wollte diesen Moment der sich aufbauenden sexuellen Spannung auskosten, die sich schließlich löst, wenn der Held und die Heldin zusammenkommen. Syntax, Stil, Szenerie oder Figuren interessierten mich nicht mehr. Ich wollte nur noch meinen Kick, und diese Bücher, die nach einem ganz bestimmten Schema geschrieben waren, waren so konstruiert, dass sie mich fesselten.
Jedes Kapitel endete mit einer spannenden Zuspitzung, und die Kapitel selbst steuerten zielstrebig auf den Höhepunkt zu. Ich verschlang den ersten Teil, bis ich den Höhepunkt des Buches erreicht hatte, und schenkte es mir dann in der Regel, den Rest zu lesen. Heute weiß ich leider, dass man jeden x-beliebigen Liebesroman zu ungefähr drei Vierteln durchblättern kann und es dann dort direkt zur Sache geht.
Ungefähr ein Jahr, nachdem ich meine neue Obsession für Liebesromanzen entdeckt hatte, fand ich mich mitten in der Woche um 2 Uhr nachts dabei wieder, noch wach zu sein und Fifty Shades of Grey zu lesen. Ich hielt es für eine moderne Version von Stolz und Vorurteil – bis ich auf die Seite mit den „Butt-Plugs“ kam und mir schlagartig bewusst wurde, dass ich meine Zeit eigentlich nicht damit verbringen wollte, bis in die frühen Morgenstunden Bücher darüber zu lesen, wie man sadomasochistische Sexspielzeuge verwendet.
Sucht wird ganz allgemein definiert als ein fortgesetzter und zwanghafter Konsum einer Substanz oder ein fortgesetztes zwanghaftes Verhalten (Glücksspiel, Computerspiel, Sex), obwohl dieser Konsum oder dieses Verhalten für einen selbst und/oder für andere schädlich ist.
Was mir passiert ist, ist im Vergleich zu dem, was Menschen widerfährt, die unter einer schweren Sucht leiden, ziemlich harmlos. Es sagt jedoch etwas über das immer größer werdende Problem des zwanghaften Überkonsums, mit dem wir heute alle konfrontiert sind, aus – selbst wenn wir ein gutes, erfülltes Leben leben. Ich habe einen netten, liebevollen Ehemann, großartige Kinder, eine sinnvolle Arbeit, genieße Freiheit, Unabhängigkeit und einen relativen Wohlstand und leide nicht unter einem Trauma, unter sozialer Entwurzelung, Armut, Arbeitslosigkeit oder anderen Risikofaktoren, die das Entstehen einer Sucht begünstigen. Und dennoch zog ich mich zwanghaft immer weiter in eine Fantasiewelt zurück.
Die dunkle Seite des Kapitalismus
Mit 23 lernte Jacob seine Frau kennen und heiratete sie. Sie zogen zusammen in die Dreizimmerwohnung, in der sie mit ihren Eltern lebte, und er ließ seine Masturbationsmaschine zurück – für immer, wie er hoffte. Jacob und seine Frau meldeten sich auf dem zuständigen Amt, um eine eigene Wohnung zu bekommen, bekamen jedoch mitgeteilt, dass sie 25 Jahre warten müssten. Das war in den 1980er-Jahren in dem osteuropäischen Land, in dem sie lebten, ganz normal.
Anstatt sich dem Schicksal hinzugeben, jahrzehntelang bei ihren Eltern wohnen zu müssen, beschlossen sie, zusätzliches Geld zu verdienen, um sich früher eine eigene Wohnung kaufen zu können. Sie fingen an, Computer zu verkaufen, die sie aus Taiwan importierten, und wurden Teil der wachsenden Schattenwirtschaft.
Ihr Geschäft lief gut, und sie wurden nach den in ihrem Land geltenden Maßstäben reich. Sie kauften sich ein Haus und etwas Land und bekamen zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter.
Ihr sozialer Aufstieg schien gesichert, als Jacob in Deutschland eine Stelle als Wissenschaftler angeboten wurde. Sie ergriffen die Gelegenheit, in den Westen zu ziehen, seine berufliche Karriere voranzutreiben und ihren Kindern alle Möglichkeiten zu eröffnen, die Westeuropa zu bieten hatte. Der Umzug bot tatsächlich viele Möglichkeiten, allerdings nicht nur gute.
„Als wir nach Deutschland zogen, entdeckte ich Pornografie, Pornokinos und Sex-Live-Shows. Die Stadt, in der ich lebte, ist für all diese Dinge bekannt, und ich konnte nicht widerstehen. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es zehn Jahre lang geschafft. Ich bin Wissenschaftler, ich arbeitete viel, aber im Jahr 1995 hat sich alles geändert.“
„Was hat sich geändert?“, fragte ich und ahnte schon die Antwort.
„Das Internet. Ich war 24 Jahre alt, und es ging mir gut, aber mein Leben begann, den Bach runterzugehen. Im Jahr 1999 war ich eines Tages in dem gleichen Hotelzimmer, in dem ich vorher auch schon gut fünfzigmal gewesen war. Am nächsten Tag stand eine große Konferenz an, auf der ich einen wichtigen Vortrag halten musste. Aber ich blieb die ganze Nacht auf und sah mir Pornos an, statt meinen Vortrag vorzubereiten. Ich erschien ohne vorbereiteten Vortrag auf der Konferenz und ohne geschlafen zu haben. Mein Vortrag war sehr schlecht. Ich habe beinahe meinen Job verloren.“ Bei der Erinnerung blickte er nach unten und schüttelte den Kopf.
„Ab dem Tag hatte ich ein neues Ritual“, fuhr er fort. „Jedes Mal, wenn ich ein Hotelzimmer bezog, klebte ich überall Notizzettel hin – an den Badezimmerspiegel, auf den Fernseher, auf die Fernbedienung –, auf denen stand: ‚Tu es nicht.‘ Aber ich hielt nicht mal einen Tag lang durch.“
Mir wurde klar, wie sehr Hotelzimmer heute einer modernen Version von Skinner-Boxen gleichen, einem Versuchskäfig, in dem Testtiere standardisiert und automatisch ein neues Verhalten erlernen sollen. In den Hotelzimmern gibt es ein Bett, einen Fernseher und eine Minibar. Man kann dort nichts tun, außer den Knopf zu drücken, um die Droge zu erhalten.
Er blickte wieder nach unten, und es entstand ein ausgedehntes Schweigen. Ich ließ ihm Zeit.
„Damals in dem Hotel habe ich zum ersten Mal daran gedacht, mein Leben zu beenden. Ich dachte, die Welt würde mich nicht vermissen und wäre ohne mich vielleicht eine bessere. Ich ging auf den Balkon und blickte hinunter. Vier Stockwerke ... das sollte reichen.“
***
Einer der größten Risikofaktoren, um von irgendeiner Droge abhängig zu werden, ist leichter Zugang zu dieser Droge. Wenn der Zugang zu einer Droge leicht ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir sie ausprobieren. Wenn wir sie ausprobieren, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir nach dieser Droge süchtig werden.
Die gegenwärtige Opioid-Epidemie2 in den USA ist ein tragisches und eindrückliches Beispiel für diese Tatsache. Die Vervierfachung der Verschreibungen von Opioiden (Oxycontin, Vicodin, Fentanyl/Durogesic) in den USA zwischen 1999 und 2012 und die gleichzeitige Verbreitung dieser Opioide bis in jeden Winkel der USA haben dazu geführt, dass es immer mehr Opioidabhängige und immer mehr auf die Opioidsucht zurückzuführende Sterbefälle gab.
Eine von der Association of Schools and Programs of Public Health (ASPPH) eingesetzte Arbeitsgruppe kam in einem am 1. November 2019 vorgelegten Bericht zu folgendem Schluss: „Die gewaltige Ausweitung des Angebots an starken (sehr wirksamen und lange wirkenden) verschreibungspflichtigen Opioiden3 führte stufenweise zu einer Zunahme der Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Opioiden und außerdem dazu, dass viele Betroffene von der Einnahme verschreibungspflichtiger Opioide auf den Konsum illegaler Opioide umstiegen, unter anderem auf Fentanyl und ähnliche Substanzen. Dies hatte eine exponentielle Zunahme von Überdosierungen zur Folge.“ In dem Bericht wurde zudem festgestellt, dass eine Opioidkonsumstörung „durch die wiederholte Exposition gegenüber Opioiden“4 verursacht wird.
Genauso führt eine Verringerung des Angebots an süchtig machenden Substanzen zu einer Verringerung der Exposition gegenüber diesen Substanzen und zu einer Verringerung des Suchtrisikos und damit verbundenen gesundheitlichen Schädigungen. Ein Experiment aus dem vergangenen Jahrhundert, das dazu geeignet ist, diese Hypothese zu überprüfen und ihre Richtigkeit zu belegen, war die Prohibition, ein landesweites Verbot der Herstellung, der Einfuhr, des Transports und des Verkaufs alkoholischer Getränke in den USA, das von 1920 bis 1933 in Kraft war.
Die Prohibition führte in den USA zu einem starken Rückgang der Anzahl der US-Amerikaner, die Alkohol konsumierten und alkoholabhängig wurden.5 Während dieser Zeit sank die Anzahl der Fälle von Trunkenheit in der Öffentlichkeit und von alkoholbedingten Lebererkrankungen um fünfzig Prozent, ohne dass es neue Heilmittel oder Therapien zur Behandlung einer Sucht gegeben hätte.
Natürlich gab es auch unbeabsichtigte Folgen, zum Beispiel das Entstehen eines großen Schwarzmarkts, der von kriminellen Banden kontrolliert wurde.6 Doch der positive Effekt der Prohibition auf den Alkoholkonsum und die damit einhergehende niedrigere Sterblichkeit wird allgemein unterschätzt.
Die Auswirkungen des verminderten Alkoholkonsums durch die Prohibition waren bis in die 1950er-Jahre zu verzeichnen. Im Laufe der darauffolgenden dreißig Jahre, als Alkohol wieder zusehends leichter verfügbar war, nahm der Alkoholkonsum kontinuierlich zu.
In den 1990er-Jahren stieg der Anteil der US-Amerikaner, die Alkohol tranken, um fast 50 Prozent, und der Anteil der US-Amerikaner mit einem hochriskanten Trinkverhalten stieg um 15 Prozent. Zwischen 2002 und 2013 stieg die Anzahl der Fälle von diagnostizierbarer Alkoholsucht7 bei älteren Erwachsenen (über 65 Jahre) um 50 Prozent und bei Frauen um 84 Prozent, zwei demografischen Gruppen, die von diesem Problem bis dahin nur relativ selten betroffen gewesen waren.
Allerdings ist ein erleichterter Zugang nicht das einzige Risiko, eine Sucht zu entwickeln. Das Risiko steigt, wenn ein biologischer Eltern- oder Großelternteil suchtkrank ist, und zwar sogar dann, wenn man nicht in der Wohnung oder dem Haus aufgewachsen ist, in dem der Süchtige lebt oder gelebt hat. Eine psychische Erkrankung ist ebenfalls ein Risikofaktor8, auch wenn noch nicht klar ist, welche Beziehung zwischen einer psychischen Erkrankung und einer Sucht besteht. Die Frage ist: Führt die psychische Erkrankung zu Drogenkonsum, verursacht Drogenkonsum eine psychische Erkrankung oder bringt diese zum Vorschein, oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen?
Traumata, soziale Umbrüche und Armut können das Suchtrisiko erhöhen, weil Drogen zu einem Mittel der Bewältigung werden und zu epigenetischen Modifikationen führen können – vererbbare Veränderungen der DNA-Stränge außerhalb der vererbbaren Basenpaare –, die sich auf die Genexpression sowohl eines Individuums als auch seiner Nachkommen auswirken.
Ungeachtet dieser Risikofaktoren ist der erleichterte Zugang zu süchtig machenden Substanzen möglicherweise der wichtigste Risikofaktor, dem Menschen in der heutigen Zeit ausgesetzt sind. Das Angebot hat eine Nachfrage geschaffen, und wir alle sind dem Strudel zwanghaften Überkonsums zum Opfer gefallen.
Unsere Dopamin-Ökonomie, beziehungsweise das, was der Historiker David Courtwright „limbischer Kapitalismus“9 genannt hat, treibt diesen Wandel voran, befeuert von einer transformativen Technologie, die nicht nur den Zugang zu Drogen erleichtert, sondern auch deren Anzahl, Vielfalt und Wirksamkeit erhöht hat.
Die im Jahr 1880 erfundene Zigarettendrehmaschine ermöglichte es zum Beispiel, die Anzahl der produzierten Zigaretten von vier pro Minute gerollten Zigaretten auf sage und schreibe 20.000 pro Minute zu steigern.10 Heute werden jährlich weltweit 6,5 Billionen Zigaretten verkauft, was ungefähr 18 Milliarden gerauchten Zigaretten am Tag entspricht, die weltweit für geschätzt 6 Millionen Todesfälle pro Jahr verantwortlich sind.
Im Jahr 1805 entdeckte der Deutsche Friedrich Sertürner, der zu dieser Zeit als Apothekergehilfe arbeitete, das Schmerzmittel Morphin – ein opioides Alkaloid, dessen Wirkung zehnmal stärker ist als dessen Ausgangsstoff Opium. Im Jahr 1853 erfand der schottische Arzt Alexander Wood die Subkutannadel zur Durchführung einer intravenösen Injektion. Diese beiden Erfindungen trugen dazu bei, dass im späten 19. Jahrhundert in medizinischen Fachzeitschriften über Hunderte iatrogener (durch Ärzte und medizinische Maßnahmen verursachte) Fälle von Morphinsucht berichtet wurde.11
Bei dem Versuch, ein weniger süchtig machendes opioides Schmerzmittel herzustellen, das Morphin ersetzen sollte, entwickelten Chemiker eine völlig neue Substanz, die sie, hergeleitet aus dem deutschen Wort heroisch für „mutig“, „Heroin“ nannten. Wie sich herausstellte, war Heroin noch zwei- bis fünfmal wirkungsvoller als Morphin und bereitete den Weg für die Narkomanie, also das krankhafte Verlangen nach Schlaf- oder Betäubungsmitteln, der frühen 1900er-Jahre.
Heute sind hochwirksame Opioide von pharmazeutischer Qualität wie Oxycodon, Hydrocodon und Hydromorphon in jeder erdenklichen Form erhältlich: als Tabletten, als Injektion, als Pflaster und als Nasenspray. Im Jahr 2004 kam eine Patientin mittleren Alters in mein Sprechzimmer und lutschte an einem knallroten Fentanyl-Lutscher. Fentanyl, ein synthetisches Opioid, ist fünfzig- bis hundertmal stärker als Morphin.
Neben Opioiden sind auch viele andere Drogen heutzutage stärker als früher. Elektronische Zigaretten – schicke, unauffällige, geruchslose, nachfüllbare Nikotinzufuhrsysteme – verursachen bei kürzerer Verwendung höhere Nikotinwerte im Blut als herkömmliche Zigaretten. Außerdem gibt es jede Menge Geschmacksvarianten, die darauf abzielen, Jugendliche anzusprechen.
Das heutige Cannabis ist fünf- bis zehnmal stärker als das Cannabis der 1960er-Jahre, und es ist in Form von Keksen, Kuchen, Brownies, Gummibärchen, Blaubeeren, „Pot Tarts“, Bonbons, Ölen, Aromastoffen, Tinkturen, Tees usw. verfügbar. Die Liste ist endlos.
Nahrungsmittel werden überall auf der Welt von Lebensmitteltechnikern manipuliert. Nach dem Ersten Weltkrieg führte die Automatisierung von Brat- und Frittierprodukten zur Erfindung von Kartoffelchips in Tüten.12 Im Jahr 2014 verzehrte jeder US-Amerikaner im Durchschnitt 51 Kilogramm Kartoffeln, wovon es sich nur bei 15 Kilogramm um frische Kartoffeln handelte. Die übrigen 36 Kilo entfielen auf verarbeitete Kartoffelprodukte. Den meisten Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen, werden gewaltige Mengen Zucker, Salz, Fett und Tausende künstliche Aromastoffe zugesetzt, um unseren Appetit auf Produkte wie French-Toast-Eiscreme oder thailändische Tomaten-Kokosnuss-Suppe zu befriedigen.13
Der erleichterte Zugang zu den Substanzen und deren immer stärkere Wirksamkeit haben dafür gesorgt, dass Polypharmazie – die gleichzeitige oder in kurzen Abständen erfolgende Einnahme mehrerer Medikamente, Wirkstoffe oder Drogen – zur Norm geworden ist. Meinem Patienten Max fiel es leichter, mir eine Zeitachse zu zeichnen, die dokumentierte, wann er welche Drogen zu sich genommen hatte, als mir seine Drogenkarriere zu erklären.
Wie man auf seiner Zeichnung sehen kann, begann er mit siebzehn mit Alkohol, Zigaretten und Cannabis („Mary Jane“). Mit achtzehn schnupfte er Kokain. Mit neunzehn stieg er auf Oxycontin und Xanax um. In seinen Zwanzigern nahm er Percocet, Fentanyl, Ketamin, LSD, PCP, DXM und MXE und landete schließlich bei Opana, einem Opioid von pharmazeutischer Qualität, das ihn zu Heroin führte, das er weiter konsumierte, bis er mit dreißig zu mir kam. Insgesamt hat er im Laufe von etwas mehr als zehn Jahren vierzehn verschiedene Drogen zu sich genommen.
Heute gibt es darüber hinaus jede Menge digitale Drogen, die es früher nicht gab. Sofern sie doch schon existierten, sind sie heute auf digitalen Plattformen erhältlich, wodurch ihre Verfügbarkeit und ihre Wirksamkeit sich exponentiell gesteigert haben. Zu diesen digitalen Drogen gehören unter anderem Pornografie, Glücksspiele und Videospiele, um nur einige zu nennen.
Zeitachse zum Drogenkonsum
Alkohol, Zigaretten, Cannabis, Kokain, Oxycontin, Xanax, Percocet, Fentanyl, Ketamin, LSD, PCP, DXM, MXE (Methoextamin), Opana, Heroin
Darüber hinaus ist die Technologie mit ihren blinkenden Lichtern, den Musikfanfaren, dem Bottomless-Bowl-Trick, also der Möglichkeit des endlosen Weiterspielens oder -sehens und dem Versprechen auf immer größere Belohnungen, wenn man weitermacht, selbst schon süchtig machend.
Meine eigene Entwicklung von einer Leserin relativ harmloser Vampir-Liebesromane zu einer Konsumentin von Büchern, die als sozial akzeptierte Pornografie für Frauen gelten, kann auf die Einführung elektronischer Lesegeräte zurückgeführt werden.
Der Akt des Konsumierens selbst ist zu einer Droge geworden. Mein Patient Chi, ein vietnamesischer Einwanderer, wurde süchtig nach dem Suchen und Kaufen von Onlineprodukten. Das berauschende Gefühl setzte bei ihm ein, wenn er entschied, was er kaufen wollte, setzte sich dann mit der Vorfreude auf die Lieferung fort und erreichte den Höhepunkt in dem Moment, in dem er das Paket öffnete.
Leider dauerte das Hochgefühl nicht viel länger, als er brauchte, um das Amazon-Klebeband von dem Paket zu reißen und zu sehen, was es enthielt. In seinen Zimmern stapelten sich billige Gebrauchsgegenstände und er hatte Zehntausende Dollar Schulden. Trotzdem konnte er nicht aufhören. Um die Prozedur in Gang zu halten, bestellte er immer billigeren Kram – Schlüsselanhänger, Tassen, Plastiksonnenbrillen – und schickte die Sachen nach der Lieferung sofort wieder zurück.
Das Internet und die soziale Ansteckung
Jacob beschloss an jenem Abend in dem Hotel, sich doch nicht umzubringen. In der Woche nach dem Hotelaufenthalt wurde bei seiner Frau ein Hirntumor diagnostiziert. Sie kehrten in ihr Heimatland zurück, und er verbrachte die folgenden drei Jahre damit, sich um sie zu kümmern, bis sie starb.
Im Jahr 2001 kam er im Alter von 49 Jahren wieder mit seiner Highschool-Liebe zusammen und heiratete sie.
„Ich habe ihr vor unserer Hochzeit von meinem Problem erzählt. Aber vielleicht habe ich es ihr gegenüber ein bisschen verharmlost.“
Jacob und seine neue Frau kauften sich gemeinsam ein Haus in Seattle. Jacob arbeitete als Wissenschaftler im Silicon Valley und pendelte. Je mehr Zeit er im Silicon Valley verbrachte und nicht bei seiner Frau war, desto stärker fiel er wieder zurück in seine alten Verhaltensmuster des Konsumierens von Pornografie und zwanghafter Selbstbefriedigung.
„Wenn wir zusammen sind, sehe ich mir nie Pornos an. Aber wenn ich hier im Silicon Valley oder auf Reisen bin und sie nicht bei mir ist, dann schon.“
Jacob hielt inne. Es fiel ihm sichtlich schwer, über das zu reden, was als Nächstes kam.
„Wenn ich bei der Arbeit mit Elektrizität herumhantierte, spürte ich manchmal etwas in meinen Händen. Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe angefangen, mich zu fragen, wie es sich wohl anfühlt, wenn ich meinen Penis unter Strom setze. Also habe ich im Internet recherchiert und herausgefunden, dass es eine ganze Online-Community von Menschen gibt, die sich mit Strom stimulieren.“
„Ich habe Elektroden und Drähte an meine Stereoanlage angeschlossen. Mit der Spannung der Stereoanlage versuchte ich, einen Wechselstrom zu erzeugen. Statt einfachen Draht zu verwenden, habe ich Elektroden aus Baumwolle an meinem Penis befestigt, die ich vorher in Salzwasser getaucht habe. Je höher ich die Lautstärke an meiner Stereoanlage drehte, desto stärker war der Strom. Bei niedriger Lautstärke spürte ich nichts. Bei höherer Lautstärke tat es weh. Dazwischen konnte ich durch das Feeling zum Orgasmus kommen.“
Ich konnte nicht anders, als große Augen zu machen.
„Aber das kann sehr gefährlich sein“, fuhr er fort. „Ich weiß, dass ein Stromausfall zu einer Überspannung führen kann, und dann könnte ich mich verletzen. Dabei sind schon Menschen gestorben. Im Internet habe ich gelesen, dass ich mir ein medizinisches Gerät kaufen kann … wie heißen diese Dinger noch mal, diese Apparate, mit denen man Schmerzen behandelt?“
„Ein TENS-Gerät?“
„Ja, genau, ein TENS-Gerät für 600 Dollar. Das ich mir aber für zwanzig Dollar auch selbst bauen konnte. Also beschloss ich, mir mein eigenes Gerät zu bauen. Ich habe mir das erforderliche Material gekauft und die Maschine konstruiert. Und sie hat funktioniert. Sehr gut sogar.“ Er machte eine Pause. „Aber dann machte ich erst die wirkliche Entdeckung. Ich konnte das Gerät programmieren. Ich konnte maßgeschneiderte Praktiken programmieren und es so einstellen, dass zu dem Gefühl die passende Musik lief.“
„Was für Praktiken?“
„Handjob, Blowjob. Was immer Sie wollen. Und ich habe nicht nur meine Praktiken entdeckt. Ich konnte online gehen und mir die Praktiken von anderen runterladen und meine eigenen teilen. Einige Leute schreiben Programme, die dafür sorgen, dass das Ganze mit Pornovideos synchron läuft, sodass man fühlt, was man sieht ... wie virtuelle Realität. Das Lustgefühl kommt natürlich durch die Empfindung, aber auch davon, die Maschine zu bauen, sich darauf zu freuen, was sie tun wird, herumzuexperimentieren, um sie zu verbessern, und die Verbesserungen mit anderen zu teilen.“
Er lächelte, während er sich das alles in Erinnerung rief, dann fiel sein Gesicht in sich zusammen, als er sich dessen bewusst wurde, was als Nächstes kommen würde. Er musterte mich, und ich erkannte, dass er abschätzte, ob er mir das, was nun kommen würde, zumuten konnte. Ich machte mich auf das Schlimmste gefasst und ermunterte ihn mit einem Nicken fortzufahren.
„Es kommt noch schlimmer. Es gibt Chatrooms, in denen man anderen live dabei zusehen kann, wie sie sich befriedigen. Man kann kostenlos zusehen, aber es gibt auch die Option, Token, eine Art Kryptowährung, zu kaufen. Ich bezahlte mit Token für eine gute Vorstellung. Ich filmte mich selbst und stellte es online. Nur meinen Intimbereich. Keinen anderen Körperteil von mir. Zunächst einmal war es aufregend, von Fremden beobachtet zu werden. Aber ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, weil das Zuschauen andere erst auf die Idee bringen kann, es auch zu tun, und sie möglicherweise ebenfalls süchtig werden.“
***
Im Jahr 2018 war ich medizinische Sachverständige in einem Gerichtsprozess im Fall eines Mannes, der mit seinem LKW in zwei Teenager hineingerast war, die dabei beide ihr Leben verloren hatten. Er war unter Drogeneinfluss gefahren. Im Rahmen des Gerichtsverfahrens verbrachte ich einige Zeit damit, mit Kommissar Vince Dutto zu sprechen, einem leitenden Ermittler der Kriminalpolizei in Placer County, Kalifornien, wo der Prozess stattfand.
Aus Interesse an seiner Arbeit fragte ich ihn, ob er im Laufe der zurückliegenden zwanzig Jahre bei den Verbrechen, mit denen er zu tun hatte, irgendwelche Veränderungen der Verhaltensmuster der Täter festgestellt hatte. Er erzählte mir von dem tragischen Fall eines sechs Jahre alten Jungen, der seinen vier Jahre alten Bruder vergewaltigt hatte.
„Wenn wir mit so einem Fall zu tun haben, ist es normalerweise so, dass das Kind von irgendeinem Erwachsenen, mit dem es Kontakt hat, sexuell missbraucht wurde, und das betroffene Kind es dann an einem anderen Kind, zum Beispiel seinem kleinen Bruder, nachmacht. Aber wir haben ausgiebige Ermittlungen angestellt, und es gab keinen Hinweis darauf, dass der ältere Bruder sexuell missbraucht worden war. Seine Eltern waren geschieden und arbeiteten viel, sodass die Kinder sich mehr oder weniger selbst großgezogen haben, aber es gab keinen offensichtlichen sexuellen Missbrauch.
Letztendlich stellte sich bei diesem Fall heraus, dass der ältere Bruder im Internet Zeichentrickfilme gesehen und dabei auf einige Animes (japanische Zeichentrickfilme) gestoßen war, in denen alle möglichen sexuellen Praktiken gezeigt wurden. Der Junge hatte ein eigenes Tablet, und niemand kontrollierte, was er damit machte. Und nachdem er jede Menge von diesen Filmen gesehen hatte, beschloss er, das, was er gesehen hatte, mal an seinem kleinen Bruder auszuprobieren. Also, so etwas hatte ich in den mehr als zwanzig Jahren meines Polizistendaseins bis dahin noch nie erlebt.“
Das Internet fördert zwanghaften Überkonsum nicht nur dadurch, dass es einen erleichterten Zugang zu alten und neuen Drogen ermöglicht, sondern auch dadurch, dass es zu Verhaltensweisen anregt, die uns ansonsten nie in den Sinn gekommen wären. Videos gehen nicht nur „viral“. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes ansteckend, was auch das Aufkommen von Memes erklärt.
Menschen sind soziale Tiere. Wenn wir online sehen, dass andere sich in einer bestimmten Weise verhalten, erscheinen uns diese Verhaltensweisen als „normal“, weil andere Menschen sie auch praktizieren. „Twitter“ ist ein passender Name für ein soziales Medium, das als Plattform zur Verbreitung von Textnachrichten dient und von Experten und Präsidenten gleichermaßen genutzt wird. Wir sind wie Vogelschwärme. Kaum hat einer von uns einen Flügel erhoben, um loszufliegen, steigen wir alle als kompletter Schwarm in die Lüfte.
***
Jacob sah hinunter auf seine Hände. Er konnte mir nicht in die Augen sehen. „Dann habe ich in diesem Chatroom eine Frau kennengelernt. Sie stand darauf, Männer zu dominieren. Ich habe ihr die Sache mit der Elektrizität erklärt und es ihr ermöglicht, die Stromstärke, die Frequenz und die Frequenzstruktur über den Lautstärkeregler aus der Ferne zu regulieren. Sie mochte es, mich bis kurz vor den Höhepunkt zu bringen, mich jedoch nicht zum Orgasmus kommen zu lassen. Das machte sie zehnmal, und andere sahen dabei zu und gaben Kommentare ab. Diese Frau und ich haben online eine Art Freundschaft entwickelt. Sie wollte nie ihr Gesicht zeigen. Aber einmal habe ich sie zufällig gesehen, weil ihre Kamera kurz heruntergefallen ist.“
„Wie alt war sie?“, fragte ich.
„In den Vierzigern, denke ich.“
Ich war versucht zu fragen, wie sie aussah, spürte jedoch, dass da meine eigene lüsterne Neugier im Spiel war und der Frage kein therapeutisches Interesse zugrunde lag, weshalb ich sie mir verkniff.
Jacob fuhr fort: „Meine Frau hat das alles herausgefunden und gesagt, dass sie mich verlässt. Ich habe ihr versprochen aufzuhören. Ich habe meiner Online-Freundin gesagt, dass ich Schluss mache. Sie war sehr wütend. Meine Frau auch. Ich habe mich selbst gehasst. Ich habe dann eine Zeit lang aufgehört. Vielleicht einen Monat oder so. Aber dann habe ich wieder angefangen. Nur ich und meine Maschine, ohne die Chatrooms. Ich habe meine Frau angelogen, aber irgendwann hat sie es herausgefunden. Ihr Therapeut riet ihr, mich zu verlassen. Also tat sie es. Sie ist in unser Haus in Seattle gezogen, und jetzt bin ich allein.“
Er schüttelte den Kopf und sagte: „Es ist nie so gut, wie ich es mir vorstelle. Die Realität ist immer schlechter. Ich sage mir, ich mache es nie wieder, und dann zerstöre ich die Maschine und werfe sie weg. Aber um vier Uhr morgens des nächsten Tages hole ich die Teile aus dem Müll und baue die Maschine wieder zusammen.“
Jacob sah mich mit flehenden Augen an. „Ich will aufhören. Ich will es wirklich. Ich will nicht als Süchtiger sterben.“
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich stellte ihn mir vor, mit seinen Genitalien durch das Internet mit einem Raum voller Fremder verbunden. Ich empfand Entsetzen, Mitleid und ein vages, beunruhigendes Gefühl, dass ich das selbst hätte sein können.
***
Ähnlich wie Jacob laufen wir alle Gefahr, uns durch einen Kick, den wir suchen, zu Tode zu vergnügen.
Siebzig Prozent aller Todesfälle werden auf änderbare verhaltensbedingte Risikofaktoren wie Rauchen, Bewegungsmangel oder die Ernährungsweise zurückgeführt. Die weltweit größten Sterblichkeitsrisiken14