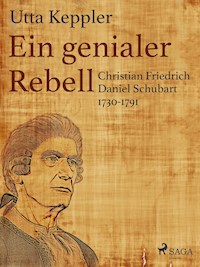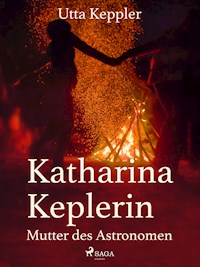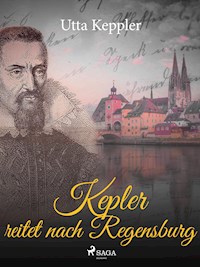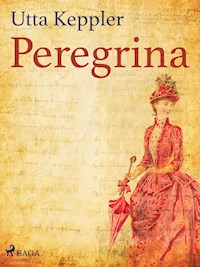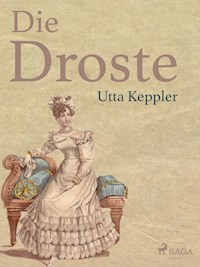
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Bei diesem Buch handelt es sich um einen biographischen Roman, der von dem Leben der Annette von Droste-Hülshoff erzählt. Die Schriftstellerin und Autorin, die besonders als eine der bedeutendsten deutschen Dichterin bekannt ist, führte ein sehr zurückgezogenes Leben, ging jedoch auch auf mehrere große Reisen, die sie insbesondere literarisch beeinflussten. Ergänzend gibt es einen Anhang, der sehr übersichtlich noch einmal kurze Informationen über die genannten Personen gibt.Utta Keppler (1905-2004) wurde als Tochter eines Pfarrers in Stuttgart geboren und wuchs dort auf. Sie besuchte die Stuttgarter Kunstakademie bis Sie die Meisterreife erreichte. 1929 heiratete sie und hat vier Söhne. Sie arbeitete frei bei Zeitungen und Zeitschriften und schrieb mehrere biographische Romane, meist über weibliche historische Persönlichkeiten, für welche sie ein intensives Quellenstudium betrieb.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Utta Keppler
Die Droste
SAGA Egmont
Die Droste
Copyright © 1985, 2018 Utta Keppler und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711730508
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Das Grab der Droste
Es regnet sanft. Fett drängt das Gras
Um blaue Samtgesichter der Violen,
Zitternde Zweige, nasse Mauerquader.
Das quillt und leuchtet: Regen, warmer Regen,
Dampfender Teppich. Dämmernd hingegeben
Spür ich sein buntes Vlies, halb unbewußt.
– Da find ich, was ich suchte: Schüchtern schmale
Gereihte Gräber, unscheinbare Male,
Kreuz, Pfeiler, Tafel, Hieroglyph.
Da steht der Name, der mich rief,
Der Falterfisch.
Aufbricht der sattgedüngte Grund,
Der Mütter Höhle, Ceres dunkler Mund,
Klafft auf. Blauzuckend faunisch Feuer
Schwelt hin. Ein glockenhafter Alt
Spricht Formeln: »… Moos … und Ammonshorn im Wald,
Der See, im knisternden Gespinst
Der trocknen Halme wie geschmolz’nes Zinn …«
Und eine Hand, Däumlein wie Vogelsporen,
Berührt mit starkem Zauberbann die Welt,
Aufspringt die Kruste, Grundgebirg zerschellt,
Türkisen glimmt in magischem Geleucht
Ein Auge. Wahr dich, du bestehst sie nicht,
Den Blick, die Stimme, das Gericht,
Das sie bestand und faßte, im Gedicht.
Utta Keppler
1.Beginn einer Rechenschaft
… Jenny hat nicht gerufen, die ist am Briefeschreiben. Was soll sie auch rufen? Ach was, immer ruft jemand nach mir, auch wenn mich niemand braucht, nur so, zur Unterbrechung, um sich zu versichern, daß ich da bin und nichts Ungeschicktes mache … sie trauen mir alle nicht recht, sie fürchten, daß ich irgendwie absinke. – Absinken, eingewikkelt in diese hellgrauen Schwaden, in das feuchte formlose Meer aus Dunst und Luft, das wogend unter mir ist, ist es wirklich da? Dichte unbewegliche Wogen, gibt es das? Unbewegliche Wogen? Wogen sind doch unaufhörlich bewegt!
Da stehe ich, über das feine feste Gitter gelehnt, eingegrenzt und gehalten, in einen winzigen Umkreis eingesperrt, und unter mir das Weite, das Unabsehbare – ich weiß, daß es da ist, gedehnt und fern.
Ich kenne den See aus vielen Anblicken, Augenblicken, in einer blendenden Sonnenbläue, spielend und verspielt, traulich – beinahe hätte ich das dumme Wort »neckisch« gedacht – damals, als er luzide und kristallen über seiner ganz unwahrscheinlichen Tiefe, der unsichtbaren, hintändelte, als wäre sie nicht unter ihm.
Er ist mein Bruder, mein Freund, mein Feind und: die große tödliche Gefahr. Jetzt dunstet er zu mir herauf, da ich ihn nicht sehen kann, Nebel haben ihn überwallt und maskiert; die kamen aus den Bergtälern, aus den wilden Schroffen, aus den harten Kanten und Schründen – ach nein, sie kommen aus ihm selber, unbestimmt und saugend und mir zugedacht, zu mir heraufgeweht …
Es wird kühler hier oben auf dem Balkon, es ist schon weit im Jahr, man sollte hineingehen und alle Fenster zumachen und sich in die schwarze Sofaecke drücken und zugeben, daß der schwächliche alte Körper nicht mehr viel Widerstand hat, wenn das Gehuste wieder anfängt.
Annette von Droste-Hülshoff ist, im Herbst 1846, fast fünfzig Jahre alt, wie sie da auf dem Balkon der urtümlichen Meersburg steht und auf den Bodensee hinunterschaut. Auf kaum bewegtes, verschattetes Wasser hat sie schon in der Kinderzeit neugierig und leise schaudernd geblickt, auf eingezwängtes und nur leise dümpelndes Wasser zwar, dunkelbräunlich, verschlammt und algengefleckt, das nur eben Raum hatte um das inselartige Anwesen mit dem unterspülten Gemäuer der Wasserburg Hülshoff, wo sie aufgewachsen ist … Gerede ging um von den feindlichen Söldnern, deren einer in den Burggraben fiel und den die Gefährten, leise nachschleichend, totschlugen, damit er ihre Nähe nicht verriete; der sei ohne Laut versunken.
Wasserfrösche unken im Randgras, und schwarze Fische, selten nur, schlängeln durch den Schlamm.
Es ist anders hier als in der westfälischen Heimat, anders sind die Leute hier am weinläubigen Ufer, eher zu tänzerischer Lust geneigt als ihre norddeutschen Landsleute. Die sind schwerknochig und schwerblütig und schwerbeweglich und in der Tiefe ernst und nachdenklich.
Große Menschen sind es, zuverlässige, und was sie träumen, ist nicht romantisch-zierlich wie hier, wo sogar der Kalvarienberg und die Leidensstationen tändelnd und naiv mit fröhlichen Putten bevölkert und verkleidet werden.
Dort ist die Phantasie eher urtümlich und ahnungsvoll und manchmal spökenkiekerisch, das weiß sie. Niemand weiß es vielleicht so klar wie sie selber, die es überschaut und einsieht und leidend und liebevoll in sich spürt und aus sich herausgeben möchte.
Annette geht endlich in ihr Zimmer; die Magd hat ein kleines Kaminfeuer angemacht, denn das »Frölen« – hier heißt es freilich die »Baroneß« – friert leicht, es riecht nach dem knackenden Reisig und den eben anglostenden Scheiten, das schwarze Sofa zieht sie an, ein langgestrecktes Möbel, in dem sie eine Ecke mit Kissen ausgefüllt und zur Zuflucht hergerichtet hat.
Sie sitzt eine Weile im Dunkeln, beobachtet die springenden Fünkchen im Kamin und sieht noch immer den bedeckten, eingehüllten See als ein graues, gestaltloses Tuch vor sich, als wäre er mit in das holzduftende, angewärmte Zimmer gekommen.
Es ist, als wollte irgendein neidischer Wassergeist ihr alle Wärme und alle Sonnenerinnerung verderben, die sie so nötig braucht. Denn sogar die tröstlich beschworene Sommergestalt, aus der Himmelssicht betrachtet, hilft ihr nicht. Wenn sie jetzt den See im Taglicht sucht, ein Abbild aus der Vogelschau zwischen Bergzacken und grünem Baumgewirr, sieht sie ihn als einen gewundenen Fisch, mit Augen und zackigen Schuppen, als wären die glitzernden Schneegipfel seine eckigen Flossen, die zueilenden Bäche seine Bartfäden; und sie sieht ihn wellenschlagend und glitzernd vor sich und in sich, und all das kleine wimmelnde Leben, das ihn tagsüber umwölkt und umwuselt wie vermoostes Zierwerk, dem Klöster und Schlösser und alte Stadttürme als Funkelschmuck eingesetzt sind.
Irgendetwas in mir ist ihm verwandt, denkt sie wieder, dem feuchten wechselgesichtigen Element.
Sie verschränkt die kleinen mageren Hände, »Fisch« denkt sie, »mir aus ersten Tagen eingeprägt, Symbole bleiben haften und werden einem erst deutlich, wenn man reif dazu ist …« Fisch – das ist ihr Wappen, das Drostewappen, oder eigentlich das Hülshoffsche, denn Droste ist ein Titel, ein Amtsname, und deren hat’s viele gegeben.
Der Fisch – er hat vielleicht mit der Weltschlange zu tun, das meint Laßberg, der sachkundige und vorweltbesessene Schwager, und der Wappenfisch hat Flügel … ein Delphin! Ein gekrönter Delphin! Sein Name ist mit dem Dauphin verwandt, auf antiken Vasen gibt es ihn als Windtier, und Flügel, ja Flügel hat er, wahrhaftig. Aus dem Untergründigen, dem Verborgenen, dem Chthonischen steigt er hoch auf, angesogen vom unirdischen Lüfte-Element – ist er nicht beinahe ein Schmetterling?
Gib’s zu, Mädchen, du bist eigentlich ein Wasserwesen, Melusine und Undine, Meernymphe und Fischweib, und ohne das Dumpfige, Dunkle, aus dem die versunkene Stadt und die wesenlosen Strömungen kommen, Vineta – ohne sie hätte ich nie die ahnungsvolle Schau gewonnen.
Aber das Fischlein hat Flügel, und eine Krone hat es auch: Flügel, die tragen im seherischen Rausch, in der großen Schau, im schwingenden Reim vogelhaft über das bannende dunkle Element hinaus und hinauf – – – ich bin wahrhaftig beides, Fisch und Vogel! Manchmal bin ich’s zu sehr, seh’ mir selber zu, als wär ich ein gespaltenes Geschöpf …
Sie lacht im Dunkeln. Manche sagen, ich wär nicht Fisch, nicht Vogel, nicht einmal ein ganzes Weib …
Jetzt ruft es, Jennys Stimme, und zugleich klopft die Magd, die das Essen bringt, kalte Milch, kaltes Wasser dareingemischt, kaltes Fleisch und ein Stück schwarzes Brot. Sie will es nicht anders, glaubt, sie vertrage die warmen Speisen nicht, sie huste so weniger. Vielleicht ist es das Fett, meint sie, das Schmalz, was sie reichlich an den Braten tun oder an das Gemüse, das sie freilich selten kochen.
Annette ißt, zaghaft wie ein Vögelchen, ohne viel Appetit. Sie hat, kaum bewußt, auch die Vorstellung dabei, das Fasten sei etwas Tugendhaftes und der Kirche wohlgefällig; jedenfalls der Mama drüben im Salon.
Dann lacht sie selber darüber: Sie ist ja nicht mehr das kleine, halb mißratene Mädchen, das die Mama so enttäuscht hat. Sie ist eine dichtende Frau, eine anerkannte sogar, aber eben doch nur eine Frau, und als solche aus Art und Brauch herausgerückt.
Ob es andere auch so mühselig gehabt haben – Jane Baillie etwa, der »weibliche Shakespeare«, die englische Zeitgenossin?
Ach, es gibt vielerlei dichtende Zeitgenossen, und die Frauen sind durchaus nicht die schlechtesten Verseschmiede. Hab ich nicht eben an die liebe große Busch gedacht, auch sie eine Dichterin? Katharina, die mir ihren kleinen Sohn ans Herz gelegt hat, ihn, ihn? O Lieber, Levin, ganz geliebter, zugehörig wie seit Urbeginn, Du Schöner! Sohn und Freund und Bruder und Geliebter – so wär’s gewesen, geworden, wenn nicht wieder das düstere Element, schlammicht und schwellend, dazwischen geflossen wäre, wie eine dunkle Schlange.
Ach, ich habe kein Recht mehr, von Liebe zu dem Kind, zu meinem »Pferdchen« zu reden und an es zu denken – es ist vorbei, bitter vorbei, zerrissen und verfärbt und verzerrt und abgetan – es muß »abgetan« sein, denn ich selber bin’s ja auch: unnütz seit je, unberechtigt, nicht vollbürtig und kaum zu Recht geboren – abgetan!
Levin, mein Schulte, mein kleines blondes wildes Pferdchen ist mir entwachsen, verbildet und mißgebildet und entstellt …
Sie hat sich jetzt so in ihre verzweifelten Gedanken hineingefiebert, daß sie zu husten beginnt, krumm und keuchend hängt sie über der Porzellanschüssel und spuckt dünne Fäden blutigen Auswurfs.
Das darf niemand sehen, die Schwester nicht, die gute besorgte Jenny, und die Mama vollends nicht.
Ach, und die es hätte sehen dürfen und ihr liebevoll mit ihren breiten Runzelhänden beigestanden wäre, Kathinka, die Pettendorfsche, ist tot.
Annette konnte sich nie von ihr trennen, nicht innerlich und nicht leiblich, denn auch von Hülshoff nach Rüschhaus ist sie mitgezogen; nur jetzt an den Bodensee, in die düstere Meersburg, hat sie nicht mitmögen, sie starb vorher, eh das hätte sein sollen. – Eine Webersfrau und gewiß nichts »Vornehmes«, nicht belesen und geziert, aber wie ein warmer Boden oder eine umhüllende Sonnenwolke, dunkel und schwer und doch zuverlässig und bergend.
Annette von Droste-Hülshoff denkt an ihre beiden nächsten Menschen: An die Quelle am Anfang, an die alte Webersfrau, die ihr das Leben gerettet hat, den Eingang und Atem, ohne den sie nicht wäre – – – und an den jungen blühenden hübschen Levin Schücking, den Sohn der Dichterin Katharina Busch, und den kümmerlichen jammervollen Abschied von ihm … Dazwischen liegt ihr Leben und ihre Arbeit.
An des Balkones Gitter lehnte ich
Und wartete, du mildes Licht, auf dich.
Hoch über mir, gleich trübem Eiskristalle,
Zerschmolzen schwamm des Firmamentes Halle;
Der See verschimmerte mit leisem Dehnen,
Zerfloßne Perlen oder Wolkentränen?
Es rieselte, es dämmerte um mich,
Ich wartete, du mildes Licht, auf dich.
Hoch stand ich, neben mir der Linden Kamm,
Tief unter mir Gezweige, Ast und Stamm;
Im Laube summte der Phalänen Reigen,
Die Feuerfliege sah ich glimmend steigen,
Und Blüten taumelten wie halb entschlafen;
Mir war, als triebe hier ein Herz zum Hafen,
Ein Herz, das übervoll von Glück und Leid
Und Bildern seliger Vergangenheit.
Das Dunkel stieg, die Schatten drangen ein –
Wo weilst du, weilst du denn, mein milder Schein? –
Sie drangen ein, wie sündige Gedanken,
Des Firmamentes Woge schien zu schwanken,
Verzittert war der Feuerfliege Funken,
Längst die Phaläne an den Grund gesunken,
Nur Bergeshäupter standen hart und nah,
Ein finstrer Richterkreis, im Düster da.
Und Zweige zischelten an meinem Fuß
Wie Warnungsflüstern oder Todesgruß;
Ein Summen stieg im weiten Wassertale
Wie Volksgemurmel vor dem Tribunale;
Mir war, als müsse etwas Rechnung geben,
Als stehe zagend ein verlornes Leben,
Als stehe ein verkümmert Herz allein,
Einsam mit seiner Schuld und seiner Pein.
Da auf die Wellen sank ein Silberflor,
Und langsam steigst du, frommes Licht, empor;
Der Alpen finstre Stirnen strichst du leise,
Und aus den Richtern wurden sanfte Greise,
Der Wellen Zucken ward ein lächelnd Winken,
An jedem Zweige sah ich Tropfen blinken,
Und jeder Tropfen schien ein Kämmerlein,
Drin flimmerte der Heimatlampe Schein.
O, Mond, du bist mir wie ein später Freund,
Der seine Jugend dem Verarmten eint,
Um seine sterbenden Erinnerungen
Des Lebens zarten Widerschein geschlungen,
Bist keine Sonne, die entzückt und blendet,
In Feuerströmen lebt, im Blute endet –
Bist, was dem kranken Sänger sein Gedicht,
Ein fremdes, aber o! ein mildes Licht.
Was für eine Sprache! Welche Bilder! Die Landschaft, der See, die Berge, Nebel und Mond im Trüben, alles in eine Form gegossen, eine völlig adäquate Form, in Klang, in Gespür, in Farbe! Das Ganze, die ganze Schöpfung, alle in ihr schlafenden Formen, Schatten, Schwingungen, Gedanken auf einmal Wort geworden, als verblute alles Herkömmliche an dieser gegossenen Form und in sie hinein! Nichts Einzelnes mehr, sondern ein ganzes Leben, vor die Gerechtigkeit, vor die Barmherzigkeit des Alls gestellt!
2.Kindheit und Jugend
Man hat ihr erzählt, daß sie ein jämmerliches Würmchen gewesen sei, als die Mama sie zu früh geboren habe, als Achtmonatskind, noch in Westfalen. Man hatte bei ihr sogar weniger Hoffnung, als wenn sie vier Wochen früher geboren wäre; man war aufgeregt und verzweifelt wie über ein ganz mißglücktes Beginnen, am meisten die Mama: Da lag ein winziges, zierliches rotes Geschöpf, das kaum behaarte Köpfchen mit gekniffenen Augen über dicken Säcken, einem greinenden Mündchen und Fingernägeln nur wie Haut, und das Rückgrat entlang feine blonde Härchen.
Da ist nichts von einem strahlenden strampelnden Baby, wie es sich die Mutter gewünscht hat, dieses sabbernde Würmchen, dem man nur Flanelltücher umzulegen wagt statt der vorbereiteten Hemdchen und Jäckchen, und das mit altklug verkniffenen Lippen alle Nahrung verweigert.
Die Mama ist enttäuscht und in ihrer Schwäche beinahe schon verbittert. Ungeduldig ist sie auch, denn die immer wiederholten Versuche, das verschlossene Mündchen dem warmen Milchstrom zu öffnen, brauchen viel Zeit und nutzen nichts.
Und endlich meint man, das Geschöpf sei nicht zum Leben geboren, nicht zum Bleiben.
Es gibt eine rasche Taufe, während der der Kaplan mehr Zutrauen zu dem scheuen Seelchen hat als die eigene Mutter, Zutrauen, daß es in dem schmächtigen rötlichen Körperchen sich durchsetzen und zum zähen Bestehen durchdringen werde.
Die Mama findet dann, daß eine Amme her müsse, eine prallbrüstige Webersfrau, die Kathinka Pettendorf, die ihren eigenen Jungen neben dem kläglichen »Frölen« aus dem Schloß wohl nähren könnte.
Aber zuerst, meint diese, vertrage das »Vögelchen« ihre fette Milch nicht – also läßt sie es an Kamillensäckchen lutschen und streut einen Hauch Zucker dazu. Sie ist selber glücklich, als die strichschmalen blauen Lippen sich regen, wölben, spitzen, und ein winziges Zünglein anfängt zu probieren.
Die Mama, die Schloßherrin, Therese von Droste-Hülshoff, ist erleichtert, das mühsame Locken und Probieren loszusein; sie hat nur widerwillig ihre vielerlei Anordnungen und Übersichten im Schloß und im Gut und Garten zurückgestellt. Es dauerte alles viel länger als bei Jennys Geburt, die »zur Zeit« und »wie es sich gehörte« ankam und aufwuchs. Als Therese dann aufstehen und herumgehen konnte und endlich auch auf den Gartenwegen auf- und abwanderte und Knechte und Mägde kontrollierte, war das winzige, halbtot geborene Kind schon so weit erholt, daß es als ein Menschlein gelten konnte.
Und da die Mama, fromme Katholikin, des Glaubens war, solch ein Seelchen sei im Himmel und von Gott ausgewählt für dieses und gerade dieses Haus und Elternpaar, hielt sie es endlich auch für wichtig und dringlich, daß man es sorgsam aufziehe und mit ein wenig Wärme umhege, zumal die Pettendorfsche mit einem zärtlichen Seufzer sagte, das allerkleinste und kaum lebensfähige Kind spüre, wie man es aufnehme und umsorge, und werde erst gedeihlich und »wohlhäbig«, wenn es fühle, daß es geliebt sei.
Annette hockt jetzt in ihrer Sofaecke im »Gehäus« in Meersburg und zieht die Decken um sich herum, wie Schalen und Windungen eines Schneckenhauses.
Sie sieht sich selber als Vierjährige mit dem wenig jüngeren Bruder um den Wassergraben herumtappen, Hand in Hand zuerst, bis sie sich losmacht, neugierig an den Rand des schwarzen Kanals herangeht, sich darüberbückt, und sie – die Alternde – ist’s jetzt selber, wie sie da in das blasige Sumpfloch schaut und das weißlich verquollene Gesicht der Wasserfrau auftauchen sieht, mit bleichen Fingerspitzen herauflangend. Und zugleich ist sie gewiß, daß die nicht da sein kann – die Schwankende, Zauberische, Verborgene – nicht damals und nicht jetzt.
Damals, vor so vielen Jahren, ist sie, den Bruder mitziehend, in den flachen Sumpf hineingewatet, langsam, Schritt für Schritt, und hat gewartet, ob das Gesicht noch einmal auftauche. Der Junge hat dann den weichen schwammigen Boden unter den bloßen Füßen gleiten gespürt und sie zum Umkehren überredet. Gern ging sie nicht mit, aber aus Angst vor der Strafe der Mutter trat sie in die schnell quellenden Fußstapfen des Kleinen; und doch blieb der Sog und Zug wie eine unwiderstehliche Strömung in ihr und um sie her, immer als Lockung und Drohung und Gefahr und, ja, als unwiderstehliches Verlangen.
Kathinka hat es gut verstehen können, was Annette schon als Mädchen aus dem Heidemoor steigen sah, Unerlöste und Irrlichternde und düstere mörderische Gespenster, und auch die schwebend-schwankenden Wasserjungfern, die immer auf- und eintauchen und Irrlichter zünden, wenn sie die Menschen locken wollen.
Kathinka, Katharina – war die eigentliche »Mutter«. Drüben im Salon saß die Mama, Spitzen häkelnd oder mit dem Rechenstift über dem Kassenbuch. Aber Kathinka, die liebe alte Frau war’s, deren breite warme Brust das Vögelchen angenommen und gewärmt und genährt und allezeit, auch als ihr eigenes Söhnchen fünfjährig gestorben war, als »ihr« Kind behalten und gepflegt hatte, sogar mit einem kühnen rechthaberischen Widerspruch gegen die Mama gehütet, manchmal auch aus dem naiven halbheidnischen Glauben mit märchen- und bildersatten Visionen gefüttert hatte.
Die Mama war der Gegenpol: die strenge Ordnung, die Selbstdisziplin. Dazu erzog sie Annette, das war das nötige Rückgrat für das überquellende, von Ängsten und Ahnungen phantastisch-gefährdete Wesen der Tochter.
Vierjährig erzählt Annette ihren Traum der Schwester Jenny: Sie sei – und sie habe sich stolz als Siebenjährige gefühlt – eine lange schnurgerade Allee entlanggewandert, immer geradezu, und immer flankiert von kleinen Gräben und großen Bäumen, alles exakt und zielgenau; und hätte doch immer darauf gewartet, daß irgendwo etwas Neues, Unerwartetes auftauche und sie fordere zur Unternehmung, zur Tat, zu Angst oder Bewunderung – aber da sei nichts Ungewöhnliches gewesen, nichts Aufregendes oder Besonderes.
Das war damals, als sie mit dem Bruder Werner ausriß …
Ausreißen – heute muß sie darüber lachen: sich freimachen, ganz anders sein und doch immer wieder um- und einkehren in den warmen strenggeregelten, unentrinnbaren Kreis, der sie hervorgebracht und gehalten hatte, bisher und weiterhin – es brauchte nicht einmal der geraunten und geflüsterten Geschichten von Ahnentaten und Ritterkämpfen.
Sie gehörte dazu, sie war aus der alten Sippe, die schon seit dem Jahr 1000 im Münsterland saß; sie delektierte sich gern an den schön klingenden alten Namen, sagte sie sich vor und liebte, ohne ihn zu kennen, den Engelbert von Deckenbrock, der um’s Jahr 1200 Drost beim Münsterschen Domkapitel gewesen war … und daß »Drost« mit dem russischen Starost zusammenhänge, war ihre spielerische Wortphantasie; sie wußte wohl, daß das Wort mit »Truchseß« zu tun haben müsse.
Wasserschloß, Dunst und Kühle und feuchte Mauern … da wächst leicht aus dem harmlosen Husten ein wucherndes Übel – und daß Jenny gesund blieb, war beinahe ein Wunder – die praktische, fröhliche, nüchterne Jenny, die dennoch so hübsch aquarellierte, so »artig« zeichnete, wie der alte Goethe das nannte. Sie schlug nach der Mutter Art, und sie, Annette, Anna Elisabeth, wäre nur dem Vater nachgeartet?
In ihm war vielerlei zusammengeflossen, vielleicht war das Blut ein wenig zu alt, zu müde, und kein ritterlichkampffrohes Lebensgefühl konnte sich mehr darin halten: Clemens August II. war eine der weichen, beinah skurrilen Figuren, wie sie die Romantik oft hervorbrachte. Leute, die – ob sie arm oder reich waren – ihren manchmal verdrehten, verschnörkelten Neigungen nachgingen.
Clemens August von Droste-Hülshoff hatte einen Raum seines Hauses mit Sand ausstreuen und darin Bäumchen anpflanzen lassen, dazu eine Voliere mit allerlei zwitscherndem, flatterndem und kleckerndem Gevögel bestückt, ohne auf Schmutz und Geruch zu achten und auch nicht zum Entzücken seiner sorgsamen Frau.
Er geigte, der Vater, er zog seltene Planzen, er schrieb an einem »liber mirabilis«, in das er ungewöhnliche Begebenheiten und weitgeschwungene Gedankenketten eintrug, in einigen Sprachen und sogar gereimt, wie es ihn eben ankam, er beobachtete einfühlsam und immer bedacht die größeren Zusammenhänge. Von seinen Mineralien zu den seltenen Planzen, von Urtieren, Ammoniten und Medusenhäuptern zog er Fäden und Linien, die sie verbanden und zu Welt und Wissen führten.
Sein »liber mirabilis« blieb ein verschlossenes Geheimnis, in das er die »Vorschau« und Ahnung seiner halbentrückten Sinne und die Rätselgeschichten eintrug, die ihm seine Dörfler erzählten, und er verglich und maß solche im uralten Bilderdenken wurzelnden Vorstellungen mit den historischen Ereignissen. –
Wenn da die huschenden »Reiter auf Gäulen wie Katzen« durch die Hecke brachen, verstand man erst viel später, daß es die russischen Steppenreiter waren. Wenn Wolken wie Fledermausflügel über das Land hinklatschten, waren’s die bösen Tage der verlorenen Schlachten gewesen.
Er selbst, der beinah weiblich-anmutige Freiherr Clemens August von Droste, war kein »reicher Mehrer«, wie sein Name es ihm ansagte – er erblickte schaudernd Dinge und Gestalten, die ihn forderten, drängten und überforderten. Es ist nie ganz deutlich geworden, wie er starb – Annette weicht noch jetzt, jetzt eben, der Erinnerung aus.
Sie sieht ihn unter seinen Vögeln, wie er den einen und anderen auf dem gebogenen Zeigefinger trägt und ihm zuflüstert und zupfeift, wie er sich auf die winzigen Blumenkeime herunterbückt, die Wurzel fester in die Erde eindrückt oder den hingestreuten Boden mischt, den festgetretenen lockert.
Da blüht ein Strauch im ersten Frühling mit winzigen porzellanrosa Blüten, ein »Winterblüher«, und unter ihm duckt sich ein Igelchen, das seinen Winterschlaf schon aufgegeben hat, und läßt sich, ganz unglaublich, von der warmen, schön gepolsterten Hand des Vaters streicheln – ohne die Stacheln zu stellen.
Die Hände des Vaters sind magisch begabt, Magneten, mit denen er Tier und Pflanze zur Sympathie stimmt, wie er die seltenen Mineralien, die Drusen und Ammoniten und Steinlilien aufspürt unter dem Geröll und in den zerschrammten Wänden der Steinbrüche, und die Binsen und Riedgräser streift, zwischen denen die blitzenden Libellen schwirren wie fliegende Edelsteine. –
Die Mutter, zweite Frau des Freiherrn Clemens August nach einer ersten, kurzen Ehe, ist sehr nüchtern, selbstbewußt, eine tüchtige Wirtschafterin und Organisatorin und alles das, was Annette als Autorität empfindet, aber nichts Elementares, nichts Bergendes, kein Quellgrund.
Ausruhen, regenerieren, Wärme saugen – Annette ist, so wild sie sich im Austausch mit dem Gewachsenen, mit Fels und Moor und Sturm austobt, immer das zarte, unverschalte Wesen geblieben, das die Amme »mit Zucker und Kamillen« aufgepäppelt hat: Ganz offen für das Einströmende und immer gefährdet von dem Allzumächtigen, das sie bis in den Grund zittern machte. Was sie bewahrt hat, ist bloß dieser angeborene untrügliche Instinkt für das ihr Gemäße, unterstützt durch das klare Wesen der Mama.
An einem Tag, wo feucht der Wind,
Wo grau verhängt der Sonnenstrahl,
Saß Gottes hartgeprüftes Kind
Betrübt am kleinen Gartensaal.
Ihr war die Brust so matt und enge,
Ihr war das Haupt so dumpf und schwer,
Selbst um den Geist zog das Gedränge
Des Blutes Nebelflore her.
Und am Gestein ein Käfer lief,
Angstvoll und rasch wie auf der Flucht,
Barg bald im Moos sein Häuptlein tief,
Bald wieder in der Ritze Bucht.
Ein Hänfling flatterte vorbei,
Nach Futter spähend, das Insekt
Hat zuckend bei des Vogels Schrei
In ihren Ärmel sich versteckt.
Da ward ihr klar, wie nicht allein
Der Gottesfluch im Menschenbild,
Wie er in schwerer, dumpfer Pein
Im bangen Wurm, im scheuen Wild,
Im durst’gen Halme auf der Flur,
Der mit vergilbten Blättern lechzt,
In aller, aller Kreatur
Gen Himmel um Erlösung ächzt.
Wie mit dem Fluche, den erwarb
Der Erde Fürst im Paradies,
Er sein gesegnet Reich verdarb
Und seine Diener büßen ließ;
Wie durch die reinen Adern trieb
Er Tod und Moder, Pein und Zorn,
Und wie die Schuld allein ihm blieb
Und des Gewissens scharfer Dorn.
Der schläft mit ihm und der erwacht
Mit ihm an jedem jungen Tag,
Ritzt seine Träume in der Nacht
Und blutet über Tage nach.
O schwere Pein, nie unterjocht
Von tollster Lust, von keckstem Stolze,
Wenn leise, leis es nagt und pocht
Und bohrt in ihm wie Mad’ im Holze.
Wer ist so rein, daß nicht bewußt
Ein Bild ihm in der Seele Grund,
Drob er muß schlagen an die Brust
Und fühlen sich verzagt und wund?
So frevelnd wer, daß ihm nicht bleibt
Ein Wort, das er nicht kann vernehmen,
Das ihm das Blut zur Stirne treibt
Im heißen, bangen, tiefen Schämen?
Und dennoch gibt es eine Last,
Die keiner fühlt und jeder trägt,
So dunkel wie die Sünde fast
Und auch im gleichen Schoß gehegt;
Er trägt sie wie den Druck der Luft,
Vom kranken Leibe nur empfunden,
Bewußtlos, wie den Fels die Kluft,
Wie schwarze Lad’ den Todeswunden.
Das ist die Schuld des Mordes an
Der Erde Lieblichkeit und Huld,
An des Getieres dumpfem Bann