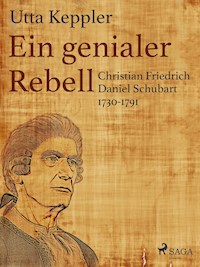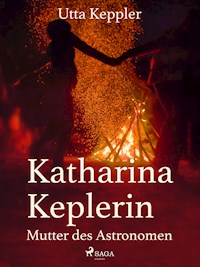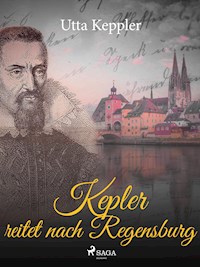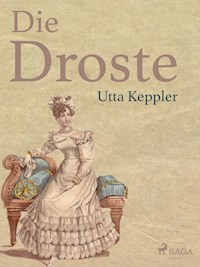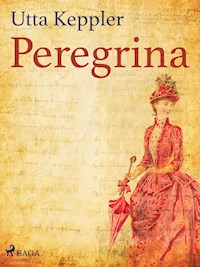Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Franziska Theresia Reichsgräfin von Hohenheim wurde durch ihre Ehe zu Herzog Karl Eugen von Württemberg zur Herzogin von Württemberg. Dort genießt die fromme und karitative Frau einen hervorragenden Ruf. Schon zu ihren Lebzeiten wurde sie als "Guter Engel Württembergs" bezeichnet. Sie war in der Lage ihren unberechenbaren und prunksüchtigen Ehemann zu einem fürsorglichen Landesvater umzuerziehen.Utta Keppler (1905-2004) wurde als Tochter eines Pfarrers in Stuttgart geboren und wuchs dort auf. Sie besuchte die Stuttgarter Kunstakademie bis Sie die Meisterreife erreichte. 1929 heiratete sie und hat vier Söhne. Sie arbeitete frei bei Zeitungen und Zeitschriften und schrieb mehrere biographische Romane, meist über weibliche historische Persönlichkeiten, für welche sie ein intensives Quellenstudium betrieb.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Utta Keppler
Franziska von Hohenheim - Die tapfere Frau an der Seite Carl Eugens
Saga Egmont
Franziska von Hohenheim - Die tapfere Frau an der Seite Carl Eugens
Copyright © 1984, 2017 Utta Keppler und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711708514
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
Frühling 1765
Das Tal lag im Glanz des Frühlingstages. Vor dem farblosen Himmel spann sich das Gewirr fiedriger Äste, an denen das neue Blattwerk funkelte. Vorjähriges Laub deckte den Hang und wirbelte in feinen Schauern unter dem schwachen Wind zu Tal. Drunten leuchteten die Wiesen – feuchtes flirrendes Grün, vollgesogen mit der ersten Sonne, blaßlila schieierndes Schaumkraut, Schlüsselblumen und blaue Inseln von Vergißmeinnicht am überwucherten Bach. Das geschwungene Tal mündete an einem vergrasten See.
Auf dem Weg, den Licht und Schatten fleckten, rasselte die Karosse heran; steif saß der Freiherr von Bernerdin im Fond, hinter und neben ihm drei Töchter und auf dem Bock beim Kutscher der Hauslehrer Weber im braunen Schoßrock, über dem der Zopf tanzte. Die Mädchen hielten sich an den runden Kinderhänden: Johanne Eberhardine und Juliane, elf- und fünfjährig, schauten großäugig über die schimmernden Wiesen. Franziska lehnte schüchtern neben dem ernsten Vater, den Spitzenschirm gegen die Sonne gehalten.
Bernerdin saß hager und sorgenvoll da, die Knie angezogen, und überdachte den Ertrag des kleinen Gutes im Ellwangischen, das er mit seiner rührigen Frau schlecht und recht umtrieb. Franziska lachte vor sich hin und spielte mit dem Schirm. Der junge Hauslehrer drehte sich um und wurde rot dabei. Während die Pferde gleichmäßig forttrabten, tauchten hinter den Feldern die Parkbäume auf und zwischen ihnen das schmale Dach des Hauses. Es war still im Wagen, während die Kutsche in den engen Schloßhof von Adelmannsfelden einbog.
Die schweren Gäule hielten. Bernerdins Gesicht verschloß sich vollends, als die Freifrau unter der Haustür erschien, unruhig nickend, unter dem weißen Häubchen sehr blaß. Hinter ihr schielte die Tochter Louise durch den Türspalt und winkte den Schwestern. Flüchtig begrüßte Frau von Bernerdin die Heimgekommenen, fegte die Mädchen mit einem Wink in ihre Kammern und machte ihrem Mann ein Zeichen. Er warf ihr einen mißvergnügten Blick zu – er hatte sich auf Ruhe gefreut, aber hier mußte etwas Wichtiges im Gang sein, wenn Charlotte Dorothea so aussah.
Sie zog ihn am Rockärmel in das winzige Kabinett neben dem Eßzimmer, wo ein paar von ihren Vohensteinschen Ahnen pastellblaß aus den geschwungenen Rahmen herunterstarrten.
„Bernerdin!“
„Was gibt’s denn?“
„Bernerdin!“
„Sprich schon, ich weiß nachgerade, wie ich heiße!“
„Spotte nicht, Bernerdin! Ein Reitender hat einen Brief vom Leininger gebracht: Der Leutrum, schreibt er, hält durch ihn um eine unserer Töchter an, für seinen Sohn.“
„Der Ritterschaftsrat? Weiß Gott, ihm verdank’ ich etliche hundert Gulden …“, sagte der Freiherr erschrocken.
„Tausend, Mann, und der Alte wär’ schon richtig Sie setzte sich ächzend, aber er ließ sie nicht weitersprechen.
„Frau, können wir denn mehr verlangen, als daß der für seinen Reinhard nach unserer Louise fragt? Er ist immerhin Karlsruher Oberhofmeister und Baden-Durlachscher Geheimderat! Und sie ist schon einundzwanzig! Was soll da das Gejammer? Bist doch sonst so genau mit unserer Rechnung, und jetzt kommt das Geld ins Haus, noch dazu vom Gläubiger selber – wer kann da nein sagen? Wohin will sonst ein Vater mit vier unversorgten Töchtern?“
„Die Marie ist aus dem Haus“, flüsterte die Mutter und wischte die Augen, „die haben wir doch an einen ehrenwerten Mann von gutem Namen gebracht.“
„Aber da sind immer noch vier, die Louise, die Franzel, die Eberhardine, die Julie – uns ist ja kein Sohn geblieben, der das Gut herauswirtschaften könnte …“, er sah sie vorwurfsvoll an.
„Zehn kleine Särge sind auf dem Friedhof, Mann, und alle zehn hab ich so willig empfangen und getragen und geboren wie die fünf Töchter, die uns geblieben sind.“
„Deshalb dürfen wir sie aber nicht festhalten, auch wenn Du’s meinst – es ist Zeit für Louise; und es wird ihr bestes sein.“
„Hat er denn Louise gemeint?“ fragte Frau von Bernerdin und stand auf. „Irgendeine, so hieß es, eine von unseren Mädchen …“ Irgendeine? dachte Bernerdin aufgestört. „Franziska ist zu jung, die nicht. Es wird sicher Louise treffen.“
Bernerdin ging eine Weile schweigend hin und her. Dann blieb er stehen. „Wir können dem nicht zuwider sein, Charlotte“, redete er ernst, „es ist der gewiesene Weg.“
Frau von Bernerdin hatte sich schon in die Lage gefunden; sie rechnete heimlich. „Und wann sollen wir den jungen Leutrum einladen?“ fragte sie.
„Je eher, desto besser, eh er sich’s anders überlegt.“ „Am Sonntag?“ schlug sie vor; „wir können ja dann immer noch mit ihm verhandeln. Ich kenn ihn doch gar nicht und … du willst unseren künftigen Eidam – will’s Gott, er ist respektabel – auch vorher noch prüfen. Und die Mädchen werde ich vorbereiten müssen.“
Bernerdin erhob sich.
„Wir wollen ihnen noch nichts sagen, das hat Zeit, wenn er da ist.“
Das gemeinsame Abendessen verlief still; die Kinder spürten, daß etwas in der Luft lag. Louise, die während der Ausfahrt bei der Mutter geblieben war, schaute heimlich den Vater an, dessen starkbrauiges dunkles Gesicht sie geerbt hatte. Aber beide Eltern schwiegen so nachdrücklich, daß keine der Töchter wagte, zu fragen. Endlich setzte man sich zum Äpfelschälen zusammen – das Winterobst faule im Keller und müsse verbraucht werden, hatte Frau von Bernerdin wortkarg festgestellt. Franziska ging rasch und geschickt mit ihrem Messer um, während sie an dem herumrätselte, was noch ungreifbar in der Luft lag.
Für den Mai war dieser Sonntag zu warm; eine brütende Dämmerung lag seit dem Morgen über den Wäldern. Kein Wind rührte sich, der den fahlen Himmel bewegt hätte.
Üppiger als sonst hatte Frau von Bernerdin schon seit Tagen gebacken und gebraten, die Mägde gehetzt und die Knechte herumgejagt. Der Feiertag begann mit dem Auswählen des Putzes für die heiratsfähigen Töchter, solange sie alle noch schliefen. Einmal schlich die Mutter an die Kammertür, hinter der die beiden Älteren lagen, und horchte auf ihr kaum merkliches Atmen. Dann riß sie sich los, stand gleich darauf wieder in der Küche und befahl, den Braten aufzusetzen, die Rüben zu putzen, die Hühnersuppe am Kochen zu halten.
Bernerdin saß schon früh auf dem Pferd. Er wollte dem Umtrieb im Haus entgehen und seiner eigenen Ruhelosigkeit Herr werden. Er ritt durch den Buchenwald, wo das Vogelgezwitscher seltsam gedämpft klang in dem diesigen Licht des durchsonnten Nebels. Noch einmal überlegte er, was man ihm berichtet hatte: Der junge Leutrum war durch seinen Vater, den Ritterschaftsrat, an den Hof gekommen, er war in Bayreuth Kammerjunker gewesen und galt als Mann von gutem Benehmen und kavaliersmäßigen Sitten; zwar spielte und trank er gern und hatte einige auffällige Affären hinter sich. Aber kein Zug in diesem Bild stach vom Üblichen ab, wenn es auch Bernerdins puritanischen Grundsätzen nicht ganz entsprach. Offenbar sah man dem jungen Menschen vieles nach. Es klang manchmal geringschätzig oder doch mitleidig, wenn von ihm geredet wurde, und es machte dem Freiherrn ein wenig Sorge, daß er so klein sein sollte, so „mäßig von Wuchs“, wie es der Leininger ausdrückte. Nun – man mußte abwarten, und die Mädchen sollten nicht schon erschreckt werden, noch ehe der Freier selbst auftauchte.
Die Töchter tuschelten untereinander. Sie fürchteten und hofften allerlei – wenigstens eine Abwechslung in ihrem wohlgeregelten Tageslauf. Sie errieten auch ungefähr das Richtige, denn was konnte ihr Putz und die festliche Aufregung im Hause sonst bedeuten? Endlich gab die Mutter eine halbe Erklärung: Ein wichtiger Gast werde erwartet, ein Mann von Stand und Ruf, und man müsse es sich zur Ehre anrechnen, daß er sich herbemühe.
Es war gegen elf Uhr am Vormittag. Über den mißfarbenen Himmel zogen vereinzelt grelle Sonnenstreifen. Das junge Laub im Garten glänzte schweflig wie vor einem Unwetter. Bernerdin war heimgekommen und zog sich, als der Knecht das Pferd versorgt hatte, hastig in sein Kabinett zurück. Da kam der Mann gelaufen, den er als Posten im Straßengebüsch aufgestellt hatte: die hochherrschaftliche Kutsche sei im Anrollen.
Frau von Bernerdin ließ die Mägde anrichten. Mit dem Auftragen sollte jedoch gewartet werden; man rufe dann …
Bernerdin erschien im grünen Samtrock, gepudert und frisiert, ein vergilbtes Spitzenjabot unter dem bläulichen Kinn. Die vier Töchter saßen unbehaglich und bedrückt herum und flüsterten miteinander. Frau von Bernerdin hatte ausnahmsweise verboten, daß sie irgend etwas halfen. Weber war nirgends zu sehen.
Der Hund schlug an – man hatte ihn vorsorglich festgebunden. Das Prachtgefährt rollte langsam ins Tor. Ein Lakai mit weißen Handschuhen sprang ab und öffnete den Wagenschlag im gleichen Augenblick, als die Bernerdins aus der Haustür traten. Oben am Fenster drängten sich die Mädchen hinter den Gardinen.
Sie sahen nicht viel: Bernerdins hohe Gestalt verdeckte den Aussteigenden, die Freifrau versank mit gespreizten Röcken in einen Hofknicks und nahm ihnen die Sicht. Der Lakai hielt den Dreispitz des Besuchers, auch der Kutscher war vom Bock geklettert und stellte sich dienstbereit neben seinen Herrn. Dann verschwanden alle im Haus.
Es dauerte nicht lange, bis Louise und Franziska gerufen wurden. Sie folgten neugierig. Im kleinen Salon saßen Eltern und Gast auf den Brokatstühlen mit den geschwungenen Beinen. Errötend schoben sich die Mädchen hintereinander in den Raum, beide verlegen, geschmeichelt und scheu zugleich. Die Vorhänge waren zugezogen, eine braungraue Dämmerung hielt das stumpfe Tageslicht ab. Stühle wurden gerückt. Die Herren standen auf.
Als Franziska, die neben Louise trat, über die rundlichen Schultern ihrer Mutter spähen konnte, entdeckte sie etwas Grünes, gurkengrüne Seide, Spitzengeriesel, Goldknöpfe über den Frackflügeln und, fast versteckt in dem aufgebauschten Rüschenwerk, eine hochtoupierte Frisur, weiße Tollen und Locken – noch kein Gesicht. Jetzt drehte sich der Kopf: Gelbliche Wangen unter eingesunkenen Augen, ein breiter Mund, kein Kinn, kein Hals, ein gebuckelter Rücken. Unter hängenden Lidern funkelte es die Schwestern an; die Pupillen glitzerten schwarz.
Die Mädchen hielten sich an der Hand. Zitternd sanken sie – fast so tief wie vorher die Mutter – in ihren weiten Röcken zusammen. Sie beugten die Köpfe und erhoben sich langsam. Dann rief der Freiherr sie zu sich und stellte sie vor: „Louise, besonnen und häuslich, einundzwanzig Jahre alt, und Franziska“ – seine Stimme schwankte – „siebzehn und noch unerfahren im Hauswesen, noch recht jung …“
Sie reichten dem Gast nacheinander die Hand zum Kuß. Leutrum lachte. Seine gepreßte Stimme klang wie die eines alten Menschen, als er sagte: „Louise und Franziska, Louise und – Franziska!“
Er ließ aus halbverdeckten Augen einen Blick über die beiden gehen, legte die Hand auf das Ordensband an seiner Hüfte und drehte sich zu den Eltern um, die gespannt zugesehen hatten.
„Ihr habt zwei schüchterne Töchter, Herr von Bernerdin“, meinte der Grüne spaßend, „und eine so hübsch wie die andere …“ Er wandte sich an die Mutter, als mache er einen Witz.
Die Mädchen waren blaß geworden; ihre Mienen verschlossen sich. Franziska wandte hilfesuchend das Gesicht zu ihrer Mutter. Nur Louise lächelte gefaßt. Leutrum wiegte ein paarmal den Kopf.
Da machte Frau von Bernerdin der Szene ein Ende und bat zu Tisch. Der Hausherr ließ dem Freier den Vortritt. Franziska hielt sich hinter dem Vater. Erstaunt starrte sie auf Leutrums lange baumelnde Arme, die mageren Hände unter den Spitzenmanschetten, die fast in Kniehöhe hingen – geäderte Hände von beinahe transparenter Zartheit, leidende Hände. Sie nahm sich vor, während der Mahlzeit nur seine Hände anzusehen, nicht die Augen.
Man setzte sich. Bernerdin trank dem Bewerber zu „auf eine innige Verbindung der beiden alten Geschlechter“; Leutrum hob sein Glas. An seinem Zeigefinger blitzte ein großer Solitär, ein Diamant von reinstem Feuer. Louise hielt den Kopf gesenkt, sie merkte blad, daß Leutrums Blicke immer wieder zu Franziska zurückkehrten. Mitleid regte sich in ihr. Sie war derber und nüchterner als die zarte Schwester und hätte eher standgehalten in der Ehe mit dem Verwachsenen.
Leutrum griff nach seinem Kelch und grüßte zu Franziska hinüber, die funkelnden Augen auf sie gerichtet. Franziska wurde rot und schloß krampfhaft die Hand um ihr Glas, das ihre Mutter mit gewässertem Wein gefüllt hatte. Es war sonderbar still an der Tafel.
Bernerdin versuchte mühsam, ein Gespräch in Gang zu bringen. Vom Hof war die Rede, von den Jagden, von den Klagen der Bauern. Ach, sie murrten wohl über die Sauhatz, die ihre Felder verwüste? sagte der Gast, und über die Wildmast auf ihren Äckern? Aber für so ein Fest wie das am Bärensee letzten Herbst brauche man an die dreihundert gut gefütterte Hirsche und Rehböcke und für ein Sautreiben an die zwanzig Eber, denn die Geladenen hätten fast alle selber Waldbesitz und seien verwöhnte Kenner.
„Es ist aber doch bitter für die Landleute“, meinte Bernerdin, „wenn sie ihren Zins an Feldfrüchten und Korn abliefern sollen und so klägliche Ernten haben! Was bleibt ihnen dann übrig? Ich teile den Meinen immer das Mögliche zu, damit sie leben können.“
Für die Herrschaft dürfe es ja ein wenig mehr sein, da sie eben die Herrschaft sei, warf Frau von Bernerdin schnell ein, als sie Leutrums spöttisches Lächeln sah.
Leutrum fuhr mit der Hand durch die Luft.
Bernerdin solle sich doch vorstellen, was so eine prachtvolle Frau wie die Maitresse en titre an Schmuck brauche, von den übrigen Tänzerinnen und Sängerinnen zu schweigen … und ob Carl Eugen vielleicht den endlich erreichten Ruhm fahrenlassen solle, den glanzvollsten Hof Europas zu haben?
„Das hat der Casanova gesagt“, bemerkte Bernerdin ärgerlich, „ein Abenteurer und Scharlatan, überall gefüttert und gefürchtet an den Höfen, und ein Frauenjäger trotz seiner vierzig Jahre, wie ihn nur Venedig hervorbringen kann!“
Frau von Bernerdin blickte bedrückt nach den Mädchen hinüber, die unbehaglich auf den Rändern ihrer Stühle hockten.
„Casanova?“ Leutrum lachte. „Ein amüsanter Mann und sehr gebildet, in der hohen Mathematik wie in der Magie der Kabbala bewandert, dem jedermann schön tut, damit er gut von ihm redet, denn er ist ja überall zu Hause! Haben Sie nicht das Histörchen gehört, wie er der Rosette Dugazon, weiland Favoritin Serenissimi, aus der Verlegenheit half? Die große Mimin hat bekanntermaßen eine taube Zunge – das R fällt ihr schwer … Da hat der Teufelskerl es fertiggebracht, in einer Nacht ihre Rolle so umzuschreiben, daß kein einziges Wort mit R mehr drinstand – um den Preis eines Kusses, sagt er …“ Der Freiherr schaute auf seinen Teller.
„Ich kenne Ihre strengen Sitten und gut protestantischen Prinzipien, Bernerdin“, Leutrum zog einen Mundwinkel hoch. „Wir sind übrigens gleichfalls Protestanten, wenn auch nicht gerade Glaubensflüchtlinge wie Ihr Ahn Andreas aus Tirol.“
Er trank. „Die Zeiten sind anders jetzt: Wer keinen Sinn hat für das Schöne, wie man’s am Hof versteht, der wird übersehen. Und Serenissimus ist doch das Maß aller Dinge …“
Er drehte sein Gesicht wieder den Mädchen zu. Auch die Jüngsten waren jetzt hereingebracht worden; in steifen langen Kleidchen standen sie an der Wand und machten große Augen. Leutrum warf ihnen eine Handvoll Konfekt zu, als beschenke er gaffendes Straßenvolk. Frau von Bernerdin befahl ärgerlich, Hocker zu bringen, und schob die Kinder zwischen sich und den Vater.
Leutrum beobachtete jetzt Franziska, die mit gebeugtem Nacken vor sich hinsah. Ihre kleinen Ohren schimmerten rot unter den geringelten Haaren, die auf den zartfarbigen Hals fielen. Die schönen Hände lagen neben dem Gedeck. Es müßte ein imposantes Bild sein, dachte Leutrum, neben der hellhäutigen Blondine in einen erleuchteten Ballsaal zu treten und alle Blicke auf sich zu ziehen, auch die von Leuten, die sich sonst abwenden, wenn ich hereinkomme; schön müßte es sein, sich mit einem so köstlichen Besitz zu schmücken wie mit einem seltenen Juwel!
Bernerdin saß mit kaum beherrschtem Mißmut an der Tafel. Serenissimus ist das Maß aller Dinge, wiederholte er sich, „und das Mädchen stiert er an wie ein Aufkäufer!
Leutrum spürte die Veränderung. Er sagte mit einem boshaften Lächeln: „Ihr habt Schwierigkeiten bei der Erbteilung Eures Besitzes gehabt? Die Herren von Junkhenn und Gültlingen waren keine bequemen Partner dabei, nehme ich an?“
Bernerdin verschluckte den Ärger über das ungehörige „Ihr“.
„Die Verhältnisse sind verwickelt“, antwortete er kurz, „die Eidame der Tanten haben sich nicht immer benommen wie Edelleute.“
„Mein Vater scheint aber Wege gefunden zu haben, sie zufriedenzustellen? Es kam mir so vor – nach seinen Andeutungen …“
Bernerdin sah seine Frau an. Sie schloß die Lippen in einer mahnenden Grimasse: Man soll einen mächtigen Gläubiger nicht reizen … Bernerdin runzelte die Stirn und blickte bedeutsam auf Franziska und Louise, die eben hinausgingen, um dem ungeschickten Diener beim Servieren zu helfen.
Leutrum verstand den Wink: Auch Bernerdin bot etwas von Wert, das die Vorschüsse des Ritterschaftsrats wohl aufwiegen konnte.
Franziska spürte, welcher Art die Gedanken waren, die wie Ströme hin- und hergingen. Sie preßte den Mund zusammen und sah zu den Männern hinüber, die jetzt am Tisch standen, die Hände aufgestützt. Sie schaute die Mutter an: Sie und der Vater gaben ihre Tochter preis. An dieses dunkle krumme Wesen.
Leutrum hatte Franziskas Blick erfaßt. Ich kaufe sie gegen ihren Willen, dachte er und schämte sich plötzlich. Aber – ich bin doch nicht schuld an meiner Ungestalt. Ich habe keinen Grund zur Dankbarkeit und keinen zur Güte. Ich werde sie alle zwingen, zu tun, was ich will.
Er beugte sich vor. „Darf ich die Herrschaften zu einer Wagenfahrt einladen, am kommenden Sonntag? Ich würde eine kleinere ‚Wurst‘ mieten, denn meine Fahrzeuge könnten doch die ganze liebe Familie nicht fassen!“
Jetzt fingen die beiden kleinen Mädchen zu lachen an. Frau von Bernerdin rief sie zur Ordnung. Die „Wurst“ sei ein offenes Fuhrwerk, erklärte sie, das bis zu zwölf Leute aufnehmen könne.
„Der Hof benutzt es bei gutem Wetter zu seinen Touren“, ergänzte Leutrum gewandt, „es hat kommode Polster und Lehnen. Ich möchte mit der verehrten Sippschaft auf den Neresheimer Klosterberg fahren, von da aus ist das Land schön zu überblicken, und die Benediktiner schenken einen guten Wein aus.“
Frau von Bernerdin verbeugte sich im Sitzen und flüsterte mit halbem Lächeln etwas von Ehre und delikatem Vergnügen; sie sagte im Namen aller zu, auch, fügte sie hinzu, auch der Töchter …
Die Spazierfahrt
Franziska hatte die Woche vor der Spazierfahrt in einer trostlosen Stumpfheit zugebracht. In der Nacht zum Sonntag lagen beide Schwestern wach in ihrem Zimmer. Louise sprach der Jüngeren gut zu, sie fände den Reinhard gar nicht so übel, er habe immerhin Geschmack, sei ein gebildeter Mann und könne sich unterhalten, wie es einem adligen Herrn zukomme. Sie selber, Louise, würde im gleichen Fall schon mit ihm fertigwerden.
Ob das ihr Ernst sei? fragte Franziska begierig, ob sie sich wirklich getraue, mit diesem Menschen zu leben?
Louise zögerte; ganz deutlich hatte sie sich das noch nie ausgemalt. Sie spürte, wie Franziskas heiße Hand in der ihren zitterte.
„Warum nicht?“ sagte sie tapfer. „Und übrigens hat er ja noch gar nicht gewählt.“
Franziska seufzte auf. Sie wußte besser, daß Leutrums Entscheidung schon lange gefallen war. Aber sie klammerte sich an die vage Hoffnung, er könnte vielleicht doch Louise …
Der Morgen kam, ein nebliger Maimorgen mit feinem Sprühregen. Die Blätter der Linde glänzten. In Schwaden wogte das Licht aus der Verhangenheit. Leutrums Wagen fuhr in den Hof ein, die Kleinen stießen sich befriedigt an. „Wie eine richtige Wurst!“ stellte Juliane überzeugt fest.
Prachtvoll geschirrte Pferde zogen das lange braunlackierte Fahrzeug, zwei Lakaien standen hinten, und einer saß neben dem Kutscher, alle in Leutrumscher Livree.
Der Freier hatte es so arrangiert, daß Franziska neben ihm Platz nehmen mußte. Er werde sonst geblendet, erklärte er halblaut, wenn er gezwungen sei, immerzu in die Augen eines so reizenden Vis-àvis zu blicken.
Franziska verbarg ihr Gesicht hinter einem Fächer, schaute angestrengt aus dem Fenster und bog sich soweit als möglich von dem eifrig Redenden weg. Man fuhr durch den leichten Regen, eine Plane war aufgespannt worden. Die Kleineren zappelten vor Unternehmungslust, Vater und Mutter saßen stumm und würdig dazwischen.
Franziska beobachtete wieder verstohlen Leutrums lange gelbe Hand, die auf seinem Knie lag; Smaragde und Rubine machten sie nicht liebenswerter, und das silbrige Spitzengeriesel am Ärmel wirkte darüber wie ein stilloser Zierat. Verborgenes, vielleicht unbewußtes Leiden schien in dem verästelten blauen Geäder eingedrückt.
Louise fiel ihr halbes Versprechen ein. Erstaunt beobachteten die Eltern, wie sich die Ältere, die Brauen ernsthaft zusammengezogen, an den Baron wandte, während das Schwanken des Wagens auf den unebenen Wegen sie schaukelte. „Sie haben so reizend vom Hof zu Ludwigsburg erzählt, Herr von Leutrum“, sagte sie mit einem nicht ganz glaubwürdigen Lächeln, „daß ich wohl Lust hätte, diese Feeninsel und Märchenfülle zu erleben. Wenn Sie es auf sich nehmen könnten, mich einmal hinzuführen?“
Frau von Bernerdin stieß erregt ihren Fuß gegen Louises Bein, das der dunkelrote Rüschenrock verdeckte.
Louise verlor ihre krampfhafte Heiterkeit und schickte einen verzweifelten Blick zu Franziska hinüber, die müde den Kopf schüttelte.
Leutrum lachte; er werde es sich zur Auszeichnung rechnen, der teuren Familie sein kleines Ludwigsburger Haus vorzuführen.
In einer nassen Waldschneise begegnete dem Gefährt eine Holzfuhre, die ein struppiger Greis über den Pfad zerrte. Er erschrak, hetzte weiter und wäre beinahe gefallen. Dann hielt er am Wegrand und zog die verbeulte Kappe. Er bückte sich, bis ihm die grauen Strähnen ins Gesicht fielen. Bernerdin grüßte. „Der gehört nicht mehr zu unserer Herrschaft, sondern zur herzoglichen“, sagte er mit einem Blick auf den zerfetzten Rock des Gebeugten. „Aber die Leute hier dürfen nur selten Holz sammeln; und dieses treibt jetzt schon und ist ganz feucht.“
Sie fuhren vorbei.
„Besser als keins“, meinte Leutrum leichthin. Franziskas Augen streiften sein verwelktes Gesicht mit dem zynischen Mund. „Er ist vor lauter Bitterkeit alt und böse geworden“, dachte sie und spürte, wie sie erstarrte.
In der welligen Felderebene tauchten die Neresheimer Klostertürme auf, vom Baugerüst wie von leichten Gittern umsponnen. Die Pferde gingen im Schritt die Allee hinauf. Leutrum wies mit dem Stöckchen vorwärts; Franziska beugte sich weg. Er legte behutsam und wie probierend den Arm um ihren Nacken. Es war eine Berührung ohne Aufdringlichkeit. Trotzdem wischte sie leicht mit den Fingern über ihre Schulter und streifte ihn ab. Bernerdin lächelte mühsam. Louise vermied es, Franziska anzusehen; sie grübelte beständig darüber nach, wie sie ihr helfen könnte.
Inzwischen kam die Kutsche im Klosterbezirk an. Leutrum bemühte sich um die Damen, die ihre Reifröcke mit zierlich vorgestreckten Füßen aus der Wagentür quetschten.
Franziska hielt die Schwester zurück. Die übrigen traten ins Haus, um das Essen zu bestellen.
„Kannst du dir denken“, flüsterte Franziska scheu, „daß der einmal ein ausgelassener Bub war? Und er soll erst dreiundzwanzig sein!“
„Das Jungsein hat ihm wohl die Hofettikette ausgetrieben“, tröstete Louise halblaut. „Aber wir müssen jetzt hinein.“
Nach der Mahlzeit in der Klosterschenke schlug Leutrum vor, den berühmten Neresheimer Kirchenbau zu besichtigen, das letzte Werk des großen Balthasar Neumann, das seit dem Tod seines Schöpfers nun schon zwölf Jahre lang verwaist liege. Es gebe keinen mehr, der es wage, die kühnen hölzernen Gewölbekonstruktionen des Meisters auszuführen. Man erzähle, daß sein Sohn an einem vereinfachten Plan arbeite, der freilich wohl nur einen großartigen Torso zutage bringen würde.
Leutrum plauderte angerept und unermüdlich über Baukunst – er hatte vorher einiges Passende gelesen. Er deutete in die Wölbungen der Decke, wo der Maler Knoller seine Fresken auf dem Verputz skizziert hatte.
Bernerdin wollte den Künstler besuchen, aber Knoller war nicht bei seinem Werk. Oft genug – klagten die frommen Brüder bekümmert – hingen nur seine Stiefel oben, er selber sitze in der Klosterschenke statt auf dem Gerüst. Und dabei sehe es von unten aus, als arbeite er demütig und hingegeben an irgendeiner irdischen Rundung oder himmlischen Schwingung. Es sei ein Jammer mit den Herren Künstlern!
Da die Bemalung sich erst in matten Wolken, in schwebenden Farbtönen zeigte, wirkte die Architektur der Bögen um so stärker. Die Balustraden und Gewölbeecken öffneten immer neue Durchblicke. Es war, als vollziehe sich ein großartig bewegtes Theater für die Augen, als schwebten und wogten die Formen in feierlichem Rhythmus gegeneinander. Franziska starrte gebannt hinauf und zog mit dem Finger die Linien in der Luft nach, als wollte sie den großen Plan aufzeichnen.
Während der Rückfahrt sprach Bernerdin über die vielfältigen religiösen Strömungen in dem kleinen Württemberger Land und merkte, wie ein Schatten über Leutrums flache Stirn lief, als er mit Sympathie von den Pietisten reden hörte. Sie seien das Salz der Kirche, meinte der Freiherr, auch wenn man es nicht immer wahrhaben wolle. Sie hätten einen tiefen Ernst und eine Einsicht in die Lage des Volkes, von der man bei Hof manches annehmen dürfte.
„Aber sie murren oft genug, und ihre Prediger halten nicht immer die gebührliche Subordination ein, sie haben hier und dort etwas auszusetzen am allergnädigsten Fürsten; Serenissimus liebt keinen engeren Kontakt mit diesen kleinen Leuten, so generös er sonst in Sachen der Konfession ist!“
„Er kümmert sich überhaupt nicht um die Religion“, tadelte Bernerdin, „und das ist etwas ganz anderes als bei seinem königlichen Oheim in Brandenburg – der gönnt es jedem, die Seligkeit auf seine Façon zu erlangen, und hält doch alle in der Ordnung.“
„Friedrich“, murrte Leutrum gelangweilt, „der sich als Mentor unseres allerhuldreichsten Fürsten aufwirft, weil er seinen Ehevertrag mitgarantiert und ihm in seinen Anfängen etliches geholfen hat … Wir machen uns immer unabhängiger von ihm, und wenn er die Subsidienverträge nicht gutheißt …“
Bernerdin schlug sich mit der Hand aufs Knie. „Den Soldatenhandel sollte er längst verbieten und nicht befehlen, der Herzog! Menschen verkaufen! Aber dahinter steckt dieser Schmeichler Montmartin, dieser gewissenlose, charakterlose … und das will ein Mann von Adel sein, ein Graf? Und der oberste Minister in Wirtenberg?“
„Soldatenhandel?“ warf Leutrum hin, „es tun’s doch alle: Der Hesse, der Bayer, alle brauchen Subsidiengelder, und wer zahlen kann, kriegt, was er will.“
Bernerdin schwieg.
Da unterbrach Leutrum die mißmutig lastende Stille mit einer Einladung. Man müsse doch das Corps de Logis in Ludwigsburg besehen und das kleine Palais, das den Kammerherren und Reisemarschällen zustehe, unter die er sich bald zu zählen hoffe. Niemand widersprach. Frau von Bernerdin verneigte sich zustimmend. Leutrum dankte; er freue sich ungemein, sagte er höflich. Aber dann verfiel er wieder in sein trübseliges Sinnieren. Nach der Heimkehr nahm er keinen Imbiß mehr an, verabschiedete sich rasch und schaute nicht zurück, als seine Karosse gegen die Wälder einbog. Da saß er versponnen und niedergedrückt in der Wagenecke und spielte mit seinen Ringen. Er sah sich wieder im Neresheimer Klostergewölbe, unter Pfeilern und Laibungen.
„Der Neumann hat’s aufs Papier gerissen“, grübelte er, „nur die vollkommene Gestalt hat er nicht mehr erlebt. Ein gigantischer Wurf. Aber jetzt wird’s verstümmelt und vertan, und was bleibt, ist ein Krüppelgewächs – wie ich!“
Der Ludwigsburger Schloßhof lag im Mittagslicht. Louise lief. Glücklicherweise hatte sie noch keiner gefragt, wer sie sei und wo sie hin wolle. Drunten im Park saßen die Ihrigen mit Leutrum und schwatzten. Man versuchte das neue, in Italien erfundene Eisgericht, das Casanova eingeführt hatte. Louises „kleiner Gang durch die Parkwege“ hatte bisher niemanden beunruhigt.
„Ich werde die Leute vom Hof nicht anreden“, dachte Louise am Tor, „hier können mir ja die kleinen Kinder sagen, wo ich den Herzog finde.“
Im weiten Umkreis des Innenhofs lagen die Schloßgebäude. Sie schaute sich neugierig um. Drüben ging ein Diener mit einem Korb voll Weinflaschen auf eine Tür zu, aber ehe sie ihm nahe genug war, um zu rufen, verschwand er schon im Eingang.
Da kam wieder ein älterer Livrierter quer über die Hofbreite, langsam, als müßte er seine Würde samt seinen weißen Strümpfen deutlich zur Schau stellen. Louise ging auf ihn zu. „Verzeihen der Herr, bitte“, redete sie ihn an, da er ihr durchaus einige Stufen über den Adelmannsfelder Bedienten zu stehen schien. Der Lakai drehte sich erstaunt um; er hatte die junge Dame im Vorbeigehen ganz richtig als ländliches Adelsfräulein eingeschätzt und wunderte sich, daß sie allein kam. „Sie befehlen, Mademoiselle?“ fragte er bereitwillig.
„Ist der Herzog hier?“ entfuhr es der aufgeregten Louise. Der Diener wurde um einige Grade steifer und legte die behandschuhten Finger an die Hosennähte. „Seine Durchlaucht erteilen seit acht Uhr Audienzen“, rapportierte er in dienstlichem Ton. „Sind die gnädige Demoiselle dafür vorgemerkt?“ Louise stockte nur einen Moment. Aber hier bot sich ihr das Stichwort, das sie brauchte. „Allerdings, und dringlich!“ stieß sie hervor, und wiederholte noch einmal: „Ganz dringlich!“
„Und wen darf ich dem diensttuenden Kammerherrn melden lassen?“
„Meld Er“ – sie verbesserte sich – „melden Sie die Demoiselle de Bernerdin in einer ganz persönlichen Angelegenheit!“
„Jawohl, Euer Gnaden“, bestätigte der Alte devot und verbeugte sich, nicht ganz so wie vor den herzoglichen Verwandten, aber doch wie man etwa eine der Hofdamen oder eine Freundin der Hauptmaitresse grüßte. Louise wurde in einen Vorraum gebeten, sie sah vor zitternder Erwartung gar nicht, in welches Gebäude, durch wie viele Flure und Türen es ging; und dann wurde sie ersucht, auf einem der seidenen Stühlchen Platz zu nehmen; sie tat es nur mit einem winzigen Teil ihrer selbst, so daß sie gerade noch vor dem Abrutschen bewahrt blieb. Um sie herum saßen und standen allerlei Leute, sie verschwammen vor Louises Augen zu einer undeutlich wogenden Masse, fast wie bunte Fische im Aquarium.
Ein dunkel gekleideter Herr mit Orden erschien unter einem geschnitzten Portal und ließ sich von einem rotbefrackten Lakaien die Neuhinzugekommenen nennen; Louise war darunter. Ihr erster Begleiter hatte ihren Namen mit bedeutsamer Miene angegeben, und betont wurde er jetzt weitergeflüstert, nachdrücklich dem Minister, geheimnisvoll schließlich dem Herzog gemeldet … Carl Eugen hörte schon seit Stunden Anliegen und Anerbieten und war müde; als ihm aber eine ansehnliche junge Dame von Adel präsentiert wurde, ließ er sie schon nach einer Viertelstunde hereinkomplimentieren.
Louise war ein wenig verstört, durchs Warten ängstlich geworden, und wischte verlegen über ihr wirres Haar, zupfte am Ausschnitt, strich über die Rockfalten. Sie trat in ein kleines Kabinett, trippelte vorsichtig über spiegelndes Parkett und wagte nicht aufzuschauen. Endlich – knapp vor dem Schreibtisch, sank sie zu dem gelernten Hofknicks zusammen. Sie rutschte ein wenig aus mit dem zurückgestellten Fuß, schwankte halb in der Hocke, trat auf die Rockrüsche und fiel vollends zu einem unbeabsichtigten Fußfall nieder. Sie schaute verzweifelt auf, sah schwarze ausgeschnittene Lackschuhe, weißseidene Hosen mit goldenen Strumpfbändern, sie registrierte alles mit der Exaktheit der Verzweiflung. Ein leises gurrendes Gelächter rollte sanft über sie hin, sie lag noch immer hingegossen in ihren fließenden Kleiderfalten und riskierte es endlich, den Kopf ganz zu heben.
Carl Eugen lächelte aus kleinen Augen. Er beugte sich ein wenig vor und bot ihr die Hand zum Aufstehen. Dann warf sie den ersten bewußten Blick auf ihn: Ein starker, sehr selbstgewisser Mann saß vor ihr, gewichtig und überlegen. Die gewölbten Brauen waren hochgezogen, der Mund verbog sich zu gutmütigem Spott: Das drang sekundenschnell in Louises jetzt überwaches Bewußtsein.
Aber dem Herzog dauerte die Verblüffung der jungen Dame zu lang.
„Nun, was führt Sie her, Demoiselle?“ fragte er und betrachtete die gebeugt Stehende in ihrem grauseidenen Gewand. Sie schien ihm nicht ganz das, was die Wichtigtuer ihm hatten nahelegen wollen, keines der verfügbaren Mädchen, und ihre Erregung deutete eher auf große Not als auf kokette Berechnung hin. Er wartete also ein paar Augenblicke. Louise zwang sich zum Reden.
„Durchlaucht, bitte tausend-, hunderttausendmal um Vergebung – ich … ich komme nicht wegen mir – es ist wegen meiner kleinen Schwester, der Franziska!“
„Ach?“ machte der Erhabene gemütlich, „was fehlt denn dem Fräulein Schwester?“
„Sie soll doch heiraten!“
„Ist das denn so schlimm?“
„Manchmal schon, Durchlaucht!“ flüsterte die Bittstellerin.
Carl Eugen mochte an eigene Erfahrungen denken und seufzte. „Ja, es kann schlimm werden, manchmal …“
Louise faßte Mut; es eilte ohnehin, denn schon spähte ein Lakai mahnend durch den Türspalt.
„Durchlaucht“, setzte sie wieder an, „sie soll den Leutrum kriegen – er ist ganz krumm und sehr klein, und sie mag ihn gar nicht, und sie ist erst sechzehn und so zart und hell und …“
„Nehmen Sie immerhin einen Stuhl, Demoiselle!“
Der Herzog deutete auf einen der imposanten goldgerahmten Fauteuils aus rotem Samt.
Louise dankte; sie blieb lieber stehen, falls doch noch ein Kniefall nötig werden sollte. „Euer Durchlaucht haben dabei gewiß ein Wort mitzureden – zu befehlen, mein’ ich. Und da wollte ich alleruntertänigst bitten, dem Leutrum zu bedeuten … zu verbieten … ach, Durchlaucht wissen es gewiß selbst am besten!“ Sie schloß aufatmend und erschöpft den Mund.
„Der Leutrum?“ erkundigte sich der Herzog, „der ist mir wohlbekannt; sein Vater ist Ritterschaftsrat des Kantons Kocher, Baden-Durlachscher Geheimderat … ja, da kann sie doch eigentlich zufrieden sein, Ihre kleine Schwester, nicht?“
„Das sagt mein Vater auch, aber der Leutrum …“ „Ich weiß, er ist nicht gut gewachsen, kein Mensch, der den Frauen gefällt. Und Ihre Franziska – ist sie schön?“
„Sehr! Wunderschön, Durchlaucht, und paßt gar nicht zu so einem … Zwerg!“
„Hm“, brummte der Herzog, „so arg ist’s ja nicht gerade. Kennt sie denn den Freier schon?“
„Ja, leider.“
„Und liebt einen anderen, wie das in solchen Fällen ist?“
„Nein, nein, Durchlaucht, niemand, bloß – der Hauslehrer hat ihr einmal ein Gedicht gebracht, und da hat ihn der Vater mit Prügeln fortgejagt.“
„Also – in Adelmannsfelden dichten sie auch, das liegt den Schwaben scheint’s im Blut … War’s denn ein Hymnus oder eine Ode, was der Dorfschulmeister da zusammengereimt hat?“
Sie merkte den Spott nicht. „Ich weiß nicht recht“, kam es stockend, „halt ein schöner Vers. Ich kann bloß noch den Schluß:
Die kühne Hoffnung, die mich längst erfüllt,
Seit ich dich sah, du süßes Engelsbild,
Will jetzt im Unglück wirklicher erscheinen.
Der demutsvoll zu deinen Füßen kniet,
Weiht dir, verehrte Franzel, dieses Lied:
Laß mich dir dienen, laß mich mit dir weinen.“
Carl Eugen lachte amüsiert. „Hm, gar nicht so schlecht! Aber was denkt sich der Mensch eigentlich? Nichts? So ist das also mit der Franzel! Nun, ich werd mir den Leutrum für irgendeine Dekoration vormerken und die kleine Schwester auch bestellen und ihr gut Zureden. Gehen Sie nur heim, Mademoiselle, einen Gruß an den Herrn Vater und an die – Franziska!“
„Die wissen’s gar nicht!“ platzte Louise heraus, „ich bin einfach weggelaufen!“
Jetzt lachte Carl Eugen, und er lachte noch, als Louise mit einem scheuen und vorsichtshalber nicht allzu tiefen Knicks verschwand. Dann vergaß er die Angelegenheit sofort.
Auf den Gängen und Treppen mußte sich Louise ohne Geleit zurechtfinden. Sie lief, als würde sie gejagt, um möglichst schnell aus dem Labyrinth dieses bedrückend weitläufigen Baues hinauszukommen. Aus einem Seitengang hörte sie Gelächter, Frauenstimmen und das Getrippel vieler Füße. Eine Gruppe junger Damen wogte schwatzend durcheinander wie gefiederte Vögel, schillernd in Seide und Spitzen. Ihre gepuderten Haare sahen aus wie eine einzige Wolke von Flaumfedern, so nah standen sie beieinander. Louise fragte schnell nach der Treppe zum Park. Sie kicherten und winkten; eine der Jüngeren trat auf Louise zu, um ihr den Weg zu weisen. Man sah sie bedauernd und belustigt an; dann blieb alles zurück, das klirrende Gelächter und die glitzernde Schar, die ganze fremde, verlockende, undurchschaubare Welt des Hofes.
Als Louise sich auf dem großen Vorplatz umsah, entdeckte sie über die Fläche hinweg ihren Vater, Leutrum, die Mutter mit Franziska und die kleinen Schwestern. Sie schlüpfte in eine Nische und wartete, bis alle ein wenig weitergegangen waren; zittrig, aber verwegen kam sie bei der kleinen Gesellschaft an. Man begrüßte sie erstaunt; aber sie hatte sich eine nette Geschichte ausgedacht: daß sie im Park mit einer Dame ins Gespräch gekommen sei, die sie ins Schloß geführt hätte. Sie sei jetzt noch ganz durcheinander von dem Vielerlei, was sie dort gesehen hätte. Louise nahm Franziska heimlich beiseite. „Franzel“, wisperte sie, „jetzt brauch ich beinah deinen Trost, und dazu noch deinetwegen!“ Franziska blickte sie verständnislos an.
„Ich hab’s recht machen wollen“, flüsterte Louise, „ich hab gedacht, jetzt kann keiner mehr der Franzel vom Leutrum helfen als der Herzog selber! Deshalb bin ich auch weggelaufen und hab mich bei der Audienz melden lassen und bin zugelassen worden, obwohl man sonst wochenlang drum eingeben muß …“
„Louise! Das hast du meinetwegen getan? Und der Vater? Und der Leutrum? O gute, gute Louise … das gibt ein Unglück!“
„Ich hab’ ja auch gar nichts erreicht“, beichtete Louise kleinlaut, „er hat mich angehört und gefragt, ob du einen anderen gern hättest, und er wollte einmal mit dir drüber diskutieren, und den Leutrum wollt er dekorieren, und du solltest halt zufrieden sein, er wär’ nicht ganz so übel, und die Ehe …“ Franziska drückte ihr die Hand auf den Mund. „Sag kein Wort mehr, damit der Vater nichts erfährt! Ich hoff nur, daß es der Leutrum nicht merkt. Und wenn der Herzog je mit ihm reden sollt’ und mit mir … wenn er mir einen Brief schriebe, mich zur Audienz beföhle, dann würde ja alles publik! Ach, liebste Louise!“
Beide schwiegen bedrückt; sie wagten sich kaum anzusehen, während man Leutrums Wohnung besichtigte. Franziska ging wie im Nebel mit und erkannte kaum, was sie umgab. Das angebotene Mahl lehnte Bernerdin ab, es werde Zeit, sagte er ernst, an den weiten Heimweg zu denken. Im Wagen klang alles nur noch wie ein Traum in Franziska nach, ein Alptraum, der sie immer mehr bedrückte, je unabwendbarer das Beschlossene herankam.
Pforzheimer Jahre
Anfang Juli 1765 wurde die Hochzeit gefeiert. Franziskas Hand „war dem Freier gewährt worden“, wie es Frau von Bernerdin ausdrückte. Das Paar wurde in Adelmannsfelden getraut; die bescheidene Mitgift von 1500 Gulden hatte Leutrum ohne Kommentar hingenommen. Nach der Feier zog er mit seiner jungen Frau nach Pforzheim.
„Du mußt dich mit ihm arrangieren, Kind“, hatte Frau von Bernerdin beim Abschied geflüstert, als ihr Franziska weinend um den Hals fiel. Der Vater hatte ihr kurz die Hand gedrückt und den beiden „Gottes Beistand“ gewünscht; er verbesserte sich schnell und wünschte „Gottes Segen“.