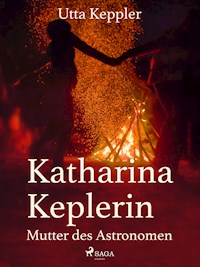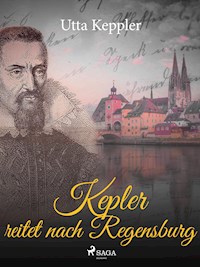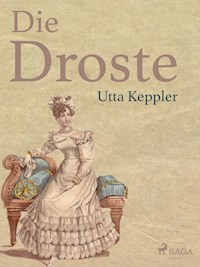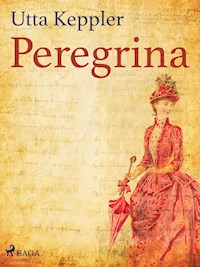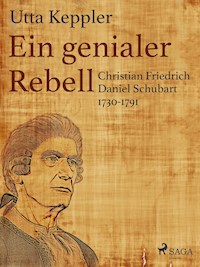
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In diesem Werk erzählt Utta Keppler über das Leben des deutschen Dichters, Organisten, Komponisten und Journalisten Christian Friedrich Daniel Schubart. Besonders bekannt ist Schubart für seine sozialkritischen Schriften, in denen er gegen die absolutistische Herrschaft in Württemberg zu seiner Zeit scharf kritisierte. Dieses Thema und noch viele weitere werden in dem Roman angesprochen.Utta Keppler (1905-2004) wurde als Tochter eines Pfarrers in Stuttgart geboren und wuchs dort auf. Sie besuchte die Stuttgarter Kunstakademie bis Sie die Meisterreife erreichte. 1929 heiratete sie und hat vier Söhne. Sie arbeitete frei bei Zeitungen und Zeitschriften und schrieb mehrere biographische Romane, meist über weibliche historische Persönlichkeiten, für welche sie ein intensives Quellenstudium betrieb.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Utta Keppler
Ein genialer Rebell - Christian Friedrich Daniel Schubart 1730-1791
Saga Egmont
Ein genialer Rebell - Christian Friedrich Daniel Schubart 1730-1791
Copyright © 1982, 2017 Utta Keppler und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711708538
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Die forelle
Von Christian Friedrich Daniel Schubart
In einem Bächlein helle,
Da schoß in froher Eil
Die launige Forelle
Vorüber wie ein Pfeil
Ich stand an dem Gestade
Und sah in süßer Ruh
Des muntern Fisches Bade
Im klaren Bächlein zu.
Ein Fischer mit der Rute
Wohl an dem Ufer stand
Und sah’s mit kaltem Blute,
Wie sich das Fischlein wand.
So lang dem Wasser Helle,
So dacht ich, nicht gebricht,
So fängt er die Forelle
Mit seiner Angel nicht.
Doch plötzlich ward dem Diebe
Die Zeit zu lang. Er macht
Das Bächlein tückisch trübe,
Und eh ich es gedacht,
So zuckte seine Rute,
Das Fischlein zappelt dran,
Und ich mit regem Blute
Sah die Betrogne an.
Die ihr am goldnen Quelle
Der sichern Jugend weilt,
Denkt doch an die Forelle;
Seht ihr Gefahr, so eilt!
Meist fehlt ihr nur aus Mangel
Der Klugheit. Mädchen, seht
Verführer mit der Angel!
Sonst blutet ihr zu spät.
Frühe Schuld
„Christian und Conrad!“ sagte der Forstmeister Hörner aus Sulzbach und nahm den Dreispitz aus dem Schrank, „ihr zwei bleibt schön still daheim und macht mir keine Flegeleien, wie’s euch der Vater schon geheißen hat!“ Er wandte sich um. „Wir gehen derweil, ’s ist Zeit jetzo!“
Christian machte eine ungeschickte Verbeugung. „Ja, gewiß, Herr Großvater!“ antwortete er gehorsam; der kleinere Conrad schaute stumm auf den zehnjährigen Bruder. „Gewiß!“ wiederholte er etwas zu spät, während der Forstmeister schon zur Tür ging. „Jakob!“ rief er hinaus, „komm, wir müssen aufbrechen, so ich als Gast mit dir auf ein Aalener Fest soll, mag ich mich nicht verspäten – oder hast du über dem Notenblatt die Hochzeitsladung vergessen?“
Jakob Schubart, der Vater der Buben, erschien im Türrahmen, ein großer kräftiger Mann mit roter Gesichtsfarbe. Er war Diakon, Präzeptor und Organist der Aalener Gemeinde. „Hab das Präludium notiert, so ich nächstens spielen will!“ entschuldigte er sich, „der Herr Schwiegervater mag sich doch einen Augenblick gedulden, ich muß nur noch den Festrock anziehen!“ Damit verschwand er.
Die Kinder standen ehrfürchtig dabei, als der Forstmeister ungeduldig hin und her ging. Er trug seine grüne Uniform mit den silbrigen Knöpfen, hatte den Zopf frisch gewachst und die Schläfenlocken gepudert, so daß ein Flor von weißem Mehl auf seinen Rockkragen stäubte, als er jäh den Kopf hob. „Euer Vater hat’s immer mit der Musika!“ murrte er ärgerlich, „die ihm doch wenig genug einbringt!“
„Der Herr Vater singt sehr schön!“ sagte Christian vorlaut. Hörner fuhr auf und stieß an einen Stuhl; es gab ein schepperndes Geräusch. „Da hätt ich schier meine Pistolen auf den Tanz genommen!“ rief er erschreckt und griff in die hinteren Taschen. „Die wären mir etwa unversehens losgegangen, so ich getanzt hätt!“ Er nahm die beiden Waffen, unförmig große schwere Instrumente, aus den Schoßtaschen und legte sie aufs Klavier, ohne die neugierigen Augen der Buben zu beachten.
Jetzt kam der Sohn wieder herein, flüchtig hergerichtet und vor Eile schnaufend. Jakob warf einen raschen Blick auf seine Kinder, rief ihnen einen Gruß zu an die Mutter, auf die er nicht mehr warten könne, und war noch vor dem Alten draußen.
Christian nahm die Hände auseinander, die er wohlerzogen gefaltet hatte, streckte sich auf die Zehenspitzen und winkte dem Brüderchen. „Da! Schau aufs Klavizimbel! Sie liegen noch droben!“
„Was?“ machte Conrad ungläubig, „und der Herr Vater hat nichts gemerkt!“ Er staunte den Älteren an, der schon höher hinaufreichte als er. „Lupf mich, Christel, ich möcht’s sehen!“
„Du bist mir zu schwer, du Klotz, aber ich will’s selber einmal untersuchen!“ Er kletterte auf einen der massigen Stühle, den er sich ans Klavier gerückt hatte, und nahm ein Terzerola herunter. „Das Mordstrumm!“ flüsterte er anerkennend, „wiegt soviel wie … wie …“ – es fiel ihm kein rechter Vergleich ein – „wie ein Krautkopf!“ beschloß er endlich.
Conrad stand unter ihm. „Laß doch sehen!“
„So hält man’s vor sich!“ erklärte der Ältere und legte den Finger an den Abzug, wobei er die Waffe mit der Linken stützte.
„Kannst schießen?“ forschte der Kleine begierig.
Christian Schubart wog das wackelnde Stück in der Rechten, hob es und schielte über die Kimme. „Weiß nicht“, murmelte er zögernd, „ist ja auch nicht geladen.“
„Ein Forstmeister trägt doch keine leere Pistol herum“, renommierte Conrad. „Paß auf, wenn’s knallt, wie laut das tut.“
Christians Augen blitzten. Er wurde rot. „Soll ich?“ fragte er beinahe beschwörend, und der Kleine schrie: „Schieß!“
Christian sprang vom Stuhl. Er stand einen Augenblick wie entrückt und richtete langsam den Lauf auf den Bruder. Unbewußt krümmte er den Finger: Donnerkrachen – Rauch – polternd fiel die Pistole zu Boden. Conrad taumelte und stürzte. Christian – zu Tode erschrocken – über ihn.
Der Kleine wälzte sich zur Seite, sein blasses Gesicht zuckte. „Bin ich verschrocken!“ stammelte er und kroch auf den Bruder zu. Aber der stieß ihn weg und bäumte sich; sein Mund war verzerrt.
„Christian!“ jammerte der Kleine, „hat’s dich erwischt?“
„Ich bin ein Mörder!“ kreischte Christian außer sich, „ich, ich!“ Er merkte nicht, daß der Bruder unversehrt auf ihn einredete, sah nicht, daß nur sein abstehendes Fräcklein seitlich gestreift worden war, und daß die zwei Kugeln in der Bettlade des Nebenraumes steckten.
Conrad fing an, laut zu weinen; er schluchzte seinen Schrecken heraus, die Händchen gegen die Augen gedrückt. Als er aufsah, war Christian verschwunden.
Helene Schubartin rannte auf den Knall hin die Treppe herauf, stolpernd und keuchend, und kam todbleich herein; der Sechsjährige saß verstört am Boden.
„Wo ist der Christian?“ fragte sie und entdeckte zugleich die Pistole neben ihm. Mit einem schrillen Schrei raffte sie das Kind auf und lief mit ihm ins Schlafzimmer, warf es aufs Bett und riß ihm die Kleider vom Leib. Da ihm nichts fehlte, nahm sie es auf den Schoß und zog es hastig an, dabei immer wieder ihr „Wo ist der Christian?“ wiederholend, bis der Bub ruhiger wurde. Leise weinend gab er Antwort: „Weiß gar nicht, wo …“
„Und wer hat geschossen?“ fragte sie weiter.
„Er! Und ich hab’s ihn geheißen!“ kam’s kleinlaut.
„Du? Bist doch der Jüngere! Das tät der Christian nie!“
„Doch, Frau Mutter – er hat’s aber nicht wollen, daß es so …“ So knallt, hatte das Kind sagen wollen, verschluckte es aber. Da fiel Helenens Blick auf die zwei runden schwarzgeränderten Löcher im Holz der Bettlade. Sie sprang auf. „Das hätt dich getroffen! Oder ihn!“ Sie warf die Arme um den Kleinen. „Und der Vater ist fort und der Ähne, beide lassen euch allein, dieweil ich Bier gezapft hab!“ Helene sah sich ratlos um, Conrads Köpfchen sank schläfrig auf die Arme, müde von der ausgestandenen Erregung machte er kaum den Mund auf, als ihm Helene das Mus einlöffelte. Er schleppte sich in die Kammer, die Mutter drückte ihn in die Kissen. „Schlaf jetzt, Lieber.“
Er schluchzte noch ein paarmal, schnaufte schlaftrunken und blieb still. Jetzt erst kam ihr die ruhige Überlegung zurück. Leise schlich sie in die Stube, hob vorsichtig die Pistole auf und legte sie zu der anderen aufs Klavier.
Der Christian! dachte sie entsetzt. Wo ist er hin? Fort jetzt, schnell ihn suchen – nur die Pistolen noch in die Küchenlade – daß sie keiner mehr findet! Einen Augenblick horchte sie nach dem Schnarchen des Kleinen, dann lief sie – in ein Wolltuch gewickelt – in den Schnee hinaus.
Viele Füße waren durch die Kirchengasse getappt, das Schmelzwasser rann von den Dächern, die Stadtkirche, breit und gelblich, wuchtete aus der halben Dämmerung vor ihr auf. „Christian!“
Ein paar Männer sahen ihr lässig nach. „Die Diakonin sucht wieder ihre Buben!“ meinte einer von ihnen, „den Christian, den Jakob, den Conrad … was weiß ich – irgendwas ist’s immer, ’s sind Schlingel!“
Da war sie schon um die Ecke, hastete gegen die Roßschwemme zu und blieb starr stehen. Hier – wenn er in seiner Exaltation hineingefallen wär? Aber da war nichts – kein Kind, kein Strudel, nur still ziehendes zähes schleimiges Eiswasser –, und die Schwemme war nicht tief. Sie lief gegen Sankt Johann hinaus.
Das jung getraute Paar, ein Förster vom Härdtsfeld und eine Handwerkerstochter aus Aalen, saßen mit ihren Gästen im „Adler“. Brummbaß und Fiedeln klangen, die Bläser hatten rote Backen, man aß scharf und trank schwer. Der Diakon Schubart, neben dem Dekan, dem Schwiegervater Hörner gegenüber, redete viel. Sein volles Gesicht glänzte. Musik, Musik … das war sein Lieblingsthema.
Der Dekan schaute ihn mißbilligend an.
„Herr Spezialb“, meinte der wortlos Getadelte und hob sein Glas, „zum Wohle!“ Der hohe Herr nickte, die dicken Puderlocken wogten, als er ein wenig indigniert den Kopf schüttelte.
„Auch König David sang, Herr Spezial!“ wagte Schubart anzufügen, während ein paar Stadtväter in langen Schoßröcken, die Perücken schon gelockert, über dem Wein schwatzten und schwitzten. Hörner erzählte Jagdgeschichten, und der einheimische Forstmeister, dem Bräutigam zulieb geladen, trumpfte kräftig dagegen. Kapitale Böcke und riesige Auerhähne stolzierten durch die Reden, als wimmele es in den Aalener und Sulzbacher Gemarkungen nur so von prächtigem Getier. Einer der Honoratioren bemerkte halblaut, der junge Herzog habe doch wohl, unter Anleitung seines allmächtigen Ministers, des Grafen Montmartin, recht ausdrücklich die Hand aufs Waidrecht gelegt? Man lasse den beamteten Förstern wenig übrig, das wisse man doch. Eine heisere Stimme krähte: „Die Wildmast ist der Bauern Pflicht, ’s kommt sie sauer genug an, bloß für die hochherrschaftliche Jagd zu schaffen … Kornfelder bauen für – fürstliche Sauen!“
Einen Augenblick war alles still. Dann rückten die Stühle, der Wirt tauchte aus dem Qualm auf und griff den Schreier beim Arm. „Hinaus, komm, Baste, dir ist nimmer ganz gut im Kopf!“ Er zerrte den Mann hoch und führte ihn zur Tür; widerstrebend taumelte der durch den vollen Saal, stockte und riß sich wildfuchtelnd los: „Ich hab ja gar nicht die vierfüßigen gemeint“, grölte er mit seiner gurgelnden Trinkerstimme, „die andern… die singenden, beinschwingenden, schauspielernden … und die mit den großen Orden, und die aus dem Norden …“
„Um Gottes willen!“ rief ein Stadtvater entsetzt, „Wirt, schnell, das kostet uns die Freiheit, so er weiterlästert!“
Man schob den Betrunkenen in den Schnee hinaus. Die Tür schlug zu. Die Pfarrer und Förster wischten sich die Stirnen, die Beamten schoben die Stühle zurück.
Dem Wirt wurde bang um seine Einnahme. „Wer will’s dem Durchlauchtigsten verargen?“ fragte er verbindlich, „haben wir doch die Last der Süßischen Verwaltung los, die der gehorsame Jud auf Geheiß des hohen Herrn Vaters uns aufgelegt. Herzog Karl Alexander hat viel Geld gebraucht. Wegzölle, Güter …“
„Ja, ja, für die Grävenitz und ihren Anhang …“, murrten ein paar durcheinander, „für die wir, ehrlicherweis’ von der Kanzel gebetet.“ Alle lachten. Man wußte, daß der Hofprediger auf des Herzogs Vorhalt, er erwähne die hochfürstliche Mätresse nie im Kirchengebet, zornig gerufen hatte: „Allsonntäglich doch, Euer Durchlaucht, im Vaterunser: ‚Und erlöse uns von dem Übel!‘“
„Hat’s schwer gebüßt!“ bemerkte Schubart leiser.
„Solches mag uns jetzo erspart bleiben“, schloß der Spezial den Disput, „da wir seit einem Jahr eine liebliche junge Frau Herzogin haben, aus dem vornehmsten Geschlecht, eine Nichte des preußischen Königs Friedrich!“
„Es scheint auch, Carl Eugen liebt sie heiß“, erzählte der Förster, „sie soll schon gesegneten Leibes gehen, die Fürstin.“
Man nickte, lächelte, griff noch einmal zu den Gläsern, die der Wirt eifrig füllte. Aber die Pfarrherren hatten es jetzt eilig mit dem Aufbruch. Dem jungen Volk war’s recht, denn nach dem Abgang der Geistlichen konnte der Tanz beginnen. Hörner blieb sitzen und zog auch Schubart wieder auf den Stuhl zurück. Im Qualm der Tabakspfeifen, im Dunst der vollen Schüsseln und erhitzten Menschen drehte sich die stampfende Masse der Tanzenden zum Ländler, schritt die feierliche Gavotte.
Stiller saßen die Schubartischen jetzt am Tisch; sie hörten nicht, daß die Tür aufging; mühsam schob sich eine dunkle Frauengestalt durchs Gedränge: Helene stand vor ihnen. Auch im rauchigen Kerzenschein erkannte Schubart, wie blaß sie war. Sie bog sich über die Tafel, die Hände aufgestützt. „Jakob“, stammelte sie, „der Christian … er ist nimmer da!“
Der Diakon sprang auf. „Was sagst? Ist er – tot?“
Helene fiel auf die Bank, den Männern gegenüber. „Hörnervater“, brachte sie endlich heraus, „Eure Pistolen!“
Hörner griff erschreckt in die Rocktaschen. „Barmherziger Himmel!“ Er faßte nicht mehr, was die Frau berichtete, hastete zur Tür, der Diakon und die Frau hinter ihm her. Auf dem kurzen Weg durch die Nacht, im Stapfen durch den dicken Schnee, konnte Helene endlich erzählen, was geschehen war. „Und ich hab ihn nirgends gefunden!“ sagte sie trostlos.
Wütend griff der Mann nach ihrer Schulter. „Der Malefizer! Der Christian! Ein ganz Boshafter ist er! Was in dem steckt… Und wenn er noch so geschickt musiziert.“
Hörner blieb besonnener: „So sind Kinder, tun’s den Großen nach – es ist meine Schuld allein.“
Im Pfarrhaus fanden sie Conrad friedlich schlafend. Helene hob ihn aus dem Bett und weckte ihn ungeduldig auf. Die Hände vor den Augen stand er barfüßig in der Stube und stotterte wieder sein: „Weiß doch nicht, wo er ist!“
Helene tat er leid, sie drückte ihn an sich. Während sie ihm die schlaffeuchten Haare aus der Stirn strich, sah sie vor sich hin, als könnte sie den furchtbaren Augenblick wiederholen: Christian, wie er mit wilden Augen auf den Bruder anlegte, halb im Spiel und doch getrieben, gezwungen – als säße ihm ein Dämon im Nakken. Der stärkste meiner Söhne, das reichste meiner Kinder, dachte sie. Wie er wild agiert, mit anmutigen Gesten noch im Affekt, wie er posiert, als stünd’ er vor dem Spiegel, schäumt und sich aufpufft wie ein Gewaltiger, sich selber ausgibt, bis er sich zerstört – und dann verzweifelt zusammenfällt, erschlafft, ohnmächtig wie ein Schaumgebild.
„Und wo tobt er jetzt wider sich selber?“ fragte sie in die Stube hinein, als wende sie sich nicht an die ratlosen Männer. Und wo liegt er wie ein gestürzter Vogel? setzte sie in Gedanken hinzu. „Jakob, Hörnervater, rufet die Nachbarn, und ich geh selber und such!“
Conrad hielt sie am Rock. „Bleib bei mir, Frau Mutter!“ Es stieg bitter in ihm auf, daß man sich mehr sorgte um den Schuldigen als um ihn, der doch beinah – er weinte – beinah zu Tod geschossen worden wäre. Aber – wo es um den Christian ging, galt er nichts mehr.
Eltern und Großvater blieben lange fort – es wurde völlig Nacht in der Stube, und der Kleine kroch schließlich allein in sein Bett, das er mit dem älteren Bruder Jakob teilte; der schlief schon lang. Als die Eltern sich vor dem Haus von den Nachbarn verabschiedeten, hatten sie nichts gefunden.
Weinend durchwachte die Mutter die kalte Nacht, immer wieder lief sie vors Haus, rief und suchte im Umkreis, ohne sich weiter weg zu wagen. Es fiel neuer Schnee, Zapfen hingen am Dachrand, im Licht ihrer Laterne wie grimmige Bärte glitzernd. Stumm verschreckt saß die Familie am Morgen bei der Suppe. Jakob Schubart sprach ein Bittgebet, der Großvater machte sich noch einmal auf den Weg …
Da klopfte es; der Aalener Zoller stand draußen und rief gleich nach dem ersten Gruß: „Habt Ihr nicht gesehen, wie er gegen den Kocher zugelaufen ist? Ich hab ihn gestern gerad noch am Roekzipfel erwischt, er wollt hinein … hat gezappelt und sich gewehrt! Ich bin ein Mörder!’ hat er geschrien, als wäre er von Sinnen. Erschreckt Euch nicht, Frau Schubartin, er hat’s nicht getan – ich hab ihn ja fest am Arm genommen.“
„Und wo ist er hin?“ fragte der Diakon endlich.
„Weiter! Als er mir gesagt, wer er ist, wollt’ ich ihn heimführen. Aber er ist mir entlaufen, ich meinte, er werd’ selber heimkommen – und ist er denn nicht hier?“
„Ach, Zoller“, sagte der Diakon traurig, „diesmal haben Euch die Füß nicht schnell genug getragen, und seid doch so oft schon einem flüchtigen Grenzläufer nachgerennt, so Euch den Zoll hat nicht zahlen wollen“
„Meine Pistolen vergrab ich“, stöhnte der Hörner.
„Wenn wir bloß den Buben nicht müssen vergraben – in Sankt Johann draußen!“ antwortete der Vater dumpf. Der Zolleinnehmer verabschiedete sich kurz.
Die Schubartin weinte den ganzen Morgen, kaum daß sie das Nötigste im Hauswesen tat. Am Mittag, beim Zwölfuhrläuten, ließen alle das Essen stehen. Die Eltern und der Großvater gingen wieder in den Schnee hinaus, sorgsam prüfte der Förster Fußstapfen und Schleifspuren, aber es hatte getaut und jetzt wirbelte es wie ein vergängliches Schleiergeweb vom Himmel – nichts war mehr sicher erkennbar.
Die Brüder saßen allein in der kalten Kammer, Jakob und Conrad. Da pochte es leis an die Scheibe, einmal, zweimal, schwach wie ein Vogeltritt. Sie sahen sich an und wischten das Glas ab. Durch das Loch im Beschlagenen erkannten sie eine Hand, einen blauen Ärmel, dahinter ein rotes Gesicht.
„Christian!“ schrien sie beide zugleich. Da war die Gestalt verschwunden, eingetaucht in das verhangene Grau wie ein Spuk. Sie rannten hinaus; im Schnee lag der Christian, leblos, als hätte ihn ein Blitz gefällt. Conrad rief ihn an, Jakob versuchte ihn aufzurichten, sie schleppten ihn zu zweien ins Haus, in die warme Stube. Jakob holte den Milchtopf. Langsam, als falle ihm jedes Lidheben schwer, kam Christian zu sich. Er starrte den kleinen Conrad an wie ein Gespenst. „Bist lebig? Wirklich?“
„Ja, wo bist denn gewesen?“ fragte Conrad in einem zärtlich besorgten Ton. „Alle haben dich gesucht, die Eltern und der Ähne und die Nachbarsleut und wir auch – und nirgends warst!“ Christian trank gierig seine Milch; er stützte den Kopf in die Hände und saß da wie ein alter Mann. Seine Blicke gingen im Zimmer hin und her, angstvoll suchten sie nach einem Schaden, einem Zeichen seines Verbrechens – ein Junge von zehn Jahren, beladen mit der Qual unerhörter Selbstanklagen, niedergeschlagen von einer heillosen Verstörung, die ihn nie mehr ganz loslassen sollte.
Inzwischen lief Conrad hinaus, um die Eltern zu suchen. Schon am Zollhaus kamen sie ihm entgegen, ungläubig hörten sie ihn schreien, der Christian sei da, in der Stube, am Ofen sitze er. Sie liefen gehetzt heim. Die Mutter nahm den verlorenen Sohn nah an sich, strich über sein verklebtes Haar, in dem Heufäden hingen, über die zerknitterten Kleider und die haltlos baumelnden Beine, die er kaum ruhig halten konnte; und endlich kam seine Erklärung, unter Stottern und Stokken gestand er: Im Heu habe er gelegen, drüben im Stadel, ganz tief unter dem Haufen, nur den Kopf habe er noch herausgestreckt, daß er nicht ersticke. Und er hätte viel geweint und großen Hunger gehabt, aber kalt sei’s ihm erst geworden, als er vor dem Fenster gewartet, bis er endlich zu klopfen gewagt habe, und jetzt, wo der Conrad lebe, jetzt – er konnte nicht weiterreden, und der Vater nahm ihm das ab, als er die Hände zu einem Dankgebet faltete und alle es ihm nachtaten; denn unter den kunstlosen Worten, die dem Diakon der Augenblick eingab, wurde Christian ruhiger. Er sah dabei den Vater ängstlich an, denn er wußte wohl, daß es mit dem allem nicht getan sei; es mußte etwas nachkommen, unabwendbar.
Als dann gegessen war – Christian würgte trotz seines Hungers mühsam an seinen Bissen – stand der Vater auf und winkte ihm; Helene warf ihrem Mann einen flehenden Blick zu und die Kinder zuckten auf. Aber der Diakon schritt unerbittlich wie ein zürnender Halbgott durchs Zimmer und der Junge trottete hinterdrein. Draußen in der Kammer wurde das Strafgericht vollführt: Man hörte die Stockschläge und das leise und immer lautere Weinen des Buben, bis der Diakon endlich, sich die Stirn wischend, allein wieder hereinkam.
Den Christian fand die Mutter in der Küche, im Herdwinkel hockend, das Gesicht in die Arme gedrückt und innerlich noch mehr zerschlagen als am Körper. Sie wagte ihn nicht zu trösten. „Geh ins Bett, Christel“, sagte sie, und das „Christel“ war schon ein bißchen Trost in seinem unabsehbaren Jammer.
Durch Wochen blieb Christian still.
„Verstockt“ sagte der Vater, dessen Urteil immer schnell feststand. „Verstört“ nannte es Helene und versuchte vorsichtig, mehr aus dem verstummten Kind herauszuhören. Die Brüder erzählten ihr, was sie von ihm wußten; damit mußte sie zufrieden sein.
In der Schule fand Christian etwas wie eine geistige Zuflucht. In den ersten Jahren hatte man ihn für dumm gehalten, steif und unbeteiligt hockte er in seiner Bank, um ihn herum die Horde der allzuvielen ungehobelten und nur durch drakonische Strenge zusammengehaltenen Buben: Geschrei und Gestank, Prügeleien untereinander und wüste Unordnung stießen ihn ab; der Präzeptor schlug viel, tobte, pochte dröhnend auf den Tisch. Lesen wurde nach seltsamen Methoden geübt, die Schreibkunst lag im argen – alles war trocken und zwanghaft. Da stellt sich ein feuriges, phantasievolles Kind taub und blind. Christian blieb unansprechbar, bis der Lehrer auf einem Schulausflug mit einem hingeworfenen Wort über die Forellen seine Einbildungskraft weckte. Der Bub spann den Faden weiter, das Leben, das Wesen, das kleine Schicksal der Forelle packte ihn und bewegte seine Gedanken. Er schrieb einen Aufsatz darüber, fragte weiter und erfand dazu.
Von dieser Zeit an gewann der Lehrer Einfluß auf den Knaben, verstand, daß er nicht durch dürre Regeln zu fesseln sei, sondern durch das Bild, das wie ein Blitz in ihn eindrang und zündete.
Das Bild! Bilder zu sehen und zu formen, sich selber zu betrachten und die Spiegelung seines Ich in anderen zu beobachten, das war der Schlüssel zu dem seltsamen Knaben, und der Lehrer gebrauchte ihn hin und wieder, so oft ihm der Lärm und die Trägheit der vielen anderen Zeit dazu ließen.
Er träumte: Dunkler Waldbach, überhängende Zweige streifen die schwellende Fläche, Schatten flekken das Wasser, gelbfunkelnde Lichter zerdehnt die Bewegung der Welle. Da taucht es auf, eine dunkle Spur, ein Wirbel, schnalzende zuckende Bewegung: Die Forelle. Er träumte davon, nachts griff er mit den Händen ins Kissen, um sie zu fassen. Oder – ein anderes wilderes Bild: Die Flamme. Am Herd stand Helene und schürte dürre Scheite, die sofort Feuer fingen, Reisig, knackendes Kleinholz. Da loderte es auf, rotgelb, grell, ohne Halt und Kontur, unaufhaltsamer Wechsel, Flackern, Zittern, leckendes Umsichgreifen… und Verzehren. Alles wird da verwandelt: Keine Form hält ihm stand, jede vergeht, krümmt sich, verfärbt und veraltet und fällt zusammen. Aber Licht strömt aus der Flamme, das einzige, was lohnt, was lebt: Helle! Auch vom Feuer träumte er, bis er schreiend aufwachte… „Mein sonderliches Kind“, sagte Helene zum Vater. Der Diakon schaute den Kleinen nachdenklich an; er belauschte ihn ungesehen, wie er Klavier spielte, dazu murmelnd sang und, mit den kleinen Händen kaum die Oktave spannend, Akkorde versuchte. Er ließ ihm jetzt mehr Raum, hörte ihn an und gab ihm kleine Aufträge. Christian wurde das Leben ein wenig leichter. In den folgenden Wochen fing er an, mit stürmischem Eifer zu lernen: Sprachen, Rechnen, Musik. Musik vor allem fesselte ihn. Er saß stundenlang am Klavier, probierte Tonfolgen, Fingerstellungen, Akkorde. Der Vater hörte staunend zu und half da und dort, nicht sehr geschickt, eher einschüchternd. Aber jetzt ging der Knabe auf alles ein, übte heimlich weiter, suchte es dem Vater recht zu machen. In der Musik verstanden sie sich.
Einmal brachte der Kleine ein Notenblatt aus seinem Schulsack hervor; plump gekritzelt und oft durchgestrichen, aber lesbar stand da eine kleine Melodie, und der Satz und die Notenzeichen stimmten. Der Vater stellte ihm Themen, die er dann phrasierte. Bald genügte ihm das Klavizimbel nicht mehr, in dem die Klänge fertig schliefen, wie er sagte. Er wollte sie selber bilden: Der Vater kaufte ihm eine Kindergeige. Kaum hatte Christian die Gründe der Technik begriffen, kaum verstanden die dicken kleinen Finger Druck und Gleiten und die Rechte das Bogenführen, da nahm ihn die Fiedel gefangen: Auf und ab und im Triller versuchte er sich, crescendo und decrescendo und vibrato, und geigte grell wie eine Grille und gelegentlich falsch. Aber er spürte die Verwandtschaft zwischen sich selber und dem sensiblen Instrument, das auf jeden Wink ansprach, eindrucksam und abhängig von der führenden, berührenden Hand.
Dann wechselten die Lehrer in der Schule. Der Präzeptor Rieder war ein kleiner Mann mit einem großen Kopfe, gescheit, gewandt, gebildet, aber irgend etwas stimmte den Knaben mißtrauisch, wenn er einschmeichelnd vorlas und lächelnd dozierte. Er wußte viel und Schubart lernte durch ihn die lateinischen Dichter und Historiker kennen, weit mehr an Stoff, als es seinem Alter und der einfachen Schule zukam. Wieder fragte er und nahm auf, saugte förmlich an, was sich ihm bot; selbst zu gestalten war er noch zu weich. Diese Weichheit war eine Blöße, die der neue Präzeptor spürte und benützte.
Der Zwölfjährige war gedrungen gewachsen, mit breiter Brust und schmalen Hüften; die runden Hände wirkten fast weiblich, unter blühenden Wangen leuchteten sehr rote kirschweiche Lippen aus dem gedrängten Untergesicht, die Nase war fleischig und vorstrebend, die Augen, dicht neben sie gesetzt, glänzten vogelhaft – neugierig; schwarzbraun funkelten sie jedem entgegen, der ein wenig Sympathie versprach.
Aber über diesem empfindsamen und sinnlichen Unterbau wölbte sich die Stirn groß und frei, sehr hoch, unproportioniert mächtig, als laste ein edles Gefäß auf schwachem Sockel und erdrücke ihn schier.
Rieder zog den begabten Schüler an sich heran, horchte ihn aus und lockte ihn zu frühreifen Fragen, gab zweideutige Auskünfte und Winke, bekrittelte den Vater. Aber den Jungen schützte sein feines Gespür. Später berichtete er pathetisch, Ausschweifungen der Wollust hätten den Rieder an den Bettelstab gebracht.
Solange sich der Lehrer ihm immer wieder aufdrängte, der Vater ihn nur am Klavier gelten ließ, streifte der Junge viel durch Wälder und Wiesen. Um Aalen zogen sich leichtgeschwungene Bergrücken, mit Buchen bewaldet, selten ein Tannenforst dazwischen. Kleine Bäche sprangen dem Kocher zu, in tief eingeschnittenen Schluchten wucherten im Spätsommer die gelben Balsaminenc in der feuchten Düsternis des Talgrundes unter geheimnisvollen Felstrümmern, die die ungefesselte Phantasie des Knaben aufregten. Sagen von verschollenen Raubrittern, vom Quellfräulein, das seine weißen Fingerspitzen als Rinnsale zierlich aus der Erde schickte, vom wilden Jäger, der in Gewitternächten auf schattenhaften Rossen mit seinem Gefolge über den Wald raste – hörte er unter den Landleuten genug.
Sein Vater mochte sie nicht gern; sie seien aus heidnischem Bodensatz gequollen, meinte er. Aber Christian kletterte nie auf die Buchenhänge am Kocherursprung, ohne mit einem leisen Schauder den Felsbrokken zu beäugen, unter dessen Überhang im heißen Sommer die Mücken schwärmten, als ob sie den erschlagenen Heckenreiter und sein Roß spürten.
Von Raubrittern war viel die Rede in der Gegend; die Leute erleichterten sich, wenn sie von den verschollenen Peinigern redeten, da sie von den gegenwärtigen nicht reden durften. Christian hörte den Vater stöhnen und die Verwandten, die Lehrer und Forstleute klagen, daß man bitter unter „der Furcht des Herrn“ leide, und erst allmählich begriff er, daß damit nicht Gott gemeint war, sondern seine Gesalbten auf Erden, die Fürsten, denen „alle Gewalt gegeben war“. Er hörte draußen auf seinen Wanderwegen mehr davon als im obrigkeitstreuen Dekanat, denn inzwischen war der Vater Dekan geworden.
Er merkte, wie ein gutherziger Bauer, der ihn auf einer Wanderung zu seiner Milchsuppe einlud, furchtsam den gewilderten Hasen versteckte, ehe er sich zu Tisch setzte, und wie die Frau dreimal das Brot abstrich, auf dem sie das Schmalz ohnehin knapp bemessen hatte. Er hörte, wie man die jungen Burschen vom Feld holte, wie die Weiber weinten und die Alten murrten, und erfuhr, aufgeweckt wie er war, daß man die Männer gewaltsam zum Soldatendienst preßte, den die preußischen Werber brutal erzwangen. Und einmal sah er, an der Straße gegen Ellwangen, die fürstliche Kavalkade vorüberrauschen, Vorreiter, Läufer, goldblitzendes Pferdegeschirr im Winterabend, wogende Federn am Bock, Windlichter, Schabracken und goldenes Zaumzeug, blitzendes Blendwerk… Man stand am Wegrand und verbeugte sich, bis der Spuk vorüber war. Nachher hörte er die Jagdhörner, weitsehallend, tönend wie auf Flügeln durch den Wiesengrund anschwellen und aushallen – er bestimmte die Töne, den Dreiklang, die Quint – es waren Musikanten unter den Hofjägern. Man redete auch von superben Konzerten in Ludwigsburg, die der junge Herr veranstaltete für seine Brandenburg-Bayreuther Gemahlin oder für andere Damen, die ihn wie ein Flor umgaben. Man redete viel, was Christian nicht alles verstand. Und einmal sagte der Jäger, den er am Kocherursprung traf: „Wenn’s nur alle so zerschlüg wie den bösen Ritter unterm Stein, die hochmögenden Junker und Blutsauger!“
Manchmal pilgerte Christian auch zum Friedhof von St. Johann außerhalb der alten Stadtmauern gegen den Rohrwang gelegen. Wenn er dort herumstrich, zwischen den Gräbern mit ihren pathetischen Epitaphen, mit Bildwerken, die das Gerippe mit der Sense greifbar machten und das mahnende Stundenglas, dann fühlte er sich verloren und flüchtete in die Ekstase, übersteigerte Angst und Verzweiflung mit der Kraft seiner Phantasie, mit dem angeborenen Hang zum Extrem.
Da saß er im zeitigen Frühjahr, ein Vierzehnjähriger, unter den kühlen Flügeln des Windes, und versank lustvoll in seine Schwermut. Das gehörte ihm allein, diese düsteren Bilder, dieser Schauder, diese abgründige Furcht. Wenn er sich so mit Seufzen und gerungenen Händen in die Darstellung seines Kummers verlor, sah er vor sich die Heiligen aus den benachbarten katholischen Gotteshäusern mit ihren schmerzvoll verdrehten Gesichtern, den schwimmenden Augen, die immer groß und schön waren, und den gewundenen wolkigen Gewändern. Das Leben war nur als ein pompöses Theater erträglich – dahinter – ja, das wollte man nicht mehr wissen.
Die Kirchen zogen ihn magisch an, nicht die Orgel allein, die er oft genug in der Aalener Stadtkirche hörte, auch die Bemalung der Wände und Decken; und manchmal wanderte er nach Ellwangen oder in das nahe Unterkochen, wo die gebietende Wallfahrtskirche über dem Dorf thronte, hinter sich den bunten Friedhof mit seinem Ausblick weit über Land.
Da stand er und staunte Anwanders prunkvolle Marienhuldigung an, die Heimsuchung und den Tod der Jungfrau, und sah die vielerlei gemalten Gestalten vom dunklen Rand zur Kuppel immer heller werden bis zu fast aufgelösten Lichtfarben, vom schweren Irdischen sich verklärend und ein erhöhtes Leben verkündend. Er schwelgte, wie er’s selber nannte, und „ergoß“ seine inneren Erlebnisse in tönende Läufe auf dem häuslichen Klavier, oder er sang. Und heimlich, wie das seinem Alter entsprach, schrieb er Verse: Todesgesänge, schüchterne Liebessehnsüchte, religiöse Gedichte.
Einer der preußischen Werber, mit dem er ins Gespräch gekommen war, brachte ihm Klopstocks Oden. In seltsamem Gegensatz zu seinem wenig menschenfreundlichen Amt betrieb dieser Hauptmann von Maltitz den Umgang mit der geistlichen Lyrik des literarischen Ideals der Zeit. Christian saugte zugleich mit diesen Hymnen die Begeisterung für den großen Friedrich auf, die dem Hauptmann Antrieb und Rechtfertigung für seine Tätigkeit war. Einmal nahm Maltitz den Buben mit auf eine Werbefahrt; der Vater glaubte, er sitze in der Schule, die der Lehrer beliebig hindehnte, wenn es ihm gefiel.
Mit Trommelwirbel und aufreizender Marschmusik aus einer Feldtrompete erschien der Hauptmann mit einem Korporal und ein paar Musikern in einem Dorf auf der Aalener Gemarkung. Daß die Werber kamen, hatte sich schon herumgesprochen; Neugierige traten zögernd heran, fragten und schauten. Nur die kräftigen jungen Burschen hielt man versteckt. Langsam, während das Gerassel und Gedröhn im Sommerabend über die staubige Dorfstraße fuhr, schlurften ein paar Männer heran, meist Zweitsöhne, die auf dem kleinen Bauernhof kein Auskommen hatten, auch Querulanten und Herumtreiber, die in keinem Gewerbe guttaten. Weiber waren dazwischen, ängstlich lauernd, ob sich einer der ihren von dem flotten Werber anziehen lasse. Kinder drängten mit glänzenden Augen vor, um die bunten Uniformen und bärtigen Soldatengesichter näher zu sehen.
Der Hauptmann verlas seinen Spruch, Schubart schaute ihm ehrfürchtig auf die Lippen. Aber keiner rührte sich, niemand wollte sich melden. Neben der Lockung stand ihnen das Bild der heimkehrenden Geschlagenen vor Augen, die Ehrgeiz und schlechte Planung oder einfach überlegene Feinde ins Unglück getrieben hatten, Verwundete mit schwärenden Narben, Rechtlose, die auf Barmherzigkeit angewiesen waren und sich krampfhaft ins Schwadronieren und Phantasieren retteten, um noch einen Rest von Achtung zu gewinnen; denn sie waren ja keine Bauern mehr, keine Handwerker, keine rechten Väter und Söhne, nur Abgeschobene und Entgleiste, Abfall der Schlachten.
Der Hauptmann wurde ungeduldig: Es sei ihm leid, sagte er, aber zwanzig Mann seien seine Zahl, die müsse er vor Nacht noch aus Mögglingen heimbringen, darunter tue er es nicht. Die Trommel ratterte wieder, Maltitz lud ins Wirtshaus, ein paar folgten widerwillig, etliche verlotterte Kerle zog der geschenkte Wein magisch an.
Der junge Schubart schlich hinter dem großen Freund drein und setzte sich auf eine Bank im Dämmerigen. Vorn, im Lichtkreis der Kerzen, die der Wirt eilig brachte, lagen jetzt die Papiere ausgebreitet. Man hörte wieder vom Kriegsruhm, von Beute und Schätzen und leckeren Weibern reden, die Burschen nahmen die Becher; viel hatten sie nicht im Magen und Wein kannten sie kaum. Langsam wurden sie munterer. Der Hauptmann trank ihnen zu. Freilich sah Christian, daß ihm der Wirt sein Glas halb gewässert hatte, ohne daß es sonst einer merkte.
Er selber trank vorsichtig, das Ungewohnte schmeckte voll und stark, er kaute ein Brot dazwischen und heftete dringlich die dunklen Augen auf die Männer. Endlich ließ sich einer herbei, die „Verpflichtung“ zu unterschreiben, malte ungeschickt seinen Namen darunter; ihm taten es zwei andere nach, ein abgerissener Knecht setzte sein Kreuz dazu.
Jetzt änderte sich alles. Die Geworbenen wurden von dem Korporal und den Bütteln, die plötzlich auftauchten, derb in die Höhe gezerrt und weggeführt. Der Junge sah ihnen erstaunt nach. Ein paar Bauernburschen zogen sich unauffällig zurück und schlichen hinaus.
Maltitz sprang auf. Da prallte ihm die Tür fast ins Gesicht: Eine Frau stürzte herein, halb angezogen, die Zöpfe langhängend. Sie schrie, man habe ihren Jörgle geholt, wer sollte jetzt das Ackerwerk versehen, wo ihr Mann lahm liege? Sie stellte sich vor dem Tisch der Werber auf, ein dürres Weib, unbestimmbar das Alter, mit flackernden Augen.
Maltitz, ihr gegenüber, wurde grob: Der Bursche habe unterschrieben, es sei alles bestellt und beschlossen und nichts mehr zu ändern. Sie fuhr mit scharfem Blick über die Platte, auf der die Weinpfützen glänzten, und griff den Bogen, der da lag. „Ist’s der? Steht’s da?“ fragte sie gellend. Schubart erkannte eine Zeile mit Namen auf dem hellen Papier in ihren Fingern; er konnte nichts lesen, aber ehe jemand reagierte, hatte das Weib ihren Fund mitten durchgerissen und warf dem Hauptmann die Stücke zu. „Ihr könnt einen nicht besoffen machen und zur Kompanie pressen!“ rief sie, „sie kommen verkrüppelt heim, sind nichts mehr nutz, wenn sie überhaupt wiederkommen!“
Der Hauptmann faßte ihren mageren Arm. „Seid still, Frau, das geht übel aus für Euch!“ sagte er herrisch.
Christian starrte ihn an – er sah fremd und unheimlich aus mit dem Schnauzbart, wie er dastand und die Frau hielt. Sie machte sich los; ein Büttel packte sie von hinten, drückte ihr die Arme an den Leib und warf sie auf die Bank. Christian rückte schnell weg. Er sah das flammendrote und gleich darauf bleiche Gesicht neben sich und dachte an seine Mutter, wenn sie so dasäße.
Er blickte Maltitz an und legte ihm die Hand auf den Ärmel. Der Hauptmann schüttelte den Kopf: „Laßt sie laufen und schaut nicht weiter nach dem Kerl!“ Ins Glas hinein brummte er noch: „Soll der Teufel die Werberei holen!“
Christian schob sich leise hinaus in die Dunkelheit und fand den Heimweg.
Keim aus gärendem Erdreich
Der Vater Schubart hielt es jetzt für nötig, den Jungen in eine höhere Schule zu schicken, da ihm das Herumstreichen mit dem Hauptmann nicht gefiel, noch weniger aber der Einfluß Rieders, dessen lasches, genüßliches Wesen sich immer mehr in Launenhaftigkeit verkehrte, bis man ihm endlich wegen unzüchtiger Handlungen den Prozeß machte und ihn entließ.
Der Dekan wählte also das Nördlinger Lyzeum für seinen begabten Sohn, das der Rektor Thilo leitete, ein tüchtiger Philologe, der auch Theologie studiert hatte und sich mit der Ästhetik der Alten wie mit der Philosophie beschäftigte.
Jakob Schubart brachte den Jungen beim Chirurgen Seidel unter, der bieder und redselig, wie er war, den jungen Christian bald ein wenig in seine Profession einführte, bei allerlei Unpäßlichkeit beriet und ihm das Interessante seines untergeordneten Berufs anpries, den er mit Geschick und Schlauheit betrieb; denn es war durchaus nicht immer nur das Leibschneiden oder Brüche und Quetschungen, die er heilte, er riß Zähne und stach den Star und gab mit seinen skurrilen Geschichten dem Glauben und Aberglauben seiner Patienten zu kauen: Wie die Spinnweben im Stall gegen Warzen gut seien, erklärte er ihm, und was der Nachtschatten schade oder woher die Hexenringe aus Waldpilzen kämen und die glattgescheuerten rindenlosen Streifen an den Eichenstämmen. Er erzählte auch vielerlei von der „Kunst Aphroditens“, wie er sagte, und machte derbe Späße dabei.
Für Christian waren es zwei Welten, und beide behagten ihm – die klare, geordnete, gütig humorvolle Art des Rektors schulte ihm Geist und Verstand, und des Baders Geschwätz schläferte ihn ein wie laue, sumpfige, dumpfe Luft. Was ihm der Vater nahegelegt hatte und immer wieder anmahnte, den Ernst des Glaubens, konnte er nicht recht einsehen; der Religionsunterricht, den Thilo nicht selber gab, war dürr und trocken. Der Rektor führte seine Schüler – und Christian war sein bester – zu den Klassikern: Homer, Plato, Horaz und Cicero wurden vorgekaut und eingepaukt, aber auch über dem peinlichsten Eindrillen verloren sie nicht ganz ihren Schimmer. Schubart las für sich, abends in der Kammer, noch einmal und im Zusammenhang, was er in den Schulstunden hörte. Auch die neuen deutschen Dichter brachte Thilo zum Klingen.
Und dann die Musik, immer wieder brach diese Urbegabung durch: Schubart spielte jetzt fast virtuos, komponierte, sang, Rhythmus und Klang verlockten ihn zu eigenen Versen, die ihm allzuleicht flossen. Auf das Lissaboner Erdbeben dichtete er eine Nänied, stark gefühlt, in „schwellenden“ Tönen, fugierte Choralmelodien, und so nebenbei, fast unbewußt, entstanden Volkslieder, verspielte, derbe und sangbare Reime; ein Gang durchs Feld, eine Nacht im Wald – alles lag in ihm wie ein empfangener Keim bereit, und es brauchte nur ein Wort, eine Tonfolge, daß sich das Geformte fertig aus ihm löste und er es nur niederzuschreiben hatte – aber oft genug ließ er’s auch hinströmen, sagte es nur sich selber vor und verlor es wieder, da es ihm nicht kostbar genug war, um es zu halten. Es formte sich nicht immer ganz originell, manchmal in den Bahnen Klopstocks und Herders, oft als Hexameter. „So lebt ich also –“ sagte er später von jener Zeit – „zaumlos als ein luftiger, gedankenloser Jüngling mein Leben hin.“
1756 verließ er Nördlingen. Man erregte und empörte sich gerade heftig über den jungen Herzog: Carl Eugen hatte es arg getrieben, selbst nach dem Urteil der geduldigen Nördlinger, und was man von Stuttgart hörte, war zwar im Licht ähnlicher Affären nicht ungewöhnlich an europäischen Höfen, aber für die Schwaben auffällig genug: Der junge Fürst hatte sich nicht lang nach den Maximen Friedrichs von Preußen gehalten, die ihm dieser zur Thronbesteigung mitgegeben hatte, wohl wissend, daß er durch seine Beurteilung des Prinzen mitverantwortlich für seine Regierungsführung wurde. Er rate, schrieb der König, drei Jahre seiner Jugend „dem Vergnügen zu weihen“, dann aber zu heiraten und mit Ernst an seine hohe Stellung zu denken. Und obwohl Carl sich schon als halber Junge sterblich in seine künftige Frau verliebte, „weihte“ er sich weiterhin dem „Vergnügen“, wie er es als sein gutes Recht verstand.
Die sechzehnjährige Friederike von Brandenburg- Bayreuth, eine Nichte Friedrichs, galt als Schönheit mit den großen Brandenburger Augen und ihrer grazilen Gestalt. Geist und musische Neigung hatte sie von der Mutter, Friedrichs kluger Schwester Wilhelmine, mitgebracht. Aber es fehlte ihr der Humor, die Weite und Reife, um den neuen Forderungen gewachsen zu sein; sie war zu jung, um, wie Maria Theresia, keinerlei Ansprüche an die Treue ihres Gemahls zu stellen und ihn trotzdem zu lieben, zu hochmütig, um ihr bäuerlich gutherziges Volk zu verstehen, und bald auch zu verstört, um zu alledem auch nur den guten Willen aufzubringen.
Ihr erstes Kind, eine kleine Tochter, starb nach einem Jahr; Carl ritt, jagte, tanzte und feierte, ohne Rücksicht auf sie zu nehmen. Balletteusen und Sängerinnen, primitive, oft nur in ihrem Fach tüchtige Geschöpfe, waren seine wechselnden Gefährtinnen. Die fähigen Minister verabschiedete er schnell; um sich als selbständiger Herrscher zu bestätigen, ließ er unbewährte Berater Einfluß gewinnen, Kreaturen, die ihm geschickt schöntaten, zwielichtige Figuren, die ihn ausnutzten und immer mehr Ausgaben verlangten, denn es sei, so legte man ihm nahe, seine Aufgabe, den glanzvollsten Hof Europens zu präsentieren. Nur der Ruhm einzigartiger Berühmtheiten könnte diese Pracht verleihen. Unsummen brachte das Land auf, erpreßten die Werber und Finanziers, um die unübersehbare Fülle von Festen und Genüssen zu bezahlen.
Ein paarmal war Friederike, die sonst gern an Opern- und Theaterabenden teilnahm, verbittert zu ihren markgräflichen Eltern gefahren; aber sie kam immer wieder, gebeten oder gemahnt und mit Rücksicht auf den Klatsch der Höfe, kaum mehr Carl zuliebe. Dann floh sie endgültig und kam nie mehr zurück.
Christians Vater stammte aus Altdorf, der berühmten Hochschulstadt bei Nürnberg, in der auch Wallenstein studiert hatte und die später Erlangen hieß. Er bestimmte seinen Sohn für Nürnberg. Zwischen Nördlingen und Nürnberg, im Begriff, seinen Fuß in die größere Welt zu setzen, verschaffte ihm ein Freund die Gunst, in Stuttgart die Oper zu hören. Man spielte „Xerxes“ von Händel, und die Pirker, aus England kommend und unter Gluck ausgebildet, sollte die Amastris singen.
Der junge Mann aus der Provinz, schüchtern in seinem unmodischen Frack, den der Freund mit eigenen Tressen aufgebessert hatte, betrat das knarrende Parkett des obersten Ranges im Hoftheater. Der Holzbau roch dumpfig, unten summten die geputzten, gepuderten Zuschauer; oben drückte sich eine Gruppe von jungen Burschen zusammen. Die Hofloge war noch leer. Der steife gemalte Vorhang wogte im Licht der Kerzenreihen, als ein mächtiger Mann davor auftauchte: Der Musikdirektor Jomelli, „so begnadet wie füllig“, wie man sich zuflüsterte. Er wurde erstaunt betrachtet, endlich beklatscht. Aber er winkte mit der fleischigen Hand. Es sei keine erfreuliche cosa, die er zu verkündigen habe: Die célebre und von ihm hochgeachtete Primadonna Madame Pirkerin sei unpäßlich und könne nicht auftreten. Man habe deshalb schnell ein anderes Stück angesetzt, in dem sie nicht benötigt werde, ein Werk des Salieri aus Salzburg, der Mozarts Konkurrent gewesen war. Schubart begeisterte freilich auch das, wiewohl er die Marianne Pirker gern gehört hätte; später erfuhr der Freund, ein junger Musiker vom Hoforchester, die Pirker sei plötzlich verschwunden.
„Was?“ schrie Schubart aufgeregt, „das ist doch nicht möglich?“
„Doch, derlei gibt’s“, murmelte der andere betreten. „Man sagt, sie sei eine sonderliche Freundin der Herzogin