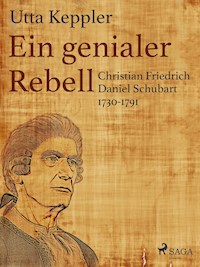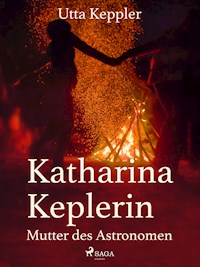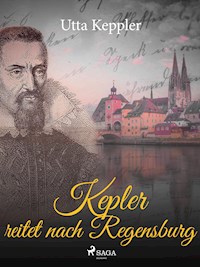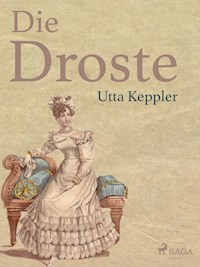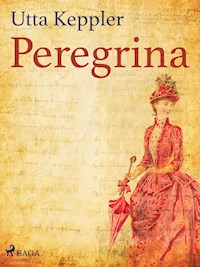Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In diesem Werk beschreibt die Autorin das Leben der Friederike Kerner, die eine glückliche Ehe mit dem schwäbischen Arzt und Dichters Justinus Kerner geführt hat. Hier wird jedoch der Blick nicht auf den bekannten Arzt gelenkt, sondern stattdessen auf die junge Frau, die hinter ihrem Mann steht. Lesen Sie mehr über das spannendes Leben von Friederike Kerner in dieser Biographie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Utta Keppler
Friederike Kerner und ihr Justinus
SAGA Egmont
Friederike Kerner und ihr Justinus
Copyright © 2017 Utta Keppler und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711708569
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Da wandert einer nach Tübingen, um zu studieren, und weiß noch nicht einmal, was. Wie eine gespannte Saite wartet er, halbbewußt und schüchtern und ängstlich zurückweichend vor einer eigenen Entscheidung, auf ein Zeichen.
Er glaubt an Zeichen, er meint, in irgendeiner heiligen Wolke oder unheiligen Zufälligkeit zu spüren, daß sie für ihn und gerade nur für ihn arrangiert worden seien, und ihn „führen“ würden … und er will dieser Anleitung folgen. Er will? Eigentlich ist es ein Traumwandeln, kein Entschluß, kein Wollen.
So trödelt er hin und gelangt an ein altes breitgelagertes Fachwerkhaus vor der Stadt, schaut es an, spürt den Wind, der jetzt schon kühl wird – es ist Abend – und meint, ihn fragen zu sollen.
Und also kommt ihm zu Hilfe, was er erwartet, er deutet als Antwort, was ein anderer ärgerlich als Unordnung und Schlamperei, als Störung oder gar nicht beachten würde:
Vor ihm kreiselt aus der Haushöhe, von einem Fenstersims, aus der Öffnung in eine dunkle Stubentiefe das weißliche Papier herunter, tanzt ein paarmal vor ihm auf und ab und verwirbelt zwischen der Hauswand und dem Baumstamm daneben.
Er hebt es auf, natürlich. Er hat ein Zeichen erwartet und liest, was da steht, Hieroglyphen, kaum zu entziffern, chemisches Gekritzel, ein Rezept.
Als gewissenhafter Bürgersohn läutet er am Eingang – es ist ein Spital, ein Alten- und Ausdinghaus – und liefert das Gefundene ab. Dann läuft er getrieben der Stadt zu, er nimmt das Zeichen ganz ernst, er wird sich dort hinter den Toren melden, er will also Medizin studieren.
Das war Justinus Kerner, der nachher eher ein Mystiker und Magier, ein Seelenforscher und Gemütsarzt wurde, als ein empirisch gerichteter Doktor …
Tübingen – Tübingen! Das ist, seit er denken kann, ein geistiger Mittelpunkt, altes blühendes, sprühendes Zentrum der Ideen, Sammelpunkt der Denker, Heimstatt der Dichter – so sieht er’s und meint, mit dem Antritt des Studiums aller Weisheiten Born und aller Kernfragen Lösung entdeckt zu haben.
Sein Herkommen hat ihm die Ehrfurcht vor dem Wissen mitgegeben, die geistige Neugier, die das Ergründen und Begründen sucht, und doch auch dahinter und darüberhinaus das Tasten und Ahnen, den Wunsch, das „Unerforschliche ruhig zu verehren“, wie es ihm der allverehrte Goethe angesagt hat.
Freilich hat der vorausgeschickt, als Bedingung und Vorspruch, es müsse „das Erforschliche erforscht“ worden sein … und das, meint er, werde ihm doch auch gelingen.
Nur ist ihm, seinem Wesen nach, das ganz nüchterne, empirische „Erforschen“ von jeher ein bißchen zuwider; ein wundergläubiges Staunen ist ihm gemäß: Schwingung der Baumäste, verschränkte, knorrig-zackige Sprossen vor dem violetten, rotgetönten Abendhimmel, Triller des Vogels im Geäst, Melodie und doch keine, und Geruch der aufgebrochenen Erde um den Quell – das sind alles Bilder, Klänge, für ihn gemeint und ihm zugesprochen; Weisungen endlich, keine Zwänge, aber lenkende leichte Bänder, deren Führung er sich gern überläßt.
Die Gassen sind holperig, die Häuser geneigte Steingesichter, und hie und da eine bröckelige Mauer. Eng ist mancherlei da drinnen, aber für ihn doch voller Gewisper und Geflüster, und wenn er – immer wieder – am Neckar steht, rührt ihn der ziehende Fluß an, als sei er verwandt und verschwistert, denn jetzt, wo er dazugehört, ist es doch ganz anders als bei den Besuchen früher.
Drüber das Schloß – dicke Türme, herrlich gemeißelte Tore, und überall die Bäume dabei, alte gebogene und frischere grüne, und ein wuselndes Leben mit vielerlei wimmelnden Gestalten, würdigen, steifen, hochgemuten und selbstgewissen, und anderen jungen, unruhig strömenden und strebenden, die sich erst selber finden möchten …
Er steht jetzt allein am Fluß, hinter der niedrigen Mauer und schaut; eigentlich wartet er, wie er immer horcht und wartet.
Er sinniert und weiß gleich, daß er von irgendeinem hören will, wer er selber eigentlich sei …
Das tun sie alle, sich suchen. Aber er hat es da vielleicht leichter als viele, weil er das gerundete, gegründete gute Elternhaus in Ludwigsburg hinter sich weiß, in dem er als vierter Sohn des Oberamtmanns und Regierungsrats Kerner nach der Mitte des September und gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts geboren worden ist.
Es sei ein klarer Tag gewesen, ein bißchen Morgennebel habe der Mutter, die in den Wehen lag, Bedrückungen auf der Brust gemacht, die aber danach, als das krebsrote Würmchen aus ihr ans Licht getreten, ganz leicht gewichen seien.
Man hat im Haus davon nicht weiter geredet, das gehörte sich nicht, aber die Hebamme hat es erzählt, als ihn die ältere Schwester einmal auf dem Arm gehalten, und die hat es als bedeutsam aufgenommen und ihm später weitergegeben.
Nur der Vater wäre weiter bedrückt gewesen, nicht wegen des Nebels, und noch weniger wegen seiner Geburt, obwohl er sehr sorgenvoll vor der Tür auf- und abgegangen sei.
Ihn preßte der Zweifel darüber, welchen Namen, den es als Signum und Wegzeichen zu tragen habe, er diesem vierten Kind auf den Weg geben solle? Da sei der Vater in den Bildersaal gegangen und habe den Namen des Ahnen gewählt, der ihm zuerst von seinem Porträt herunter in die Augen sähe; das war aber ein Herr Spezialsuperintendent Andreas Justinus Kerner, der um 1590 in Güglingen gewirkt hatte, der kleinen Stadt im Württembergischen, in der einmal nicht ganz dreißig Jahre danach die Mutter des großen Astronomen Johannes Kepler ihren Hexenprozeß gerade nur überstanden hatte – „und wenn ihr mir jede Ader aus dem Leibe ziehet, ich habe nichts zu bekennen“, habe die gesagt.
Justinus, der Nachfahr und Student, kannte ein paar Züge dieser Geschichte, aber die starre, zielklare Antwort wäre ihm für sich selber nicht eingefallen. Er hätte eher auf ein flatterndes Papierchen gesehen und sich nach dem gerichtet – sei’s drum: Er war ein Dichter.
Da ist also etwas, das ihn mitgebildet hat oder haben könnte: Ein theologischer Anhauch und Zug zu Dogma, Würde und auch zur Transzendenz. Er spürt es genau.
Aber jetzt ist er mitten im Strudel, wenn er aus dem stillen Hinschauen auf den ziehenden Nachtfluß sich losmacht, und da schlendern und trappeln sie schon vorbei, ein Trupp Studenten in hohen Stiefeln, mit kleinem Cerevis, in hellen engen Hosen – sie stehen gedrängt unter der einzigen Laterne an der Brückenecke, gestikulieren und schwatzen, und gelegentlich schreit einer, irgendein Schimpf- oder Jubelwort; und er sieht eine lange Pfeife übers Geländer hängen, der weiße Porzellankopf ragt schon weit in die Tiefe, hebt sich zuckend und zuckelnd und lichtgestreift gegen den schwarzen Fluß da unten ab, der wie eine zähe Pechstraße aussieht in der Nacht, und dabei doch ganz unsichtbar lebendig ist, hinschwillt, murrt und murmelt und viel mehr weiß, als er sehen läßt.
Die wandernden und schwatzenden, die schwärmenden und streitenden Burschen sind jetzt ganz nah, sie umringen ihn und einer sagt laut: „Du, Neuer, bisch scho a Fux oder no net?“
Justinus schüttelt den Kopf und sie drücken ihn fragend und schreiend gegen das Geländer.
„I werd’s scho werde, wartet no …“, sagt er ärgerlich und will sich nicht hetzen lassen, der langsame Fluß ist ihm nah und tröstlich in dem Gezeter.
„Lasset mi no …“, sagt er noch, windet sich aus dem Gewühl und dreht gegen das Uhlandhaus zu, wo der alte Arzt wohnt, den er kennt – und wieder meint er es winken und deuten zu sehen –, der damals das Rezept unterschrieben hatte, das ihm ein Orakel schien.
Er ist dann fast unbemerkt vollends aus dem Studentenhaufen weggeschlichen und hat sich, weiter drüben, die Treppchen zum Neckar hinuntergedrückt, wo das Mauerwerk im rechten Winkel von der Brücke am Fluß entlanglief. Es war dunkel genug, daß er ungesehen dahinunter gelangte, hinter sich kleine Gärten und eng an die Hausmauern gefügte rankende Hecken.
Er sieht unter sich im Fluß eine Bewegung, einen Nachen, und diesmal ist der Ruderer ganz still, singt und ruft nicht und bewegt seinen schmalen schwarzen Fisch fast lautlos mit ein paar Ruderschlägen voran. Ein einsamer Mensch, ein trauriger vielleicht? Manchmal verschwindet das dunkle Gefährt unter den überhängenden Weidenzweigen, es zieht weiter, wird kleiner, fast unsichtbar, weiter hinunter, hinüber …
Kerner denkt: Übergänge, ohne genaue Grenzen. Und ich studiere Medizin, die nüchterne Erfahrungswissenschaft. Anderntags, so nimmt er sich vor, werde ich den Doktor Uhland besuchen, vielleicht ist er am Abend zu Haus von seinen Patientengängen, und ihm meine Führung und Berufung erzählen und hören, ob er die für maßgeblich hält. Sein Neffe, überlegt er, soll doch auch hier studieren, Jura, hieß es, und den sollte ich auch aufsuchen, der hält sich nicht beim lauten Haufen, vielleicht ist er auch so ein Stiller, man sagt, er dichte …
In einem blitzartigen Einfall meint er, der Ruderer unter ihm könnte der junge Uhland sein, und vielleicht ist er es auch – er will ihn demnächst fragen.
Kerner studierte also Medizin, betrachtete und zeichnete das Knochengerüst, Rippenbogenbrustkorb und Augenlochschädel, und steckendürre Gelenke und beinerne Beckenschale – und während der Professor doziert und die aufgehängte Klapperfigur dabei bewegt, fällt ihm ein, was er als junger Bursche schauerlich dröhnen hörte, aus dem Tollhaus neben der Tuchfabrik, und gebunden und gebannt hat immer wieder hören müssen: „Totenköpf und Krautsalat“ – das krächzende Geschrei eines Tobsüchtigen, den sie angefesselt hatten … Er sieht auf einmal, als wäre es wirklich, das Gesicht des Schädels sich füllen und runden und meint, der Kopf, ein lebendiger, rucke und zucke. Solche Bilder schafft er sich oft, oder vielmehr seine Phantasie schafft sie ihm, und die schweren, bösen Erinnerungen aus der Jugendzeit.
Seine schmalen Augen, die schon bei dem jungen Mann geschwollene Augensäcke haben, sehen ein bißchen traumverloren vor sich hin, und der Dozent mahnt – mit einem Seitenblick – zur allgemeinen Aufmerksamkeit. Kerners ganzer Habitus scheint ihm zu weich, fast schwammig-wässerig – er meint, etwas Straffes und Konzentriertes in dem Studenten aufrufen zu müssen, Disziplin, Einschränkung, Sammlung … aber er sagt nichts. Er weiß auch nicht, was für Nachtgesichte den Burschen bedrängen, unauslöschbare Bilder: Der Vater ist tot, die Mutter steht mit den kleinen Kindern allein, und der Justinus, dessen Name sie ihm als „gerecht und ausgerichtet, ausjustiert“ deutet, muß einen Beruf haben, in den er früh genug hineinwächst.
Da tut man ihn in die herzogliche Tuchfabrik in Ludwigsburg. Was ein Lehrling da zu tun hat, sieht so aus: Stoffballen schleppen, aufwickeln, in die Regale räumen; dabei muß man hoch oben auf der Leiter herumturnen und die unhandlichen Dinger balancieren. Er tut es tagelang, es gibt keine geregelten Arbeitsstunden.
Der Raum ist dunkel, die Fenster verdeckt von den getürmten Ballen; irgendein freundlicher Meister macht eine Scheibe dahinter auf, daß Luft hereindringt, es riecht nach dem staubigen Zeug, das jahrelang da gelagert worden ist – Justinus atmet auf, aber mit der frischeren Kühle, die ihn gerade noch erreicht, kommt auch ein Ton herein, zwei, drei, kaum menschliche Laute, Ächzen, Stöhnen, wildes Schreien – und dazwischen ein gellendes Gelächter.
Er weiß, was das ist. Nah bei der Stoffhandlung ist das Irrenhaus, wo nebenan auch die gefangenen Verbrecher eingesperrt sind.
Wenn die Verrückten toben, fesselt man sie, die Ketten hört er rasseln. Sind das Ärzte, die das befehlen? Zwangsjacken gibt es auch, Kopfmasken, Prügelstöcke …
Justinus ist zu feinfühlig, um das lang auszuhalten. Er sinkt und gleitet in die schwärzeste Schwermut, er spürt was die Schwarzgalligkeit bei den Alten hieß, die Melancholeia. Er sagt weinend zu seiner Mutter, so prästiere er das nimmer lang.
Endlich hat einer der vermögenden Verwandten es erreicht, mit eigenen Opfern, daß er doch studieren darf; er war lang krank gewesen, Nerven- und Magenkrämpfe, und das „Hoppelpoppel“, mit dem man ihn behandelt hat, besserte nichts. Das war ein aus Rußland stammendes Rezept obskurer Zusammensetzung, das manchem schon geholfen hatte, ihm nicht. Er erbrach das meiste von dem, was man ihm eingab, und wurde immer elender.
Magnetische Striche, eine Kur des berühmten Doktor Gmelin, halfen endlich, sonst hätte er gewiß die „Tuchfabrik“ gar nicht einmal antreten können …
Jetzt Tübingen, das Studium, Freunde … Er findet Freunde, und das ist neu, anders als die Kinder- und Bubengemeinschaften in Ludwigsburg.
Besonders der Uhland zieht ihn an, ein Dichter, ein „hochgemuter“ Jüngling, ein selbständiger und beständiger Charakter, und kräftig in seinem Urteil und im „Sistieren“ darauf. Auch den alten Doktor, den Onkel des Ludwig, sucht er auf und findet eine gemessene Bestätigung seiner Pläne bei ihm. Der wohnt also am Neckar, neben der Brücke, in einem weiträumigen gemütlichen Haus, in dem er freilich selten Zeit hat, „zu Hause zu sein“.
Jetzt, gegen Ende April 1807, sind die Freunde wieder beieinander, Kerner, Uhland, Karl Mayer, der hübsche Karikaturen zeichnen kann für das gemeinsame handschriftlich verbreitete „Sonntagsblatt für ungebildete Stände“, ein Gegenspiel gegen das „Wochenblatt für gebildete Stände“, das obligate Organ der Gesellschaft.
Da ist ein strahlender Frühlingstag, wie man so sagt, wirklich strahlend, blauäugig von oben her und leichtfüßig bevölkert von Burschen und Mädchen, die den Hang zur Achalm hinaufziehen, zwischen dem hellen Buchenlaub.
Es ist schon gegen Ende April, der 26. im Jahr 1807, Uhlands Geburtstag, und einer, der am schnellsten und lustigsten ausschreitet, ist auch der Dichter Ludwig Uhland – schon bekannter als andere, die fast alle auch einmal Verse gemacht haben (das wäre bei jungen Leuten hierzuland nichts Besonderes!), aber die schon einmal gedruckt worden sind, und darauf legen sie Wert, das hebt sie im eigenen und Freundesbewußtsein, das Gedrucktwerden.
Sie fühlen sich aber auch als „Studiosi“ gehoben und privilegiert und sind deshalb auch laut und unbekümmert, und die Mädchen, die sie zu dieser Wanderung und „Lustbarkeit“ eingeladen haben, sind es auch.
Weiße Kleider mit fliegenden Bändern haben sie an, blaue Gürtel und über gestreiften geblümten Taillen Dreieckfichus, Spitzenkragen, Schutenhüte, hellrote Schirmchen – wer sie sieht, dem fällt ein Vogelschwarm ein, rotbrüstige, blaugefiederte, weißgefleckte Meisen, Elstern und Rotkehlchen, zartgraue mit bläulichen Flügeln, mit schmalen schwarzen Sohlen; und wie wolkige Federn sehen die Volants aus, die Falbeln und schwingenden Rüschen, und vogelhaft klingt das Gezwitscher und Gesumme, das Getuschel und Gepiepse und Gelächter …
Die Burschen, sonst ernsthafte Philosophen und berufen, die Welt zu erlösen – so fühlen sie sich – laufen und hüpfen dazwischen, schreiten auch gemessener und bieten den Arm zur Stütze, wenn der Weg ansteigt oder Wurzeln und Gras uneben sind, und mit ihren schon dunkler tönenden Stimmen geben sie den Baß zu dem Gezirpe ab, wie ein Continuo zu einer lustigen Melodie, die allegretto vivace springt und sprudelt.
Ende April sind schon Veilchen da, als violette Flecken im niedrigen Gras, ihr Duft ist überall, auch wenn man sie nicht sieht, und die Buchenblätter haben sich aus den rötlichen Knospen geschält und glänzen wie lackiert.
Uhland mit seiner hochgewölbten Stirn, dem krausen Haar am Hinterhaupt und dem schwachen Kinn wirkt eher wie ein scheuer Bub, den Juristen und exakt planenden Logiker traut man ihm nicht zu, so wenig wie dem Kerner mit seinem mädchenhaften Gesicht mit den kirschroten geschwellten Lippen und dem molligen Kinn. Locken haben sie beide, empfindsam sehen sie aus, und wie sie vorauslaufen, streifen sie die Röcke ab und strecken die Arme in die sonnige Luft. Sie heißen sich Floris und Clarus, und der Clarus kneift die schmalen Augen über den weichen Wangen zusammen und sagt: „Warum heißt Ihr mich Clarus? So arg klar seh’ ich gar nicht – aber es schwimmt mir doch in lauter Wonne.“
Er bleibt dann ein wenig zurück, spielt mit einer knospigen Gerte und schaut nach den langsamer gehenden Mädchen, sieht die schmalen Gelenke in den weißen Strümpfen, von gekreuzten Riemen gestreift, die wippenden Rocksäume, die das dicke Gras biegen und wiegen, und guckt dann über die hellen Gestalten hinauf zu den Gesichtern. Eine ist dunkler angezogen.
Justinus spürt mehr von ihr als von den anderen, da er angelegt ist als ein ganz feines Echogerät, ein sensibles Widerspiel aller Töne und Farben und Ströme, die um ihn sind, und jetzt, an diesem jubilierenden Morgen, mitten in einer lauten kindlich umtreibenden Gruppe, zieht es ihn wie magnetisch – ein Wort, das er liebt – zu dieser zarteren Schwingung, die ihm unwissend und unbewußt da entgegenkommt: Es ist ein schmales hochgewachsenes Mädchen mit dunklem Haar und klar geschnittenem Gesicht, schwarz angezogen, und die Kleiderfalten sind gerade und ohne gebauschte Raffung und gebogene Verzierung.
Das Mädchen schaut ihn an, sie spürt ebenso wie er eine Berührung und einen Anruf, sie zuckt, ohne es zu wollen, und sieht zur Seite. Ihre Augen sind ringsherum gerötet, die Lider geschwollen, alles an ihr wirkt streng, mit Anstrengung zusammengerafft.
Sie geht langsamer als er und langsamer als die vergnügten Freundinnen und Freunde, und er stockt jetzt auch, läßt sie herankommen und wendet den Kopf nach ihr. Er verbeugt sich leicht, es ist ihm eine ungewohnte Geste, er ist kein Gesellschaftsmensch – und dann sagt er, wie wenn es ihm diktiert würde, halblaut:
„Wie kommt’s, daß du so traurig bist
Wo alles froh erscheint?
Ich seh dir’s an den Augen an:
Gewiß, du hast geweint …”
Das ernste verschlossene Mädchen schweigt einen Augenblick, dann antwortet sie, auch so, als würde es diktiert:
„Und hab ich einsam auch geweint,
So ist’s mein eig’ner Schmerz,
Die Tränen fließen gar so süß,
Erleichtern mir das Herz.“
Sie gibt ihm die Hand, er lächelt, beinah erlöst: Goethes Vers hat einen klaren Bogen zwischen ihnen geschlagen …
Es hat etwas angefangen, das für beide bestimmt schien: Friederike ist das kluge, unaufdringliche und zielsichere Wesen, das Justinus braucht, und ihr kommt der Weichere, reich Begabte, in seiner warmherzigen Schwingung und treuherzigen Aufgeschlossenheit entgegen wie ein brüderlicher Freund und ein hilfsbedürftiger Leidender, und mitten in dieser seelischen Gestimmtheit der Trauer um ihren sehr geliebten Vater ist er auf einmal da, hingenommen und hingegeben, ein Liebender mit aller Stärke der zarten, unverbogenen Leidenschaft, ohne selbstsüchtiges Begehren, nur ihr Wesen und Wohl sucht er; und die endliche Einigung, die ganze völlige, unverhaltene, ist eine „gewisse Hoffnung“, die er sehnsüchtig erwarten will.
Friederike Ehmann ist die Tochter des Klosterschulprofessors und Pfarrers Friedrich Philipp Ehmann, sie ist im Pfarrhaus zu Ruit auf den Fildern im gleichen Jahr (1786) wie Justinus geboren und hat beide Eltern verloren; sie ist „mittellos“, wie man damals sagte, ohne hilfreiche Verwandte, und empfindet das Preisgegeben- und Aufsichgestelltsein schwerer als andere – freilich weckt es bei ihr nicht die Niedergeschlagenheit hilfloser Mädchen, sondern eher das Gefühl, daß die schwerste Aufgabe die wichtigste ist und am sichersten zu bestehen.
Sie sprechen sich aus, sie erklärt ihr Traurigsein – der Vater war ein so naher Freund, ein so zärtlicher Schutz gewesen, er hing an ihr mit einer tiefgegründeten Liebe, er brauchte sie nach dem Tod der Mutter als Beraterin, als liebevollen Widerhall.
Sie wird bei einer Tante leben, die – wie Verwandte oft genug in solchen Fällen – mit dem unschuldigsten Gesicht fragt, wie sie sich das denn eigentlich denke, so ohne allen Rückhalt?
Und Friederike sagt, und beißt sich vorher ein bißchen auf die Lippen, sie sei es ja nicht, die sich so ein Schicksal ausgesucht habe und habe ja selber genug unter ihm zu leiden; dann steigt ihr doch das Wasser in die großen Augen, als sie an dem verkniffenen Altfrauengesicht der Tante abliest, was die denkt, als wäre Elend die Schuld des Leidenden, und Not die Folge des Versagens.
Die Tante Hehl in Lustnau nimmt sie also auf, nicht gern, wie sie spüren läßt, und in der Voraussicht, daß sie damit eine tüchtige Wirtschafterin gewinne; denn etwas anderes kann ein elternloses Ding nicht erwarten.
Friederike mußte „aus dem Haus“, denn die zweite Mutter war mit der großen umtriebigen Kinderschar schon überfordert und hatte wenig Herzlichkeit für diese fast erwachsene Tochter aus der ersten Ehe. Sie meinte, sie hätte genug getan, wenn das Mädchen „wohlausgebildet im Hauswesen“ wäre, sie hatte ihr all die umständlichen und mühseligen Handgriffe und Begriffe beigebracht, die dazugehörten, vom Anheizen im Küchenherd bis zum langwierigen sorgsamen Kuchenrühren, vom Gemüseputzen bis zum Soßenabschmecken, vom Anrichten und Servieren bis zum Abwasch, und dann das Anfeuern in der Waschküche, das Einbürsten und Seifen, das Schwenken und Aufhängen – denn die kleine Magd war nur fürs Gröbste zu brauchen, fürs Holztragen und Wasserholen und zur Hilfe, wenn Körbe und Gelten zu schwer waren, der Knecht zum Holzhacken und Zaunflicken und Pferdefüttern, denn ohne das „Kütschle“ wäre ja der Vater in seinem Amt nicht denkbar gewesen. Dazu brauchte er Pferde.
Das hörte dann freilich auf, vieles hörte auf, der Knecht mußte fort, eine Stube wurde vermietet – und also mußten drei Jüngere zusammenschlafen, und alles wurde kleiner und enger; es war kein Zuhause mehr, wenn sie einmal wieder heimkam, und ungern genug auch aus Lustnau fortgelassen wurde, denn dann „bleibt die Arbeit liegen“, wie Frau Hehl sagte.
Und nach der zweiten „Heimfahrt“ gab sich auch Friederike selber zu, daß es eigentlich eine Quälerei sei, so lieb ihr das Wiedersehen mit den Geschwistern war; eine Qual, denn sie sah überall noch den Vater und hörte ihn, wie er bei ihrem letzten Lustnauer Besuch so schwer Abschied von ihr genommen hatte. „Komm bald wieder, lieb’s Rickele, ich kann nicht leben ohne dich!“
Es ist ihr jedesmal schwerer gefallen, sich in diese nüchterne karge Tageswelt zurückzufinden:
Da sitzt die Tante hinter ihr und hüstelt und beobachtet sie, wie sie gerade einen Fensterflügel aufmacht und den Sims draußen abwischt, da es die Tante befohlen hat. Sie spürt die kalte Feuchtigkeit des unebenen Steins, der Rillen und Poren hat und fremd und feindselig unter ihren Fingern ist, wenn der zerfaserte Lappen ihn nicht abdeckt.