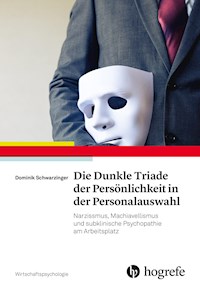
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Wirtschaftspsychologie
- Sprache: Deutsch
In diesem Band werden theoretische Grundlagen und aktuelle Befunde zu Narzissmus, Machiavellismus und subklinischer Psychopathie am Arbeitsplatz ebenso wie komplexe Fragen zur Struktur der Dunklen Triade und ihren Messmethoden für eine praktische Nutzung verständlich aufbereitet. Im Zentrum stehen dabei Fragen des individuellen beruflichen Erfolgs und der Arbeitsleistung sowie Risiken, wie missbräuchliches, destruktives Führungsverhalten und kontraproduktive Verhaltensweisen, die von Personen mit erhöhten Ausprägungen dieser Eigenschaften am Arbeitsplatz ausgehen. Zudem werden rechtliche und fachliche Vorgaben zur Erfassung dunkler Persönlichkeitseigenschaften mit der Sicht der Bewerber hinsichtlich der Aspekte Akzeptanz und soziale Validität zusammengeführt, die vorliegenden Messansätze evaluiert und Empfehlungen für die Praxis und weitere Forschung ausgesprochen. Als Praxisbeispiel beinhaltet das Buch die Vorstellung der Entwicklung, Qualität und Anwendbarkeit eines für den Einsatz in Organisationen konzipierten Testverfahrens zur Erfassung der Dunklen Triade am Arbeitsplatz. Darüber hinaus werden konkrete Handlungsempfehlungen für die Anwendung der Merkmale Narzissmus, Machiavellismus und subklinische Psychopathie in der Personalauswahl gegeben. Sowohl Wissenschaftler als auch Personalpraktiker, die an einem Einsatz der Dunklen Triade in der Personalarbeit interessiert sind, finden in diesem Buch wertvolle Informationen, wie rechtssichere Prozesse gestaltet werden können und das große Potenzial dieser Merkmale für eignungsdiagnostische Entscheidungen genutzt werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Dominik Schwarzinger
Die Dunkle Triade der Persönlichkeit in der Personalauswahl
Narzissmus, Machiavellismus und subklinische Psychopathie am Arbeitsplatz
Wirtschaftspsychologie
Die Dunkle Triade der Persönlichkeit in der Personalauswahl
Prof. Dr. Dominik Schwarzinger
Herausgeber der Reihe:
Prof. Dr. Heinz Schuler
Prof. Dr. Dominik Schwarzinger, geb. 1983. Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Spezialisierung auf Personalpsychologie an der Universität Hohenheim. Mehrjährige Praxistätigkeit für die HR Diagnostics AG. 2018 Promotion. Seit 2019 Professor im Fachbereich Psychologie der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, Berlin.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com by Getty Images / twinsterphoto
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
Format: EPUB
1. Auflage 2020
© 2020 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3014-0; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3014-1)
ISBN 978-3-8017-3014-7
https://doi.org/10.1026/03014-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
|5|Vorwort
Drei Klassiker der Psychologie sind in den letzten Jahren wieder zu größerer wissenschaftlicher, vor allem aber öffentlicher Wahrnehmung gelangt – Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Gemeinsam gefasst unter dem ansprechenden Titel „dark triad of personality“ (Paulhus & Williams, 2002) werden sie seither verstärkt in vielerlei Bereichen von der Paarpsychologie bis zur Managementforschung betrachtet. Dabei konnte in nur wenigen Jahren eine enorme Breite an Erkenntnissen zur Dunklen Triade gewonnen werden. Ganz aktuell mehren sich kritische Stimmen, die monieren, dass dabei Tiefe und Stringenz der Beschäftigung teilweise vernachlässigt wurden, was den wissenschaftlichen Fortschritt hemmt, vielfach Missverständnisse erzeugt hat und letztlich insbesondere für angewandte Zwecke erhebliche Gefahren bedeuten kann.
Der vorliegende Band bespricht Die Dunkle Triade der Persönlichkeit in der Personalauswahl und damit ein angewandtes Feld, das nicht nur rechtlich und fachlich hoch reguliert ist, sondern entsprechend seiner Bedeutung für Person und Organisation auch aus berufsethischen Gründen ein besonderes Augenmaß und Qualität verlangt. Daher sollen in dem folgenden Text alle relevanten Aspekte für einen solchen Einsatz thematisiert werden, um den aktuellen Forschungsstand zu bewerten und der Praxis eine belastbare Basis für operative Anwendungen der Dunklen Triade bereitzustellen.
Es gibt viele Personen und Organisationen, ohne die das vorliegende Buch nicht möglich gewesen wäre, weshalb hier nur die wichtigsten gewürdigt werden können. Herzlichen Dank an Herrn Professor Heinz Schuler für die jahrelange fachlich inspirierende und menschlich angenehme Zusammenarbeit und die Möglichkeit, meine (stark überarbeitete) Dissertation in seiner Buchreihe Wirtschaftspsychologie zu veröffentlichen. Frau Professor Marion Büttgen und ihrem gesamten Lehrstuhlteam sowie der HR Diagnostics AG für vielfältige und unersetzbare Unterstützung. Dem Hogrefe Verlag für die ausgezeichnete Zusammenarbeit rund um das vorliegende Buchprojekt und den Test TOP, vor allem Frau Tanja Ulbricht und Frau Sara Wellenzohn. Und nicht zuletzt Frau Anne Konz, im Namen aller Leser1, für unschätzbar wichtige sprachliche Überarbeitungen und Korrekturen am Typoskript.
Berlin, im November 2019
Dominik Schwarzinger
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im vorliegenden Text die männliche Sprachform gewählt. Selbstverständlich gelten die entsprechenden Aussagen für alle Geschlechter.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Die Dunkle Triade der Persönlichkeit – ein Trendthema der vergangenen Jahre
1.2 Zu den Notwendigkeiten der Betrachtung „dunkler“ Persönlichkeitsmerkmale am Arbeitsplatz
1.3 Aufbau des Buches
2 (Dunkle) Persönlichkeit, berufliche Leistung und beruflicher Erfolg
2.1 Von der Schädeldeutung zum Fünf-Faktoren-Modell und dem DSM-5
2.1.1 „Normale“ Persönlichkeit und Persönlichkeitsstörungen
2.1.2 Die Big Five und das Fehlen „dunkler“ Faktoren
2.2 Prognose beruflicher Leistung mit Persönlichkeitsmerkmalen
2.2.1 Berufliche Leistung und beruflicher Erfolg
2.2.2 Berufliche Eignungsdiagnostik mit Persönlichkeitsmerkmalen
2.3 Dark Side Personality Traits als neuer Ansatz in der Personalpsychologie
2.3.1 Eine allgemeine Taxonomie „dunkler“ Persönlichkeit im DSM-5?
2.3.2 Definition und Abgrenzung der „dunklen“ Eigenschaften
2.3.3 „Dunkle“ Persönlichkeitseigenschaften am Arbeitsplatz
3 Die Dunkle Triade der Persönlichkeit
3.1 Zur Geschichte von Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie
3.1.1 Narzissmus
3.1.2 Machiavellismus
3.1.3 Psychopathie
3.2 Ausgewählte Befunde der gemeinsamen Betrachtung der Merkmale
3.2.1 (Evolutions-)biologische Aspekte
3.2.2 Emotionale Defizite und moralische Vorstellungen
3.2.3 Allgemeine Persönlichkeitsmodelle
3.2.4 Kognitive und verwandte Merkmale
3.2.5 Interpersoneller Verhaltens- und Lebensstil
3.3 Strukturelle und messmethodische Abgrenzung der Triade-Eigenschaften
3.3.1 Strukturelle Konzeption der Dunklen Triade
3.3.2 Messmethodische Zugänge bei der Erfassung der Dunklen Triade
3.3.3 Die Subfacetten der Dunklen Triade
4 Eignungsdiagnostisch relevante Befunde zur Dunklen Triade
4.1 Prognose kontraproduktiver Verhaltensweisen am Arbeitsplatz
4.2 Prognose beruflicher Leistung und beruflichen Erfolgs
4.2.1 Führungserfolg und destruktives, missbräuchliches Führungsverhalten
4.2.2 Individuelle Leistungskriterien
4.2.3 Beruflicher Erfolg
4.3 Weitere personalpsychologische Anwendungsfelder
4.3.1 CEO- und Präsidentenpersönlichkeit sowie Entrepreneurship
4.3.2 Interessen und Berufsorientierung bzw. -wahl
4.3.3 Berufsbezogene Motivation, politische Fertigkeiten und Befinden am Arbeitsplatz
5 Anforderungen an ein in der Praxis einsetzbares eignungsdiagnostisches Verfahren zur Messung der Dunklen Triade
5.1 Überblick der verschiedenen Messansätze und ihrer Besonderheiten
5.1.1 Faking von Testergebnissen
5.1.2 Fremdeinschätzungen und informationstechnologisch gestützte Messungen
5.1.3 Selbsteinschätzungsverfahren mit Forced-Choice- vs. Likert-Skalierung
5.2 Rechtliche und fachliche Vorgaben für den operativen Praxiseinsatz
5.2.1 Legale, subklinische Messung „dunkler“ Persönlichkeitseigenschaften
5.2.2 Fachlich korrekte Messung: Gütekriterien etablierter Standard- und Kurzverfahren zur Erfassung der Dunklen Triade
5.3 Die Bewerbersicht – sozial valide, akzeptierte und berufsbezogene Messung
5.3.1 Soziale Validität
5.3.2 Berufs- und Anforderungsbezug
6 Berufsbezogene Messung der Dunklen Triade – das Beispiel des Verfahrens TOP
6.1 Konstruktion der TOP
6.1.1 Bedarf, Ziele und Datenbasis der Testentwicklung sowie Konstruktion der Items
6.1.2 Itemanalysen und Prüfung der Dimensionalität: Struktur der TOP
6.2 Reliabilität, Validität und Normierung
6.2.1 Objektivität, Reliabilität und Verteilungseigenschaften
6.2.2 Konstruktbezogene Validität: Verwandte Verfahren, Persönlichkeitsmodelle und Beziehungen zu eignungsdiagnostisch eingesetzten Verfahren und Konstrukten
6.2.3 Zusammenhänge mit Integrität, prosozialem und kontraproduktivem Verhalten
6.2.4 Kriterienbezogene Validität: Beziehungen zu beruflicher Leistung und beruflichem Erfolg
6.3 Evaluation der TOP
7 Empfehlungen für die Praxis und die weitere Forschung
7.1 Empfehlungen für die Forschung
7.1.1 Bedarf weiterer theoretischer Fundierung und methodischer Konsolidierung
7.1.2 Bedarf weiterer berufsbezogener Forschung und praktischer Erfahrungen
7.2 Empfehlungen für die Praxis
7.2.1 Vorgaben und Empfehlungen für die praktische Nutzung der Dunklen Triade
7.2.2 Personalauswahl mit der TOP – Möglichkeiten und Limitationen
7.3 Fazit: Die Dunkle Triade in der Personalauswahl?
Literatur
|9|1 Einleitung
1.1 Die Dunkle Triade der Persönlichkeit – ein Trendthema der vergangenen Jahre
Die Eigenschaften Narzissmus, Machiavellismus und subklinische Psychopathie sind seit ihrer gemeinsamen Betrachtung unter dem Begriff Dunkle Triade der Persönlichkeit zu einem der größten Trendthemen in der psychologischen Forschung der letzten zehn Jahre avanciert. Dies kann mit der Anzahl und der inhaltlichen Breite der wissenschaftlichen Artikel zur Dunklen Triade belegt werden. So wurde die initiale Arbeit von Paulhus und Williams (2002) bislang über 2 000 Mal zitiert und Muris, Merckelbach, Otgaar und Meijer (2017) konnten fast 100 Arbeiten in ihre Metaanalyse mit Datenstand Januar 2016 einbeziehen, die jeweils alle drei Triade-Bestandteile umfassen. Die überwiegende Mehrheit davon ist in den letzten Jahren erschienen und damit ein quasi exponentieller Anstieg der Anzahl von Fachartikeln zu verzeichnen (vgl. Abbildung 1).
Abbildung 1: Publikationen zur Dunklen Triade seit der Begriffsschöpfung, basierend auf einer Web-of-Science-Recherche (aus Muris et al., 2017, S. 185)
Anfang 2019 – nur drei Jahre nach „Redaktionsschluss“ der Metaanalyse und 17 Jahre nach der „Erfindung“ der Dunklen Triade – lagen bereits mehrere Hundert spezifische Fachpublikationen vor, alleine im Journal Personality and Individual Differences erschienen zuletzt über 20 pro Jahr. Eine Auswahl der dort 2018 in Bezug zur Triade behandelten Themen kann die Breite der Beschäftigung illustrieren: Kinderzahl, Intelligenz, Wohnortpräferenzen, akademisches Fehlverhalten, Schlaflosigkeit, Gewalt in Beziehungen, sportliche Aktivität, Verhalten in sozialen Medien.
Der Trend geht so weit, dass in mehreren Publikationen mittlerweile erhebliche Kritik geübt wird (z. B. Adam, 2019; Miller, Vize, Crowe & Lynam, 2019): weniger am Konzept der Dunk|10|len Triade selbst als an der Art und Weise, wie einige Studien durchgeführt wurden, etwa an deren theoretischer Fundierung und den eingesetzten Messverfahren, vor allem aber daran, wie die Vielzahl der Erkenntnisse (nicht) kumulativ reflektiert und integriert wurde – also an einigen der Grundlagen jeder seriösen wissenschaftlichen Forschung. Man kann die Kritik daher auch als eine an den Beteiligten und dem System lesen, das eine zu unkritisch geprüfte Publikationszahl erzeugt und zugelassen hat, die zum derzeit bestehenden teilweise missverständlichen Forschungsstand beigetragen hat.
Diesen Umstand mag man als eine von Zeit zu Zeit in verschiedenen Wissenschaftsbereichen vorkommende Entwicklung ansehen, welche die betroffene Scientific Community ja auch bereits im Korrigieren begriffen ist, und damit vielleicht als nicht weiter schlimm. Ein vergleichsweise größeres Problem liegt jedoch darin, dass die Dunkle Triade in den letzten Jahren (und damit vor den Korrekturen und uneingedenk der Mahnungen der einschlägigen Fachwelt) auch auf ein überwältigendes Interesse in den der Psychologie angrenzenden Fachbereichen, wie der betriebswirtschaftlichen Management- und Personalforschung, sowie vor allem in der populärwissenschaftlichen und Publikumspresse gestoßen ist – dies in erster Linie aufgrund der Auswirkungen der Dunklen Triade in der Arbeitswelt, einem in jüngerer Zeit zunehmend an Bedeutung gewinnenden Forschungsschwerpunkt (z. B. Cohen, 2016; O’Boyle, Forsyth, Banks & McDaniel, 2012; Spain, Harms & LeBreton, 2014; Wille, De Fruyt & De Clercq, 2013). Gerade die hierzu gewonnenen Ergebnisse werden gerne außerhalb des wissenschaftlichen Bereichs rezipiert, vor allem in Online-Medien jeglichen Hintergrunds und Qualitätsniveaus, aber auch in Karriereteilen von großen Tages- und Wochenzeitungen – es ist ein regelrechter Hype um die Auswirkungen der Merkmale im Berufsleben ausgebrochen.
So titeln beispielsweise Artikel mit Aussagen wie „Die Dunkle Triade – warum radikal rücksichtslose Menschen weiter kommen“, und es werden an verschiedenen Stellen Narzissten und Psychopathen im Top-Management thematisiert. In der aktuellen Diskussion werden erhöhte Werte der Dunklen Triade somit zum Teil als zuträglich für beruflichen Erfolg beschrieben, vor allem in Führungspositionen, entsprechend dem Hintergrund der Merkmale und der umgangssprachlichen Verwendung der Begriffe aber in erster Linie und überwiegend negative Konsequenzen für Dritte mit ihnen verbunden.
Aufgrund der bisherigen wissenschaftlichen Befundlage (oder der medialen Berichterstattung?) ist es jedenfalls wenig überraschend, dass bereits Arbeitgeber Mitarbeiter mit diesen Eigenschaften „erkennen, loswerden, bestrafen [oder] umschulen“ möchten (Jonason, Wee, Li & Jackson, 2014, S. 122). Für das Merkmal Psychopathie wurde mehrfach gefordert, Screening-Maßnahmen einzusetzen, um gefährliche Personen von bestimmten Positionen fernzuhalten (Skeem, Polaschek, Patrick & Lilienfeld, 2011). Mehrere einschlägige Autoren verweisen explizit auf einen möglichen eignungsdiagnostischen Einsatz, namentlich die Personalauswahl auf Basis der Dunklen Triade (z. B. O’Boyle et al., 2012; Schyns, 2015; Wu & LeBreton, 2011) – womit sie zu einem Forschungsobjekt der Berufseignungsdiagnostik geworden ist.
Eine weitere Erforschung der Auswirkungen der Dunklen Triade am Arbeitsplatz ist dringend angebracht, will man sie nicht nur für wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn und öffentliche Diskussion, sondern für Personalarbeit in der Praxis nutzen. Für die Rechtfertigung eines tatsächlichen operativen Einsatzes der Eigenschaften als Grundlage von Personalentscheidungen müssen sie zunächst in der Lage sein, für diesen Zweck relevante Kriterien sicher vorherzusagen – und die Befundlage hierzu ist weit weniger breit und klar, als es die öffentliche Rezeption vermuten lässt. Allerdings liegen mittlerweile genügend hoch|11|wertige empirische Arbeiten vor, die auf der Basis von Daten aus Unternehmen und von Berufstätigen Aussagen darüber zulassen, inwieweit ein Einsatz der Dunklen Triade in der Personalarbeit tatsächlich nutzenbringend ist.
Mit einem angewandten eignungsdiagnostischen Einsatz von Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie ist jedoch eine Reihe von potenziellen Problemen verbunden, die von ethischen Erwägungen und fachlich-rechtlichen Vorgaben über ungeklärte theoretische Fragestellungen bis hin zu grundlegenden psychometrischen Anforderungen an die dafür vorgesehenen Verfahren reichen. Diese Fragen sind im Gegensatz zu den bislang meist untersuchten Kriterienbeziehungen noch weitgehend ungeklärt, was in erster Linie daran liegt, dass die Triade-Forschung nicht von Beginn an berufsbezogen war und erst seit etwa fünf Jahren eine breitere Beschäftigung in dieser Hinsicht stattfindet. Vor allem aber bestehen kaum Erfahrungen aus dem organisationalen Kontext, wie die Anwendung „dunkler“ Persönlichkeit in der praktischen Personalarbeit gelingen kann, auf welche Reaktionen sie trifft und wie wertvoll die gewonnenen Ergebnisse wirklich sind. Hierzu sollen in dem vorliegenden Band erste Beiträge geleistet und geprüft werden, ob der Hype um die Dunkle Triade der Persönlichkeit aus personalpsychologischer Sicht gerechtfertigt ist.
1.2 Zu den Notwendigkeiten der Betrachtung „dunkler“ Persönlichkeitsmerkmale am Arbeitsplatz
Die aktuell verstärkte Hinwendung zu „dunklen“ Persönlichkeitseigenschaften in der Arbeits- und Organisationspsychologie entstammt meist dem Wunsch, Merkmale zu identifizieren, die dafür verantwortlich sind, dass Mitarbeiter auf dem Karriereweg „entgleisen“ – ein Risiko, welches von manchen Autoren für über die Hälfte aller Führungskräfte gesehen wird (Dalal & Nolan, 2009). Simonet, Tett, Foster, Angelback und Bartlett (2018) gehen auf Basis von Experteneinschätzungen davon aus, dass die Kosten für eine „entgleiste“ Führungskraft in die Millionen gehen können und diese damit nicht nur häufig, sondern auch kostspielig sind.
Bei De Fruyt, Wille und Furnham (2013) weisen über 20 % der getesteten Manager eine potenzielle Persönlichkeitsstörung auf. Die Autoren machen deutlich, dass sich jeder HR-Verantwortliche mit der Thematik beschäftigen sollte, da 15 % der Bevölkerung (hier der USA) im Verlauf ihres Lebens mindestens eine Persönlichkeitsstörung bzw. deren Symptome aufweisen, man also zwangsläufig mit betroffenen Mitarbeitern in Kontakt kommt. Daran zeigt sich auch, dass das Problem nicht nur Manager bzw. Personen in gehobenen Hierarchie-Leveln einer Organisation betrifft, im Gegenteil ist die „dunkle Seite“ der Persönlichkeit eines Menschen (vor allem, wenn man nicht nur klinische Störungen, sondern auch deren viel weiter verbreitete subklinische Formen in die Betrachtung einbezieht) auf allen Ebenen und in allen Wirtschaftsbereichen einer der wesentlichen Einflussfaktoren für deviantes Verhalten (vgl. dazu Abschnitt 2.2 und 4.1).
Auch wenn die Beschäftigung mit „dunklen“ Persönlichkeitseigenschaften sehr relevant und nicht neu ist, stößt sie erst in den letzten Jahren auf breites Interesse in der Arbeits- und Organisationspsychologie und den Managementwissenschaften (Harms & Spain, 2015), was zu zwei Sonderheften von Fachzeitschriften zu „dark personalities in the workplace“ geführt hat (Murphy, 2014; Stephan, 2015). Diese und eine Reihe von in den Folgejahren |12|erschienenen Arbeiten belegen, dass verschiedenste psychische Störungen und auch harmlosere Auffälligkeiten und sogar Überausprägungen eigentlich positiver Merkmale, wie Perfektionismus, zumeist negativ mit beruflicher Leistung verbunden sind (z. B. McCord, Joseph & Grijalva, 2014). Es werden aber auch positive Auswirkungen „dunkler“ Merkmale diskutiert (zumeist für ihren Träger), die jedoch nicht eindeutig sind und nicht für alle Eigenschaften und Berufe in gleicher Form gelten (z. B. Gaddis & Foster, 2015).
Zusammenfassend wird der potenzielle Mehrwert der Betrachtung der „dunklen Seite“ der Persönlichkeit erkannt, aber sehr deutlich auf den unklaren und widersprüchlichen Forschungsstand hingewiesen und gerade für praktische Anwendungszwecke in der Personalarbeit auf die erheblichen Einschränkungen und Risiken, die noch weitgehend ungeklärt sind und oftmals nicht bedacht werden. Jackson (2014) stellt für maladaptive Persönlichkeitseigenschaften allgemein fest, dass berufsbezogene Forschung angebracht ist, der Schritt hin zur Nutzung für tatsächliche Besetzungsentscheidungen jedoch Herausforderungen bereithält, die alles andere als trivial sind. Harms und Spain (2015) sehen „dunkle“ Eigenschaften zum Mainstream in der Forschung werden, während für die Anwendung der Merkmale in der Organisationspraxis ungeklärte Fragen bezüglich ihrer theoretischen Fundierung bestehen, in erster Linie auch solche, die die praktische Erfassung von „dunklen“ Persönlichkeitseigenschaften angehen.
Spain et al. (2014) weisen beispielsweise in ihrem Review darauf hin, dass die am weitesten verbreiteten Inventare zur Messung der Dunklen Triade aufgrund ihrer psychometrischen Qualität kritisiert und gerade hinsichtlich der Nutzung in angewandten beruflichen Kontexten praktische und sogar potenzielle rechtliche Probleme aufgeworfen worden sind. O’Boyle et al. (2012) sehen extreme Einschränkungen für die gängigerweise eingesetzten Maße, die sie speziell für die Personalauswahl als inadäquat bezeichnen, weshalb ihre eindeutige Empfehlung für die zukünftige Forschung zur Dunklen Triade, die laut ihnen von vielen Autoren geteilt wird, in ihrer besseren berufsbezogenen Messung liegt.
Dem großen Interesse an der Dunklen Triade und ihrem mutmaßlichen eignungsdiagnostischen Nutzen stehen damit ungeklärte Fragen gegenüber, die ihre tatsächliche Brauchbarkeit und Anwendbarkeit zu Zwecken praktischer Personalarbeit betreffen – in allererster Linie bezüglich der dafür einzusetzenden Messverfahren. In dem vorliegenden Buch sollen daher die angesprochenen Probleme thematisiert und Kenntnislücken bezüglich der Dunklen Triade in der Personalauswahl geschlossen werden. Aufgrund der großen Schäden, die mit diesen „dunklen“ Eigenschaften verbunden sind, und der Chancen, welche die Betrachtung der „dunklen Seite“ bietet, müssen jedoch noch viele weitere Anstrengungen geleistet werden – in Forschung wie Praxis –, um das Potenzial dieser Merkmalsgruppe voll auszuschöpfen und zu verhindern, dabei schwere Fehler im Umgang mit anderen Menschen, namentlich Bewerbern, zu begehen – also selbst durch nicht regelkonformes Verhalten auf die „dunkle Seite“ zu wechseln.
1.3 Aufbau des Buches
Wie im vorigen Abschnitt angesprochen, besteht weiterer Forschungsbedarf zu den berufsbezogenen Auswirkungen der Dunklen Triade der Persönlichkeit und einige Skepsis bezüglich ihrer praktischen Anwendbarkeit, namentlich dem Einsatz der gängigen Messmethodik zu Personalauswahlzwecken. Im vorliegenden Buch soll daher dargestellt werden, inwieweit die Dunkle Triade für operative Personalarbeit, in erster Linie in der Personal|13|auswahl, tatsächlich nutzbar ist. Hierfür werden Befunde aus der Literatur vorgestellt, anhand derer sich die grundsätzliche eignungsdiagnostische Brauchbarkeit von Narzissmus, Machiavellismus und subklinischer Psychopathie beurteilen lässt, und Rahmenbedingungen und Anforderungen für den praktischen Einsatz, speziell zur Personalauswahl, besprochen. Darauf aufbauend wird ein Testverfahren vorgestellt, das den Anforderungen bezüglich rechtlicher und fachlicher Vorgaben und der praktischen Anwendbarkeit im Zielfeld Organisation genügen soll. So wird, ähnlich der „grand migration“ (Furnham, Richards & Paulhus, 2013, S. 200) von klinischer zu subklinischer Sphäre, in diesem Text der Versuch einer „small migration“ der Dunklen Triade von der subklinischen zur Arbeitssphäre vorgenommen.
Die notwendigen Schritte dieser Wanderungsbewegung können in die beiden großen Blöcke Grundlagen und Praktische Anwendung sortiert werden; die Grundlagen umfassen dabei die Kapitel 1 bis 3, die praktische Anwendung die Kapitel 4 bis 6. Den Abschluss bildet mit Kapitel 7 ein Fazit mit Handlungsempfehlungen.
Nach der vorliegenden Einleitung werden in Kapitel 2 die Grundlagen für das Hauptthema – die Dunkle Triade der Persönlichkeit in der Personalauswahl – vorgestellt, es ist daher eher kurz und überblicksartig gehalten. Zunächst erfolgt in Abschnitt 2.1 eine Darstellung des derzeitigen Standes der Persönlichkeitsstrukturforschung und der in der Klinischen Psychologie entstandenen Schemata. Für ersteren wird vor allem auf die breit anerkannten Modelle Big Five und HEXACO eingegangen, bezüglich der Klinischen Psychologie in erster Linie auf die DSM-Systematik der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung (APA). Anschließend werden in Abschnitt 2.2 zentrale Befunde zu personalpsychologischen Anwendungsmöglichkeiten von allgemeinen Persönlichkeitsmerkmalen und gängige Konzeptualisierungen beruflichen Erfolgs und Misserfolgs vorgestellt. Der Abschnitt 2.3 beschäftigt sich darauf aufbauend mit dem Konzept der sogenannten „dunklen“ Persönlichkeitseigenschaften, dabei werden der Hintergrund für die wachsende berufsbezogene Beschäftigung mit diesem Ansatz sowie die Begriffsgenese und die unter dem Begriff gefassten Merkmale näher beschrieben. Zudem wird eine Abgrenzung zur DSM-Systematik vorgenommen und das neue alternative DSM-5-Modell für Persönlichkeitsstörungen vorgestellt.
Die Dunkle Triade der Persönlichkeit wird in den Kapiteln 3 und 4 besprochen. Abschnitt 3.1 gibt eine Einführung in die historische Entwicklung von und den aktuellen Forschungsstand zu der isolierten Betrachtung der Merkmale Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. In Abschnitt 3.2 werden ausgewählte (nicht-berufsbezogene) Befunde zu den Eigenschaften bezüglich der in der Forschung am stärksten beachteten Fragestellungen beschrieben, die eine Grundlage für das Verständnis der typischen Motivation und Verhaltensweisen von Dunkle-Triade-Merkmalsträgern geben sollen, welche auch für das berufsbezogene Verständnis dieser Merkmale von Bedeutung ist. In Abschnitt 3.3 erfolgt eine Gegenüberstellung von verschiedenen Auffassungen zu Struktur und typischen analytischen Methoden der Dunklen Triade und der forschungsmethodischen Kritik, die in den letzten Jahren besonders hinsichtlich dieser Aspekte formuliert wurde, sowie eine Abgrenzung der Triade-Bestandteile voneinander und die Darstellung ihrer jeweiligen Besonderheiten.
In Kapitel 4 werden nach einleitenden, allgemeinen Ausführungen zur Dunklen Triade im Berufsleben vielfältige Belege für ihre grundsätzliche eignungsdiagnostische Nützlichkeit vorgestellt. In Abschnitt 4.1 zunächst zu ihren Beziehungen mit kontraproduktiven Verhaltensweisen am Arbeitsplatz, in Abschnitt 4.2 zu ihren Zusammenhängen mit Kriterien beruflicher Leistung und beruflichen Erfolgs sowie (destruktivem) Führungsverhalten. Der |14|Abschnitt 4.3 bespricht weitere eignungsdiagnostische Anwendungsfelder der Dunklen Triade und berufsrelevante Korrelate, die für die praktische Personalarbeit und Berufsberatung von Interesse sind.
Kapitel 5 behandelt die fachlichen, rechtlichen und ethischen Voraussetzungen für eine operative Nutzung der Dunklen Triade. In Abschnitt 5.1 werden die verschiedenen bislang für die Dunkle Triade vorgeschlagenen Messansätze vorgestellt und bezüglich ihrer Qualität und Nutzbarkeit in der Personalpraxis evaluiert. Darauf aufbauend werden in Abschnitt 5.2 die Notwendigkeit eines berufsbezogenen Messverfahrens und die fachlich-rechtlichen Anforderungen besprochen, die für den Einsatz eines solchen in angewandten eignungsdiagnostischen Kontexten bestehen, und in Abschnitt 5.3 wird auf die Sicht der Bewerber und damit verbundene ethische Aspekte eingegangen.
Kapitel 6 gibt, als ein Beispiel für eine explizit berufsbezogene Nutzung der Dunklen Triade, einen Überblick über das Testverfahren Dark Triad of Personality at Work (TOP; Schwarzinger & Schuler, 2016), der in Abschnitt 6.1 zunächst die Zielsetzungen der Testentwicklung zusammenfasst sowie die Konstruktion der TOP von der Formulierung der Items über Itemanalysen und -reduktion bis hin zur faktoriellen Exploration des Itemmaterials beschreibt. In Abschnitt 6.2 werden Ergebnisse der Reliabilitäts- und Validitätsuntersuchungen bezüglich der Beziehungen der TOP zu externen Variablen, ihren Effekten auf Dritte sowie zu Maßen individueller und kollektiver Leistung und beruflichen Erfolgs berichtet. Zum Abschluss des Kapitels werden in Abschnitt 6.3 Fragen zum Praxiseinsatz der TOP besprochen, was die Statthaftigkeit ihrer Anwendung vor dem Hintergrund fachlich-formaler und rechtlicher Standards sowie die Akzeptanz der Testteilnehmer angeht.
In der gemeinsamen Betrachtung der theoretischen Arbeiten zu Inhalten und Struktur der Triade, ihrer Messmethodik und berufsbezogenen Befunden sowie den operativen Anwendungsvoraussetzungen rechtlicher und fachlicher Natur werden in Kapitel 7 ein abschließendes Fazit gezogen und praktische Anwendungsempfehlungen für die Nutzung der Dunklen Triade der Persönlichkeit in der sowohl empirisch forschenden (Abschnitt 7.1) als auch praktisch angewandten Berufseignungsdiagnostik (Abschnitt 7.2) gegeben.
|15|2 (Dunkle) Persönlichkeit, berufliche Leistung und beruflicher Erfolg
Bevor ab Kapitel 3 die Dunkle Triade der Persönlichkeit behandelt wird, soll zunächst ein Überblick über die verschiedenen Strömungen in der Frage, was die menschliche Persönlichkeit konkret ausmacht, über die „dunkle Seite“ der Persönlichkeit allgemein sowie die berufsbezogene Anwendung von „hellen“ und „dunklen“ Eigenschaften gegeben werden. Aufgrund der Breite und Tiefe dieser Forschungslinien kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Eine Übersicht, welche die zentralen allgemeinen Persönlichkeitsmerkmale sind und wie sie berufsbezogen wirken sowie über die Konzepte und Klassifikationen, die in der Klinischen Psychologie für die am häufigsten auftretenden Persönlichkeitsstörungen gewählt wurden, ist als Grundlage für das Verständnis der Struktur der Dunklen Triade, ihrer Verwandtschaftsbeziehungen und der für sie erbrachten berufsbezogenen Befunde gleichwohl bedeutsam.
Zudem werden verschiedene Konzeptualisierungen von beruflicher Leistung und beruflichem Erfolg vorgestellt, um den Kriterienraum zu definieren, an dem die eignungsdiagnostische Brauchbarkeit von Persönlichkeitseigenschaften allgemein und der Dunklen Triade im Speziellen beurteilt werden kann.
2.1 Von der Schädeldeutung zum Fünf-Faktoren-Modell und dem DSM-5
Die Beschäftigung mit der menschlichen Persönlichkeit kann auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurückblicken und hat dabei keine einzelne und eindeutige, einer naturwissenschaftlichen Theorie vergleichbare Systematik hervorgebracht, „ganz zu schweigen von einem Periodensystem der psychischen Elemente“ (Schuler, 2014a, S. 143). So ist es nicht verwunderlich, dass Persönlichkeit je nach Zeitalter und Sprachraum ganz unterschiedlich definiert wurde (Amelang & Bartussek, 1997). Von frühen Versuchen, sich den Unterschieden in Charaktereigenschaften von „außen“ – also vom Aussehen oder dem Verhalten her – zu nähern, beispielsweise Lerschs phänomenologische Persönlichkeitstheorie oder, bereits mit eignungsdiagnostischen Erwartungen verknüpft, Lavaters physiognomische Charakterdeutung (Schuler, 2014a), bis hin zu Untersuchungen von „innen“ durch moderne neurowissenschaftliche oder molekulargenetische Methoden (vgl. Asendorpf, 2009).
2.1.1 „Normale“ Persönlichkeit und Persönlichkeitsstörungen
Es existiert heute immer noch eine Vielzahl von Persönlichkeitstheorien nebeneinander, Asendorpf (2009) unterscheidet verschiedene Paradigmen, um diese zumindest in Gruppen zu gliedern. Innerhalb des Eigenschaftsparadigmas ging man in jüngerer Zeit dazu über, Persönlichkeit durch eine (empirische) Reduktion auf wenige, statistisch möglichst unabhängige Dimensionen bzw. Eigenschaften auszudifferenzieren und zu klassifizieren. So |16|herrscht derzeit weitgehende Einigkeit darüber, dass sich die menschliche Persönlichkeit im Normalbereich vollständig mit unterschiedlich starken Ausprägungen auf diesen – je nach Autor zwischen drei und sieben – breiten Dimensionen beschreiben lässt, die sowohl durch weniger Faktoren höherer Ordnung erklärt, als auch in jeweils zwei zentrale Aspekte und weiter aufgeschlüsselte Subfacetten gegliedert werden können (Guenole, 2014).
In einem solchen hierarchischen Modell wurden auch zwei Faktoren höherer Ordnung, mit alpha und beta (Digman, 1997) oder Stabilität und Plastizität (DeYoung, Peterson & Higgins, 2002) bezeichnet, sowie ein Generalfaktor der Persönlichkeit vorgeschlagen (z. B. Erdle & Rushton, 2010; Musek, 2007) und gleichzeitig die Nützlichkeit feiner aufgegliederter Faktoren gezeigt (z. B. DeYoung, Quilty & Peterson, 2007) – gerade für anwendungsbezogene Fragestellungen. Dieser Ansatz wird auch für die Beschäftigung mit der Dunklen Triade der Persönlichkeit weiter unten aufgegriffen. Mit bildgebenden oder molekulargenetischen Methoden können Annahmen des eigenschaftstheoretischen Ansatzes zunehmend bestätigt bzw. spezifische Unterschiede für Persönlichkeitsfaktoren in der Hirnanatomie gezeigt werden (z. B. DeYoung et al., 2010).
Die geschilderten Erkenntnisse beziehen sich auf den sogenannten „normalen“ Bereich der Persönlichkeit. Obwohl zwischen diesem und psychischen Störungen durchaus Zusammenhänge bestehen und letztere teilweise schlicht als extreme Ausprägungen menschlicher Charakterzüge gesehen werden (vgl. Moscoso & Salgado, 2004), sind in der Klinischen Psychologie davon quasi unabhängige Klassifikationsschemata entstanden. Dazu zählen das ursprünglich nur für die USA entwickelte, „nationale“ Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen, kurz DSM (aktuellste deutsche Fassung DSM-5; APA/Falkai et al., 2018), und die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, kurz ICD (aktuellste deutsche Fassung ICD-10-GM; DIMDI, 2019).
Die ICD ist wesentlich breiter auf Krankheiten allgemein angelegt, das DSM ausschließlich auf Krankheiten des Geistes, weshalb es auch mehr Störungsbilder und feiner aufgeschlüsselte diagnostische Kriterien abbilden kann. In der Arbeitsversion für die neue ICD-11 (WHO, 2019) werden in der Kategorie Persönlichkeitsstörungen (Code 6D10) lediglich allgemeine Merkmale der Gruppe genannt und einzelne DSM-Störungen sogar davon getrennt geführt (aber weder Narzissmus noch Psychopathie). In Abschnitt 3.1.1 des vorliegenden Bandes finden sich als Beispiel für ein Klassifikationsschema die diagnostischen Kriterien für die Narzisstische Persönlichkeitsstörung nach DSM-5. Eine Diagnose kann beispielsweise mithilfe des Strukturierten Klinischen Interviews für DSM-5-Störungen vorgenommen werden (SCID-5-PD; Beesdo-Baum, Zaudig & Wittchen, 2019). Nur Personen mit entsprechender Approbation wie Psychologische Psychotherapeuten oder psychotherapeutische Fachärzte (vgl. Psychotherapeutengesetz – PsychThG, hierzu insbesondere dessen aktuell im Gesetzgebungsprozess befindliche Neufassung für 2020) sind befugt, Persönlichkeitsstörungen offiziell zu diagnostizieren und zu behandeln.
DSM und ICD eint, im Gegensatz zur skizzierten dimensionalen Sicht des eigenschaftsorientierten Ansatzes, die Fokussierung auf durch bestimmte Symptome manifestierte typische Krankheitsbilder, d. h. ein kategoriales Modell psychischer Störungen. Klinischer und normaler Persönlichkeitsbereich sind aber nicht vollständig unabhängig voneinander, was sich in konzeptionellen Arbeiten z. B. zu den Big Five und DSM-Störungen (Widiger, Trull, Clarkin, Sanderson & Costa, 2002) und auch metaanalytisch bestätigten Korrelationsmustern für diese Bereiche (Samuel & Widiger, 2008a) sowie geteilten latenten Dimensionen beider Seiten und Vorschlägen zur gemeinsamen Fassung unter einem hierarchischen |17|Modell zeigt (Markon, Krueger & Watson, 2005). Die „phänomenologische Sicht“ bzw. kategoriale Sichtweise wird daher im klinischen Bereich zunehmend aufgebrochen bzw. ergänzt um eine dimensionale (z. B. Eaton, Krueger, South, Simms & Clark, 2011), weshalb in Teil III der neuesten, fünften Auflage des DSM auch ein Ansatz für eine dimensionale Konzeptualisierung von Persönlichkeitsstörungen aufgenommen wurde (die bisherigen Kategorien bleiben weiter im Hauptteil des DSM-5 bestehen).
Auf das DSM-5 und den dort neu enthaltenen dimensionalen Ansatz wird in Abschnitt 2.3.1 zu „dunklen“ Persönlichkeitseigenschaften näher eingegangen. Zunächst sollen in knapper Form der Stand der Forschung zur „normalen“ Persönlichkeit und in Abschnitt 2.2 deren Anwendungsmöglichkeiten in der Personalpsychologie vorgestellt werden.
2.1.2 Die Big Five und das Fehlen „dunkler“ Faktoren
Heutzutage als Referenzrahmen allgemein anerkannt ist das sogenannte Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit (FFM) von Costa und McCrae (1985) mit den fünf breiten, bipolaren Dimensionen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Für dieses Modell bzw. seine Bestandteile wird auch das Synonym Big Five verwendet (Goldberg, 1993). Die Entwicklung des Fünf-Faktoren-Modells wird im Folgenden etwas ausführlicher referiert, da in ihr ein möglicher Hauptgrund für die lange Nichtbeachtung „dunkler“ Eigenschaften zu finden ist. Denn es drängt sich natürlich die Frage auf, warum die „dunklen“ Eigenschaften nicht Teil der klassischen, breiten Persönlichkeitsmodelle wie der Big Five sind.
Bereits 1933 wurde von Thurstone erstmals über ein Fünf-Faktoren-Modell berichtet, auch andere namhafte Autoren wie Cattell oder die Guilfords fanden Lösungen, die den heutigen Big Five ähneln (Digman, 1996). Einen Meilenstein in der Persönlichkeitsstrukturforschung markierte der lexikalische Ansatz von Allport und Odbert (1936), aus einem Wörterbuch Persönlichkeitsbeschreibungen zu extrahieren. Cattell (1947) ermittelte auf dieser Basis zunächst 35 Trait-Cluster, die Fiske (1949) auf fünf Faktoren reduzierte (Wiggins & Trapnell, 1997). Tupes und Christal (1958, 1961) extrahierten aus den Cattell’schen Variablen-Clustern „eine klare, generalisierbare Fünf-Faktoren-Lösung, welche sie als Begeisterungsfähigkeit/Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Emotionale Stabilität und Kultur identifizierten“ (Wiggins & Trapnell, 1997, S. 741), weshalb sie als die „wahren Väter“ der Big Five (Goldberg, 1993, S. 27) bezeichnet werden. Daraufhin kam es in den späten 1980er und den 1990er Jahren zum „Beinahe-Konsens über die Anzahl und Natur der Basisdimensionen der Persönlichkeitsunterschiede“ (Lee & Ashton, 2006, S. 182) und durch die Verbreitung des ersten Inventars, das auf den fünf Faktoren beruhte, zur „Hegemonialstellung“ (Schuler & Höft, 2006, S. 117) des Fünf-Faktoren-Modells.
Doch warum sind in diesem elaborierten Modell keine „dunklen“ Eigenschaften enthalten? Spain et al. (2014) führen das auf ein Fehlen „dunkler“ Persönlichkeitsaspekte im lexikalischen Ansatz zurück. So wurden laut Tellegen (1993) beispielsweise bewertende Beschreibungen, wie „böse“, aus der grundlegenden Adjektivliste von Allport und Odbert (1936) entfernt, die später faktorenanalytisch zu den Big Five verdichtet wurde (siehe dazu auch Saucier, 2019). Dass bestimmte „negative“ Aspekte fehlen, zeigt sich daran, dass eine Aufnahme entsprechender Adjektive in unabhängige lexikalische Studien nicht etwa nur neue Extremaspekte bestehender Faktoren erbrachte, sondern zu ganz neuen geführt hat, |18|die in eben diese Richtung weisen (vgl. HEXACO, Ashton & Lee, 2008; Big-7, Waller & Zavala, 1993).
Von den weiteren diskutierten Modellen soll in knapper Form nur auf das von Ashton und Lee (2008) näher eingegangen werden (siehe Kasten): Hier konnte durch neue lexikalische Analysen (von sieben europäischen und asiatischen Sprachen sowie in weiteren Sprachfamilien unterschiedlicher Herkunft) ein Faktor gefunden werden, der zentrale Aspekte „dunkler“ Persönlichkeitseigenschaften umfasst.
HEXACO-Modell
Im HEXACO-Modell der Persönlichkeitsstruktur finden sich als sechs Hauptdimensionen der Persönlichkeit der neue Faktor Honesty-Humility (Ehrlichkeit-Bescheidenheit), daneben Emotionality (Emotionalität), Extraversion (Extraversion), Agreeableness (Verträglichkeit), Conscientiousness (Gewissenhaftigkeit) und Openness to Experience (Offenheit für Erfahrung).
Emotionalität und Verträglichkeit sind keine direkten Entsprechungen der FFM-Faktoren, sondern lediglich deren rotierte Varianten; die Faktoren Extraversion, Gewissenhaftigkeit und Offenheit für Erfahrung des HEXACO-Modells sind hingegen denen des Fünf-Faktoren-Modells sehr ähnlich (Lee & Ashton, 2006). Obwohl das Modell somit nicht einfach ein „Big Five plus eins“ darstellt, ist sein zentraler Beitrag der neue Faktor Ehrlichkeit-Bescheidenheit oder „H-Faktor“. Vereinfacht gesprochen, stellt dieser sechste Faktor eine Art Gegenteil der Wesenszüge dar, die häufig mit der Dunklen Triade einhergehen oder unter dieser subsumiert werden, weshalb Paulhus (2014) geringe Ausprägungen auf dem „H-Faktor“ als einen gemeinsamen Kern der Dunklen Triade sieht (vgl. Abschnitt 3.3).
Der Inhalt des neuen Faktors und sein Zusatznutzen zu den Big Five wird von Lee, Ashton und de Vries (2005, S. 182) untersucht und wie folgt beschrieben: „[Ehrlichkeit-Bescheidenheit] repräsentiert individuelle Unterschiede in der Abneigung versus dem Willen, andere auszubeuten, eine Tendenz, die von keinem der Big-Five-Faktoren adäquat erfasst werden kann.“ Gerade diese Neigung, andere für den eigenen Vorteil auszunutzen, ist, wie weiter unten erörtert wird, demgegenüber ein Hauptmerkmal der Dunklen Triade. Weitere Befunde zum Zusammenhang des „H-Faktors“ und allgemein der vorgestellten Persönlichkeitsmodelle mit der Dunklen Triade finden sich in Kapitel 3, zuvor wird im nächsten Abschnitt auf Kriterien beruflichen Erfolgs und ihre Zusammenhänge mit „hellen“ Persönlichkeitsmerkmalen eingegangen.
2.2 Prognose beruflicher Leistung mit Persönlichkeitsmerkmalen
An dieser Stelle sollen zunächst gängige Operationalisierungen beruflicher Leistung und beruflichen Erfolgs vorgestellt werden – nicht zuletzt, da die Zusammenhänge der Dunklen Triade mit diesen Kriterien die Rechtfertigung dafür darstellen, Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie eignungsdiagnostisch zu nutzen. Anschließend werden Befunde zur Validität von allgemeinen Persönlichkeitsfaktoren für die Vorhersage dieser Kriterien besprochen.
|19|2.2.1 Berufliche Leistung und beruflicher Erfolg
Berufliche Leistung ist eines der am meisten erforschten Kriterien der Arbeits- und Organisationspsychologie, was sich in der Anzahl publizierter Artikel widerspiegelt (Cascio & Aguinis, 2008). Sie kann als mehrdimensionales Konzept verstanden werden, das den Gesamtbeitrag einer Person zu „organisationalem Erfolg“ umfasst (Motowidlo, 2003). Daran wird ersichtlich, dass es nicht „die eine“ berufliche Leistung gibt, sondern sie ein Konstrukt ist, welches aus vielen, miteinander verbundenen Teilaspekten in einer längerfristigen Betrachtungsperspektive besteht, die alle zur Gesamtleistung beitragen, und denen ein übergeordneter Faktor zugrunde liegt (Lohaus & Schuler, 2014; Viswesvaran, Schmidt & Ones, 2005). Versuche, sie zu messen, können daher jeweils nur einzelne Ausschnitte der Gesamtleistung erfassen, womit Leistungskriterien defizient sind, also relevante Teile der Leistung nicht erfassen, und kontaminiert, da sie Einflüssen ausgesetzt sind, die nicht auf die eigentliche Leistung der Person zurückgehen (Lohaus & Schuler, 2014).
Von faktischer Leistung abzugrenzen ist beruflicher Erfolg, dessen Kennzeichen gerade nicht der Beitrag zum Erfolg der Organisation, sondern das individuelle Ergebnis (über den konkreten Arbeitsplatz hinaus) ist – gerade bei „dunklen“ Persönlichkeitseigenschaften scheinen differenzielle Beziehungen zu diesen beiden Kriterien möglich. Zur Messung von Erfolg werden häufig objektive Maße wie Gehalt, Gehaltssteigerungen oder Beförderungen als Kriterien herangezogen (Henslin, 2005). Auch diese sind defizient, unter anderem da sich in vielen Berufen und für viele Personen Erfolg nicht valide in monetären Maßen oder nach klassischen Hierarchien bemessen lässt. Zudem kann Erfolg im Beruf auch im Sinnerleben durch die Tätigkeit bestehen, der eigenen Zufriedenheit damit, dem Gefühl der persönlichen Passung zum Arbeitsplatz und der Organisation oder der konkreten Tätigkeit zu den eigenen Interessen (Schuler, 2014a).
Obwohl in der Forschung meist auf die Beziehung von verschiedenen Prädiktoren zu beruflicher Leistung fokussiert wird, werden auch subjektive Erfolgsmaße wie Arbeitszufriedenheit oder Karrierezufriedenheit betrachtet. Beide Bereiche weisen gegenseitige Abhängigkeiten auf, sollten aber als eigenständige Konstrukte aufgefasst bzw. gemessen werden (Henslin, 2005). Neben Arbeitszufriedenheit ist (organisationales) Commitment eine zweite wichtige Variable, die Werthaltungen bezüglich der Arbeit beschreibt. Die eine erfasst subjektives Empfinden der eigenen Aufgabe oder des Arbeitsplatzes, die andere solches gegenüber der Organisation (Sanecka, 2013) – beide stellen somit Indikatoren einer als erfolgreich erlebten beruflichen Platzierung oder Entwicklung dar. Auf verschiedene Formen der Messung objektiven und subjektiven Erfolgs und beruflicher Leistung wird zum Ende des vorliegenden Abschnitts noch einmal eingegangen, zuerst werden die wichtigsten Teilbereiche des letztgenannten Kriteriums vorgestellt.
Eine weit verbreitete Ausdifferenzierung beruflicher Leistung ist die klassische von Borman und Motowidlo (1993) in aufgabenbezogene (task performance) und umfeldbezogene Leistung (contextual performance). Aufgabenbezogene Leistung umfasst die klar beschreibbare bzw. geforderte Leistung an einem Arbeitsplatz, die umfeldbezogene Leistung solche Beiträge für Kollegen, Teams oder die Organisation, die oft nicht formalisiert gefordert sind, also freiwillig erfolgen und nicht der eigentlichen Tätigkeitserfüllung dienen. Ein eng verwandtes bzw. sehr ähnliches und oft als Synonym herangezogenes Konzept stellt Organizational Citizenship Behavior dar (OCB; Smith, Organ & Near, 1983). Hier wurde schon früh unterschieden in Verhaltensweisen, die auf Individuen bezogen sind, |20|wie einem Kollegen zu helfen, und organisationsbezogenen, etwa positiv über die Firma zu sprechen (Sackett, Berry, Wiemann & Laczo, 2006).
Aufgaben- und umfeldbezogene Leistung haben einen hohen, metaanalytisch generalisierbaren Zusammenhang und können, wie beschrieben, als Bestandteile des Konstrukts allgemeiner beruflicher Leistung verstanden werden. Allerdings müssen sie zumindest an den Randbereichen auch unabhängig betrachtet werden. So besteht ein kurvilinearer Effekt dergestalt, dass zu starkes Engagement für andere (ab etwa einer halben Standardabweichung über dem Durchschnitt) zu sinkender eigener aufgabenbezogener Leistung führt (Rubin, Dierdorff & Bachrach, 2013).
Kontraproduktives Verhalten am Arbeitsplatz
Ein Konzept, das nicht zu beruflicher Leistung im eigentlichen Sinn gezählt werden kann, sondern im Gegenteil Verhaltensweisen beschreibt, die den organisationalen Gesamtwertbeitrag einer Person entscheidend verringern oder gar ins Negative kehren, sind kontraproduktive Verhaltensweisen am Arbeitsplatz (Counterproductive Work Behavior; CWB). Dies sind alle absichtlichen Handlungen, die prinzipiell geeignet sind, einen Schaden für die Organisation oder eines ihrer Mitglieder zu verursachen (Marcus & Schuler, 2004; Nerdinger, 2008). Zwar spielen auch hier situationale Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen eine Rolle, zentral für die Wahrscheinlichkeit, kontraproduktive Verhaltensweisen zu zeigen, ist jedoch die Persönlichkeit eines Mitarbeiters – theoretisch erklärbar mit spezifischen Big-Five-Profilen, geringer Integrität oder mangelnder Selbstkontrolle (Marcus, 2000).
Der letztgenannte Erklärungsansatz für kontraproduktives Verhalten stellt eine mögliche Verbindung zur Dunklen Triade dar, da auch sie mit mangelnder Selbstkontrolle bzw. Impulsivität verbunden wird (vgl. Abschnitt 3.2.5). Geringe Selbstkontrolle wurde von Gottfredson und Hirschi (1990) als Ursache für kriminelle Handlungen im Allgemeinen postuliert und gilt als ein Treiber für kontraproduktives Verhalten (Mussel, 2003). Ein Mangel an Selbstkontrolle wurde als erste explizit theoretische Erklärung für das Phänomen CWB vorgeschlagen, und es konnte empirisch bestätigt werden, dass der Einfluss dieser in der Person liegenden Variablen größer ist als der der situativen Rahmenbedingungen (Marcus & Schuler, 2004).
Bennett und Robinson (2000) belegen die große Relevanz von CWB für Unternehmen anhand einer Zusammenstellung von Studien, die hohe Zahlen von Mitarbeiterdiebstahl, Absentismus, Drogenmissbrauch und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zeigen. Abgesehen von den entstehenden individuellen Konsequenzen für die Opfer erleiden Unternehmen bzw. die Volkswirtschaft durch jeden einzelnen der genannten Bereiche kontraproduktiver Verhaltensweisen von Mitarbeitern jährlich Milliardenschäden in zweistelliger Höhe (Marcus, 2000).
Ähnlich wie bei beruflicher Leistung wird auch für CWB ein zugrundeliegender Faktor angenommen, der sich in verschiedene Ziele bzw. Opfer oder Arten von Vergehen aufteilen lässt (Marcus, Schuler, Quell & Hümpfner, 2002; Sackett, 2002). Bekannte Konzeptualisierungen sind die Teilung in individuumsbezogene und organisationsbezogene kontraproduktive Verhaltensweisen (Bennett & Robinson, 2000) und ein umfassendes Modell von Gruys und Sackett (2003), das 250 CWB-Items aus der Literatur zu 66 einzelnen Verhaltensweisen auf elf Facetten verdichtet.
|21|Strukturell sehen manche Autoren mehr Evidenz für hierarchische Strukturen aus einem Generalfaktor mit zwei darunter liegenden Faktoren oder mehreren Facetten, andere sprechen sich für die Eindimensionalität des Merkmals aus – in jedem Fall aber belegen metaanalytische Befunde hohe Zusammenhänge bei gleichzeitiger Sinnhaftigkeit der separaten Betrachtung der Merkmale (Berry, Ones & Sackett, 2007; Dalal, 2005). Marcus, Taylor, Hastings, Sturm und Weigelt (2016) verglichen verschiedene Auffassungen. Die beste Passung lieferte ein bimodales Modell, in dem die CWBs simultan auf den elf inhaltlichen Skalen und einem der drei „Ziele“ Organisation, andere Person oder eigene Person laden.
OCB und CWB sind negativ verbunden, beide aber eigenständige Konzepte und nicht Pole eines Kontinuums, was an strukturellen Analysen, bivariaten Zusammenhängen und Beziehungen zu Außenkriterien festgemacht werden kann (Sackett et al., 2006). Verschiedene Autoren haben daher vorgeschlagen, zumindest drei Bereiche beruflicher Leistung voneinander abzugrenzen – aufgabenbezogene Leistung, OCB und CWB (z. B. Dalal, 2005). Für diese Kriterien beruflicher Leistung und auch für beruflichen Erfolg bieten sich mehrere Messmethoden an, die jeweils spezifische Vorteile und Einschränkungen aufweisen und Lohaus und Schuler (2014) folgend im Kasten vorgestellt werden.
Ansätze zur Erfassung der Kriterien nach Lohaus und Schuler (2014)
Objektive Daten haben den Vorteil der klaren Definition und Messbarkeit sowie geringer Verfälschbarkeit. Allerdings sind sie in den meisten Fällen stark defizient, da viel zu enge Ausschnitte einer Tätigkeit erfasst werden, oder kontaminiert, wenn sie zu breit operationalisiert sind und viele äußere Einflüsse das Leistungskriterium bedingen.
Mit subjektiven Leistungseinschätzungen kann der Kriteriumsdefizienz durch parallele Berücksichtigung eines breiteren Spektrums an und der Integration von nicht objektiv beobachtbaren Aspekten begegnet werden. Sie unterliegen jedoch potenziell stärker Urteilsverzerrungen oder bewusstem Antwortverhalten.
Trotzdem gelten subjektive Einschätzungen durch die Vorgesetzten – als klassische Form der Leistungsbeurteilung – als die Methode der Wahl in der Forschung zu beruflicher Leistung.
Auch Fremdeinschätzungen durch Kollegen oder geführte Mitarbeiter bieten sich an, insbesondere wenn die Leistungskriterien – etwa „Führungsverhalten“ – nur von diesen eingeschätzt werden können.
Zudem sind Selbsteinschätzungen möglich, da die Beurteiler hier den umfassendsten und einen zeitlich überdauernden Zugang zum Kriterium besitzen. Je nach Zweck weisen sie jedoch von allen subjektiven Methoden die höchste Urteilsverzerrung auf. Trotzdem wird gerade kontraproduktives Verhalten fast immer durch Selbsteinschätzungen erfasst, da viele Vergehen erst gar nicht entdeckt werden bzw. niemandem anderen bekannt sind oder werden sollen (zum „Faking“ von Selbsteinschätzungen vgl. auch Abschnitt 5.1.1).
Es sollten daher möglichst vielfältige Maße und Methoden verwendet werden, um sich den hypothetischen Konstrukten Leistung und Erfolg anzunähern (Lohaus & Schuler, 2014).
In Kapitel 4 werden Zusammenhänge der Dunklen Triade mit aufgaben- und umfeldbezogenen Kriterien beruflicher Leistung, OCB und CWB sowie verschiedenen Kriterien objektiven und subjektiven Erfolgs berichtet, die mit Selbst- und Fremdeinschätzungen sowie |22|objektiven Maßen erfasst wurden. Auch das in Kapitel 6 vorgestellte berufsbezogene Verfahren für die Dunkle Triade wurde hinsichtlich aller genannten Kriterien und Messansätze validiert. Nachfolgend wird als Grundlage für diese Betrachtungen ein Überblick über Prognosemöglichkeiten beruflicher Leistung mit „hellen“ Persönlichkeitsmerkmalen gegeben.
2.2.2 Berufliche Eignungsdiagnostik mit Persönlichkeitsmerkmalen
Wie in Abschnitt 2.1 erwähnt, sind schon früh Versuche unternommen worden, Zusammenhänge von verschiedenen differenziellen Persönlichkeitsmerkmalen mit berufsbezogenen Verhaltensweisen oder Auswirkungen zu finden. So wurde beispielsweise eine der entscheidenden Untersuchungen, die zur Entwicklung der Big Five beigetragen hat, in den amerikanischen Streitkräften mit eignungsdiagnostischem Zweck durchgeführt (vgl. Tupes & Christal, 1958, 1961). Sackett, Lievens, Van Iddekinge und Kuncel (2017) beschreiben individuelle Unterschiede (und ihre berufsbezogene Anwendung, speziell zur Personalauswahl) als eines der zentralen und praktisch bedeutsamsten Themen der angewandten Psychologie der letzten 100 Jahre. Eines der Hauptfelder waren dabei individuelle Unterschiede in der Persönlichkeit – verstanden als stabile Merkmale, die Personen beispielsweise zur Arbeit „mitbringen“.
Die Bewertung der Anwendung von Persönlichkeit für berufsbezogene Fragestellungen gleicht laut Sackett et al. (2017) allerdings einer „Achterbahn“, die von vier Phasen gekennzeichnet ist: Nach der Entdeckung ihrer grundsätzlichen Nützlichkeit erfolgte von 1917 bis in die 1960er Jahre eine Phase zunehmender Nachweise berufsbezogener Korrelate der Persönlichkeit. Nachdem Guion und Gottier (1965) und Mischel (1968) den Nutzen von Persönlichkeitstests für eignungsdiagnostische Fragestellungen in Abrede stellten, kam es in der Folge zu einem Einbruch der diesbezüglichen Forschung. Erst ab 1991 fand eine Wiederbelebung durch konzeptionelle und methodische Entwicklungen statt, insbesondere die der Metaanalyse, durch die der Nutzen von Persönlichkeit für die Prognose beruflicher Kriterien belegt werden konnte. Die Gegenwart seit 2004 ist von einer kritischen Betrachtung und Verfeinerung des Kenntnisstands geprägt. Dies betrifft theoretisch-konzeptionelle Fragen, die Messmethodik, Urteilsquellen und prognostische Validität, zum Teil auch neue Faktoren, wie den „H-Faktor“ des HEXACO-Modells, aber auch die erste Hinwendung zu maladaptiven Aspekten wie der Dunklen Triade.
So vielfältig sie sind, haben fast alle bei Sackett et al. (2017) als gegenwärtig relevant eingestuften Themen eines gemein – sie beziehen sich auf das Referenzmodell FFM. Daher wird im Folgenden die Validität von Persönlichkeit für die Vorhersage beruflicher Leistung stellvertretend anhand des FFM vorgestellt, und dieses Modell wird auch im Kapitel zur Dunklen Triade als Bezugsrahmen verwendet (gemeinsam mit dem HEXACO-Modell).
Entsprechend der gezeigten Entwicklungslinie kann für die berufsbezogene Anwendung von Persönlichkeitsfaktoren nach „anfänglich regem Einsatz … ab 1973 ein nachlassendes Interesse“ konstatiert werden (Schuler & Höft, 2006, S. 119). Die Metaanalyse von Barrick und Mount (1991) und auf diese folgend eine Metaanalyse zweiter Ordnung (Barrick, Mount & Judge, 2001) generalisierte die Validität des Faktors Gewissenhaftigkeit, der die höchste kriterienbezogene Validität über alle Kriterien und Berufsgruppen aufweist. Es wurden eine Reihe weiterer relevanter Zusammenhänge gefunden, beispielsweise für Neurotizismus, jedoch nicht für alle Faktoren generelle Validität über alle Kriterien und Berufsgruppen hin|23|weg (Schuler & Höft, 2006). Mehrere aktuelle Metaanalysen kommen zu ähnlichen Ergebnissen, weshalb Pelt, van der Linden, Dunkel und Born (2017) die Zusammenstellung von Barrick et al. (2001) als weiterhin gültige und gute Einschätzung der prognostischen Validität von Persönlichkeitsfaktoren bezeichnen.
Daneben wurden Faktoren über den Big Five (etwa der Generalfaktor der Persönlichkeit) und deren darunterliegende Facettenebene untersucht, wobei der übergeordnete Generalfaktor und einzelne Facetten zum Teil höhere Zusammenhänge zu beruflicher Leistung aufweisen als einzelne Big-Five-Dimensionen. In einem Vergleich dreier hierarchischer Ebenen von Persönlichkeit – Facetten, Globalfaktoren und Generalfaktor – durch Sitser, van der Linden und Born (2013) wies der Generalfaktor die höchsten und konsistentesten Beziehungen zu Leistungskriterien auf, auch metaanalytisch konnte für diesen höhere Vorhersagekraft als für einen einzelnen Big-Five-Faktor nachgewiesen werden (Pelt et al., 2017). Neben allgemeiner beruflicher Leistung wurde den Big Five für weitere berufliche Leistungs- und Empfindenskriterien prognostische Validität bescheinigt, sie wurden allerdings auch als zu breit kritisiert, spezifisches berufliches Verhalten vorherzusagen – hierbei werden Fragestellungen wie Moderationseffekte, die Kriteriumsabhängigkeit oder die Vorteile spezifischer Persönlichkeitseigenschaften diskutiert (vgl. Schuler, Höft & Hell, 2014).
Zusammenfassend haben sich sowohl feine Abstufungen als auch breite Faktoren als nützliche Prädiktoren menschlicher Verhaltensweisen erwiesen. Welches Abstraktionsniveau nun für personalpsychologische Zwecke am geeignetsten erscheint, ist abhängig vom interessierenden Kriterium, was ganz allgemein unter dem Begriff Bandwith-Fidelity-Dilemma (Cronbach, 1990) diskutiert wird. Es beschreibt die Abwägung zwischen einer hohen Bandbreite für eine möglichst umfassende, breite Prognose beruflicher Leistung gegenüber einer sehr feinen, akkuraten Messung zur Vorhersage spezifischer Aspekte. Pelt et al. (2017) fassen die Befunde zu dieser Fragestellung zusammen. Demnach sind breite Konstrukte generell zu bevorzugen, besonders bei der Vorhersage breiter Ergebnisvariablen wie der beruflichen Leistung, lediglich sehr spezifische Aspekte können besser durch enge Facetten prognostiziert werden. Idealerweise sind Prädiktor und Kriterium aufeinander abgestimmt. Entsprechend der Symmetriehypothese (Cronbach & Gleser, 1965) wurde im Grundsatz schon von Paunonen (1998) für größtmögliche Vorhersagegüte eine Äquivalenz der Breite von Prädiktor und Kriterium vorgeschlagen – also grobe Faktoren für allgemeine, breite und feiner abgestufte Faktoren für spezifische, enge Kriterien.
Compound Traits
Einen von der Abstraktionsebene abweichenden Ansatz, der ebenfalls das Ziel hoher prognostischer Validität verfolgt, stellt die Kombination verschiedener inhaltlicher Bereiche dar, die bestmöglich an das Kriterium angepasst sind. Solche mit dem Ziel möglichst hoher Vorhersagegüte entwickelte Skalen sind Criterion-Focused Occupational Personality Scales, kurz COPS. Diese stellen Mischungen von verschiedenen abgrenzbaren Eigenschaften dar, sogenannte Compound Traits, die am Arbeitsplatz relevant sind, und sie wurden speziell für die Nutzung in diesem Kontext entwickelt (Ones & Viswesvaran, 2001). Im Anwendungsfall haben COPS überragende Eignung gegenüber klar abgrenzbaren Faktoren, wie etwa den Big Five, für die Prognose von beruflicher Leistung gezeigt (Ones & Viswesvaran, 2001).
Ein Paradebeispiel für COPS sind Integritätstests: meist Fragebogen, die in der Personalauswahl eingesetzt werden, um Personen zu identifizieren, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit |24|aufweisen, kontraproduktive Verhaltensweisen wie Diebstahl oder Substanzkonsum am Arbeitsplatz zu begehen. Der Begriff Integrität wurde erst seit den 1980er Jahren für diese Klasse durchaus heterogener Instrumente geprägt, die seit den 1920er Jahren praktisch genutzt werden (Sackett & Wanek, 1996). Es handelt sich bei Integrität damit um kein abgrenzbares Persönlichkeitsmerkmal und den Tests liegt keine explizite Theorie zugrunde, erst in jüngerer Zeit kommt es zu intensiverer Beschäftigung in dieser Hinsicht (Berry, Sackett & Wiemann, 2007). Die Metaanalyse von Ones et al. (1993) weist Integritätstests generelle Validität bei der Prognose beruflicher Leistung über verschiedene Kriterien, Prädiktoren und Berufsgruppen hinweg und für die Vorhersage kontraproduktiver Verhaltensweisen zu. Schmidt und Hunter (1998) zeigen für Integritätstestergebnisse die höchste inkrementelle Validität zu Intelligenz bei der Prognose beruflichen Erfolgs, weil sie mit kognitiver Leistungsfähigkeit (im Vergleich etwa zu Arbeitsproben) nicht korreliert sind. Neuere Metaanalysen (z. B. Van Iddekinge, Roth, Raymark & Odle-Dusseau, 2012) bestätigen die grundsätzliche Validität, kommen aber zu deutlich geringeren Werten. Vor allem aufgrund des meist proprietären Datenmaterials der Analysen (Integritätstests werden fast ausschließlich kommerziell vertrieben) sind die Ergebnisse nicht zu vergleichen; die tatsächliche Höhe ist damit unklar, die grundsätzliche Validität von Integritätstests bleibt jedoch unbestritten (Sackett et al., 2017).





























