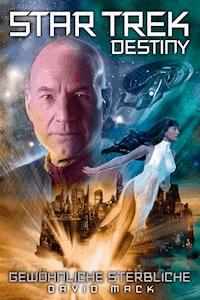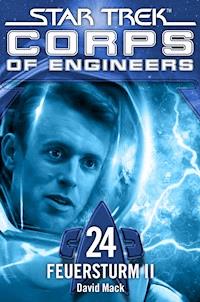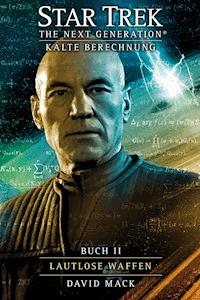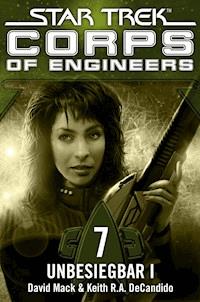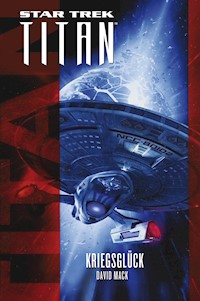Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In "Die Schatten-Kommision", der weltumspannenden Fantasy-Fortsetzung von "Der eiserne Kodex" des New-York-Times-Bestsellerautors David Mack, müssen die Magier des Kalten Krieges eine Geheimorganisation aufdecken, die für das Kennedy-Attentat verantwortlich ist. November 1963. Cade und Anja haben ein Jahrzehnt lang im Verborgenen gelebt und neue Magier ausgebildet. Dann löst die Ermordung von Präsident Kennedy eine Mordserie aus, deren Opfer allesamt Magier sind – mit Cade, Anja und ihren Verbündeten als Hauptziel. Ihre einzige Hoffnung zu überleben: zu lernen, wie man sich gegen die finstere Geheimorganisation, bekannt als die Schattenkommission, wehrt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
DUNKLE KÜNSTE 3
DIE SCHATTENKOMMISSION
DAVID MACK
Ins Deutsche übersetzt von
CLAUDIA KERN& HELGA PARMITER
Die deutsche Ausgabe von DUNKLE KÜNSTE 3: DIE SCHATTENKOMMISSIONwird herausgegeben von Cross Cult, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg.Herausgeber: Andreas Mergenthaler, Übersetzung: Claudia Kern & Helga Parmiter;verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde; Lektorat: Jana Karsch;Korrektorat: Peter Schild; Satz: Rowan Rüster; Cover-Illustration: Larry Rostant;Printausgabe gedruckt von CP, 25917 Leck. Printed in the EU.
Titel der Originalausgabe:
DARK ARTS 3: THE SHADOW COMMISSION
Copyright © 2019 by David Mack
Published by arrangement with Tom Doherty Associates. All rights reserved
Dieses Werk wurde im Auftrag von Tom Doherty Associates durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.
German translation copyright © 2022, by Cross Cult.
Print ISBN 978-3-96658-916-1 (Oktober 2022)
E-Book ISBN 978-3-96658-917-8 (Oktober 2022)
WWW.CROSS-CULT.DE
Für all die unbesungenen Helden
Sternenlicht, schau meine schwarzen, tiefen Wünsche nicht;Sieh, Auge, nicht die Hand, doch lass geschehen,Was, wenns geschah, das Auge scheut zu sehen.
– William Shakespeare, Macbeth, Erster Akt, Vierte Szene
Inhalt
1963
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
1964
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
GLOSSAR
DIE HIERARCHIE DER HÖLLE
DANKSAGUNG
1963
FREITAG, 22. NOVEMBER
Bruder Tenzin erklomm verfolgt vom Gestank der Dämonen die unebene Steintreppe. Der buddhistische Mönch lebte bereits seit zwanzig Jahren in Key Gompa, weshalb die süße Luft, die vom Himalaya über den Spiti-Fluss bis zu dem Kloster geweht wurde, für ihn selbstverständlich geworden war. Durch die reine Atmosphäre des Tempels wirkte eine Manifestation des Bösen innerhalb seiner heiligen Hallen umso widerlicher, wie Kadaver, die auf einem Lavendelfeld verwesten.
Er blieb am Ende der Treppe stehen, um sich den Schweiß von seinem rasierten Kopf zu wischen und sich die Hände an seiner orangeroten Kutte abzutrocknen. Ein tiefer Atemzug verlangsamte seinen Puls – und verriet ihm, dass die kühle Morgenluft noch immer von den Ausdünstungen der Dämonen verpestet wurde. Der üble Geruch war in den Minuten, die er gebraucht hatte, um zur Behausung des ältesten Bewohners des Tempels zu gelangen, sogar noch stärker geworden.
Tenzin näherte sich der Unterkunft des Meisters. Als er die Hand hob, um anzuklopfen, schwang die Tür lautlos vor ihm auf.
»Komm rein, Tenzin«, sagte der Uralte.
Tenzin trat ein. Im Gegensatz zu den meisten Zimmern des Tempels war dieses vollgestopft mit Büchern, Schriftrollen und zahlreichen Behältern unterschiedlicher Größe. Einige bestanden aus Kupfer, andere aus Messing, einige wenige aus Kristall. Ein großes, in Leder gebundenes Grimoire lag aufgeschlagen auf der Schlafmatte in der Ecke. In der Mitte des Raums stand Meister Khalîl el-Sahir. Er band gerade sein dunkelgraues Gewand zu. »Riechst du sie?«
»Jede Seele in diesem Tempel riecht sie.«
»Zweifellos. Wo ist mein Zauberstab?« Der Magicker mit dem weißen Bart wirbelte nach links herum, dann nach rechts. »Aha!« Er zog den handgeschnitzten Stab aus Ebenholz unter einem Stapel Schriftrollen hervor. »Was sagen die Sterne?«
»Sie sind erfüllt von bösen Omen.«
»Wie immer.« Er wickelte den Zauberstab in ein rotes Seidenband ein und steckte ihn sich in den Gürtel. »Komm mit.« Er schritt zur Tür. »Zum Dach.«
Tenzin folgte seinem alten Freund gehorsam, aber auch besorgt. »Halten Sie das für klug, Meister Khalîl? Wenn der Feind Schritte gegen uns unternimmt …«
»Wird er das gut sichtbar tun.« Khalîl ging schneller. Obwohl der Meister-Karcist über fünfhundert Jahre alt war, wirkte er agil und rüstig. »Wir werden ihn uns aus sicherer Entfernung ansehen, umgeben von den Schutzzaubern des Tempels, bevor wir entscheiden, wie wir darauf reagieren.«
Die schmalen Gänge und langen Wendeltreppen von Key Gompa waren berüchtigt dafür, dass sie Neuankömmlinge verwirrten. Sie beschwerten sich oft über die vielen miteinander verbundenen Wege des Tempels und bezeichneten sie als Labyrinth, aber Tenzin war mit ihnen so gut vertraut wie mit seinem eigenen Spiegelbild. Das galt auch für Khalîl, der Tenzin nun an dem Tempel vorbeiführte, der über der rund um eine Hügelkuppe über dem Spiti-Tal errichteten, festungsartigen Ansammlung rechteckiger weißer Gebäude thronte.
Tenzin und Khalîl gingen die letzte Treppe hinauf und betraten das Flachdach des Tempels. Eisige Sturmböen stachen ihnen ins Gesicht, als sie die Landschaft unter ihnen betrachteten.
Die Sonne ging gerade auf, doch das Tal lag noch im Schatten. Südlich davon erstreckten sich zerklüftete, eisbedeckte Berggipfel bis zum Horizont. Unterhalb des Klosters schlängelte sich der dunkle Spiti-Fluss durch die gefrorene Ebene. Im Norden, hinter Tenzin und Khalîl, lag frisch gefallener Schnee auf Abhängen, über denen schwarze Felswände in den Himmel ragten. Der Wind jaulte klagend, während er über die ebenso trostlose wie öde Landschaft wehte.
Grüne Flammen loderten in Khalîls Augenhöhlen. Aus Respekt vor den Mönchen von Key Gompa beschränkte der alte Meister seine Ausübung der Kunst auf Engelsmagick, wenn er sich innerhalb der Tempelmauern aufhielt. Khalîl fiel die Paulinische Kunst schwerer als die Goetische, aber der uralte Karcist hatte sich noch nie darüber beschwert oder gebeten, von dem Verbot ausgenommen zu werden. Abgesehen von wenigen kurzen Ausnahmen hatte er sich als perfekter Gast erwiesen.
Wenn man jemanden, der seit über einem Jahrhundert hier lebt, denn überhaupt noch als »Gast« bezeichnen kann.
Der Meister blinzelte und die Flammen verschwanden aus seinen Augen. »Unsere Feinde sind gut versteckt.«
»Spione?«, überlegte Tenzin laut.
»Vielleicht. Aber es könnten auch Kundschafter sein.«
Beide Möglichkeiten machten Tenzin nervös. Der Mönch suchte auf der leeren Leinwand der schneebedeckten Hügel nach Anzeichen von Gefahr. »Meister Khalîl, wenn Ihre Feinde wissen, dass Sie sich hier aufhalten, sollten Sie sich ihnen besser nicht zeigen.«
»Wenn ich ihr Ziel bin, dann verrät mein Anblick ihnen nichts, was sie nicht bereits wissen. Außerdem …« Seine ausladende Geste schloss die gesamte Umgebung mit ein. »Solange wir uns innerhalb der Schutzzauber des Tempels aufhalten, wird uns nichts etwas anhaben können. Weder Zauber noch Dämonen, Klingen oder …«
Der Knall eines Gewehrschusses unterbrach ihn.
Ein Blitz enthüllte eine zuvor unsichtbare Blase aus magischer Energie, die das gesamte Kloster umgab – doch im selben Moment platzte sie.
Die Schutzzauber des Tempels waren verschwunden.
Khalîl stieß Tenzin in Richtung Treppe. »Lauf!«
Ein weiterer Schuss zerriss die kalte Morgenluft. Warmes Blut spritzte über Tenzins Rücken und seinen Nacken. Als er sich umdrehte, sah er, dass Khalîl wie ein Betrunkener schwankte und auf die Knie fiel. Ein Blutfleck breitete sich auf dem Gewand des Meisters aus und rosafarbener Speichel blubberte in seinem Mund, als er nach Luft schnappte. Tenzin streckte die Hand aus, um ihm zu helfen, doch da fiel ein dritter Schuss …
Khalîls Schädeldecke explodierte. Blutige Knochen- und Gehirnstücke trafen Tenzins Gesicht, woraufhin er unwillkürlich vor Schmerz, Ekel und Entsetzen stöhnte. Als er die Augen öffnete, stellte er fest, dass das Blut seines Freundes, der nun vor seinen Füßen auf dem Dach lag, sein Gewand durchnässt hatte.
Tenzin kam sich wie ein Gefangener in seinem eigenen Körper vor, als er den Rest des Tempels mit seinen gestammelten Hilferufen alarmierte. Seine Stimme schien wie aus weiter Ferne zu kommen, fremd, unbekannt. Die Hilfeschreie waren sinnlos – niemand konnte Khalîl jetzt noch retten –, aber er stieß sie instinktiv aus und konnte nicht damit aufhören. Als die anderen Mönche ihn und den ermordeten Karcisten fanden, war Tenzin durch die Trauer und die eisige Kälte heiser geworden.
Tenzin war übel vor Wut und Verzweiflung. Mit Blicken suchte er die Abhänge nach dem Mörder ab, fand jedoch niemanden, den er hätte verfolgen oder dafür bestrafen können, dass nicht nur ein Leben, sondern auch ein halbes Jahrtausend Wissen und Weisheit ausgelöscht worden waren. Nur der Wind heulte durch die leeren Räume der Welt und verlieh seiner Trauer eine Stimme.
Privatsphäre war das größte Privileg, das Luxus zu bieten hatte. Niccolò Falco bewunderte zwar die opulenten Tower-Suiten in New Yorks berühmtem Waldorf-Astoria-Hotel, doch noch mehr genoss er die Stille, die eintrat, wenn die Tür zwischen zwei Zimmern geschlossen wurde und sämtliche Stimmen aussperrte. Er respektierte seinen Arbeitgeber, daher versuchte er nicht, das Ohr an die Wand zu legen und zu lauschen. Er bezweifelte eh, dass er durch die dicken Wände und Türen des Hotels etwas hätte hören können.
Man hatte ihn zusammen mit vier anderen Karcisten – von denen er keinen als ebenbürtig betrachtete – in ein Vorzimmer verbannt. Niccolò wollte seinen Arbeitgeber nicht bei der Erledigung seiner Angelegenheiten stören, doch sie beide hatten lange auf das Telefonat gewartet, das er gerade beendete. Die Mühlen des Ehrgeizes mahlten eifrig.
»Danke für Ihren Anruf«, sagte Niccolò zu seinem Mitarbeiter. »Das Honorar für Ihre Dienste wird Ihnen morgen früh wie versprochen überwiesen.«
»Es ist hier schon morgen«, sagte der pakistanische Attentäter barsch.
»In New York ist es aber noch Donnerstagabend.«
»Wollen Sie mich übers Ohr hauen?«
»Sie sollten erst einmal lernen, wie Zeitzonen funktionieren. Und reden Sie nie wieder so mit mir, sonst schicke ich einen Dämon, der Ihnen die Zunge herausreißt. Ciao, verme.« Niccolò legte auf, ging durch das Zimmer zu der zweiflügeligen Tür, die ihn und seine Magickerkollegen von ihren Förderern trennte. Er klopfte mit den Fingerknöcheln zweimal an die Eichentür, dann wartete er, bis eine Stimme auf der anderen Seite »Herein« sagte.
Er öffnete die Tür und betrat einen großen Salon. Das Vorzimmer, in dem er mit den anderen Magickern gewartet hatte, war zwar bequem, doch dieser Raum war dekadent – geräumig, mit teuren Möbeln eingerichtet und mit Kunstobjekten geschmückt. Durch die großen Fenster konnte man Manhattan mit seinen hell erleuchteten Wolkenkratzern und dem irrsinnigen Verkehr in seiner ganzen elektrischen Pracht bewundern.
Fünf Männer saßen in der Mitte des Zimmers an einem runden, lackierten Mahagonitisch, der auf einem großen Podest stand. Alle fünf waren elegant gekleidet. Der jüngste von ihnen, der Russe, schien Anfang fünfzig zu sein. Der weiße Südafrikaner, der blonde Argentinier und der Araber mit seinem schwarzen Bart wirkten wie Ende fünfzig. Niccolò kannte ihre richtigen Namen nicht, doch er wusste, dass er nicht danach fragen durfte.
Das älteste Mitglied der Gruppe war Niccolòs Arbeitgeber. Den Namen des alten Manns kannte er zwar, hatte jedoch durch eine brutale Zurechtweisung gelernt, ihn nicht vor anderen zu benutzen, auch nicht vor den Mitgliedern der Kommission, obwohl sie wahrscheinlich ebenfalls wussten, wie er hieß.
Niccolò näherte sich dem Tisch erst, als sein Förderer ihn heranwinkte.
Als der Magicker sich in Bewegung setzte, hob ein gut gepflegter deutscher Schäferhund, der zu Füßen des alten Manns lag, den Kopf, gähnte Niccolò an und döste dann weiter.
Der Karcist beugte sich neben der Schulter des alten Manns vor. »Entschuldigen Sie die Störung, Signore.« Der alte Mann bedeutete Niccolò mit einem Nicken fortzufahren, obwohl die düsteren Blicke der anderen Milliardäre am Tisch erkennen ließen, dass sie bei ihren hochtrabenden Plänen nicht gestört werden wollten. Niccolò wandte den Blick von diesem kollektiven Vorwurf ab und flüsterte: »Ich wurde gerade von unserem Mitarbeiter auf dem Subkontinent kontaktiert. Es ist erledigt.«
»Sehr schön«, sagte der alte Mann. In seinem Londoner Dialekt schwang ausnahmsweise kein Hochmut mit. »Danke, Niccolò.« Er bat Niccolò mit einem Blick, vom Tisch zurückzutreten, aber im Zimmer zu bleiben. Als der Magicker der Anweisung nachkam, stand er auf und strich über seinen maßgeschneiderten dreiteiligen Anzug. »Gentlemen, unser Plan zur Erneuerung der Welt wurde in Gang gesetzt.«
Die anderen Versammlungsteilnehmer reagierten auf diese Aussage mit überraschten oder besorgten Blicken. Als Erstes meldete sich der Araber mit vor Wut geweiteten Augen zu Wort: »Es ist zu früh!«
»Das sehe ich auch so«, sagte der Südafrikaner mit einem von Afrikaans geprägten Akzent.
Der Russe hatte seine Fassung wiedererlangt. »Darüber hätten wir abstimmen müssen.«
»Richtig«, pflichtete ihm der Argentinier bei, der deutlich gelassener klang. »Ein Unterfangen dieser Größenordnung sollte man Schritt für Schritt angehen.«
Der alte Mann hob die Hände, wahrscheinlich, um die anderen zu beruhigen. »Meine Freunde, glaubt bitte nicht, ich hätte überstürzt gehandelt. Der morgige Regimewechsel ist eine Notwendigkeit und dient dem Schutz unserer gemeinsamen Investitionen.« Er spielte das Ausmaß seines Schachzugs mit einem Schulterzucken herunter. »Dass wir damit die Grundlage für einen noch dreisteren Schlag schaffen – einen, der unsere langfristige globale Strategie vorantreiben wird –, ist ein glücklicher Zufall.« Er lächelte unter seinem imposanten knochenweißen Schnurrbart, der von einem kleinen Ziegenbärtchen am Kinn begleitet wurde. »Einer, den ich in vollem Umfang zu nutzen gedenke.«
Der Araber gab sich keine Mühe, seine Zweifel zu verbergen. »Das ist töricht und riskant. Wir könnten dadurch auffliegen.«
»Das sehe ich auch so«, sagte der Russe. »Selbst ein einziger Fehler könnte zu einer Katastrophe führen.«
Der Südafrikaner und der Argentinier äußerten ihre Einwände gleichzeitig und so vehement, dass man sie nicht verstehen konnte.
Die erhobene Hand des alten Mannes brachte alle erneut zum Schweigen. »Freunde, ich habe mich lange darauf vorbereitet. Ich habe diesen Schritt nur gewagt, weil meine Mitarbeiter bereit sind und sich die Lage zu unseren Gunsten entwickelt hat.«
»Das stimmt vielleicht«, sagte der Südafrikaner, »aber ich halte es für das Beste, unsere Versammlung jetzt zu beenden, damit wir getrennte Wege gehen können, bis Sie Ihr Projekt abgeschlossen haben.«
»Ich unterstütze diesen Antrag«, sagte der Araber.
Der Argentinier fragte: »Wer ist noch dafür?« Vier Hände schossen in die Höhe – nur die des alten Manns nicht. »Dann ist es beschlossen. Versammlung beendet.«
Die anderen vier Milliardäre schoben ihre Stühle zurück und standen auf. Der Russe legte dem alten Mann brüderlich die Hand auf die Schulter. »Sie haben uns auf einen gefährlichen Weg geführt. Möchten Sie hören, wie ich an Ihrer Stelle jetzt vorgehen würde?«
»Wärs abgetan, so wie’s getan, wärs gut, es wär schnell getan.«
Der Russe nickte anerkennend, als der alte Mann Macbeth zitierte, dann verließen er und die anderen den Salon. Die vier Oligarchen sammelten ihre Karcisten im Vorzimmer ein und schlossen die Tür hinter sich.
Der alte Mann nahm einen halbvollen Teller Entenleberpastete vom Tisch und stellte ihn auf den Boden. Sein Schäferhund machte sich sofort über die fettreiche Leckerei her. Der alte Mann strich dem fressenden Hund lächelnd über den Kopf, doch seine Stimme klang grimmig, als er sich an Niccolò wandte: »Frisch ans Werk, mein Junge. Wir dürfen keine Zeit verlieren.« Er sah seinen Chefmagicker düster an. »Je schneller diese blutige Sauerei beendet ist, desto besser.«
Naxos war kein Paradies, kam der Sache aber näher als alle anderen Orte, an denen Anja Kernova je gewesen war. Es gab viele dieser hügeligen, bewaldeten griechischen Inseln im Ägäischen Meer und sie alle waren schön, voller Pflanzen und mit fruchtbarer Vulkanerde gesegnet. Sie und Cade Martin waren vor acht Jahren nach Naxos gekommen, kurz nach ihrer Hochzeit. Sie hatten falsche Namen angenommen, ein großes Haus auf einem Hügel westlich von Apiranthos gekauft und es bar bezahlt. Die Einheimischen hatten sie nie gefragt, woher das Geld für den Kauf stammte – oder wer sie eigentlich waren.
»Das ist ein gutes Zeichen«, hatte Anja damals zu Cade gesagt und er hatte zugestimmt.
Das Haus in ihr Heim zu verwandeln hatte viel Zeit in Anspruch genommen. Sie hatten die große Bibliothek im ersten Stock mit Büchern bestückt: mit Grimoires, alten und neuen Kodizes über die Kunst der Magick, Ephemeriden, Nachschlagewerken über Anatomie, Geografie, Geschichte, Naturwissenschaften, Philosophie und viele andere Themen. Irgendwann hatte Cade sich auf die Küche und das Befüllen der Vorratskammer konzentriert, während Anja sich um den Beschwörungsraum im Untergeschoss gekümmert hatte, der sich neben dem Weinkeller und der Käsehöhle befand und dringend abgesichert werden musste.
Der Rest des Hauses nahm nach und nach Form an, meistens dann, wenn sie beide dem Ganzen nur wenig Beachtung schenkten. Sie hatten keine großen Ansprüche und das bequeme, wenn auch langweilig aussehende Mobiliar reichte ihnen voll und ganz. Ihr Schlafzimmer, die Gästezimmer und das offene Erdgeschoss besaßen die Atmosphäre eines rustikalen Landsitzes. Nachmittags fiel honiggelbes Sonnenlicht durch die hauchdünnen Vorhänge des Wohnzimmers; morgens zog der Duft von frisch gebackenem Brot und türkischem Kaffee durch das ganze Haus. Beides wurde von den Lamien zubereitet, die sie als Diener beschworen hatten.
Der Hügel rund um das Haus war von dichtem Wald bedeckt. Anja gefiel die Privatsphäre, die ihnen die Bäume spendeten. Trotzdem hatte Cade das Grundstück so weit gerodet, dass sie einen Gemüsegarten, ein Rankgitter für Trauben, Bienenstöcke (nicht nur für Honig, sondern auch für Bienenwachs, aus dem man zeremonielle Kerzen herstellte) und eine kleine, von einem Blasebalg betriebene Schmiede unterbringen konnten. An der Nordseite des Hofs standen einige Olivenbäume, die Cade ein paar Jahre zuvor gepflanzt hatte. Noch trugen sie keine Früchte, doch Cade gab die Hoffnung nicht auf. Er hatte hochtrabende Pläne, zu denen auch das Pressen seines eigenen Olivenöls gehörte.
Das war ein netter Traum, Anja glaubte allerdings nicht, dass er sich erfüllen würde.
Das erste Sonnenlicht des Tages bohrte sich durch die Bäume, als Anja das Haus verließ, um sich anzusehen, welche Fortschritte ihre neueste Schülerin gemacht hatte. Die meisten Lehrlinge, die sie und Cade ausbildeten, kamen aus weit entfernten Ländern. Melia Volonakis – oder Mel, wie die beiden sie nannten – war jedoch ein Mädchen aus der Nachbarschaft, das durch seine akademischen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Mel hatte Anja und Cade mit ihrem Talent für alte Sprachen und moderne Wissenschaft imponiert. Sie war weltoffen und besaß einen Blick fürs Detail, hatte als Schülerin der Magick jedoch ein Defizit: Ungeduld.
Mel stand an einem von Klingen vernarbten und vom Wetter gezeichneten Holztisch, nur wenige Meter von der Außenschmiede entfernt. Barış Kılıç war bei ihr. Er war Cades ranghöchster Adept und daher verantwortlich für Mels erste Lektionen. Unter anderem hatte er ihr einen kleinen Berg an Literatur zu lesen gegeben, deren Lektüre eine absolute Grundvoraussetzung für die Kunst darstellte, und ihr beigebracht, wie sie ihre eigenen Karcisten-Werkzeuge herzustellen hatte, was ebenfalls essenziell war. Er trug einen braunen Anzug, ein weißes Hemd, eine rote Fliege und einen ebenso roten Fez. Neben dem Bauernmädchen sah Barış’ feine Kleidung albern aus.
Als Anja sich den beiden näherte, sah sie, dass Mel ihre Hilfsmittel in ihre frisch zurechtgeschnittene lederne Werkzeugrolle einsortiert hatte. Es roch nach Salbei, Lavendel und heiligen Ölen, ein Hinweis darauf, dass die Werkzeuge der jungen Frau zur Vorbereitung auf das Ritual gereinigt und gesegnet worden waren.
Mel strahlte stolz, als sie Anja bemerkte: »Ich bin fertig!«
»Das sehe ich.« Anja trat zwischen Mel und Barış, inspizierte jeden Gegenstand in Mels Sortiment und gab ihm mit einem Nicken ihren Segen. »Sehr schön.« Anja strich sich ein paar lange, schwarze Haarsträhnen aus dem Gesicht und steckte sie hinters Ohr. Zu Barış sagte sie: »Zeig ihr, wie man das Werkzeug sicher aufbewahrt, bis sie für ihren ersten Pakt bereit ist.« Barış nickte. Anja drehte sich um und wollte zum Haus zurückgehen.
Mel sprang ihr in den Weg. Ihre braunen Augen blitzten wütend. »Was meinst du mit: Bis ich bereit bin? Mein Werkzeug ist fertig!«
Anja konnte nicht bestreiten, dass eine gewisse Seelenverwandtschaft zwischen ihr und der hitzköpfigen jungen Frau bestand. Mel hatte fast dieselbe Haarfarbe und Frisur wie Anja. Ein Fremder hätte sie für Cousinen halten können, da Anja dank des Jahrzehnte alten Pakts mit ihrem infernalischen Patron ASTAROTH wie Mitte zwanzig aussah, obwohl sie Anfang vierzig war. Und Mels Tonfall – rechtschaffene Empörung gepaart mit bitterer Enttäuschung – erinnerte Anja an den, den sie oft genug gegenüber ihrem verstorbenen Mentor Adair Macrae angeschlagen hatte, wenn er ihr schlechte Nachrichten überbrachte.
Anja versuchte, nicht ganz so barsch aufzutreten wie sonst. »Dass du dein Werkzeug hergestellt hast, heißt nicht, dass du bereit bist.«
»Ich habe auch alles gelesen und auswendig gelernt. Das schwöre ich.« Mel klang ehrlich, aber als Anja Barış mit einem Blick um Bestätigung bat, wandte er sich ab und spielte mit seiner Fliege.
Wie immer diplomatisch. Anjas Miene wurde hart. »Welche Gaben kann man bekommen, wenn man MARBAS unterjocht?«
»Die Fähigkeit, Krankheiten zu verursachen und zu heilen und das Talent, die eigene Gestalt zu wandeln.«
Also hatte das Mädchen wirklich einiges gelesen. Doch Anja hatte weiterhin Bedenken. »Wenn man den Großen Kabbalistischen Kreis zeichnet, an welchem Punkt fängt man mit dem inneren Dreieck an?«
Dieses Mal zögerte Mel und zog die Augenbrauen zusammen, als sie sich konzentrierte. »Im Norden.«
»Falsch. Osten. Womit umgibst du deine Kerzen?«
»Mit Kränzen aus … nicht Stechpalme …«
»Eisenkraut«, berichtigte sie Anja. »Wenn sich der Anwender mit der Honorius-Methode reinigt, was ist am ersten Tag verboten?«
»Rotes Fleisch«, verkündete Mel mit unverdienter Überzeugung.
»Jegliche Fleischsorten, außerdem Wein.« Anja schüttelte den Kopf. »Du hast viel gelernt, aber du bist noch nicht bereit für den Kreis. Barış wird dich unterrichten.«
Die junge Frau knurrte frustriert, als sie sich von Anja abwandte und losstürmte – nicht zu dem Weg, der zurück in ihr Dorf führte, sondern in Richtung des bewaldeten Hügels.
Anja rief ihr nach: »Mel! Halte dich vom Wald fern!«
»Zur Hölle mit dir und deinen Regeln!« Sie wurde schneller.
Anja hatte keine Lust, sich so früh am Morgen mit einem aufsässigen Teenager zu streiten. Also wartete sie, bis Mel den Waldrand erreicht hatte, und hielt sie dann mit BAELS angsteinflößenden, unsichtbaren Händen gewaltsam fest. Mel musste mitten im Schritt anhalten, wand sich und schrie griechische Schimpfwörter. Anja ging zu ihr und stellte sich neben sie.
»Sei still.« Anja verstärkte den Griff des Dämons. Dieses Mal gehorchte Mel. »Die Regeln, die Cade und ich aufgestellt haben, sind zu deinem Schutz da.« Sie zeigte auf das von Tau bedeckte Gras und sagte zu Melina: »Sieh genauer hin. Was fällt dir auf?«
Mel betrachtete den Boden. Das Morgenlicht brach sich in den Tautropfen. »Meinst du diesen silbernen Faden?« Anja nickte. Mel fuhr fort: »Ist das Spinnenseide?«
»Ein Stolperdraht.« Mit einer Handbewegung hob Anja die Tarnung auf, die einen militärischen Sprengsatz am Fuß eines Baumstamms verborgen hatte. »Für die Claymore-Mine. Cade hat im ganzen Wald welche versteckt. Die hier hätte dich in Stücke gerissen.«
Mel wurde blass. »Hier draußen gibt es Minen?«
»Wir verstecken unsere Schutzmaßnahmen aus gutem Grund. Und wir stellen Regeln ebenfalls aus gutem Grund auf.«
Mel wich Anjas strafendem Blick aus. »Vergib mir.«
»Lies mehr Honorius. Barış wird dir die richtigen Bücher zeigen.« Anja zeigte auf das Haus.
Die Jugendliche schlurfte kleinlaut zurück zum Haus und ging hinein, ohne den Kopf zu heben. Anja folgte ihr mit einigen Schritten Abstand. Sie blieb an der Hintertür stehen, als Barış sich zu Wort meldete: »Ah, die Impulsivität der Jugend. So hätte ich mich vor nicht allzu langer Zeit auch verhalten.«
Sie konnte mit seiner wehmütigen Nostalgie nichts anfangen. »Bemitleide sie nicht, Barış. Fordere sie.«
»Das werde ich. Aber pass auf, dass du sie nicht entmutigst. Sie bewundert dich.«
»Tatsächlich?« Anja ging zurück ins Haus. »Dann hat sie keine gute Menschenkenntnis.«
Der Geruch nach Kaffee und brutzelndem Speck holte Briet Segfrunsdóttir aus ihrem unruhigen Schlaf. Sie warf einen Blick auf die Uhr auf ihrem Nachttisch. Halb zehn, was erklärte, warum goldenes Sonnenlicht durch das Schlafzimmerfenster fiel. Sie drehte sich auf die linke Seite, weg vom Fenster. Dabei legte sie den Kopf auf ihre eigenen kupferroten Haare, die ihr eigenes Kissen und die Kissen daneben bedeckten. Der Rest des Doppelbetts war leer. Alton und Hyun, ihr Liebhaber und ihre Liebhaberin, waren vor einer Stunde aufgestanden und kümmerten sich nun unten ums Frühstück.
Briet schob die Bettdecke von ihrem nackten Körper. Sie stand auf. Streckte sich. Gähnte. Kratzte sich in den Achselhöhlen, die sie nicht rasierte, obwohl Alton sie immer wieder anflehte, das zu tun. Sie blinzelte sich den Schlaf aus den Augen, während sie ins Bad ging und ihren Frottee-Bademantel anzog. Während sie sich das Gesicht wusch, versuchte sie, nicht in den Spiegel zu sehen. Einer ihrer unterjochten Dämonen tendierte dazu, sein Missfallen zu äußern, indem er sie zwang, wie besessen ihre Sommersprossen zu zählen. So etwas mochte harmlos klingen, aber nur solange man nicht einen ganzen Tag vor dem Spiegel zubrachte.
Auf dem Rückweg ins Schlafzimmer schlüpfte Briet in warme Pantoffeln, dann ging sie nach unten. An der Wand neben der Treppe hingen zahlreiche gerahmte Fotos. Darunter waren ein paar Porträtaufnahmen von Alton und Hyun, doch bei den meisten handelte es sich um Erinnerungen an ihre Reisen: Spanien, Australien, die Osterinseln, Stonehenge … sie dachte gern daran.
Auf der Stereoanlage lief eine Schallplatte von Miles Davis. Normalerweise hätte Briet sich darüber beklagt, da sie Jazz erst ab Mittag genießen konnte, aber heute war sie gut gelaunt aufgewacht. Sie hatte sich den Tag freinehmen können – was an ein Wunder grenzte, nicht nur, weil es Freitag war, sondern auch, weil sie schon für die ganze nächste Woche Urlaub eingereicht hatte. Da wurde Thanksgiving gefeiert. In den meisten Regierungsabteilungen wäre so etwas nicht ungewöhnlich gewesen, aber beim okkulten Verteidigungsprogramm des Verteidigungsministeriums kam das praktisch nie vor.
Ausnahmsweise hat es mal Vorteile, die Königin zu sein.
Ihre beiden Geliebten befanden sich in der Küche. Beide trugen noch Schlafanzug, Morgenmantel und Pantoffeln. Der große Alton, der langsam kahl wurde, stand am Herd und kümmerte sich mit einem Pfannenwender geschickt um die Eier in der gusseisernen Pfanne. Auf der Kunststoffarbeitsplatte neben ihm stand ein Teller mit knusprig gebratenem Speck. Briets Nase verriet ihr, dass die Eier im ausgelassenen Fett des Specks gebraten wurden. Hyun saß an dem kleinen Tisch in der Frühstücksecke und ertränkte ein Tablett mit frisch gebackenen Zimtschnecken in Zuckerguss. Sie lächelte, als sie Briet erspähte. »Morgen!«
»Guten Morgen.« Briet beugte sich vor und küsste Hyun. »Mhmm.« Als sie sich über die Lippen leckte, erkannte sie, dass Hyun den Zuckerguss schon probiert hatte. »Zucker und Zitrone.«
Hyun verpasste Briet einen spielerischen Klaps auf den Hintern.
Briet durchquerte die Küche, um Alton zu begrüßen. Sie umarmte ihn von hinten, passte aber auf, dass sie ihn nicht beim Kochen störte. »Morgen.« Sie küsste seinen Nacken. »Das Frühstück riecht toll.«
»Ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht«, sagte Alton.
»Das habe ich. Und Appetit habe ich auch.« Sie lächelte verführerisch, um die Zweideutigkeit ihrer Bemerkung zu unterstreichen. Als er ihren Blick auf die gleiche Weise erwiderte, ließ sie ihn los und ging mit schwingenden Hüften zurück zum Tisch, um seine Aufmerksamkeit nicht zu verlieren. Sie setzte sich auf den Stuhl gegenüber von Hyun, nahm einen Löffel und half ihr, den Zuckerguss auf den Zimtschnecken zu verteilen. »Was ist mit dir? Hast du Lust, den Tag im Bett zu verbringen?«
Die anmutige Koreanerin tat so, als müsste sie darüber nachdenken. »Verlockend. Ich frage mal meinen Mann.« Sie schaute Alton an, der mit betonter Ernsthaftigkeit nickte. Sie wandte sich wieder Briet zu und grinste: »Er sagt … okay.«
Obwohl Alton und Hyun schon seit einigen Jahren verheiratet waren – und mit Briet seit fast einem Jahrzehnt romantisch verbandelt waren –, hatte Hyun nach wie vor großen Spaß daran, ihn als ihren Mann zu bezeichnen. Diese Ehe war für alle drei sinnvoll gewesen. Alton hatte Hyun nicht nur aus Liebe geheiratet, sondern auch, um ihr nach der Auswanderung aus Korea die Staatsbürgerschaft zu ermöglichen. Da er ein in den USA geborener Amerikaner war, wurde sie durch die Heirat ebenfalls Amerikanerin. Briet war zwar in Island geboren worden, hatte allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen von Operation Paperclip die Staatsbürgerschaft bekommen. Das war eine ihrer Bedingungen für die Anstellung gewesen.
Um Diskretion zu wahren, war ihr Stadthaus in Georgetown auf Alton und Hyun überschrieben worden. Offiziell war Briet ihre Mieterin. So konnte Briets Privatsphäre gewahrt werden. Gleichzeitig wurden so die Fragen und neugierigen Blicke der Misstrauischen und Intoleranten im Keim erstickt.
Hyun verteilte die Zuckermasse auf der letzten Zimtschnecke. Dann holte sie ein bisschen Zuckerguss mit ihrem kleinen Finger aus der Schüssel. »Wäre doch schade, den wegzuwerfen.«
Briet strich mit den Fingerspitzen über Hyuns Unterarm, liebkoste ihren Handrücken und führte ihn in Richtung ihres Munds. Sie leckte Hyuns von süßsaurem Zuckerguss bedeckte Fingerkuppe ab. »So wird er nicht verschwendet.«
Sie sahen sich in die Augen, als Hyun ihren kleinen Finger noch einmal in den Zuckerguss steckte und ihn Briet vor die Lippen hielt. »Mach das noch mal.«
Der Hauch eines Lächelns erfasste Briets Mundwinkel, als sie Hyuns Fingerspitze mit ihren Lippen umschloss. Der Finger rutschte feucht und ohne Zuckerguss heraus. »Immer noch lecker.«
In Hyuns Augen funkelte es schelmisch. Sie tauchte ihren Zeigefinger in den Zuckerguss und schob die Hand unter den Tisch … unter ihren Bademantel … zwischen ihre Beine …
Das Telefon klingelte laut und schrill.
Briet warf einen Blick über ihre Schulter in Richtung Wohnzimmer, wo das einzige Telefon im Haus stand. »Verdammte Scheiße. Ich habe frei.«
Es klingelte noch einmal. Ihre Frustration verwandelte sich in Wut.
»Geh nicht ’ran«, sagte Hyun, aber es war zu spät.
Briet verließ die Küche und stürmte durch das Wohnzimmer zum Telefon. Sie riss den Hörer beim vierten Klingeln von der Gabel. »Was?«
»Bree, gehört es sich etwa, so ans Telefon zu gehen?« Wie erwartet und befürchtet gehörte die Stimme am anderen Ende der Leitung Frank Cioffi, ihrem Kollegen beim OVP. Sein Brooklyn-Akzent wurde stets etwas stärker, wenn er genervt war, und er war meistens genervt. »Wir haben ein Problem. Du musst sofort kommen.«
Sie stellte sich kurz vor, wie sie das fette Schwein mit einer seiner hässlichen Krawatten erwürgte. »Was für ein Problem, Frank?«
»Ein schwerwiegendes. Einer deiner Adepten hat eine Routine-Zeichendeutung durchgeführt und ist dabei auf die denkbar beschissenste Konstellation gestoßen, die man sich vorstellen kann.«
»Na und? Er soll sie eintragen und überprüfen lassen.«
»Das haben wir schon gemacht. Die Analytiker glauben, dass Kennedy heute in Dallas Schwierigkeiten bekommen wird. Du musst herkommen und die magischen Schutzzauber des Präsidenten kontrollieren.«
»Nein, ich habe Urlaub.«
»Es ist mir scheißegal, ob du Urlaub hast oder auf dem Mond bist. Schwing deinen Arsch hier rüber.«
»Nein, das ist Zeitverschwendung, und das weißt du auch. Wir und die katholische Kirche haben so viele Schutzschichten um Kennedy herum aufgebaut, dass der Teufel persönlich ihm nichts anhaben könnte. Aber wenn die Schwachköpfe in der Chefetage sich wirklich so große Sorgen machen, sollen sie dem Secret Service Bescheid sagen und Kennedys Leibwache auffordern, endlich mal den Arsch hochzukriegen und ihren Job zu machen. Was dich angeht? Wenn ich deine Stimme vor dem zweiten Dezember noch einmal höre, sorge ich dafür, dass du den Rest deines erbärmlichen, kurzen Lebens mit Pestbeulen am verschrumpelten Schwanz verbringst. Auf Wiederhören, Frank.«
Bevor er darauf reagieren konnte, knallte Briet den Hörer auf die Gabel – und dann, um auf Nummer sicher zu gehen, riss sie das schwarze Kabel aus der Wand und stopfte alles zusammen in den Schrank.
Als sie sich umdrehte, sah sie, dass Alton und Hyun im Türrahmen standen. Er hob eine Augenbraue, was einem leichten Tadel entsprach. »Bist du sicher, dass das klug war?«
»Ich lasse es am Montag reparieren.«
»Ich meine nicht das Telefon, sondern so einen Tonfall bei deinem Chef anzuschlagen.«
»Frank ist nicht mein Chef.«
Hyun wirkte besorgter als Alton. »Was wird passieren, wenn du wieder ins Büro kommst?«
»Oh, das wird die Hölle auf Erden. Doch mit diesem Problem befasse ich mich nach meinem Urlaub.« Sie ging durch das Zimmer und stellte sich vor das Ehepaar. »Jetzt frühstücken wir erst mal. Und dann …« Sie lächelte, schob die linke Hand unter Altons Bademantel und rieb seinen Schwanz. Hyuns Möse nahm sie in die rechte Hand. »… reservieren wir den Rest des Tages für den Nachtisch.«
Schon sein ganzes Leben lang liebte Cade Bibliotheken. Als Kind in Connecticut hatte seine Mutter ihn am Wochenende nachmittags oft in der Stadtbücherei gelassen, während sie Besorgungen machte. Die Bibliothekare hatten auf ihn aufgepasst und er hatte viele glückliche Stunden mit illustrierten Märchenbüchern und Sagen verbracht. Selbst heute noch, Jahrzehnte später, genoss er den Geruch von Ledereinbänden und altem Papier. Es gab nur weniges, was sich für ihn besser anfühlte als die Textur qualitativ hochwertiger Seiten unter seinen Fingerkuppen, und wenn er sich an die schönsten Zeiten seiner Jugend erinnerte, dachte er fast immer an die Worte von Poe, Doyle, Wells oder Shakespeare.
Keine Wissenskathedrale verehrte er mehr als die berühmte Bodleian Library in Oxford. Die Bibliothek war ebenso gewaltig wie alt und es gab dort mehr Bücher, als ein normaler Mensch in seiner Lebenszeit verschlingen konnte. Selbst in den siebenhundert Jahren, die ihm sein infernalischer Patron LUCIFUGE ROFUCALE versprochen hatte, würde Cade wohl kaum die Zeit finden, jedes Werk im ständig größer werdenden Bestand der Bodleian zu lesen. Er hatte schon seit Jahren keinen Fuß mehr in diese Bibliothek gesetzt. Er vermisste sie, ebenso wie das Exeter College und den Rest von Oxford. Die Tage, die er dort während des Studiums zusammen mit seinem besten Freund Miles Franklin verbracht hatte, gehörten zu den glücklichsten seines Lebens.
Dann war der Zweite Weltkrieg ausgebrochen und seine Eltern waren von Nazi-Magickern ermordet worden, deren eigentliches Ziel Cade gewesen war. Nachdem er seine Mutter und seinen Vater beim Untergang des Passagierschiffs Athenia verloren hatte, war Cade von der Mitternachtsfront rekrutiert worden. Dort hatte er Magick studiert und den Alliierten bei ihrem geheimen Krieg gegen die Magicker des Dritten Reichs geholfen. Erst jetzt, rund zwanzig Jahre nach Kriegsende, hatte er den Eindruck, dass er das alles endlich hinter sich gelassen hatte. Für diese spirituelle Genesung machte er vor allem die neueste Bibliothek in seinem Leben verantwortlich. Er und Anja hatten sie zusammen hier in ihrem Haus auf Naxos aufgebaut.
Sie war nicht groß; um genau zu sein, war sie sogar recht klein und bestand nur aus einem einzigen Raum, dessen Wände vom Boden bis zur Decke mit Bücherregalen überzogen waren. In der Mitte des Zimmers stand ein breiter Lesetisch aus dunklem Eichenholz, der von acht dazu passenden Stühlen umgeben war. Anja hätte zwar rustikalere Möbel vorgezogen, aber Cade hatte auf Stühle mit dicken Polstern und Lederbezug auf der Sitzfläche, den Arm- und Rückenlehnen bestanden. Wenn er die vielen Stunden bedachte, die er in den letzten sieben Jahren in diesem Raum verbracht hatte – inklusive seinem momentanen Arbeitsrausch, der seit zwei schlaflosen Tagen anhielt –, war er froh, dass er sich diesen Luxus gegönnt hatte.
Er saß an dem Ende des Tischs, das am weitesten von der Tür entfernt war, mit dem Rücken zum Fenster, das einen Blick auf die Nordseite des Hofs bot. Das indirekte Licht, das durch die offenen Gardinen fiel, erhellte das Zimmer, ohne harte Schatten zu werfen – ideale Bedingungen für seine Arbeit. Er hielt gerade die Ergebnisse seiner magischen Experimente und seiner Dämonenverhöre im dritten Band seines neuen Grimoires fest. Er hatte ihm noch keinen Namen gegeben, obwohl der langfristige Zweck des Werks ihm bereits klar war.
Lass dir Zeit. Du hast gerade erst angefangen. Dem Werk einen hochtrabenden Namen zu geben wäre verfrüht. Die ersten beiden Bände dokumentierten seine spirituelle Reise in den Himmel und in die Hölle und seine Entdeckung, dass es an beiden Orten keine menschlichen Seelen gab. Außerdem hatte er darin das Rätsel des toten Gottes dargelegt, dass er entdeckt hatte, als er Anja geholfen hatte, den Eisernen Kodex aus den Geheimarchiven des Vatikans zurückzustehlen. In seinem neuesten Band zeichnete er die Ergebnisse seiner magischen Experimente auf. Das Werk hatte sich noch keinen Titel verdient.
Es verdiente allerdings Aufmerksamkeit und Sorgfalt.
Die Tür zur Bibliothek ging auf. Cade schloss das große, in Leder eingebundene Buch, legte ein anderes zur Tarnung darauf und öffnete es. Er entspannte sich, als er sah, wer ihn da besuchte: Es war Anja, die ihm eine frische Tasse Tee mitbrachte.
Sie lächelte, als sie die Tasse vor ihm abstellte. »Mel ist mit ihrem Werkzeug fertig.«
Das hörte er gern. »Gut. Wann können wir ihr einen Patron besorgen?«
»Im Frühjahr.« Sie kam Cades nächster Frage zuvor. »Sie muss noch mehr lesen.«
»Ist sie deshalb vor ein paar Stunden in Richtung Wald gelaufen?«
Anja brachte ihre Unzufriedenheit mit einem leisen Seufzer zum Ausdruck. »Sie ist intelligent, aber ungeduldig.«
Cade nippte an seinem Zitronentee mit Honig. »So war ich in dem Alter auch.«
Anja schenkte ihm ein wissendes Lächeln. »Daran kann ich mich nur allzu gut erinnern.« Ihre Miene nahm einen geschäftsmäßigen Zug an und sie setzte sich rechts von Cade an den Tisch. »Ich habe möglicherweise eine neue Ausbildungskandidatin in Schweden gefunden. Sie macht nächstes Jahr ihren Abschluss an der Universität Stockholm.«
»Noch eine Adeptin?« Cade brachte seine Zweifel mit einem Stirnrunzeln zum Ausdruck. »Ich verliere ja jetzt schon den Überblick. Wie viele haben wir gerade … neunzehn?«
»Achtzehn«, berichtigte Anja.
»Trotzdem viele.« Er hielt inne und strich sich über den Kinnbart. »Vielleicht zu viele.«
»Du siehst nicht nur aus wie Adair …« Anja fuhr mit dem Zeigefinger durch Cades schulterlange, zottelige braune Haare. »Du klingst auch schon wie er.« Sie zog ein Stück Papier aus der Gesäßtasche ihrer Hose und legte es auseinandergefaltet auf den Tisch. Darauf befand sich eine Liste mit Namen. »Einige von denen, die du als Lehrlinge bezeichnest, sind bereit, Karcisten zu werden.«
»Zum Beispiel?«
»Barış. Du bildest ihn seit fünfzehn Jahren aus. Er ist so weit.«
»Vielleicht. Er ist schlau, aber ein bisschen nervös. Wer noch?«
»Alle, die seit zehn oder mehr Jahren von dir ausgebildet werden. Gathii, Viên, Adelita, Garrett …«
»Ich weiß, wie sie heißen.«
»Ach ja? Dann sag mir die anderen fünf Namen.«
Sie hatte ihn durchschaut, trotzdem stammelte er: »Äh … Lila. Und … Fareed?«
»Wer noch?«
»Ich geb’s auf. Fass es für mich zusammen. Was bringt uns das?«
»Es halbiert unsere Lehrlingsliste.« Sie drehte den Zettel um und schob ihn Cade hin, damit er ihn lesen konnte. »Und wir können eine neue Liste anfertigen: eine mit Verbündeten.«
»Okay. Das ist ein gutes Argument. Vielleicht habe ich zu sehr die Hand über meine Schüler gehalten. Einige kommen bestimmt schon allein zurecht. Aber sie gehen zu lassen ist ein großer Schritt.«
»Es ist Zeit.«
»Sagst du. Aber was, wenn …«
Er unterbrach sich, als in der Innentasche seiner Bomberjacke, die links von ihm über einer Stuhllehne hing, eine dumpfe Stimme erklang. »Moment.« Er zog einen handtellergroßen Stahlspiegel aus der Tasche, auf dessen Rückseite HAELS Sigille eingraviert war. Als Cade einen Blick auf die Vorderseite warf, sah er nicht etwa sein Spiegelbild, sondern das Gesicht von Bruder Tenzin, einem buddhistischen Mönch. Anja und er hatten ihn vor fast zehn Jahren kennengelernt, als sie von Meister Khalîl im Kloster Key Gompa ausgebildet worden war. Der Tibeter wirkte verzweifelt und aufgewühlt. Seine Stimme zitterte und brach. »Cade? Bist du das?«
»Ja, Tenzin. Ich bin’s. Alles in Ordnung?«
»Master Khalîl ist tot. Er wurde ermordet!«
Anja wich vor Entsetzen sämtliche Farbe aus dem Gesicht und Cade spürte, wie ihm ungläubig die Gesichtszüge entgleisten. »Was ist passiert, Tenzin? Wir brauchen Einzelheiten.«
»Es ist bei Tagesanbruch geschehen.« Tenzin richtete den Blick nach unten, als würde er sich zu sehr schämen, um Anja und Cade anzusehen. »Ein Scharfschütze. Sein erster Schuss hat die Schutzzauber des Tempels durchschlagen. Seine nächsten beiden haben den Meister getroffen.«
Die Vorstellung ließ Cades Blut gefrieren. Er warf Anja einen besorgten Blick zu. »Was könnte denn dazu in der Lage sein? Von so etwas habe ich noch nie gehört.«
»Ich auch nicht«, flüsterte sie entsetzt.
»Das ist noch nicht alles. Unsere Freunde aus anderen Orden berichten, dass das Gleiche überall auf der Welt passiert. Meister und Adepten der Kunst werden von Scharfschützen getötet. Und nicht nur Goetische Karcisten. Wūshī der uralten chinesischen Künste, arktische Schamanen, afrikanische Ritualdoktoren …«
»Eine Säuberungsaktion«, sagte Anja. »Wie bei Stalin.«
»Oder Hitler.« Cade wurde übel. »Tenzin, wer steckt dahinter?«
»Das weiß niemand. Aber die Morde scheinen der Sonne zu folgen. Sobald ein neuer Tag anbricht, wird wieder Blut vergossen. Sei vorsichtig, Bruder Cade. Beschütze deine Seele und alle, die du liebst. Namaste.« Er beendete die magische Verbindung zwischen ihren Spiegeln mit dem Befehl: »Velarium.«
Einige Sekunden lang schwiegen Cade und Anja benommen.
Dann stieg Ärger in ihr auf und färbte die y-förmige Narbe auf ihrer linken Wange rot. Die Ausläufer dieser alten Wunde verbanden ihr unteres Augenlid, den Tragus ihres Ohrs und ihren Mundwinkel miteinander. Sie war Anja von einer dämonischen Waffe zugefügt worden, als sie noch ein Kind war, und ließ sich nicht mit magischen Mitteln entfernen, sondern nur verbergen – was Anja jedoch fast nie tat. Sie trug dieses Mal stattdessen wie einen Orden.
Wenn Anjas Gesicht hart und ihr Blick kalt wurde, war sie bereit für den Kampf.
»Cade, unsere Schüler brauchen uns. Bring sie alle her.«
Er nickte. »Je mehr, desto besser.« Er riss die Liste der Adepten in der Mitte durch und gab ihr eine Hälfte. »Du findest diese Gruppe, ich kümmere mich um die anderen. Wir hören erst auf, wenn wir alle in Sicherheit gebracht haben.«
Ein Blick auf seine Uhr verriet Secret Service Agent Clark Warden, dass die Wagenkolonne des Präsidenten einige Minuten hinter dem Zeitplan lag. Es war 12:29 Uhr, als sich der führende Wagen auf dem Weg zu Kennedys Rede im Trade Mart der Kreuzung von Elm und North Houston Street in der Innenstadt von Dallas näherte. Der Jubel der Menschenmenge, die die Parade säumte, war ohrenbetäubend.
Während er neben den langsam fahrenden Fahrzeugen herjoggte, warf Clark einen Blick auf die Digitaluhr an der Ecke des Texas Book Depository direkt vor ihm. Sie zeigte die aktuelle Temperatur mit 19 Grad Celsius an. Das gemäßigte Wetter, gepaart mit einer leichten Brise, die die Wimpel der Schaulustigen flattern und die noch grünen Blätter an den Zweigen rascheln ließ, sorgte für nahezu ideale Bedingungen: weder zu heiß, um mit der Fahrzeugkolonne Schritt halten zu können, noch so kalt, dass die Agenten hinderliche Schichten über ihren dunklen Anzügen tragen mussten.
An diesem Morgen hatte es in Dallas geregnet, aber der Sturm war schon lange vorbei und hatte den Eindruck hinterlassen, als wäre die Stadt in Vorbereitung auf die Ankunft des Präsidenten gerade frisch gewaschen worden.
Das Auto an der Spitze, ein Zivilfahrzeug der Polizei, das vom Polizeichef der Stadt gefahren wurde und als rollende Kommandozentrale für die Wagenkolonne diente, überquerte die Kreuzung und fuhr auf die Auffahrt zum Stemmons Freeway, einige Wagenlängen vor der schwarzen Lincoln-Cabrio-Limousine des Präsidenten. In wenigen Augenblicken würden Clark und die anderen Agenten, die derzeit zu Fuß unterwegs waren, wieder in die ihnen zugewiesenen Fahrzeuge steigen müssen, bevor sie auf den Highway auffuhren.
Auf der Rückbank der Limousine saß Präsident John F. Kennedy. Sein dunkelgrauer Anzug bildete einen starken Kontrast zu dem rosafarbenen Kleid und dem dazu passenden Pillbox-Hut seiner Frau Jacqueline. Die Sitze des Staatsoberhaupts und der First Lady waren um einige Zentimeter erhöht worden, damit die Öffentlichkeit sie besser sehen konnte, wenn sie vorbeifuhren. Vor ihnen, auf den mittleren Klappsitzen, saßen rechts der texanische Gouverneur John Connally und links seine Frau Nellie.
Die Gefahr, die das offene Cabriolet darstellte, war von mehreren Mitgliedern des Präsidentenschutzes als Grund zur Besorgnis angeführt worden, aber Präsident Kennedy hatte darauf bestanden, dass es eine Schande wäre, einen Tag mit derart bildschönem Wetter zu vergeuden. Da er den Wind und die Sonne auf seinem Gesicht spüren wollte, hatte er beschlossen, die Fahrt von Love Field zum Trade Mart ohne die schützende Plexiglashaube des Wagens zu unternehmen. Trotz aller Einwände hatten die Agenten eingewilligt.
Das Quartett von Motorradpolizisten der Polizei von Dallas, das die Limousine flankierte, hielt seine Formation, als sie die Kreuzung in Richtung der Auffahrt zum Stemmons Freeway überquerten. Clark schaute über die Schulter, in der Erwartung, wieder in das ihm zugewiesene Fahrzeug geschickt zu werden.
Ein Knall hallte von den Bürogebäuden wider und Clark wurde zum Jäger, der die Quelle suchte.
Ungeübte Ohren hätten dieses Geräusch für einen Feuerwerkskörper oder die Fehlzündung eines Autos halten können. Aber Clark und die anderen Agenten erkannten den Schuss eines Gewehrs, wenn sie ihn hörten.
Eine seltsame Elektrizität in der Luft ließ Clarks Nacken kribbeln. Er aktivierte die magische Allsicht von VELAR, die die Welt um ihn herum in blaues Monochrom tauchte. Seine gesteigerte Wahrnehmung führte zu Panik: Die vielen Sphären der magischen Verteidigung, die die Limousine des Präsidenten hätten umgeben sollen, waren alle auf einmal verschwunden – eine Katastrophe, die er für unmöglich gehalten hatte.
Aber das würde bedeuten …
Noch ein scharfer Knall eines Gewehrschusses.
Blut spritzte aus der Kehle des Präsidenten. Er umklammerte seine Wunde mit beiden Händen, während Gouverneur Connally, ebenfalls getroffen, zur Seite sackte. Die First Lady griff nach ihrem Mann, während Connally sich dem Präsidenten zuwandte. Verängstigte Stimmen erfüllten den Dealey Plaza.
Roy Kellerman, der Secret-Service-Agent auf dem Beifahrersitz der Limousine, warf einen Blick nach hinten, um zu sehen, was geschehen war. Gouverneur Connally lag in den Armen seiner Frau, so wie der Präsident in der Umarmung der geschockten Jackie zusammengesackt war.
Clarks geschulte Instinkte – die er sowohl durch die Ausbildung beim Secret Service als auch durch die bei der streng geheimen magischen Verteidigungsgruppe, angesiedelt unterhalb des Pentagons, trainiert hatte – setzten zu spät ein. Er nutzte die Gabe seines unterjochten Dämons XOLUS, um einen neuen unsichtbaren Schutzschild um das Auto des Präsidenten zu errichten.
Ein dritter Schuss aus dem Gewehr ließ Clarks im Entstehen begriffenen Schutzschild wie eine Seifenblase zerplatzen.
Kennedys Kopf explodierte in einer Wolke purpurner Gischt. Knochensplitter und blutverschmierte Hirnteile bespritzten das Innere der Limousine und überzogen die First Lady sowie Gouverneur Connally und seine Frau mit dunklen Punkten. Inmitten des Gemetzels erblickte Clark herabfallende Sträuße aus roten und gelben Rosen, als die Connallys sich in ihren Sitzen duckten. Zu seiner Verwirrung und Beunruhigung kletterte Mrs. Kennedy aus ihrem Sitz und krabbelte unbeholfen auf den langen Kofferraum der Limousine.
Zur selben Zeit versuchte der Secret Service Agent Clint Hill auf den hinteren Teil der Limousine zu klettern. Kellerman wies den Fahrer, Agent Bill Greer, an, den Präsidenten ins nächstgelegene Krankenhaus zu bringen. Der Wagen beschleunigte. Hill verlor den Halt, aber bei seinem zweiten Versuch kletterte er über den Kofferraum der Limousine und schob Mrs. Kennedy zurück auf ihren Sitz neben dem Präsidenten.
Clark, der sich verloren und überfordert fühlte, warf einen Blick zurück und suchte die Menge und den gesamten Dealey Plaza mit der Allsicht ab, in der Hoffnung, den Attentäter aufzuspüren. Am Boden herrschte das reinste Chaos – die Menschen rannten wild durcheinander, flohen vor den Schüssen und dem Blutvergießen – trotz der Bemühungen des Dallas Police Department und des Secret Service, die Ordnung wiederherzustellen und die Zeugen zu sichern.
Der Schütze hätte sich nicht unter die Menge gemischt. Er hätte sich einen Platz mit freier Sicht gesucht.
Sein Blick glitt nach oben und blieb am Texas Book Depository hängen.
Da – ein offenes Fenster im sechsten Stock, an der Ecke über der Kreuzung.
Clark streckte seine Wahrnehmung durch die Außenfassade des Gebäudes und entdeckte den Schützen. Es war zu dunkel, als dass Clark die Gesichtszüge des Mannes hätte erkennen können, aber der Schütze war von schlanker Statur und verließ eilig sein Schützennest. Innerhalb von Sekunden hatte er sich ins Innere des Gebäudes zurückgezogen und war außer Sichtweite.
Stimmen ertönten knisternd in den Funkgeräten. Der Agent im Führungswagen der Wagenkolonne befahl, das Fahrzeug von Vizepräsident Johnson von der Paraderoute abzulenken und zurück nach Love Field zu fahren, wo die Air Force One wartete. Um Clark Warden herum herrschte Chaos. Seine einzige Chance, die Flucht des Attentäters zu verhindern, bestand darin, zum Buchdepot zu gelangen und es abzuriegeln, bevor …
Jemand ergriff Clarks Arm und riss ihn herum.
Es war ein weiterer Agent, Daniel Jurow. »Hey! Wir müssen der Polizei von Dallas helfen, jeden ausfindig zu machen, der etwas gesehen hat. Das heißt alle, die am Straßenrand gestanden haben.«
Clark riss seinen Arm los und zeigte auf das Buchdepot. »Wir müssen das Gebäude abriegeln, sofort. Ich glaube, der Schütze hat aus dem Eckfenster im sechsten Stock geschossen.«
Jurow spähte mit zusammengekniffenen Augen zum Buchdepot hinüber. »Von ganz da oben? Sind Sie verrückt?« Er fegte Clarks Einwand mit einer Handbewegung beiseite. »Anweisung des Innenministers. Zeugenbefragung.«
Frustration stieg in Clark auf, wie ein Feuerball, der aus seiner Brust zu platzen drohte. Er konnte nicht erklären, woher er wusste, dass der Mörder des Präsidenten immer noch in diesem Gebäude war, ohne die operative Sicherheit zu verletzen oder die Existenz des amerikanischen Okkulten Verteidigungsprogramms zu enthüllen. Er hatte auch keine Möglichkeit, seine Informationen noch rechtzeitig weiterzugeben, damit jemand anderes darauf reagieren konnte. Um seine Tarnung zu wahren, musste er seine Befehle befolgen und den Mörder entkommen lassen.
Er verbannte die Wut aus seinem Gesicht und folgte Jurow in Richtung der nächstgelegenen Gruppe Zivilisten. Clark war sich sicher, dass diese nicht weniger hilfreich hätten sein können, wenn sie allesamt blind, taub und stumm gewesen wären.
Weniger als eine Stunde später hörte er die Nachricht im Radio.
Präsident Kennedy war tot.
Bevor der Tag zu Ende war, würde jemand dafür brennen. Clark Warden versprach sich selbst, dass er alles Nötige tun würde, um sicherzustellen, dass dieser jemand nicht er selbst war.
Draußen vor dem Bürofenster war alles ruhig. Der riesige Abgrund des Silos war leer und still. Die in den fünf Wänden eingelassenen Sensoren waren dunkel und inaktiv; die große fünfeckige Beschwörungsbühne stand leer am Ende eines langen und bedenklich schmalen Laufstegs, ihre Kohlenbecken unbeleuchtet und kalt.
Hunderte von Metern über dem geheimen Schwarzmagickerlabor und seinen mehrstufigen Kommando- und Kontrollsystemen herrschte im Pentagon höchste Alarmbereitschaft, fast schon Kriegszustand nach dem Attentat auf den Präsidenten. Jeder hatte seine eigene Lieblingstheorie. Einige gaben den Kommunisten die Schuld an der Ermordung. Andere zeigten mit dem Finger auf die Kubaner oder die Mafia. Einige Randgruppen flüsterten, es handele sich um ein lang geplantes CIA-Komplott, das als Reaktion auf Kennedys Umgang mit der Kubakrise in Gang gesetzt worden war.
Frank Cioffi scherte sich einen Dreck um all das. Er hatte größere Probleme. Zunächst einmal war er der Einsatzleiter des Okkulten Verteidigungsprogramms, des bestgehüteten Geheimnisses des amerikanischen Geheimdienstes, und seine wichtigste Anweisung, seine heiligste Pflicht hatte darin bestanden, das gewählte Staatsoberhaupt der Regierung der Vereinigten Staaten davor zu bewahren, auf offener Straße wie ein tollwütiger Hund erschossen zu werden. Man hatte ihm diese, die wichtigste aller Aufgaben übertragen und er und sein Team hatten es total vermasselt.
Es spielte also keine Rolle, dass sein Gesicht nicht rasiert war, dass sein Haar fettig und ungewaschen war oder dass seine Kleidung roch, als hätte er sie drei Tage lang ununterbrochen getragen. Was in diesem Moment zählte, war, dass Präsident John Fitzgerald Kennedy tot war und eine Menge mächtiger Leute von Frank Cioffi eine Erklärung dafür erwarteten, wie zum Teufel das möglich war, nach all dem Geld, das sie in sein Programm gesteckt hatten, und all seinen Versprechungen und Garantien, dass eine solche Tragödie niemals eintreten würde – nicht unter seiner Aufsicht. Aber sie war eingetreten. Und es gab einen verdammten Film davon. Ein Streifen stummes 8-mm-Filmmaterial, aufgenommen von einem Zivilisten namens Zapruder.
Ein verdammter Film. Himmel, Arsch und Zwirn.
Frank hatte sich alle Bänder angesehen. Er hatte alle Abschriften noch einmal gelesen. Er war vollkommen ratlos. Nichts davon ergab einen Sinn. Er und sein Team unter der Leitung von Briet Segfrunsdóttir hatten alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Sie hatten den Präsidenten nicht nur einfach, sondern sechsfach mit den Siegeln der sechs großen Minister der Hölle beschützt. Darüber hinaus hatte eine Bruderschaft von Weißmagickern, die im Auftrag der römischkatholischen Kirche arbeitete, Kennedy mit Engelsschutz gesegnet. Sie hatten diese besondere Anstrengung in Anerkennung seines Status als erster katholischer Präsident Amerikas unternommen.
Und nichts davon hatte eine Rolle gespielt. All diese Verteidigungsmaßnahmen – und das Gehirn des Präsidenten war trotzdem im Schoß der First Lady gelandet. Frank ging in seinem Büro auf und ab, unfähig, sich einen Reim darauf zu machen, und schimpfte im Stillen vor sich hin. Was für ein verdammtes Fiasko.
Um Punkt 15 Uhr klopfte es an seine Bürotür. Er wandte sich ihr zu. »Herein.«
Die Tür schwang nach innen. Ein stämmiger US-Marine-Sergeant und ein Marine-Corporal begleiteten Briet in Franks Büro, dessen Ausstattung jede Spur von Sentimentalität vermissen ließ. Sie sah wütend und zerzaust aus, was wahrscheinlich daran lag, dass man sie aus ihrem Haus gescheucht hatte, sobald der Mord am Präsidenten vom Geheimdienst bestätigt worden war. Frank sagte zu ihr: »Setzen Sie sich.« Er deutete auf die Marines. »Sie gehen raus.«
Die Marinesoldaten verließen das Büro und der Sergeant schloss die Tür. Briet ignorierte wie immer Franks Anweisungen und blieb stehen. Seine rothaarige Mitarbeiterin im schwarzen Trenchcoat ragte in der Mitte seines Büros auf wie eine Vulkaninsel, die darauf wartete, auszubrechen. »Ersparen Sie mir den Vortrag, Frank, ich weiß, was passiert ist. Was unternehmen wir?«
»Bis wir herausfinden, wie genau das Ganze passieren konnte? Nichts.«
Sie begann, vor seinem Schreibtisch auf und ab zu gehen. Das hatte er noch nie bei ihr erlebt. »Was wissen wir? Haben wir die Kugeln, die Kennedy getroffen haben? Die Waffe, die sie abgefeuert hat?«
Frank seufzte und blickte aus seinem Bürofenster auf das fünfzehn Meter tiefe Becken aus schwarzem Wasser, das den Boden des Silos bedeckte. »Da müssen Sie das FBI fragen.«
Briet schob sich die Haare zurück und offenbarte ihr kantiges Gesicht. Frank konnte beinahe sehen, wie sich hinter ihren eisblauen Augen die Zahnrädchen drehten, während sie angestrengt nachdachte. »Wir brauchen die Beweismittel, Frank. Die Kugeln, die Waffe, einfach alles. Und ich muss die Leiche sehen, so schnell wie möglich.«
»Dafür dürften mehr als nur ein paar Hürden zu überwinden sein.«
Sie blieb stehen und warf ihm einen Blick zu. »Warum?«
»Weil die magische Verteidigung des Präsidenten durchbrochen wurde und niemand weiß, wie.« Er spürte, wie ihn der Mut verließ, als er gestand: »Aber im Moment will das Verteidigungsministerium Ihnen die Schuld geben.«
»Oh, ich könnte drauf wetten, dass sie das tun.«
»Können Sie es ihnen verübeln? Nach Ihrem kleinen Stunt heute Morgen …«
»Mal im Ernst. Würde ich in dieser Sache drinstecken, wäre ich hier gewesen.«
Frank verdrehte die Augen. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen das irgendwas genützt hätte.«
Sie setzte sich wieder in Bewegung. »Ich schwöre Ihnen, Frank, ich weiß nicht, wer das getan hat. Aber was mich noch mehr beunruhigt, ist, dass ich nicht weiß, wie sie das Ganze bewerkstelligt haben.«
»Dann sollten Sie sich schnell eine Theorie einfallen lassen.« Frank neigte den Kopf in Richtung Tür. »Bevor diese Affen da draußen Ihren Arsch nach Leavenworth verfrachten.«
Ihre Augen weiteten sich. »Was soll das heißen, Frank?« Sie starrte Richtung Tür, dann kehrte ihr Blick zu ihm zurück. »Wollen Sie mir sagen, dass sie den Befehl haben, mich zu verhaften?«
»Es sei denn, Sie sagen mir irgendwas Nützliches? Ja.«
Sofort stellte sie sich kerzengerade hin, was sie einen Zentimeter größer erscheinen ließ, und ihr wütender Blick wurde hart und eisig. »Ich werde nicht den Sündenbock spielen.«
»Dann sollten Sie den hohen Tieren lieber gleich einen besseren Verdächtigen liefern.«
Sie schäumte. »Und wenn ich das nicht kann?«
»Dann sollten Sie sich daran gewöhnen, Kartoffeln zu schälen und gestreifte Pyjamas zu tragen.«
Ein sardonisches und zugleich bitteres Grinsen verzog ihre Miene. »Den Teufel werde ich tun.« Sie griff in ihren Trenchcoat und zog ihren Zauberstab hervor.
»Briet!« Frank hob die Hände. »Sie wissen, dass das hier drin nicht funktioniert!«
»Warum? Wegen der Anti-Magick-Verteidigung? Ich habe sie errichtet, Frank.«
»Verdammt, seien Sie vernünftig. Was glauben Sie, wie weit Sie kommen, wenn der Alarm ertönt? Zwischen Ihnen und dem Ausgang befinden sich wahrscheinlich hundert Marinesoldaten. Sie sind eine der besten Karcistinnen der Welt, aber selbst Sie können es nicht mit solchen Leuten aufnehmen.«
»Ich weiß.« Sie bedachte ihn mit einem verschmitzten Lächeln. »Gut, dass ich nicht darauf gehört habe, als man mir sagte, ich solle keine Dämonen mehr an mich binden.« Sie schwang ihren Zauberstab in einer dramatischen Spiralbewegung und bevor Frank etwas erwidern konnte, war Briet von einem Strudel blassblauer Flammen umgeben. Sein Büro wurde mit einem eiskalten Luftstoß erfüllt, der nach Schwefel und Asche stank.
Als die Flammen erloschen, war Briet verschwunden, doch der dämonische Gestank blieb.
Wie Frank schon lange befürchtet hatte, hatte Briet eine Schwachstelle in den magischen Verteidigungsanlagen des Silos verborgen – oder, wie ihre Computeringenieure es vielleicht genannt hätten, eine »Hintertür«.
Frank seufzte und ließ sich in seinen Sessel sinken. Briets jüngste Trotzreaktion – nur eine in einer langen Kette solcher Verstöße – würde für keinen von ihnen gut ausgehen.
Und was zur Hölle sollte er bloß den Marinesoldaten vor seiner Tür sagen …?
Er öffnete die unterste Schublade seines Schreibtischs, holte ein Glas und eine Flasche Glenlivet heraus und schenkte sich drei Finger voll des goldenen Whiskys ein.
Ein verdammtes Problem nach dem anderen.
»Wenn Sie meine Frage nicht beantworten können«, verlangte Kardinal Timo Moretti zu wissen, »wer kann es dann?«
Pater Bernardo D’Odorico, der gerade mit feierlicher Dankbarkeit seinen siebzigsten Geburtstag begangen hatte, fühlte sich zu alt, um einen solchen Grad an Gereiztheit zu tolerieren, nicht einmal von seinem sogenannten Vorgesetzten in der römisch-katholischen Kirche. Er betrachtete Kardinal Moretti mit unbewegter Miene. »Bei allem Respekt, Monsignore, ich denke, die einzige Person, die Ihre Frage mit Gewissheit beantworten kann, ist derjenige, der diese üble Tat begangen hat.«
Es war offensichtlich, dass der Kardinal sein Bestes tat, um nicht in D’Odoricos beengtem Büro in der Wallfahrtskirche Monte Paterno unruhig hin und her zu laufen. Infolgedessen beschrieb Moretti kleine Kreise, ein Verhalten, das seine Beunruhigung nur noch verstärkte. »Man sagte mir, Sie und Ihre Brüder seien die herausragenden Gelehrten der Kirche auf dem Gebiet der transzendentalen Magick.«
»Und das sind wir auch. Aber wir sind weit davon entfernt, allwissend zu sein, Eure Eminenz.«
Moretti blieb vor dem nächstgelegenen Bücherregal des Direktors stehen. Der Kardinal um die Fünfzig strich mit seinen Fingerspitzen über die Buchrücken mehrerer Bände mit theologischen, dämonologischen und rituellen Themen. Seine schwarze Soutane und die scharlachroten Accessoires, darunter sein auberginefarbenes Zucchetto, das Scheitelkäppchen, wirkten in der rustikalen Schlichtheit von D’Odoricos Büro mit seinen simplen, grob behauenen Holzmöbeln und -regalen und seinem verwitterten Boden aus handgeschnittenen Dielen fehl am Platz. »Keine Kugel hätte unsere Verteidigung gegen Kennedy durchdringen können«, sagte er schließlich. »Er wurde von den Engeln des Herrn, unseres Gottes, beschützt.« In seinen Augen standen Tränen der Wut. »Wie konnte das geschehen, D’Odorico? Wer könnte das getan haben?«
In dieser Frage steckte so viel Angst, so viel Schmerz, so viel Bedauern … Angesichts dessen war Pater D’Odorico unsicher, wie er antworten sollte. Er wollte seinem Freund Timo etwas zuteilwerden lassen, das wie eine Zusicherung, wie Trost klang … Aber sein Vorgesetzter, das ernannte Oberhaupt der Paulinischen Synode, war für eine Erklärung zu ihm gekommen, nicht um Trost zu suchen.
»Vergeben Sie uns, Kardinal. Meine Brüder und ich segneten Präsident Kennedy mit jeder uns zur Verfügung stehenden Verteidigung. Bis heute haben wir geglaubt, dass es in der Goetischen Kunst keine Macht gibt, die ihm etwas anhaben könnte.« D’Odorico senkte beschämt den Kopf. »Aber die Kirche hat uns die Hände gebunden.«
Dieses Eingeständnis veranlasste Moretti, sich von den Bücherregalen abzuwenden und D’Odorico mit einem Blick zu fixieren. »Die Hände gebunden? Erklären Sie das, Pater.«
Der anklagende Blick des Kardinals war zu viel für D’Odorico. Er wandte sich dem Fenster seines Büros zu und schaute stattdessen auf die schneebedeckten Dolomiten hinaus. »Ich bin sicher, dass Sie, Eminenz, besser als die meisten anderen wissen, unter welchen Beschränkungen wir unsere Forschung betreiben. Nicht nur, dass das Abkommen uns verbietet, uns in die Experimente unserer dunklen Kollegen einzumischen, auch die Kirche höchstpersönlich verbietet uns den Umgang mit den Gefallenen, selbst wenn es um reine Forschungszwecke geht.«
»Ich hoffe, Sie wollen damit nicht andeuten, dass Satan und Konsorten als Quellen der Wahrheit angesehen werden sollten.«
»Ganz und gar nicht, Monsignore.« D’Odorico musste seine nächsten Worte mit äußerster Vorsicht wählen. »Aber das Verhör von Agenten des Widersachers kann, wenn es mit großer Sorgfalt und unter heiliger Führung durchgeführt wird, Einblicke in die Machenschaften und Methoden der Hölle geben – Wissen, das genutzt werden kann, um die Pläne des Teufels gegen Gottes Schöpfung zu vereiteln.« Er versuchte, den Anschein schüchterner Bescheidenheit zu erwecken, und fügte hinzu: »Leider ist uns diese Einsicht seit vielen Jahrzehnten verwehrt. Und so hat der Feind im Dunkeln, jenseits unserer Wahrnehmung, gegen uns intrigiert.«
Moretti legte sich eine bleiche Hand auf den Mund, fuhr sich damit über das bärtige Kinn, glättete den grau melierten Schnurrbart und seufzte dann. »Erwarten Sie, dass ich das dem Heiligen Vater mitteile? Dass die Schuld an dieser Tragödie bei denen liegt, die den Waffenstillstand ausgehandelt haben, der Sie und Ihre Brüder davor bewahrt, zu Spielfiguren des Betrügers zu werden?«