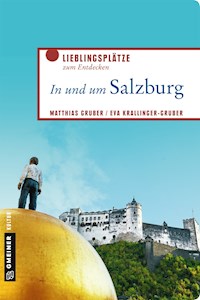Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ist vierzehn und wäre gerne wie andere Mädchen, vor allem schön. Doch Arielle hat kaum Haare am Kopf, mit ihren Zähnen stimmt was nicht, und obwohl Sommer ist, kann sie nicht schwitzen. Die Nachmittage verbringt sie mit ihrem Vater in den Wohnungen von Verstorbenen, um diese auszuräumen und das Brauchbare vom Müll zu trennen. Während er am Abend weggeworfene Festplatten nach Kryptogeld durchsucht, wühlt sie sich auf alten Handys durch fremde Existenzen – bis sie eines Tages auf Pauline stößt und die Fotos, die sie auf dem Telefon des unbekannten Mädchens findet, ins Internet hochlädt. Die Herzen fliegen ihr zu, auch das von Erich. Aber während ihr bald alles zu viel wird, findet ihre psychisch labile Mutter Gefallen an der ungewohnten Aufmerksamkeit und will den Kanal nutzen, um ihre ganz eigenen Träume zu verwirklichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE EINSAMKEIT DER ERSTEN IHRER ART
© 2023 Jung und Jung, Salzburg
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten
Umschlagbild: © Ewa Cwikla, Plastic Generation, 2018
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com
ISBN 978-3-99027-199-5
MATTHIAS GRUBER
Die Einsamkeit der Ersten ihrer Art
Roman
Für Lisa und Andreas
INHALT
01 AM BECKENGRUND
02 EXPLOSIONS OF ART
03 AUFZUGTIERE
04 GENDRIFT
05 EVOLUTION ÜBEN
06 EINDRINGLINGE
07 SCHLANGENSCHUSS
08 WÜSTENPLANET
09 GIFTKÖDER
10 DER ERSTE ATEMZUG
Have you seen her dressed in blue?
See the sky in front of you
And her face is like a sail
Speck of white so fair and pale
Have you seen a lady fairer?
The Rolling Stones: She’s A Rainbow
01
AM BECKENGRUND
Ich stand vor dem Spiegel und probierte Lachmünder an. Kreisrund schnitt ich sie mit der Schere aus Mutters Modezeitschriften. Dann befestigte ich sie mit Klebestreifen an den Enden der blauen Strohhalme aus der Küchenschublade. Ich stellte mich vor den Kleiderschrank in meinem Zimmer, streckte den Arm aus und ließ die Münder, einen nach dem anderen, zu meinen werden. Im Spiegel hatte ich ein Lächeln mit sanft geöffneten Lippen. Ein lippenstiftrotes Lächeln für den Moment der Verführung und eines für kopfschüttelnde Vergebung. Ganz und gar vollkommene Lächeln und solche, die erst durch einen Makel zu etwas Besonderem wurden. Ein Lächeln für jeden Moment.
»Arielle«, sagte Mutter. Ich drehte mich um und sah sie in der Zimmertür stehen. Auf der Titelseite der Zeitschrift in ihrer Hand bewarb eine mundlose Frau die Trends für den Landhaussommer. »Das muss aufhören, Arielle«, sagte sie. »Weißt du, was diese Magazine kosten?«
Ich schüttelte den Kopf und ließ mein Strohhalmlächeln sinken.
»Viel«, sagte sie. »Sehr viel. Trotz der ganzen Werbung.« Ich betrachtete die Frau auf der Titelseite. Wo ihr Mund gewesen war, konnte man im Heftinneren ein Stück nackten Oberschenkel erkennen.
»Schluss damit«, sagte sie. »Kein Zerschneiden mehr. Verstanden?«
Ich nickte. Mutter ließ das Heft sinken und sah sich im Zimmer um. Ihr Blick streifte den leeren Bettbezug, den ich der Hitze wegen wie einen Schlafsack benutzte. Den Ventilator und die gefrorene Mineralwasserflasche. Den Lachmundstapel auf meinem Schreibtisch. Ich wartete darauf, dass ihr Zorn sich neu entzünden würde, aber das geschah nicht. »Das hier kannst du behalten«, sagte sie und ließ die Zeitschrift aus ihrer Hand auf mein Bett fallen. »Darin kannst du herumschnippeln, so viel du willst.«
Später saß ich am Bettrand und blätterte durch Mutters Heft. Von den zerschnittenen Seiten starrten mich Models an, denen ich ihr Lächeln geraubt hatte. Hochglanzfotos ohne Mitte und ohne Bedeutung. Die Leute behaupteten, die Augen seien das Tor zur Seele, aber das stimmte nicht. Die Augen verrieten nichts. Ohne ihr Lächeln blieben die Frauen stumm. Stumm und ausdruckslos und ihrer selbst beraubt.
*
Das handgeschriebene Namensschild neben der Klingel von Familie Fischer war ein Überrest aus anderen Zeiten. Hier lebte schon lange keine Familie mehr. Zuletzt war es nur noch Herr Fischer, und auch der war jetzt tot. Vater drückte auf den Messingknopf neben dem Schriftzug aus verblasster Tinte. Dann noch einmal und noch einmal. Als niemand öffnete, läuteten wir so lange bei den anderen Türschildern, bis sich jemand erbarmte und die schwere Eingangstür aus Glas und Metall entriegelte. Seit das Gebäude mit all den Mietern an einen Investor verkauft worden war, kamen wir oft hierher, um einzusammeln, was die toten Rentner in ihren Wohnungen zurückließen. Wir fanden Bücher ohne antiquarischen Wert, alte Kleidung und Dinge, die in Schreibtischschubladen die Jahre überdauert hatten. Wir packten alles in Schachteln, verstauten sie in Vaters Kastenwagen und brachten sie auf den Müll. Sobald unsere Arbeit getan war, kamen die Handwerker, um Emaillewannen durch Regenwaldduschen zu ersetzen und Erinnerungen aus dem Fischgrätparkett zu schleifen. Ein paar Wochen später konnte man die Wohnungen stilvoll ausgeleuchtet auf den Webseiten der Immobilienbüros bewundern. Manchmal zeigte Vater mir die Anzeigen, wenn er abends vor seinem Computer saß. Er tat es mit einem Anflug von Werkstolz und fragte sich zugleich, wer die geforderten Summen für den Kauf solcher Objekte aufbringen konnte.
Oben war die Wohnungstür der Fischers nur angelehnt. Es war die letzte ihrer Art im dritten Stock, mit geschwungenen Zierleisten, einem großen Guckloch und einer Drehklingel aus Messing. Bald würde auch sie verschwunden sein. Die neuen Bewohner setzten auf Sicherheitstüren. Weiß und flach und undurchdringlich. Noch war es kein gutes Viertel.
Vater klopfte. Erst zögerlich, dann fester. In der Wohnung rührte sich nichts. Er blickte auf die Uhr an seinem Handgelenk und schüttelte den Kopf. Schließlich zog er das zerkratzte Tastentelefon aus seiner Hosentasche und wählte die Nummer von Herrn Fischers Tochter. Ich konnte das Freizeichen an seinem Ohr hören, Augenblicke später begann in der Wohnung ein Telefon zu läuten. Die Melodie kannte ich aus der Werbung. Ein junges Paar saß auf einem schmalen Balkon und aß Pizza von einem Tisch mit karierter Tischdecke. Erst am Ende des Spots stellte sich heraus, dass die beiden sich nicht über den Gassen einer italienischen Kleinstadt befanden, sondern an einer stark befahrenen Straße irgendwo in Deutschland.
Wir betraten die Wohnung und folgten dem Pizzalied durch den dämmrigen Flur, vorbei an Nippesfiguren auf Häkeldecken und Landschaftsgemälden in Holzrahmen. Vorbei an den Spuren, die Herr Fischer hinterlassen hatte. Wenn Menschen gingen, verschwanden sie nicht einfach. Jeder ließ etwas zurück, und Vater und ich kümmerten uns darum. Wir sammelten die Reste ein und schufen Platz für Neues.
Am Ende des Ganges hob die Melodie hinter einer verschlossenen Tür zur dritten Strophe an. Vater drückte die Klinke, machte einen Schritt ins Zimmer und blieb abrupt stehen. Ich spähte an ihm vorbei in den Raum.
»Wir haben geläutet«, sagte er zu der Frau, die am Fußende eines Ehebettes saß.
»Schon gut«, sagte die Frau. Eine Weile betrachtete sie das Telefon in ihrer Hand. Dann drückte sie eine Taste, um aufzulegen. Das Pizzalied verstummte. Rings um sie herum lagen Kleiderstapel auf der Tagesdecke. Schubladen und Türen standen offen. In ihrem Schoß ruhte ein rotes Stück Stoff.
»Wir können später wiederkommen«, sagte Vater, obwohl das nicht stimmte. »Oder in der Küche anfangen.« Er nahm die Hand von der Klinke und trat zögerlich ein.
»Das ist nicht notwendig«, sagte Frau Fischer. Sie griff nach dem Stück Stoff und legte es zu den anderen Dingen auf die Tagesdecke. Dann stand sie auf und strich mit den Handflächen über die breiten Falten ihres Rocks. »Es ändert ja doch nichts.«
Vater nickte und sah sich um. »Bleibt das alles hier?«
»Fast alles«, sagte Frau Fischer. Sie blickte zu Boden und stieß mit der Schuhspitze gegen eine Sporttasche. »Es sind nur ein paar Dinge, die ich behalten will.«
»Dann kommen wir mit den kleinen Kisten nicht weit«, sagte Vater und drängte sich an mir vorbei zurück in den Flur, um die großen Schachteln aus dem Auto zu holen. Im Stiegenhaus hörte ich ihn zwei Stufen auf einmal nehmen.
»Du kannst mir mit der Vitrine helfen«, sagte Frau Fischer und deutete auf einen Schrank, durch dessen Glastüren Pokale und vergoldete Teller zu sehen waren. »Das Allerheiligste.« Sie bückte sich nach einer Rolle schwarzer Müllsäcke, drei Versuche waren nötig, um die Plastikfolie abzureißen. Dann öffnete sie die Vitrine. Die Neonröhre sprang mit einem Klicken an und beleuchtete die Trophäen im Inneren. Gravierte Kelche und Medaillen an rot-weißen Bändern, dazwischen verblasste Urkunden. Eine Weile betrachtete Frau Fischer unentschlossen die Erinnerungsstücke, dann griff sie nach einem kleinen Bilderrahmen aus Holz. Das Foto darin zeigte einen untersetzten Mann mit kreisrunder Glatze und Schnurrbart, der von zwei Mädchen in Turnanzügen flankiert wurde. Der Mann hatte den Arm um die Schultern der Kinder gelegt, die beiden hielten ihre Medaillen in die Kamera und grinsten stolz. Einem der Mädchen fehlte ein Vorderzahn. Frau Fischer seufzte leise.
»Dann haben Sie die alle gewonnen?«, fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf und wischte mit dem Handballen über die Scheibe, obwohl darauf gar kein Staub lag. »Ich war, wie er gerne gesagt hat, sein größter Misserfolg.« Dabei verstellte sie ihre Stimme, um jemanden zu imitieren.
»Das tut mir leid«, sagte ich.
»Muss es nicht«, erwiderte Frau Fischer, »er hatte seine Erfolge.« Sie stellte das Bild zurück an seinen Platz und nahm einen der Pokale aus dem Schrank. »Ich glaube, in Wahrheit hat er sie immer als seine eigenen betrachtet«, sagte sie und ließ den Kelch in den leeren Müllsack fallen, sodass er mit einem dumpfen Geräusch am Boden aufschlug. Dann nahm sie einige Medaillen und einen vergoldeten Teller aus der Vitrine und warf auch diese hinein. So ging es eine Weile, bis sich in der obersten Regalreihe nichts mehr befand als eine ordentlich zusammengelegte Trainingsjacke.
»Als Kind habe ich ihn überhaupt nur so gekannt«, sagte Frau Fischer. Sie faltete das Kleidungsstück auseinander und betrachtete es mit ausgestreckten Armen. Dann führte sie es an ihr Gesicht. »Sein Geruch ist immer noch da.« Sie ließ die Jacke sinken, als wäre es ihr unangenehm, dass ich sie dabei beobachtet hatte, und fuhr mit ihrer Arbeit fort. Im Inneren des schwarzen Müllsacks schlugen die Trophäen klimpernd aufeinander. »Kennst du das?«, sagte sie irgendwann. »Man ist eine Weile nicht zuhause, und wenn man zurückkommt, kann man für einen Moment die eigene Wohnung riechen.«
Ich schüttelte den Kopf und versuchte, mich an den Geruch unseres Hauses zu erinnern, aber es gelang mir nicht. Ich konnte mich an alles Mögliche erinnern, aber daran nicht.
»Als Kind habe ich das sehr gemocht«, sagte Frau Fischer. »Als könne man das eigene Leben einen Augenblick lang von außen betrachten.«
Ich blickte mich nach Vater um, aber es würde dauern, bis er von unten zurückkehrte. An der Wand neben dem Trophäenschrank hing das Bild eines Stabhochspringers. Es zeigte ihn am Scheitelpunkt seiner Flugbahn. Im Augenblick der Aufnahme war nicht zu erkennen, ob es ihm gelingen würde, das Hindernis zu überwinden. Frau Fischer ließ einen weiteren Pokal in den Müllsack fallen, die Vitrine war nun fast leer. Auf den Glasplatten hatten die Sockel der Trophäen Quadrate und Kreise hinterlassen. Nur das Foto der beiden Mädchen in ihren roten Turnanzügen stand noch da.
»Ist das Ihre Schwester?«, fragte ich und zeigte auf das Kind mit dem fehlenden Milchzahn.
Frau Fischer schüttelte den Kopf. »Wir haben zusammen trainiert.« Sie hob mit beiden Händen den Müllsack an, um zu testen, ob er reißen würde. Eine Glasscheibe knirschte im Inneren. »Als Kinder waren wir uns nah.« Sie griff ein zweites Mal nach dem Foto und betrachtete es eine Weile. »Später hat sie sich mir anvertraut. Da lag alles schon hinter ihr.«
Vor dem Fenster stakste eine Taube mit kratzenden Tritten über die Dachrinne und flatterte davon. Unten fiel die Tür ins Schloss. Vaters Schritte hallten durchs Stiegenhaus.
»Wenn ich danach hierhergekommen bin, war es anders«, sagte Frau Fischer. »Dieser Geruch. Richtig geekelt habe ich mich davor.« Sie ließ sich auf die Bettkante sinken und betrachtete den Bilderrahmen in ihrem Schoß. »Naja«, sagte sie, wie man etwas zur Seite legt, das schlecht gelungen ist. Als Vater den Raum betrat, ließ sie das Bild in den Müllsack fallen.
»Wir würden dann anfangen«, keuchte er.
»Sie können alles mitnehmen«, antwortete Frau Fischer und stand auf.
»Wir nehmen nur mit, was beweglich ist. Die schweren Teile holt später der Möbeltrupp.« Vater wischte sich mit dem Handgelenk über die Stirn, dann begann er, die perforierten Kartontafeln zu Schachteln zusammenzufalten. Dabei machte er wie immer einen Fehler und musste noch einmal von vorne anfangen.
Frau Fischer bückte sich nach der Sporttasche, stellte sie aufs Bett und legte das rote Stück Stoff hinein, das bei unserer Ankunft in ihrem Schoß gelegen war. Sie tat es sanft, wie man ein Kätzchen anfasst.
»Und die Pokale?«, sagte Vater und deutete auf den schwarzen Plastiksack, der offen neben der Vitrine lehnte. »Sollen wir die wirklich alle wegwerfen?«
Frau Fischer betrachtete die leere Vitrine und wandte sich dann ab, ohne die Frage zu beantworten. »Das muss Ihnen seltsam vorkommen.«
Vater sah sich ratlos um, als hätte er etwas Wichtiges übersehen.
»All diese Wohnungen zu durchstöbern.«
»Keine Sorge, wir nehmen nichts mit. Wir bringen die Sachen nur zur Entsorgung. Das steht auch so im Vertrag.«
»Ich mache mir keine Sorgen«, sagte Frau Fischer. »Sie würden hier ohnehin nichts mehr finden.« Sie zog den Reißverschluss zu und hängte sich den Gurt der Sporttasche über die Schulter. »Ich meinte nur«, sie dachte einen Augenblick nach, »es muss seltsam für Sie sein. Jeden Tag in fremden Leben zu wühlen.«
»Wissen Sie«, sagte Vater, während er weiter Schachteln zusammenfaltete, »die Arbeit ist eine Plackerei. Vor allem in den alten Häusern. Und bei dieser Hitze. Der Körper macht das nicht mehr mit, ab einem gewissen Alter.« Er fasste sich an die Hüfte.
»Aber Sie haben eine großartige Hilfe«, sagte Frau Fischer und lächelte in meine Richtung. Ich drehte mich weg, sodass ich mein Spiegelbild in der leeren Vitrine sehen konnte. Ohne Trophäen wirkte der Kasten viel kleiner. Die Rückwand war mit Silberfolie beklebt.
»Muss ich noch etwas unterschreiben?«, fragte Frau Fischer.
»Nein«, sagte Vater. »Wenn es für Sie so in Ordnung ist.«
Sie nickte und wandte sich zum Gehen. An der Tür machte sie noch einmal kehrt, kramte im Netz der Sporttasche nach ihrem Portemonnaie und reichte Vater einen Geldschein. Er nahm ihn entgegen und steckte ihn in die Hosentasche.
»Was stimmt nicht mit ihr?«, fragte Frau Fischer, als wäre ich gar nicht da.
Vater öffnete den Mund, sagte dann aber nichts.
Als sie gegangen war, sammelten wir alles ein. Wir luden die Kisten in den Lieferwagen und brachten sie zur Müllhalde. Wir verteilten die Dinge auf Container: Sperrmüll, Karton, Metall, Textilien, Holz und Elektrokleinteile. Was dann von Familie Fischer übrig war, warfen wir für 20 Cent das Kilo auf den Restmüll.
*
»Die Rumänen werden immer aggressiver«, sagte Heinz und lachte ein Lachen, das auch ein Husten hätte sein können. »Wenn sie noch einmal in der Nacht kommen, besorgen wir einen Hund. Oder eine Waffe.« Er ließ sich auf den Tresen sinken, an dem der Parteienverkehr abgewickelt wurde, und drückte auf den Einschaltknopf des Ventilators. Schweißgeruch wehte uns ins Gesicht.
»Mittlerweile haben sie es sogar auf den Bauschutt abgesehen«, sagte er zu Vater, während mein Blick durch das Büro der Müllplatzverwaltung wanderte. Ich sah die Ringe der Kaffeetassen auf Heinz’ Schreibtisch, dahinter den Bildschirm, auf dem sich Frauen in Unterwäsche nach Dingen bückten.
»Hast du etwas hereinbekommen?«, fragte Vater und trat kaum merklich mit der Schuhspitze gegen den Tresen. Heinz ging in die Knie, kramte etwas hervor und stellte dann eine Kartonschachtel neben den feuchten Fleck, den sein Unterarm auf der Tischplatte hinterlassen hatte. In der Schachtel lagen Festplatten und USB-Sticks, ein Mobiltelefon mit kaputtem Display und eines mit einem Einhornsticker auf der Rückseite. Das Einhorn war rosa und sah aus, als hätte jemand zu oft mit dem Finger daran gekratzt.
»Irgendwann musst du mir das mit dem Computergeld erklären«, sagte Heinz, während er mit dem Daumen in der Nase bohrte. Sein Fingernagel war gelb und so groß, dass er fast nicht in das haarige Nasenloch passte. »Gestern war wieder etwas in den Nachrichten.«
»Ja«, sagte Vater und starrte in den Karton, als wäre er längst woanders. Er legte einen Zehner auf die Tischplatte und schob ihn mit der flachen Hand von sich weg. Dann nahm er die Schachtel vom Tresen und stellte sie auf den Boden, wo Heinz sie nicht mehr erreichen konnte.
»Der Strom war auch schon wieder weg«, sagte Heinz und säuberte mit den Schneidezähnen seinen Daumennagel. Mit der anderen Hand griff er nach dem Zehner und steckte ihn ein, ohne eine Quittung zu schreiben. Dann verschwand er in seinem Büro und kam mit zwei Bierdosen zurück.
»Gestern hat der Idelberger eine ganze Palette vorbeigebracht«, sagte er und reichte eine Dose über den Tresen.
»Hast du inzwischen mit ihm reden können?«, fragte Vater. Aluminium knackte. Heinz schüttelte den Kopf, während er den Schaum vom Dosenrand schlürfte.
»Ari«, sagte Aljosa leise und zupfte mich von hinten am Ärmel. Ich hatte ihn gar nicht eintreten gehört. »Komm mit«, flüsterte er. »Ich muss dir etwas zeigen.« Dann zog er mich an der Schulter nach draußen.
Unser Weg führte vorbei an alten Menschen, die aussahen, als würden sie nach etwas suchen, das jemand weggeworfen hatte, ohne um Erlaubnis zu fragen; vorbei an Männern, die sich freuten, wenn Dinge beim Aufprall kaputtgingen. Wir erklommen auf allen Vieren einen Hang aus losem Mauerwerk, das unseren Schritten kaum Halt bot. An einer zerbrochenen Fliese funkelte der Regenbogenfisch. Als wir den Gipfel des Trümmerhaufens erreichten, klebte Staub auf Aljosas verschwitzten Armen, meine Haut war trocken wie immer.
Von hier oben konnten wir alles sehen: das Verwaltungsgebäude mit dem Kiesdach, in dem Heinz sein Büro hatte; dahinter die einstöckige Dienstwohnung, in der er mit Aljosa lebte; und gleich daneben der Sammelplatz mit den Containern, wo unentwegt Männer aus Autos stiegen, um ihre Schultern mit immer größeren Gegenständen zu beladen. Ich stellte mir vor, dass die schwere Arbeit ihre Körper so lange verformte, bis sie irgendwann den Schattenungetümen glichen, die wir von hier oben sahen. Nur Vaters Körper widersetzte sich der Verwandlung. Er blieb, wer er war: schmal und feingliedrig und nicht für diese Arbeit gemacht.
Früher war er zusammen mit Heinz in einem weißen Raum gestanden, um Computerchips auf Platinen zu kleben. Er hatte weiße Kleidung getragen, an der kein Staub haften blieb, und weiße Plastikbeutel über die Schuhe gezogen. Dann hatte das Werk geschlossen. Heinz fand Arbeit bei der Gemeinde, und Vater kaufte einen Kastenwagen, um auf eigene Rechnung Wohnungen auszuräumen. Er litt unter Rückenschmerzen, die nie wirklich verschwanden. Er behandelte sie mit Spritzen, die Mutter ihm in den Rücken injizierte, aber das half nicht. Und wenn doch, dann half es nie lange.
»Schau«, sagte Aljosa. »Dort drüben.« Er deutete mit ausgestrecktem Arm in die entgegengesetzte Richtung, weg von Heinz’ Büro und den schwitzenden Männern an den Containern. Eine Weile begriff ich nicht, was er mir zeigen wollte, dann sah ich die Kleiderpuppen. Mit verrenkten Gliedmaßen standen sie am Fuß des Trümmerbergs. Wie eine Gruppe verirrter Touristen, die in der Fremde falsch abgebogen waren.
»Woher sind die?«, fragte ich.
»Ich habe sie gerettet«, sagte Aljosa, und dass er den ganzen Nachmittag gebraucht habe, um die Puppen aus den Sperrmüllcontainern hierherzutragen, in jenen abgelegenen Teil des Müllplatzes, den außer uns nur selten jemand betrat. »Komm«, sagte Aljosa und nahm mich an der Hand. »Wir kleiden sie ein.«
Unten angekommen brachten wir die Puppen erst einmal in Sicherheit. Dann liefen wir zur Textilpresse und schleiften prall gefüllte Säcke mit Kleidung durch den Staub in Aljosas Studio. Er nannte es so – das Studio –, obwohl es doch viel eher an eine Theatergarderobe erinnerte, in der Tänzerinnen sich auf ihre Auftritte vorbereiteten. Zumindest stellte ich es mir so vor. Jedes Mal, wenn Vater mich auf den Müllplatz mitnahm, hatte Aljosa dem Studio etwas hinzugefügt: eine elektrische Trockenhaube, einen Koffer mit vertrockneten Nagellackfläschchen oder einen alten Friseursessel, aus dessen Sitzfläche Watte quoll. Sogar einen echten Theaterspiegel mit einem Kranz aus Glühbirnen gab es. Der Spiegel war das einzige, das Aljosa von den Sachen seiner Mutter hatte retten können, den Rest hatte Heinz eines Tages auf den Müll geworfen, während sein Sohn in der Schule war. Als Aljosa nach Hause kam, war alles fort gewesen. Außer der Spiegel.
Die Regeln des Wettbewerbs waren einfach: Jeder von uns durfte fünf Puppen ankleiden, dann ließen wir sie gegeneinander antreten. Im Fersensitz hockten wir auf dem staubigen Boden und bewerteten sie mit Punkten, wie die Juroren im Fernsehen. Meine Puppen machten sich schlecht. Im Gegensatz zu denen von Aljosa fehlte ihren Outfits jede Raffinesse, und nach der zweiten Runde waren sie alle ausgeschieden. Aljosas Puppen dagegen sahen aus, als hätte ein großer Designer sie eingekleidet. Eines der beiden Modelle, die es bis ins Finale geschafft hatten, trug einen efeugrünen Plisseerock und dazu eine hochgeschlossene, weiße Bluse. Die zweite Puppe trug einen cremefarbenen Jumpsuit mit knallgelbem Bananenprint, dazu Sportsocken und Turnschuhe mit einer sehr hohen Sohle. Aljosa sagte Dinge wie: »Das haben wir alles schon einmal gesehen, aber nicht in dieser Ehrlichkeit«, oder: »Dort, wo Mode gelingt, kehrt sie unser Innerstes nach außen.« Dabei blieb er sehr ernst, und ich dachte, dass er eines Tages wirklich im Fernsehen auftreten würde. Am Ende gewann die Puppe mit dem grünen Rock. Wir einigten uns darauf, dass ihr Outfit gerade durch seine Schlichtheit Horizonte öffnete, und freuten uns über ihren Triumph.
Später nahmen wir die Kleidungsstücke, die uns am besten gefielen, und probierten sie selbst an. Aljosa trug ein rotes Wickelkleid mit schwarzen Punkten, dazu Schuhe mit hohen Absätzen, die seine Beine noch länger erscheinen ließen. Mühelos stolzierte er auf Trümmern umher und schoss Fotos, während ich vergeblich nach etwas Passendem für mich suchte.
»Bleib so«, sagte Aljosa. Er drehte übertrieben oft an der Linse des alten Fotoapparates und drückte dann ab. Dabei wusste ich nicht einmal, ob die Kamera überhaupt funktionierte.
»Ich bin zu klein«, sagte ich und trat mit staubigen Schuhen gegen einen Stein.
»Wir finden schon etwas«, sagte Aljosa. Er legte die Kamera weg und half mir bei der Suche. Schließlich reichte er mir ein gelb-weiß-gestreiftes T-Shirt mit sehr kurzen Ärmeln und eine Latzhose aus Denimstoff. Wie fast alles in meiner Größe waren es Kleidungsstücke für Kinder, aber zumindest sah man es ihnen nicht an.
»Und jetzt«, sagte Aljosa und führte mich zu dem Friseursessel mit dem Brandloch, »jetzt machen wir dich schön.«
Aljosa arbeitete wie immer mit großer Ernsthaftigkeit. Durch den Theaterspiegel beobachtete ich ihn, wie er Schwämmchen in Gefäße tauchte, die er aus dem Müll gefischt hatte. Ich genoss die sanften Berührungen seiner Finger, das Kitzeln der Pinsel auf meiner Haut. Ich befolgte seine Anweisungen. Die Lippen nach innen ziehen und aufeinander drücken, die Augen schließen, aber nicht zu fest. Augen wieder auf. Das Kinn ein wenig anheben.
»Jetzt habe ich noch eine Überraschung für dich«, sagte er schließlich, legte den Pinsel zur Seite und verschwand hinter dem Spiegel. »Aber nicht schauen!«
Ich schloss die Augen und betrachtete die Abdrücke der Welt auf der Innenseite meiner Lider. Dann spürte ich, wie Aljosa den Friseursessel ein wenig zur Seite drehte. Ich spürte seine Hand auf meinem Kopf, und dann spürte ich, wie etwas meine Ohren und meinen Hals kitzelte.
»Jetzt«, sagte Aljosa nach einer Weile. Er zupfte noch ein paar Mal an mir herum und drehte mich zurück vor den Spiegel. »Jetzt darfst du sie aufmachen.«
Als ich die Augen öffnete, sah ich die Perücke auf meinem Kopf. Rote Locken fielen tief in meine Stirn und über meine Schultern hinab. Aljosa hatte ganze Arbeit geleistet, das Outfit, die Frisur, das Make-up, alles passte zusammen. Sogar meine unsichtbaren Augenbrauen hatte er mit einem dunklen Stift nachgezogen, und von der Narbe über meiner Lippe war fast nichts mehr zu erkennen.
»Gefällt es dir?«, sagte Aljosa und legte seine Hand auf meine Schulter. Ich nickte und vergaß für einen Augenblick, dass dort, wo nun die Perücke saß, nur schüttere Haarbüschel waren, kaum mehr als der Flaum eines Kükens.
»Schön bist du«, sagte Aljosa und strahlte mir aus dem Spiegel entgegen. »Eine richtige Arielle.«
Ich nickte und lächelte mein schönes Lächeln. Ein Lächeln mit geschlossenem Mund, bei dem ich die Kontrolle über meine Gesichtszüge behielt. Dann blickte ich ein weiteres Mal zu Aljosa auf, bemerkte die Zufriedenheit in seinem Gesicht und verlor die Kontrolle. Aus meinem schönen Lächeln wurde ein Strahlen, dann ein Lachen mit offenem Mund. Ein Lachen, dem die Zähne fehlten. Dem alles fehlte, was einen Moment des Glücks von einem bitteren Scherz unterschied. Im Spiegel musste ich dabei zusehen, wie die Hässlichkeit mitten durch mein Lachen drang, und als ich es endlich geschafft hatte, die Hand vor meinen Mund zu schieben, war es zu spät.
»Du kannst die Perücke behalten«, sagte Aljosa so beiläufig wie möglich. Ich konnte sehen, dass er sich schämte.
»Das ändert aber nichts«, antwortete ich und machte eine Bewegung mit der Schulter. Er nahm seine Hand weg. Dann zog ich die Perücke vom Kopf und warf sie fort.
Später lagen wir auf alten Sofas, die Arme hinter den Köpfen verschränkt. Aljosa hatte die Augen geschlossen, seine Lider mit den feinen, blauen Adern zitterten im Sonnenlicht. Die Sofas rochen nach dem Fell von Hunden, die Luft roch nach Rauch. Ich stellte mir vor, wie es früher einmal gewesen war. Als all die Dinge um uns herum noch nicht in Containern gelegen waren, sondern dort, wo sie hingehörten. Dann dachte ich, ob es möglich wäre, alles wieder zusammenzusetzen. Ich fragte Aljosa danach, aber er schüttelte nur den Kopf.
»Vielleicht eine Maschine«, insistierte ich, »eine künstliche Intelligenz.« Ich dachte an einen sehr großen, sehr klugen Menschen.
»So etwas gibt es aber nicht«, sagte Aljosa blinzelnd. »Und selbst wenn, irgendetwas fehlt doch immer. Irgendetwas bleibt immer verloren.«
Als wir später mit dem Lieferwagen auf die Hauptstraße abbogen, fragte ich Vater, warum Heinz den Müll beschütze, als wäre es seiner.
»Der Müll gehört nicht Heinz, sondern der Stadt«, sagte Vater, und dass Heinz es gut erwischt hätte mit dem Job auf der Müllhalde.
Vater rülpste lautlos, und im Auto verbreitete sich Biergeruch. Zwischen seinem Sitz und meinem stand die Kiste mit den Festplatten. Wenn wir über ein Schlagloch fuhren, rumpelte es im Karton, und Vater legte seinen Arm darauf. »Wir sind Goldgräber«, sagte er, und dass wir Glück hätten, in dieser Pionierzeit zu leben. Sein Blick pendelte zwischen der Straße und der Kiste mit den Festplatten. »In ein paar Jahren wird alles anders sein, dann wird es keine Festplatten mehr geben«, sagte er. »Dann gibt es nur mehr die Cloud, und alle unsere Daten schweben irgendwo dort oben.«
Ich blickte aus dem Fenster. Es waren keine Wolken zu sehen. Nur reines Blau. Und ohnehin, dachte ich, war die Cloud keine Wolke, sondern ein Kabel. Nicht eines. Tausende. Kabel, die in der Erde vergraben wurden, immer dichter und dichter, bis sie alles erdrücken. So stellte ich es mir vor.
*
Wir hielten an der Ampel. Vaters Blick folgte einem Mann, der aus einem Lokal in die Sonne trat, um sich auf den Gehsteig zu übergeben. Etwas weiter die Straße hinunter schoben zwei Frauen in Trainingshosen einen Einkaufswagen die Fahrbahn entlang. Vater legte den Gang ein und richtete sich unter Schmerzen im Fahrersitz auf. Wir fuhren vorbei an Tankstellen mit Münzsaugern und an Wettcafés mit verklebten Scheiben. Vorbei am alten Geschützturm und an der ehemaligen Brauerei, in deren Keller einmal Flugzeuge für den Weltkrieg gebaut worden waren und wo nun Pilze für veganen Leberkäse wucherten. Vorbei am gusseisernen Tor einer Arbeiterwohnanlage aus dem letzten Jahrhundert, an Paketshops und Auslagen mit gebrauchten Mobiltelefonen. Vorbei an dem Waldstück am Fluss, in dem Kinder Fahrwege angelegt hatten und in dem vor einigen Jahren eine Frauenleiche gefunden worden war. Vorbei an einer Kleingartensiedlung und den Häusern unserer Nachbarschaft, die sich enger aneinanderduckten, je näher wir den Hängen der Weinberge kamen. Wir lebten dort, wo die Leute sagten, dass die Ränder waren. Dabei hatten sich die Ränder längst aufgelöst. Alles floss ineinander, und dort, wo sich das Zentrum befand, hatte nichts etwas mit uns zu tun.
Im Keller klatschten Mutters Handschuhe gegen die Wäschetrommel. Durch ein vergittertes Fenster drang ein Lichtstrahl in den dämmrigen Raum und warf ein Muster an die gegenüberliegende Wand, genau dort, wo, in Plastikfolie eingeschweißt, Mutters Cremen im Regal standen. Draußen am Gehsteig ging jemand mit schnellem Schritt vorbei. Ich konnte seine Hosenbeine bis zu den Knien sehen, dann war er fort. Ich schlüpfte aus meinen Turnschuhen und legte mich unter den Wäscheleinen flach auf den Steinboden. Dann schloss ich die Augen und wartete, bis die Hitze aus meinem Rücken kroch. Es gab viele Wege, um mit der Hitze fertig zu werden. In der Schule machte ich graue Papierhandtücher im Waschbecken nass und stopfte sie unter meine Kleidung. Ich packte Plastikflaschen voll gefrorenem Wasser in meinen Rucksack und trank daraus, so oft ich konnte. All das half, um an heißen Tagen nicht das Bewusstsein zu verlieren, aber wenn die Hitze aus meinem Körper verschwinden sollte, musste sie aus meinem Rücken entweichen, dort hatte sie ihr Nest. Und von dort breitete sie sich aus, wogend und flirrend wie Quallenschwärme. Ich wusste von Menschen, deren Gliedmaßen schmerzten, obwohl man ihnen Arme und Beine längst abgenommen hatte. Die Schweißdrüsen unter meiner Haut hatte es nie gegeben, und doch juckte und brannte jede einzelne von ihnen bei dem Versuch, mich abzukühlen. Der Körper begriff nicht. Er tat, wofür er gemacht war.
»Hast du mich erschreckt!«, sagte Mutter. Den leeren Wäschekorb in die Hüfte gestemmt, stand sie in der Kellertür und blickte im Dämmerlicht zu mir herab. Ich hatte sie nicht kommen gehört, vielleicht war ich auch eingeschlafen. An der Decke sprangen glucksend die Neonröhren an.
»Ist dir wieder zu heiß geworden?«, fragte sie.
Ich richtete mich auf und nickte. Das weiße Licht tat in den Augen weh.
»An solchen Tagen solltest du gar nicht hinaus.« Sie betrat den Raum und ging vor der Waschmaschine in die Knie. Das Telefon hinterließ in der Gesäßtasche ihrer Jeans einen viereckigen Abdruck.
»Als Kind hast du das auch schon gemacht«, sagte sie. »Überall haben wir dich gesucht, dabei bist du die ganze Zeit unten im Keller gelegen.« Sie leerte die Trommel und ging mit dem Korb voller Wäsche quer durch den Raum. Feuchter Waschmittelduft breitete sich aus. Im Liegen konnte ich sehen, wie sie einen Handschuh neben den anderen an die Leine hängte.
»Was ist denn mit denen passiert?«, sagte sie und stieß mit ihrer Fußspitze gegen meine staubigen Turnschuhe.
»In dem Haus war eine Baustelle«, log ich.
»Für die Baustelle habe ich sie dir aber nicht gekauft«, antwortete Mutter. Sie hängte den letzten Handschuh auf und ließ eine Kluppe zurück in den Kübel fallen. Dann griff sie nach den staubigen Schuhen, musterte sie kopfschüttelnd und trug sie zur Waschmaschine. Ich konnte hören, wie sie die Türe mit lautem Klicken ins Schloss drückte und Wasser in die Trommel strömte. »Kommst du?«, fragte sie von der Treppe aus.
»Gleich«, sagte ich und wartete, bis sie gegangen war. Dann ließ ich mich auf den Boden zurücksinken. Über meinem Kopf hingen Mutters weiße Handschuhe einer neben dem anderen an der Wäscheleine. Wehte ein Luftzug durchs Haus, winkten sie mir zu. Und lief ich auf Zehenspitzen darunter hindurch, berührten Mutters Fingerkuppen meine Stirn, Mutters Hände meine Wangen, Mutters Daumen meine geschlossenen Augenlider. Begleitete ich sie morgens in den Keller, um ein frisches Paar von der Leine zu nehmen, sagte sie: »Mit weißen Handschuhen siehst du immer aus wie eine Prinzessin.« Und kam sie abends nach unten, die Handflächen grau, die Fingerkuppen schwarz, sagte sie: »Schau, Arielle, so schmutzig ist die Welt.«
Als ich nach oben kam, putzte Mutter das Klo.
Sie kniete am Fliesenboden und schob die Klobürste so tief in das Abflussrohr, dass man den Stiel nicht mehr sehen konnte. Am Spülkasten hatte sie einen Turm aus Klopapierrollen errichtet, auf dem das Telefon thronte. In dem Video am Display unterhielten sich zwei Frauen über Kosmetikprodukte. Sie trugen Kleider aus weißem Stoff und saßen auf weißen Sofas, im Hintergrund konnte man durch die offene Terrassentür das Meer sehen.
Mutter hatte mich nicht kommen gehört. Ich lehnte in der Klotür und beobachtete, wie ihr blauer Gummihandschuh in der Schüssel verschwand und gleich darauf wieder auftauchte. Der Pferdeschwanz wippte im Takt ihrer Bewegungen, vor und zurück, vor und zurück. Obwohl sie mir den Rücken zugekehrt hatte, kannte ich ihren Gesichtsausdruck. Mutters Putzgesicht sah immer verzweifelt aus. Das Haus war schuld, es ließ sich nicht sauber halten. Selbst wenn es ihr einmal gelang, den Dreck so gründlich zum Verschwinden zu bringen, wie sie es sich wünschte, war er tags darauf zurück, in den alten Holzböden, in den unerklärlichen Winkeln und Bauentscheidungen der Generationen vor uns. Mutter sehnte sich nach den Siedlungen. Ständig trug sie uns in Listen ein und führte deswegen Telefongespräche, aber nie bekamen wir die Zusage für eine der modernen Wohnungen, die im Viertel gebaut wurden. Also blieben wir. Im Gegensatz zu ihr mochte ich das Haus. Ich mochte seine Überraschungen und die versperrten Zimmer und Kammern, in denen die Vermieterin Dinge aufbewahrte, die uns nicht gehörten. Durchs Schlüsselloch konnte man sie sehen, Schachteln und Kisten, deren Inhalt sich nur erahnen ließ. Matratzen, die bis unter die Decke gestapelt waren, und eine Marienfigur, die in einer Wandnische unter einem Glassturz stand. Manchmal, wenn ich alleine durchs Haus streifte, dachte ich an all die Leben, mit denen wir Tür an Tür wohnten, wie mit Geistern.
»Ich habe heute eine Perücke getragen«, sagte ich, aber Mutter hörte mich nicht. Im Video erzählte die eine Frau in dem weißen Kleid von dem faszinierenden Verjüngungseffekt einer Peelingmaske. Dabei berührte sie sanft das Knie der anderen Frau. Dann sprang das Handy plötzlich in den Sperrmodus, und das Video brach ab.
Mutter hob den Kopf. Sie zog die Bürste aus dem Klo, klopfte sie am Rand der Schüssel ab und stellte sie zurück in die Halterung. Dann stemmte sie sich hoch und tippte mit dem Zeigefinger im Handschuh ein paar Mal auf den Bildschirm, bis das Video wieder ansprang. Dort, wo die Frau in Weiß ihr Gesicht hatte, blieb am Display eine feuchte Stelle zurück. Ich beschloss, in mein Zimmer zu gehen. Als ich die Türklinke nach unten drückte, hörte ich einen schrillen Schrei.