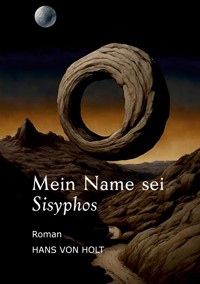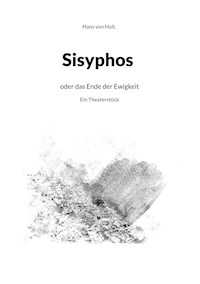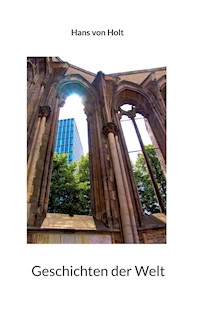Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Johannes reist durch die Zeiten und die Erfahrungen. Was die Erfahrungen bringen und wohin sie führen, bleibt ungewiss. Als Menschen haben wir die Möglichkeit, uns darauf einzulassen, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Man kann es das Abenteuer des Mensch-Seins nennen, oder die Odyssee des Lebens auf dem Meer der Seele. Der Leser sei eingeladen, das Schiff zu besteigen und sich - wenn man will - auf eigene Reflexionen einzulassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch:
Johannes reist durch die Zeiten und die damit verbundenen Erfahrungen. Was die Erfahrungen hinterlassen und wohin sie führen, bleibt ungewiss. Als Menschen haben wir die Möglichkeit, uns darauf einzulassen, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Man kann es das Abenteuer des Mensch-Seins nennen, oder die Odyssee des Lebens auf dem Meer der Seele.
Der Leser sei eingeladen, das ›Schiff‹ zu besteigen und sich – wenn man will – auf die Reise zu begeben.
Der Autor:
Der Autor wurde am Ende eines Krieges in einer ausgebombten Stadt geboren. Die Trümmer hinterließen eine frühe Prägung. Er wohnte in Städten wie Hamburg, Amsterdam, Salzburg, Basel, Zürich und Köln. In der Welt von Film und Fernsehen fand er seinen Beruf. Als Filmtonmeister arbeitete er während fünfundzwanzig Jahren in Zürich und Köln. Nebenbei engagierte er sich im Musiktheater der »Mixt-Media«, Basel mit vielen Auftritten in Deutschland, der Schweiz, Italien und Griechenland. Mit dem Schreiben begann er in den neunziger Jahren.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Römischer Morgen
Das Gastmahl
Der Kampf
Der Übergang
Kapitel 2
Ritterliches Mittelalter
Die Wunde
Die Heimkehr
Die Flucht
Der Schmerz
Walburga
Neue Ufer
Ankommen
Abgesang
Kapitel 3
Der Einzugsbefehl
Feldzug nach Frankreich
Der Deserteur
Résistance
Kapitel 4
Epilog
Prolog
Auf dem Wege, Intuitives und eigene innere Welten formulierbar zu machen, entstanden die ersten Skizzen. Ein Leben in Kulturen und Umgebungen, die ein fühlbares Fundament des hiesigen Daseins bildeten, bot einen äußeren Rahmen. Es geht nicht um historische Genauigkeit, die nicht verifizierbar wäre. Manches kann durchaus abweichen und sich von bekannter Geschichtsschreibung unterscheiden. Das ist weder Absicht noch Zufall. Subjektives Erleben hat andere Daten und unterliegt eigenen Zyklen. Die Beschreibungen beziehen sich auf Erfahrungswege, die inneren Charakter haben, Fraktale des Erlebten.
Das Schwert, die Ritter, der Krieg und die Abkehr davon, und vor allem die Frauen sind Elemente, die sich durch Lebenswege ziehen und als selbstähnliche Muster – als Fraktale – wiederkehren. M ist der dreizehnte Buchstabe im Alphabet. Dreizehn ist die Vollständigkeit, wie die zwölf Jünger, und die dreizehn – M – ist der Meister. M ist auch die Mutter, die Materie, die die Mutter gebiert. Dreizehn ist die sechste Zahl in der Fibonacci-Reihe und gleichzeitig eine Primzahl. Welch eine Amplitude!
M wie Muster. Muster, die sich in Namen spiegeln. Muster, die haften. Ob all die Muster durchlebt werden wollen, um gelöst – erlöst – zu werden? Ich weiß es nicht. Jedenfalls kann dies kein Zufall sein. Es liegt ein System dahinter, welches sich erst in der Erfahrung zeigen mag. Und die Erfahrung will erst gemacht werden. Sie lässt sich nicht vorwegnehmen.
Dies ist der Versuch, einiger Erfahrungen habhaft zu werden, das Haftende zu erforschen. Im Chinesischen ›I Ging‹, dem Buch der Wandlungen, wird das Haftende mit dem Feuer1 gleichgesetzt. Ob hier das Feuer, welches die Erscheinungsformen des Mensch-Seins antreibt, das ›Haftende‹ mit sich bringt oder gar bedingt?
Wie weit der Versuch gelingt und ob er zu Lösungen führt, ist nicht vorhersehbar. Auf dem Weg der Erfahrungen ist alles ungewiss. Die Odyssee beschreibt dies mit starken Metaphern. Jeder ›Schiffbruch‹ gebiert einen neuen Anfang. Jede Weggabelung will neu entschieden werden. Keine dieser Entscheidungen ist wiederholbar. Einmal gemacht, ist der Weg eingeschlagen und muss gegangen werden.
In diesem Sinne will ich versuchen, mir Zugängliches aufzuschreiben.
1 Li, das Haftende, leuchtend, das Feuer – die mittlere Tochter. Rein bildlich sieht man hier den schwachen mittleren Strich [haftend] von zwei starken oben und unten eingerahmt. [I Ging, Eugen Diederichs Verlag, übersetzt von Richard Wilhelm]
Kapitel 1
Römischer Morgen
Es war ein herrlicher Morgen. Golden strahlte die Sonne. Ein leichtes Summen der Bienen hing in der Luft. Der Thymian duftete zum Fenster herein. Gleißendes Sonnenlicht bahnte sich einen Weg durch meine geschlossenen Lider. Ich drehte mich auf meinem Lager zur anderen Seite, um dem grellen Licht zu entgehen. Meine Hände tasteten halb schlaftrunken – in die Leere. Der Platz neben mir war verlassen, aber noch warm. Entferntes Blöken drang von der Krete an mein Ohr. Ich erhob mich leicht benommen, stand auf, bewegte mich zum Fenster. Ein Hirte trieb seine Schafe zu neuem Weidegrund. Es trieb mich vors Haus.
Draußen am Brunnen holte mich das frische Wasser in den neuen Tag. Ich liebte diesen Brunnen mit seinem weiten Trog, in den ich ganz eintauchen konnte. Ein lauer Wind fächelte meine nasse Haut. Jetzt war ich wach. Ich begab mich zurück ins Haus und zog mir eine Tunika über. Der Name der letzten Nacht klang melodisch in mir – Merlina. Sie war gestern Abend bei mir geblieben. Ihre Wärme, ihr Duft waren gegenwärtig, als hielte ich sie in meinen Armen. Ich rätselte ihrem Verschwinden nach. Sie konnte nicht lange fort sein. Sonst wäre ihr Lagerplatz kalt gewesen.
Ich holte einen Eimer Wasser und brachte ihn zum Stall. Ventus, mein treues Pferd hatte Durst. Ventus rettete mir durch seine Geschwindigkeit bei einigen Gelegenheiten das Leben. Das letzte Mal, als meine Lanze brach und eine Horde Barbaren gefährlich nahekam. Das schweißt zusammen. Ich sprach leise mit ihm, während er trank. Dann rieb er seinen Kopf an meinem und wieherte zum Zeichen, dass er Auslauf brauchte. Ich öffnete den Verschlag und ließ ihn auf die angrenzenden Wiesen. Ein paar Sprünge signalisierten seine Dankbarkeit. Welch ein friedliches Bild.
Als ich zurück auf die Veranda kam, gruppierte Merlina Wildblumen in einer Vase auf dem Tisch. Das war also der Grund ihres frühen Aufstehens. Sie lächelte mich an und wir flogen aufeinander zu. Ein stilles Einverständnis umgab uns, und wir küssten uns zurück auf das Lager. Es gab keine Zeit für ein Ientaculum2. Uns war das Verschmelzen in der Sonne, die uns durchdrang, Nahrung in Fülle.
Wir mussten eingenickt sein. Es wurde kühl am Rücken. Die Sonne war weiter gezogen. Ich bewunderte Merlinas ebene Züge, die geschlossenen Augen in eher meditativem Ausdruck, nicht dem einer Schlafenden. Sie mochte meinen Blick gespürt haben und blinzelte zurück. Ein Lächeln wie aus einer fernen Welt glänzte zu mir herüber.
»Ich weiß noch garnichts von dir«, begann ich, als ich sie im Wachsein angekommen wähnte. »Magst du etwas trinken?«
Sie strahlte mich entwaffnend an: »Was gibt es denn?«
»Es ist noch etwas Honigwein da, oder magst du lieber einen roten Etrurier?«
»Der Etrurier ist wunderbar. Ich bin nicht so – süß ...«
Sie lächelte herausfordernd.
»Das mit dem ›süß‹ sehe ich etwas anders«, hob ich grinsend meine Augenbrauen, »aber natürlich bekommst du deinen Roten.«
Ich erhob mich und ging in die Küche. Unvermittelt erschien Uma vor mir und musterte mich aus effektvoll weit aufgerissenen Augen.
»Excusatio!«, erschreckte ich. Sie war ins Haus gekommen, während wir schliefen, und ich stand splitternackt vor ihr. Sie drehte sich lachend um.
»Brauchst du Hilfe, Giovanni?«
Es war mehr ein Schmunzeln als eine Frage.
Ich ignorierte ihre sprichwörtliche Zweideutigkeit:
»Ja, gerne. Den roten Etrurier bitte.«
Sie gab mir den Krug, ohne sich umzudrehen:
»Die Liebe macht durstig, Wasser steht im Atrium.«
Das Grinsen war ihr noch von hinten anzusehen. Damit entschwand ich ihren Blicken. Uma war das humorvollste Wesen, das ich kannte, eine Schauspielerin und eine begnadete Köchin. Beides wußte ich zu schätzen, wobei das Kulinarische überwog.
Als ich mit Wein und Wasser zurückkam, stand Merlina am Fenster und sog die laue Mittagsluft ein. Ihr schwarzes Haar wogte harmonisch fließend im Wind, als wollte es mit den sanften Wellen des Meeres wetteifern. Dieses Bild war von faszinierender Schönheit. Kaum ein paar Tage kannte ich sie. Es war wie ein Traum. Sie ergriff den Becher, den ich ungelenk mit dem Weinkrughielt. Ich goss ihr Wein ein. Den Wasserkrug gab ich ihr, damit sie selbst mischen konnte.
Einige Zeit standen wir wortlos am Fenster. Die Welt war stehengeblieben und es fühlte sich wunderbar an. Die Götter mussten uns gnädig sein. Ventus graste nahe am Haus. Die Zypressen warfen inzwischen kurze Schatten in der hochstehenden Sonne. Ich fühlte mich eins mit dem Wind in ihren Haaren und war wunschlos glücklich. Mir selber unbemerkt verdrängte ich meine Zugehörigkeit zum römischen Heer.
Merlina gab mir ihren Becher zum Trinken.
»Dein Pferd da auf der Wiese?«
Ich nickte.
»Ventus. Er trägt seinen Namen zurecht«.
Damit stellte ich den Becher ab und zog sie sanft nach draußen zum Brunnen.
»Terribilis!«, rief sie aus, als sie eintauchte, »das ist ja Eiswasser!«, und spritzte mich an. Ich sprang zu ihr und wir planschten wie die Kinder. Das Wasser kam mit dem Bach aus den Bergen und brachte die Frische der Höhen mit. Wir entflohen bald dem kalten Nass. Unsere Körper trockneten rasch an der wärmenden Sonne. Wir begaben uns ins Haus und kleideten uns an.
»Bleibst du? Mercurio, unser Primus Pilus3, gibt ein Gastmahl heute Abend.«
Wieder dieses entwaffnende Lächeln ohne Worte. Eine Zäsur in der Zeit, ein stilles Abwarten. Dann tickte meine Ungeduld, und ich fuhr fort:
»Ich wäre glücklich, wenn du bleiben magst.«
»Sollte ich da nicht in Abendgarderobe erscheinen!«
»Mercurio gibt nicht so viel auf Etikette, wenns privat ist.«
»Ich schau mal, was ich habe. Bin bald wieder da.«
Damit verschwand sie lächelnd, bevor ich reagieren konnte.
So schnell ich im Kampf mit Lanze und Schwert war, so zögerlich kam ich mir mit Merlina vor. In Gedanken verhangen nahm ich den Becher, der am Fenster stand, schenkte nach, trank einen Schluck und sinnierte vor mich hin.
Mercurio war mein Centurio, inzwischen mit allen Ehren als Primus Pilus4 ausgestattet. Wir fochten einige Schlachten gemeinsam aus. Er nahm mich früh unter seine Fittiche, und jetzt durfte ich in seiner Villa das Leben genießen – ein Leben zwischen den Schlachten. Das war nicht ganz uneigennützig, denn in Gallia Cisalpina5 gab es Querelen, die ein baldiges Ausrücken wahrscheinlich werden ließen. Das hatte ich die vergangenen beiden Tage erfolgreich verdrängt. Für mich gab es gegenwärtig allein noch Raum für Merlina.
Bis zu ihrer Rückkehr nahm ich mir Zeit für einen kleinen Ritt. Ich ging hinaus und pfiff leise durch die Zähne. Dieses Signal kannte Ventus. Er kam freudig angetrabt. Ich liebte es, ohne Sattel und Zaumzeug aufzusitzen und Tempo und Richtung durch verhaltene Töne und den sanften Druck der Schenkel anzugeben. Ich flüsterte ihm mein Vorhaben ins Ohr und wusste, dass er mich verstand. Mit geübtem Schwung saß ich auf und lenkte Ventus zum Hügel, im Trab nahmen wir eine kleine Steigung an den drei Pinien vorbei. Dann im Galopp hinauf zu den Zypressen, die einen Weg flankierten. Auf dem Weg ging es im lockeren Trab bis zum Bach, dem wir folgten. An einer ebenen Stelle hielt Ventus an, damit er trinken konnte. Das gehörte zum Ritual und ich konnte ihm die Führung überlassen. Hier trank er lieber als aus dem Eimer, obwohl es dasselbe Wasser war, welches durch unseren Brunnen floss. Am Rande des Bachbettes genoss er ein paar Kräuter, während ich, die Hand über den Augen, Ausschau hielt, ob ich Merlinas Rückkehr entdeckte. Das Haus lag in der sonnendurchfluteten Stille des Mittags da. Ein sanftes Summen verschiedener Tonarten begleitete den sommerlichen Wind. Ein Bild des Friedens, das mich alle vergangenen Kämpfe vergessen ließ. Kein Mensch war weit und breit zu sehen. Ventus wieherte zum Zeichen, dass er bereit war. In langsamem Schritt entlang des Baches genoss ich die Szenerie. In der Vorfreude auf Merlinas Nähe erschien die Welt für einen Moment vollkommen zu sein. Ich hatte Ventus frei gelassen. Er wusste den Weg nach Hause, während ich meinen Gedanken nachhing. Das letzte Stück ging er in Trab über. Der Stall mit kühlendem Schatten zog ihn zurück. Am Haus angekommen glitt ich hinunter. Im Gleichtakt nebeneinander, frei von Zügeln oder Leinen, schritten wir zum Stall. Es schwang ein stilles Einverständnis zwischen uns. Ich öffnete das Gatter, rieb ihm den Schweiß vom Rücken, striegelte sein Fell, flüsterte ein paar Worte in seine aufgestellten Lauscher und begab mich nach draußen. Das Gatter ließ ich offen. Ventus würde sich gegen Abend, wenn die Hitze abgeklungen war, wieder auf die Wiese begeben, wo er eine leichte Abendbrise und frisches Gras genießen wird.
2 römisches Frühstück
3 der ranghöchste Centurio einer Legion
4 Primus Pilus war der höchstrangige Centurio einer römischen Legion, der die 1. Centurie und die 1. Kohorte führte. Es war auch eine herausragende Ehrung.
5 »Gallien diesseits der Alpen« oder »diesseitiges Gallien« war von 203 bis 41 v. Chr. eine Provinz des Römischen Reiches und wurde danach fester Bestandteil des römischen Kernlandes.
Das Gastmahl
Die ersten Düfte eines vielversprechenden Mahles verbreiteten sich im Hause. Ich saß im Atrium und sinnierte vor mich hin. Die Meridiatio6 ließ mich in einen Halbschlaf treiben, in dem Traum und Wirklichkeit ineinander waberten. Ich sah Merlina. Sie saß auf Ventus, der sie langsam in eine blendend dunstige Ferne trug. Merlina drehte sich um, und ich sah ihre Augen, während ihre Figur im Nebel verblasste. Eine schwere Traurigkeit hing in der Landschaft. Ich wollte schreien, aber ich bekam keine Luft. Der dichte Nebel hüllte alles in zähes undurchdringliches Weiß.
Eine forsche Stimme riss mich unsanft aus meinen inneren Gefilden:
»Salve! Da bin ich wieder!«, schallte es laut und einnehmend. Mercurio war angekommen, und klapperte wie immer mit seiner Ausrüstung. Er lief ziellos hin und her und machte sich breit. Es war einer der Momente, wo ich spürte, dass ich seine Nähe außerhalb des Kampfes nicht lange ertrug. Ich zog mich zurück und überließ ihn seiner Unruhe. In besinnlichen Momenten, wie soeben aus dem Traume kommend, konnte ich mit Grobem nicht umgehen. Mein Traum hing nach. Kurz entschlossen begab ich mich zum Brunnen und tauchte in das erfrischende kalte Wasser, um ganz aus den Traumgefilden aufzutauchen. Das frische Nass tat seine Wirkung und ich planschte ausgiebig im kalten Wasser. Jetzt war ich wieder ganz da. Die Ungeduld, ein passendes Kleidungsstück für den Abend auszusuchen, trieb mich. Ich wollte Merlina gefallen. Meine zur Verfügung stehende Auswahl beschränkte sich allerdings auf wenige Stücke – es sollte nicht schwerfallen.
Die ersten Gäste fanden sich ein. Mercurio stellte mich vor. Ich war nicht bei der Sache, suchte ich doch nach Merlina. Endlich kam sie. Mercurio war begeistert von ihr. Mit ausladender Geste präsentierte er das Buffet. Wir nahmen uns ein wenig und machten uns unmerklich aus dem Staube. Hier war jeder mit sich selbst beschäftigt, dass es kaum auffiel, als wir verschwanden.
Der Mond stand über der Krete. Wir gingen den Hügel hinauf, erreichten loses Buschwerk und ließen uns nieder. Es war eine wunderbare Nacht. Samtenes Dunkel unter einem Gewölbe unendlicher Sterne. Wir lagen im warmen Grase und genossen die endlose Weite des Himmels. Der Mond, zögernd, ob er sich dem Abnehmen hingeben soll, erhellte unsere Silhouetten, deren blasse Farben die Nuancen unserer nackten Körper silbern zeichneten. Die Zypressen warfen lange Mondenschatten. Sie standen reglos da in ihrem mythischen Dunkel – wie warnende Wächter einer anderen Welt, deren Bewachung sich in nächtlichem Mysterium barg.
Es war die Nacht des Abschieds. Morgen sollte ich als Reiter unter Mercurios Führung in die Schlacht ziehen. Das war nicht das erste Mal. Es war das erste Mal, dass mehr als ein zunehmender Unwille in mir aufkeimte. Ich spürte deutlich, wie ich mein Dasein als Soldat in Frage stellte. Das Leben hatte sich mir so zart und liebevoll offenbart, dass die Kämpfe auf dem Schlachtfeld in eine unwirkliche grobe Ferne rückten. Ich versuchte, sie zu verdrängen. Ich grub mein Gesicht zwischen Merlinas Brüste, als könnte ich so der Welt entfliehen. Sie zog mich sanft über sich und wir verharrten in stiller Vereinigung, ergaben uns gemeinsamer Innigkeit, bekamen zarte Flügel und entglitten der irdischen Schwere.
6 Mittagsruhe
Der Kampf
Der Tag kündete sich mit einem kühlen Hauch an, begleitet von unerbittlichem Licht, welches die Sonne ihrem Aufgang vorausschickte. Hätte doch die samtene Nacht der Sonne den Zugang versagt! Die Zeit lief gnadenlos in unbeirrbarem Takt. Wir lösten uns voneinander. Beim Brunnen angekommen küsste ich Merlina ein letztes Mal. Dann warf ich mich in meine Rüstung, schnallte mein Schwert um, stelle die Lanze bereit und holte Ventus. Er begrüßte mich freudig. Frisch gesattelt gingen wir zusammen nach draußen. Ich saß auf, packte meine Lanze und winkte Merlina, die stumm und traurig am Brunnen stand.
»Ich komme zurück!«, rief ich im Davonreiten.
Mercurio war vorausgeritten und ich galoppierte ihm nach. Mit der Truppe vereint ritten wir der Schlacht entgegen. Die Sonne war hinter uns aufgegangen, der Vorteil mit dem Licht zu kämpfen. Es kam anders. Von schräg hinten brachen gallische Horden aus dem nahen Wald hervor und wir mußten einen riesigen Schwenk gegen die Sonne vollziehen.
»Schilde schräg stellen!«, kommandierte Mercurio.
Er wollte den Gegner blenden. In rasendem Galopp ritten wir auf das Fußvolk zu. Auch sie hatten Lanzen. Ein Gemetzel begann. Die Reitertruppe mähte die ersten Reihen des Fußvolkes nieder, unsere nachfolgenden Fußsoldaten bildeten eine Phalanx, die alles überrollte.
Immer wieder dachte ich an Merlina, was meine Konzentration beeinträchtigte. Ich vergaß, meinen Schild aus der Schräge rechtzeitig wieder an mich zu nehmen, und zur sicheren Deckung zu stellen. Unkonzentriert übersah ich einen dieser Gallier, dessen Lanze mich von unten traf und aus dem Sattel hob, bevor ihn einer unserer Reiter nieder machte. Ich fiel zu Boden. Die Spitze brach ab und blieb in der Brust stecken. Rasender Schmerz. Ich war unfähig, mich zu bewegen. Jemand schrie laut: »Merlina!« Das mußte ich gewesen sein. Ich hörte es von Ferne. Es wurde dunkel vor meinen Augen. Der Schmerz brannte wie loderndes Feuer. Es war unerträglich. Blut lief aus meinem Mund. Werde ich sterben? Werde ich wahnsinnig? Merlinas Gesicht pulsierte vor mir. Wieder schrie ich. Der Schrei entfernte sich zu einem diffusen Echo. Es wurde still.
Der Übergang
Langsam ließ der Schmerz nach, ja ich spürte ihn nicht mehr. Welch eine Erleichterung! Ich war verwundert, damit hatte ich nicht gerechnet. Mit diesen heftigen Schmerzen in Magen und Brustbein hatte ich erwartet, lange zu leiden. Doch auf einmal schwand der Schmerz wie ein sich lichtender Nebel. Ich erhob mich und schaute in die Runde, sah mich um. Die Kämpfer waren weitergezogen. Ventus, mein treues Pferd muss ihnen nachgelaufen sein. Verstreute Körper lagen verblutend im Gras. Keiner, den ich kannte. Es waren alles Gallier. Sie sahen schrecklich aus mit ihren zerzausten Bärten. Wenige hatten einen Helm auf dem Kopf, kaum eine Rüstung. Die meisten waren mit nacktem Oberkörper in die Schlacht gezogen. Mir kam das alles unwirklich, ja wahnsinnig vor.
Was sollte ich tun? Ventus zu suchen war mein nächster Gedanke. Ich machte mich auf, folgte dem fernen Kampfgetümmel. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich keine Waffen mehr hatte. Wo hatte ich sie verloren? Die Erinnerung war zäh, ich kam nicht darauf. Ohne Schwert und Lanze war ich wertlos für die weitere Schlacht. Der Sinn dieses Schlachtens war mir ohnehin abhandengekommen. Ich beschloß, umzukehren, und machte mich auf den Rückweg. Die Sonne brannte. Das störte mich nicht. Ich nahm es wahr, aber spürte es nicht. Es war ein leichter Marsch, frei vom Gewicht der Waffen. Eine Unbeschwertheit überkam mich und eine Verwunderung darüber, wie leicht sich alles anfühlte. Jetzt durchströmte mich das Bild von Merlina wie eine warme Welle, und eine Sehnsucht ergriff mich. Mir wurde klar, wie fern mir der Kampf geworden war, wie wenig ich mit diesem Krieg zu tun hatte. Das war nicht mein Krieg. Ich suchte die Liebe. Der Krieg entfernte sich in Unschärfe, ein verzerrtes Gebilde, welches die Konturen verlor, im hellen Licht der Sonne davon waberte und sich auflöste.
Endlich erreichte ich das Anwesen von Mercurio, meine derzeitige Wohnstatt. Vor dem Haus am Brunnen saßen Uma und Merlina. Sie sprachen, halb in Gedanken versunken, miteinander. Merlina war noch schöner. Ich nahm ihr inneres Leuchten wahr – mehr denn je – und darüber eine Traurigkeit, die mich in ihren Bann zog.
»Ich spüre eine Schwere, die mir Angst macht«, brach Merlina einen Moment des Schweigens.
»Ich habe ein ungutes Gefühl.«
Auf sie zulaufend wollte ich sie umarmen. Sie reagierte nicht.
»Ich bin´s, ich bin wieder da! Alles ist gut!«, versuchte ich sie aus ihrer Traurigkeit zu erlösen. Sie reagierte nicht. Auch Uma schien mich nicht wahrzunehmen.
»Vertraue ein wenig, Merlina!«, gab Uma zurück.
»Giovanni ist ein geschickter Kämpfer und er ist sehr umsichtig ...«
Sie brach ab, stockte, ohne weitere Worte zu finden, die überzeugen konnten.
Es kam kein Blick zu mir, keine Begrüßung. Nichts! Wie konnte das sein? Dieses innige Zusammensein mit Merlina, und jetzt nicht die leiseste Reaktion, als wäre ich Luft! Mein Unverständnis schlug langsam in Ratlosigkeit um. Ich wollte sie umarmen, damit sie mich endlich erkannte. Ich griff ins Leere. Ich versuchte es wieder und abermals griff ich ins Leere. Die Ratlosigkeit wuchs. Ich schrie sie an. Es war wie in einem schalltoten Raum. Kein Echo, keine Reaktion. Schall-toter Raum ... Toter Raum ... war ich in einem toten Raum gefangen? War ich ... nein, das konnte nicht sein! Ich war nicht tot? Ich war doch wach, bewusst, war da – aus der Ratlosigkeit wurde Verzweiflung, stumme Verwunderung, von Leere durchdrungen. Ungläubig versuchte ich es nochmals – und griff wieder ins Leere. Diese Freude über die Leichtigkeit, als sich die Folgen meiner Verwundung auflösten, schlug in eine unendliche Traurigkeit um. Ein Gefühl, nie wieder glücklich zu sein. Langsam dämmerte es mir, dass alles verloren sein könnte. Ich sah die Welt und doch war sie verloren. Bilder, die ... was waren sie? Unfassbar! Traumgebilde? Unwirklich? Und obwohl ich sie zu sehen glaubte, war ich allein. Ich setzte mich an den Rand des Brunnens und schaute zu. Unschlüssig. Wartend. Auf was? Vor mir lief die Szenerie ab, ohne dass ich einen Einfluß darauf hatte.
Es wurde Abend. Die beiden Frauen waren hineingegangen. Dämmerung breitete ihre Flügel aus und ich vermisste die Kühle des Abends, die immer die beginnende Nacht begleitete. Ich fühlte sie nicht. Auch nicht den begleitenden Windhauch, der uns früher im Herabgleiten von der Krete wohltuend fächelte. Langsam wurde mir klar, dass das Schwinden des Schmerzes aus der Verwundung in der Schlacht ein Schwinden des Körpergefühls war. Lag hier der Grund für die Leichtigkeit, die ich trotz allem körperlich wahrnahm? Nahm ich den Körper jetzt überhaupt nicht mehr wahr? Ich stand auf und schaute im letzten Dämmerlicht in den Brunnen, um mein Spiegelbild zu sehen. Ich sah einen aufgehenden Mond gespiegelt. Mich sah ich nicht. Ich redete mir ein, dass es zu dunkel sei. Der Mond war noch fast voll und hell genug, dass mich dieses Argument nicht zu überzeugen vermochte.
Ich schlich ums Haus. Dann sah ich ein Zimmer, in dem eine Öllampe brannte. Es war mein Zimmer. Merlina saß am Bettrand, gebeugt und hielt das Gesicht in den Händen verborgen. Ob sie weinte, sah ich nicht. Unschlüssig stand ich da. Die vorherige Erfahrung nahm mir allen Mut, etwas zu unternehmen. Ich ging weiter meine Runde, bis ich wieder am Brunnen ankam. Ventus stand auf der Weide. Er hatte zurückgefunden. Er wieherte. Ob wenigstens er mich wahrgenommen hat? Ich kam näher, und er wieherte nochmals, dann graste er im Mondenschein. Als ich vor ihm stand, trabte er davon. Zurück beim Brunnen setze ich mich wieder auf den Rand, ratlos, wie es weitergehen sollte. Inzwischen war der Mond weitergezogen und der erste Streifen einer matten Dämmerung kündigte einen baldigen Sonnenaufgang an. Ein neuer Tag lauerte hinter den Zypressen. In der Dunkelheit war mir wohl und ich wußte nicht, ob ich mich auf das Licht des neuen Tages freuen konnte. Ich spürte keinerlei Müdigkeit, nur ein unscharfes Sehnen, welches ich nicht einordnen konnte.
Der Morgen strahlte in sonniger Wärme, als Mercurio mit zwei Soldaten erschien, die einen Toten auf ihrem Gefährt mitführten. Ich winkte und rief, aber es war wie gestern bei Merlina. Niemand nahm mich wahr. Ich ging näher und schaute auf den Körper, der auf dem Gefährt lag. Die Spitze einer abgebrochenen Lanze steckte im Körper. Sie mußte den Reiter von einem Kämpfer zu Fuß von unten erfaßt und vom Pferd gerissen haben. Ich erkannte den Toten und erschrak. Eine Eiseskälte überkam mich. Ich erkannte – mich selbst. Das war zu viel! Und doch war es die Erklärung für alles, was ich am Vortag erlebt hatte. Es dämmerte mir nicht nur, jetzt wußte ich es: Ich war tot!
Deutlich spürte ich, wie sehr ich der Welt verlorengegangen war. Ich war ein Außenseiter, ein Jenseitiger, jemand, den die Welt nicht mehr wahrnahm, unsichtbar, unhörbar, ohne wahrnehmbares Dasein, abhandengekommen, ein Schatten für die Welt und nicht einmal das. In meiner Verzweiflung schossen mir unendliche Fragen durch den Kopf. Den Kopf? Ich war nicht mehr sicher, ob ich einen Kopf hatte. Ich sah mich tot, fühlte mich gegenwärtig. Die Welt sah mich als toten Körper, und mich sah man nicht.
Was macht man als Toter, der für die Welt gegangen ist, als verloren gilt, und als Lebender – so fühle ich mich – unsichtbar, unhörbar. Ich bin im ›Jenseits‹, wie es immer hieß, und doch bin ich hier und einfach da – jetzt. Wie soll das weitergehen? Wie es für die Sichtbaren weitergeht, das wußte ich ja, während ich selbst ein Sichtbarer war. Aber in der jetzigen Form – wobei Form kein stimmiger Ausdruck ist – in einem Da-Sein, welches ich nicht beschreiben kann, weil ich es unerwartet neu erlebe, oder muss ich ›ersterbe‹ sagen, wie soll es weitergehen? Welch ein Paradoxon! Philosophen hatten mich immer interessiert. Dem ›Ersterben‹ bin ich bei ihnen nicht begegnet.