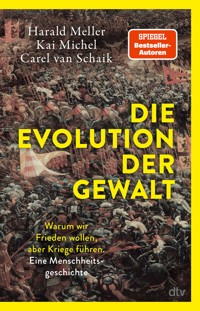
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum töten wir? Wer hätte sich vor wenigen Jahren vorstellen können, dass Krieg wieder zu einer zentralen Bedrohung unserer Welt werden könnte? Was bringt Menschen dazu, andere Menschen zu töten? Dazu müssen wir nach den evolutionären Wurzeln von Gewalt und Aggression forschen und deren Wucherungen durch die menschliche Geschichte hindurch rekonstruieren. Die drei Autoren verbinden anhand von Fallgeschichten die Erkentnisse aus Archäologie, Evolutionärer Anthropologie und den Religions- und Geschichtswissenschaften, um in dieser Menschheitsgeschichte der Gewalt aufzuzeigen, unter welchen Bedingungen es zu Krieg, Mord und Totschlag kommt. Und wie wir diese in Zukunft verhindern können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
KRIEG, MORD UND TOTSCHLAG
Von der Bibel bis heute ließen sich die Menschen von ihrer alles andere als friedlichen Gegenwart blenden und malten sich die dazu passende kriegerische Vorgeschichte aus. Das scheint leichter akzeptabel als die Erkenntnis, dass die Gewalt der Gegenwart eben gerade nicht normal ist und auch nicht in unserer Natur liegt.
Ein Biologe, ein Archäologe und ein Historiker enthüllen die Evolution menschlicher Gewalt und zeigen, dass Krieg nicht das Schicksal der Menschen ist.
»Packend geschriebenes Big-History-Buch im Stil von Yuval Noah Harari.« Die Welt
Harald Meller / Kai Michel / Carel van Schaik
Die Evolution der Gewalt
Warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen. Eine Menschheitsgeschichte
Inhaltsverzeichnis
Aus der Totengrube
Teil 1 Keine Kinder Kains
1 Der Krieg um die menschliche Natur
2 Wovon wir sprechen, wenn wir von Krieg reden
Teil 2 Das evolutionäre Fundament
3 Wie wir Menschen wurden
4 Über Aggression
5 Kollektive Gewalt
6 Die Wahrheit über Schimpansen und Bonobos
7 Lehren der Jäger und Sammler
8 Kriegspsychologie?
Freund-Feind-Denken
Zusammenstehen
Anführer
Gewalt verlangt nach Legitimation
Entmenschlichen
Männerbande
Friedenspsychologie
Teil 3 Archäologische Spurensuche
9 Cold Cases in der Eiszeit
10 Die Wehen des Krieges
11 Als der Krieg alltäglich wurde
12 Drachenzähne: Die Saat des Krieges geht auf
13 Die Geburt der Helden
Teil 4 Der Krieg wird total
14 Kriegsmaschine Staat
15 Krieg als Lebensprinzip
16 Krieg gegen Frauen
17 Im Namen Gottes
18 Die Bestie zähmen
Zwölf Lektionen
Dank
Literatur
Aus der Totengrube
TEIL 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Zwölf Lektionen
Aus der Totengrube
Am Ende blieben sie nackt auf dem Schlachtfeld zurück. Nicht nur das Leben war ihnen genommen worden, auch die Kleider, die Stiefel, all ihre Habseligkeiten fehlten. Beraubt und geschunden, wurden die 47 Männer in ein Massengrab geworfen. In manchen Köpfen steckten noch Bleikugeln. Nichts verriet mehr, wer Freund war und wer Feind.
Anfangs waren die Bauern um Ordnung bemüht, zum Schluss ließen sie die Leichen nur noch in die Grube plumpsen. Allein die beiden letzten Toten drapierten sie zuoberst in der Pose des gekreuzigten Christus. Der eine lag mit weit ausgebreiteten Armen auf dem Rücken, die leeren Augen gen Himmel gerichtet. Der andere ruhte auf dem Bauch und blickte durchs Gewimmel der Leiber in Richtung Hölle. Wollten die Bauern ein Zeichen setzen, ein Memento mori für die Ewigkeit? Oder war es nur ein blasphemischer Kommentar auf einen Krieg, der auf beiden Seiten im Namen Gottes geführt wurde, aber allein an diesem Tag über sechstausend Menschen das Leben gekostet hatte?
2011 stießen Archäologen unter der Leitung eines der Autoren dieses Buches auf das Massengrab in Lützen. Im November 1632 hatte dort eine der Hauptschlachten des Dreißigjährigen Krieges getobt: Das protestantische Heer unter der Führung des schwedischen Königs Gustav II. Adolf kämpfte gegen die kaiserlichen Truppen der Katholischen Liga, angeführt von Albrecht von Wallenstein. Schätzungsweise 36000 Soldaten trafen an der alten Via Regia zwischen Naumburg und Leipzig aufeinander.
Während der schwedische Herrscher bis heute in einem Marmorsarg in Stockholm neben anderen Königen ruht und ihm bei Lützen eine Gedenkkirche gewidmet ist, gerieten die Abertausenden einfachen Soldaten in Vergessenheit. Erst die Archäologie holte 47 von ihnen ins Gedächtnis zurück.
Ihr Grab ist das einzige, das in Lützen entdeckt wurde. Vielleicht hat es auch als einziges die Zeiten überdauert. Gräber von Gefallenen wurden geöffnet, um die Skelette in Knochenmühlen zu zerkleinern und mit dem Mehl die Felder zu düngen. Auch Salpetersieder gruben Leichen aus – ausgerechnet für die Produktion von Schwarzpulver. Fast 200 Jahre später kaufte die Zuckerindustrie die Knochen der Gefallenen von Waterloo, um Rübenzucker zur begehrten Weiße zu verhelfen.
Das Massengrab von Lützen dagegen blieb fast 400 Jahre unberührt. Es wurde im Block geborgen, ins Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle gebracht und in Gänze konserviert. Anthropologen untersuchten die Skelette und konnten deren Schicksal in Ansätzen klären: Jenen bäuchlings in der Totengrube Liegenden etwa hatte eine Kugel getroffen. Sie durchschlug das linke Schläfenbein, Fragmente stecken noch im angrenzenden Schädelknochen. Mit seinen 40 bis 50 Jahren handelt es sich um einen altgedienten Recken. Dazu passen verheilte Verletzungen im Gesicht und am Unterarm. Zudem litt er an einer fortgeschrittenen Syphilis-Infektion. Die Isotopenuntersuchungen seiner Zähne und Knochen sprechen dafür, dass er aus südlicheren Gefilden Skandinaviens stammte und wohl zu den schwedischen Truppen gehörte.
Der zweite obenauf Bestattete war zu Lebzeiten sein Gegner – gut zwanzig Jahre jünger. Die dunklen Zähne verraten exzessiven Tabakgenuss. In der Jugend hatte er sich den Oberschenkel gebrochen; die Bruchkanten waren nicht korrekt zusammengefügt worden, sodass das linke Bein eine Handbreit kürzer blieb als das rechte. Die Hüfte weist eine durchs Hinken verursachte Arthrose auf. Alles andere als ein Einsatz als Reiter wäre für ihn unmöglich gewesen. Beim Angriff der kaiserlichen Truppen auf die schwedischen Fußsoldaten scheint er vom Pferd gestürzt und sein Leben durch einen Schwertstich in den Bauch verloren zu haben.
Da lagen also Feinde im Tod vereint, die Opfer eines der grauenvollsten Kriege der Menschheitsgeschichte. Doch auch sie repräsentieren nur einen kleinen Ausschnitt. Der Dreißigjährige Krieg machte vor der unbeteiligten Bevölkerung nicht halt. Ganze Landstriche wurden verheert und entvölkert. Die Gesamtopferzahl wird auf mindestens acht Millionen geschätzt, manche Historiker sprechen von deutlich mehr Toten.
Einer, der in Lützen ebenfalls tödlich verwundet wurde, ist Gottfried Heinrich zu Pappenheim, Feldmarschall in Diensten der Katholischen Liga. Als er 1632 dabei scheiterte, die niederländischen Stellungen rund um die Stadt Maastricht zu erstürmen, zog er ab und plünderte stattdessen das Land der eigenen Verbündeten. Ein Jahr zuvor waren Pappenheims Truppen in vorderster Reihe dabei, als Magdeburg erst gebrandschatzt, dann dem Erdboden gleichgemacht wurde. Lebten vorher 35000 Menschen in der Stadt an der Elbe, waren es danach keine 500. Seither galt »Magdeburgisieren« als Synonym für totale Verheerung und gnadenlose Gemetzel. Mochte Pappenheim auch für seine philosophische Bildung gerühmt worden sein, verbreitete er nur Tod und Schrecken. In der Chronik Theatrum Europaeum heißt es: »Dann das Pappenheimische Volck/wie auch die Wallonen/so am aller Unchristlichen ärger als Türcken gewütet/ … haben mit nidergehawen/beydes der Weiber und kleinen Kinder/auch schwanger Weiber in Häusern und Kirchen.«
Möglicherweise liegt also einer der Pappenheimer Reiter zuoberst im Lützener Grab, denkbar, dass auch er sich in Magdeburg über Frauen und Kinder hergemacht hatte. In erster Linie aber ruhten in der Totengrube Soldaten der Blauen Brigade, einer Eliteeinheit zu Fuß des Pappenheim-Gegners Gustav II. Adolf. Der Jüngste von ihnen war kaum 16 Jahre alt.
Die Knochen der Soldaten sind eine einzige Elegie von Leid und Gewalt. Sie künden von Skorbut und Rachitis, Tuberkulose und Parasitenbefall. Schlecht verheilte Verletzungen noch und noch. Fast die Hälfte hat Kopfschüsse erlitten, die Mehrzahl wurde vermutlich aus zwei bis fünf Metern Entfernung abgegeben. Das war Nahkampf. Jetzt kehren die 47 zurück aufs Schlachtfeld, für sie wird ein Museum gebaut: »Lützen 1632«. Jeder soll dort fortan dem Schrecken des Krieges ins Auge sehen können.
Einigen war die Schlacht eine Lehre. Und zwar jenen, die in Zukunft Kriege zu verantworten hatten. Noch Pappenheim war so von Schlachtennarben übersät, dass man ihn »Schrammenheinrich« nannte. Und Gustav II. Adolf hatte sich an der Spitze eines Kavallerieregiments ins Getümmel gestürzt, um die Seinen zum Sieg zu führen. Die Kugel eines Musketiers zerschmetterte den linken Arm des Königs. Dann traf ihn ein Pistolenschuss in den Rücken. Er stürzte vom Pferd und starb nach mehreren Degenstichen durch den Kopfschuss eines Kürassiers. Seither wagen Feldherren sich kaum mehr persönlich aufs Schlachtfeld. Eine Weile werden sie noch, wie Napoleon, gut beschützt von einem Hügel herab die Armeen dirigieren. Seither sitzen sie hinter den dicken Mauern ihrer Paläste oder Bunker, führen Kriege und schicken andere in den Tod. Warum lassen Menschen sich das gefallen?
Auch 400 Jahre nach der Schlacht von Lützen füllen sich die Massengräber der Welt und sorgen dafür, dass den Archäologen der Zukunft die Arbeit nicht ausgehen wird. So schockierend und verstörend die Nachrichten von den Schlachtfeldern unserer Tage sind, stellt sich mit größter Dringlichkeit die Frage: Warum ist dem Krieg nicht endlich und endgültig der Krieg erklärt worden? Um sich darüber zu wundern, muss man nicht einmal sonderlich pazifistisch motiviert sein. Denn Gewalt gegen Menschen ist eine Bankrotterklärung aller Menschlichkeit. Unwürdig für eine Art, die so stolz auf ihre Vernunft ist wie der Homo sapiens. Der Krieg ist ein Skandal.
Die Frage wiegt heute umso schwerer, da profilierte Beobachter und Theoretiker des Krieges wie der Politikwissenschaftler Herfried Münkler konstatieren, dass die Gewalt weltweit zu Formen zurückkehrt, die denen des Dreißigjährigen Krieges ähneln, als Marodeure raubend und vergewaltigend, sengend und mordend durch die Lande zogen, ohne dass ihnen Einhalt geboten werden konnte. Ist der Krieg eine Bestie, die sich gerade wieder von all den Ketten befreit, die ihr durch Kriegs- und Völkerrecht angelegt worden sind?
Bei all dem Leid, das vor allem die Schwächsten der Schwachen heimsucht, verwundert es, warum in Sachen Krieg nicht das geschieht, was beim Klimawandel längst der Fall ist: nämlich ein Bündnis der Staaten dieser Erde zu seiner Verhinderung auf die Beine zu stellen. Was die globale Erwärmung angeht, herrscht weitgehend Einigkeit, dass sie wesentlich menschengemacht ist. Eine internationale Allianz aus Wissenschaft und Politik hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Ursachen des Klimawandels aufzudecken und Strategien zu entwickeln, ihn aufzuhalten. Auf regelmäßigen Megakonferenzen, begleitet von enormem Medieninteresse, unternimmt die Weltgemeinschaft Großes, um eine einheitliche Klimapolitik durchzusetzen. Wieso geschieht nichts Vergleichbares, um das organisierte Töten auszumerzen? Warum lebt noch immer die Vorstellung fort, dass Krieg unvermeidlich sei?
Natürlich gibt es den Weltsicherheitsrat, den Friedensnobelpreis und internationale Abkommen und Maßnahmen der Friedenssicherung. Seit gut achtzig Jahren untersagt die Charta der Vereinten Nationen den Mitgliedsstaaten »jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete … Androhung oder Anwendung von Gewalt« – von der Selbstverteidigung und dem UN-Sicherheitsrat beschlossenen Sanktionen einmal abgesehen. Doch ein Beschluss, dem Krieg endgültig den Garaus zu machen? Fehlanzeige.
Ohne die bisher erbrachten Leistungen im Geringsten schmälern zu wollen: Der Forschungsaufwand zur Kriegsvermeidung ist im Vergleich zur Klimaforschung bisher eher marginal gewesen und erfährt wenig öffentliche Resonanz. »In den meisten westlichen Universitäten wird die Erforschung des Krieges weitgehend vernachlässigt«, klagte die Historikerin Margaret MacMillan. Auch der Soziologe Arno Bammé bemängelte, dass der Krieg in den Sozialwissenschaften einen »blinden Fleck« darstellt. Seine Kollegen Hans Joas und Wolfgang Knöbl sprachen sogar von »Kriegsverdrängung« und »Kriegsvergessenheit«.
Wie kann das sein? Die existenzielle Dringlichkeit, das kollektive Töten in seiner Genese zu verstehen, sollte außer Frage stehen: Abgesehen von Seuchen hat in der Vergangenheit nichts mehr Menschenleben gekostet und fürchterlichere Konsequenzen für Gesellschaften und Umwelt entfaltet. Selbst dort, wo kein Krieg herrscht, sind seine Kosten galaktisch: Die Verteidigungshaushalte verschlingen unvorstellbare Summen. Kriege sind hauptverantwortlich für Flüchtlingsströme und verschärfen die Klimakrise. Auch die organisierte Kriminalität gedeiht bestens in diesem Ausnahmezustand par excellence. Und damit ist noch nicht einmal das eigentliche Damoklesschwert benannt: Die nuklearen Waffenarsenale bergen das Potenzial, das Leben auf der Erde auszulöschen. Warum also wird nicht alles unternommen, den tödlichsten der apokalyptischen Reiter endgültig auf den Gnadenhof zu schicken?
Der Umstand, dass solche Gedanken den Verdacht grenzenloser Na-ivität erwecken können, verweist auf das grundlegende Problem. Im Gegensatz zum Klimawandel erscheinen Kriege zwar von Menschen geführt, aber nicht menschengemacht zu sein – also in dem Sinne, dass sie als kulturelle Produkte eliminiert werden könnten. Zwar herrscht angesichts der massiven Wiederkehr des Krieges große Ratlosigkeit, doch geht die bemerkenswert oft mit dem Fatalismus einher, dass man allenfalls im Einzelfall etwas bewirken könnte, weil Kriege nun mal des Menschen Schicksal seien.
Am prominentesten hat das 2009 der damalige US-Präsident Barack Obama formuliert – ausgerechnet in seiner Dankesrede für die Verleihung des Friedensnobelpreises: »Der Krieg kam, in der einen oder anderen Gestalt, mit dem ersten Menschen in die Welt. Als die geschichtliche Zeit anbrach, wurde seine Moralität nicht infrage gestellt; er war eine bloße Tatsache wie Dürre oder Krankheit – so strebten erst Stämme, dann Zivilisationen nach Macht, so trugen sie ihre Konflikte aus.«
Daher dominiert die Ansicht, Kriege habe es schon immer gegeben, sie würden folglich nicht verschwinden. Das Kriegführen entspräche der menschlichen Natur und sei der Normalzustand des Homo sapiens. Der Mensch ist schließlich, das wusste schon Aristoteles, ein Zoon politikon, ein politisches Wesen, und der Krieg, wie Clausewitz formulierte, nichts als die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln. Und als Albert Einstein Sigmund Freud nach dem Urgrund des Krieges fragte, antwortete dieser: »Interessenkonflikte unter den Menschen werden also prinzipiell durch die Anwendung von Gewalt entschieden. So ist es im ganzen Tierreich.«
Und wer sich an den Schulunterricht erinnert: Ist Geschichte nicht eine schier endlose Aneinanderreihung von Schlachten? Und sind ihre Protagonisten nicht jene »großen Männer«, die sich als die größten Haudraufs von allen auszeichneten? Von den ältesten Epen der Menschheit – »Gilgamesch«, »Ilias« und »Odyssee« – über die Bibel und die Dramen Shakespeares bis hin zu »Herr der Ringe«, »Game of Thrones« und, ja, »Fourth Wing«: Was beherrscht Geschichten anderes als Mord und Totschlag?
Auf den ersten Blick scheint die Archäologie keine hoffnungsvolleren Befunde zutage zu fördern. Zumindest suggeriert das ein Blick auf jüngste Ausgrabungen: In Sibirien wurde eine der ältesten Befestigungen der Welt gefunden. Jäger und Sammler errichteten dort schon vor 8000 Jahren Graben, Wall und Palisaden. Im slowakischen Vráble entdeckten Archäologen im Graben einer 7000 Jahre alten Siedlung 38 Skelette. Abgesehen von einem kleinen Kind fehlten allen die Köpfe. Die Untersuchung von zwölf abgehauenen Händen aus dem Palast von Avaris belegt: Es handelt sich um die Trophäen besiegter Feinde des ägyptischen Pharao. Und im mysteriösen Steinzeitheiligtum von Karahan Tepe in der Türkei stießen Archäologen auf eine überlebensgroße Statue eines Mannes, der seinen erigierten Penis in Händen hält. Daneben die Plastik eines Geiers. Ist das der alte Adam, Urvater aller Grausamkeit, ein 10500 Jahre altes Idol dessen, was heute als »toxische Männlichkeit« für die grassierende Gewalt verantwortlich gemacht wird?
Funde wie diese passen zu den intuitiven Gewissheiten, die viele Menschen darüber haben, wie ihre Artgenossen nun mal so sind – nämlich nicht sonderlich gut. Entsprechend schlecht ist die Meinung über ihre Vorfahren in grauer Urzeit. Haben die sich nicht mit Keulen die Köpfe eingeschlagen? Lange konnte man sich trösten, dass der Philosoph Thomas Hobbes zwar recht habe und der Mensch nun mal des Menschen Wolf sei, aber dass wir heute in der zivilisierten Welt unsere dunkle Seite in den Griff bekommen haben. Krieg sei etwas Antiquiertes, Primitives, das allenfalls noch Weltgegenden heimsuche, die man lange als »unterentwickelt«, wenn nicht gar als »wild« oder »barbarisch« bezeichnete. Dem Westen käme deshalb die Aufgabe zu, den Weltpolizist zu geben und den Rest des Globus zu befrieden. Krieg werde nur in schnellen, cleanen Kommandoaktionen ausgetragen, um noch den letzten Winkel der Welt zur Raison zu bringen.
Solches Denken ist in den vergangenen Jahren als Illusion entlarvt worden. Der Krieg hat wieder unsere Insel der Seligen erreicht, zuerst in seiner »unzivilisierten« Form als Terror, mittlerweile auch in traditioneller Gestalt staatlicher Kombattantenarmeen. Allerorten wird aufgerüstet, die Waffenindustrie produziert auf Hochtouren. Schon wird den westlichen Gesellschaften eingeschärft, sich auf Krieg vorzubereiten und in Wehrtüchtigkeit zu erproben.
Doch wenn der Krieg unentrinnbares Menschenschicksal ist: Was bleibt außer Resignation – und dem Investieren in Panzer, Bunker, Kamikazedrohnen? Die Ratlosigkeit in den Talkshows ist mit Händen greifbar. Aus diesem Grund ist es höchste Zeit für eine evolutionäre wie archäologische Bestandsaufnahme. Wir brauchen festen Grund unter den Füßen. Dafür werden wir in diesem Buch die Zusammenhänge der Evolution der Gewalt und die Geburt des Krieges rekonstruieren und zeigen: Menschen sind nicht zum Krieg verdammt.
Wir haben eine der zentralen Ursachen gestreift, warum bisher eher wenig Forschung betrieben wurde, um die Wurzeln des Krieges zu ergründen. Sollte er tatsächlich bereits mit den ersten Menschen in die Welt gekommen sein, stellt sich die Frage nach seinen Ursprüngen gar nicht. Das aber würde implizieren, dass Kriegführen tief in unsere Biologie eingeschrieben ist.
Dieses »Krieg-ist-ewig«-Motiv ist in jüngster Vergangenheit von durchaus prominenten Stimmen vertreten worden. Aus diesem Grund lassen viele Kultur- und Sozialwissenschaftler die Finger davon und begnügen sich mit generalisierenden Feststellungen wie der, dass der Krieg zu den »Elementarerscheinungen zwischenmenschlichen Zusammenlebens« gehöre »und, unabhängig von Raum und Zeit, im tiefsten Wesen des Menschen verankert« sei (Bammé) – ohne das zu vertiefen.
Hier herrscht die Furcht, »Biologismus« zu betreiben, also Menschen und ihre Gesellschaften als von ihren Genen determiniert zu beschreiben und damit den Krieg als »natürlich« zu legitimieren. Was die Angelegenheit besonders delikat macht: Kriege sind nun mal, betrachtet man die Seite der Akteure, im Wesentlichen Männersache – und ja, es existieren markante Geschlechterunterschiede hinsichtlich der Gewalt. Geht man also der Frage nach den evolutionären Wurzeln der Kriege nach, schreibt man dann nicht Geschlechterrollen fest und beschränkt Frauen auf die des Opfers?
Da die Evolutionstheorie bis tief ins 20. Jahrhundert hinein sozialdarwinistische Positionen vertrat, die wie gemacht schienen, Raubtierkapitalismus und das Recht des Stärkeren sowie männliche und westliche Dominanz zu legitimieren, etablierte sich etwas, was sich als Evolutionstabu beschreiben lässt: die Zurückweisung aller biologischen und evolutionären Erklärungen im Hinblick auf menschliches Verhalten und Gesellschaften.
Was einst eine sinnvolle Weigerung war, sich mit tendenziöser Biologie zu beschäftigen, läuft heute Gefahr, zur Ignoranz zu verkommen. Die Sichtweise auf die evolutionären Wurzeln des Menschseins hat sich radikal gewandelt. Niemand glaubt mehr an Determinismus. Menschen sind keine Sklaven ihrer Gene. Im Gegenteil, der Homo sapiens ist eine höchst plastische, enorm flexible Art, was das Verhalten angeht. Menschen sind nur im kaum unterscheidbaren Zusammenspiel von Kultur und Natur zu verstehen.
Was das Evolutionstabu fatal macht: Es spielt dem Krieg in die Karten. Die Nichtberücksichtigung der Evolution lässt diesen ewig erscheinen. Dadurch, dass man sich allein auf die historischen Zeiten konzentriert, also die gut 5000 Jahre, aus denen uns Schriftquellen vorliegen und Menschen in Staaten leben, entsteht der Eindruck, Krieg sei immer existent gewesen. So aber wird lediglich ein einziges Prozent der Menschheitsgeschichte berücksichtigt – und zwar ausgerechnet jenes Prozent, in dem der Krieg bereits voll ausgebildet war. Damit können jedoch die Faktoren gar nicht erkannt werden, die ihn beförderten. Mit dieser Reduktion hält man ein misanthropisches Phantasma am Leben, das uns allen schadet: Menschen seien zutiefst kriegerische Kreaturen. Es ist alles andere als ein Zufall, dass gerade die Autokraten und Populisten dieser Welt es lieben, die Gewalttätigkeit der menschlichen Natur ins Feld zu führen, um daraus das Recht der starken Hand abzuleiten.
Es ist zwingend nötig, die restlichen 99 Prozent Menschheitsgeschichte einzubeziehen und ein wissenschaftlich abgesichertes Fundament zu besitzen, das uns handlungsfähig macht. Deshalb lautet eine der grundlegenden Thesen dieses Buches: Der Krieg ist noch gar nicht recht in seiner Eigenart verstanden. Die Annahme, wir führten Kriege, weil das ins Erbgut des Homo sapiens einprogrammiert sei, ist ebenso veraltet wie unzutreffend. Wir sollten aufhören, unsere eigenen Vorfahren zu diffamieren.
Das bedeutet keinesfalls – so ein populäres Missverständnis –, dass hier eine Romantisierung der Vorgeschichte, wie sie gerne mit dem Namen Jean-Jacques Rousseau verknüpft wird, betrieben wird. Es geht nicht darum, unsere evolutionäre Vergangenheit zu einem Paradies des Friedens zu stilisieren oder zu behaupten, dass Menschen im Grunde gut seien. Denn dass sie seit eh und je eine gewaltvolle Seite besitzen, liegt auf der Hand. Anders wäre der Umstand nicht zu erklären, warum der Krieg zu einem schier universellen Phänomen werden konnte und noch heute allerorten schnell wieder aufflammt. Menschen müssen ein evolutionäres Substrat dafür besitzen.
Unsere Natur ist da seltsam ambivalent: Einerseits fällt Menschen das Töten von Artgenossen schwer. Sie haben einen robusten Widerstand dagegen – es sei denn, es liegt eine psychopathische Persönlichkeitsstörung vor, eine massive Abstumpfung oder eine höchst affektive Ausnahmesituation. Wir sind alles andere als natural born killers. Ansonsten würden Menschen nicht vor Krieg flüchten, sondern begeistert an die Front stürmen.
Andererseits mögen wir zwar fassungslos vor den aktuellen Kriegen stehen und zutiefst schockiert über deren Grausamkeiten sein, dennoch lieben wir es, unsere Freizeit mit dem Genuss von Ungeheuerlichkeiten zu verbringen: Morde, Monster, Zombies. Ob sonntags im »Tatort«, im True-Crime-Podcast, in Ego-Shootern oder Romantasy-Büchern – kaum etwas fesselt mehr als das Töten von Menschen, kitzelt uns so sehr wie das Verstümmeln, Martern und Vernichten, gerne auch durch den feurigen Atem eines Drachen. Wir genießen epische Schlachten: ob gegen die Orks aus Mordor oder das Hinmetzeln der Truppen des Nachtkönigs. Und würde »Lützen 1632« von Ridley Scott verfilmt, avancierte auch das zum Kassenschlager. Welche dunklen Gelüste haben uns da im Griff?
Für solche Erkundungen im Herz der Finsternis bedarf es mehr als einer Wissenschaft. Dazu braucht es erstens Evolutionäre Anthropologie und Primatologie, die das tierische Erbe in uns freilegen und das Zusammenspiel von biologischer und kultureller Evolution aufdecken, nicht zuletzt durch Vergleiche mit unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen und Bonobos. Dazu benötigt es zweitens die Archäologie, liefert sie doch handfeste Beweise, um die Gewalttaten der Vergangenheit aufzuklären. Dazu braucht es drittens Geschichts- und Religionswissenschaft, die erklären, wie Krieg, Mord und Totschlag zum Signum der Zivilisation werden konnten. Deswegen macht sich hier ein Autorenteam ans Werk, das diese Felder abdeckt und seine Expertise mittels Feldforschungen an Primaten, durch Ausgrabungen und Schlachtfeldarchäologie sowie das Ausrichten von Ausstellungen zum Thema Krieg nachgewiesen hat und diverse für die Evolution der Gewalt relevante Aspekte in zahlreichen Büchern und Aufsätzen aufgearbeitet hat.
Natürlich wird auch die Ethnografie einbezogen, sie liefert wertvolle Einsichten. Doch gilt es, Vorsicht walten zu lassen. Weil das Wissen um die tiefe Vorgeschichte lange mehr als spärlich war, hat man sich mitunter nur zu gerne damit beholfen, die Lücken mit Berichten über indigene Kulturen zu füllen. Insofern kam es oft zum Zirkelschluss, weil in die Vergangenheit das projiziert wurde, was gerade in der Ethnografie passend erschien. Je nach Gusto nahm man entweder die kriegslüsternen Yanomami aus Südamerika oder die Batek von der malaysischen Halbinsel, die jegliche Gewalt untereinander und gegen Fremde für inakzeptabel halten. Eine Gewissheit hat die Ethnografie zu bieten: Die rund um den Globus zu beachtende Variabilität der Lebensstile belegt, Menschen sind weder auf Krieg noch auf Frieden festgelegt.
Erst die Kombination der Wissenschaften kann Licht in die dunklen Winkel unserer Persönlichkeit wie unserer Geschichte bringen. Wir werden uns ausführlich unter Tieren umschauen und unsere Rekonstruktion der Evolution der Gewalt, insbesondere dann, wenn es um prähistorische Zeiten geht, archäologisch untermauern sowie auf Ermittlungen rund um konkrete Tatorte zurückgreifen. Leider ist die bisherige Forschung, was frühe Epochen angeht, stark eurozentrisch geprägt und die Generalisierbarkeit der Ergebnisse damit diskutabel. Doch wir hoffen, das durch unseren breiten Ansatz zu kompensieren. Ohnehin ist eine Fokussierung auf die Genealogie des westlichen Kriegswesens gerechtfertigt, da dieses der Welt als eine Matrix der Gewalt aufgezwungen wurde. Sie ist es, die wir primär durchschauen müssen.
Nicht zuletzt hoffen wir Aspekte ins Spiel zu bringen, die meist viel zu selten berücksichtigt werden. Erinnern wir uns: 47 Menschen liegen im Massengrab von Lützen, alle männlich. Und was macht der Krieg mit Frauen? Und warum sind die Soldaten dort eher entsorgt als bestattet, während dem König, der sie in den Tod schickte, ein Dorf weiter eine Kirche gewidmet ist, in der er als Heiliger und Retter des Glaubens verehrt wird? Menschen führen Krieg? Wirklich? Alle?
Wir präsentieren keine Kriegsgeschichte voller Pulverdampf und Schlachtenlärm. Das Ziel unseres Buches ist evolutionäre Aufklärung: Wir legen auf Basis des aktuellen Forschungsstandes und eigener Arbeiten eine Anamnese der Vorgeschichte des Krieges vor. Wir möchten die evolutionären Wurzeln von Aggression und Gewalt freilegen und deren Wucherungen durch die menschliche Geschichte verfolgen. So lässt sich verstehen, unter welchen Bedingungen es zu kriegerischen Eruptionen kommt und wer die eigentlichen Kriegstreiber sind. Erst eine korrekte Diagnose eröffnet die Möglichkeit, wirkungsvolle Therapien und funktionierende Prävention zu entwickeln – und das, ohne damit politisch naiv zu erscheinen.
Teil 1Keine Kinder Kains
Wir begeben uns auf vermintes Terrain. Die Frage, wie es um die kriegerische Vergangenheit der Menschen bestellt ist, besitzt enorme Brisanz. Die Debatten, die sie seit Jahrhunderten entfacht, belasten jede Herangehensweise an die Evolution der Gewalt. Deshalb ist es nötig, das Feld zunächst von den ideologischen Altlasten zu räumen, damit sie nicht den Blick auf die Wirklichkeit verstellen. Das wird eine erstaunlich befreiende Wirkung haben. Deshalb inspizieren wir zunächst, warum ein Krieg um die menschliche Natur tobt, und zeigen dann in aller Kürze, wie eine ebenso zeitgemäße wie produktive Herangehensweise an das große Menschheitsthema überhaupt möglich ist.
1Der Krieg um die menschliche Natur
Dank moderner naturwissenschaftlicher Methoden macht die Archäologie die spektakulärsten Entdeckungen und bringt noch die unscheinbarsten Dinge zum Sprechen. Vor allem fördert sie Tatsachen zutage, über die keine Schriftquellen berichten. Haschisch im Allerheiligsten Gottes etwa.
Eine Festung auf einem Bergsporn am Rande der Wüste Negev im heutigen Israel, fast 3000 Jahre alt: Als die Archäologen sich in Tel Arad an die Arbeit machten, waren sie auf vieles gefasst, schließlich gruben sie im Heiligen Land. Doch sollten Jahrzehnte vergehen, bis die größte Überraschung enthüllt wurde. Sie steckte in der unansehnlichen Kruste auf der Oberseite eines Altars.
Die Lage der Festung ist nicht so spektakulär wie die des gut zwanzig Kilometer Richtung Totes Meer gelegenen Masada, wo jüdische Widerstandskämpfer den römischen Belagerern bis zu ihrem Massenselbstmord trotzten. Dafür stießen die Ausgräber in Tel Arad bereits in den 1960er Jahren auf den einzig unzerstörten Tempel Jahwes mitsamt Allerheiligstem im Königreich Juda. Alles deutet darauf hin, dass er weder den Heeren der Assyrer noch der Babylonier, die das Land verwüsteten, zum Opfer fiel. Er wurde gegen Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. gezielt abgebaut.
Im Allerheiligsten stand eine Mazzebe, ein aufrecht stehender Stein, der die Gegenwart des Staats- und Kriegsgottes Jahwe signalisierte. Sorgfältig niedergelegt, fanden sich zwei kleine Altäre. Obwohl das Tempelensemble ins Israel-Museum nach Jerusalem transferiert wurde, blieben die Brandreste auf den Altären unbeachtet. 2020 erst wurden die Laboranalysen veröffentlicht – und die hatten es in sich.
Dass auf dem einen Altar über mehrere Jahrzehnte Räucherwerk dargebracht wurde, überrascht nicht. Ebenso wenig, dass es kostbarer Weihrauch war, schließlich stammte er aus einer Festung des Königs. Auf dem anderen aber wurde Cannabis verbrannt. Damit handelt es sich um dessen ältesten Nachweis im Nahen Osten. Weil Haschisch einen wenig attraktiven Duft produziert, sind sich die Archäologen sicher: Es wurde als psychoaktive Substanz eingesetzt, um die Priester in allerheiligste Stimmung zu versetzen. Und sie vermuten, dass das auch in anderen Tempeln wie dem prächtigen Tempel Salomos in Jerusalem der Fall war.
Wir starten aus zwei Gründen mit dieser Geschichte. Sie führt uns auf die Fährte des wohl verhängnisvollsten Mythos der Menschheitsgeschichte. Denn Tel Arad wird traditionell mit den Kenitern verknüpft, einem kriegerischen und nomadisch lebenden Wüstenstamm, den die Bibel mehrfach erwähnt. Archäologen haben an der Stelle des Tempels ein kenitisches Vorgängerheiligtum vermutet. Die Keniter werden im Süden Judas verortet, wo sie weite Teile des Negevs dominierten. Im Hebräischen schreibt sich ihr Name genauso wie der Kains. Der biblische Brudermörder gilt als ihr Stammvater.
Kain, der Abel erschlug – das ist der Bibel zufolge der erste Gewalttäter der Menschheit. Kaum waren Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden, geschah der erste Mord. Auf dieser Geschichte beruht das folgenreiche Narrativ, das erklärt, warum die Welt nicht den Eindruck macht, als ob ein guter Gott sie erschaffen habe: Wir alle sind Kinder Kains. Krieg und Gewalt sind unausrottbar, so lautet die Anklage, weil in Menschen von Anfang an etwas Dunkles, Böses schlummert. Diesem Mythos wohnt eine ideologische Funktion inne, legitimiert er doch die harte Hand kirchlicher und weltlicher Herrscher. Es braucht sie, um die Menschen vor sich selbst zu schützen.
Der Kain-Mythos rechtfertigte gut zweitausend Jahre lang Herrschaft und Unterdrückung. Mehr noch: Er emanzipierte sich aus seinen religiösen Anfängen und zieht sich wie ein roter Faden durch die politischen und wissenschaftlichen Debatten bis zum heutigen Tag. Im Namen Kains tobt ein Krieg um die menschliche Natur. Deshalb braucht es zunächst die Aufklärung des mutmaßlichen Urverbrechens, verhindert es doch eine vorurteilsfreie Herangehensweise an das Thema Gewalt. Spoilerwarnung: Der Fall wird mit einem überraschenden Freispruch enden.
Der zweite Grund ist, dass Archäologie nicht allein im Hinblick auf materielle Hinterlassenschaften benötigt wird. Es braucht sie auch, um uns durch kulturelle Altlasten zu graben. Das ist eine Konsequenz der kumulativen, also sich anreichernden kulturellen Evolution. Nicht nur die konkrete Welt der Dinge, auch unsere Vorstellungen und Begriffe, Narrative, Diskurse und Institutionen sind durch die Zeiten gewachsene Produkte. Schicht um Schicht lagern sie sich ab, versteinern und schaffen damit eine künstliche Umwelt, die unsere Wahrnehmung und unser Verhalten bestimmt. Damit belastet immer auch längst Veraltetes gegenwärtiges Denken. Die »Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen« nannte das der Philosoph Ernst Bloch.
Verstärkt wird das durch einen weitverbreiteten kognitiven Fehlschluss, den wir Kulturblindheit nennen. Das ist die Tendenz, Phänomene wie »Kunst«, »Religion«, »Liebe«, aber eben auch »Krieg« als unveränderliche Entitäten, also als über die Zeiten hinweg Existierendes zu betrachten und sie nicht als das zu erkennen, was sie wirklich sind: kulturelle Komplexe mit einer langen und wechselvollen Geschichte. Der Fehler liegt darin anzunehmen, dass sie in der Vergangenheit das Gleiche repräsentierten wie heute. Aufbauend auf biologischen Substraten wie psychologischen Dispositionen sind diese Phänomene jedoch kumulativ gewachsen, Dimension um Dimension kam hinzu (und manches erodierte wieder) – daher variieren sie von Zeit zu Zeit, von Kultur zu Kultur. Deshalb müssen wir uns durch die Schichten graben und den Schutt beiseiteräumen, um freien Blick zu erhalten.
Kulturblindheit ist ein gravierendes Problem. Menschen unterschätzen dramatisch, wie sehr sie kulturell geprägte Wesen sind. Ihnen ist vieles, was ihre Sozialisation in Kindheit und Jugend bestimmte, zur zweiten Natur geworden. Das macht sie voreingenommen und spurt die Weise vor, wie sie die Welt wahrnehmen und welche Handlungsoptionen sie für legitim halten. Ihre historisch zufällige Sicht erscheint ihnen dadurch als natürlich und unantastbar. Ein anderer Blick auf die Welt wird damit, so der französische Soziologe Pierre Bourdieu, »undenkbar«.
Das gilt gerade für Herrschaftsnarrative, die Menschen von klein auf verinnerlicht haben. Um es anhand eines Beispiels Bourdieus zu illustrieren: Die Vorstellung, dass Bildungserfolg auf dem individuellen Talent beruht – und nicht auf dem Bildungsniveau der Eltern –, ist umso weiter verbreitet, je tiefer die Menschen auf der sozialen Leiter stehen. Bildungsferne Menschen schreiben sich also selbst die Schuld an ihrer Lage zu. Ihnen mangele es, so die Eigenaussage, an Talent. Dadurch stabilisieren ausgerechnet jene die herrschende soziale Ordnung, die am meisten unter ihr zu leiden haben.
Ebenso wurde der Kain-Mythos in seinen unterschiedlichsten Metamorphosen den Menschen eingeschrieben, sodass sie selbst daran glaubten, dass es Herrscher geben muss, die über sie wachen und vor ihrer dunklen Seite beschützen. Auch hier: Die Untertanen stabilisieren jene Ordnung, unter der sie selbst am meisten zu leiden haben. Machen wir uns also an die Genealogie des Diskurses von der boshaften, mithin kriegerischen Natur des Menschen. Uns von dieser ideologischen Altlast zu befreien ist eine wissenschaftliche Notwendigkeit, kontaminiert sie doch die Debatten um den Ursprung des Krieges bis heute. Es geht um so viel mehr als nur um eine biblische Geschichte.
Hinter dem Namen Kain verbirgt sich ein misanthropisches Phantasma: Unter dem dünnen Firnis der Kultur schlummert eine blutrünstige Bestie – wehe, sie regt sich! Der Ursprung ist bekannt: Was lässt Menschen morden? Sie sind Nachfahren Kains. So steht es in der Bibel, so war es für die jüdische, die christliche und die islamische Tradition über fast zwei Jahrtausende maßgeblich, so hat es das Denken und die Kultur des Westens bis in den letzten Winkel infiltriert.
Adam und Eva hatten den Garten Eden verlassen, und schon erschlug der eine Sohn den anderen. Tatsächlich erklärt die Bibel, wie Kains Nachfahren die Eskalationsspirale der Gewalt in Gang setzten – und damit die Welt der Kriege begründeten: »Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule«, wird sich Lamech, Kains Urururenkel, rühmen. »Kain soll siebenmal gerächt werden, aber Lamech siebenundsiebzigmal.«
Hier offenbart sich die wichtigste Quelle der Idee, dass mit den ersten Menschen Gewalt und damit auch der Krieg in die Welt getreten sei. Hier beginnt die Verteufelung der menschlichen Natur, hier liegt der Urgrund dessen, was der Anthropologe Marshall Sahlins treffend als »menschliche Selbstverachtung« tituliert hat.
An dieser Stelle zeigt sich aber auch, wie das »undenkbar« ins Spiel kam: Der erste Teil der Bibel, die Genesis, fungierte als »Urgeschichte«, sie sollte erklären, wie es mit den Menschen und ihrer Kultur begonnen hatte. Sie blieb in dieser Hinsicht bis weit ins 19. Jahrhundert hinein die verbindliche Erzählung. Die Bibelautoren erfanden eine Geschichte, welche die Seltsamkeiten ihrer Gegenwart erklären sollte. Solche ätiologischen Geschichten erläutern, warum die Welt so ist, wie sie nun mal ist.
Die monotheistischen Religionen kämpfen da mit einem Grundsatzproblem. Ihnen steht nur ein einziger Gott zur Verfügung, um den eher unerfreulichen Zustand der Welt zu erklären. Im Polytheismus mit seinen vielen Göttern existierte stets die Option, dass ein böser Gott oder der Streit der Götter für irdisches Unheil verantwortlich waren. Der berühmteste Fall ist der Krieg um Troja, der ausbrach, weil drei Göttinnen darum stritten, welcher von ihnen ein goldener Apfel mit der Aufschrift »der Schönsten« gebührte. Wie kann es dagegen sein, dass sich in Gottes Schöpfung (die der »Herr« ja für gut befunden hatte) die Menschen die Köpfe einschlagen? Da Gott daran keine Verantwortung tragen darf, kann die Schuld nur bei den Menschen liegen. Entweder ist ihre Natur sündig oder so schwach, dass sie nur allzu leicht den Einflüsterungen des Bösen erliegt.
Erstaunlicherweise betreibt die Bibel keinen Aufwand, um die Gründe für den ersten Mord offenzulegen: »Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick.« Gott ermahnte zwar Kain, aber der sprach zu seinem Bruder: »Lass uns aufs Feld gehen! Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot.«
Die Bibel verweigert sich einer klaren Begründung, warum das erste Kapitalverbrechen überhaupt geschehen konnte. Es passierte aus heiterem Himmel. Menschen sind nun mal so. Die islamische Tradition wird deshalb nachbessern und psychologisierend darauf verweisen, dass Kain schon immer ein aufbrausendes Gemüt besaß. Wut über eine Zurücksetzung also, ein ganz normaler menschlicher Affekt: Das ist die unausgesprochene Erklärung der Genesis, wie es zum Ausbruch der Gewalt kommen konnte. Entsprechend lässt Gott sogar mildernde Umstände gelten und schützt den Brudermörder Kain. Generationen von Theologen werden andere Begründungen liefern. Sie alle aber lesen etwas in den Text hinein, das dort nicht steht. Das Christentum fokussiert ganz auf die sündhafte Natur der Menschen – und bringt den Teufel als Verführer ins Spiel. Manche vermuten sogar, Kain könnte ein Kind des Leibhaftigen sein.
Warum uns die biblische Geschichte zu interessieren hat: Sie illustriert, wie die Menschen auf die falsche Fährte gesetzt worden sind. Denn der eigentlich Schuldige kommt unbehelligt davon. Die Ursache für Kains Gewaltakt war eine ungleiche Behandlung, eine Ungerechtigkeit. Wie Abel hatte Kain ein Opfer dargebracht. Seines wird aber nicht anerkannt. Warum? Es gibt in der Genesis keine Erklärung dafür. Der Urheber dieser Ungerechtigkeit? Gott! Er nimmt nur ein Opfer an – ohne jede Begründung. Die Genesis-Geschichte lässt keine andere texttreue Deutung zu.
Doch gerade das Offensichtlichste ist inakzeptabel, eben »undenkbar«. In einer von einem guten Gott geschaffenen Welt kann alles Böse nur von den Menschen ausgehen – oder allenfalls vom Teufel, der eigentlich eine den Monotheismus verwässernde Hilfskonstruktion ist. Aber nicht von Gott.
Adams und Evas Ursünde avancierte zur Erbsünde des gesamten Menschengeschlechts. Der maßgeblichen Linie des christlichen Kirchenvaters Augustinus von Hippo (354–430) zufolge sind die Menschen von Geburt an durch die Erbsünde in ihrer Natur geschädigt und auf sich allein gestellt, hilflos den Anwandlungen des Bösen ausgesetzt. Nur Gott kann der Sündhaftigkeit Einhalt gebieten, weshalb es unabdingbar ist, dem »Herrn« und seinen irdischen Stellvertretern – Kirche und Staat – zu folgen.
Augustinus geht so weit, formuliert es die Religionswissenschaftlerin Elaine Pagels, dass er aufgrund des Sündenfalls »das obrigkeitliche Regiment in jedweder gegebenen Form, und sei es die Tyrannis, bejaht und für unverzichtbar erklärt, da ohne es die in der Menschennatur von der Sünde entfesselten Kräfte nicht niederzuhalten wären«. Kurzum: Der Mythos von der gewalttätigen Natur der Menschen dient dazu, Gewalt über Menschen zu rechtfertigen. Er soll sie der Herrschaft unterwerfen. Die Herrschenden werden ihn dafür lieben. Er bescherte ihnen eine göttliche Legitimation.
Das christliche Abendland wird immer neue Metamorphosen dieses Diskurses erleben. In der Renaissance brachte die verstärkte Rezeption der Antike neue Impulse, welche die Dominanz der biblischen Weltsicht infrage stellten. Doch waren auch diese wenig angetan, einem friedlicheren Menschenbild zum Durchbruch zu verhelfen. Im Gegenteil, sie folgten der vorgespurten Bahn und sorgten dafür, dass die religiöse Idee der menschlichen Bosheit im weltlichen Gewand fortlebte und damit das politische und wissenschaftliche Denken bis in unsere Tage beeinflussen wird.
Niccolò Machiavelli (1469–1527), der Apologet der blanken Macht, wird den Fürsten aufgrund der »Schlechtigkeit der Menschen« das Recht auf Notwehr erteilen. Diese müssen keinerlei Rücksicht gegenüber den Untertanen walten lassen, sondern die Herrschaft mit Härte und List ausüben. Die Weltgeschichte belege »es durch viele Beispiele, … dass alle Menschen schlecht sind und dass sie stets ihren bösen Neigungen folgen, sobald sie Gelegenheit dazu haben«.
Man kann zu Machiavellis Verteidigung vorbringen: Seine Welt war die der Condottiere, der Italienischen Kriege und marodierenden Landsknechte. Er erlebte den »Sacco di Roma«, die wochenlange Plünderung und Verwüstung Roms durch führerlose Söldnerheere. Die Grausamkeiten seiner Zeit ließen ihn in seiner Schrift »Die Kunst des Krieges« die Renaissance des römischen Militärstaats ersehnen.
Ein Jahrhundert später meldete sich mit dem Philosophen Thomas Hobbes (1588–1679) die prägendste Stimme in diesem Diskurs zu Wort. Er schuf das wirkmächtige Bild, dass der Mensch nun mal des Menschen Wolf sei. Wie kam er darauf? Nun, Hobbes war der Erste, der Thukydides (454–399/396 v. Chr.) ins Englische übersetzte. Dessen monumentales, als frühestes Geschichtswerk geltendes Buch »Der Peloponnesische Krieg« berichtet über den fast drei Jahrzehnte währenden Krieg zwischen Athen und Sparta. Über die Anfänge der zutiefst martialischen Welt des antiken Griechenlands behauptete Thukydides, dass die Menschen untereinander zerstritten und in ständiger Angst vor Überfällen in armseligen Verhältnissen gelebt hätten. Es herrschte die »Ohnmacht der Vorzeit«.
Der antike Historiker schilderte mit fast modern anmutender Attitüde den Krieg und fokussierte dabei immer wieder auf dessen Gräueltaten. Über das Massaker auf Kerkyra schreibt Thukydides: »Der Tod zeigte sich da in jeder Gestalt, wie es in solchen Läuften zu gehen pflegt, nichts, was es nicht gegeben hätte, und noch darüber hinaus. Erschlug doch der Vater den Sohn, manche wurden von den Altären weggezerrt oder dortselbst niedergehauen, einige auch eingemauert im Heiligtum des Dionysos, sodass sie verhungerten.« Und das Schicksal der von Athen besiegten Melier ist eines, wie es als archetypisch für Kriege betrachtet werden kann: »Die Athener richteten alle erwachsenen Melier hin, soweit sie in ihre Hand fielen, die Frauen und Kinder verkauften sie in die Sklaverei.«
Gut 2000 Jahre später griff Thomas Hobbes mit seiner Thukydides-Lektüre also auf die ältesten für ihn verfügbaren historischen Quellen zurück – ein Blick weiter in die Vergangenheit war für Menschen seiner Zeit unmöglich. Woher sollte er also auf die Idee kommen, dass es einmal Epochen ohne Mord und Totschlag gegeben haben könnte? Hobbes trug mit seiner 1651 erschienenen Schrift »Leviathan« maßgeblich dazu bei, das biblische Narrativ von der menschlichen Sündhaftigkeit zu entgöttlichen und damit zu historisieren. Die Urgeschichte der Genesis mutierte bei ihm zum menschlichen Ur-, nämlich Naturzustand. Den aber lässt er erst jenseits von Eden beginnen. Einen paradiesischen Anfang kennt Hobbes nicht: Die Menschen befinden sich »während der Zeit, in der sie ohne eine allgemeine, sie im Zaum haltende Macht leben, … in einem Krieg eines jeden gegen jeden«. Sie existierten in »beständige(r) Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes«. Das menschliche Leben sei »einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz« gewesen. Hier klingt Thukydides als Hobbes’ Kronzeuge mit seiner »Ohnmacht der Vorzeit« durch. Und dann taucht das viel zitierte Wort vom Homo homini lupus auf. Das hatte Hobbes aus einer antiken Komödie des Plautus übernommen – es aber sinnentstellend eingekürzt: Der Mensch sei des Menschen Wolf, heißt es im Original, zumindest, solange er den anderen nicht kennt.
Hobbes zufolge braucht es den Staat, den er nach dem biblischen Ungeheuer als Leviathan bezeichnet, der die Menschen mit seinem Gewaltmonopol vor sich selbst schützt. Auch hier wird die Frage nach unserer dunklen Seite mit einem Verweis auf unsere dunklen Anfänge beantwortet: Menschen seien von Natur aus nicht sozial, sie könnten nur gezwungen werden, es zu sein. Dafür müssten sie sich einem absoluten Herrscher unterwerfen. Aus Angst vor dessen Bestrafung werde der Krieg aller gegen alle verhindert.
Hobbes naturalisierte den Kain-Mythos und die Erbsünde: Gewalt und Krieg lasten auf dem Menschengeschlecht vom Anfang aller Tage an. Und wir müssen den Herrschern dankbar sein, dass sie uns vor uns selbst beschützen. Hobbes wird als Anwalt des Staates in die Geschichtsbücher eingehen. Kein Wunder, dass dieses Narrativ so erfolgreich war.
Auch hier darf man sich nicht zu sehr erheben. Die Theoretiker der Vergangenheit konnten es nicht besser wissen. Wohin sie nur sahen, welche Bücher sie auch lasen, alles kündete von Gewalt in der fürchterlichsten Gestalt. Bei Hobbes stand sie sogar Taufpate, schreibt er in seiner Autobiografie. Seine Mutter brachte ihn nicht nur zu früh zur Welt – aus Furcht vor dem Angriff der spanischen Armada auf England. Sie gebar auch Zwillinge, schreibt Hobbes: ihn selbst und die Angst.
Das Unheil nahm kein Ende: Zu seinen Lebzeiten tobten der Dreißigjährige Krieg und der Englische Bürgerkrieg (1642–1649), der in der Hinrichtung des Königs Karl I. gipfelte – und Hobbes zur Flucht ins französische Exil zwang. Er war wiederholt Zeuge, wie ein Kollaps der Staatsgewalt in ein fürchterliches Morden mündete. Der Philosoph entwarf also die zu seiner kriegerischen Gegenwart passende kriegerische Vorgeschichte.
Die pessimistische Sicht wird über die Jahrhunderte hinweg populär bleiben. Schließlich lautet die einfachste Erklärung für die grassierende Gewalt: Da ist ein dunkles Erbe in uns am Werk. Die Erbsünde ließ sich biologisieren. Der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, glaubte einen zutiefst destruktiven »Todestrieb« identifizieren zu können. In »Das Unbehagen in der Kultur« (1930) heißt es: »Homo homini lupus; wer hat nach allen Erfahrungen des Lebens und der Geschichte den Mut, diesen Satz zu bestreiten?« Unter für grausame Aggressionen günstigen Umständen äußert sich die Gewalt »spontan, enthüllt den Menschen als wilde Bestie, der die Schonung der eigenen Art fremd ist … Die Kultur muss alles aufbieten, um den Aggressionstrieben der Menschen Schranken zu setzen«. Auch Freud untermauert das mit den Erfahrungen historischer Zeiten – von den »Gräueln der Völkerwanderung« bis zu den »Schrecken des letzten Weltkriegs«.
Solche Trieb- und Instinktlehren werden das ganze 20. Jahrhundert virulent bleiben und spuken teils noch heute herum, obwohl sie wissenschaftlich unhaltbar geworden sind. Sie basieren auf der mechanistischen Vorstellung, dass sich der Aggressionstrieb in regelmäßigen Abständen entladen müsse, ansonsten käme es zum Triebstau, der sich irgendwann in einer Gewaltexplosion entlade.
Einflussreicher noch waren die sozialdarwinistischen Behauptungen, dass den immerwährenden Kampf ums Dasein nur die Stärksten gewinnen und unsere Vorfahren den Planeten eroberten, weil sie alles Schwache ausrotteten. Deswegen sei die Vererbung des besten Erbguts überlebensnotwendig. Das ist die Grundlage für Eugenik und Rassismus. Der »Rassenkampf« um Lebensraum avancierte zum zentralen Topos völkischen Denkens; die Nationalsozialisten führten als angebliche »Herrenmenschen« ihren Vernichtungskrieg gegen alle »Untermenschen« und als »minderwertig« Gebrandmarkte. Der Zweite Weltkrieg wird schätzungsweise 80 Millionen Menschen das Leben kosten.
Nun hätte man nach 1945 zu dem Schluss kommen können, dass »die westliche Zivilisation auf einer perversen und falschen Vorstellung von der menschlichen Natur errichtet wurde«, wie der Anthropologe Marshall Sahlins unverblümt formulierte. Tatsächlich war das der Grund, warum biologische und evolutionäre Begründungen des Menschseins von den Kulturwissenschaften auf den Index gesetzt wurden. Trotzdem erwies sich das Narrativ, dass die Spezies Mensch eine mordende Vergangenheit besäße, als unverwüstlich. Der Verhaltensforscher und spätere Nobelpreisträger Konrad Lorenz legte 1963 mit »Das sogenannte Böse« ein Buch vor, das bis heute seine Leser findet – und eine Erklärung präsentiert, die ein altes Bild aufgreift. Nachdem unsere Vorfahren »aller feindlichen Mächte der außerartlichen Umwelt Herr geworden« waren, sei »der Mensch« nun tatsächlich »sein eigener Feind, Homo homini lupus« geworden. Der den Menschen innewohnende »Aggressionstrieb« verlange nun mal nach Entladung.
Und hier kommt die Erbsünde im biologischen Gewand ins Spiel. Lorenz spricht vom »verderbliche(n) Maß an Aggressionstrieb, das uns Menschen heute noch als böses Erbe in den Knochen sitzt«. Der »Auslese treibende Faktor war der Krieg, den die feindlichen benachbarten Menschenhorden gegeneinander führten«. Wo der nicht ausgelebt werde, bestehe die Gefahr, dass der Aggressionstrieb nach einem anderen »Ventil« sucht. Der Triebstau führe zu Neurosen. »In gewissem Sinne sind wir also alle Psychopathen, denn jeder von uns leidet unter den Triebverzichten, die das Gemeinwohl von ihm fordert.«
Lorenz bediente sich ausdrücklich des Kain und Abel-Narrativs. Kaum hatte »der Mensch« Faustkeil und Feuer erfunden, verwendete er »sie prompt dazu, seinen Bruder totzuschlagen und zu braten«. Unseren Vorfahren habe es an »Tötungshemmung« gefehlt, die die zwischenmenschliche Entladung des Aggressionstriebes verhindert hätte. Dagegen sind die modernen Menschen Opfer der neuen Waffentechnologien geworden, die dazu führten, »dass dem Handelnden die Folgen seines Tuns nicht unmittelbar ans Herz greifen«.
Hier zeigt sich der damalige Boom der Paläoanthropologie, der Suche nach den frühesten Relikten unserer Vorfahren. Raymond Dart deutete fragmentierte und zerbrochene Tierknochen, die gemeinsam mit Schädelresten von Vormenschen der Gattung Australopithecus gefunden worden waren, als Beweise, dass diese nicht nur Tiere erbeutet hatten, sondern auch ihresgleichen. Die Australopithecinen waren für ihn, schreibt Dart 1953, »confirmed killers«, erwiesene Mörder: »Fleischfressende Kreaturen, die sich ihrer lebenden Opfer gewaltsam bemächtigten, sie zu Tode schlugen, ihre gebrochenen Körper zerrissen, sie Glied für Glied zerstückelten, ihren Heißhunger mit dem heißen Blut der Opfer stillten und gierig das sich noch windende Fleisch verschlangen.« Das Morden habe uns zu Menschen gemacht.
Selten ist so mit Händen zu greifen, wie Narrative über die Jahrhunderte bestehen bleiben, selbst wenn sie dabei von der religiösen in die wissenschaftliche Sphäre wechseln: Raymond Dart stellte seinem Aufsatz ein Zitat aus der »Christlichen Ethik« Richard Baxters (1615–1691) als Motto voran: »Von allen Bestien ist die menschliche Bestie die schlimmste – für andere und für sich selbst der grausamste Feind.« Baxter, ein puritanischer Pfarrer, war wie sein Zeitgenosse Hobbes von den Schrecken des 17. Jahrhunderts geprägt. Einmal mehr zeigt sich, wie die eigene Weltanschauung als Folie dient, um das Bild der menschlichen Urgeschichte zu entwerfen.
Spätere Untersuchungen zeigen, dass die von Dart begutachteten Knochenensembles mit jenen übereinstimmen, wie sie von Leoparden und Hyänen stammen. Unsere Vorfahren, die Australopithecinen, waren eher die Gejagten als die Jäger, Beute und keine Killer. Trotzdem wird die Man the Hunter-These überaus populär und unterstützte die Überzeugung, dass Menschen erfolgreich Krieg führen können, weil ihre Vorfahren als blutrünstige Jäger begonnen hatten. Die Paläoanthropologie erteilte dem Wettrüsten des Kalten Krieges den wissenschaftlichen Ritterschlag.
Robert Ardrey, Dramatiker, Drehbuchautor und Anthropologe, hat diese Thesen unters große Publikum gebracht: »Wir sind Kains Söhne«, schreibt er 1961 in einem der erfolgreichsten Bücher der Paläoanthropologie. »Der Mensch ist ein Raubtier, dessen natürlicher Instinkt ihn dazu treibt, mit der Waffe zu töten. Die plötzliche Bereicherung der Ausstattung eines erfolgreich bewaffneten Raubtieres durch ein vergrößertes Gehirn brachte nicht nur den Menschen hervor, sondern auch das Verhängnis des Menschen.« Der Titel des Buches? »African Genesis« (deutsch: »Adam kam aus Afrika«).
Es ist die paläoanthropologische Metamorphose des biblischen Mythos. So wie der Brudermörder zum Urvater aller Kultur wird, avancierte die Entdeckung, dass man einen Knochen zum Töten anderer Menschen nutzen kann, zum Urknall aller Kultur. Stanley Kubrick setzte diesen Gedanken in seinem Film »2001: Odyssee im Weltraum« genial ins Bild: Der von Urmenschen beim ersten Mord in die Luft gewirbelte Knochen verwandelt sich in ein Raumschiff.
Als dann in den 1970er Jahren die Primatologin Jane Goodall berichtete, dass sie unter Schimpansen kriegsähnliche Zustände in Gestalt systematisch betriebener Angriffe auf Nachbargruppen beobachtet hatte, war es ihr Schüler Richard Wrangham, der im Buch »Demonic Males« die direkte Linie zog: Gewalt und Töten seien das Erbe, das von den letzten gemeinsamen Vorfahren, die der Homo sapiens mit den Schimpansen teilt, auf uns gekommen sei.
So formierte sich eine heute noch kursierende evolutionäre Sicht, der zufolge auch der Krieg angeboren sei. Bei dieser Erblast handele es sich um eine Anpassung an die kriegerischen Verhältnisse der Urzeit, in der sich nur die Gewalttätigsten fortpflanzten. Demnach wäre nicht allein die individuelle Aggression in uns verwurzelt, sondern auch die kollektive Gewalt, da einzelne Gruppen sich stets gegenseitig attackierten. Das korrespondierte mit dem Glauben, unsere Jäger und Sammler-Vorfahren hätten unter einer mangelhaften Ressourcenlage gelitten und sich deshalb in ständiger Konkurrenz zueinander befunden.
Auch hier steht die ideologische Funktion dieses Narrativs außer Frage: Mit einem dunklen Erbe belastet, versteht es sich von selbst, warum Menschen anderen Menschen die Hölle auf Erden bereiten – und wir können uns glücklich schätzen, dass uns die Errungenschaften der Zivilisation gegen uns selbst beschützen. Wir sind nicht mehr »die Wilden«, wir sind »zivilisiert«, lautete das Mantra des Westens. Bereits im Kolonialismus hatte der vorgegeben, die Welt befrieden zu wollen – und sei es mit Waffengewalt.
Entsprechend hatten um die Jahrtausendwende Bücher Konjunktur, die wie Lawrence Keeleys »War before Civilization«, Steven LeBlancs »Constant Battles«, Azar Gats »War in Human Civilization« oder Keith F. Otterbeins »How War Began«, aber auch Barbara Ehrenreichs »Blood Rites: Origins and History of the Passions of War« alle mal mehr, mal weniger rigoros nachweisen wollten, dass es überall und jederzeit Kriege gegeben habe. Mit dem Ende des Kalten Krieges indes könne endlich ein Zeitalter des Friedens anbrechen – dem Fortschritt sei Dank. Zumindest hofften das viele, insbesondere, dass die USA eine globale »Pax Americana« garantieren würden.
Die Annahme der kriegerischen Vorgeschichte harmonierte bestens mit dem Fortschrittsmythos: Der britische Archäologe Ian Morris huldigte dem Krieg als jenem Phänomen, dem wir unseren Fortschritt und die Komplexität der modernen Welt zu verdanken hätten: »Die Antwort auf die Frage: Wozu Krieg? ist paradox und schrecklich zugleich«, schreibt Morris. »Krieg hat die Menschheit sicherer und wohlhabender gemacht, aber nur um den Preis des Massenmords. Aber da der letztlich zu etwas gut war, kommen wir nicht umhin festzustellen, dass all das Elend und Sterben nicht vergeblich gewesen ist.« Das »Tier in uns« sei nur durch ein »noch entsetzlicheres Tier« an die Kandare zu nehmen: den »Leviathan Staat«, der sich formiert habe, als aus »Killern« Herrscher geworden waren. Gelänge es, die USA dauerhaft als technisch überlegenen »Globocop« zu installieren, lautet Morris’ frohe Botschaft, werde alles »gut«.
Am wohl wirkungsvollsten vertrat der Evolutionspsychologe Steven Pinker die Neo-Hobbes-These, dass wir uns aus gewalttätigen Anfängen befreit und die »chronischen Überfälle und Fehden, die das Leben im Naturzustand gekennzeichnet« hatten, hinter uns gelassen haben und heute »in der friedlichsten Epoche leben, seit unsere Spezies existiert«. Aus »garstigen« Anfängen hätten Menschen sich in eine »edlere Richtung entwickelt«. Das staatliche Gewaltmonopol habe das Risiko gesenkt, eines gewaltsamen Todes zu sterben. Dass Pinker massive Kritik erfahren hat, weil er seine Analyse auf einer mehr als fahrlässigen Auswahl von archäologischen und ethnografischen Quellen gründete, sei an dieser Stelle nur erwähnt.
Morris wie Pinker lieferten damit den USA nicht nur eine evolutionäre Ahnenlinie als ultimative Legitimation, sondern verschafften ihnen auch eine heilsgeschichtliche Mission. Schon immer diente das Narrativ von der gewalttätigen Natur dazu, die Herrschaft des Staates über seine Bürger sowie der »entwickelten« Staaten über die »nicht entwickelten« Länder zu legitimieren. Ganz so wie einst nur die Kirche die sündhafte Natur der Menschen unter Kontrolle gehalten hat und der Leviathan namens Staat den Krieg aller gegen aller verhinderte.
Wir haben nun ein pessimistisches Menschenbild freigeschaufelt, das offenbar nicht totzukriegen ist. Der Anthropologe Douglas Fry nennt es einen »Mythos«, eine Form des vermeintlichen »Wissens«, der Kern des »okzidentalen Glaubenssystems« sei. Marshall Sahlins bringt es anschaulich auf den Punkt: »Seit mehr als zwei Jahrtausenden werden die Menschen des sogenannten Westens vom Phantom ihres eigenen inneren Wesens heimgesucht: vom Schreckgespenst des gierigen und Streit suchenden Menschen, der, wenn er nicht auf irgendeine Art und Weise der Herrschaft unterworfen wird, die Gesellschaft unweigerlich in die Anarchie stößt.«
Warum ist das so erfolgreich? Die »Ideen von Gewalt und Krieg, vom der Menschheit innewohnenden Bösen« seien so eingebettet in unsere Kultur, sagt der Anthropologe Robert W. Sussman, dass es ganz selbstverständlich sei »für Wissenschaftler wie das allgemeine Publikum anzunehmen, dass dieses Verhalten normal ist, biologisch determiniert, vererbbar und ein natürlicher Teil des menschlichen Verhaltensrepertoires«. Die Annahme, es sei immer schon gewesen wie heute, sei besonders »einfach zu denken«.
Und zwar aus einer ganzen Reihe von Gründen. Erstens: Angesichts der alles andere als friedlichen Gegenwart beruhigt die Vorstellung, dass es schon immer so gewesen ist. Da gibt es weder Erklärungs- noch Veränderungsbedarf. Zweitens: Es bestätigt die Alltagserfahrungen, dass Skrupellosigkeit die Welt zu regieren scheint und sich Friedfertigkeit nicht auszahlt, sondern offene Brutalität nur allzu oft als Gewinnerstrategie erweist. Drittens: Es harmoniert bestens mit dem Menschenbild des Kapitalismus, dem zufolge Menschen egoistische Gewinnmaximierer sind und sich in der Konkurrenz des Marktes die Stärksten durchsetzen. Schließlich viertens: Vor allem sichert es die Herrschaft ab, indem es das Menetekel sich gegenseitig zerfleischender Menschen an die Wand malt, überließe man diese sich selbst. Kurz, das Narrativ von der kriegerischen Natur taugt auf polyvalente Weise dazu, die herrschenden Verhältnisse abzustützen und jene an der Macht zu halten, die davon profitieren.
Immer gab es Gegenstimmen, die sich weigerten, die menschlichen Anfänge in den düstersten Farben zu malen. Bereits im alten Griechenland kursierten Vorstellungen vom ursprünglichen Goldenen Zeitalter, in dem Frieden herrschte. Selbst die Bibel lässt die ersten Menschen zunächst im Garten Eden ein paradiesisches Dasein führen. Insbesondere die mentalen Horizonterweiterungen, die mit der im 15. Jahrhundert beginnenden europäischen Expansion einhergingen, stellten das Krieg-ist-ewig-Narrativ infrage. Aus allen Winkeln der Erde lieferten Entdecker und Missionare Berichte, die erstaunlich oft von freundlichen Menschen handelten. Das inspirierte viele, über alternative Entwürfe des menschlichen Zusammenlebens nachzudenken; nicht zuletzt, um Kritik an den eigenen Verhältnissen in Europa zu üben.
Spekulationen über den »Naturzustand« und das »Naturrecht« schossen ins Kraut, wie man sie mit Denkern wie Hugo Grotius, John Locke oder Lord Shaftesbury verbindet, die mit optimistischen Menschenbildern operierten. Gipfeln wird das in Jean-Jacques Rousseaus Abhandlungen, dass der Mensch im Naturzustand gut gewesen sei und ihn erst das Eigentum verdorben habe. Dieser Urzustand war aber für den französischen Philosophen lediglich eine Hypothese, um erklären zu können, wie die Ungleichheit in die Welt gekommen sei. Der Topos des »edlen Wilden«, des unverdorbenen Naturmenschen, der noch heute unauflösbar mit Rousseaus Namen verknüpft ist, wurde von ihm selbst gar nicht verwendet. Dennoch begeistert er zivilisationsmüde Europäer bis zum heutigen Tag.
Im 20. Jahrhundert versuchte sich die Ethnologie aus ihren imperialen und auch rassistischen Anfängen zu befreien. Namentlich der Begründer der amerikanischen Ethnografie Franz Boas und seine Schüler bekämpften alle Rassenkampf-Ideen. Die berühmteste aus diesem Kreis wird Margaret Mead sein. 1940 stellte sie nicht nur die Frage: »Ist der Krieg eine biologische Notwendigkeit, eine soziologische Zwangsläufigkeit oder einfach eine schlechte Erfindung?« Sie beantwortete sie auch gleich dahingehend, dass es sich beim Krieg nur um eine kulturelle Innovation wie die Schrift oder die Ehe handeln könne, da es nun mal Kulturen gäbe, denen er unbekannt sei. Und das sei eine hoffnungsvolle Erkenntnis. In kulturellen Dingen sei es schließlich so, »dass eine schlechte Erfindung für gewöhnlich einer besseren Platz machen wird«.
In einer Zeit, in der die Paläoanthropologen Schädelfragmente und Faustkeile inspizierten, um die Man the Hunter-Theorie und damit die kriegerischen Anfänge der Gattung Homo zu untermauern, reisten Ethnografen zu den letzten Jägern und Sammlern. Bücher wie »The Harmless People« über die »harmlosen« San in der Kalahari-Wüste von Elizabeth Marshall Thomas erschienen. Da die friedliebende Seite bald die Ethnografie dominierte, klagten deren Gegner über eine »Friedens- und Harmoniemafia«, die alle unliebsamen Beobachtungen unterdrücke. »Pacifying the Past« lautete der Vorwurf, aus ideologischen Gründen werde die Vergangenheit befriedet. Die Auseinandersetzungen und Vorwürfe wurden heftig, die Lager polarisierten sich.
Der Krieg um die Natur des Menschen ist nie wirklich beigelegt worden. In den vergangenen Jahren haben eine Reihe von Anthropologen viel Arbeit investiert, um zu zeigen, dass die Datengrundlage der These widerspricht, kollektive Gewalt sei immer und überall vorhanden gewesen. Wer das wie Steven Pinker behaupte, wähle nur die seiner Sichtweise genehmen Fälle aus. Brian Ferguson hat sich in »Pinker’s List« die Mühe gemacht, für jeden einzelnen Fall nachzuweisen, wie heikel seine Verwendung in diesem Kontext ist.
Tödliche Gewalt zwischen Gruppen könne, so die Annahme, in der Evolutionsgeschichte keine entscheidende Selektionskraft gewesen sein, welche die menschliche Psychologie geformt habe. Immerhin dokumentiert Douglas Fry über siebzig nicht kriegerische Gesellschaften. Diese belegen, »dass ein Leben ohne Krieg tatsächlich möglich ist« – und wir nicht verdammt sind, uns ständig zu bekriegen. Zweifelsohne haben Menschen »das Potenzial, gewalttätig zu sein, aber eben auch das Potenzial, friedlich zu sein«, so Fry. »Möglicherweise könnte jeder von uns einen Mord begehen, aber in Wirklichkeit tun es die allermeisten von uns nie.« Konflikt sei ohne Frage ein unvermeidliches Charakteristikum des sozialen Lebens, aber »physische Aggression« stelle »nicht die einzige Möglichkeit der Konfliktbewältigung« dar. Und Ferguson schreibt: »Der Krieg lässt sich nicht ewig in der Zeit zurückverfolgen. Er hatte einen Anfang.« Unser Gehirn sei für den Krieg nicht fest verdrahtet. »Wir lernen ihn.«
Es ist an der Zeit, den Streit hinter uns zu lassen. Beide Seiten beschränken sich zu sehr darauf, nach Belegen zu suchen, um die eigene Position zu untermauern oder die der anderen zu unterminieren. Selbst jene, die für die friedliche Seite des Menschen eintreten, sind so mit der Verteidigung ihrer Position beschäftigt, dass sie wenig Aufwand betreiben, die Ursachen für Kriege zu ergründen.
Darüber hinaus essentialisiert der Streit die Menschen und schreibt ihr angebliches Wesen fest. Er verdeckt damit eine Grundtatsache der menschlichen Existenz: Wir sind eine hoch flexible und hoch plastische Spezies. Es gibt so viel mehr Gründe, warum Menschen Kriege führen, als die angebliche Eigenart ihrer Natur. Der Streit, ob wir nun Kains Kinder sind oder nicht, leistet vor allem eines: Er verhindert, dass man der zentralen Frage, wieso es Krieg überhaupt gibt, auf den Grund geht und Lösungen findet, ihn zu verhindern.
Der Ursünden-Diskurs gehört also ins Endlager ideologischer Altlasten. Was umso angebrachter ist, führte er Menschen doch 2000 Jahre lang auf den Holzweg. Das Schicksal Kains hat uns nicht im Geringsten zu interessieren! Wir sind nicht seine Kinder und Kindeskinder – und das sogar in einem ganz biblischen Sinne. Die komplette abendländische Tradition, in diesem Brudermord die Wurzel allen Übels zu verorten, baut auf einer falschen Prämisse auf. Die Bibelwissenschaft weiß das längst.
Dass die Geschichte von Kain und Abel zutiefst merkwürdig ist, springt einem aus jeder Zeile entgegen. Vor allem verblüfft der unmotivierte Brudermord, kaum dass die Menschen erschaffen sind. Versteht denn Gott sein Handwerk nicht? Tatsächlich gibt es mindestens zwei Aspekte, die Bibelwissenschaftler zu der Überzeugung kommen ließen, dass sie gar nicht an diesen frühen Ort in der Bibel gehört.
Auf die Kain und Abel-Geschichte, Genesis 4, folgt in der Bibel bald schon die Sintflut, in der alle Menschen mit Ausnahme von Noahs Familie ertränkt werden. Doch die Kain-Episode weiß nichts davon. Ansonsten hätte Kain ja nicht zum exklusiven Stammvater der Keniter werden können, ebenso wenig wäre er der Ahnherr all derer geworden, »die in Zelten wohnen und Vieh halten«, der »Zither- und Flötenspieler«, der Werkzeugmacher und »Erz- und Eisenschmiede«. Denn die wären ja alle in der Sintflut ertrunken. Und zweitens: Wen meinte Kain, als er Gott um Schutz anflehte: »So wird mir’s gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet.« Wer sollte ihn totschlagen? Nach dem Brudermord gab es außer Adam und Eva keine weiteren Menschen auf Erden. Ursprünglich muss die Geschichte also von einem anderen Ort innerhalb der biblischen Geschichten stammen – und zwar nach der Sintflut. Die Brudermord-Episode ist von den Bibelredakteuren erst spät an den prominenten Platz gleich nach dem Paradies versetzt worden.
Die Konsequenz: Die Intention der ursprünglichen Geschichte war es niemals, die mörderische Natur aller Menschen zu postulieren. Das erklärt auch, warum sie sich keinerlei Mühe gibt, die Tat zu begründen. Kain ist gar nicht der Urahn der gesamten Menschheit! Sondern allein der Keniter (die gemeinsam mit den Ismaeliten als Vorfahren der Araber galten).
Tatsächlich handelt es sich auch bei dieser Geschichte um eine Ätiologie, die zwei Besonderheiten in der Lebenswelt der Bibelautoren verständlich machen sollte. Erstens die Frage beantworten, warum es Nomaden, Pastoralisten, gab, die mit ihren Herden herumzogen, wie sie nicht nur, aber besonders typisch waren für die südlichen Regionen der Levante, etwa der Negev-Wüste. Die Erklärung der Genesis, deren Autoren aus einem urbanen Umfeld stammten: Die Nomaden waren »flüchtig« und zum Herumziehen verdammt, weil Gott ihrem zu Jähzorn neigenden Urahn Kain als Strafe auferlegt hatte, seine Heimat zu verlassen.
Und zweitens sollte die Episode die hohe Gewaltbereitschaft und Rachsucht erklären, die charakteristisch für Nomadenstämme wie die Keniter war. Die hielten sich nämlich nicht an das im damaligen Nahen Osten herrschende Ius talionis





























