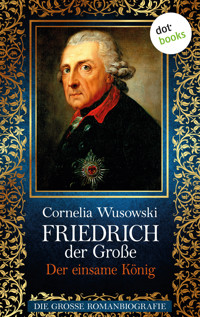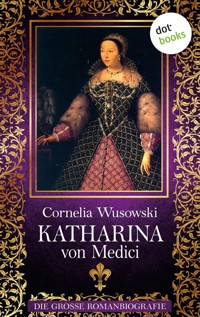Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer zu hoch steigt, kann tief fallen … "Die Familie Bonaparte" von Cornelia Wusowski jetzt als eBook bei dotbooks. 1793: Die Flucht vor politischen Konflikten führt die Familie Bonaparte von Korsika nach Frankreich. Dort beginnt der rasante Aufstieg des stolzen Sohnes der Familie – Napoleon. Er schwingt sich auf zum Kaiser, gestaltet ein modernes Frankreich und verändert mit Hilfe seiner Geschwister das Antlitz Europas. Schon bald herrschen die Bonapartes über ein gewaltiges Reich. Doch so viel Macht zu halten, ist nicht leicht, und Napoleons Willkür und riskante Staatsgeschäfte führen seine Herrschaft unweigerlich dem Abgrund entgegen. Und wenn er stürzt, reißt er seine gesamte Familie mit sich … Aufstieg und Fall des wohl mächtigsten Mannes Europas – detailgenau und mitreißend erzählt! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die große Romanbiographie "Die Familie Bonaparte" von Cornelia Wusowski. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1631
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
1793: Die Flucht vor politischen Konflikten führt die Familie Bonaparte von Korsika nach Frankreich. Dort beginnt der rasante Aufstieg des stolzen Sohnes der Familie – Napoleon. Er schwingt sich auf zum Kaiser, gestaltet ein modernes Frankreich und verändert mit Hilfe seiner Geschwister das Antlitz Europas. Schon bald herrschen die Bonapartes über ein gewaltiges Reich. Doch so viel Macht zu halten, ist nicht leicht, und Napoleons Willkür und riskante Staatsgeschäfte führen seine Herrschaft unweigerlich dem Abgrund entgegen. Und wenn er stürzt, reißt er seine gesamte Familie mit sich …
Über die Autorin:
Cornelia Wusowski wurde 1946 in Fulda geboren. 1971 schloss sie ihr Studium der Politischen Wissenschaft am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin mit dem Diplom ab. Bis 2009 war Cornelia Wusowski im Höheren Verwaltungsdienst tätig. Anfang der 1990er-Jahre schrieb sie ihren ersten historischen Roman. Auf ihr erfolgreiches Debüt »Die Familie Bonaparte« folgten weitere Romanbiografien großer historischer Persönlichkeiten. Diese bieten dank der detaillierten Recherche von Cornelia Wusowski einen überzeugenden Einblick in die Charaktere.
Cornelia Wusowski veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Romanbiografien »Katharina von Medici«, »Elisabeth I.«, »Friedrich der Große: Der ungeliebte Sohn« und »Friedrich der Große: Der einsame König«.
***
eBook-Neuausgabe November 2016
Copyright © der Originalausgabe 1993 Franz Schneekluth Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von Alexandre Menjaud
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-883-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Familie Bonaparte« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Cornelia Wusowski
Die Familie Bonaparte
Die große Romanbiographie
dotbooks.
Dem Andenken meines Vaters gewidmet
Erstes Buch
Kapitel I
Der Weinberg in Vitullo und die Landparzelle in Torre Vecchia ergeben zusammen ungefähr 31 Morgen Land, dazu noch die Wohnungen in Marcello und in Santa Catalina, die Kornmühle, der Backofen, das Bargeld. Diese Mitgift ist eine beachtliche Aufstockung unseres Vermögens. Mein verschwenderischer Neffe wird mit seiner Frau standesgemäß von diesen Einkünften leben können, und ich werde auch in Zukunft das Erbe seines Vaters für die Familie verwalten, vielleicht sogar vermehren.
Diese weltlichen Überlegungen gingen durch den geistlichen Kopf des Archidiakons Luciano Buonaparte, als er am 2. Juni 1764 im Dom von Ajaccio vor dem Altar stand.
Seine feierliche Miene verriet nichts von seinem Stolz und seiner Genugtuung über die Eheschließung seines Neffen Carlo mit Letizia Ramolino. Abgesehen von der stattlichen Mitgift war sie das anmutigste Mädchen der Stadt – die Einheimischen nannten sie Ajaccios kleines Wunder –, und sie entstammte einer angesehenen Patrizierfamilie. Die Ramolinos waren mit den Collaltos verwandt, die im Mittelalter die Lombardei beherrscht hatten, und waren im 15. Jahrhundert vom italienischen Festland nach Korsika übergesiedelt. Die Buonapartes – ein toskanisches Adelsgeschlecht – waren erst hundert Jahre später auf der Insel ansässig geworden.
Während der Archidiakon auf das Ausklingen der Orgel wartete, um mit seiner Predigt beginnen zu können, wanderten seine Augen über die Gemeinde, die an diesem Tag das Kirchenschiff bis zum letzten Winkel füllte. Sämtliche Honoratioren waren erschienen, sogar die reichen Peraldis und die adelsstolzen Pozzo di Borgos. Die ungefähr fünfzig Vettern der Braut saßen wie ein Schutzwall zwischen den nächsten Angehörigen des jungen Paares und der übrigen Gemeinde. Die Vettern gehörten zu den Familien Ramolino und di Pietra Santa. Die meisten von ihnen waren aus Sartene und den umliegenden Dörfern herabgestiegen, festlich gekleidet und mit Geschenken beladen.
Das rauhe Leben in den Bergen hatte ihre Erscheinung geprägt. Sie traten stolz und selbstbewußt auf, die Gesichter wirkten ernst und verschlossen, die Augen blickten wachsam und mißtrauisch. Die Vendetta, die Blutrache, war für diese Korsen noch heilige Pflicht.
Im Kircheneingang und auf den Stufen vor dem weit offenen Portal drängte sich schaulustiges Volk. Niemand wollte sich diese Hochzeit entgehen lassen. Die Verbindung der Buonapartes mit den Ramolinos war eine Sensation, weil die Familien unterschiedlichen politischen Richtungen anhingen. Die Buonapartes sympathisierten mit der korsischen Unabhängigkeitsbewegung und deren Führer, dem General Pasquale Paoli.
Die Ramolinos hingegen waren treue Anhänger der Republik Genua, in deren Besitz die Insel seit dem Ende des 13. Jahrhunderts war.
Während der letzten Wochen vor der Hochzeit war die Hafenstadt Schauplatz abenteuerlicher Gerüchte und Vermutungen gewesen: Was hatte wohl den Archidiakon bewogen, in eine Verbindung mit einer genuesisch gesinnten Familie einzuwilligen, zu einem Zeitpunkt, zu dem Genua nur noch auf dem Papier über Korsika herrschte? In Wirklichkeit war es ja Paoli, der regierte, seit fast zehn Jahren. Die Mitgift mußte der Köder gewesen sein, folgerte das Volk, das einfach und praktisch dachte. Die Familien der korsischen Nobilität vermuteten außerdem, daß die Buonapartes durch diese Verbindung ihren Adel aufwerten wollten.
Während der letzte Orgelton noch in der Luft schwebte, stieg der Archidiakon langsam die Stufen zur Kanzel empor. Einige Sekunden verharrte er dort in stiller Andacht, dann begann er mit seiner Predigt. Er sparte nicht mit Ratschlägen und Ermahnungen für das Brautpaar, belehrte es über Verantwortung, christliche Lebensführung, eheliche Treue, eheliche Rechte und Pflichten, Sparsamkeit, das Ansehen der Familie. Die Gründe für diese Ermahnungen waren das jugendliche Alter des Paares – die Braut war noch keine vierzehn Jahre alt, der Bräutigam achtzehn Jahre – und die Beziehung des Archidiakons zu seinem Neffen. Nach dem Tod seines Bruders Giuseppe hatte Luciano die Verantwortung für die Erziehung von Carlo und dessen älterer Schwester Geltruda übernommen. Und an diesem Tag schien es ihm angebracht, dem lebenslustigen jungen Mann noch ein paar Ratschläge mit auf den Weg zu geben.
Carlo saß während der Predigt entspannt auf dem Kirchenstuhl, die sanften grauen Augen zur Kanzel gerichtet. Er war hochgewachsen und schlank, die Hände waren schmal, die Nase kräftig geformt, die Lippen voll und sinnlich. Die Haare trug er à la mode frisiert und sorgfältig gepudert, die Kleidung war von dezenter Eleganz. Material und Schnitt ließen erkennen, daß sie von einem Schneider aus Pisa oder Florenz gefertigt worden war. Ein Rock aus schwarzer Seide, Kniehosen aus weißem Satin, eine Weste aus Silberbrokat, ein reichgekräuseltes Spitzenjabot, weiße seidene Strümpfe und schwarze Schuhe mit Silberschnallen. Es war vielleicht nicht so sehr die Kleidung, worin Carlo sich von den anwesenden Honoratioren unterschied, sondern die Art, sich darin zu bewegen: weltmännisch, gelassen, sicher wie ein junger Kavalier, der in einer großen Stadt auf dem Festland aufgewachsen war.
Seine Mitbürger trugen ihren Feiertagsstaat mit Würde und ein wenig steif, und wer sie genau beobachtete, spürte wohl auch ein leichtes Unbehagen bei ihnen.
Carlo schien aufmerksam den Worten des Archidiakons zu lauschen, aber seine Gedanken waren schon seit geraumer Zeit aus der Gegenwart zurück in die Vergangenheit gewandert. Predigten langweilten ihn, besonders die Predigten seines Onkels, und so erinnerte er sich an jenen Sonntag, an dem er Letizia zum ersten Mal bewußt gesehen hatte.
Im Sommer 1762 hatte Carlo seine Studien auf der Höheren Schule in Corte beendet und war nach Ajaccio zurückgekehrt. Dem Wunsch des Archidiakons und der Familientradition folgend, wollte er im Herbst in Pisa mit dem Studium der Rechtswissenschaft beginnen.
An einem Sonntag, wenige Tage vor seiner Abreise, gingen Carlo, seine Mutter und seine Schwester zum Hochamt in den Dom. Auf dem Weg begegneten ihnen eine Frau und ein Mädchen von zwölf Jahren. Carlo streifte die hagere, strenge Gestalt der Frau mit einem flüchtigen Blick, dann sah er das Mädchen: sie war zierlich und schlank, trug ein einfaches Kleid aus korsischem Tuch. Ein weißes Mandile war locker um das volle kastanienbraune Haar geschlungen. Der Blick der tiefdunklen Augen im zart geformten Gesicht verriet Schüchternheit und Ernst. Carlo blieb stehen und betrachtete gebannt die kleine Gestalt, die behende die wenigen Stufen zur Kirche emporstieg.
»Wer ist das Mädchen?«
Seine Schwester, die ihn amüsiert beobachtet hatte, lachte. »Sie ist Ajaccios kleines Wunder. Erinnerst du dich nicht an Letizia Ramolino?«
Carlo verneinte. Die Jahre in Corte hatten die Erinnerung an Ajaccio in den Hintergrund gedrängt.
»Letizias Vater war Kapitän in unserer Garnison«, erklärte seine Mutter, »dann wurde er zum Generalinspektor für Brücken und Wege ernannt. Er war ein achtbarer Mann, schade, daß er immer auf der Seite von Genua stand. Er starb, als Letizia noch klein war. Vor ein paar Jahren hat ihre Mutter dann Francesco Fesch geheiratet. Er ist Kapitän bei der Genueser Marine.«
»Fesch?« fragte Carlo. »Ein merkwürdiger Name.«
»Er ist gebürtiger Schweizer.«
inzwischen hatten sie den Dom betreten, aber Geltruda schwatzte weiter. »Stell dir vor, Carlo, dieser Fesch war Protestant und ist zum katholischen Glauben übergetreten. Nur unter dieser Bedingung hat die Signora Ramolino ihn geheiratet. Und es wird sogar behauptet, daß seine Familie ihn deswegen enterbt hat. Ich glaube, die Signora ist schrecklich fromm, sie geht jeden Nachmittag in den Dom, und Letizia besucht jeden Morgen die Messe.« Sie wollte weiterreden, aber ein mahnender Blick ihrer Mutter ließ sie verstummen.
Einige Tage nach dieser Begegnung reiste Carlo nach Pisa ab. Die neue Umgebung, Studium und Studentenleben ließen ihn die frommen Feschs bald vergessen. Erst im darauffolgenden Sommer kehrte er während der Universitätsferien nach Ajaccio zurück.
Am Tag nach seiner Rückkehr streifte er durch die verwinkelten Gassen der Altstadt und des genuesischen Viertels und unterhielt sich hier und da mit einem Bekannten. Auf dem Marktplatz blieb er einen Augenblick stehen und beobachtete amüsiert die Mädchen, die den Hauptbrunnen umlagerten und mit Krügen aus Terrakotta Wasser schöpften, dann ging er langsam zurück zu seinem Elternhaus. Als er in die Via Malerba einbog, kam ihm ein Mädchen entgegen. Der leichte, graziöse Schritt rief in Carlo eine Erinnerung wach, und als sie an ihm vorbeiging, erkannte er die Kirchenbesucherin des verflossenen Sommers. Verwirrt von der unerwarteten Begegnung ging er geistesabwesend an seinem Haus vorbei, die Straße hinauf zur Zitadelle. Letizia hatte sich innerhalb weniger Monate vom Kind zum jungen Mädchen entwickelt. Carlo setzte sich auf eine Mauer der Zitadelle und blickte gedankenverloren über das grünblaue Meer. Erst als die Mittagsstunde eingeläutet wurde, schrak er aus seiner Versunkenheit auf und eilte zurück in die Via Malerba.
Den Nachmittag verbrachte er in seinem Zimmer, blätterte abwesend in einem Buch und dachte an das junge Mädchen. Plötzlich erinnerte er sich an die Worte seiner Schwester. Ob Letizia immer noch jeden Morgen zur Messe ging? Er mußte sie Wiedersehen!
Nach einer unruhigen Nacht stand er früh auf und begab sich zur Messe in den Dom.
Sie war bereits da, als er die Kirche betrat, und er wählte einen Platz, wo er sie ungestört betrachten konnte. Letizia bemerkte ihn erst, als sie hinausging, und als er höflich grüßte, dankte sie mit ernster Miene. Das gab ihm den Mut, sie anzusprechen.
Von da an trafen sie sich jeden Morgen im Dom, dann auch nachmittags irgendwo in der Stadt, heimlich und vorsichtig. Aber in Ajaccio gab es viele Augen und Ohren, und bald waren der Archidiakon Buonaparte und der Kanonikus Ramolino, ein Onkel Letizias, im Bilde über die Romanze zwischen Neffe und Nichte. Unabhängig voneinander entschieden sie jedoch, vorerst abzuwarten und sich nicht einzumischen. Der Archidiakon hielt es aber für angebracht, sich diskret über die Vermögensverhältnisse der Ramolinos zu erkundigen.
Am Tag vor seiner Abreise nach Pisa verlobte sich Carlo heimlich mit Letizia. Mit der Hochzeit wollte er warten, bis das Studium beendet war; er hoffte, in spätestens einem Jahr den Doktortitel erworben zu haben. Er hatte Letizia versprochen, regelmäßig zu schreiben, und damit die Briefe unauffällig die Empfängerin erreichen konnten, hatte er seine Schwester eingeweiht. Sie war praktisch veranlagt und unkompliziert. Geltruda fand die ganze Situation höchst amüsant, wunderte sich allerdings, was ihren lebensfrohen Bruder zu der schüchternen, stillen Letizia hinzog. Aber sie versprach, das Geheimnis zu wahren und die Briefe zu befördern.
Als im Frühjahr 1764 ein Brief des Archidiakons in Pisa eintraf mit der Aufforderung, Carlo solle nach Ajaccio zurückkehren, um Letizia zu heiraten, fiel der junge Mann aus allen Wolken. Hatte Geltruda geplaudert?
Aber die bevorstehende Hochzeit versetzte ihn in freudige Erregung, und die berufliche Zukunft, die sein Onkel andeutete, weckte in ihm die kühnsten Hoffnungen.
Der Archidiakon schrieb, daß Paoli einen juristischen Berater suche und daß seine Wahl auf Carlo gefallen sei. Carlo könne den Posten sofort antreten, auch ohne formalen Studienabschluß, Paoli halte nicht viel von Titeln, sondern mehr von Leistung.
Der Brief schloß mit den Worten: »Paolis Angebot ist natürlich eine große Ehre für unsere Familie, aber das Doktorexamen in Pisa ist ebenfalls wichtig. Bevor Du eine endgültige Entscheidung triffst, müssen wir uns noch einmal darüber unterhalten.« Dann wurde Carlo noch beauftragt, zwei bis drei Fäßchen toskanischen Weins für die Hochzeitsfeier mitzubringen, da die Familie vor der neuen Verwandtschaft und den geladenen Honoratioren repräsentieren müsse und sie nicht mit dem Wein aus Eigenbau bewirten könne. Allerdings erschien Carlo die Summe, die der Onkel für diese Sonderausgabe festgesetzt hatte, lächerlich gering.
Einen knappen Monat später unterhielt sich der Archidiakon sehr eindringlich mit seinem Neffen über dessen berufliche Zukunft. Es war früher Nachmittag. Im Arbeitszimmer des Archidiakons waren die Fenster weit geöffnet, und die hereinflutende Wärme der Maisonne ließ den karg möblierten Raum weniger spartanisch erscheinen.
Der Archidiakon saß etwas zurückgelehnt in seinem Stuhl, die Hände über dem Bauch gefaltet, und als er zu sprechen anfing, huschte ein listiges Lächeln über sein wohlgenährtes Gesicht.
»Du hast dich wahrscheinlich gewundert, warum ich deine Heirat mit Letizia so rasch arrangiert habe. Nun, ich war bestens informiert über eure Beziehung. Letizia ist ein ungewöhnlich anziehendes Mädchen aus guter Familie, sie ist fromm, ihre Mitgift ist ansehnlich – warum soll man lange warten, vor allem, wenn man damit rechnen muß, daß über kurz oder lang noch mehr Bewerber auftauchen. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum ich eure Verbindung zum jetzigen Zeitpunkt wünsche.«
Er unterbrach sich, um seine Gedanken noch einmal zu ordnen, und fuhr dann fort: »Wie du weißt, habe ich Verbindungen zu einigen angesehenen Familien in Calvi, vor allem zu den Giubegas. Die Stadt hält ja nach wie vor treu zu Genua, aber dadurch erfährt man etwas über die Pläne dieser Republik. Seit geraumer Zeit erzählt man sich nun in Calvi, daß Genua – wie bereits vor einigen Jahren – französische Truppen in unseren Garnisonen stationieren will, in der Hoffnung, dadurch die Herrschaft über Korsika zurückzugewinnen. Angeblich werden darüber bereits Verhandlungen mit Versailles geführt.«
»Was hat das mit meiner Heirat zu tun?« unterbrach Carlo.
»Geduld, ich will es dir ja gerade erklären. Falls diese Gerüchte stimmen und tatsächlich französische Truppen landen, gibt es Unruhen, ich kenne doch meine Landsleute. Ich fürchte, daß Paoli dann in Schwierigkeiten kommt. Arrangiert er sich mit Genua und Frankreich, wird wahrscheinlich ein Teil der Bevölkerung von ihm abfallen; seine heimlichen Gegner – diese archaischen Sippenhäuptlinge in den Bergen – können sich sammeln, und bald haben wir Bürgerkrieg. Versucht er aber die Eindringlinge zu vertreiben – nun, wie ein solches Unternehmen ausgehen mag, weiß Gott allein. Die französische Armee ist uns zahlenmäßig überlegen und besser ausgerüstet. Bei derart unsicheren Verhältnissen halte ich es für sinnvoll, daß sich eine Familie nach beiden Richtungen hin absichert, und zwar zum richtigen Zeitpunkt. Die Ramolinos waren immer auf Seiten Genuas, bei Letizias Vater sind die französischen Offiziere ein- und ausgegangen, und der Kapitän Fesch steht ja auch im Dienst der Republik. Man weiß nie, ob nicht solche familiären Verbindungen eines Tages von Vorteil sein können. Was Paoli betrifft, so haben wir nichts zu befürchten; er weiß, daß die Buonapartes immer für ein unabhängiges Korsika eingetreten sind, und von dir hat er eine hohe Meinung.«
Carlo hatte teils erstaunt, teils verärgert zugehört, und nur der Respekt vor seinem Onkel hatte ihn daran gehindert, ein paar Mal heftig aufzufahren. Er beherrschte sich, trotzdem schwang in seiner Stimme ein trotziger Unterton mit: »Ich heirate Letizia, weil ich sie liebe; die politische Gesinnung ihrer Familie interessiert mich nicht. Und, verzeihen Sie, Onkel, aber wenn man Ihnen zuhört, gewinnt man den Eindruck, daß Sie die Sache Paolis für verloren halten. Außerdem verstehe ich nicht, warum Frankreich an einer Unterstützung Genuas interessiert sein sollte.«
»Frankreich hat den Krieg gegen Preußen mit Genuas Hilfe finanziert. Diese Kriegsschulden müssen irgendwie zurückgezahlt werden, wenn nicht mit Bargeld, dann eben mit militärischer Unterstützung; es ist weniger ein Interesse Frankreichs als ein Sachzwang. Aber ich will nicht ausschließen, daß Ludwig XV. auch ein gewisses Interesse an Korsika hat. Diese Vermutung hat übrigens dein künftiger Schwiegervater vor einiger Zeit geäußert. Er meinte, durch den Verlust der Kolonien an England im Friedensvertrag von 1763 sei Frankreich gezwungen, neue Territorien zu erschließen, aus handelspolitischen Gründen natürlich, und Korsika bietet durch seine Lage eine günstige strategische Ausgangsbasis. Aber um auf Paoli zurückzukommen, ich halte seine Sache nicht für verloren, und ich hoffe genau wie du, daß er sein Ziel erreicht: ein unabhängiges Korsika mit einer modernen Verfassung, einer reformierten Justiz, einem zeitgemäßen Schulsystem. Aber ich sehe auch, daß seine Position noch nicht so gefestigt ist, wie es wünschenswert wäre, und daß Krisen von außen oder innen Konsequenzen haben können.
Er möchte dich gerne als juristischen Berater zur Seite haben; ich nehme an, daß du an der Verfassung mitarbeiten sollst. Er hat dich während deiner Studienzeit in Corte bei Diskussionen erlebt und einen günstigen Eindruck gewonnen. Er glaubt, daß du inzwischen in Pisa genügend juristische Kenntnisse erworben hast, um ihn zu unterstützen, und legt auf den formalen Studienabschluß keinen Wert. In diesem Punkt bin ich allerdings anderer Meinung. Natürlich ist Paolis Angebot sehr schmeichelhaft für uns, aber angesichts dieser unsicheren Lage halte ich es für besser, daß du nach der Hochzeit nach Pisa zurückgehst und dein Studium beendest. Du kannst deine berufliche Zukunft nicht ausschließlich an Paoli orientieren. Der Doktortitel verschafft dir eine gewisse Unabhängigkeit, und außerdem kann man ein bißchen damit prunken.«
»Ich wußte nicht, daß Ihnen der Titel so viel bedeutet.«
»Mein Gott, Carlo, verstehst du mich denn nicht? Es geht mir hauptsächlich darum, daß du deine Ausbildung beendest. Irgendwann wirst du die Verantwortung für eine Familie tragen müssen.« Nach diesen heftigen Worten des Archidiakons senkte sich eine beklemmende Stille über den Raum. Der Nachmittag war vorgeschritten, und im Haus wurde es lebendig. Im Erdgeschoß, in den Kellerräumen, stritten Carlos Mutter und die Dienerin Caterina darüber, in welcher Ecke der Wein gelagert werden sollte, den Carlo aus der Toskana mitgebracht hatte. Der Wortwechsel war so laut, daß er bis zum Zimmer des Archidiakons im ersten Stock drang. Als Carlo die Stimmen hörte, mußte er unwillkürlich lächeln. Seine Mutter und Caterina stritten jeden Tag über unwichtige Kleinigkeiten, das gehörte zum Familienalltag. Aber gleich verdüsterte sich seine Miene wieder. Er hatte sich darauf gefreut, nun auf der Insel, bei Letizia, bleiben zu können. Er war wie Paoli der Meinung, daß seine Kenntnisse ausreichten, um eine berufliche Laufbahn zu beginnen. Schließlich brach er das Schweigen: »Wie wird Paoli auf eine Absage reagieren?«
»Mach dir darüber keine Gedanken. Ich würde den Brief so formulieren, daß er eine Absage respektieren könnte.« Versöhnlich fuhr der Archidiakon fort: »Überlege in aller Ruhe, was ich gesagt habe, du hast ja bis morgen Zeit. Aber ich möchte doch, daß du eine endgültige Entscheidung getroffen hast, bevor wir zu den Feschs gehen. Ich habe uns für elf Uhr angekündigt. So, und nun wollen wir uns etwas gönnen.«
Er ging zum Wandschrank und kam mit zwei kleinen Gläsern und einer Flasche Weißwein zurück. »Auf deine gute Heimkehr, Carlo – welchen Wein hast du übrigens mitgebracht?«
»Ich habe die besten Lagen der Toskana ausgewählt«, erwiderte Carlo, und während er aufzählte, wie viele Fäßchen Chianti, Vernaccia aus San Gimignano und Brunello aus Montalcino er besorgt hatte, überschlug sein Onkel im Geist entsetzt die Rechnung und kam zu dem Ergebnis, daß sein Neffe den doppelten Betrag der festgesetzten Summe ausgegeben hatte. Er beschloß, die Hälfte des Weines für zukünftige Familienfeiern zu verwahren. Diese Großzügigkeit muß er von seiner Mutter geerbt haben, dachte Luciano, die Paravicinis leben gerne gut und wollen ihrer Umgebung immer zeigen, was sie besitzen.
Am nächsten Morgen teilte Carlo seinem Onkel mit, daß er nach reiflicher Überlegung entschlossen sei, in den Dienst Paolis zu treten. So könne er der Sache Korsikas am besten dienen.
Der Onkel erwiderte trocken, daß es vielerlei Möglichkeiten gebe, seinem Land zu dienen. Dann begaben sie sich zur offiziellen Brautwerbung zu den Feschs.
Letizia saß aufrecht und ein wenig steif auf dem Kirchenstuhl und bemühte sich, ihre Aufregung zu verbergen.
Zum ersten Mal in ihrem Leben war sie der gesellschaftliche Mittelpunkt, zum ersten Mal war sie elegant angezogen: Sie trug ein weißes seidenes Kleid, das am Ausschnitt und an den Ärmeln mit Spitzen besetzt war, ein weißer Spitzenschleier, der bis zur Taille reichte, bedeckte die Haare, unter dem Kleid lugten weiße Satinschuhe hervor. Zum ersten Mal hatte sie Schmuck angelegt, feine Goldschmiedearbeiten, die Carlo aus Florenz mitgebracht hatte: eine Goldkette mit einem Kreuz aus Granaten und ein Goldring, der ebenfalls mit Granaten besetzt war.
Sie versuchte, sich auf die Predigt zu konzentrieren, konnte aber nicht verhindern, daß ihre Gedanken zu dem Gespräch zurückwanderten, das ihre Mutter vor ein paar Tagen mit ihr geführt hatte.
Letizia war über ihre ehelichen Pflichten belehrt worden, und das hatte sie in eine nervöse Spannung versetzt, in einen schwebenden Zustand zwischen Angst und Neugier.
Angela Maria Fesch, geborene di Pietra Santa, saß streng und gebieterisch hinter dem Brautpaar. Sie war erst Mitte dreißig, wirkte aber älter. Nichts in ihrem ernsten Gesicht verriet etwas von den Gefühlen, die sie an diesem Tag empfand. Sie hatte lange gezögert, ehe sie ihre Einwilligung zu dieser Ehe gab. Es störte sie, daß Carlo ein Parteigänger Paolis war. Sie empfand dem General gegenüber Mißtrauen, weil er die Vendetta abgeschafft hatte und die Vorrechte des alten Adels, zu dem ihre Familie gehörte. Durch ihre beiden Ehemänner fühlte sie sich Genua verbunden, also ein weiterer Grund, sich von den Patrioten fernzuhalten.
Francesco Fesch und dem Kanonikus Ramolino war es schließlich gelungen, sie von Carlos Vorzügen zu überzeugen. Ihr Mann hatte immer wieder betont, daß Carlo durch das Studium in Pisa seinen geistigen Horizont erweitert habe, er denke sachlich und würde wahrscheinlich nie ein politischer Fanatiker werden. Jetzt saß Francesco, ein stattlicher Schweizer mit einem offenen, gutmütigen Gesicht, in seiner Galauniform neben Angela Maria und genoß die kirchliche Feier und das katholische Ritual, von dem sein protestantisch erzogenes Gemüt immer wieder fasziniert war.
In freudiger Stimmung war auch Carlos Mutter Saveria. Sie war eine elegante Erscheinung um die Vierzig, mit weichen Gesichtszügen, lächelnden braunen Augen und einem ausdrucksvollen Mund. Seit sie verwitwet war, trug sie nur noch Schwarz, aber sie legte Wert auf feine Stoffe und lockerte die Trauerkleidung sehr geschickt mit farbigen Tüchern, Gürteln und dezentem Schmuck auf. Sie war mit Carlos Brautwahl sofort einverstanden gewesen und stolz auf seine Stellung bei Paoli; dem Doktortitel trauerte sie nicht nach. Vielleicht würde sich ja noch eine Gelegenheit ergeben, das Examen nachzuholen. Wochenlang war sie mit den Vorbereitungen für die Hochzeitsfeier beschäftigt gewesen und hatte ihre Großzügigkeit voll ausleben können; der Archidiakon hatte sie gewähren lassen.
Neben ihr saß – ebenfalls in Galauniform – ihr Schwager, der Oberst Napoleone, der zur Leibwache Paolis gehörte. Er war zusammen mit Tommaso Arrighi di Casanova, einem Onkel Letizias, und dessen Frau aus Corte gekommen. Der Oberst hatte selbst keine Familie. Nachdem ihm zwei Frauen und drei Kinder weggestorben waren, hatte er beschlossen, allein zu bleiben. Aber er besuchte jedes Familienfest, obwohl ihn die langen kirchlichen Sitzungen, die damit verbunden waren, langweilten. Die Predigt und die von Weihrauch und Blumenduft geschwängerte Luft hatten ihn schläfrig gemacht, außerdem verspürte er Durst und überlegte, wie lange es wohl noch dauern würde, bis er einen Becher mit kühlem Wein genießen konnte.
Am Ende der Reihe saßen Geltruda und ihr Mann Nicolo Paravicini. Nicolo war ein Cousin Geltrudas, ein ruhiger, besonnener Mann, der den Archidiakon bei der Verwaltung der Ländereien unterstützte. Sie waren fast ein Jahr verheiratet, kamen gut miteinander aus und warteten ungeduldig auf die ersten Anzeichen einer Schwangerschaft. Schließlich war Geltruda schon dreiundzwanzig Jahre alt.
Für Carlos Schwester waren Familienfeste immer eine Gelegenheit, sich herauszuputzen. Nach langen Überlegungen hatte sie sich endlich für ein weinrotes Kleid mit cremefarbenem Spitzenbesatz entschieden. Die Haare hatte sie zu einer kunstvollen Frisur hochgesteckt, an den Ohren schimmerten Perlen. Sie fühlte sich sehr elegant und vornehm und hatte sich insgeheim über den mißbilligenden Blick amüsiert, mit dem Angela Maria ihre Aufmachung gemustert hatte.
In der zweiten Reihe saßen eine Cousine Saverias, Maria, und ihr Mann Antonio Pozzo di Borgo sowie Letizias Onkel Tommaso mit seiner Frau und die Dienerin Caterina. Caterina war schon seit über zwanzig Jahren bei den Buonapartes und wurde wie ein Familienmitglied behandelt. Auf ihrem Schoß saß Letizias einjähriger Halbbruder Giuseppe, und Caterina schaukelte den Kleinen hin und her, damit er ruhig blieb.
Am Ende der Reihe thronte Giustina Bozzi mit ihrer eindrucksvollen Leibesfülle auf zwei Kirchenstühlen. Sie war eine unverheiratete Cousine von Carlos Vater und genoß lebenslanges Wohnrecht im Haus. Sie war stolz auf ihre Verwandtschaft mit den Buonapartes, und es störte sie überhaupt nicht, daß die Familie sich ihretwegen genierte und sie möglichst selten der Öffentlichkeit zeigte. Es war nicht nur ihre äußere Erscheinung, die man als peinlich empfand (Saveria bezeichnete sie taktvoll als füllig, für Geltruda war sie fett, für Carlo ein Monstrum); es waren auch gewisse Ereignisse in ihrem fünfzigjährigen Leben, die totgeschwiegen wurden.
Die kirchliche Feier näherte sich ihrem Ende. Carlo und Letizia hatten sich das Eheversprechen gegeben, die Ringe gewechselt, und nun konnte sich die Familie zum Hochzeitszug gruppieren. Während die Orgel zum letzten Mal erklang, schritt der Archidiakon langsam dem Ausgang zu, gefolgt von dem Brautpaar, den beiden Familien, den Verwandten, den Honoratioren. Einer von Letizias Vettern war an die Spitze des Zuges geeilt und trug stolz den Freno, das Symbol der Fruchtbarkeit: einen Spinnrocken, der oben mit vielen Spindeln und bunten Bändern geschmückt war.
Die Bürger Ajaccios standen an den Fenstern und auf den Balkonen und schütteten mit vollen Händen Reiskörner über das Brautpaar, Kinder liefen neben dem Zug her und streuten Myrten. Die Luft war erfüllt von Flintenschüssen und dem Spiel der Mandolinen und Sackpfeifen. Von allen Seiten erscholl der Segensruf »Bona futura e figli maschi.« (»Alles Gute für die Zukunft und viele Söhne.«) Der Hochzeitszug bewegte sich vom Domplatz aus nach links zur Zitadelle und weiter bis zum Hafen, bog dann in eine Straße ein, die zum Marktplatz führte, von dort ging es weiter durch die Gassen der Altstadt bis zu dem Platz vor dem Haus der Buonapartes. Familie und Verwandtschaft umdrängten das junge Paar, und vielstimmig erklang der alte Spruch: »Dio vi dia buona fortuna, tre di maschi e femmin’una.« (»Gott gebe euch Glück, drei Söhne und eine Tochter.«)
Auf dem viereckigen Platz vor dem Haus standen weißgedeckte, blumengeschmückte Tische. Ein Tafelaufsatz mit Früchten und Blumen zierte den Familientisch, der in einer schattigen Ecke aufgebaut war. Auf jedem Tisch standen bauchige Steinkrüge, die für die Familie und die Honoratioren mit toskanischem Wein, für die übrigen Verwandten mit Wein aus eigenem Anbau gefüllt waren.
Über offenen Feuern drehten sich Spieße mit Ziegen- und Hammelfleisch, brutzelten große Stücke von wilden Schweinen, alles kräftig gewürzt mit Kräutern und Knoblauch. Der aromatische Geruch verbreitete sich über den Platz und vermischte sich mit dem des warmen Kastanienbrotes. Und über allem schwebte der typische Duft der Insel, jenes Gemisch aus Oleander und Lavendel, aus Rosmarin und Thymian, aus wilder Minze und bitterem Honig.
Der Archidiakon als Familienoberhaupt saß am Kopfende des Tisches, zu seiner Rechten Carlo und Letizia, die restliche Familie hatte sich in bunter Reihe um den Tisch gruppiert. Platten mit knusprigen, saftigen Fleischstücken wurden aufgetragen und Schüsseln mit einem exotisch duftenden Gemüse von gelber Farbe, anscheinend in viel Fett gebraten, denn die Scheiben waren teils gebräunt, teils glänzten sie. Niemand kannte diese neue Beilage, bis auf Carlo und Napoleone, die geheimnisvoll lächelten.
»Dieses Gemüse«, begann Carlo, »ist eine Delikatesse, die Paoli bei besonderen Gelegenheiten servieren läßt. Bei ihm habe ich die Kartoffeln, so nennt man sie, kennengelernt. Ich glaube, er läßt sie in der Balagna anbauen. Der Graf Marbeuf in Bastia hat ihn dazu angeregt. Zur heutigen Feier hat er mir einen Sack voll geschenkt.«
»Ich habe auch einen Sack Kartoffeln mitgebracht«, fiel der Oberst ein, und zu Saveria gewandt fügte er hinzu: »Die Kartoffel ist wirklich vielseitig verwendbar, man kann sie auch kochen, mit und ohne Schale, man kann sie sogar in abgekühltem Zustand verarbeiten. Sie hat einen neutralen Geschmack und paßt als Beilage eigentlich zu allem, zu Fleisch, Fisch, Eiern, Käse. Nur roh darf man sie nicht essen, sie muß unbedingt gekocht werden.«
»Wie sieht sie denn aus?« wollte Saveria wissen.
»Sie ist oval oder rundlich geformt, ungefähr so groß wie ein kleiner Pfirsich, die Schale ist hell- oder dunkelbraun.«
Geltrudas Mann Nicolo hatte inzwischen die Kartoffeln zu den verschiedenen Fleischsorten probiert, lehnte sich nun befriedigt zurück und trank einen großen Schluck von dem rubinroten Brunello. »Köstlich, also zu Schweinefleisch schmecken diese Kartoffeln am besten. Weißt du etwas über den Anbau, Carlo? Vielleicht können wir sie in Bastelica anpflanzen.«
»Ich weiß nur, daß sie in der Erde reifen, daß die Ernte mühselig ist und man viele Arbeitskräfte dafür benötigt. Deshalb hat Paoli wohl auch Schwierigkeiten, den Kartoffelanbau durchzusetzen. Aber ich will mich gerne nach Einzelheiten erkundigen.«
Angela Maria hatte schweigend zugehört, aber nun konnte sie sich nicht länger zurückhalten: »Für ein Volk von Hirten und Jägern ist es eine Zumutung, daß wir auf den Ackerbau umsteigen sollen. Warum brauchen wir Kartoffeln? Kastanien haben doch bisher gereicht.«
»Dieses Gemüse ist nahrhafter als Kastanien, und es läßt sich gut lagern«, erwiderte Carlo. »Im übrigen ist der Kartoffelanbau ein Teil von Paolis Wirtschaftsprogramm, das unseren Handel beleben soll. Ohne Handel kein Wohlstand, und wenn wir uns eines Tages auch juristisch von Genua trennen wollen, brauchen wir volle Kassen. Das beste Beispiel ist Preußen; der jetzige König und schon sein Vater haben ihr Land systematisch wirtschaftlich erschlossen, das war die Voraussetzung für den Aufbau der Armee, und heute ist Preußen ein wohlhabender Staat mit einem starken Heer. Übrigens habe ich gehört, daß auch in Preußen Kartoffeln angebaut werden, und zwar auf ausdrücklichen Befehl des Königs.«
Für eine Weile verebbte die Unterhaltung, und alle widmeten sich den leiblichen Genüssen. Carlo hatte Letizias Teller liebevoll mit den zartesten Fleischstücken und den röschesten Kartoffeln gefüllt. Sie war zwar völlig appetitlos, quälte sich aber, um Carlo nicht zu kränken, etwas von dem neuen Wundergemüse hinunter.
»Schmeckt es dir?« fragte er und goß ihr ein Glas Vernaccia ein.
Sie bejahte. »Wo kommen die Kartoffeln her?«
»Aus Nordamerika, soviel ich weiß. Probier’ mal den Vernaccia. Er steigt nicht so rasch zu Kopf wie der Brunello. Der Vernaccia kommt aus San Gimignano.« Dann wandte er sich an die Tischgesellschaft. »San Gimignano ist eine merkwürdige Stadt. Aus der Ferne sieht man von ihr nur Türme. Die Einheimischen nennen sie ›Geschlechtertürme‹, weil jede Familie, die dort Rang und Namen hat, einen solchen Turm auf ihr Haus baut.«
»Welche Aufgabe sollst du eigentlich bei Paoli übernehmen?« fragte Fesch, der mit dem Begriff juristischer Berater‹ nicht viel anfangen konnte.
»Ich soll an der Verfassung mitarbeiten. Paoli hat wohl bestimmte Vorstellungen von dem zukünftigen Staatsaufbau, auch von den Aufgaben der einzelnen Organe. Über Details hat er noch nicht mit mir gesprochen, aber soweit ich ihn verstanden habe, soll der künftige korsische Staat auch demokratische Elemente enthalten. Ich soll ihn also sowohl sachlich-inhaltlich beraten als auch seine Gedanken in die richtige juristische Form bringen.«
Geltruda, die sich für Verfassungsprobleme nicht sonderlich interessierte, fragte, warum Paoli nicht verheiratet sei, ein Mann in seiner Stellung müsse doch eine Frau haben, allein schon wegen der Repräsentationspflichten, und auch einen Sohn wegen der Nachfolge.
Der Oberst lachte. »Ich kann mir Paoli nicht verheiratet vorstellen, es paßt nicht zu ihm. Außerdem lehnt er für sich persönlich eine Ehe ab, weil er dann zu stark von seiner Aufgabe abgelenkt würde. Er will seine ganze Kraft in den Dienst seines Volkes stellen. Und die Nachfolge ist unproblematisch. Er hat viele junge, tüchtige Mitarbeiter, einen von ihnen wird er irgendwann zum Nachfolger bestimmen.«
Inzwischen war der Nachtisch aufgetragen worden: süßes Gebäck, sahniger Broccia und dunkler, dickflüssiger Honig.
Letizia hatte die Unterhaltung aufmerksam verfolgt und ab und zu mit bewunderndem Blick zu Carlo aufgesehen; sie war sichtlich stolz auf seine Kenntnisse und seine Stellung bei Paoli.
Aber auch Tante Giustina, die ihr schräg gegenübersaß, hatte ihre Aufmerksamkeit gefesselt. Letizia hatte noch nie jemanden gesehen, der solche Mengen in sich hineinstopfte. Von den drei Fleischsorten hatte sich Giustina eine doppelte Portion genommen, natürlich die größten und fettesten Stücke, hatte sich wiederholt mit Kartoffeln bedient und alle Weine probiert. Nun nahm sie bereits zum dritten Mal Gebäck und häufte zum dritten Mal Broccia auf ihren Teller, den sie derart mit Honig übergoß, daß der Ziegenkäse förmlich darin schwamm.
Letizia erinnerte sich, was Geltruda ihr über Tante Giustina erzählt hatte: Als junges Mädchen hatte sie sich mit einem genuesischen Soldaten eingelassen – ausgerechnet einem Genuesen, wenn es wenigstens noch ein Korse gewesen wäre! – und als die Folgen sichtbar wurden, war der Soldat längst wieder in Genua. Um unnötiges Aufsehen zu vermeiden, hatte man Giustina in ein entlegenes Dorf gebracht, dort hatte sie ein totes Kind, ein Mädchen geboren. Carlos Großvater hatte sie dann aus Mitleid in sein Haus aufgenommen und später testamentarisch verfügt, daß sie lebenslanges Wohnrecht genießen solle. Geltruda hatte keine weiteren Einzelheiten erzählt, aber doch angedeutet, daß Giustinas Lebenswandel auch in späteren Jahren nicht immer im Sinne der Familie gewesen sei, gewiß, sie habe die Diskretion gewahrt, aber dennoch … Schon Carlos Vater sei das Wohnrecht der Tante ein Dorn im Auge gewesen, ebenso Carlo, der außerdem der Meinung sei, daß sie die Familie schamlos ausnutze, besonders die Nachsichtigkeit seiner Mutter, und dann diese hemmungslose Völlerei!
Dies alles fiel Letizia ein, als sie Tante Giustina betrachtete, die genüßlich ihren Broccia löffelte und freundlich grinste, als sie den nachdenklichen Blick der jungen Frau bemerkte. Dann zerbröselte sie das Gebäck in den restlichen Honig, verrührte alles zu einem Brei und löffelte weiter. Carlo warf einen kurzen Blick auf ihren Teller und unterhielt sich dann weiter mit Fesch. Geltruda versuchte, einen Lachkrampf zu unterdrücken, Angela Maria verzog keine Miene, und Saveria bemerkte nur: »Hoffentlich bekommt dir alles, Giustina.«
Inzwischen war es Abend geworden, und der Archidiakon bat noch um ein paar Minuten Aufmerksamkeit. Er erhob sich feierlich und dankte mit warmen Worten allen, die zu diesem Fest gekommen waren. Für ihn persönlich sei es eine große Freude, die Familie bei einem solchen Anlaß in Harmonie vereint zu sehen, und er hoffe, daß dies so bleibe. Zum Schluß ließ er das Brautpaar noch einmal hochleben und wünschte Glück und natürlich viele Kinder.
Während seiner Ansprache hatte man einige Tische zur Seite geräumt, und nun erschienen Musikanten und spielten eine Serenade für das junge Paar. Dann endlich konnte der Tanz beginnen: die Marsiliana, die Tarantella.
Carlo nahm Letizias Hand: »Komm, mir reicht jetzt der Trubel. Laß uns noch einen Abendspaziergang machen, und dann verschwinden wir unauffällig.«
Beim Weggehen sahen sie noch, daß der Oberst schlafend in einer Ecke lag und daß Saveria und einer der Vettern ihn in ein Ziegenfell rollten und unauffällig ins Haus schafften.
Carlo mußte unwillkürlich lachen. »Onkel Napoleone ist und bleibt ein Freund von Bacchus«, und als er Letizias fragendes Gesicht sah, erklärte er ihr, daß Bacchus der römische Gott des Weines sei.
Als sie außer Sichtweite waren, legte er den Arm um sie, und schweigend und glücklich überquerten sie den Domplatz und gingen dann am Meer entlang. An jenem Sommerabend schien eine geordnete Zukunft vor ihnen zu liegen, ohne materielle Sorgen und mit einer glänzenden Laufbahn für Carlo.
»Wie oft wirst du von Corte nach Ajaccio kommen können?« fragte Letizia.
»Ich weiß es noch nicht, aber ich verspreche dir, so oft wie möglich. Irgendwann werden wir sowieso nach Corte übersiedeln müssen. Oder möchtest du lieber in Ajaccio bleiben?«
»Nein, ich werde immer dorthin gehen, wohin du möchtest. Aber ich bin hier aufgewachsen, wir haben hier geheiratet, ich werde mich immer ein bißchen nach Ajaccio zurücksehnen, egal wo wir wohnen.«
Sie blieben stehen und sahen auf die grauen Felsen, die aus dem Meer emporragten und im Volksmund Blutinseln genannt wurden.
»Was haben sie uns heute gewünscht, Carlo? Drei Söhne und eine Tochter. Wenn wir drei Söhne bekommen, muß einer von ihnen Jurist werden wie du, einer Geistlicher wie Onkel Luciano und einer Offizier wie Onkel Napoleone.«
In diesem Augenblick traf der Schein der untergehenden Sonne die Blutinseln; grellrot standen die grauen Felsen mitten im Meer.
Kapitel II
Am Abend des 14. August 1765 saß Letizia neben der Wiege ihres schwerkranken Sohnes. Das Kind war bereits bei der Geburt im Frühjahr schwächlich gewesen, und in der ersten Augustwoche hatte es plötzlich hohes Fieber bekommen; alle Bemühungen, die Temperatur zu senken, waren vergeblich gewesen.
Seit dem letzten Besuch des Arztes waren mehrere Stunden vergangen. Nächtliche Stille hatte sich über das alte Haus und seine Bewohner gesenkt. Das schwache Licht einer Öllampe ließ die Umrisse der Möbel erkennen und die Gestalt Saverias. Sie saß in einem eichenen Lehnstuhl in der Nähe des Fensters und beobachtete besorgt ihre Schwiegertochter, die seit Stunden wie erstarrt neben der Wiege saß. Letizia weinte nicht und klagte nicht, nur in den Augen spiegelte sich stumme Verzweiflung.
Ihre Hände umklammerten einen Rosenkranz und schoben eine Perle nach der anderen weiter, aber sie betete nicht. Ihr ganzes Denken und Fühlen wurde von den letzten Worten des Arztes beherrscht: »Signora, Ihr Sohn wird diese Nacht nicht überleben. Er ist zu schwach, er besitzt nicht genug Abwehrkräfte gegen solche Fieberattacken.«
Saverias Stimme riß sie aus ihren Gedanken: »Möchtest du nicht ein paar Stunden schlafen? Du hast jetzt zwei Nächte durchgewacht. Ich würde dich wecken, wenn bei dem Kleinen eine Verschlechterung eintritt.«
»Nein!«
Saveria zuckte zusammen, als sie die harte Stimme ihrer Schwiegertochter hörte; so hatte sie Letizia noch nie erlebt, bisher war sie immer sanft und gefügig gewesen.
Wenn wenigstens Carlo hier wäre, dachte Saveria, dann müßte sie nicht so ganz allein mit allem fertig werden. Aber Carlo war vor einigen Wochen von Paoli als Sonderbotschafter zum Papst geschickt worden, vor Mitte September war mit seiner Rückkehr kaum zu rechnen.
Der Morgen des 15. August dämmerte herauf. Letizia erhob sich und beugte sich über die Wiege. Der kleine Napoleone war tot.
An einem Nachmittag Anfang September wurde Caterina durch den dumpfen Klang des Türklopfers in ihrer Siesta gestört. Sie öffnete gereizt die Haustür, vergaß aber ihren Ärger sofort: Carlo stand vor ihr. Da er seine diplomatischen Verhandlungen in kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen hatte, war er früher als erwartet zurückgekommen, und außerdem erlaubte seine finanzielle Lage keinen längeren Aufenthalt mehr in Rom.
Carlo lachte über ihr erstauntes Gesicht und eilte hinauf in den zweiten Stock, in das Zimmer, das er mit seiner Frau bewohnte.
Caterina sah ihm besorgt nach: »Er weiß es noch nicht«, sagte sie leise zu sich selbst, »der Brief hat ihn nicht mehr erreicht.«
Carlo klopfte an die Tür, öffnete, trat ins Zimmer und blieb erschrocken stehen, als er die schwarzgekleidete Letizia erblickte.
Diese sprang von ihrem Stuhl hoch, bekreuzigte sich mit dem Ausruf »Jesus« – das war eine Angewohnheit von ihr, wenn sie überrascht oder aufgeregt war –, lief dann auf ihn zu und umarmte ihn.
Inzwischen hatte er gesehen, daß die Wiege in der Ecke neben dem Ehebett leer war. Eine plötzliche Angst überfiel ihn, lähmte seine Sinne und machte ihn unempfindlich für ihre weichen Lippen und ihren biegsamen Körper. Er löste sich aus ihrer Umarmung und sah sie an: »Was ist passiert«?
Erst in diesem Moment wurde Letizia bewußt, daß er ahnungslos war. Sie holte Luft und versuchte, ihrer Stimme einen festen Klang zu geben, konnte aber ein leichtes Zittern nicht verhindern: »Napoleone hat plötzlich Fieber bekommen, der Arzt konnte nicht helfen, er meinte, das Kind sei zu schwach. Am 15. August in den ersten Morgenstunden, da …« Sie konnte plötzlich nicht mehr weiterreden.
Carlo setzte sich geistesabwesend auf die Bettkante. »Und ich war in Rom …«
»Aber du mußtest doch, es war doch im Auftrag Paolis!«
»Ja, ja, gewiß«, gab er zurück und dachte beschämt daran, daß er an den Abenden die Vergnügungen der Stadt genossen hatte, während sie an der Wiege des kranken Kindes saß.
Als sie sein hilfloses Gesicht sah, tat er ihr leid. Sie ging zu ihm, setzte sich neben ihn und suchte nach tröstlichen Worten. »Der Kleine war nur wenige Monate alt. Stell’ dir vor, wir hätten ihn großgezogen und dann vielleicht im Alter von fünf oder sechs Jahren verloren; das ist schwerer zu ertragen. Wir können noch so viele Kinder bekommen.«
Eine Weile schwiegen beide.
»Hast du den Onkel schon begrüßt?« Sie stand auf, strich den Rock glatt, betrachtete sich prüfend im Spiegel und ging zur Tür. Er folgte ihr, noch etwas benommen.
Caterina hatte inzwischen alle Hausbewohner über Carlos Ankunft informiert, und nun standen sie erwartungsvoll in dem geräumigen Wohn- und Eßzimmer im ersten Stock. Sogar Antonio Pozzo di Borgo, seine Frau und Tante Giustina, die sonst nur zu den Mahlzeiten erschienen, waren heruntergekommen.
Als alle Carlo begrüßt und umarmt hatten, konnte er endlich erzählen: »Ihr wißt, daß Paoli mich als Sonderbotschafter nach Rom geschickt hat, damit ich den Papst dazu bewege, daß der Vatikan die korsische Unabhängigkeit von Genua anerkennt. Dieses Ziel habe ich erreicht, und zwar gegen den Widerstand der fünf korsischen Bischöfe.«
Nach einem überraschten Schweigen wurde Carlo von allen Seiten laut und herzlich beglückwünscht. Geltruda umarmte ihn stürmisch, Letizias Augen funkelten stolz und glücklich, der Onkel strahlte. Nur Antonio Pozzo di Borgo lächelte säuerlich und sagte maliziös: »Nun wird dein Aufstieg bei Paoli nicht mehr zu bremsen sein. Du bist ja fast sein Alter Ego.«
Als die Aufregung sich gelegt hatte, zogen sich Carlo und sein Onkel ins Arbeitszimmer zurück. Der Archidiakon war gespannt auf Neuigkeiten aus dem Vatikan.
»Was sollte die Bemerkung von Antonio?« fragte Carlo verärgert.
»Kümmere dich nicht um sein Gerede. Er ist neidisch auf deine Stellung bei Paoli. Verständlich, wenn man, wie er, nie richtig gearbeitet hat und nur vom Geld der Familie lebt. Es ist gut, daß du erfreuliche Nachrichten aus Rom mitbringst. In den letzten Wochen war hier im Haus eine recht bedrückte Stimmung. Letizia hat dir wohl inzwischen alles erzählt?« Carlo nickte. Der Archidiakon füllte zwei Gläser mit Wein und fuhr dann fort: »Letizia hat sich tapfer gehalten. Sie hat drei Nächte durchgewacht und wirkte sehr gefaßt, als alles vorbei war. Ich habe jedoch den Eindruck, daß sie unter deiner häufigen Abwesenheit leidet. Willst du nicht bald einmal mit ihr nach Corte übersiedeln? Du kannst doch nicht jahrelang im Franziskanerkloster wohnen. Es wäre vielleicht auch besser, wenn du nicht mehr hier auftauchen würdest. Du bist dem genuesischen Statthalter unangenehm aufgefallen. Dein Schwiegervater hat mir erzählt, daß der Statthalter dich für einen Spion Paolis hält, der den Leuten hier politisch die Köpfe verdreht und sie gegen Genua aufwiegelt.«
Carlo sah seinen Onkel erstaunt an.
»Das ist doch lächerlich und eine böswillige Unterstellung. Ich versuche doch nur, die Leute von Paolis Verfassung und seinen Reformen zu überzeugen. Aber ich werde wohl in den nächsten Monaten ganz nach Corte übersiedeln. Vor meiner Abreise nach Rom hat Paoli angedeutet, daß er mir vielleicht den Posten eines ständigen Sekretärs übertragen wird, und als Leiter der Staatskanzlei müßte ich natürlich in Corte wohnen. Aber das entscheidet sich erst in den nächsten Wochen. Deshalb möchte ich auch der Familie noch nichts davon erzählen.«
Dem Archidiakon verschlug es fast die Sprache, als er diese Neuigkeit hörte. Er stand auf und lief erregt hin und her, wobei er wiederholt ausrief: »Leiter der Staatskanzlei!«
Endlich beruhigte er sich und füllte erneut die Gläser.
»Das ist ein hochinteressanter Posten, Carlo. Du wirst Einblick bekommen in alle Sparten der Verwaltung, der Justiz, des Militärwesens. Du wirst alle wichtigen Leute kennenlernen und wertvolle Verbindungen knüpfen können. Bei der Wohnungsfrage kann dir vielleicht Letizias Onkel Tommaso behilflich sein. Aber nun erzähle endlich, was du in Rom erlebt hast.«
Die Domglocken läuteten den Abend ein. In der Küche der Buonapartes stand Caterina mit gerötetem Gesicht vor dem Herd, rührte in verschiedenen Töpfen und scheuchte die junge Magd herum, die ihr bei den groben Hausarbeiten half. Wenn Carlo im Hause war, verfeinerte Caterina die Gerichte mit Sahne, Eiern und frischen Kräutern und verwendete reichlich Olivenöl und Wein.
Während in der Küche angerichtet wurde, versammelten sich die Familienmitglieder im Wohnraum um den ovalen Tisch. Jeder hatte seinen festen Platz: am oberen Ende saß der Archidiakon, rechts von ihm Saveria, Letizia, Geltruda und Saverias Cousine Maria, links von ihm Carlo, Nicolo, Antonio und Tante Giustina. Am unteren Ende war Caterinas Platz. Der Archidiakon fand das praktisch, weil sie nicht jedes Mal hereingerufen werden mußte, wenn etwas fehlte.
Endlich erschienen Caterina und die Magd und stellten Schüsseln mit duftender Kräutersoße auf den Tisch; dann eilten sie erneut hinaus, um die Platten mit den Makkaroni zu holen.
Der Archidiakon füllte seinen Teller bereits zum zweiten Mal, so gut schmeckte es ihm. Dennoch hielt er eine kleine Rüge für angebracht. Während er Rotwein in seinen Zinnbecher goß, fragte er Caterina halb im Scherz, halb im Ernst: »Wie viele Eier hast du für die Makkaroni verwendet? So zart sind sie sonst nicht.«
»Wenn Signor Carlo nach Hause kommt, ist das doch ein besonderer Tag«, erwiderte Caterina ausweichend.
»Gewiß, aber kein Anlaß, verschwenderisch zu kochen.«
Nicolo kam Caterina zu Hilfe. »Ein bißchen Verschwendung können wir uns zur Zeit leisten. Ich habe vor einigen Tagen die Einnahmen des letzten Jahres zusammengestellt, sie sind doppelt so hoch wie in früheren Jahren, und zwar seitdem die Franzosen wieder bei uns sind. Für die wirtschaftliche Entwicklung Korsikas hat der Vertrag vom August letzten Jahres bis jetzt nur Vorteile gebracht.«
Im Vertrag von Compiègne hatte Genua auf vier Jahre fünf korsische Festungen dem französischen Militärkommando unterstellt: Bastia, Calvi, San Fiorenzo, Algajola und Ajaccio.
Carlo staunte. »Wie kommt es, daß du soviel Wein, Öl und Mehl an die Franzosen verkaufen kannst?«
»Ich habe rechtzeitig dafür gesorgt, daß ich zu denjenigen gehöre, die die Truppen in der Zitadelle beliefern. Natürlich hat dein Schwiegervater mir dabei geholfen. Die Belieferung lohnt sich, weil die Soldaten reichhaltig verpflegt werden und die Offiziere häufig Feste feiern.«
»Feiern auch korsische Mädchen mit?« fragte Carlo.
Nicolo lachte: »Nein, so fortschrittlich wie in Bastia sind wir hier nicht. Vielleicht würden sich die Verhältnisse ändern, wenn der Graf Marbeuf und Paoli ihren Standort nach Ajaccio verlegen würden.«
Saverias Augen blickten skeptisch. »Ich fürchte, daß die französischen Offiziere in Bastia bei ihren Festen unsere Mädchen belästigen. Wie verständigen sie sich überhaupt? Französisch spricht doch fast niemand von uns, abgesehen von dir, Carlo, Paoli und einigen Beamten in der Regierung.«
Geltruda stieß Letizia an: »Ich würde gern einmal ein Fest mit französischen Offizieren erleben, du auch?«
»Nein, ich glaube nicht, daß ich viel Spaß dabei hätte.«
Inzwischen hatten Caterina und die Magd Bohnen und ein dampfendes Hammelragout gebracht, das einen aromatischen Duft nach Knoblauch und Thymian ausströmte.
»Zur Feier des Tages«, sagte Caterina, als sie die Schüssel auf den Tisch stellte, denn Fleisch gab es bei den Buonapartes nur an Sonn- und Feiertagen und bei Familienfesten, an Werktagen wurde meistens Fisch serviert.
Antonio schnüffelte skeptisch an dem Ragout, bevor er sich zu einer Kostprobe entschließen konnte. Nach den ersten Bissen legte er entrüstet die Gabel nieder. »Caterina, das hier ist nicht Hammel mit Knoblauch, sondern Knoblauch mit Hammel!«
»Signor Carlo mag Knoblauch«, antwortete Caterina, nahm zwei Krüge und ging hinunter in den Keller, um Wein nachzufüllen.
»Knoblauch ist gesund, Antonio«, sagte Nicolo mit einem spöttischen Unterton in der Stimme, dann wandte er sich an Carlo: »Nun, sind der Oberbefehlshaber der Franzosen (damit meinte er Marbeuf) und Paoli immer noch ein Herz und eine Seele?«
»Ja, seit sie sich im Frühsommer zum ersten Mal begegnet sind, hat sich alles gut weiterentwickelt. Sie gehen im Tal von Patrimonio gemeinsam auf die Jagd und unterhalten sich stundenlang unter vier Augen. Die Aufregung im letzten Sommer war überflüssig.«
Bei der Landung der französischen Truppen war es zu Unruhen gekommen, wie der Archidiakon befürchtet hatte. Aber Paoli hatte die Situation gemeistert.
»Marbeuf ist ein untadeliger Kavalier, ein ausgezeichneter Vertreter des französischen Königs. Aber ich glaube, auch er war angenehm überrascht, als er uns im Sommer zufällig in der Nähe von Patrimonio traf. Er hatte wohl nicht erwartet, daß es Korsen gibt, die Französisch sprechen. ›Wie, Pariser Anstand in der Wildnis?‹ sagte er auf sehr charmante Art.«
Antonio schüttelte mißbilligend den Kopf: »Ich finde diese Bemerkung ziemlich anmaßend. Wildnis! Dieser Marbeuf glaubt wohl, daß Frankreich die Zivilisation gepachtet hat. Und was wird in drei Jahren sein, wenn der Vertrag ausläuft?«
»Das weiß zur Zeit niemand«, erwiderte Carlo, »wahrscheinlich werden Frankreich und Genua neu verhandeln.«
Drei Tage später mußte Letizia erneut von ihrem Gatten Abschied nehmen. Er begab sich nach Sollacaro zu Paoli, der dort ein Syndikatgericht hielt.
Rund dreißig Jahre zuvor, im Jahr 1736, hatten die Führer der korsischen Unabhängigkeitsbewegung den westfälischen Baron Theodor von Neuhof zum erblichen König von Korsika proklamiert. Diesen Preis hatte der Baron gefordert, als er den Korsen anbot, ihren Kampf gegen Genua mit Geld und Waffen zu unterstützen. Die korsischen Generäle waren dankbar für jede Hilfe von außen, denn der Unabhängigkeitskrieg dauerte bereits sieben Jahre, und es war noch kein Ende abzusehen. Unter Theodor I. wurde der Arzt und General Hyacinto Paoli zum Premierminister ernannt und in den Grafenstand erhoben.
Aber 1739 mußte Theodor I. Korsika wieder verlassen und ging nach England ins Exil. Genua hatte französische Truppen zu Hilfe gerufen und die Insel zurückerobert. Auf Wunsch Genuas blieben die Franzosen während der folgenden Jahre auf der Insel, und auch die beiden Führer der Unabhängigkeitsbewegung – die Generale Giafferi und Paoli – gingen ins Exil nach Neapel.
Der vierzehnjährige Pasquale Paoli begleitete seinen Vater; seine Mutter, seine Schwester Chiara und sein älterer Bruder Clemens blieben auf Korsika. In Neapel erlernte er auf der königlichen Militärakademie das Soldatenhandwerk und trat mit sechzehn Jahren in den Dienst der neapolitanischen Bourbonen.
1745 wurde er Mitglied einer Loge und kam zum ersten Mal mit den Gedanken der europäischen Aufklärung in Berührung. Er hörte Vorlesungen bei Genovesi, der später Inhaber des ersten europäischen Lehrstuhls für Politische Ökonomie wurde, und beschäftigte sich viel mit den Werken von Livius und Plutarch. In Neapel knüpfte er auch erste Kontakte zu den Engländern und lernte die englische Sprache, weil er sich von Großbritannien Unterstützung für den korsischen Freiheitskampf erhoffte.
Seit 1752 schaltete er sich vom Festland aus in die korsische Politik ein und drängte in unzähligen Schreiben auf eine Fortsetzung des Krieges gegen Genua.
Im Jahr 1755 wurde Pasquales Bruder Clemens zum Führer der Korsen ernannt. Nach dem Mord an Gaffori, dem ›General der Nation‹, der 1746 die Genuesen aus Corte vertrieben hatte, waren die Korsen zwei Jahre lang ohne Oberhaupt gewesen und hatten sich nun für Clemens Paoli entschieden. Aber der fühlte sich dem Amt nicht gewachsen und empfahl seinen Bruder Pasquale.
So kehrte Pasquale Paoli im April 1755 in die Heimat zurück, und im Sommer desselben Jahres wurde er von der Consulta, dem höchsten Rat des Königreichs Korsika, zum neuen ›General der Nation‹ gewählt. Er war erst dreißig Jahre alt.
Als 1756 der größte Teil der französischen Truppen Korsika verließ, um gegen Preußen zu kämpfen, konnte Paoli die Genuesen in kurzer Zeit vertreiben; nur einige Basteien und Zitadellen an der Küste blieben noch besetzt, unter anderem Ajaccio und Calvi.
Während der folgenden Jahre befreite Paoli sein Land von den archaischen Sitten und schuf einen modernen Staat mit einer Verfassung, die Gleichheit vor dem Gesetz und freie, allgemeine Wahlen garantierte. ›Typisch korsisch‹ waren das Mißtrauen gegen Staat und Obrigkeit, die Selbstjustiz, die Verachtung von Ackerbau und Handwerk, die totale Bindung der einzelnen Familienmitglieder an die Sippe, die Verpflichtung zur Vendetta, zur Blutrache. Mit diesen Traditionen brach Paoli. Er trieb seine Landsleute zum Ackerbau an, ließ sie in den Bergwerken nach Bodenschätzen schürfen, eine Handelsflotte bauen und Sümpfe trockenlegen. In Corte wurde eine Universität gegründet, dort und in Oletta wurden Buchdruckereien eingerichtet. Und erstmals mußte auch der Klerus Steuern zahlen! Das Volksheer wurde in regelmäßigen Abständen im Soldatenhandwerk unterrichtet, seit 1762 gab es sogar ein kleines stehendes Heer mit zwei Regimentern zu 400 Mann.
Der Justizreform widmete Paoli besondere Aufmerksamkeit: Die Vendetta wurde gesetzlich abgeschafft, mit dem Ergebnis, daß die Zahl der Korsen, die sich als Rächer und Gegenrächer gegenseitig umbrachten, in den ersten Jahren von Paolis Regierung auf sechzig sank, während in den letzten dreißig Jahren vor diesem Gesetz 28 000 Menschen der Blutrache zum Opfer gefallen waren.
Die Gerichtsbarkeit war mehrstufig organisiert; die höchste richterliche Instanz war die ›Rota‹, die aus drei unabsetzbaren, juristisch ausgebildeten Berufsrichtern bestand. Aber auch sie stand, ebenso wie die lokalen Richter, unter der Kontrolle der sindaci, das waren reisende Richter des Generals, die überall ungerufen erschienen, nach Ordnung sahen und Beschwerden entgegen – nahmen. Paoli selbst war meistens einer der sindaci.
Der korsische Unabhängigkeitskrieg und die demokratische Verfassung erregten in Mitteleuropa Aufsehen und Anerkennung. Friedrich der Große schickte Paoli einen Ehrensäbel mit der Inschrift Patria – Libertas, Joseph II. und Katharina die Große sprachen bewundernd vom General der Nation, der Papst schickte 1760 einen Nuntius auf die Insel, und Rousseau schrieb in seinem Gesellschaftsvertrag: ›In Europa gibt es noch ein der Gesetzgebung fähiges Land, nämlich die Insel Korsika. Der Mut und die Beharrlichkeit, mit der dieses tapfere Volk seine Freiheit wiederzuerlangen und zu verteidigen wußte, verdienten wohl, daß ein weiser Mann es lehre, sie zu bewahren. Ich habe eine gewisse Vorahnung, daß diese kleine Insel Europa eines Tages in Staunen versetzen wird.‹
Eines Nachmittags erschien ein junger schottischer Adliger, James Bothwell, auf dem Schloß der Familie Colonna, wo Paoli während der Zeit, in der das Syndikatsgericht tagte, Quartier genommen hatte. Bothwell war auf einer Kavaliersreise durch Mitteleuropa und war nach Korsika gekommen, um Paoli kennenzulernen, von dem er viel gehört hatte.
Die äußere Erscheinung Paolis überraschte ihn. Er hatte einen bärtigen Korsen in landesüblicher Tracht erwartet: schwarzlederne Gamaschen, eine schwarze Zipfelmütze, um den Leib eine Patronentasche, Dolch und Pistole im Gürtel, die Flinte quer über der Schulter. Statt dessen erblickte er einen Mann, der in seinen Stulpenstiefeln und dem Degen an der Seite eher einem Offizier vom Festland ähnelte. Paoli war hellhäutig, groß und kräftig; er sah einem Nordländer ähnlicher als einem Mann des Mittelmeerraumes. Er trug einen goldbetreßten grünen Rock, das Jabot fiel gut gestärkt von der weißen Halsbinde zur Weste, die Haare waren sorgfältig zum Zopf frisiert und leicht gepudert.
Bothwell überreichte ein Empfehlungsschreiben von Rousseau. Der General las den Brief, betrachtete dann den Schotten aufmerksam und fragte: »Was führt Sie nach Korsika?«
»Ich habe von England aus den Kampf Ihres Volkes gegen Genua mit großem Interesse verfolgt. Als ich meine Reise plante, stand es für mich fest, daß ich auch Korsika besuchen würde. Bis vor kurzem war ich in Rom und habe dort die Kultur eines großen Volkes der Vergangenheit kennengelernt. Auf dieser Insel erlebe ich ein großes Volk der Gegenwart.«
»Wir können uns nicht mit den Römern messen, die über ein Weltreich geherrscht haben. Aber im Vergleich zu vergangenen Jahrhunderten können wir mit unserer jetzigen Lage zufrieden sein. Unsere Abhängigkeit von Genua besteht nur noch auf dem Papier, zu den Franzosen haben wir ein gutes Verhältnis, unser Handel hat sich belebt, wir haben endlich ein vernünftiges Justizsystem. In zwanzig oder dreißig Jahren können wir unseren Gästen Künste und Wissenschaften, Konzerte und Gesellschaften bieten.« Nach einer kleinen Pause fragte er: »Sie waren also bei Rousseau in Motiers? Ich habe ihn eingeladen, nach Korsika zu kommen und hier zu leben und zu arbeiten. Wir würden ihm ein angenehmes Exil bieten. Er wäre sicher vor Verfolgung und Diskriminierung, er könnte schreiben, was er wollte. Ich verstehe nicht, warum er meiner Einladung bisher nicht gefolgt ist, aber er wird seine Gründe haben. Immerhin ist er dem Wunsch des Staatsrates Buttafuoco nachgekommen und hat uns einen Verfassungsentwurf geschickt. Auch sein Gesellschaftsvertrag hat uns für den Aufbau des Staates wertvolle Anregungen gegeben. Haben Sie den Gesellschaftsvertrag gelesen?«
»Nein, ich kenne nur die Nouvelle Héloïse.«
Paoli lächelte nachsichtig. »Natürlich, ein Liebesroman ist für junge Leute interessanter, vielleicht auch wichtiger.«
Bothwell wurde etwas verlegen und sagte rasch einige bewundernde Worte über die korsische Verfassung.
»Unsere Gesellschaftsstruktur war immer anders als auf dem Festland«, erklärte Paoli. »Es gab hier kein Feudalsystem, kein höfisches Leben. Die Adligen, die aus Italien eingewandert sind, wurden von der Bevölkerung nie als ›gottgewollt‹ empfunden. Niemand dünkt sich hier geringer, nur weil er arm ist.«
Ein Adjutant hatte das Zimmer betreten und meldete einen Dorfbewohner, der eine Beschwerde vorzubringen wünschte. Paoli nickte und wandte sich wieder an Bothwell: »Wir werden unser Gespräch an der Abendtafel fortsetzen. Haben Sie Lust zu einem Ausritt in die Umgebung? Ich stelle Ihnen gerne mein Pferd zur Verfügung und gebe Ihnen einen Begleiter mit, der fließend französisch spricht, dann ist die Verständigung einfacher.«
Der junge Mann nahm das Angebot dankbar an, und Paoli erteilte dem Adjutanten einige Anweisungen.
»Ihr Begleiter ist ein tüchtiger Jurist. Er hat mich hervorragend bei der Ausarbeitung der Verfassung unterstützt. Ich habe ihn vor kurzem zu meinem ständigen Sekretär ernannt. Ab Oktober wird er in Corte die Staatskanzlei leiten.«
Bei den letzten Worten betrat Carlo das Zimmer. Paoli machte die jungen Männer miteinander bekannt, und bald waren sie in ein angeregtes Gespräch vertieft.
An der Abendtafel durfte Bothwell neben Paoli sitzen. Die Gesellschaft bestand aus fünfzehn Personen. Die Männer, die zu Paolis Stab gehörten, waren wie dieser in Grün mit Gold gekleidet; Weste und Kniehosen hatte jeder nach persönlichem Geschmack gewählt.
Carlo zog sich stets um, bevor er zur Tafel erschien. An diesem Abend trug er zu dem grünen Rock ein weißes seidenes Hemd mit Spitzenmanschetten, eine Weste und Kniehose aus dunkelrotem Samt; außerdem hatte er sich mit einem Duftwasser parfümiert, das er aus Rom mitgebracht hatte.
Paoli lächelte amüsiert, als Carlo erschien. Er kannte und tolerierte die Schwäche seines Mitarbeiters für elegante Garderobe; er selbst fand keinen Geschmack daran und hatte – bis zur Ankunft der Franzosen 1764-stets das grobgewebte korsische Tuch getragen. Er haßte Verschwendung. Deshalb ließ er auch an seiner Tafel nur einheimischen Wein servieren und nur fünf bis sechs Gerichte, die von einem italienischen Koch vortrefflich zubereitet waren.
Die Tischgesellschaft hatte den Gast freundlich aufgenommen und sofort in die allgemeine Unterhaltung einbezogen. Man sprach über Literatur. Bothwell staunte, wie gut Paoli die klassische Dichtung kannte und mit welcher Sicherheit er Verse in lateinischer und griechischer Sprache vortrug.
Bothwell blieb mehrere Tage im Schloß der Colonna in Sollacaro, wo man ihm ein Zimmer zur Verfügung gestellt hatte. Dort saß er jeden Abend und führte Tagebuch über seine Erlebnisse und Eindrücke, weil er ein Buch über Korsika schreiben wollte.
Eines Abends erschien Carlo, in der Hand ein Muschelhorn.
»Ich will mich schon heute von Ihnen verabschieden, Monsieur, weil ich morgen bei Sonnenaufgang nach Corte aufbrechen werde. Ich möchte Ihnen ein Andenken schenken. Mit diesen Hörnern wurde in Kriegszeiten die Bevölkerung in den Bergtälern zu den Waffen gerufen, aber schon seit etlichen Jahren sind sie verstummt, hoffentlich für immer.«
Carlo lag im Bett und betrachtete Letizia, die vor dem Spiegel stand und ihr Haar bürstete. Sie trug ein weißes, dünnes Hemd, das ihren Körper kaum verhüllte. Carlos Augen folgten genießerisch den Linien ihrer Figur. Der bloße Anblick ihres jungen, straffen Körpers erregte ihn mehr als die raffinierten Liebeskünste der römischen Kurtisane. Deren berechnender Blick und der schwere Duft ihres exotischen Parfüms hatten ihn eher abgestoßen.
Letizia hatte inzwischen die Öllampe gelöscht und sich an ihn gekuschelt. Er wandte sich ihr zu und betrachtete leicht amüsiert ihre erwartungsvollen Augen. In der Hochzeitsnacht hatten dieselben Augen ihn ängstlich und hilflos angeblickt und zur Unfähigkeit verdammt.