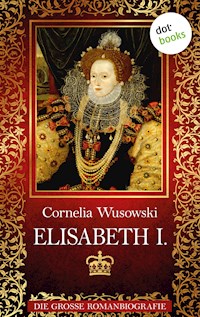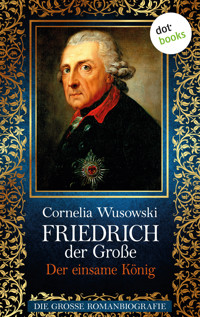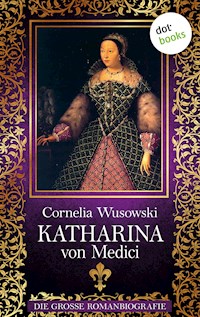Friedrich der Große - Band 1: Der ungeliebte Sohn - Die große Romanbiografie E-Book
Cornelia Wusowski
7,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Pflichterfüllung und dem Drang nach Freiheit: „Friedrich der Große – Der ungeliebte Sohn“ von Cornelia Wusowski jetzt als eBook bei dotbooks. Er liebt die Musik, die Literatur, die Kunst – doch sein Vater verlangt Disziplin, Pflichtbewusstsein und Härte: Friedrich lernt früh, was es heißt, Kronprinz von Preußen zu sein. Von Kindesbeinen an wird er darauf vorbereitet, als starker Herrscher über das große Reich zu regieren. Für seine persönlichen Vorlieben, das Flötenspiel oder das Schreiben von Gedichten, bleibt da kein Platz. Gezwungen, die Erwartungen seines Vaters zu erfüllen, fühlt Friedrich sich in dem prächtigen Berliner Stadtschloss bald wie in einem Gefängnis. Als ihm dieses Leben unerträglich wird, sieht er nur noch einen Ausweg: Er muss fliehen … Der wohl bekannteste Vater-Sohn-Konflikt der deutschen Geschichte mitreißend erzählt! Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Friedrich der Große – Der ungeliebte Sohn“ von Cornelia Wusowski. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1130
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch:
Er liebt die Musik, die Literatur, die Kunst – doch sein Vater verlangt Disziplin, Pflichtbewusstsein und Härte: Friedrich lernt früh, was es heißt, Kronprinz von Preußen zu sein. Von Kindesbeinen an wird er darauf vorbereitet, als starker Herrscher über das große Reich zu regieren. Für seine persönlichen Vorlieben, das Flötenspiel oder das Schreiben von Gedichten, bleibt da kein Platz. Gezwungen, die Erwartungen seines Vaters zu erfüllen, fühlt Friedrich sich in dem prächtigen Berliner Stadtschloss bald wie in einem Gefängnis. Als ihm dieses Leben unerträglich wird, sieht er nur noch einen Ausweg: Er muss fliehen …
Über die Autorin:
Cornelia Wusowski wurde 1946 in Fulda geboren. 1971 schloss sie ihr Studium der Politischen Wissenschaft am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin mit dem Diplom ab. Bis 2009 war Cornelia Wusowski im Höheren Verwaltungsdienst tätig. Anfang der 1990er-Jahre schrieb sie ihren ersten historischen Roman. Auf ihr erfolgreiches Debüt »Die Familie Bonaparte« folgten weitere Romanbiografien großer historischer Persönlichkeiten. Diese bieten dank der detaillierten Recherche von Cornelia Wusowski einen überzeugenden Einblick in die Charaktere.
Cornelia Wusowski veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Romanbiografien »Katharina von Medici«, »Elisabeth I.«, »Friedrich der Große: Der einsame König« und »Die Familie Bonaparte«.
***
eBook-Neuausgabe September 2016
Copyright © der Originalausgabe 2007 Verlag Josef Knecht in der Verlag Karl Alber GmbH, Freiburg
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von Antoine Pesne
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-815-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Friedrich der Große: Der ungeliebte Sohn« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Cornelia Wusowski
Friedrich der GroßeDer ungeliebte Sohn
Die große Romanbiografie
dotbooks.
Für Herta Ganß, Ralf Nölte, Manfred Thomas, Gerhard Wirtz
ERSTER TEIL
1716 – 1725
1. Kapitel
1
Seit Tagesanbruch lag über der Residenzstadt Berlin ein grauer, trüber Himmel, und bereits am frühen Nachmittag wurden in den Handwerksbetrieben, den Läden und Bürgerhäusern Talglichter, Kerzen und Lampen entzündet, damit man bei der täglichen Arbeit besser sehen konnte.
Im weitläufigen Stadtschloss an der Spree waren nur zwei Räume erleuchtet, das Arbeitszimmer des Königs und der Salon der Königin, weil genügend Kerzen zu den Privilegien gehörten, die der König seiner Gattin zubilligte.
An jenem Nachmittag Mitte Februar 1716 stand Madame de Roucoulles, die Gouvernante des vierjährigen Kronprinzen Friedrich, im Vorzimmer seines Appartements, betrachtete schon seit geraumer Zeit unschlüssig einen zinnernen Kerzenleuchter und überlegte, ob sie es wagen durfte, ein Licht zu entzünden, denn der Vorrat musste noch bis zum Monatsende reichen.
»Nun«, sagte sie halblaut zu sich selbst, »der Prinz muss heute besonders sorgfältig angekleidet werden, weil ihm ein wichtiges Ereignis bevorsteht«, und kurz entschlossen zündete sie die Kerze an, ging in die schmale, fensterlose Kleiderkammer, stellte den Leuchter auf einen niedrigen, sauber gescheuerten Tisch aus dunkelbraunem Eichenholz und suchte in den Schränken nach einem passenden Kleid.
Sie nahm eine Robe nach der anderen, betrachtete sie im Kerzenschimmer und hängte sie leise seufzend wieder zurück.
»Sie sind alle zu verspielt«, murmelte sie, »zu viele Rüschen und Borten, sie entbehren der Schlichtheit und Würde.«
Ihre Augen wanderten hilflos die Kleiderstange entlang und betrachteten dann fasziniert die letzte Robe, sie strich behutsam, fast andächtig über das einfache, sattblaue Tuch, betrachtete die roten Ärmelaufschläge, die blankpolierten gelben Messingknöpfe und murmelte zufrieden: »Dieses Uniformkleid ist das einzige, das dem Ereignis angemessen ist, das den Prinzen erwartet.«
Sie ging hinüber in Friedrichs Schlafzimmer und gab der Kammerfrau, die neben einem spärlich flackernden Kaminfeuer saß, ein Zeichen. Diese stand rasch auf, nahm die Zinnkanne, die neben dem Feuer stand, und goss das Wasser in die Zinnschüssel auf dem niedrigen Waschtisch aus Fichtenholz; dann tauchte sie kurz einen Finger hinein, stellte zufrieden fest, dass das kalte Wasser inzwischen etwas weniger kalt war, knickste und verschwand.
Die Gouvernante trat an das Bett des Prinzen, betrachtete liebevoll die vom Schlaf geröteten Wangen, die dichten, dunkelblonden, schulterlangen Locken, und plötzlich erschien vor ihrem inneren Auge das Bild seines Vaters, als dieser ungefähr fünf Jahre alt war: »Er ist ein Abbild des Königs«, sagte sie leise zu sich selbst, rüttelte ihn sanft, und als Friedrich erwachte und seine Erzieherin sah, strahlten seine großen, himmelblauen Augen, er lächelte sie an, sie erwiderte sein Lächeln und sagte: »Sie müssen sich beeilen, Königliche Hoheit, Ihre Majestät erwartet uns um drei Uhr.«
Da erinnerte er sich, dass er an jenem Nachmittag nicht wie sonst in einem Schlitten über die zugefrorene Spree fahren würde – diesen Nachmittag würden er und seine Schwester Wilhelmine im Salon der Königin verbringen, wo eine Überraschung auf sie wartete.
Während er das warme Bett verließ, frierend zum Waschtisch ging und lustlos begann, Hände, Gesicht und Hals einzuseifen, überlegte er, wie er seine Erzieherin dazu bringen könnte, ihm die Überraschung zu verraten; bis jetzt war es ihm nicht gelungen, ihr ein Wort zu entlocken.
Madame de Roucoulles stand neben ihm, achtete darauf, dass er sich sorgfältig wusch, und sagte nach einer Weile mahnend: »Königliche Hoheit, Sie müssen mehr Seife nehmen, Sie wissen doch, dass Seine Majestät großen Wert auf körperliche Sauberkeit legt und die Familie seinem Beispiel folgt, sich mindestens einmal täglich gründlich wäscht und die Leibwäsche wechselt.«
Friedrich gehorchte und sagte: »Ich mag keine Seife.«
Als die Erzieherin ihm das Uniformkleid anziehen wollte, trat er einen Schritt zurück und sagte bestimmt: »Nein, ich mag dieses Kleid zwar, aber heute ist ein besonderer Nachmittag, ich will das hellblaue Samtkleid anziehen.«
»Königliche Hoheit, das Samtkleid ist Ihr Sonntagskleid, heute ist ein Werktag, und der Uniformrock ist das einzige Kleidungsstück, das dem wichtigen Ereignis angemessen ist.«
Er lächelte seine Gouvernante an und erwiderte: »Ich werde dieses Kleid tragen, wenn Sie mir sagen, welche Überraschung im Zimmer meiner Mama auf mich wartet.«
Sie sah ihn erstaunt an und sagte nachdenklich: »Sie versuchen, mich zu erpressen, Königliche Hoheit, genau wie damals Seine Majestät«, und vor ihrem inneren Auge sah sie plötzlich die stämmige Gestalt des fünfjährigen Kurprinzen von Brandenburg, und sie hörte sich sagen: »Sie bekommen kein Frühstück, Hoheit, wenn Sie nicht aufhören, Teller an die Wand zu werfen, mon Dieu, das kostbare Porzellan!«
»Ich hasse Porzellan, ich will Zinnteller.«
Er kletterte auf die Fensterbank und brüllte: »Ich springe hinunter in den Hof, wenn ich nicht sofort mein Frühstück bekomme!«
»Um Gottes Willen, Hoheit, Sie können doch nicht vom zweiten Stock hinunterspringen!«
Sie klingelte Sturm nach der Dienerschaft, befahl den Lakaien, unverzüglich das Frühstück zu servieren, und wenig später löffelte Friedrich Wilhelm von Hohenzollern gierig die dampfende Starkbiersuppe und verschlang genüsslich ein Schinkenbrot nach dem anderen.
Der König hat mich damals erpresst, dachte die Erzieherin, jetzt erpresst mich sein Sohn. Aber seine Erpressung ist feiner und subtiler, nicht so rau und gewalttätig wie bei seinem Vater. Sie zog Friedrich das Uniformkleid an, legte ihm einen weißen Leinenumhang über die Schultern, und während sie anfing, seine Locken zu bürsten, sagte sie: »Königliche Hoheit, Sie wollen wissen, welche Überraschung Sie in den Räumen Ihrer Majestät erwartet, nun ja, Sie erinnern sich, dass ich Ihnen von dem Krieg Seiner Majestät gegen die Schweden erzählt habe und von der Belagerung der Stadt Stralsund.
Am 22. Dezember des vergangenen Jahres kapitulierte die Stadt, und die schwedischen Offiziere waren nun die Gefangenen Seiner Majestät. Sie wurden nach Berlin gebracht und warten jetzt auf den Friedensvertrag, der es ihnen erlaubt, nach Schweden zurückzukehren. Unter diesen Offizieren gibt es einen Grafen Cron, der anscheinend die Gabe des Zweiten Gesichtes besitzt, man erzählt, dass er einigen vornehmen Berliner Familien die Zukunft vorhersagte; Ihre Majestät hat davon gehört und befahl den Grafen für heute Nachmittag in das Schloss, er soll Ihrer Majestät, der Prinzessin Wilhelmine und Ihnen, Königliche Hoheit, die Zukunft prophezeien.«
»Die Zukunft? Das verstehe ich nicht.«
»Nun, Königliche Hoheit, angenommen, Sie fangen morgen mit der Prinzessin Wilhelmine einen Streit an; diesen Streit würde der Graf Ihnen heute vorhersagen.«
Friedrich überlegte einen Augenblick und erwiderte: »Wilhelmine und ich, wir haben noch nie gestritten, und wir werden uns nie streiten.«
»Nun, Königliche Hoheit, Sie wissen, dass Sie in einigen Wochen ein neues Geschwisterchen haben, aber Sie wissen nicht, ob es ein Bruder oder eine Schwester ist. Der schwedische Graf wird Ihrer Majestät wahrscheinlich sagen, ob sie einen Sohn oder eine Tochter zur Welt bringen wird.«
Friedrich dachte erneut nach und fragte nach einer Weile; »Madame, was soll der Graf mir Vorhersagen? Ich weiß schon jetzt, dass ich einmal König sein werde.«
»Gewiss, Königliche Hoheit, aber jeder König regiert, wie er es für richtig hält; der Graf wird Ihnen prophezeien, ob Sie auch ein bedeutender Herrscher werden.«
Friedrich schwieg, und nach einer Weile sagte er leise, und in seiner Stimme schwang deutlich Enttäuschung mit: »Dies ist also die Überraschung, die mich im Salon meiner Mama erwartet. Ich höre jeden Tag, wenn ich bei Mama bin, dass ich einmal König sein werde. Ich hoffte, dass ich heute neues Spielzeug bekomme, neue Bilderbücher oder Süßigkeiten.«
Madame de Roucoulles legte den leinenen Umhang zur Seite, bürstete das Uniformkleid ab und sagte: »Königliche Hoheit, Sie sollten an das glauben, was der Graf Ihnen prophezeien wird! Vor vielen Jahren lebte in Frankreich eine Königin, die mit dem Zweiten Gesicht begabt war; sie sah voraus, dass ihr Gatte bei einem Turnier tödlich verunglücken würde. So jedenfalls kann man es in den Memoiren ihrer Tochter Margot lesen.«
Sie betrachtete die Messingknöpfe, nahm ihr blütenweißes Taschentuch, hauchte die Knöpfe an und begann, sie eifrig zu polieren. Friedrich betrachtete seine Erzieherin, und plötzlich bemerkte er zum ersten Mal, dass sie immer schwarze Kleider trug, die nur durch eine weiße Halskrause aufgelockert wurden. Die Erzieherin seiner Schwester Wilhelmine und die Hofdamen seiner Mutter hingegen waren stets bunt gekleidet. Er zögerte etwas und fragte dann vorsichtig: »Madame, warum tragen Sie immer schwarze Kleider?«
Sie sah ihn überrascht an und versuchte, ihm den Unterschied zwischen Hugenotten und den übrigen Protestanten zu erklären: »Ich bin Hugenottin, Königliche Hoheit, so werden die Protestanten in Frankreich genannt. Unsere Religion fordert, dass wir arbeiten, beten, sparsam leben und uns schlicht anziehen, die schwarze Kleidung ist eine alte Tradition.«
Friedrich dachte nach und fragte nach einer Weile: »Sie haben in Frankreich gelebt, Madame?«
»Ja, Königliche Hoheit.«
»Wo liegt Frankreich?«
»Im Westen Europas, ich werde es Ihnen morgen auf der Landkarte zeigen.«
Er überlegte und fragte zögernd: »Warum haben Sie Frankreich verlassen, Madame?«
»Das ist eine traurige Geschichte, Königliche Hoheit. Im Jahr 1685 widerrief der französische König Ludwig XIV. das Toleranzedikt des guten Königs Heinrich, seines Großvaters. Dies bedeutete, dass die Hugenotten erneut mit blutiger Verfolgung rechnen mussten, und so verließen wir Frankreich und begaben uns nach England und Holland, nach Schweden und vor allem in die protestantischen Länder Deutschlands. Im Oktober 85 erließ Ihr Urgroßvater, Kurfürst Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, ein Edikt, worin uns nicht nur eine neue Heimat zugesichert wurde, sondern auch finanzielle Unterstützung beim Aufbau einer neuen Existenz und freie Ausübung unserer Religion. Damals wanderten ungefähr 45.000 Franzosen in Brandenburg ein, und mein verstorbener Mann ging mit den Kindern und mir nach Berlin. Im Jahre 93 wurde ich zur Erzieherin Ihres Vaters, des Kurprinzen Friedrich Wilhelm, ernannt. Als Seine Majestät 1706 heiratete, fragte er mich, ob ich bereit wäre, seinen ältesten Sohn, den künftigen Kronprinzen, zu erziehen, und ich war gerne bereit. Die Nachfolger Ihres Urgroßvaters, Königliche Hoheit, haben seine religiöse Toleranzpolitik fortgeführt. Im Reich Seiner Majestät, Ihres Vaters, wird jede Religion respektiert, hier leben Protestanten, Katholiken und Juden friedlich nebeneinander, das zeichnet Preußen vor vielen europäischen Staaten aus, hier ist nicht die Religionszugehörigkeit wichtig, sondern der Beitrag des Einzelnen zum Aufbau des Staates.« Sie schwieg plötzlich, weil ihr bewusst wurde, dass sie zu einem vierjährigen Kind sprach, das dies alles noch nicht begreifen konnte.
»In einigen Jahren, Königliche Hoheit, werden Sie besser verstehen, was ich meine.«
»Ich habe Sie verstanden, Madame, im Reich meines Papas kann jeder zu Gott beten, wie er will.«
Die Erzieherin lächelte: »Ja, Königliche Hoheit.«
Inzwischen war der letzte Knopf poliert, und Madame de Roucoulles legte ihre Hände auf die Schultern des Kindes und sagte ernst und feierlich: »Ich will Ihnen jetzt erklären, Königliche Hoheit, warum es wichtig ist, dass Sie heute Nachmittag das Uniformkleid tragen: Sie werden nachher etwas über Ihre Zukunft als künftiger König erfahren, und da ist es angemessen, den Rock des Königs zu tragen, so wird diese Uniform allgemein genannt; das einfache blaue Tuch symbolisiert den Beginn eines wirtschaftlichen Aufschwunges, weil es in unserem Land hergestellt wird, das ist eine der vielen Leistungen Seiner Majestät seit seinem Regierungsantritt. Seine Majestät hat am letzten Weihnachtsfest die königliche Familie mit diesem Tuch beschenkt, und ich habe Ihnen einen Uniformrock schneidern lassen, den Sie vorerst als Kleid tragen können. Sie sind zwar schon etwas zu alt für Mädchenkleider, aber wir müssen sparen, deshalb lasse ich Ihre Kleider immer wieder ausbessern und verlängern. Vielleicht haben wir im nächsten Jahr genügend Geld, dass ich Hosen anfertigen lassen kann, und der Uniformrock ist so groß, dass Sie ihn mindestens zwei Jahre tragen können, Sie werden hineinwachsen. Vielleicht begegnen wir nachher Seiner Majestät, Ihr Vater freut sich immer, wenn er Sie in diesem Kleid sieht, und Sie wollen ihrem Vater doch stets Freude bereiten, nicht wahr?«
»O ja, Madame, ich liebe meinen Papa.«
Sie setzte ihm einen kleinen schwarzen Dreispitz auf die Locken und legte ihm einen schwarzen Zobelpelz um, weil es in den Gängen des Schlosses bitterkalt war und er sich nicht verkühlen sollte. Dann betrachtete sie unschlüssig das Kaminfeuer und murmelte: »Ob ich der Kammerfrau befehle, Holz nachzulegen? Nein, der Vorrat muss noch bis zum Monatsende reichen, überdies verbringt der Prinz den Nachmittag bei Ihrer Majestät, es genügt, wenn das Feuer am Abend noch einmal angefacht wird.«
Das trübe Tageslicht, das durch die hohen Fenster in die verwinkelten Gänge und die langen Galerien schimmerte, erhellte diese kaum, und so schritten Friedrich und seine Erzieherin im Halbdunkel vorwärts, was den Kleinen nicht weiter störte, er war es gewohnt, dass im Schloss erst bei Anbruch der Dunkelheit die Kerzen entzündet wurden.
»Ist Ihnen sehr kalt, Königliche Hoheit?«
»Nein, Madame, ich friere nie, wenn ich meine Mama besuche, ich weiß, dass sich irgendwann eine Tür öffnet und wir dann ein Zimmer betreten, wo viele Kerzen brennen und wo es warm ist.«
Endlich standen sie vor dem Eingang zum Appartement der Königin. Die Gouvernante übergab Zobelpelz und Dreispitz einem der Lakaien, ein anderer huschte flink in das Appartement, und wenig später öffnete sich vor Friedrich die große dunkelbraune Flügeltür, für den Bruchteil einer Sekunde wanderten seine Augen verzückt über die Ornamente aus Blattgold, dann hörte er den Diener rufen: »Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz, Madame de Roucoulles!« Er atmete tief durch, betrat freudig erregt ein großes, hohes Zimmer und schritt langsam und feierlich über einen weinroten, weichen Teppich zu seiner Mutter.
2
Die Luft im Salon der Königin war dumpf und schwer, weil die Fenster nur am Morgen kurz geöffnet wurden. Es roch nach süßem Parfüm und Puder, nach Schweiß und den Ausdünstungen ungewaschener Körper, aber Friedrich nahm die Gerüche nicht wahr. Er spürte nur die Wärme des hochflackernden Kaminfeuers und bewunderte im Stillen jeden Tag von neuem die schweren weinroten Samtportieren an den Fenstern, die unzähligen brennenden Kerzen in den silbernen Leuchtern und in den funkelnden kristallenen Lüstern, die an der Decke hingen. Seine Augen streiften kurz das Deckengemälde, auf dem die vier Jahreszeiten dargestellt waren. Dann sah er zu den Damen, beobachtete, wie sie elegant ihre buntbemalten Fächer bewegten, er hörte, wie sie sich halblaut auf Französisch unterhielten, er hörte das leise Rascheln der Seidenroben und die sanften Klänge eines Cembalos, das irgendwo im Hintergrund stand.
»Träume ich?«, flüsterte er. »Nein, es ist kein Traum, ich darf jeden Tag hier sein.«
Madame de Roucoulles ging hinter ihm und betrachtete flüchtig die Szene. Die Königin saß in der Nähe des Kamins in einem bequemen gepolsterten Armsessel, rechts von ihr saßen die Oberhofmeisterin, Frau von Kamecke, und einige Hofdamen auf Polsterstühlen ohne Armlehne. Links von ihr saß die sechsjährige Prinzessin Wilhelmine kerzengerade auf einem weinroten Samtschemel; die kleinen Hände lagen sittsam auf dem dunkelblauen Samtkleid, und als Madame de Roucoulles das schlanke, aschblonde Mädchen genauer betrachtete, fiel ihr wieder einmal auf, dass Wilhelmine verängstigt und eingeschüchtert wirkte, wie immer, wenn ihre Erzieherin Fräulein Leti hinter ihr saß, und die Hugenottin dachte im Stillen, dass Wilhelmine stets lebhaft und fröhlich war, solange die Leti nicht in ihrer Nähe weilte.
Jedes Mal, wenn Friedrich den Salon seiner Mutter betrat, unterbrachen die Damen ihre Unterhaltung, betrachteten ihn liebevoll, wohlwollend, mütterlich und entzückt und überlegten, mit welchen Bemerkungen über den Kronprinzen sie sich die Gunst der Königin sichern konnten.
»Oh, quel prince charmant«, flötete eine junge Hofdame, »wenn ich Seine Königliche Hoheit sehe, spüre ich, wie die Sonne aufgeht.«
Frau von Kamecke, eine mittelgroße, füllige Dame mittleren Alters, drehte sich zu dem jungen Edelfräulein um und flüsterte hinter ihrem Fächer: »Meine Liebe, Sie sollten die aufgehende Sonne nicht zu früh anbeten.«
Dann sah sie verstohlen zu der Königin, hoffte, dass diese ihre Worte nicht gehört hatte, und atmete auf, als sie beobachtete, dass die ganze Aufmerksamkeit ihrer Herrin dem Kronprinzen galt.
Sophie Dorothea von Hohenzollern, Kurfürstin von Brandenburg und Königin in Preußen, war eine große, vollschlanke Frau Ende zwanzig. Ihre Augen glitten über die zwei Saphirringe, die an den beiden Ringfingern steckten, und wieder einmal dachte sie erbittert, dass sie als Königin nur wenig Schmuck besaß. Sie bewegte gereizt den Fächer hin und her, um in dem überheizten Salon etwas Luft zu bekommen, und legte ihn zur Seite, als der Kronprinz gemeldet wurde.
Während Friedrich auf sie zuschritt, überflutete sie eine Woge von Stolz auf diesen Sohn, und sie dachte im Stillen, dass er nach den überstandenen Krankheiten etwas kräftiger geworden, aber immer noch zart und anfällig war. Aber, überlegte sie, seine Zartheit lässt ihn vornehm wirken. In diesem Augenblick sah sie, dass er das Uniformkleid trug, und versuchte vergeblich, die aufsteigende Wut zu bekämpfen. Warum, dachte sie verärgert, warum hat die Gouvernante meinen einzigen Sohn, den Kronprinzen, ausgerechnet heute so schlicht gekleidet?
Nun stand Friedrich vor ihr, verbeugte sich, und als sie ihm lächelnd die rechte Hand reichte, schmatzte er ihr spontan einen feuchten Kuss auf den Handrücken.
Sophie Dorothea entzog ihm halb amüsiert, halb verärgert die Hand und sagte mit einem tadelnden Unterton: »Mon bijou, hast du vergessen, wie ein Kavalier einer Dame die Hand küsst?«
Friedrich sah überrascht auf, überlegte, warum die Königin seinen liebevollen Handkuss ablehnte, und antwortete: »Ich habe es nicht vergessen, Mama.«
Sie reichte ihm erneut die Hand, und als er sich jetzt darüberbeugte, achtete er darauf, dass seine Lippen den Handrücken nicht berührten.
Sophie Dorothea lächelte: »So ist es richtig, mon chéri. Du willst doch ein formvollendeter Kavalier werden?«
»Ja, Mama.«
Dann betrachtete er fasziniert ihre großen, strahlenden, dunkelblauen Augen, das schwarze Samtkleid und den schwarzen Samtumhang, der dekorativ über ihren Leib gebreitet war, er genoss den Duft von Puder und Parfum, der sie stets umgab, und bewunderte im Stillen den Perlenschmuck an Hals und Ohren sowie die kunstvoll aufgesteckte, weißgepuderte Lockenfrisur.
Sophie Dorothea wandte sich zu der Gouvernante, musterte sie einen Augenblick herablassend und fragte: »Madame, warum haben Sie ausgerechnet heute dem Kronprinzen dieses entsetzliche Soldatenkleid angezogen, diesen… diesen Sterbekittel?!«
Friedrich horchte auf; das Wort »Sterbekittel« kannte er noch nicht, und er beschloss, seine Erzieherin zu fragen, was ein Sterbekittel war.
Die Hugenottin straffte sich, sah der Königin in die Augen und erwiderte gelassen: »Majestät, heute wird Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz, etwas über sein Schicksal als künftiger König in Preußen erfahren – ich hielt es für angemessen, ihm den Rock des Königs anzuziehen, überdies, vielleicht begegnet der Kronprinz Seiner Majestät. Seine Majestät ist stets von neuem begeistert, wenn er den Kronprinzen in diesem Kleid sieht, und ich überlege mir immer, wie ich Seiner Majestät eine kleine Freude bereiten kann.«
Sophie Dorothea fächelte sich Luft zu und ärgerte sich über die Anhänglichkeit der Erzieherin gegenüber dem Gatten; sie verstand diese Gefühle nicht und sagte scharf: »Begeben Sie sich zu Ihrem Platz, Madame.«
Dann wandte sie sich zu ihrem Sohn und hob sein Gesicht zu sich empor: »Hast du gut geschlafen, mon chéri?«
»Ja, Mama.«
Sie strich ihm über die Locken und sagte: »Du und deine Schwester werdet heute zum ersten Mal bei mir Tee trinken. Zum Tee wird englisches Gebäck serviert, diese Delikatessen hat dein guter Großvater, der König von England, vor einigen Tagen geschickt. Tee und Gebäck sollen mich stärken. Du und deine Schwester, ihr dürft nie vergessen, dass ihr die Enkel des Königs von England seid, und ihr müsst allmählich anfangen, euch mit der englischen Lebensart vertraut zu machen.«
»Ja, Mama«, erwiderte Friedrich und dachte im Stillen, dass dieser König für seine Mutter ein wichtiger Mann war, weil sie jeden Tag von ihm sprach. Als er sich auf den weinroten Samtschemel zwischen Mutter und Schwester setzte, stieg eine leichte Staubwolke empor, die von den Anwesenden nicht beachtet wurde, weil Staub zu Polstermöbeln gehörte.
Jeden Tag genoss Friedrich von neuem die weichen Sitzmöbel im mütterlichen Appartement und sagte leise zu Wilhelmine: »Warum sind Stühle, Armsessel und Bänke nur in Mamas Räumen gepolstert, und warum werden in den übrigen Zimmern die Möbel täglich mit Wasser abgewaschen?«
»Es ist ein Befehl von Papa, Fritzchen, er wünscht, dass im Schloss alles sauber ist, deswegen liegen nirgends Teppiche auf den Holzböden, und an den Fenstern hängen keine Vorhänge. Er erlaubt Mama Polstermöbel, Teppiche und Vorhänge, weil sie die Königin ist.«
»Das verstehe ich, eine Königin ist eine wichtige Dame. Ist es nicht wunderbar, dass wir einen ganzen Nachmittag bei Mama verbringen dürfen? Wir sehen sie doch sonst nur eine Stunde am Vormittag und während der Mittags- und Abendtafel.«
In diesem Augenblick wurde Graf Cron angekündigt. Als er das Zimmer betrat, verstummte die Unterhaltung, die Damen betrachteten ihn mit einer Mischung aus Neugier und Ängstlichkeit, und eine sagte leise zu ihrer Nachbarin: »Hoffentlich prophezeit er den Hohenzollern eine glückliche Zukunft, ein Niedergang dieser Dynastie würde meine Entlassung bedeuten, und ich bin auf die Einkünfte als Hofdame angewiesen, weil meine Güter verschuldet sind.«
Sophie Dorothea betrachtete den Schweden gelassen und dachte im Stillen, dass sie nicht mehr viel zu verlieren hatte und der Weg ihres ältesten Sohnes vorgezeichnet war. Er würde einmal König werden, und seine Schwestern mussten natürlich vorteilhaft verheiratet werden.
Sie dachte auch daran, dass sie nicht viel von Astrologen hielt, aber in Berlin gehörte es inzwischen zum guten Ton, Cron zu empfangen und sich die Handlinien deuten zu lassen.
Friedrich zuckte beim Anblick des großen, hageren Grafen unwillkürlich zusammen, rückte etwas näher zu seiner Schwester, betrachtete die schwarzen Samtkleider, die wallende, schwarze Lockenperücke, die bis zu den Hüften reichte, und spürte Angst in sich aufsteigen.
»Er ist ein Gespenst«, flüsterte er.
Nun stand der Schwede vor der Königin, beugte das Knie, berührte mit den Lippen den Saum ihres Kleides und sagte: »Majestät, es ist eine große Ehre für mich, dass Sie geruhen, mich zu empfangen, ich bin Ihr ergebener Diener.«
Sophie Dorothea lächelte: »Ich habe viel von Ihnen gehört, Sie sollen meinen beiden Kindern und mir die Zukunft Vorhersagen.«
»Zu Befehl, Majestät. Wollen Sie etwas über die nahe oder die ferne Zukunft wissen?«
»Was mich betrifft, so möchte ich etwas über die nahe Zukunft wissen, bei meinen Kindern ist natürlich nur die ferne Zukunft interessant.«
»Was möchten Sie wissen, Majestät?«
»In wenigen Wochen werde ich mein siebtes Kind zur Welt bringen, wird es ein Sohn sein oder wieder nur eine Tochter?«
Der Graf erhob sich und bat die Königin, ihm ihre rechte Handfläche zu zeigen. Während Cron mit ernstem Gesicht die Handlinien betrachtete, wurde Sophie Dorothea immer nervöser, und die wenigen Sekunden kamen ihr vor wie Stunden. Endlich sah der Schwede auf, lächelte und sagte: »Majestät, Sie werden am 13. März eine gesunde Tochter zur Welt bringen.«
Die Königin glaubte, nicht richtig zu hören, und entzog Cron jäh ihre Hand.
»Nein!«, rief sie. »Nein, nicht schon wieder eine Tochter, ich habe genug Töchter geboren, ich möchte endlich einen Sohn haben, der die Erbfolge des Hauses Hohenzollern garantiert!«
»Ich bitte um Vergebung, Majestät, Sie haben doch einen Sohn und Thronfolger.«
»Ein Sohn ist zu wenig, die Erbfolge ist erst bei zwei Söhnen gesichert, der Kronprinz ist zwar gesund, aber sehr zart, ich weiß nicht, ob er eine schwere Krankheit überleben würde.«
Eine Tochter, dachte Sophie Dorothea und fächelte sich nervös Kühlung zu, eine Tochter… eine Tochter bedeutet, dachte sie, dass ich nach dem Wochenbett erneut Friedrich Wilhelms leidenschaftliche Umarmungen ertragen muss, ich verabscheue seine derben Zärtlichkeiten, ich hoffte, dass er nach der Geburt eines Sohnes mein Schlafgemach eine Weile nicht aufsuchen würde… mein Gott, wie viele Schwangerschaften und Wochenbetten stehen mir noch bevor?
Sie spürte, dass ihre Laune bei dem Gedanken an die künftigen Wochenbetten immer schlechter wurde, und legte den Fächer abrupt zur Seite. Cron wartete einen Augenblick und fragte dann vorsichtig: »Majestät, darf ich Ihnen noch weitere Fragen beantworten?«
»Nein, deuten Sie jetzt die Handlinien der Prinzessin Wilhelmine.«
Während der Schwede sich über die Handfläche des kleinen Mädchens beugte, wanderten Sophie Dorotheas Augen kritisch über das verblichene, abgetragene, dunkelblaue Samtkleid der Tochter, und sie ärgerte sich, dass ihre finanzielle Lage es nicht erlaubte, für die Kleine neue Roben schneidern zu lassen. Aber, dachte sie, meine Garderobe für den Sommeraufenthalt in Monbijou ist wichtiger, schließlich muss ich in meinem Lustschlösschen bei jedem gesellschaftlichen Ereignis angemessen gekleidet sein, ich benötige neue Kleider und dazu passende Accessoires für Bootsfahrten, Spaziergänge im Park, für Bälle und Konzerte. Wilhelmines Kleider werden verlängert, überlegte sie, und die Naht kann mit Spitzen, Rüschen oder Borten verdeckt werden. Sie betrachtete die aufgesteckten Locken, die mit einem dunkelblauen Samtband geschmückt waren, und ärgerte sich erneut. Ausgerechnet meine Tochter, dachte sie, besitzt nur diesen armseligen Kopfschmuck, nun, im Frühjahr und Sommer, muss die Leti dem Kind Blumen ins Haar flechten, die älteste Tochter des preußischen Königs trägt kein mit Edelsteinen verziertes Diadem, sondern eine Krone aus frischen Rosen, eine Rosenkrone mit Dornen, eine Dornenkrone…
Sie zuckte unmerklich zusammen, mon Dieu, wohin verirren sich meine Gedanken? In diesem Augenblick fiel ihr der Halsschmuck des Kindes auf, und sie spürte eine Woge von Wut, Enttäuschung und Verbitterung in sich aufsteigen und beherrschte sich nur mühsam. Sie betrachtete die einreihige Kette aus dunkelroten Steinen, die aussah wie Rubinschmuck, aber es ist kein Rubinschmuck, dachte sie, es ist rotgefärbtes Glas, Tand… und vor ihrem inneren Auge sah sie plötzlich den Gatten: er spazierte in Begleitung seines Kammerdieners Eversmann, wie ein gewöhnlicher Bürger am Nachmittag des Heiligen Abends, zwischen den Buden des Berliner Christmarktes umher und kaufte kleine Geschenke für seine Kinder, die rote Glaskette für Wilhelmine, eine neue Trommel für Friedrich und Süßigkeiten für die zweijährige Friederike Luise. Warum benimmt er sich nicht wie ein König, dachte sie empört, warum mischt er sich unter das gemeine Volk? An den ausländischen Höfen lacht man über ihn, ich schäme mich für ihn vor den ausländischen Gesandten. Mon Dieu, wie lange noch will der Schwede die Handlinien meiner Tochter studieren? Aber wahrscheinlich ist dies ein gutes Zeichen.
In diesem Augenblick sah Cron auf und sagte: »Königliche Hoheit, ich bitte um Vergebung, aber nun ja, es ist so, Ihr Leben wird von trügerischen Hoffnungen begleitet sein, und Sie werden viele Leiden erdulden müssen.«
Sophie Dorothea erschrak. Nein, dachte sie, das ist unmöglich, das darf nicht Wilhelmines Zukunft sein, wahrscheinlich prophezeit dieser Schwede nur Unsinn, er will sich wichtigmachen, ich werde bestimmt einen Sohn gebären, und meine Tochter wird die Königin des reichsten europäischen Landes werden und an einem glanzvollen Hof leben. Was sind trügerische Hoffnungen, fragte sich Wilhelmine, dann dachte sie an den Schluss der Vorhersage und sagte leise zu Cron: »Ich weiß, was es bedeutet zu leiden.«
Sie presste die Lippen aufeinander und unterdrückte mühsam die aufsteigenden Tränen. Friedrich spürte den Kummer der Schwester, sprang spontan auf, umarmte sie und wisperte: »Sei nicht traurig, Wilhelmine, ich bin doch bei dir, ich werde dir helfen.«
»Ich weiß, Fritzchen«, und sie strich ihm über die Locken.
Cron hüstelte: »Möchten Sie noch etwas wissen, Königliche Hoheit?«
»Nein, Monsieur.«
Nun beugte der Schwede sich über Friedrichs kleine, feingliedrige Hand, stutzte nach einer Weile, führte das Kind dann zu einem hohen Kerzenständer, studierte im vollen Licht erneut die Handlinien, dann sah er auf und sagte feierlich: »Königliche Hoheit, Sie werden in Ihrer Jugend viele Unannehmlichkeiten erdulden müssen, aber später, in reiferen Jahren, werden Sie einer der größten und bedeutendsten Fürsten Europas werden.«
Nach diesen Worten herrschte sekundenlang eine ehrfurchtsvolle Stille im Salon. Ich werde einmal König sein, dachte Friedrich, aber das weiß ich schon lange, und so sagte er zu Cron: »Vielen Dank, Monsieur«, und ging zurück zu Wilhelmine.
Die Schwester sah ihn liebevoll an und flüsterte: »Ich bin so glücklich, Fritzchen, du wirst einmal ein großer König werden.«
Sophie Dorothea strahlte und strich dem Sohn über die Locken: »Mon bijou, ich bin so stolz auf dich: einer der größten und bedeutendsten Fürsten Europas. Nun, es überrascht mich nicht weiter, schließlich bist du ein halber Welfe«, und zu dem Schweden: »Vielen Dank, Sie können jetzt gehen.«
3
Nach einer Weile unterhielten die Hofdamen sich auf Französisch über die glückliche Zukunft des Hauses Hohenzollern. Frau von Kamecke hörte zu, und als nun eine der Damen erneut sagte: »Der Kronprinz wird einer der größten und bedeutendsten Fürsten Europas«, sah sie sich erstaunt in der Runde um. Merkwürdig, dachte sie, der erste Teil der Prophezeiung wird von allen ignoriert, auch von der Königin.
In diesem Augenblick wurde die Ankunft des Königs gemeldet und die Damen schwiegen sofort, weil in der Gegenwart des Monarchen nur Deutsch gesprochen werden durfte.
Sie sahen unsicher zur Tür, weil sie nie wussten, ob er gut oder schlecht gelaunt war, nur Frau von Kamecke, die Königin und ihre Kinder blieben gelassen, sie fürchteten sich nicht vor dem König, Gatten und Vater.
Als Friedrich Wilhelm L, Kurfürst von Brandenburg, König in Preußen, den Salon betrat, atmeten die Damen erleichtert auf, weil seine großen, runden, etwas vorstehenden hellblauen Augen strahlten und lachten, er war also gut gelaunt.
Die Damen betrachteten den siebenundzwanzigjährigen mittelgroßen, kräftigen Fürsten, und eine sagte zu ihrer Nachbarin: »Ist er nicht ein gutaussehender Mann? Ich bewundere immer wieder sein volles, rundes Gesicht, die gerade Nase, und vor allem seine schlanken Hände und die weiße Haut.«
»Gewiss, aber seiner Kleidung fehlt die höfische Eleganz, sie ist für einen Fürsten zu schlicht, und seit einigen Wochen trägt er nur noch die Uniform seines Leibgarderegiments, mon Dieu, wir leben in einer Residenzstadt und nicht im Heerlager«, und ihre Augen glitten geringschätzig über die schlichte rote Uniform unter dem blauen Rock aus preußischem Tuch, wanderten zu den knappsitzenden roten Hosen, die in weißen Leinengamaschen steckten, und zu den breiten, bequemen schwarzen Schuhen.
»Seine Perücke ist auch zu schlicht, kein Lockengekräusel, nur ein kurzer Zopf, der auf den Rücken fällt.«
»Das ist doch die neue Haartracht à la Chinoise, fällt Ihnen nicht auf, dass er immer so frisch wirkt, wenn er den Salon betritt?«
»Frisch? Ich weiß nur, dass er nie Puder oder Parfüm benutzt, wie es sich für einen hochgestellten Herrn ziemt, und sehen Sie nur, wie er wieder bewaffnet ist: an der linken Seite baumelt der Offiziersdegen, in der rechten Hand trägt er seinen dicken Stock aus Buchenholz.« Friedrich Wilhelm ging bis zur Mitte des Salons und blieb dann stehen, weil die schwere Luft ihn anwiderte, am liebsten hätte er sich die Nase zugehalten, aber das war unhöflich, und so ging er zu den Damen, die im Hofknicks vor ihm zu Boden sanken.
»Meine Damen!«, rief er laut, und seine Stimme klang für die Ohren der Anwesenden etwas schnarrend. »Bitte keine überflüssigen Zeremonien, Sie wissen doch, dass ich diese Fisimatenten hasse, Sie sind nicht bei einem offiziellen Empfang, sondern im Salon meiner Frau und leisten ihr Gesellschaft. Ich wundere mich allerdings, dass Sie in diesem Mief atmen können.«
Er marschierte zu der Fensterreihe, riss einen Flügel nach dem anderen auf, blieb beim letzten Fenster stehen, atmete tief durch und genoss die klare Winterluft.
Einige Damen schrien leise auf, als eine Woge von eisiger Kälte in das Zimmer strömte. Sophie Dorothea zog ärgerlich den Umhang fester um sich und wollte den Gatten bitten, die Fenster wieder zu schließen, da stand ihre Oberhofmeisterin schon auf, trat zum König und sagte in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete: »Majestät, die kalte Luft ist nicht gut für die Gesundheit der Königin und für das ungeborene Kind.«
Friedrich Wilhelm zuckte zusammen und erwiderte: »Sie haben recht, liebe Frau von Kamecke, mein Gott, wie konnte ich es nur vergessen, das Kind…«
Er schloss eilig ein Fenster nach dem anderen bis auf das letzte im hinteren Teil des Raumes und ging zu seiner Gattin. Er nahm ihre rechte Hand, beugte sich darüber, streifte den Handrücken sanft mit seinen Lippen und fragte: »Wie fühlen Sie sich heute, liebe Frau?«
Frau von Kamecke horchte auf den weichen Klang in seiner Stimme, sie sah den zärtlichen Blick, der auf der Königin ruhte, dann betrachtete sie Sophie Dorothea.
Die Königin lächelte gezwungen und antwortete seufzend: »Mon Dieu, Sie stellen merkwürdige Fragen, wenige Wochen vor einer Niederkunft fühle ich mich immer schlecht, das Kind wird allmählich zur Last.«
Friedrich Wilhelm betrachtete nachdenklich den gewölbten Leib der Gattin, dann nahm er ihre Hände und sagte ernst und feierlich: »Liebe Frau, Kinder sind ein Geschenk Gottes, sie sind der Sinn und die Erfüllung einer Ehe, wenn ein Ehepaar viele Kinder hat, so ruht Gottes Segen auf diesem Bund.«
Er schwieg, streichelte ihre Hände und betete im Stillen: Mein Gott, ich danke dir, dass ich mit einer so wundervollen, fruchtbaren Frau verheiratet bin, von unseren sechs Kindern haben zwar nur drei die ersten Monate überlebt, aber die drei lebenden Kinder gedeihen, wir sind eine harmonische Familie, auch dafür danke ich dir, Gott. Er sah seine Gattin an und sagte leise: »Ich habe Sie aus Liebe geheiratet, und mit jedem Kind ist meine Zuneigung zu Ihnen tiefer und inniger geworden. Ich verstehe nicht, warum andere Fürsten sich Mätressen halten – Mätressenwirtschaft ist nicht nur ein teures Vergnügen, sondern auch ein schlechtes Beispiel für die Untertanen; ein Fürst muss immer ein Vorbild sein für die Menschen, deren Schicksal in seinen Händen liegt.
Liebe Frau, wir sind die Erste Familie des Landes, und dies verpflichtet uns, Vorbild zu sein, was unser Familienleben betrifft, also: eheliche Treue, viele Kinder und eine fromme Lebensführung ohne großen Aufwand. Bis jetzt waren wir ein Vorbild, und Sie haben entscheidend dazu beigetragen, dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen, und ich hoffe, dass unser Familienleben harmonisch bleibt.«
Ich hasse seine Grundsätze, dachte Sophie Dorothea gereizt, warum verabscheut er Mätressen, ein Hof ohne Mätressen ist kein richtiger Hof. Warum hat er nicht wenigsten eine einzige Geliebte? Er muss sich ja keinen Harem halten wie der sächsische Kurfürst, eine Mätresse würde bedeuten, dass ich mir einen Liebhaber nehmen kann, einen Mann, der mein Interesse für Literatur und Musik teilt, einen Mann, mit dem ich mich geistreich unterhalten kann. Ich leide unter seiner Sparsamkeit und hasse sie, aber ich muss meine Gefühle verbergen, um mir meine Privilegien zu sichern. Sie lächelte ihn an und sagte: »Sie haben recht, die königliche Familie muss ein Vorbild für die Untertanen sein.«
Friedrich Wilhelm strahlte und erwiderte: »Ich bin sehr glücklich, dass wir immer einer Meinung sind.« Gütiger Himmel, dachte Frau von Kamecke, während sie das Paar beobachtete, ob er jemals bemerkt, dass seine Zuneigung nicht erwidert wird, und wenn er es merkt, wie wird er reagieren?
Sophie Dorothea lächelte immer noch, und während sie sich Luft zufächelte, sagte sie zu ihrem Gatten: »Erzählen Sie mir, wie Sie den Nachmittag verbracht haben.«
»Da gibt es nicht viel zu erzählen, liebe Frau, das heißt, nein, davon später, also ich verbrachte den Nachmittag wie üblich, nach der Mittagstafel diktierte ich einige wichtige Briefe, dann spazierte ich durch das Viertel um die Nikolaikirche, beobachtete die Handwerker bei der Arbeit, hörte mir ihre Bitten und Beschwerden an, schlichtete einen Ehestreit, wobei der Mann meinen Stock zu spüren bekam, weil er nicht einsichtig war. Na, bei meiner Rückkehr erwartete mich eine wundervolle Überraschung, einhundertfünfzig Lange Kerls waren eingetroffen, hundert aus Russland, fünfzig aus Großbritannien und dem Kurfürstentum Hannover. Mein Freund, der Zar, hat sich mit seinem Geschenk selbst übertroffen, seine Russen sind alle sieben Fuß hoch, ich muss ihm natürlich eine Gegengabe schicken, darüber werde ich nachher mit Leopold sprechen. Bei den Briten ist ein Ire, der sieben Fuß misst, alle übrigen sind nur sechs Fuß hoch, aber ich habe mich richtig gefreut, dass ich Ihrem Bruder, dem Komödianten, einige kräftige Untertanen abjagen konnte, er wird sich höllisch ärgern, wenn er davon erfährt.«
Sophie Dorotheas Lächeln gefror, sie legte den Fächer zur Seite und sagte vorwurfsvoll: »Warum nennen Sie meinen Bruder, der Ihr Vetter und Schwager ist, immer einen Komödianten? Überdies wird nicht er sich ärgern, sondern mein Vater, der König von England.«
»Ich weiß nicht, warum ich meinen Vetter einen Komödianten nenne, Sie wissen, dass wir uns schon als Kinder nicht mochten. Mein Gott, ich werde nie vergessen, wie ich ihn in Hannover verprügelte!« Er lachte und fuhr gutgelaunt fort: »Unsere Großmutter, die Kurfürstin, war darüber so entsetzt, dass sie mich nach Berlin zurückschickte, obwohl ich ihr Lieblingsenkel war. – Nun, liebe Frau, ich bin gekommen, um zu hören, was der Schwede prophezeit hat.«
Sophie Dorothea seufzte: »Er hat mir prophezeit, dass ich eine Tochter zur Welt bringen werde, wieder nur eine Tochter, ach, es ist entsetzlich.«
»Liebe Frau, wichtig ist, dass Sie das Wochenbett überleben und dass unsere Tochter gesund bleibt und heranwächst. Vielleicht ist unser nächstes Kind ein Sohn – oder das übernächste; Gott hat uns die beiden ersten Söhne genommen, wahrscheinlich wollte er uns Demut lehren, ich habe seither versucht, ihm zu dienen, so gut ich konnte. Vielleicht schenkt er uns noch einen Sohn, vielleicht sogar mehrere Söhne – ich bitte ihn stets um ein ›Vierergespann‹.«
»Ein Vierergespann?«
»Ja, ich bitte Gott, dass unser Fritzchen noch drei Brüder bekommt, bei vier Söhnen ist die Thronfolge nach menschlichem Ermessen gesichert.«
Sophie Dorothea schwieg und bewegte langsam ihren Fächer hin und her. Gütiger Himmel, dachte sie, drei weitere Söhne, wie oft soll ich noch schwanger werden?
»Gott wird uns weitere Prinzen schenken, liebe Frau«, er beugte sich über ihre Hand und trat zu seiner Tochter.
»Mein liebes Kind, was hat der Schwede dir prophezeit?«
Ehe Wilhelmine antworten konnte, sagte Sophie Dorothea zu ihrem Gatten: »Haben Sie vergessen, was wir an Wilhelmines sechstem Geburtstag vereinbarten? Es war mein Wunsch, dass wir unsere älteste Tochter künftig mit ›Sie‹ anreden.«
»Liebe Frau, manchmal denke ich nicht daran«, er zögerte etwas und fuhr fort: »Die Anrede ›Sie‹ ist so förmlich, sie schafft eine Distanz zwischen Eltern und Kindern, die ich nicht mag.«
»Die Anrede ›Sie‹ ist vornehmer als das vertrauliche ›Du‹.«
Friedrich Wilhelm wandte sich erneut seiner Tochter zu: »Mein liebes Kind, was hat der Schwede Ihnen prophezeit?«
Wilhelmine sah zu Boden und antwortete leise: »Er hat gesagt, dass ich viele Leiden werde erdulden müssen, Papa.«
Friedrich Wilhelm betrachtete seine Älteste und dachte: Wie kann ich sie trösten? Die Prophezeiung des Schweden ist albern, zum Leben eines Menschen gehören Höhen und Tiefen, aber wie kann ich das einer Sechsjährigen erklären? Er hob das Gesicht der Tochter zu sich empor und sagte: »Mein Kind, das Leben eines jeden Menschen besteht aus Freude und Leid; ich bin Ihr Vater und werde alles tun, damit Sie möglichst wenig leiden und ein glückliches Leben führen. Ich werde Sie zur rechten Zeit mit einem frommen Fürsten verheiraten, der vor allem an das Wohl seiner Untertanen denkt. An der Seite eines pflichtbewussten Fürsten werden Sie glücklich werden.«
Was bedeutet dies, überlegte das Kind, was ist ein frommer, pflichtbewusster Fürst? Nun, Papa meint es gut mit mir – und sie atmete erleichtert auf.
»Ich danke Ihnen, Papa, Sie sind zu gütig.«
Ein frommer, pflichtbewusster Fürst, dachte Sophie Dorothea entsetzt, schmiedet er Heiratspläne, die meine Pläne durchkreuzen?
Friedrich Wilhelm beugte sich zu dem Kronprinzen hinunter und strich ihm über die Locken.
»Nun, Fritzchen, deine Zukunft ist sehr wichtig, was hat der Schwede zu dir gesagt?«
Ehe Friedrich antworten konnte, rief Sophie Dorothea: »Cron hat prophezeit, dass unser Sohn dereinst der größte und bedeutendste Fürst Europas sein wird!«
Der König sah die Gattin überrascht an, betrachtete nachdenklich den Kronprinzen, dann hob er ihn plötzlich hoch und wirbelte ihn durch die Luft.
»Ich werde ihn zu einem soldatischen, frommen, pflichtbewussten und sparsamen König erziehen lassen!«, rief er mit strahlenden Augen. »Diese Erziehung wird ihn zu einem großen Fürsten formen, ein großer Fürst denkt immer zuerst an das Wohl des Staates, ein großer Fürst ist immer der Erste Diener seines Staates!«
Sophie Dorothea zuckte zusammen. Mon Dieu, dachte sie, er will den Sohn zu seinem Ebenbild formen, aus Friedrich soll ein zweiter Friedrich Wilhelm werden, dies bedeutet, dass der preußische Hof auch unter dem künftigen Friedrich II. sparsam, glanzlos und unkultiviert vor sich hin vegetiert. In Dresden, Wien und vor allem in London wird man auch künftig über den Berliner Hof spötteln und die Nase rümpfen. Nein, das muss verhindert werden, der künftige König in Preußen muss ein gebildeter, kultivierter Herrscher sein, dessen geistiger Horizont über Landwirtschaft und Soldaten hinausreicht. Ich werde versuchen, Friedrichs Erziehung zu beeinflussen, so weit es möglich ist.
»Nun, Fritzchen«, sagte der König, »wollen wir zusammen Ball spielen?«
»Ja, Papa, sehr gerne, Papa.«
Sophie Dorotheas Augen wanderten zwischen Vater und Sohn hin und her. Soll ich ihn bitten, Fritz mir zu überlassen, damit er endlich englische Lebensgewohnheiten kennenlernt? Aber mein Mann mag die englischen Verwandten nicht besonders, es ist vielleicht diplomatischer, wenn ich das Fritzchen heute seinem Vater überlasse.
Der König nahm die Hand des Kronprinzen und wollte das Zimmer verlassen, als ihm noch etwas einfiel: »Liebe Frau, ich werde heute nicht an der Tafel anwesend sein, sondern den Abend im Tabakskollegium verbringen, wegen der Friedensverhandlungen habe ich fast eine Woche auf dieses Vergnügen verzichtet.«
Die Königin atmete auf. Gott sei Dank, dachte sie, endlich ein Abend, an dem ich nicht hören muss, wie viel Land im Oderbruch bereits urbar gemacht wurde, welche Krondomäne wie viele Taler erwirtschaftet und dass die Erweiterung Potsdams die ökonomische Entwicklung des Landes beschleunigt und ein großes Plus einbringt.
Mon Dieu, manchmal kann ich das Wort ›Plus‹ nicht mehr hören.
Friedrich Wilhelms Gedanken kreisen nur um dieses Wort, kein Wunder, dass das Volk ihn den ›Plusmacher‹ nennt. Nun, an der heutigen Abendtafel wird nicht über ›Plus‹ geredet, wir werden uns über französische Literatur unterhalten und über die geplanten Verschönerungen in Monbijou. Nach dem Kaffee verbringen wir den Abend am Spieltisch, und neben den Goldmünzen müssen keine Kaffeebohnen liegen; wenn er in der Tabagie ist, wird er nicht unverhofft auftauchen. Gott sei gedankt, dass Damen an dieser vulgären Tabagie nicht teilnehmen dürfen, aber sie gehört zu seinem Leben, es ist wohl angebracht, dass ich Interesse und Anteilnahme heuchle.
Sie lächelte den Gatten an und fragte: »Werden Sie wieder Fische braten, um die Herren für Ihre mehrtägige Abwesenheit zu entschädigen?«
»Nein, meine Abwesenheit ist kein Grund, um aufwendig zu speisen, es muss gespart werden. Während der nächsten Wochen werden weder kalter Braten noch Schinken serviert, sondern eine preußische Delikatesse: Tilsiter Käse. Die Holländerin auf der Domäne versteht ihr Handwerk, es ist der würzigste Käse, den ich je gegessen habe, viel besser als die teure Importware aus Frankreich, für die mein seliger Vater einst Unsummen ausgab. Die Domäne hat vor Weihnachten eine Menge geliefert, die bis zum Sommer reichen wird, und während der vergangenen Wochen konnte der Käse noch richtig reifen, er entfaltet erst jetzt seinen Duft und ist zu einer wahrhaften einheimischen Delikatesse geworden.«
Sophie Dorothea betrachtete die genießerische Miene des Gatten und erinnerte sich wehmütig an die feinen französischen Käse, die am väterlichen Hof serviert wurden. Dort gab es sahnigen Brie, milden Camembert und würzigen Roquefort.
Dieser gelbe Käse aus Tilsit ist widerlich, mon Dieu, wenn ich daran denke, dass dieser starke Käsegeruch sich mit dem Bierdunst und dem Tabaksqualm vermischt, wird mir übel. Diese Tabagie ist dégoûtant, die ausländischen Gesandten berichten ihren Fürsten natürlich über diese unkultivierte abendliche Männerrunde, und in London wird man wahrscheinlich über dieses Freizeitvergnügen meines Gatten spötteln.
Sie zwang sich zu einem Lächeln und sagte: »Ich wünsche Ihnen einen erholsamen, vergnüglichen Abend.«
»Ich wünsche Ihnen ebenfalls einen schönen Abend und viel Glück am Spieltisch.«
»Mon Dieu«, und sie bewegte nervös den Fächer hin und her, »es ist doch gleichgültig, ob ich gewinne oder verliere. Sie wissen doch, dass wir nicht um Geld, sondern um Kaffeebohnen spielen.«
»Ich weiß, liebe Frau, entschuldigen Sie mich bitte.«
Kaffeebohnen, dachte er, während er mit Friedrich und der Gouvernante hinausging. Kaffeebohnen, ich spüre, dass in ihrem Salon trotz meines Verbotes nach wie vor um Geld gespielt wird, wie zu Lebzeiten meines seligen Vaters, aber ich kann es nicht beweisen, wenn ich am Abend einmal unangemeldet ihren Salon aufsuche, liegen stets Kaffeebohnen neben den Karten und keine Goldmünzen.
Sophie Dorothea sah dem Gatten nach und dachte, dass seine Abwesenheit von der Abendtafel eine günstige Gelegenheit war, etwas delikater zu speisen als gewöhnlich. Am Mittag, überlegte sie, wurden Grünkohl mit geräuchertem Schweinebauch, Erbsen mit Speck, gekochtes Eisbein und Bratwürste serviert. Da niemand, außer meinem Mann, diese derben Speisen mag, ist viel übriggeblieben, und die Reste werden aufgewärmt und am Abend erneut serviert. Ich habe keine Lust, aufgewärmten Grünkohl zu essen, und weil mein Sohn ein bedeutender Herrscher wird, sollten wir heute delikat speisen.
»Meine Damen, Sie haben gehört, dass in der Tabagie preußische Delikatessen serviert werden, nun, wir werden heute Abend englische Delikatessen genießen.«
Sie ließ den Küchenmeister holen und sagte: »Verwende Er die Reste der Mittagstafel, wie es Ihm gut dünkt, Er besitzt einige englische Rezepte, bereite Er also für den Abend eine Fischpastete vor, ferner ein englisch gebratenes Roastbeef, dazu Rotkohl, dieses Gemüse ist feiner als Weißkohl, und als Dessert…«
Mon Dieu, ich bin heißhungrig auf Marzipankonfekt, Eiercreme und Torten, aber ich will den Bogen nicht überspannen …
»Er kann den trockenen Hefekuchen servieren, aber mit Butter und Konfitüre, so ist er einigermaßen genießbar, und der Kellermeister soll nicht nur Rheinwein hochschicken, sondern auch Tokaier.«
Der Küchenmeister glaubte, nicht richtig zu hören, verbeugte sich während der Befehle und erwiderte vorsichtig: »Majestät, mein Budget ist begrenzt, ich weiß nicht, wie ich bis zum Monatsende…«
»Das ist Seine Angelegenheit«, erwiderte Sophie Dorothea. »Er hat meine Befehle gehört und kann gehen.«
Gütiger Himmel, dachte Frau von Kamecke, wenn der König wüsste, dass wir in der Mitte des Monats Roastbeef essen und teuren Tokaier trinken – ab der Monatsmitte werden doch nur noch Innereien und Würste serviert!
Er wird von unserer teuren Tafel erfahren, dachte Sophie Dorothea, aber da ich ihn gewöhnlich erst am Mittag sehe, wird seine erste Wut verraucht sein. Und wenn er mir eine Szene macht und Verschwendungssucht vorwirft – nun ja, ich habe mich an diese Szenen gewöhnt, und bis jetzt hat er mich am Schluss einer solchen Szene noch immer um Verzeihung gebeten, ich weiß, dass er mich liebt, und ich weiß, was ich ihm zumuten kann.
4
Als Madame de Roucoulles im Vorraum den Zobelpelz um Friedrich legen wollte, sagte der König: »Ich sehe es zwar gern, wenn mein Sohn ein Geschenk meines Freundes, des russischen Zaren, trägt, trotzdem, meine liebe Roucoulles, kein Pelz, das Fritzchen muss abgehärtet werden.«
»Mit Verlaub, Majestät, wollen Sie, dass der Prinz sich verkühlt?«
»Nein«, brummte Friedrich Wilhelm, »Sie untergraben meine Erziehungsmethoden, liebe Roucoulles.«
Im Arbeitszimmer nahm Friedrich Wilhelm den mittelgroßen Lederball, der in einem Korb neben dem Kamin lag, und sagte zu seinem Sohn: »Du bist jetzt vier Jahre alt, Fritzchen, es ist an der Zeit, dass ich dir den Ball aus einer größeren Entfernung zuwerfe. Versuche, ihn zu fangen, wenn es nicht klappt, so ist es nicht schlimm, es ist eine Sache der Übung, bei meinen Soldaten dauert es auch einige Wochen, bis sie einexerziert sind und den Gleichschritt und das Laden der Musketen mit dem eisernen Ladestock beherrschen.«
Er warf ihm den Ball zu, und Friedrich schrie vor Vergnügen, als es ihm gelang, ihn beim dritten Mal zu fangen.
»Hervorragend!«, rief der König. »Man kann Anforderungen nicht hoch genug ansetzen, merke dir, mein Sohn, nur hohe Anforderungen erbringen hohe Leistungen.«
Friedrich fragte sich, was der Vater damit meinte, aber da ihm weitere Bälle zugespielt wurden, die er mühelos auffing, vergaß er die Bemerkung des Vaters.
Einige Minuten später meldete ein Diener die Ankunft von Monsieur Duhan de Jandun. Friedrich Wilhelm sah auf: »Duhan ist rascher genesen, als es zunächst schien!«, rief er. »Er soll eintreten«, und er warf dem Sohn den Ball zu. Friedrich warf den Ball zurück, und im gleichen Augenblick betrat ein mittelgroßer, schlanker junger Mann von ungefähr dreißig Jahren das Zimmer und betrachtete erstaunt das Spiel zwischen Vater und Sohn.
Friedrich Wilhelm ging zu dem Besucher, drückte herzlich dessen rechte Hand und sagte: »Willkommen am Hof, Monsieur Duhan. Sie wundern sich, dass ich mit meinem Sohn spiele, nun, Väter müssen mit ihren Kindern zuweilen Kinder sein, müssen mit ihnen spielen und ihnen die Zeit vertreiben.«
»Gewiss, Majestät.«
Friedrich trat einen Schritt vor, betrachtete die schlichte schwarze Kleidung des Mannes und sah, dass die dunklen Haare sorgfältig zurückgekämmt und zu einem Zopf geflochten waren.
»Es ist gut, dass Sie jetzt gekommen sind«, sagte Friedrich Wilhelm, »so lernen Sie ohne überflüssige Zeremonien meinen Sohn kennen. Komm, Fritzchen, der Herr ist Monsieur Duhan de Jandun, er wird dich von jetzt an bis zu deinem fünfzehnten Lebensjahr unterrichten.
Monsieur Duhan ist Hugenotte, seine Familie verließ Frankreich anno 87 und kam nach Berlin. Bei der Belagerung Stralsunds zeichnete er sich durch Tapferkeit aus, und ich beschloss damals, dass er dein Lehrer sein soll. Es gibt keinen besseren Lehrer für dich als einen tapferen Soldaten. Offiziell ist er bereits seit dem 31. Januar dein Informator, aber eine fiebrige Erkältung hinderte ihn daran, dich in die Rechenkunst einzuführen.«
Friedrich betrachtete das offene, freundliche Gesicht des Hugenotten, ging plötzlich auf ihn zu, strahlte ihn an und sagte: »Guten Tag, Monsieur, Sie gefallen mir.«
Der Franzose verbeugte sich: »Königliche Hoheit, es ist eine große Ehre für mich, dass ich den künftigen preußischen König unterrichten darf.«
Dann ließ er die großen blauen Augen des Kindes auf sich wirken: Der Kleine scheint aufgeweckt zu sein, aber in den Augen spiegelt sich eine gewisse Verträumtheit, eine reizvolle Mischung, dachte er und sagte spontan: »Königliche Hoheit, ich werde Sie gerne unterrichten, ich werde Sie in die antike und in die französische Dichtkunst einführen, wir werden zusammen Ciceros Reden lesen und darüber disputieren. Ich werde Sie mit der mythologischen Welt der alten Griechen vertraut machen, ich werde alles tun, damit Sie sich zu einem fähigen Fürsten entwickeln.«
Friedrich Wilhelm musterte den Franzosen und sagte bedächtig: »Ich freue mich, dass wir das gleiche Ziel verfolgen, aber ein fähiger Fürst muss vor allem die praktischen Dinge des Lebens lernen. Er muss die Rechenkunst beherrschen; können Sie morgen mit dem Unterricht beginnen?«
»Ja, Majestät.«
»Sehr gut, ich werde Ihnen jetzt meinen Erziehungsplan erläutern. Das Fritzchen hat bis jetzt in den Tag hineingelebt und gespielt, das ist völlig in Ordnung während der ersten drei Lebensjahre. Seit einem Jahr wird er von seiner Gouvernante in der Religion unterrichtet, sie erzählt ihm biblische Geschichten und lehrt ihn fromme Lieder und Gebete. Am 24. Januar ist mein Sohn vier Jahre alt geworden, und ich denke, er ist jetzt verständig genug, um allmählich zu lernen, dass die Wochentage eingeteilt sind in Arbeit und Muße, die Sonn- und Feiertage in Gebet, Gottesdienst und Muße. Ich möchte dem Fritzchen den Schock ersparen, wenn er in drei Jahren zwei Gouverneure bekommt, die ihn bis zum sechzehnten oder siebzehnten Lebensjahr erziehen. In drei Jahren wird sein Tag nicht mehr nach Stunden eingeteilt, sondern nach Minuten! Er soll sich ab jetzt langsam an einen geregelten Tagesablauf mit Arbeit und Freizeit gewöhnen. Ab morgen wird er täglich um halb acht Uhr geweckt, bis acht Uhr müssen Morgengebet, Waschen, Ankleiden und Frühstück erledigt sein. Punkt acht Uhr beginnt seine Erzieherin mit dem Religionsunterricht, von neun bis halb zehn Uhr kann er spielen, dann beginnen Sie mit dem Unterricht, um halb elf Uhr gibt es eine Pause von fünfzehn Minuten, dann folgt eine weitere Stunde Unterricht bis Viertel vor zwölf, eine Viertelstunde genügt, um das Fritzchen für die Mittagstafel zu säubern. Ich erwarte Sie und meinen Sohn um Punkt zwölf Uhr im Speisesaal. Am Nachmittag kann das Fritzchen spielen wie bisher.«
Friedrich Wilhelm ging zum Schreibtisch, entnahm einer Schublade einen Bogen Papier und reichte ihn Duhan.
»Ich habe einen Stundenplan aufgestellt, in welchen Gebieten Sie meinen Sohn wie lange unterrichten sollen. Von Montag bis Freitag werden Sie das Fritzchen in der ersten Stunde die Rechenkunst lehren, nach der Pause unterweisen Sie ihn eine halbe Stunde lang im Lesen und Schreiben und nicht nur in der französischen, sondern auch in der deutschen Sprache. Ich lege Wert darauf, dass mein Sohn die deutsche Sprache richtig beherrscht, und Sie sprechen Deutsch so gut wie Französisch, nicht wahr?«
»Ja, Majestät.«
»Mein Sohn und ich, wir haben zuerst Französisch gelernt, weil Madame de Roucoulles nur diese Sprache beherrscht und an den deutschen Fürstenhöfen nur Französisch gesprochen wird. Mein Sohn und ich, wir haben die deutsche Sprache nur von der Dienerschaft gelernt, das ist schlimm, ich bin ein deutscher Fürst und lebe in Deutschland, nicht in Frankreich, die deutschen Fürsten sollten Deutsch sprechen und nicht Französisch.
Nach dem Sprachunterricht unterweisen Sie ihn eine halbe Stunde in Geographie und der Geschichte der letzten hundert Jahre. Ich überlasse es Ihnen, an welchen Tagen Sie Geographie oder Geschichte unterrichten.
Am Sonnabend repetieren Sie mit dem Fritzchen den Lernstoff der Woche, danach sind Sie beurlaubt bis zum Montag. Sie dürfen während des Unterrichts zusätzlich zu der größeren Pause zwei kleine Pausen einlegen, aber jede darf nur fünf Minuten dauern.«
Gütiger Himmel, dachte Duhan entsetzt, das ist kein Unterrichtsplan, sondern ein militärisches Reglement, ich werde die Pausen verlängern, wenn es notwendig ist.
Friedrich bekam Herzklopfen, als er hörte, dass er nun lesen und schreiben lernen würde. Lesen…
»Lesen«, sagte er leise, ging spontan zu seinem Vater und schmiegte sich an ihn.
»Papa«, rief er, »ich bin so glücklich, dass ich endlich lesen lerne! Jetzt entscheide ich, welche Geschichte ich lese, wie oft ich sie lese, jetzt muss ich Madame de Roucoulles oder Wilhelmine nicht mehr bitten, dass sie mir vorlesen.«
Friedrich Wilhelm betrachtete überrascht die blauen Kinderaugen, die ihn anstrahlten, und strich dem Sohn über das Haar.
»Ich wusste nicht, dass dir so viel daran liegt, lesen zu lernen, das ist gewiss löblich, mein Sohn, aber vergiss das Rechnen nicht, das ist noch wichtiger als Lesen«, und zu Duhan: »Ich lege Wert darauf, dass mein Fritzchen flink die Rechenkunst erlernt, ein Fürst muss gut und rasch rechnen können, das ist die Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes, für volle Staatskassen, für das Wohlergehen seiner Untertanen. Die Beherrschung der Zinsrechnung ist besonders wichtig, ein Fürst muss sofort berechnen können, wie viele Zinsen ein Projekt abwirft, ob er dabei für den Staat ein Plus erwirtschaftet, haben Sie mich verstanden?«
»Gewiss, Majestät.«
Was meint Papa mit Rechenkunst, überlegte Friedrich. Wilhelmine kann rechnen, dachte er, und vor seinem inneren Auge sah er sie an ihrem Schreibtisch sitzen: Sie leerte ihre Geldbörse, zählte Pfennige und Groschen, dann schrieb sie etwas in ein Heft und sagte seufzend: »Hoffentlich reicht das Geld, das Mama mir gegeben hat, bis zum Sonntag.«
»Was hast du eben geschrieben?«
»Ich notiere regelmäßig meine Ausgaben, um zu wissen, wie viel Geld ich noch habe, außerdem kontrolliert Mama einmal im Monat, ob ich mein Ausgabenbuch sorgfältig führe, Mama führt auch ein Ausgabenbuch.«
»Ich finde es langweilig, Pfennige zu zählen.«
»Es ist notwendig, Fritzchen.«
Wilhelmines Gestalt verschwand, und er flüsterte: »Rechnen«, dann sah er zu seinem Vater hoch und sagte ernst: »Ich werde versuchen, die Rechenkunst zu erlernen, das verspreche ich Ihnen, Papa.«
Friedrich Wilhelm beugte sich zu dem Kind hinunter, küsste den Kleinen auf Stirn, Wangen und Mund und rief: »So gefällst du mir, Fritzchen!«
Als Duhan gegangen war, hob Friedrich Wilhelm das Gesicht seines Sohnes zu sich empor und sagte: »Du musst Monsieur Duhan ebenso gehorchen wie deiner Erzieherin, der Mama oder mir. Gehorsam ist wichtig für einen künftigen König; nur wenn du lernst, zu gehorchen, wirst du eines Tages auch befehlen können, hast du mich verstanden?«
»Ja, Papa.«
»Für heute haben wir genug gespielt, Fritzchen, die Pflicht ruft, ich muss jetzt wieder dem König in Preußen dienen.«
Friedrich sah den Vater erstaunt an: »Warum müssen Sie dem König dienen? Sie sind doch der König.«
Friedrich Wilhelm betrachtete seinen Sohn eine Weile und erwiderte: »Ich will versuchen, dir meine Auffassung von den Pflichten eines Fürsten zu erklären: Ich bin König von Gottes Gnaden, Fritzchen, und Gott erwartet, dass ich dieses Amt zum Wohle meiner Untertanen ausübe. Dies ist nur möglich, wenn ich mich als Diener des Königs betrachte, ich stehe im Dienst des Königs in Preußen, und nur, wenn ich die damit verbundenen Pflichten erfülle, werde ich nach meinem Tod mit gutem Gewissen vor Gott treten können; Gott wird mich zur Rechenschaft ziehen über mein irdisches Leben.« Auf dem Weg zu seinem Appartement dachte Friedrich über die Worte des Vaters nach. Warum ist ein König gleichzeitig Diener? Madame de Roucoulles kann es mir bestimmt erklären.
5
Friedrich Wilhelm zog weißleinene Ärmelschoner an, band sich eine saubere Schürze aus weißem Leinen um, die den Uniformrock vor Tintenspritzern schützen sollte, und begann, die Akten auf dem Schreibtisch zu studieren.
Er nahm den Speiseplan des Küchenmeisters für den folgenden Tag und überprüfte die einzelnen Posten.
»Wie bitte«, brummte er, »eine Zitrone kostet neun Pfennige? Unsinn, die Marktweiber sagen, der Tagespreis beträgt acht Pfennige, auch das ist zu teuer, ein guter Küchenmeister muss ohne Zitronen auskommen«, und er strich den Posten.
»Ah«, murmelte er zufrieden, »morgen an der Mittagstafel werden Hammelkaldaunen mit Weißkohl serviert«, und er schloss genießerisch die Augen.
»Gesottene Hammelkaldaunen sind eine Delikatesse«, und er amüsierte sich, als vor seinem inneren Auge die indignierten Gesichter der Familie und der Hofleute auftauchten, wenn dieses Gericht serviert würde: »Sie werden die Kaldaunen mit gezierten Bewegungen auf dem Teller hin- und herschieben«, sagte er halblaut, »aber das interessiert mich nicht, die Kaldaunen sind nicht nur delikat, sondern auch billig.«
Er öffnete die Augen, las, welche Summe der Küchenmeister dafür ansetzte, und erstarrte: »Drei Taler!«, rief er. »Drei Taler?«
Er schlug mit der Faust auf den Tisch, sprang auf und lief erregt auf und ab.
»Drei Taler!«, schrie er und befahl den Küchenmeister zu sich.
»Ist Er verrückt geworden?«, brüllte Friedrich Wilhelm und hielt dem zitternden Koch das Blatt Papier unter die Augen.
»Will Er seinen König übervorteilen? Will Er mich für dumm verkaufen? Hammelkaldaunen mit Weißkohl kosten keine drei Taler! Nun, was sagt Er dazu?«
»Ich bitte um Vergebung, Majestät, ich würde es nie wagen, Eure Majestät zu übervorteilen, aber der Preis für dieses Gericht beträgt drei Taler.«
»Nein!«, brüllte Friedrich Wilhelm, und der Küchenmeister beobachtete ängstlich, wie das Gesicht des Königs rot wurde vor Wut und sich zwischen den Augenbrauen eine Zornesfalte bildete.
»Dieses Essen kostet nur eineinhalb Groschen, ich habe es mir von dem Gärtner, bei dem ich vor einigen Tagen das Gericht zum ersten Mal aß, vorrechnen lassen. Wie oft habe ich Ihm gesagt, Er soll sich bei verschiedenen Marktweibern und Metzgern nach dem Tagespreis erkundigen und die Preise vergleichen?«
»Ich bitte um Vergebung, Majestät, ich habe mich bei zwei Gemüsehändlerinnen und zwei Metzgern nach den Preisen erkundigt.«