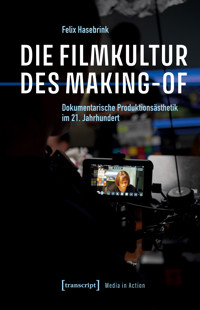
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Media in Action
- Sprache: Deutsch
Filmen sieht man nicht vollständig an, wie sie gemacht wurden. Einblicke in ihre Herstellung liefern jedoch andere Filme: Making-ofs, Filme über Filmproduktion, die sich bis ins frühe Kino zurückverfolgen lassen. Making-ofs breiten sich in der post-kinematografischen Medienkultur des frühen 21. Jahrhunderts explosionsartig aus. Felix Hasebrink analysiert ihre Formen und Verbreitungswege in unterschiedlichen Kontexten: Dokumentarfilm, Home Video, Social Media und Festivalkino. In dieser Perspektive sind Making-ofs weitaus mehr als filmindustrielles Marketing – sie machen darauf aufmerksam, wie das Medium Film heute seine eigenen Produktionsbedingungen ästhetisch bearbeitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Open Library Community Medienwissenschaft 2023 ist ein Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken zur Förderung von Open Access in den Sozial- und Geisteswissenschaften:
Vollsponsoren: Technische Universität Berlin / Universitätsbibliothek | Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin | Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz | Universitätsbibliothek Bielefeld | Universitätsbibliothek Bochum | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | Technische Universität Braunschweig / Universitätsbibliothek | Universitätsbibliothek Chemnitz | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | Sächsische Landesbibliothek, Staatsund Universitätsbibliothek Dresden (SLUB Dresden) | Universitätsbibliothek Duisburg- Essen | Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf | Goethe-Universität Frankfurt am Main / Universitätsbibliothek | Universitätsbibliothek Freiberg | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Universitätsbibliothek | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen | Universitätsbibliothek der FernUniversität in Hagen | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek | Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover | Universitätsbibliothek Kassel | Universität zu Köln, Universitäts- und Stadtbibliothek | Universitätsbibliothek Leipzig | Universitätsbibliothek Mainz | Universitätsbibliothek Mannheim | Universitätsbibliothek Marburg | Ludwig-Maximilians-Universität München / Universitätsbibliothek | FH Münster | Universitäts- und Landesbibiliothek Münster | Bibliotheks- und Informationssystem (BIS) der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Universitätsbibliothek Passau | Universitätsbibliothek Siegen | Universitätsbibliothek Vechta | Universitätsbibliothek der Bauhaus- Universität Weimar | Zentralbibliothek Zürich | Zürcher Hochschule der KünsteSponsoring Light: Universität der Künste Berlin, Universitätsbibliothek | Freie Universität Berlin |Bibliothek der Hochschule Bielefeld |Hochschule für Bildende Künste Braunschweig |Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Bibliothek | Hochschule Hannover - Bibliothek | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | Hochschule Mittweida, Hochschulbibliothek | Landesbibliothek Oldenburg | Akademie der bildenden Künste Wien, Universitätsbibliothek | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | ZHAW Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hochschulbibliothek | Westsächsische Hochschule Zwickau | Hochschule Zittau/Görlitz, HochschulbibliothekMikrosponsoring: Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden | Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) e.V. | Technische Universität Dortmund | Evangelische Hochschule Dresden | Hochschule für Bildende Künste Dresden | Hochschule für Musik Carl Maria Weber Dresden, Bibliothek | Palucca Hochschule für Tanz Dresden – Bibliothek | Filmmuseum Düsseldorf | Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt | Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg | Berufsakademie Sachsen | Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater Hamburg | Hochschule Hamm-Lippstadt | Hochschule Fresenius | ZKM Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe | Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, Bibliothek | Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf - Universitätsbibliothek | Universitätsbibliothek Regensburg | Bibliothek der Hochschule Rhein-Waal | FHWS Hochschule Würzburg-Schweinfurt
Felix Hasebrink
Die Filmkultur des Making-of
Dokumentarische Produktionsästhetik im 21. Jahrhundert
Eine erste Fassung der vorliegenden Arbeit wurde im Mai 2023 als Dissertation an der Fakultät für Philologie der Ruhr-Universität Bochum angenommen und am 14. Juli 2023 verteidigt.
Gutachter: Prof. Dr. Oliver Fahle, Prof. Dr. Simon Rothöhler
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz (BY). Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.
Erschienen 2024 im transcript Verlag, Bielefeld
© Felix Hasebrink
Umschlagkonzept: Maria Arndt, Bielefeld
Umschlagabbildung: Sören Meffert
Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar
https://doi.org/10.14361/9783839471302
Print-ISBN: 978-3-8376-7130-8
PDF-ISBN: 978-3-8394-7130-2
EPUB-ISBN: 978-3-7328-7130-8
Buchreihen-ISSN: 2749-9960
Buchreihen-eISSN: 2749-9979
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff.
»…for a film takes place wholly behind the scenes.«Stanley Cavell: The World Viewed
»It may be possible to imagine the existence of a moving image as it goes through the process of being created.«Paolo Cherchi Usai: The Death of Cinema
»It’s more important to show how we make the show than to actually make it.«Frankie Muniz in Arrested Development (S03E5)
Inhalt
Einleitung
Konjunktur des Making-of
Zum Begriff (Film)Produktion
Dokumentarische Produktionsästhetik
1. Produktion als Außen
Gerahmte Bewegtbilder
Produktionsgerät ausklammern
Hors-cadre des Raums
Making-of – erste Annäherung
Hors-cadre der Zeit
Making-of – zweite Annäherung
Produktion dokumentieren
Das hors-cadre anderer Filme zeigen
2. Produktion als Rückseite
DVD- und Blu-ray-Making-ofs: Grundformen
Making-ofs vor der DVD
Produktion kommentieren
Blicke hinter die Kulissen
Produktionsansichten vernähen
Exkurs 1: Making-of, ca. 1950–1960
Postproduktion
Pre-Production
Making-ofs nach der DVD
Zersetzung und Absicherung
3. Produktion als Intervention
Un/angemessene Produktionsränder
Exkurs 2: Making-of, 1971
Hors-cadre-Taktik
Mockumentary und Making-of
Faking-of-Epistemologie
Einmischungen, behind the scenes
Go, digital, go!
4. Produktion als Performance
Making-of online
Schweres Gerät
Exkurs 3: Making-of, ca. 1985
Bilder zerlegen
#betweenthelines
Dabeisein und mitfilmen
Das Außen der Desktop Documentary
Performing Production
5. Produktion als Nicht-Film
Ceci n’est pas un film
Making-of und acinéma
Exkurs 4: Making-of, 1968
Kamerapersonen
Footage-Arbeit
Slow Production
Pause machen
Schattenfilme
Schlussbetrachtungen
Warum jetzt?
Making-of-Installationen
Inside the Scenes
Epilog und Dank
Quellenverzeichnis
Literatur
Audiovisuelle Quellen
Abbildungsverzeichnis
Einleitung
Paris, im Winter 1907. Die frontale, schwarzweiße Filmaufnahme zeigt einen hohen, hallenartigen Raum. In der Mitte steht eine Gruppe höfisch kostümierter Tänzer*innen. Hinter ihnen ist, schemenhaft, ein Saal im Renaissancestil zu erkennen. Der Saal hat aber keinen Boden – offenbar handelt es sich um eine flache Kulisse. Linkerhand ist ein großer Lichtmast aufgebaut. Qualmende Scheinwerferbatterien strahlen die kostümierte Gruppe an. Die Kamera schwenkt langsam nach rechts, bis ein zweiter, baugleicher Lichtmast ins Bild kommt.
Vor dem Kulissenaufbau herrscht rege Betriebsamkeit. Ein Mann, der seine Augen vor dem gleißenden Licht mit einer schwarzgetönten Brille schützt, läuft geschäftig zwischen den Personen hin und her, verrückt einzelne Paare um wenige Zentimeter, ruft Mitarbeiter*innen Anweisungen zu. Ein zweiter Mann bedient eine klobige, dunkle Box auf einem Stativ. Daneben wird ein zweites Stativ mit einer Fotokamera aufgebaut. Ein Fotograf tritt an den Apparat, hüllt sich in eine schwarze Decke und schießt einige Aufnahmen. Rechts, beim zweiten Lichtmast, nimmt eine Frau Aufstellung. Neben ihr befindet sich ein Gerät mit zwei Schalltrichtern. Die Frau spricht mit dem sonnenbebrillten Mann, der nun einige Einstellungen an dem klobigen Kasten weiter links vornimmt. Als beide Geräte fertig kalibriert scheinen, betätigt die Frau einen Schalter unterhalb der Trichter. Die Personen vor der Saalkulisse beginnen, einen höfischen Tanz aufzuführen.
Der kurze Film, der nur aus der eben beschriebenen Einstellung besteht, trägt den Titel ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNEDANSLESSTUDIOSDE BUTTES-CHAUMONT*1. Er zeigt die Dreharbeiten einer phonoscène, die das Gaumont-Studio als Serie von kurzen Tonfilmen zwischen 1902 und 1917 produzierte (Altman 2004, S. 158–166). Der Kasten mit den beiden Trichtern ist das von Léon Gaumont patentierte Chronophone, das die Synchronisierung einer Phonographen-Walze mit einem Kinematografen erlaubte. Die derart modifizierte Filmkamera ist der verkabelte, schwere Apparat neben dem linken Lichtmast. Alice Guy ist höchstwahrscheinlich die Frau, die rechts neben dem Chronophone steht und das Gerät bei Aufnahmebeginn einschaltet (Abb. 1).
Was Guy hier in Szene setzt, geht aus dem Kurzfilm nicht hervor. Alison McMahan (2002, S. xiv, 55) vermutet, dass der Film die Dreharbeiten zum Opernfilm MIGNON (1906) zeigt. Maurice Gianati (2012, S. 118) geht hingegen davon aus, dass Guy hier den BALDES CAPULET (1907) aus Charles Gounods Oper Roméo et Juliette inszeniert. Gianatis Einordnung ist etwas wahrscheinlicher – er kann sich auf ein Drehtagebuch von Guys Kameramann Étienne Arnaud (der Mann mit der Sonnenbrille) und einen historischen Verkaufsschein stützen, der mit einem Standbild der phonoscène bedruckt war (Gianati/Lange 2012, S. 213). McMahan und Gianati beziehen sich bei ihrer Rekonstruktion der Produktionsumstände außerdem auf ein historisches Foto, das die Dreharbeiten aus einem ähnlichen Blickwinkel wie der Kurzfilm zeigt. Die Existenz eines solchen Fotos legt nahe, dass auch der Kurzfilm nicht zufällig entstanden ist. Möglicherweise wurde er selbst in frühe Kinoprogramme integriert.
Abb. 1: Frontalansicht der Dreharbeiten einer phonoscène.
Quelle: ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE, Still, GP archives.
Ungefähr 100 Jahre später in Los Angeles: ein Schauspieler, gefilmt in einer Halle, die mit Bühnenelementen, Traversen und Kulissenteilen vollgestellt ist. Der junge Mann trägt einen schwarzen Ganzkörperanzug mit neonfarbenen Streifen, dazu einen Helm, aus dem blaue und rote Kabel herausragen. Vor seinem Gesicht ist ein Gestell mit einer kleinen Kamera befestigt. Mit der rechten Hand lässt er eine kurze Gummileine kreisen, als würde er sich mit einem Lasso einem ungezähmten Pferd nähern. Nach einer Weißblende ist eine andere, weitläufige und nun vollkommen leere Halle zu sehen. Im Vordergrund der Aufnahme steht ein fest installierter Bildschirm. Darauf ist eine blaue Figur zu erkennen, die sich mit einer Fangleine vorsichtig an ein drachenähnliches Flugwesen heranpirscht. Hinter dem Bildschirm, inmitten der Halle, nestelt ein Mann an einem verkabelten, tragbaren Monitor herum.
Der beschriebene Ausschnitt aus CAPTURING AVATAR (2010, Laurent Bouzereau) dokumentiert das Motion-Capture-Verfahren, das für die Realisierung des 3D-Films AVATAR (2009, James Cameron) zum Einsatz kam. In gefilmten Interviews vor und nach den beiden kurzen Einstellungen erläutern der Produzent Jon Landau und der Editor Steven Rivkin, was in den Aufnahmen konkret zu sehen ist. Die erste zeigt den Schauspieler Sam Worthington auf einer Motion-Capture-Bühne, die zweite den Regisseur Cameron, wie er einen Monitor als virtuellen Sucher verwendet. Er sieht auf dem Bildschirm die aufgezeichneten Bewegungsabläufe der Schauspieler*innen, die auf rudimentär gestaltete, digitale Figuren in einer virtuellen Umgebung übertragen wurden (Prince 2012, S. 134–135). Cameron kann die Aufzeichnungen ablaufen lassen und durch Bewegungen des Monitors die gewünschten Blickwinkel auf die Szene festlegen. Rivkin und Landau beschreiben dieses Prinzip, als würden sie über herkömmliches Filmemachen sprechen: Cameron dreht »takes« und blickt durch die »Linse« der virtuellen Kamera, »as if the actor were there and were giving him their performances live« (Landau, TC 01:11:02–01:12:09).
ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE und CAPTURING AVATAR trennen ein Jahrhundert Mediengeschichte. Sie unterscheiden sich deutlich, was ihre Laufzeit, ihre technische Machart, ihre Gestaltung und ihre Auswertung angeht. Dennoch gehören beide zur gleichen Genealogie einer bestimmten Sorte von Filmen. ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE ist dafür wahrscheinlich eines der ältesten, erhaltenen Beispiele. Im frühen Kino gab es für entsprechende Filme noch keinen eigenen Begriff. Das ist heute anders: Beide, der Kurzfilm und die Dokumentation zu AVATAR, können als ein sogenanntes Making-of bezeichnet werden.
Konjunktur des Making-of
Die filmische Form des Making-of steht im Zentrum der vorliegenden Studie. Anhand unterschiedlicher Beispiele möchte ich untersuchen, wie Filme auf die Entstehung eines anderen Films Bezug nehmen. Der Fokus liegt darauf, wie ein Making-of die Hervorbringung und Herstellung, also die Produktion eines Films dokumentiert. ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE und CAPTURING AVATAR zeigen, dass diese Dokumentation mit unterschiedlichen filmischen Verfahren realisiert werden kann: etwa als einfache, unkommentierte Aufnahme der Dreharbeiten (ALICE GUYTOURNE…), aber auch als Kombination solcher Aufnahmen mit anderen Ansichten von filmischer Produktionsarbeit, begleitet durch zusätzliche Interviews und Voice-over-Erläuterungen, möglicherweise auch in Verbindung mit Ausschnitten des fertigen Films etc. (CAPTURING AVATAR). Auf diese Weise bringen Making-ofs unterschiedliche Filmbilder von Filmproduktion hervor. Die Studie soll aufzeigen, wie diese Bilder aussehen, wie sie formal strukturiert sind und welche Beziehungen sie zu den Bildern des produzierten Films unterhalten. Das Interesse dieser Studie ist also ein dezidiert ästhetisches – und damit auch ein filmtheoretisches. Das Ziel besteht darin, eine eigene Ästhetik des Making-of zu beschreiben. Es soll gezeigt werden, wie sich diese Ästhetik in konkreten Filmen niederschlägt, um die Bedeutung dieser Bilder von Filmproduktion für das Medium Film besser zu verstehen.
Die folgende Untersuchung erfindet den Ausdruck ›Making-of‹ nicht neu. Er wird seit geraumer Zeit als Bezeichnung für Filme wie ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE und CAPTURING AVATAR verwendet. Einschlägige Lexika definieren den Begriff in der Regel nach folgendem Schema (Roy 1999, S. 193; Magny 2004, S. 58; Rauscher 2007; Journot 2011, S. 73): Ein Making-of ist ein »Dokumentarfilm oder eine »Reportage« über die Entstehung eines Films. Meistens werden Making-ofs für eine Fernsehausstrahlung oder eine Home-Video-Auswertung produziert. Sie werden von der Filmindustrie gerne zu Werbezwecken eingesetzt, zuweilen aber auch als eigenständige Kinofilme veröffentlicht. Es existieren außerdem zwei Alternativbezeichnungen, die vor allem in englischsprachigen Definitionen auftauchen. Dort werden Making-ofs häufig als »Featurette« oder »Behind-the-Scenes Film« bezeichnet (Konigsberg 1989, S. 114; Penney 1991, S. 24; Cones 1992, S. 182).2 Der Anglizismus ›Making-of‹ ist im Französischen und Deutschen offenbar etwas geläufiger – und zwar ungefähr seit den 1990er-Jahren, als die ersten lexikalischen Definitionen erschienen.
Der Veröffentlichungszeitpunkt der Lexikoneinträge verrät, dass Making-ofs in einer ganz bestimmten medienhistorischen Situation zu erklärungsbedürften Gegenständen werden. Man kann Making-ofs zwar bis ins frühe Kino zurückverfolgen – siehe das ALICE-GUY-Beispiel –, trotzdem lässt sich gerade ab den 1990er-Jahren eine starke Konjunktur des Making-of beobachten. CAPTURING AVATAR wird in einer Zeit veröffentlicht, in der eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten und Formen des Making-of entstehen. Sie durchziehen diverse Bereiche der zeitgenössischen, audiovisuellen Medienkultur. Dieses Phänomen ist die Ausgangsbeobachtung der vorliegenden Studie. Das Making-of reicht filmhistorisch weit zurück, aber es gewinnt im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert eine beispiellose Dynamik, die eine eingehende Betrachtung erfordert.
Der bemerkenswerte Aufschwung des Making-of vollzieht sich im Kontext von tiefgreifenden Veränderungen im Bereich des Films, des Kinos und des Fernsehens. Dazu zählt in erster Linie der zunehmende Einsatz von Computertechnologien. In der Film- und Fernsehproduktion beginnt diese Entwicklung mindestens in den frühen 1990er-Jahren (Manovich 2002, S. 287), wird aber von Interessenverbänden in der US-Filmindustrie und Kameraherstellern wie Sony und Panasonic vor allem in den 2000er-Jahren massiv vorangetrieben (Mateer 2014). Bis Mitte der 2010er-Jahre ersetzt die digitale Bildakquise sukzessive die bis dato übliche Aufzeichnung auf analogen Rohfilm. Filme werden digital geschnitten, digital nachbearbeitet und zunehmend als Datenpakete vertrieben, nicht mehr als physische Kopien. 2012 projiziert bereits die Hälfte der weltweiten Kinos digital (Bordwell 2012, S. 82), Ende des Jahres 2013 sind es schätzungsweise 90 % (Barraclough 2013). Digitale Speichertechnologien halten auch im Home-Video-Bereich Einzug. Neue Datenträger wie die DVD (ab 1997) und die Blu-ray (ab 2006) lösen das Magnetbandsystem der VHS-Kassette und des Videorekorders ab. Filme können nunmehr als digitale Dateien auf Festplatten oder Servern gespeichert, am Computer abgespielt, aus dem Internet heruntergeladen oder online gestreamt werden.
Film, Kino und Fernsehen verändern sich aber nicht nur im technischen Sinne. Fernsehserien erleben einen prestigeträchtigen Aufschwung, gestützt durch die Verfügbarkeit von Serienstaffeln erst auf DVDs, später in den Onlinebibliotheken großer Video-on-Demand-Streaminganbieter.3 Auch hochbudgetierte Blockbuster-Filme werden verstärkt als offene Serien angelegt, die durch Sequels, Prequels, Remakes oder Reboots beliebig verlängert werden können (Brinker 2022, S. 4–10). Parallel wächst die Bedeutung von Film- und Medienkunstfestivals – für die Auswertung, aber auch die Finanzierung und Produktion gerade solcher Filme, die ansonsten kaum Chancen auf eine kommerziell erfolgreiche Auswertung haben (Elsaesser 2005, S. 84–89). Zugleich wird Film als lingua franca vermehrt in der zeitgenössischen Kunst aufgerufen. Künstler*innen bauen nicht nur Versatzstücke aus existierenden Filmen in ihre Arbeiten ein, sondern beschäftigen sich auch grundlegend mit kinematografischen Dispositiven, Inszenierungsweisen oder Narrationsstrukturen (Hagener 2011, S. 50–51).
Dieser Schnelldurchlauf durch 20 bis 30 Jahre Mediengeschichte lässt sich sicherlich noch durch weitere Entwicklungen ergänzen. Als Überblick soll er aber vorerst genügen, um ein medienkulturelles Umfeld zu umreißen, in dem das Making-of eine ungeahnte Dynamik entfaltet. Dies lässt sich an den schon erwähnten Home-Video-Technologien wie der DVD ablesen, die regelmäßig mit Making-of-Material bestückt werden. Es sind jedoch bei Weitem nicht nur DVDs, die dem Making-of zu einer größeren Sichtbarkeit und Popularität verhelfen. Auch Filmfestivals zeigen Making-of-Reihen oder richten eigene Programmsparten für Making-of-Filme ein. Das International Documentary Film Festival Amsterdam präsentierte beispielsweise im Rahmen der Festivalausgabe 2013 eine Auswahl von Making-of-Filmen in der Sektion Paradocs; 2019 lief ein umfangreiches Making-of-Programm unter dem Titel Fabriquer le cinéma auf dem Pariser Dokumentarfilmfestival Cinéma du Réel. Auch bei Festivals ohne Dokumentarfilmschwerpunkt entstehen Programmschienen für Dokumentarfilme über Filmproduktion, etwa Lights! Camera! Action! beim Filmfest München oder vergleichbare Sektionen beim Internationalen Trickfilmfestival Stuttgart sowie beim Festival d’Animation Annecy.
Es sind solche Verbreitungswege, die die Präsenz des Making-of in der zeitgenössischen Film- und Medienkultur spürbar erhöhen. Ein Effekt dieser wachsenden Sichtbarkeit besteht darin, dass der Begriff mittlerweile ohne Genitivattribut auskommt. Ähnlich wie das ›Best-of‹ ist ›Making-of‹ zur Chiffre für eine bestimmte mediale Form geworden, ohne dass immer spezifiziert werden muss, was im Einzelfall überhaupt gemacht wird und worauf sich das of im Making-of genau bezieht. Der Begriff findet deshalb auch außerhalb des Films oder des Fernsehens Anwendung. Ein Beispiel ist das Theater: Der Dramatiker Albert Ostermaier schrieb zum 100. Geburtstag von Berthold Brecht das Stück The Making Of. B-Movie (1999) für das Bayerische Staatsschauspiel; Nora Abdel-Maksoud inszenierte 2017 ein anderes Stück mit dem gleichen Titel am Maxim-Gorki-Theater. Die Bezeichnung taucht aber auch in anderen Bereichen auf. Spielentwickler*innen statten Videospiele mit Making-of-Materialien aus, die teilweise als Einblendungen, Kommentarspuren oder freischaltbare Bonusinhalte direkt ins Spielgeschehen integriert werden (Glas 2016). Die französische Tageszeitung Le Monde unterhält eine Onlinerubrik namens Making of, um über die Hintergründe ihrer journalistischen Arbeit zu berichten.4 Thematisch ähnlich ausgerichtet ist die Podcast-Serie The Making of von National Geographic, oder, als deutschsprachiges Beispiel, der Podcast Making of Ö1 des Österreichischen Rundfunks. Alle diese Fälle setzen voraus, dass ein Theater, Videospiel, Lese- oder Hörpublikum mit dem Begriff Making-of prinzipiell etwas anfangen kann. ›Making-of‹ fungiert heute als allgemein verständliches Etikett, das bestimmte Topoi impliziert: ein Blick ›hinter die Kulissen‹, die Entstehung von etwas, die Offenlegung verborgener Produktionsvorgänge.
Längst ist das Making-of auch in der film- und medienwissenschaftlichen Theoriebildung angekommen. Es liegt eine Reihe von Arbeiten vor, die sowohl zeitgenössische als auch historische Formen des Making-of untersuchen. Nach Dennis Göttel (2018, S. 43–44) lassen sich diese Studien näherungsweise in drei Rubriken einteilen. Das Making-of wird erstens, aus einer ökonomischen Perspektive, als Instrument von Filmwerbung und Filmmarketing erforscht. So verknüpft Vinzenz Hediger (2005a, 2005b) in zwei prägnanten Aufsätzen die Geschichte des Making-of mit der Geschichte des Trailers. Hediger versteht das Making-of dabei als Werbemittel, das, ähnlich wie der Trailer, in erster Linie Reklame für einen Film betreibt.
Zweitens wird das Making-of in Anlehnung an Gérard Genette (2001 [1987]) als »Paratext« untersucht. Entsprechende Analysen interpretieren es als audiovisuellen Hilfs- oder Nebentext, der einem Film beigeordnet wird und dadurch dessen Rezeption zu lenken versucht. Diese Perspektive lässt sich in der Mehrzahl der bisherigen Veröffentlichungen wiederfinden, insbesondere bei Autor*innen, die das Making-of innerhalb der Bonusmaterialarchitektur einer DVD analysieren. Das Untersuchungsinteresse besteht häufig darin, die Funktion des Making-of für den Umgang von Rezipient*innen mit medialen Texten herauszuarbeiten. Die Studien zeichnen beispielsweise nach, wie sich die Wahrnehmung eines fiktionalen Spielfilms durch Kenntnisse seiner Produktion verändert, die wiederum in einem Making-of dargestellt wird (Kaufmann 2011). Mit dem Paratextmodell geht demnach eine stark textzentrierte Perspektive einher. Sie liegt auch solchen Arbeiten zugrunde, die den Ausdruck ›Making-of‹ ebenfalls für nicht-filmische Phänomene verwenden – so etwa bei Jan Cronin (2019), der transmediale Adaptionen mit Fokus auf Filmherstellungsprozesse als ›Making-ofs‹ betrachtet.
Eine dritte Perspektive, der Göttel seine eigenen Untersuchungen zurechnet, begreift das Making-of dagegen als epistemologisches und historiografisches Werkzeug. Das Making-of, so Göttels Annahme, betreibt selbst Filmproduktionsforschung. Es bringt ein charakteristisches, eigenes Wissen über Filmproduktionsvorgänge hervor. Dieses Wissen zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es »auf somatisch-affektive Weise generiert [wird]« (Göttel 2018, S. 43) – mit filmischen Gestaltungsmitteln nämlich, die das Making-of, weil es selbst ein Film ist, systematisch zum Einsatz bringen kann.
Neben diesen drei Untersuchungsrichtungen taucht das Making-of noch in einem vierten Theoriekontext auf, allerdings eher en passant, weniger als eigener Untersuchungsgegenstand. Making-ofs werden immer wieder dann erwähnt, wenn über die oben geschilderten Transformationen des Films und des Kinos nachgedacht wird. Dieser Diskussionszusammenhang wird seit geraumer Zeit als Post-Cinema-Debatte bezeichnet.5
Mutmaßlich taucht der Neologismus »Post-Cinema« um das Jahr 2000 erstmals in filmwissenschaftlichen Publikationen auf. So verwendet Robert Stam den Begriff in Film Theory. An Introduction (2000, S. 314–327), um zu beschreiben, wie der (Kino)Film seine frühere Vormachtstellung als Leitmedium einbüßt und verstärkt in anderen Medienverbünden und Künsten aufgeht. Eine programmatische Zuspitzung erfährt das Konzept anschließend vor allem durch Steven Shaviro. In seinem Essay Post-Cinematic Affect (2010) skizziert Shaviro eine »postkinematografische« Medienlandschaft, die durch geänderte (sprich: digitale) Produktions- und Distributionsweisen neue Wahrnehmungsformen und Affektökonomien hervorgebracht habe. Mit dem klassischen Vokabular des Kinos könne dieses neue »media regime« nicht mehr präzise beschrieben werden (ebd., S. 2).
Ein prägnantes Beispiel, wie das Making-of in der Post-Cinema-Diskussion aufgerufen wird, findet sich in David N. Rodowicks The Virtual Life of Film (2007). Rodowick setzt sich darin intensiv mit der Problemstellung auseinander, auf welche Art und Weise das Digitale bisherige ontologische Bestimmungen des Filmbildes herausfordert. Dabei kommt er auch auf die phänomenologische ›Dauer‹ eines filmischen Bildes zu sprechen und bezieht sich dafür insbesondere auf RUSSIAN ARK (2002, Alexander Sokurov). Der Film entstand als ausgetüftelte Plansequenz durch die St. Petersburger Eremitage: eine ununterbrochene Aufnahme von 86 Minuten Länge, gefilmt per Steadicam und notwendigerweise komplett digital aufgezeichnet, denn eine Filmrolle hätte mehrmals gewechselt werden müssen. Rodowicks These lautet, dass es sich bei dieser Plansequenz nicht mehr um eine filmische Aufnahme im klassischen Sinne handelt. Die digitale Aufzeichnung wurde umfassend nachbearbeitet, deshalb gebe es in dieser Aufzeichnung keine echte raumzeitliche Einheit wie in einem analogen long take mehr (ebd., S. 163–174).
Rodowick gelangt zu dieser Einschätzung auf Grundlage des Making-of IN ONE BREATH (2003, Knut Elstermann), das DVD-Editionen von RUSSIAN ARK als Bonusmaterial beigefügt war. Rodowick zieht das DVD-Making-of als Beleg für die vielen, unsichtbaren Nachbearbeitungen der Steadicam-Aufnahme heran. Außerdem übernimmt er aus dem DVD-Audiokommentar den Begriff »digital event«, um die digitalen Nachbesserungen und Neumodellierungen am Bild zu beschreiben (ebd., S. 165–167; Meurer 2003, TC 01:04:38–01:05:52). In seinem Essay Que reste-t-il du cinéma? formuliert Jacques Aumont (2012, S. 13–18) wenig später eine Replik auf Rodowicks These. Auch er erwähnt dabei IN ONE BREATH, plädiert aber dafür, RUSSIAN ARK weiter als herkömmlichen Film zu verstehen.
Rodowicks und Aumonts Diskussion über die filmische oder nicht-mehr-filmische Qualität eines digital gedrehten Films ist typisch dafür, wie in filmtheoretischen Debatten auf Making-ofs Bezug genommen wird. Ähnliche Verweise durchziehen den gesamten Post-Cinema-Diskurs, der sich an einer Standortbestimmung des Films im 21. Jahrhundert abarbeitet. Wie bei Rodowick dient das Making-of meistens als Quelle, aus der Informationen über filmische Produktionsvorgänge übernommen werden. Teilweise wird es auch als Beispiel genannt, um übergreifende ästhetische Ausdehnungen des Films zu veranschaulichen – so etwa bei Nicholas Rombes (2009, S. 62–63, 94–95, 98), bei Francesco Casetti (2015, S. 101) oder bei André Gaudreault und Philippe Marion (2015, S. 99–100, 178). Selten wird das Making-of dagegen als Gegenstand eigenen Rechts untersucht. Es wird primär als Informationslieferant behandelt, oder kursorisch als eine Form neben vielen anderen erwähnt, die zu Entgrenzungen des Mediums Film beitragen.
Ich gehe davon aus, dass die intuitive Zuordnung des Making-of zum Post-Cinema richtig ist. Seine dynamische Verbreitung und wachsende Sichtbarkeit haben offenkundig etwas mit der Lage des Films und des bewegten Bildes im frühen 21. Jahrhundert zu tun. Das Untersuchungsziel der vorliegenden Studie kann deshalb in zwei Richtungen konkretisiert werden. Zum einen möchte ich nachzeichnen, welche Varianten des Making-of in den letzten 20 bis 30 Jahren entstanden sind. Die Studie soll aufzeigen, in welchen Kontexten das Making-of in diesem Zeitraum in Erscheinung tritt, welche Gestaltungsformen es dabei annimmt, und in welchem Verhältnis es zu den jeweiligen Filmen steht, deren Hervorbringung es dokumentiert. Zum anderen möchte ich herausarbeiten, welche Repräsentationen von Filmproduktion diese Making-ofs transportieren. Das vermehrte Aufkommen des Making-of weist darauf hin, dass das Phänomen Filmproduktion heute, unter digitalen Bedingungen, einen größeren Stellenwert für sich beansprucht. Die gegenwärtige Film- und Medienkultur ist deshalb zu nicht unerheblichen Teilen eine Kultur des Making-of. Die Studie versucht, diese Situation besser zu verstehen und einzuordnen. Es soll im Folgenden also nicht darum gehen, das Making-of noch einmal als bloßen Paratext oder als Werbeinstrument zu untersuchen. Vielmehr plädiere ich dafür, es als einen komplexen, voraussetzungsreichen Gegenstand zu begreifen, der eng mit der Ästhetik des Films im Post-Cinema verflochten ist.
Zum Begriff (Film)Produktion
Rodowick und Aumont erwähnen Making-ofs, weil sie sich für Filmproduktionsverfahren interessieren. Das Making-of macht solche Verfahren zu seinem hauptsächlichen Inhalt. Es generiert ein Wissen über diese Verfahren; es vermittelt sie in bewegten Bildern an seine Zuschauer*innen. Die dokumentarische Betrachtung von Filmproduktion gehört, so gesehen, zu seinem Kerngeschäft. Doch: Was heißt das genau? Was ist gemeint, wenn davon die Rede ist, dass ein Making-of die Produktion eines Films dokumentiert?
Unter ›Produktion‹ lassen sich dem Alltagsverständnis nach unterschiedliche Tätigkeiten und Vorgänge bündeln, die etwas mit dem ›Machen‹ eines Films zu tun haben. Dafür heute den Ausdruck ›Produktion‹ zu verwenden, ist aber nicht selbstverständlich. Der Begriff lässt sich bis zur altgriechischen poiesis zurückverfolgen, die wahlweise als göttliche Schöpfung, als natürliche Wirkung oder Erzeugung, als menschliche Handwerkstätigkeit oder auch als Dichtkunst übersetzt werden kann. Rüdiger Zill (2003) rekonstruiert, wie sich der Begriff, ausgehend von der lateinischen Übertragung producere, über verschiedene historische Stationen als Fremdwort im Französischen, Englischen und Deutschen eingebürgert hat. Dabei kann Zill nachweisen, dass ›Produktion‹ im Sinne von ›etwas erzeugen‹ und ›etwas künstlich hervorbringen‹ erst ab dem 18. Jahrhundert verwendet wird. Und es dauert ein weiteres Jahrhundert, bis der Begriff seine heutigen Konturen annimmt. Es ist die romantische Kunstphilosophie des frühen 19. Jahrhunderts, welche die schöpferische Tätigkeit von Künstler*innen verstärkt als eine ›Produktion‹ bezeichnet. Parallel beginnen ökonomische Theorien, den Begriff nicht mehr nur für landwirtschaftliche Erzeugung, sondern auch für industrielle Fabrikation zu verwenden (ebd., S. 60–68; Breyer 2019). Zur Produktion wird jeweils auch ein begrifflicher Gegenpart entworfen. Die Kunstphilosophie stellt, etwa bei Friedrich Schleiermacher (2021 [1819]), der Produktion eine Rezeption gegenüber.6 Karl Marx (2006 [1857/58]) setzt die ökonomische Produktion in ein enges Wechselverhältnis zur Konsumtion.
Die heute übliche Dreiteilung Produktion–Werk/Produkt–Rezeption/Konsum ist also ein ideengeschichtliches Erbe des 19. Jahrhunderts. Sie findet auch im Bereich des Films Anwendung. Ein Film wird hergestellt, dadurch entsteht ein Werk, dieses Werk wird anschließend von einem Publikum rezipiert. Speziell für den Film lassen sich die Verbindungen zwischen den drei Ebenen noch weiter präzisieren. Die Filmökonomie unterscheidet zwischen der Produktion eines Films, seiner Distribution und seiner exhibition, also z.B. seiner Vorführung in einem Kino.7 Produktion, Distribution und Vorführung bezeichnen demnach einzelne Etappen, die ein Film klassischerweise durchläuft, um zu einem Publikum zu gelangen. Mit einer weiteren Dreiteilung lässt sich darüber hinaus noch die erste Etappe, die Filmproduktion, weiter aufschlüsseln. Unterschieden werden kann hier zwischen der Vorproduktion bzw. pre-production, die alle Konzeptions- und Planungsschritte vor den Dreharbeiten umfasst, den eigentlichen Dreharbeiten (im Englischen: principal photography), sowie der Postproduktion, also der nachträglichen Weiterverarbeitung der Aufnahmen im Schnitt, in der Farbkorrektur, in der Tonmischung, durch die Hinzufügung visueller Effekte etc. (Kuhn/Westwell 2012, S. 325, 327–328).
Das Making-of kann prinzipiell alle drei Ebenen in den Blick nehmen, wenn es die Entstehung eines Films nachzeichnet. Genau dieses Nachverfolgen von Filmproduktion bringt dem Making-of aber auch Kritik ein – besonders von denjenigen, die selbst in der Film- und Fernsehproduktion arbeiten. Sein heimliches Ziel, so der Vorwurf, sei gar nicht die transparente Darstellung realer Produktionsprozesse, sondern Werbung, positive PR und eine plumpe Verlängerung der filmischen Wertschöpfungskette. Der Stop-Motion-Animator Bernhard Schmitt drückt diese Vorbehalte folgendermaßen aus: »Making-ofs [zu Animationsfilmen] haben in etwa so viel mit einer realen Filmproduktion zu tun wie ein Schweizer Bergbauer mit der Herstellung von Ricola-Hustenbonbons.«8
Ähnliche Vorbehalte finden sich auch in der akademischen Forschung zu Film- und Fernsehproduktion. Hier genießt das Making-of ebenfalls einen eher zweifelhaften Ruf. John Thornton Caldwell (2008, S. 287–290) unterstellt gängigen Film- und Fernseh-Making-ofs gar die Verschleierung eines »inzestuösen« Nutznießertums. Anhand eines TV-Making-of zu X-FILES: THE MOVIE (1998, Rob S. Bauman) weist er nach, wie fast alle Prominenten, die im Making-of als Fans der Serie interviewt werden, finanziell von dem besprochenen X-FILES-Spielfilm profitieren.
Caldwells Making-of-Kritik stammt aus seiner Studie Production Culture. Darin setzt er sich mit US-amerikanischer Film- und Fernsehproduktion der 1990er- und frühen 2000er-Jahre auseinander. Interessanterweise können Caldwells methodischen Prämissen aber auch zum Anlass genommen werden, den Vorwurf der ideologischen Verschleierung von realen Produktionsverhältnissen selbst einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Caldwell liefert stichhaltige Argumente, um seine eigene, drastische Kritik am Making-of ein Stück weit abzumildern.
Der Clou von Caldwells Forschung besteht darin, Film- und Fernsehproduktion nicht nur mit makroökonomischen Erhebungen, Interviews oder ethnografischen Beobachtungen zu untersuchen. Caldwell analysiert gezielt auch die »trade and worker artifacts« (ebd., S. 4), die er als reflektierte Selbsttheoretisierungen von Filmpraktiker*innen versteht. Making-ofs wären Beispiele für solche »trade artifacts«, also für Bilder und Texte, die eine industrielle Branche über sich selbst erzeugt und in eine allgemeine Öffentlichkeit kommuniziert. Diese Kommunikation ist expliziter Bestandteil von Caldwells Studie. Er schreibt: »My project is […] less about finding an ›authentic‹ reality ›behind the scenes‹ – an empirical notion that tends to be naïve about the ways that media industry realities are always constructed – than it is about studying the industry’s own self-representation, self-critique, and self-reflection« (ebd., S. 5, Herv. i. O.).
Folgt man dieser Perspektive, müssen die Repräsentationen des Making-of also nicht gleich verworfen werden, weil sie eine bestimmte Agenda verfolgen könnten. Film- und Fernsehindustrien sind schlicht und einfach ständig damit beschäftigt, neue Darstellungen des eigenen Tuns zu verbreiten (Elsaesser 2012, S. 329–340). Es ist wichtig, die Sinngehalte dieser Darstellungen als solche zu analysieren und kritisch zu kommentieren. Nur so kann den wirkmächtigen »cross-cultural interfaces« (Caldwell 2014, S. 736) zwischen Filmpraktiker*innen und ihrem Publikum angemessen Rechnung getragen werden. Caldwell betrachtet diese Schnittstellen daher nicht als hinderliches Dickicht, durch das sich Forscher*innen erst mühsam hindurchkämpfen müssen, sondern als eigenständigen, untersuchungswerten Bestandteil des Phänomens Filmproduktion. Die Schnittstellen kaschieren keine geheime, empirische Wahrheit. Im Gegenteil: Sie sind nach Caldwell sogar »more real and significant than industry’s mythological centres« (ebd., Herv. FH).
Patrick Vonderau (2013, S. 17) resümiert, dass Caldwell den Komplex Produktion damit als »Text ohne Referenten« betrachtet. Dieser Ansatz stellt eine wichtige methodologische Errungenschaft des Feldes dar, das seit einigen Jahren unter dem Label Production Studies oder Cultural Studies of Media Industries firmiert. Darunter lässt sich eine Reihe von Arbeiten subsumieren, die von einem ähnlichen Forschungsinteresse angeleitet sind. Vertreter*innen einer kulturwissenschaftlich ausgerichteten Produktionsforschung untersuchen oft nicht die Genese eines einzelnen Werks, und sie begreifen Produktion nicht nur als Schaltstelle zwischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und filmischen Texten.9 Stattdessen geht es ihnen darum, die soziokulturellen Mechanismen innerhalb von Personengruppen besser zu verstehen, die in den Film- und Fernsehindustrien arbeiten.10Philip Drake fasst zusammen:
Across these often quite different studies are key questions exploring how media workers make sense of their work, understanding how professionals reflect on their industry and their place within it, exploring industrial hierarchies and economies of labor, and bringing out a deeper understanding of industry rituals and practices. (2022, S. 99)
Vonderau beobachtet, dass der Begriff Produktion dabei jedoch strukturell unterbestimmt bleibt. Die kulturwissenschaftliche Produktionsforschung bringt keinen »verbindlichen Begriff dessen [hervor], was Produktion nun letztgültig sei« (Vonderau 2013, S. 24).
Was Arbeiten aus den Production Studies gleichwohl verbindet, ist eine starke Konzentration auf Tätigkeiten, die mit dem unmittelbaren ›Machen‹ eines Films zu tun haben. Im dreiteiligen Schema Produktion/Distribution/Vorführung liegt der Fokus klar auf dem ersten Bereich. Distribution wird beispielsweise kaum untersucht, worauf etwa Derek Johnson (2017b, S. 150) hinweist. Er bemängelt, dass die Production Studies mit ihrer Konzentration auf Produktion im Prinzip der industrieeigenen Begriffsverwendung unkritisch folgen und Produktion als kulturelle Aktivität, entgegen der eigenen Ansprüche, letztendlich stark verengen. Johnson schlägt daher vor, Produktion weiter zu fassen: nicht nur als Begriff für professionelle Herstellungsabläufe, sondern auch als Bezeichnung für Aktivitäten von Fans und ›Amateur*innen‹, sowie als Ausdruck für eine allgemeine Umgangsweise mit Medien, die selbst ›produktiv‹ ist (ebd., S. 152).
Die Production Studies bilden insgesamt einen markanten Diskurs innerhalb eines noch weitaus größeren Forschungsgebiets, das sich der Untersuchung von medialen Produktionsphänomenen verschrieben hat. In ähnlicher Weise wie Johnson schlagen einige Autor*innen vor, Produktion zunächst sehr weit zu verstehen, nämlich als alle möglichen Formen des alltäglichen, herstellenden Machens. Darunter fallen auch medientechnische Aktivitäten: fotografieren, filmen, Texte schreiben, Bilder bearbeiten, auf Social-Media-Plattformen posten etc. Gleichzeitig – und das wäre eine Abgrenzung zu Johnson – geht etwa David Hesmondhalgh (2006; 2019, S. 84–97) von einer grundsätzlichen Asymmetrie zwischen alltäglichen Medienpraktiken und den organisierten, professionalisierten Herstellungsaktivitäten in den media industries aus. Mediensoziolog*innen und ökonom*innen wie Hesmondhalgh untersuchen Produktionsweisen in Film, Rundfunk, Musik, Print- und Onlinemedien daher grundsätzlich als industrielle Formationen. Dabei gehen sie besonders auf übergeordnete Arbeitsbedingungen, Eigentumsverhältnisse, legislative und juristische Rahmenbedingungen, Konzepte von Kultur und Kreativität oder die Handlungsspielräume von lokalen Praktiker*innen ein.11 Der methodische Zugang stammt weniger aus den Kulturwissenschaften und der Kulturanthropologie, sondern eher aus der Tradition der kritischen politischen Ökonomie und der Kultursoziologie Pierre Bourdieus. Paul McDonald (2022, S. 10–14) merkt an, dass Arbeiten in dieser Forschungsrichtung jedoch zuweilen Gefahr laufen, ›die Filmindustrie‹ oder ›den Rundfunk‹ als feste, homogene Einheiten vorauszusetzen. Ihm zufolge sind derartige Bezeichnungen immer auch heuristische Zuschreibungen, um spezifische Untersuchungsfelder abzustecken. Der Wert von makroperspektivischen Studien besteht trotzdem darin, dass sie übergeordnete medienindustrielle Entwicklungen beschreibbar machen – insbesondere in den Bereichen Film und Fernsehen.
Für eine Untersuchung des Making-of sind mehrere Aspekte der bisher dargestellten Produktions- und Medienindustrieforschung relevant. Die Produktion, die ein Making-of mitverfolgt, scheint sich erstens im Wesentlichen mit dem impliziten Begriffsverständnis der kulturwissenschaftlichen Production Studies zu decken. Making-ofs nehmen die Hervorbringung und die Herstellung bewegter Bilder in den Blick, weniger ihre distributive Verbreitung oder Wiedergabe für ein Publikum. Aus heuristischen Gründen ergibt es also Sinn, den Begriff Produktion für eine Beschäftigung mit dem Making-of nicht so weit auszudehnen, wie es Johnson vorschlägt.
Darüber hinaus können, zweitens, auch mediensoziologische und ökonomische Ansätze von solchen Autor*innen für das Making-of fruchtbar gemacht werden, die Produktion als ein Bündel spezialisierter Tätigkeiten begreifen. Diese Tätigkeiten werden in institutionellen Kontexten von bestimmten Personen ausgeführt. Der Mediengebrauch von Gruppen, die man früher ›Laien‹ oder ›Amateur*innen‹ genannt hätte, mag sich heute mehr denn je mit professionalisierten Tätigkeiten in den Medienindustrien überschneiden; und es scheint einfacher als je zuvor, eigenen user-generated content zu erstellen und im Internet zu verbreiten, wie Studien zu »Prosumern« oder »Produsern« nicht müde werden zu betonen.12 Das bedeutet allerdings nicht, dass sich Differenzierungen zwischen Produktion und Rezeption vollständig auflösen. Es gibt nach wie vor strukturelle Unterschiede zwischen denjenigen, die etwa an der Entstehung eines Hollywoodfilms mitarbeiten, und denjenigen, die einen solchen Film auf dem heimischen Fernsehgerät streamen und nur gelegentlich ein Video mit ihrem Smartphone aufnehmen, um es in einer Chatgruppe oder in ihren Social-Media-Accounts zu posten. In vergleichbarer Weise insistieren die kulturwissenschaftlichen Production Studies darauf, dass Produktion und Rezeption – auch unter digitalen Vorzeichen – »zwei grundverschiedene Erfahrungs- und Wissensbereiche [markieren]« (Vonderau 2013, S. 17, Herv. i. O.). Produktion deckt sich demnach weder vollständig mit dem hergestellten Werk noch mit seiner Rezeption. Die Frage ist also, wie ein Making-of, das selbst ein filmisches Artefakt ist, den Wissens- und Erfahrungsbereich Produktion medial vermittelt.
Caldwell und andere betonen, dass Artefakte wie das Making-of nicht auf eine stabile, ›eigentliche‹ Realität hinter der medialen Darstellung verweisen. Mediale Vermittlung bedeutet jedoch nicht, dass Produktion im Making-of gänzlich referenzlos wäre. Wenn Produktion als Domäne gelten kann, in der reale Menschen arbeiten und reale technische Vorgänge stattfinden, dann kann die Produktion, die ein Making-of transportiert, nicht gänzlich losgelöst von diesen realen Arbeits- und Erfahrungswelten betrachtet werden. Produktion im Making-of hängt – das wäre ein dritter Aspekt – also immer mit der realen Herstellung von Filmen, Serien, Fernsehsendungen oder Videos zusammen. Ändert sich ihre Herstellung, wirkt sich das auf die Bilder aus, die ein Making-of von dieser Herstellung liefern kann. Auch Caldwell bemüht sich, seine Untersuchung von ästhetischen Produktionsartefakten an allgemeine technische, ökonomische und kulturelle Entwicklungen rückzubinden. Diese Perspektive darf für das Making-of nicht vernachlässigt werden.
Einen vierten und letzten Gesichtspunkt, den ich für die folgende Untersuchung festhalten möchte, ist die Idee einer anhaltenden Unbestimmtheit von Produktion. Der Begriff Produktion ist nach wie vor extrem vage – oder, positiver formuliert, enorm flexibel. Es liegt de facto keine kohärente Theorie vor, was Filmproduktion genau ist, was sie umfasst, wo sie anfängt und wo sie endet.13 Analog dazu haben Making-ofs gewisse Spielräume, welche Vorgänge und Aktivitäten sie konkret dokumentieren. Sie können aus den unterschiedlichen Berufsgruppen, die mit der Herstellung von Filmen, Fernsehserien, Videos usw. betraut sind, bestimmte Tätigkeitsfelder hervorheben. Sie haben die Möglichkeit, einzelne Arbeitsschritte und Gerätschaften in den Blick zu nehmen, bestimmte Abläufe (an einem Filmset, im Schneideraum, in einem Tonstudio usw.) zu beleuchten sowie bestimmte Materialien ins Bild zu holen, die zur Produktion eines Films angefertigt wurden. Diese Auswahl hat Konsequenzen für das, was ein Making-of jeweils als Produktion zeigt.
Dokumentarische Produktionsästhetik
Mein eigener Begriff des Making-of setzt bei dieser Bandbreite möglicher Produktionsdarstellungen an. Die Beispiele ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE und CAPTURING AVATAR machen deutlich, dass ›Produktion‹ in einem Making-of unterschiedliche Bereiche umfassen und auch sehr unterschiedlich dargestellt werden kann. Es gibt jedoch eine übergreifende Gemeinsamkeit, die das Verhältnis dieser Produktion zum produzierten Film betrifft. ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE und CAPTURING AVATAR zeigen etwas, das in der phonoscène und in AVATAR selbst nicht enthalten ist. Ich möchte vorschlagen, diesen Umstand als eine grundlegende mediale Struktur des Films zu verstehen: Filmische Bilder können nicht in Gänze abbilden, wie sie selbst hergestellt wurden. Bei ihrer eigenen Entstehung bleibt immer etwas zurück – zum Beispiel der Raum des Filmstudios rings um die phonoscène bei Alice Guy. Der produktionsseitige Überhang wird zum Inhalt des Making-of.
Diese Leitüberlegung baut sich in drei Schritten auf. Erstens lässt sich der Bereich der Filmentstehung, der im Film nicht abgebildet wird, mit dem Konzept des hors-cadre zusammendenken. Das hors-cadre bezeichnet in der französischen Terminologie ein besonderes Außen des Filmbildes.14 Dieses Außen kann mit dem realen Raum der Filmproduktion identifiziert werden. ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE ist dafür ein anschauliches Beispiel: Der Kurzfilm zeigt ein Umfeld rund um den Bildausschnitt der phonoscène-Kamera. Dieses Umfeld liegt im Off der gedrehten phonoscène. ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE holt einen Ausschnitt dieser Produktion außerhalb (hors) des Bildausschnitts (cadre) der filmenden Kamera wieder in ein filmisches Bild – nämlich das des Making-of.
Zweitens kann Produktion vor diesem Hintergrund als das verstanden werden, was im hors-cadre stattfindet. Produktion, so zeigt es das ALICE-GUY-Beispiel, sind Handlungen, Vorgänge, Abläufe usw., die nicht in Gänze im produzierten Film erscheinen. Entstehungsprozesse, die im Außen eines Films verbleiben, müssen dabei nicht zwangsläufig Dreharbeiten sein. Auch die Motion-Capture-Performances und die Festlegung von Bildausschnitten per Monitor in CAPTURING AVATAR lassen sich als Vorgänge begreifen, die strukturell in einem Außen des Films AVATAR liegen, auch wenn es sich bei diesem Außen nicht direkt um den Umraum einer laufenden Kamera handelt. Daher können auch Vorgänge in der Vor- oder Postproduktion zur ›Produktion‹ im Sinne der gesamten Entstehung eines Films dazugerechnet werden. Wichtig ist, dass diese Produktion immer eine ausschnitthafte bleibt. Ein Making-of kann Produktion niemals als eine Gesamtheit zeigen, die alles enthält, was in irgendeiner Weise mit der Entstehung eines Films zu tun hat. Es wird notwendigerweise bestimmte Aspekte in den Vordergrund stellen, andere dagegen weglassen.
Drittens setzt das Making-of die Produktion im hors-cadre wieder in ein filmisches Bild. Dadurch mediatisiert es das hors-cadre eines Films und dokumentiert seine Produktion. Eine Beschäftigung mit Making-ofs muss diese eigene mediale Ebene immer mitberücksichtigen. Ein Making-of liefert nicht einfach ›authentische‹ oder ›verfälschte‹ Repräsentationen von Produktion. Es stellt Produktion immer in einer bestimmten Art und Weise dar. Dadurch ist es maßgeblich an einer Semantisierung und Diskursivierung von Filmproduktion beteiligt. Anders ausgedrückt: Wenn sie filmische Herstellungsvorgänge dokumentieren, laden Making-ofs den abstrakten Begriff ›Produktion‹ mit konkreten Bedeutungen auf.
Diese Überlegung kann wiederum an vereinzelte Arbeiten aus dem Feld der Production Studies anschließen. Sarah Aktinson (2018a) führt am Beispiel des Films GINGERAND ROSA (2012, Sally Potter) vor, wie der abstrakte Begriff (Film-)Produktion während der praktischen Herstellung des Films mit konkreten Bedeutungen verknüpft wird. Atkinson beobachtet dabei nicht nur technische Vorgänge, Arbeitsabläufe und Mitarbeiter*innen, sondern widmet sich insbesondere auch den unterschiedlichen Repräsentationen des entstehenden Films, die in den Schilderungen von Mitarbeiter*innen, den verwendeten Arbeitsmaterialien (inkl. Software), in Produktionsdokumenten und in öffentlichen Darstellungen der laufenden Filmherstellung zum Ausdruck kommen. Auf diese Weise, so Atkinson, bringe jeder entstehende Filme eine jeweils eigene »Production Aesthetic« (ebd., S. 3) hervor. Weniger einzelfallorientiert als Atkinson geht auch Caldwell (2023) in einer jüngeren Studie zu Produktionspraktiken zwischen Film, Fernsehen und Social-Media-Plattformen davon aus, dass sich Produktion jeweils in spezifische Bedeutungsfelder übersetzt, die in Äußerungen von Praktiker*innen manifest und beobachtbar werden. Caldwell wählt dafür die Begriffe der »industrial poetics« (ebd., S. 86) und des »socioprofessional discourse« (ebd., S. 87), der darauf aufmerksam mache, dass Produktion immer auch als soziale Konstruktion verstanden werden müsse (ebd.).
Die vorliegende Arbeit nimmt Atkinsons und Caldwells Impulse auf, bezieht die Semantisierungen von Produktion aber weniger auf das konkrete Umfeld eines einzelnen Films (Atkinson) oder auf soziokulturelle Selbstbeschreibungen von Praktiker*innen (Caldwell). Ich gehe vielmehr davon aus, dass Making-ofs eigene Semantisierungen von Filmproduktion hervorbringen, die als eine übergeordnete Produktionsästhetik beschreibbar sind. Damit meine ich keine Filmästhetik, die auf bestimmte Produktionsprozesse rückführbar wäre. Vielmehr verstehe ich Produktionsästhetik hier als ein spezifisches, eigenes Erscheinungsbild von Filmproduktion, das Making-ofs einzeln oder im Verbund erzeugen.
Kurz zusammengefasst: Making-ofs beziehen sich auf das hors-cadre eines entstehenden Films – das wäre ihre filmtheoretische Dimension. Sie tun dies, um die Produktion dieses Films zu dokumentieren – das wäre die Dimension der Ökonomie und Soziologie, mithin also auch die Beobachtungsebene der Production Studies. Dadurch bringen Making-ofs unterschiedliche Bedeutungen und Gesamtbilder von Produktion hervor – das wäre schließlich ihre eigene, filmästhetische Ebene. Der Modus des Dokumentarischen ist hierbei insofern wichtig, als er die grundsätzliche Eigenständigkeit des »Wissens- und Erfahrungsraums« Produktion (Vonderau) garantiert. Es geht also nicht darum, anhand des Making-of einfach die Entstehung irgendwelcher Produktionsbilder nachzuverfolgen. Diese Bilder sind immer das Ergebnis dokumentarischer Verfahren, die sich auf reale Personen, Situationen und Vorgänge beziehen.
Mit diesem Modell soll in der vorliegenden Studie ein Panorama zeitgenössischer Formen des Making-of entfaltet werden. Das Making-of wird damit als ein wichtiges Phänomen der Film- und Medienkultur des frühen 21. Jahrhunderts markiert. Mit seinen ästhetischen Verzweigungen hängt auch der theoretische Rahmen zusammen, in dem sich die folgende Untersuchung bewegt. Malte Hagener (2011, S. 47–51) argumentiert, dass eine Beschäftigung mit den heutigen Transformationen filmischer Bilder nicht umhinkommt, die Situation aus mehreren Perspektiven anzugehen. Film verändert sich technisch, er verändert sich aber auch wirtschaftlich, ästhetisch und kulturell. Es mache wenig Sinn, diese Ebenen künstlich auseinanderzurechnen; vielmehr gelte es, sie gemeinsam im Blick zu behalten. Das scheint auch für eine Untersuchung des Making-of angezeigt.
Die konzeptuellen Werkzeuge für die folgenden Analysen stammen dementsprechend aus einer philosophisch-ästhetisch ausgerichteten Film- und Medientheorie, aber auch aus der Filmökonomie, der Technikgeschichte und den kulturwissenschaftlichen Production Studies. Meistens stehen dabei Fallbeispiele für Making-ofs im Zentrum, die die Entstehung einzelner Filme mitverfolgen. Diese Beschränkung hat in erster Linie pragmatische Gründe und soll nicht suggerieren, dass Making-ofs nur bei Filmproduktionen realisiert werden. Selbstverständlich kann auch die Entstehung einer TV-Nachrichtensendung oder eines TikTok-Clips durch ein Making-of dokumentiert werden. Die Ergebnisse der folgenden Analysen sind potenziell auch auf solche Bewegtbilder übertragbar.
Eine zweite Einschränkung betrifft die Making-ofs selbst. Die hier vorgeschlagene Begriffsverwendung ist zunächst etwas weiter als im Alltagsdiskurs und im Industriejargon. Die folgenden Kapitel widmen sich nicht nur den dokumentarischen Videos, die als Extras auf DVDs, Blu-rays oder in Streamingportalen angeboten werden. Making-ofs sind komplexer: Sie können ebenso gut in Gestalt längerer Dokumentarfilme oder auch als kurze Videos auftreten, die eine Schauspielerin in ihren eigenen Social-Media-Kanälen postet. Entscheidend ist, dass diese Making-ofs alle auf bewegten Bildern basieren. Es existieren weitere Formen der Dokumentation von Filmproduktion, die gelegentlich als Making-of verstanden werden, darunter Ausstellungen, literarische Texte oder auch touristische Reiseangebote (Cronin 2019). Der Fokus liegt im Folgenden jedoch rein auf filmischen Verfahren. Diese Schwerpunktsetzung ist wichtig, um die Implikationen des Making-of für eine allgemeine Ästhetik des Films nicht aus den Augen zu verlieren.
Zur Schärfung der zeitgenössischen Fallbeispiele erfolgen im Verlauf der Arbeit kurze Abstecher zu historischen Making-ofs. Diese Exkurse unterstreichen die reichhaltige Geschichte der Form. Making-ofs lassen sich bis zu den Anfängen des Films zurückverfolgen, wie das ALICE-GUY-Beispiel zeigt. Aber sie haben sich historisch immer wieder verändert – bis zu den ubiquitären Formen im frühen 21. Jahrhundert, die im Zentrum der Studie stehen.
Die Untersuchung ist folgendermaßen aufgebaut: Das erste Kapitel erarbeitet eine theoretische Annäherung an das Making-of über das Konzept des hors-cadre. Dafür kann auf eine Reihe von filmhistorischen und filmphilosophischen Lesarten des hors-cadre zurückgegriffen werden. Diese Positionen sind für das Making-of relevant, weil sie ein vielschichtiges Außen des Films beschreibbar machen. Filmproduktion ist in diesem Außen situiert und wird vom Making-of in diesem Außen dokumentiert. Diese Dokumentation ist nicht an ein bestimmtes Genre oder Format gebunden. Deshalb ist es produktiv, das Making-of nicht als eigenes Genre, sondern eher als eine lose dokumentarische Form zu verstehen, die in verschiedenen Gattungs- und Genrekontexten auftreten kann.
Auf dieser Grundlage untersuche ich in den nachfolgenden Kapiteln vier verschiedene Gegenstandsbereiche des zeitgenössischen Making-of. Im zweiten Kapitel steht mit DVD- und Blu-ray-Bonusmaterialien eine bekannte und sehr populäre Spielart im Fokus. Die Annäherung an DVD- und Blu-ray-Making-ofs erfolgt allerdings nicht über ausgesuchte Einzelbeispiele, sondern über ein größeres, weitgehend zufällig zusammengestelltes Korpus. Das Ziel des Kapitels besteht darin, anhand von durchschnittlichen, massiv konventionalisierten Making-ofs ein vergleichbar konventionalisiertes, ästhetisches Konzept von Produktion zu bestimmen. Die Analyse wird zeigen, dass DVD- und Blu-ray-Making-ofs die Produktion der dazugehörigen Filme vor allem als Rückseite dieser Filme begreifen.
Das dritte Kapitel nimmt die Ergebnisse des zweiten Kapitels auf. Es unterzieht solche Making-ofs einer näheren Betrachtung, die sich mit DVD- und Blu-ray-Extras und zugleich mit der Instanz des entstehenden Films mal spielerisch-humoristisch, mal offen ablehnend auseinandersetzen. Die ausgewählten Making-ofs dokumentieren weiterhin die Entstehung eines Films. Doch sie tun dies in einer Art und Weise, dass Vorgänge und Handlungen von Produktion – so der zentrale Befund – als kritische Interventionen verstanden werden können.
Anschließend rücken im vierten Kapitel verschiedene Varianten des Making-of in den Blick, die in Onlinevideoportalen und auf Social-Media-Plattformen zirkulieren. Der methodische Zugriff erfolgt wieder über gebündelte Fallbeispiele, die unterschiedliche, plattformspezifische Ausprägungen des Making-of veranschaulichen. Dazu zählen eine formale Verknappung und inhaltliche Verdichtung, außerdem eine starke Betonung einzelner Herstellungsvorgänge in ihrem momentanen Vollzug. Das Internet bringt Making-of-Typen hervor, die Produktion vor allem als eine Performance interpretieren.
Das fünfte Kapitel widmet sich verschiedenen Beispielen, die sich am weitesten von einem landläufigen Begriff des Making-of entfernen. Es handelt sich zwar immer noch um dokumentarische Filme über die Entstehung eines Films, aber sie transportieren eine vergleichsweise ungewöhnliche Auffassung, was im jeweiligen Fall als Produktion gelten kann. Sie begreifen Produktion als ein peripheres Phänomen, das in Bereiche vorstößt, in denen sich die Herstellung eines Films und eine allgemeine, außerfilmische Wirklichkeit zu überlappen beginnen. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint Produktion als etwas tendenziell Nicht-Filmisches, das gleichzeitig am Rand von herkömmlichen Vorstellungen des Filmemachens und am Rand von herkömmlichen filmischen Ästhetiken zu verorten ist.
Diese unterschiedlichen Annäherungen an das Making-of – im inhaltlichen wie im methodischen Sinne – werden im Schlussteil der Studie zusammengefasst. Dabei werde ich auch noch einmal auf den zeitgenössischen, medienkulturellen Stellenwert des Making-of zu sprechen kommen und diskutieren, warum ausgerechnet in den letzten Jahren so viele dokumentarische Darstellungen von Filmproduktion entstanden sind. Denn die zeitgenössische Proliferation des Making-of hat nicht nur etwas mit einem wachsenden Interesse für technische Produktionsabläufe oder mit veränderten ökonomischen Rahmenbedingungen zu tun. Making-ofs reagieren auf eine neue Unbestimmtheit des Films im Post-Cinema – und schlagen vor, das, was Film heute ist, verstärkt über sein hors-cadre zu begreifen.
1Archivarische Filmtitel werden im Folgenden mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet. Die genauen Besitznachweise sind im Film- und Medienverzeichnis angegeben.
2Bevor Making-ofs auch Featurettes genannt wurden, war der Begriff bis in die 1950er-Jahre als Formatbezeichnung für einen Zweiakter à zwei Filmrollen gebräuchlich – ein ›kleiner‹ feature film, kürzer als der abendfüllende Langfilm. Das Featurette-Format ist nach den 1950er-Jahren weitgehend aus dem Kino verschwunden.
3Siehe exemplarisch, am Beispiel Netflix, Tryon (2015).
4Siehe https://www.lemonde.fr/making-of/ [letzter Zugriff: 02.01.2024].
5Für einen Diskussionsüberblick siehe Morsch (2021, S. 572–577). Ein gutes Kondensat der Post-Cinema-Diskussion bieten Denson/Leyda (2016), Hagener/Hediger/Strohmeier (2016) und Chateau/Moure (2020).
6Schleiermacher verwendet dafür den Ausdruck »Receptivität«, die er grundsätzlich passiver als die »Productivität« konzipiert und stellenweise auch mit wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn assoziiert. »Productivität« verortet er dagegen vollständig auf der Seite der Kunst (Schleiermacher 2021 [1819]; Zill 2003, S. 62–63).
7Siehe hierzu, am Beispiel der US-Filmindustrie, Wasko (2003).
8So Schmitt auf der Tagung »In Wirklichkeit Animation« an der Fachhochschule St. Pölten vom 26. bis 28.11.2018. Ich danke Bernhard Schmitt für seine Erlaubnis, das Zitat zu verwenden.
9Dies wäre, nach Chris Tedjasukmana (2021, S. 159–163), eher das Erkenntnisinteresse der klassischen Filmsoziologie.
10Beispiele für diese Forschungsrichtung sind folgende Sammelbände: Mayer/Banks/Caldwell (2009), Szczepanik/Vonderau (2013), Banks/Conor/Mayer (2016) und Udelhofen/Göttel/Riffi (2023). Production-Studies-Schwerpunkte finden sich außerdem in den Zeitschriftenausgaben montage AV (2013, 22 [1], »Produktion«), Cultural Studies (2014, 28 [4], »Theorizing Production/Producing Theory«) und Navigationen (2018, 18 [2], »Medienindustrien«), die speziell die Produktions- und Medienindustrieforschung aus dem deutschsprachigen Raum bündelt (Krauß/Loist 2018). Für einen einführenden Gesamtüberblick über das Feld siehe Herbert/Lotz/Punathambekar (2020, S. 50–66).
11Siehe einführend Hesmondhalgh (2006; 2019), Holt/Perren (2009) sowie – mit einem Fokus auf die Auswirkungen der digitalen Vernetzung in den Medienindustrien – die Beiträge in Deuze/Prenger (2019).
12Für einen kritischen Überblick über den Prosumer-Diskurs siehe Deuze (2009).
13Jean-Pierre Geuens Film Production Theory (2000) ist meines Wissens die einzige Publikation, die explizit den Anspruch einer grundlegenden Theoretisierung von Filmproduktion formuliert. Darunter versteht Geuens aber vor allem philosophische Denkanstöße für angehende Filmpraktiker*innen.
14Hier und im Folgenden verwende ich für hors-cadre das Genus Neutrum, schreibe also »das hors-cadre«, weil der vollständige Ausdruck in der deutschen Übersetzung »das Außen des Rahmens« oder »des Einzelbildes« lauten würde. Im Deutschen ist auch die maskuline Übertragung (der hors-cadre) gebräuchlich. Häufige fremdsprachliche Fachbegriffe wie hors-cadre werden im Laufe dieser Arbeit bei der ersten Nennung kursiv, danach für eine bessere Lesbarkeit normal gesetzt.
1.Produktion als Außen
Die in der Einleitung beschriebenen Szenen aus ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE und CAPTURING AVATAR zeigen Menschen, Dinge und Abläufe, die in der phonoscène und in AVATAR nicht vorkommen. Dazu gehören sowohl die beiden Studioumgebungen als auch das eingesetzte Produktionsgerät – unabhängig davon, ob es sich dabei um ein frühes Tonfilmsystem oder um eine Motion-Capture-Bühne und eine virtuelle Kameravorrichtung handelt. Die grundlegende Struktur ist jeweils dieselbe: Was in ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE und CAPTURING AVATAR für die Umsetzung einer phonoscène und eines 3D-Kinofilms mobilisiert wird, ist in der phonoscène und im 3D-Film weder zu sehen noch zu hören.
Fragen von filmischer Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit werden in der Filmtheorie oft mit der Kategorie des Offs und des off-screen space in Verbindung gebracht. Das Off wird klassischerweise als unsichtbare Erweiterung des filmischen Raums definiert. Es basiert auf dem Wahrnehmungseindruck, dass der filmische Raum jenseits der Bildränder einer Einstellung weitergeht.1 Die französische Terminologie ist hier präziser als die englische, denn sie kennt für das Außerhalb eines Bildes mehrere Begriffe. Der unsichtbare Raum im Off wird meistens als hors-champ bezeichnet – als ein Außen des sichtbaren Bildfeldes. Davon zu unterscheiden ist das sogenannte hors-cadre. Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie und Marc Vernet verwenden den Begriff, um auf eine spezielle Dimension des filmischen Außen aufmerksam zu machen, die das Konzept des hors-champ nicht abdeckt:
As for that space of the film production where the technical equipment, filmmaking activity, and, metaphorically, the work of écriture are all deployed and undertaken, it will be more useful to use the phrase ›out of frame‹ [franz.: hors-cadre, FH]. This term may be inconvenient since it is rarely used, yet by way of compensation it offers the advantage of referring directly to the frame, that is, to an artifact of the film’s production, and not to the screen space, which is already produced and taken in by the illusion. (1992, S. 15–18)
Das hors-cadre charakterisiert das filmische Bild also als ein gemachtes Artefakt. Es betont eine spezielle Außenseite, nämlich den »space of the film production«. Dieser Raum entspricht zunächst dem realen, empirischen Off jenseits des Bildausschnitts einer filmenden Kamera. Den Autoren zufolge kann er aber auch im weiteren Sinne als allgemeiner, unsichtbar bleibender Raum des Filmemachens verstanden werden, der jenseits des cadre oder frame liegt. Im Französischen und Englischen schwingen hier zwei Bedeutungen mit: cadre/frame meint sowohl die Kadrierung, d.h. den kompositorischen Bildausschnitt, als auch den Kader, das materielle Einzelbild auf dem Filmstreifen.
Mein Vorschlag lautet, das Making-of mit dem hors-cadre zusammenzudenken. Diese Verknüpfung soll einerseits die filmästhetischen Implikationen des Making-of berücksichtigen, die in bisherigen Definitionen keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen. Andererseits soll die Verknüpfung mit dem hors-cadre helfen, die dokumentarische Qualität des Making-of und seinen Bezug auf die Produktion eines anderen Films besser zu beschreiben.
Dieses Argument wird in mehreren Etappen entfaltet. Den Ausgangspunkt bildet die immer wieder formulierte Idee, dass die äußeren Ränder eines Filmbildes in bestimmter Hinsicht wie ein Rahmen funktionieren. Aus diesem Rahmencharakter lassen sich, in einem zweiten Schritt, die Entstehung des Offs und die Ausklammerung von Herstellungsprozessen aus dem filmischen Bild ableiten. Der Begriff des hors-cadre entstand ursprünglich, um diese Exklusionsmechanismen präziser zu beschreiben. Die Ausblendung der Filmherstellung aus dem Film lässt sich allerdings noch weiterdenken, nämlich, in einem dritten Argumentationsschritt, als eine grundsätzliche, räumliche Unverfügbarkeit des Bildursprungs. Diese Unverfügbarkeit kann, viertens, auch als zeitliche Abgeschiedenheit der Bildhervorbringung bestimmt werden. Der »space of the film production« bei Aumont, Bergala, Marie und Vernet ist also nicht nur nicht sichtbar und nicht hörbar, er ist auch nicht gegenwärtig. Dadurch wird – letzter Schritt der Argumentation – der Bereich der Filmproduktion strukturell von einer Sphäre der Filmrezeption getrennt. Das Making-of vermag es, den Bereich der unsichtbaren, abwesenden Produktion für ein Rezeptionspublikum zu dokumentieren.
Im Verlauf dieses Theorieparcours möchte ich unterschiedliche Autor*innen miteinander in einen Dialog bringen, die sich mit Denkfiguren der filmischen Rahmung, des filmischen Außen und einer ästhetischen Ausblendung von Filmherstellung auseinandergesetzt haben. Für solche Positionen kann in der Geschichte der Film- und Medientheorie relativ weit zurückgegangen werden. Theoriehistorische Perspektiven sind für das Making-of überraschend produktiv. Denn auch Autor*innen, die ihre Überlegungen am Modell des klassischen, analogen und auf einer Kinoleinwand vorgeführten (Spiel)Films entwickelt haben, liefern ein präzises Vokabular, das für ein besseres Verständnis des Making-of fruchtbar gemacht werden kann. Mithilfe ihrer Positionen kann das Making-of als mediales Phänomen – auch unter digitalen und postkinematografischen Vorzeichen – weiter an Kontur gewinnen.
Bevor ich mit Überlegungen zur Rahmung des Filmbildes beginne, sind noch zwei methodische Vorbemerkungen notwendig. Erstens geht es mir im Folgenden nicht darum, ein fest umrissenes Genre namens Making-of zu definieren. Potenzielle Filmbeispiele bilden eher eine offene Menge – sie sind so lose miteinander verbunden wie ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE mit CAPTURING AVATAR. Zweitens schließt diese Arbeit an einen existierenden Diskurs an. Es gibt Filme, die allgemein als Making-ofs bezeichnet werden; ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE und CAPTURING AVATAR gehören sicherlich dazu. Das Ziel dieses Kapitels ist nicht, aus dieser Einordnung eine wasserdichte Definition zu extrahieren, sondern anhand des hors-cadre eine auffällige Gemeinsamkeit dieser Filme besser zu verstehen.
Gerahmte Bewegtbilder
In ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE ist die Entstehung eines Tonkurzfilms in einer markant komponierten, filmischen Einstellung zu sehen. Das, was im Bild als Aufnahmecrew und Aufnahmetechnik identifiziert werden kann, ist rings um den hellen, szenischen Raum angeordnet. Die Silhouetten der Lichtmasten, Reflektoren, Kameras und arbeitenden Techniker bilden einen visuellen Rahmen, der den bespielten Kulissenraum einfasst. Dort, wo der Umraum der Studiotechnik und der Mitarbeiter*innen beginnt, scheint eine Grenze zu verlaufen. Die von Guy verwendete Kamera erfasst mutmaßlich nur die angeleuchtete Kulisse und die Tänzer*innen. Sie lässt ihre eigene Kadrierung dort enden, wo die dunklen Reflektoren und Lichtmasten ins Bild hineinragen würden.
Auch ein zweiter Film, den etwa Journot (2011, S. 73) als frühes Making-of bezeichnet, strukturiert seine Darstellung von Dreharbeiten über das Motiv des Rahmens. Jean Dréville, der die Entstehung der Literaturadaption L’ARGENT (DAS GELD, 1928, Marcel L’Herbier) mit einer Filmkamera begleiten durfte, inszeniert in AUTOURDE L’ARGENT (1929) die Studiohallen mit ihren Lichtanlagen, Kamerasystemen und geschäftigen Technikern immer wieder als Rahmen um die Schauspieler*innen und Sets. Schon zu Beginn seines Films fährt die Kamera, nachdem die klobigen Scheinwerfer unter der Studiodecke angeworfen wurden, langsam in die erleuchteten Kulissen hinein, vorbei an den dunklen Rückseiten der Bauten und Deckenaufhängungen, die das Set visuell einrahmen (TC 00:03:39-00:04:11; Abb. 2). In der Schlussszene zieht sich die Kamera wieder aus der leeren Kulisse zurück. Links und rechts kommen die Rückseiten der Stellwände ins Bild, ringsherum gehen die Studiolichter aus (TC 00:35:40-00:37:14; Abb. 3).
Abb. 2–3: Studioräume und technisches Gerät als visuelle Rahmen um die Sets von L’ARGENT.
Quelle: AUTOURDE L’ARGENT, DVD, Stills.
Der Rahmen gehört gleichermaßen zum festen Begriffsvorrat der klassischen Filmtheorie. Er wird vor allem dann als Konzept herangezogen, wenn das Verhältnis zwischen dem visuell begrenzten Filmbild und seinen möglichen, unsichtbar bleibenden Außenzonen bestimmt werden soll. ALICE GUYTOURNEUNEPHONOSCÈNE und AUTOURDE L’ARGENT setzen dieses Verhältnis gewissermaßen direkt in ein filmisches Bild. Sie zeigen, wo eine Trennlinie zwischen einer geplanten filmischen Einstellung und ihrem unmittelbaren, realen Umraum verläuft. Der Rahmen, die Abgrenzung des Filmbildes nach außen, scheint in dieser Hinsicht ein geeigneter Startpunkt, um einen filmtheoretischen Begriff des Making-of zu entwickeln.
Rudolf Arnheim ist mutmaßlich der erste Autor, der in den ausgehenden 1920er-Jahren eine Verknüpfung zwischen dem filmischen Bild und dem Konzept des Rahmens vornimmt. In Film als Kunst, rund zwei Jahre nach AUTOURDE L’ARGENT entstanden, stellt Arnheim (2002 [1932], S. 31–34) einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem menschlichen Sehvermögen und dem filmischen Bild fest. Das »Sehfeld« eines Menschen sei begrenzt, weil seine Augen nur einen bestimmten Raumwinkel überblicken können. Diese Begrenzung werde aber als solche nicht wahrgenommen. Man könne die Ränder des eigenen Sehraums nicht sehen, weder als Zonen zunehmender Unschärfe noch als scharfe, limitierende Kanten. Augen- und Kopfbewegungen würden außerdem dafür sorgen, dass beim Sehen der Eindruck eines holistischen, »einheitlichen Sehraum[s]« (ebd., S. 31) entsteht. Dagegen ist das Filmbild nicht nur ein begrenztes Feld, seine Grenzen sind auch von den Zuschauer*innen wahrnehmbar. Arnheim schreibt: »Die Begrenzung, die das Bild hat, empfinden wir sofort als eine solche. Der abgebildete Raum ist bis zu einer bestimmten Ausdehnung sichtbar, dann aber kommt ein Rand, der das Weitere abschneidet« (ebd., S. 32).
Das »wir«, aus dessen Perspektive Arnheim hier schreibt, ist das Publikum im Kinosaal. Im Laufe seiner weiteren Ausführungen wechselt er jedoch streckenweise auf die Seite derjenigen, die mit einer Kamera tatsächlich Filme machen. Für sie sei die rahmende Begrenzung des Bildes eine willkommene Herausforderung, weil sie nach kreativen Entscheidungen verlangt. Filmemacher*innen müssten aktiv aus der prinzipiellen »Unbegrenztheit des Wirklichen« (ebd., S. 84) ein Motiv auswählen, das innerhalb der festen Grenzen der Einstellung zu sehen sein soll. Film ist für Arnheim deshalb niemals direkte Wiedergabe der Wirklichkeit, sondern ihre gezielte ästhetische ›Einrahmung‹. Der Rahmencharakter des bewegten Bildes ist eine wichtige Voraussetzung, um Film als eine neue, legitime Kunstform zu beschreiben.
Um die Klärung grundsätzlicher Bildeigenschaften geht es auch André Bazin, einer zweiten theoriehistorischen Station des Rahmenbegriffs. Bazins Methode ist ebenfalls der Vergleich. Doch während Arnheim natürliches Sehen und Filmbild gegenüberstellt, kontrastiert Bazin zwei unterschiedliche Bildtypen: Malerei und Film. In seinem gleichnamigen Aufsatz (2004a [1959]) stellt er zunächst fest, dass sowohl das Gemälde als auch das projizierte Filmbild für ihre Betrachter*innen bzw. Zuschauer*innen sichtbar begrenzt sind. Doch diese Begrenzung hat, laut Bazin, sehr unterschiedliche Konsequenzen:
[D]er Rahmen des Gemäldes ist eine Zone räumlicher Desorientierung. Er stellt dem natürlichen Raum und dem unserer aktiven Erfahrung, der den Rahmen außen umgibt, einen nach innen orientierten Raum gegenüber: Der kontemplative Raum öffnet sich nur auf das Innere des Gemäldes. Die Umgrenzung der Kinoleinwand ist kein ›Rahmen‹ des Kinobildes, wie die technischen Begriffe manchmal glauben machen, sondern ein Kasch, eine Abdeckung, die nur einen Teil der Realität freilegen kann. Der Rahmen polarisiert den Raum nach innen, hingegen ist alles, was die Leinwand uns zeigt, darauf angelegt, sich unbegrenzt ins Universum fortzusetzen. Der Rahmen ist zentripetal, die Leinwand zentrifugal. (Ebd., S. 225)
Bazin beschreibt damit zwei abweichende Wahrnehmungseindrücke. Er nimmt an, dass der Gemälderahmen den Aufmerksamkeitsfokus seiner Betrachter*innen notwendigerweise auf das Innere des Gemäldes lenkt,2 während im Kino das genaue Gegenteil geschieht. Man könnte Bazin vorwerfen, hier einen potenziellen Rezeptionseffekt zu verabsolutieren. Tatsächlich steht seine These aber im Kontext einer Auseinandersetzung mit verschiedenen Filmen über Malerei, besonders solche, die ein Gemälde nicht vollständig in einer einzigen, fixen Einstellung abbilden. Das Interessante an einem Film wie Alain Resnais’ VAN GOGH (1948) ist für Bazin, dass hier die äußeren Grenzen der Einstellungen gerade nicht mit den äußeren Grenzen der Van-Gogh-Bilder zusammenfallen. Vielmehr filmte Resnais die Gemälde nur portionsweise. Seine Kamera zerlegt die Bilder in kleinere Ausschnitte; bestimmte Partien werden erst durch Umschnitte oder Kamerabewegungen sichtbar.
Bazin arbeitet heraus, wie Resnais den ganzheitlichen Bildraum eines Gemäldes durch ein filmisches Spiel mit mal sichtbaren, mal unsichtbaren Raumausschnitten ersetzt. Zuschauer*innen des Films können kaum wissen, wo ein Gemälde aufhört und das nächste anfängt. Anders als Arnheim, der Filmbilder im Grunde als stillgestellte, unbewegte Leinwandprojektionen behandelt,3 registriert Bazin hier eine spezifische Dynamik: Filme können die Begrenzung einer Einstellung jederzeit überschreiten. Weil sie bewegte Bilder sind, ist es ihnen möglich, ihr visuelles Bildfeld zu verschieben –





























