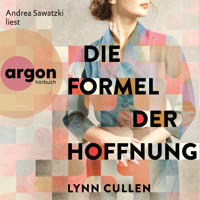17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
»Ich bin beeindruckt von dieser Wissenschaftlerin, die viel zu lange übersehen worden ist - ein kluge, mutige und großherzige Frau.« Andrea Sawatzki Vanderbilt-Hospital, Nashville 1940: Dr. Dorothy Millicent Horstmann fällt auf unter den Ärzten der Klinik. Sie ist 1,85 m groß. Und sie ist eine Frau – meistens die einzige im Raum. Dorothy stammt aus kleinen Verhältnissen, doch sie hat Großes vor: Sie will die Kinderlähmung bezwingen, die so viel Leid im ganzen Land verursacht. Zu viele Patienten hat sie als junge Kinderärztin in der »eisernen Lunge« um Luft ringen sehen. Dorothy kennt nur ein Ziel: das Virus auszulöschen, durch Heilung oder einen Impfstoff. Die berühmten Forscher in ihrem Umfeld zweifeln an ihrer These zur Ausbreitung des Virus im Körper, aber sie wird ihnen beweisen, dass sie recht hat – um jeden Preis. Im Rennen gegen die Zeit wird sie zur Pionierin, die ihr privates Glück und ihr eigenes Leben aufs Spiel setzt. »Ohne Dr. Dorothy Horstmann hätte es nie einen Impfstoff gegeben. Einen großen Applaus für dieses Buch, das Dorothys brillante Arbeit in den Vordergrund rückt – und uns an Frauen in der Wissenschaft erinnert.« Bonnie Garmus, Autorin des Bestsellers »Eine Frage der Chemie«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Ähnliche
Lynn Cullen
Die Formel der Hoffnung
Roman
Über dieses Buch
Die Geschichte einer Frau, die gegen ein mysteriöses Virus kämpfte – in einer Welt, in der für Frauen kein Platz war.
Leere Schwimmbecken, verlassene Parks, unbesetzte Schaukeln und verwaiste Wippen: Nirgendwo Kinder zu sehen in diesem heißen August – als hätte man sie aus dem Bild geschnitten. Der Sommer ist die Jahreszeit der Angst. Ausbrüche von Kinderlähmung bedrohen in den vierziger und fünfziger Jahren das Leben vieler Familien.Während die besten Forscher der Welt sich ein Rennen um den ersten Impfstoff liefern, kämpft die Ärztin Dorothy Horstmann unter Einsatz des eigenen Lebens gegen das Virus, bei den Erkrankten und im Labor.
»Dank diesem Buch erfahren wir endlich, wie viel Dorothy Horstmann und so viele andere Frauen geopfert haben, um das Unmögliche zu erreichen. HERstory vom Feinsten.« Melanie Benjamin
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Lynn Cullen wuchs in Fort Wayne, Indiana, als fünftes Mädchen in einer Familie mit sieben Kindern auf. Sie lernte, Geschichte in Verbindung mit Reisen zu lieben, als sie bei jährlichen Ausflügen mit der Familie historische Stätten in den USA besichtigte. Sie besuchte die Indiana University in Bloomington und Fort Wayne und belegte Schreibkurse an der Georgia State University.
Als ihre drei Töchter noch klein waren, schrieb sie Kinderbücher, während sie in einer Kinderarztpraxis und später in der Redaktion einer Zeitschrift für Psychoanalyse an der Emory University arbeitete. Lynn Cullen liebt es noch immer, zu reisen und in der Vergangenheit zu graben, und hat mehrere historische Romane veröffentlicht, die zu US-Bestsellern wurden. Die Autorin lebt heute mit ihrer großen Familie in Atlanta.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
1940–1941
Eine Ehefrau
1
2
3
4
5
6
7
1942
Eine Großmutter
8
9
1944–1945
Eine Krankenschwester
10
11
12
13
14
15
1945
Eine Sekretärin
16
17
1948
Eine Ehefrau
18
19
1949
Eine Mutter
20
21
22
23
24
1950–1951
Eine Wissenschaftlerin
25
26
27
28
1952
Eine Ehefrau
29
30
1953
Eine Statistikerin
31
32
33
34
35
1954–1956
Eine Sekretärin
36
Eine Ehefrau
37
38
1959–1960
Eine Großmutter
39
40
1963
Eine Tochter
Danksagung
Personen-/Figurenverzeichnis
Für die Kinder in meinem Leben, Keira, Ryan,
Will, Maeve, Vivi, Olivia und Sloane,
mit Dank an Dr. Dorothy Horstmann
für ihre Hilfe, sie zu schützen.
Alle Wahrheiten sind einfach zu verstehen, sobald sie entdeckt wurden. Die Schwierigkeit ist, sie zu entdecken.
Galileo Galilei
1940–1941
Eine Ehefrau
1940
Arlene kam einfach nicht über die leeren Schwimmbecken hinweg. Es war der erste Juli. Das Wasser sollte nur so schäumen vor Kindern. Ein Rettungsschwimmer sollte auf seinem Holzthron lässig mit seiner Trillerpfeife spielen, Mütter sollten Thermosflaschen mit Kool-Aid herausholen, in Wachspapier eingepackte Sandwiches mit Eiersalat verteilen und die Steinchen der Beckeneinfassung von den schlaffen Windeln der Kleinsten fegen. Doch jetzt klaffte das Becken weit auf wie die Zahnreihe eines Kindes, in der sich gerade die erste Lücke zeigte. Der einzige Besucher war ein kurzhaariger schwarzer Hund, der ein Bonbonpapier fraß.
In bereits schweißnassen Kleidern versuchten Arlenes zweieinhalb und vier Jahre alte Mädchen von der Rückbank nach vorn zu klettern. Sie hielt sie mit einem Arm zurück, während sie den Anschlag an einem Telefonmast las:
Gefahr!
Kinderlähmung!
Polio!
Die Badeanstalt ist geschlossen!
Auf Anordnung des Gesundheitsamtes der Stadt Nashville ist das Schwimmen verboten
»Mädels! Es ist geschlossen. Setzt euch wieder hin!«
Sie hatte nicht damit gerechnet, dass das Bad geöffnet sein würde. Es war den Großteil des Sommers über geschlossen gewesen. Sie war auf dem Weg ins Krankenhaus, um ihrem Mann das Mittagessen zu bringen, und hatte nur hier angehalten, damit die Mädchen es selbst sahen und sie nicht länger anbettelten, baden zu gehen.
Arlene fuhr weiter, durch den Park mit den hohen Bäumen, vorbei an leeren Schaukeln, vorbei an einem stillgelegten Karussell, vorbei an verwaisten Wippen. Kurz darauf kamen sie in ein Viertel mit weißen Fachwerkhäusern. Frauen in Schürzen hängten im Garten Wäsche auf, Katzen saßen draußen auf der Veranda neben dem Drahtkorb des Milchmanns, und Männer schoben den Rasenmäher über den dunkelgrünen Augustrasen. Nirgendwo waren Kinder zu sehen. Es wirkte wie ein Bild von Norman Rockwell, aus dem die Kinder herausgemalt worden waren.
Vor ein paar Jahren hatte sie in der Zeitung von Städten gelesen, die von Polio heimgesucht wurden und daraufhin wie Pestdörfer im Mittelalter unter Quarantäne gestellt wurden. Sie war entsetzt gewesen, als sie erfuhr, dass Polizisten am Stadtrand Straßensperren errichtet hatten, um die Polioopfer einzuschließen und die Gesunden auszusperren. So etwas gab es heute nicht mehr. Man konnte im Sommer herumreisen, wie man wollte, solange es einem nichts ausmachte, Angst um seine Kinder zu haben.
Als sie an einer Ampel wartete, balgten sich die Kinder auf dem Rücksitz. Arlene rieb sich die Augen. In Gedanken sah sie Mikey Brown vor sich, der sich mit seinen Beinschienen zur Kirche schleppte, und das kleine Mädchen im Rollstuhl, das von seiner tapfer lächelnden Mutter in den Supermarkt geschoben wurde. Sie erinnerte sich an eine von Barrys kleinen Patientinnen, die in einer eisernen Lunge leben musste und Arlene durch den angewinkelten Spiegel über ihrem neumodischen Apparat beobachtete. Aber ihre Mädchen konnten Gott sei Dank noch laufen.
Beim Krankenhaus parkte sie am Bordstein und lockte ihre Älteste, Suzie, vom heißumkämpften Platz unter der Ablage am Heckfenster hervor. Sie richtete die Schleifen, die die Haare der Mädchen in kleinen Knoten auf ihren Köpfen zusammenhielten, und strich ihre Röcke glatt, dann tupfte sie ihre eigene feuchte Stirn mit dem Taschentuch ab, bevor sie die braune Papiertüte mit Barrys Mittagessen nahm.
Auf dem Weg zu Barrys Etage schärfte sie den Mädchen ein, dass sie im Krankenhaus unbedingt leise sein mussten. Sie dürften die kranken Menschen hier nicht aufwecken. Der Fahrstuhlführer zog die Tür auf, und sie entdeckte Barry beim Schwesternzimmer. Er trug den Laborkittel, den sie gebleicht, gestärkt und gebügelt hatte, und grinste sie an. Die Mädchen stürmten los. »DADDY! DADDY! DADDY!«
Mit je einem Kind, das sich an sein Bein klammerte, stapfte er zum Empfangstresen. Die Sekretärin dahinter hörte auf zu tippen. »Sind sie nicht herzallerliebst?«
»Darf ich?« Barry deutete auf die Schale aus geschliffenem Glas auf dem Tresen.
»Nur zu.«
Er fischte zwei Lollis für die Mädchen heraus. »Wer möchte einen Lutscher?«
Gierig schnappten sie sich die Süßigkeiten und kämpften mit dem Einwickelpapier. »Die sind neu«, erklärte er Arlene, als die Mädchen ihr die Lollis zum Auspacken reichten. »Saf-T-Pops. Der Stiel ist gebogen, so dass er sich nicht in den Gaumen bohrt, wenn ein Kind damit hinfällt.«
»Pfiffig.«
Die Familie schlenderte den Korridor entlang, in dem es stark nach Reinigungsalkohol und Jod roch. Die Mädchen lutschten an ihren Lollis, und Arlene hörte zu, als Barry ihr erzählte, wie beschäftigt er war. Das wusste sie natürlich. Seit er im letzten Juli seine zweijährige Assistenzzeit begonnen hatte, kam er häufig erst spätabends nach Hause. Er war dann so müde, dass er nur noch das Abendessen herunterschlingen konnte, das sie ihm aufwärmte, während er duschte, und dann ins Bett kroch. Heute sollte ein weiterer Assistenzarzt eintreffen. »Ein Kerl namens D.M. Horstmann«, sagte er. »Der gute D.M. sollte sich besser beeilen und mir zur Hand gehen, bevor der Vater dieser Kinder tot umfällt.«
»Barry.« Sie fühlte sich heute selbst seltsam müde, als würde auf der zellulären Ebene ihres Körpers ein Kampf ausgefochten. Angst streckte ihre scheußlichen Tentakel bis in ihre Eingeweide aus. Es war jetzt schon das dritte Mal, dass sie sich so seltsam fühlte.
Ulkig, dass eine Schwangerschaft in gewisser Hinsicht wie Polio war – körperliche Distanz war die einzige Möglichkeit, sie zu verhindern.
Die Mädchen hatten die Standwaage entdeckt und hüpften darauf herum.
»Mädels!« Doch sobald sie ein Kind heruntergezogen hatte, krabbelte das andere bereits wieder auf die Trittfläche. Sie amüsierten sich prächtig und zerrten abwechselnd an dem Gerät und ihrem Dad, bis die zweijährige Trixie bei einem weiteren Versuch, glucksend die Waage zu erklimmen, nach hinten kippte. Ihr Kopf prallte auf die harten Bodenfliesen.
Arlene schrie auf. »Trix!« Sie riss das Kind sofort hoch, doch die Kleine bäumte sich auf und strampelte. Ihre Augen traten hervor, und das Gesicht lief rot an, doch sie schrie nicht.
»Barry! Sie erstickt!«
Arlene spürte einen Luftzug. Eine Frau eilte herbei, und mit einer geschickten Bewegung schnappte sie sich Trixie, ließ sich auf die Knie fallen, legte sich das Kind über den Unterarm und schlug sanft mit dem Handballen zwischen die Schulterblätter.
Eine rote Scheibe flog heraus, der gebogene Stiel dämpfte den Aufprall auf den Boden.
Hinter Arlene sagte eine tiefe Stimme: »Gut gemacht, Miss …«
Die Frau übergab Arlene das Kind und richtete sich zu ihrer vollen beachtlichen Größe auf. Arlene hatte noch nie eine so große Frau gesehen. Neben ihr sah Barry wie ein Schuljunge aus. Sie rückte ihren randlosen Hut über honigfarbenen Haarbüscheln gerade, während sie den eingestickten Namen auf dem Laborkittel des Sprechers las. Ein Lächeln erhellte ihr Gesicht. »Dr. Morgan! Genau Sie habe ich gesucht!«
Arlenes Blick sprang von dem Laborkittel zu Barry. Hugh Morgan war der Chefarzt. Barrys Boss.
Dr. Morgan legte den Kopf schräg. »Hatten wir bereits das Vergnügen …?«
»Ich bin Dorothy Horstmann.«
Auf Dr. Morgans knochiger Stirn bildeten sich Falten.
Die Frau holte Luft. »Dr. D.M. Horstmann«, fügte sie hinzu. »Ich bin Ihre neue Assistenzärztin. Bitte entschuldigen Sie meine Verspätung. Mein Bus hatte eine Reifenpanne.«
Arlene unterdrückte einen überraschten Aufschrei. D.M. Horstmann war eine Frau?
Dr. Morgans Haut schien zu eng für sein Gesicht zu werden. »Wir hatten letzten Winter telefoniert.«
»Ja!«
»Und ich habe Ihnen mitgeteilt, dass wir bedauerlicherweise keine freie Stelle mehr haben.«
»Ja, das haben Sie.« Sie öffnete ihre Tasche. »Stellen Sie sich nur vor, wie überrascht und dankbar ich war, als ich kürzlich dieses Bestätigungsschreiben erhielt.« Sie zog einen zusammengefalteten Brief hervor.
Dr. Morgan warf einen kurzen Blick darauf und gab ihn ihr zurück. Er schwankte leicht, wie ein Baum, auf dessen Stamm man eingehackt hatte und der kurz davor war, umzustürzen. Hatte er vergessen, wer D.M. Horstmann war?
Barry nahm Arlenes Arm. Sie ergriff die klebrigen Hände der Mädchen, und er führte sie von der feindseligen Konfrontation fort.
»Vielen Dank, Dr. Horstmann!«, rief sie über ihre Schulter. »Glaubst du, sie hat mich gehört?«, fragte sie Barry.
»Das spielt keine Rolle«, sagte er. »Sie wird nicht lange bleiben.«
1
Nashville, Tennessee, 1941
»He, Horstmann, wollen Sie einen Blödmann kennenlernen?«
Die Stimme drang durch das Getümmel, in dem Dorothy, ein moderner Gulliver, von winzigen kleinen Männern niedergerungen und gefesselt wurde. Anscheinend war sie in die geheimnisvolle Welt der Winzlinge gestolpert, und jetzt waren sie ziemlich erbost.
Mühsam öffnete sie ein Auge. Vor den Pappkartons im Lagerraum, in dem sich die Assistenzärzte gern ein Nickerchen gönnten, schaute ein Mann mit Babygesicht und rotem Kopf im weißen Kittel zu ihr herunter. Wahrscheinlich kein Traum. Barry Montgomery war wie sie Assistenzarzt im Vanderbilt. Aber ganz sicher war sie nicht. In den letzten achtundvierzig Stunden hatte sie dreißig Minuten geschlafen, was nicht ungewöhnlich war für die letzten zehn Monate im Vandy, und sie konnte ihren Sinnen nicht vertrauen.
Sie schloss ihre brennenden Augen. »Muss ich?«
»Ich glaube, diesen werden Sie sehen wollen, wenn man sich die Schwestern so ansieht.«
Aus dem Radio erklangen die letzten Töne eines Orchesterstücks. Dorothy hatte ganz vergessen, dass sie es eingeschaltet hatte, und jetzt verkündete das Geräusch klappernder Schreibmaschinen den Beginn einer Nachrichtensendung. Sie richtete sich auf und schaltete das Empfangsgerät aus.
»Wollen Sie die Nachrichten nicht hören?« Barry hatte drei Kinder, eines davon ein neugeborenes Baby, doch mit seinem fuchsroten widerspenstigen Haarwirbel und den rosigen Wangen sah er aus, als hätte er eher Steinschleuder und Mundharmonika in der Tasche und nicht Zungenspatel und Otoskop. Er war dreißig, ein Jahr älter als sie – sah sie auch noch so jung aus? »Was glauben Sie, in welches Land die Deutschen heute einmarschiert sind?«
Selbst im Halbschlaf machte sich ein unbehagliches Gefühl in ihr breit. Auf der anderen Seite des Globus spielten sich schreckliche Dinge ab, doch hier in den Staaten machten sie weiter, als wäre nichts geschehen. Es war unerträglich. »Gibt es denn noch Länder in Europa, die sie noch nicht besetzt haben?«
»Russland.« Barrys Stethoskop schlug gegen seinen weißen Kittel, als er sie auf die Füße zog. »Hoch mit Ihnen! Kommen Sie und sehen Sie sich diesen Kerl an – wenn Sie ihn durch die Mauer aus hechelnden Krankenschwestern sehen können.«
»Ich fasse es nicht, dass ich meinen kostbaren Schlaf dafür hergebe.«
»Schon gut. Sie können mir später danken.«
Ihr Traum war immer noch nicht ganz verflogen, als Barry sie den Flur hinunterschob. Es musste etwas damit zu tun haben, dass sie vorhin eine Gruppe A-Streptokokken unter dem Mikroskop betrachtet hatte. Wie robust diese Bakterien waren! Wenn sie sich in einer günstigen neuen Situation wiederfanden, wie auf einem Objektträger mit Blutagar, freuten sich die fröhlichen kleinen Hedonisten über ihr Glück und stürzten sich in eine wilde Fressorgie, woraufhin sie sich fortpflanzten und weiter fortpflanzten, bis nichts mehr übrig war, was sie aus diesem Leben noch heraussaugen konnten, und dann starben sie. Sie mochte die kleinen Monster fast gern, die so kühn waren, so hungrig, so versessen darauf, alles auszukosten. Sie würde sie mögen, wenn sie nicht Millionen Menschenleben kosten würden.
Ein unheilvolles mechanisches Zisch-STÖHN, Zisch-STÖHN drängte sich in ihre Gedanken. Hinter den Fenstern der Poliostation sah sie Krankenschwestern, die zwischen den weinenden Kleinkindern in ihren Wiegen und den Kindern im Ganzkörpergips hin- und herliefen. Andere Schwestern kümmerten sich um die Quelle des metallischen Stöhnens, die Beatmungsapparate, in denen einzelne Kinder lagen.
An der Universität hatte Dorothy einmal darum gebeten, in einer Eisernen Lunge liegen zu dürfen, um zu erleben, wie es sich anfühlte. Zwei Krankenschwestern hatten ihr die Bitte zögernd erfüllt und sich vielsagende Blicke zugeworfen, als sie sich auf eine Trage gelegt und befohlen hatte: »Schieben Sie mich hinein.«
Die Schwestern rollten sie neben das Beatmungsgerät und hoben sie wie bei Gullivers Reisen von der Trage auf die gepolsterte Liegefläche. Sie schoben die Liege in die Stahlröhre, schlossen den sargähnlichen Deckel und verriegelten ihn, so dass nur noch ihr Kopf herausschaute.
»Bereit!«
Jemand stellte das Gerät an. Mit einem Klicken sprang die Maschine an. Etwas drückte Dorothys Brust zusammen, als würde sich ein Elefant daraufsetzen. Nachdem jedes Fitzelchen Luft aus ihr herausgepresst worden war, stand der Elefant auf, und ein Tsunami aus Sauerstoff rollte über sie hinweg. Sie ertrank in Luft, bis der Elefant sich wieder setzte und alles aus ihr herausdrückte.
Sie klopfte an die Seiten des Tanks. Irgendwo aus ihren Lungen kratzte sie genug Luft zusammen und keuchte: »Hilfe!«
Die Schwester – Dorothy erinnerte sich noch immer an ihren Namen, Trudy – schob ihr Gesicht nur wenige Zentimeter über Dorothys. Ihr Atem roch nach dem Pfefferminzkaugummi, das zwischen ihren Zähnen und der Wange klemmte. »Gehen Sie mit. Lassen Sie los. Lassen Sie die Maschine die Arbeit machen.«
»Ich kann nicht!«
Dorothy spürte, wie jemand ihre Hand ergriff – Trudy hatte den Arm durch eine der Luken gesteckt. »Doch, Sie können.«
Beschämenderweise war sie den Tränen nah, doch Dorothy ließ zu, dass das Gerät die Luft aus ihren Lungen herauspresste und sie anschließend wieder freigab, damit frischer Sauerstoff in sie hineinströmen konnte. Sie atmete – nicht so, wie sie wollte, nicht bequem, nicht natürlich, nicht glücklich, aber sie atmete.
Noch heute fühlte sich diese Angst ganz frisch an, wenn sie über die aufgereihten Maschinen blickte. Der Spiegel über dem Kopfteil jedes Geräts zeigte das Entsetzen, die Verwirrung oder die Resignation des Kindes darin. Ihre Aufgabe als Ärztin war es, diese kranken Kinder zu heilen. Noch schlimmer, sie glaubten tatsächlich, sie könnte es.
Barry zog sie am Arm. »Kommen Sie, Horstmann. Sie werden Polio heute nicht besiegen.«
»Was, wenn ich es eines Tages schaffe?«
Er lachte. »Natürlich werden Sie das. Und ich finde die Quelle der ewigen Jugend.«
Am Ende des Flures hatte sich eine Menschentraube um die Schwesternstation gebildet. Der Mann im Mittelpunkt schien nicht sehr viel älter zu sein als Dorothy. Er sah geradezu lächerlich gut aus; das dunkle Haar war wie bei dem bekannten Matineeidol mit Pomade in Wellen gelegt, der Schnurrbart gepflegt und elegant. Er hatte sogar die gleiche Kinnspalte wie Laurence Olivier. Dem teuren Nadelstreifenanzug nach zu urteilen, könnte er tatsächlich ein Star sein, oder er hatte Geld. Die meisten Menschen in ihrem Beruf stammten aus reichen Elternhäusern, zumindest an den angesehenen medizinischen Hochschulen. Frauen waren an solchen Orten selten, Frauen aus Familien wie ihrer sogar noch seltener. Tatsächlich war sie in ihrem Fachgebiet bisher noch keiner anderen Person wie ihr begegnet. Sie war die menschliche Entsprechung eines Einhorns.
Barry sprach den Mann über die Schar der Krankenschwestern hinweg an. »Doktor, ich möchte Ihnen jemanden vorstellen.«
Als die Schwestern hörten, dass ein Arzt sprach, selbst wenn es nur ein Assistenzarzt war, machten sie den Weg für Barry frei.
»Entschuldigen Sie.« Dorothy versuchte, ebenfalls durchzukommen, doch die Schwestern waren nicht daran gewöhnt, einer Frau Platz zu machen. »Entschuldigen Sie bitte. Verzeihung.« Sie drückte den Arm einer Schwester, nachdem sie sie versehentlich angerempelt hatte, dann streckte sie dem jungen Dr. Aalglatt die Hand entgegen. »Ich bin Dorothy Horstmann. Ich freue mich, Sie kennenzulernen.«
Er hörte lange genug auf zu reden, um seinen Blick die beachtliche Strecke ihres Arztkittels von oben bis unten entlangwandern zu lassen. Sie wappnete sich. Nur zu. Sagen Sie es.
Er streckte seine Hand aus. »Dr. Horstmann, schön, Sie kennenzulernen. Albert Sabin. Dies ist mein Kollege …«, er schob den jungen Mann neben sich nach vorn, »… Robbie Ward.«
Dr. Ward, grobknochig und bullig wie ein Footballspieler, schob das Kinn zurück und gaffte sie an. »Sie sind aber groß!«
Na bitte. Irgendwie legte der Anblick einer einen Meter fünfundachtzig großen Frau in den Gehirnen der meisten Menschen einen Schalter um, und sie platzten mit diesen vier Worten heraus. Es war verblüffend.
Bewundernd schüttelte er den Kopf. »Und ziemlich blond.«
Vermutlich qualifizierte das Vogelnest auf ihrem Kopf sie als Blondine. Sie lächelte Dr. Ward an, um ihn nicht in Verlegenheit zu bringen, falls er begriff, wie idiotisch er sich anhörte, dann wandte sie sich an Dr. Sabin. »Sind Sie nicht derjenige, der Ärzten rät, im Sommer keine Tonsillektomien durchzuführen, weil man einen Zusammenhang zwischen Mandelentzündungen und Polio vermutet?«
Er verbeugte sich. »Genau der.«
»Wie alt waren Sie, als Sie diesen Aufsatz verfassten?«, fragte Barry. »Zehn?«
»Sechsundzwanzig«, sagte Dr. Sabin. »Doch selbst ein Zehnjähriger hätte darauf kommen können, dass es eine schlechte Idee ist, mitten in der Poliosaison zu operieren.« Er verzog einen Mundwinkel. »Meistens liegt die Wahrheit auf der Hand, doch wir ignorieren sie.«
Oh ja. Das war der Dr. Sabin, der Wunderknabe. Sie hatte von ihm gehört, als sie sich in San Francisco durch ihr Medizinstudium gekämpft hatte. Als er an der Uni war, hatte er einen Test entwickelt, den Ärzte auf der ganzen Welt noch immer benutzten, um schneller zu bestimmen, welcher Bakterientyp eine Lungenentzündung verursachte. Es war allgemein bekannt, dass man ihm die Leitung der pädiatrischen Forschungsabteilung an der Cincinnati University angeboten hatte – einer unbedeutenden Einrichtung, bis er sie übernahm. Angeblich kamen viele Kollegen nicht mit seiner anmaßenden Arroganz zurecht und ärgerten sich über seine Überzeugung, er sei jedem anderen Lebewesen in seinem Denken weit voraus. Aber Dorothy konnte nicht erkennen, inwiefern er sich dadurch von den meisten anderen Medizinern unterschied.
Jetzt ging er den Flur hinunter, als wäre er der Chefarzt auf großer Visite und nicht ein junger Arzt auf Besuch. Dorothy und die anderen drei Ärzte folgten ihm. Dr. Ward ging neben ihr und musterte sie, als wollte er herausfinden, wer von ihnen größer war.
»Was führt Sie in unser bescheidenes Krankenhaus?«, fragte Barry Dr. Sabin.
Dorothy hörte den Sarkasmus heraus. Am Vanderbilt war nichts bescheiden. Manche Menschen sahen in der Universität gern das Harvard des Südens. Einige frischgebackene Ärzte, darunter auch Barry, entschieden sich allein wegen des Prestiges, als Assistenzarzt an dieses Krankenhaus zu gehen. Dorothy konnte etwas Prestige zwar ebenfalls gut gebrauchen, doch sie hatte sich für das Vandy entschieden, weil … nun, weil man sie hier genommen hatte. Und selbst das war ein Versehen gewesen. Dr. Morgan hatte vergessen, dass Dr. D.M. Horstmann eine Frau war, als er sie auf Grundlage ihrer Bewerbung eingestellt hatte. Er hatte immer noch nicht herausgefunden, wie er sie wieder loswerden konnte.
Robbie Ward antwortete für Dr. Sabin. »Das ist streng geheim.«
»Eigentlich gar nicht«, sagte Dr. Sabin. »Ich habe von den National Institutes of Health die Erlaubnis erhalten, jedes Polioopfer im Umkreis von 400 Meilen um Cincinnati zu obduzieren. Sie haben hier einen siebenjährigen Jungen, der heute Morgen verstorben ist, und hier bin ich.«
Dorothy wandte den Blick ab, ein scharfer Schmerz durchbohrte ihr Brustbein. Das Kind war mit Schwächegefühl in den Armen und den unteren Extremitäten eingeliefert worden. Innerhalb von zwei Stunden waren die Lähmungen so weit vorangeschritten, dass sie nicht einmal genügend Zeit hatten, ihn in eine Eiserne Lunge zu legen, damit er atmen konnte. Er starb, während Dorothy verzweifelt einen Luftröhrenschnitt machte. Zwölf Minuten lang hatte sie versucht, ihn wiederzubeleben, nachdem der Oberarzt ihn bereits für tot erklärt hatte. Der Arzt hatte sie aus dem Zimmer geschickt und ihr gesagt, sie solle sich »zusammenreißen«. So war sie im Labor gelandet, wo sie wie betäubt das Treiben der tödlichen, mikroskopisch kleinen Streber beobachtet hatte.
»Sie sind den ganzen Weg nach Tennessee gekommen nur für eine Leiche?«, fragte Barry. »Haben Sie in Ohio nicht genug davon?«
Dr. Sabin hob sein Kinn mit der Olivier-Spalte. »Offensichtlich nicht.«
»Man fährt vier Stunden bis hierher«, sagte Barry.
»Dreieinhalb«, korrigierte Dr. Sabin, »wenn Robbie am Steuer seines Cabrios sitzt. Wenn er der Medizin jemals überdrüssig wird, könnte er Rennfahrer in Le Mans werden.« Dorothy fiel auf, dass er den Namen französisch aussprach. Ein Mann von Welt.
Robbie strich sich mit der Hand über die Halbinsel aus sandfarbenem Haar, die sein zurückweichender Haaransatz übrig gelassen hatte. »Ich fahre nicht zu schnell. Es stimmt allerdings, dass meine Frau sich weigert, mit mir auszufahren, wenn das Verdeck unten ist.«
»Seien Sie froh, wenn Sie nicht im Februar hinten auf seinem Motorrad mitfahren müssen«, sagte Dr. Sabin.
»Wie bitte?«, rief Robbie. »Es war nicht meine Idee gewesen, mit der Harley zu diesem Fall zu fahren!«
Dorothy fragte laut: »Warum machen Sie so viele Obduktionen?«
Die Männer sahen sie an, als ihr Männerclubgeplauder abrupt unterbrochen wurde.
»Sie fahren im Land herum, um Patienten post mortem zu untersuchen, die nicht Ihre sind – warum?« Sie lächelte. Immer lächeln. Immer entwaffnen. »Ich kann mir angenehmere Gründe für eine Autofahrt vorstellen.«
Dr. Ward sah sich um, als könnte hinter dem Trinkbrunnen ein Spion lauern. »Wir arbeiten an etwas ganz Großem. Wenn wir fertig sind …«
Ein Blick von Dr. Sabin brachte seinen Kollegen zum Schweigen.
»Darf ich hospitieren?«, sagte Dorothy.
»Bei der Autopsie?«, rief Dr. Ward. »Sie wollen bei einer Autopsie hospitieren?«
»Es wäre nicht meine erste.« Sie mochte Obduktionen zwar nicht besonders, aber immer noch lieber, als zum Beispiel Mäusen Krankheitserreger zu spritzen. Der Obduzierte konnte nicht länger leiden; eine Maus schon. Doch sie hatte es nicht geschafft, den Jungen zu retten, und hatte das Gefühl, es ihm schuldig zu sein. Sie musste herausfinden, was schiefgelaufen war. Sie würde alles tun, um dem Tag näher zu kommen, an dem sie keiner Mutter mehr erklären musste, dass sie ihr Kind an Polio verloren hatte.
Dr. Sabin zuckte die Achseln. »Ich sehe keinen Grund, weshalb Sie nicht dabei sein sollten. Sie werden Gesellschaft haben.«
2
Dorothy spähte durch das Fenster der Galerie. Es würde eine überaus seltsame Obduktion werden. Nicht nur, dass sie in einem chirurgischen Operationssaal anstelle der Leichenhalle stattfand – Dr. Sabin hatte auch seine eigenen Instrumente mitgebracht, ganze Arztkoffer voll. Jetzt trug er OP-Kleidung, Maske und Handschuhe, als wäre sein Patient noch am Leben, und begutachtete seine Ausrüstung. Dutzende von Skalpellen, Sägen, Scheren und Zangen lagen vor ihm wie die Tasten einer Orgel, die er zu spielen beabsichtigte. An seiner Seite bereitete Robbie, der Assistent des Meisters, Objektträger und Glasfläschchen vor. Der Leichnam war noch nicht hereingebracht worden.
In derselben Reihe wie Dorothy saß der Chefarzt Dr. Morgan (der sich immer noch nicht davon erholt hatte, eine Frau in seiner Ärzteschaft zu haben) und beobachtete das Treiben mit tief in den Höhlen liegenden Augen. »Das ist doch lächerlich.«
Die neun anderen anwesenden Ärzte nickten.
Er beugte sich vor, um in das Mikrophon zu sprechen. Das Licht einer Deckenleuchte spiegelte sich auf seiner knochigen Stirn. »Wozu diese aufwendige Inszenierung, Dr. Sabin?«
Dr. Sabin schaute im hellen Licht der Operationsleuchten nach oben, sichtlich verärgert, weil sich die Ankunft des Leichnams verzögerte. »Da sich die Sache noch etwas hinzuziehen scheint, gestatten Sie mir, Ihnen einige Hintergrundinformationen zu liefern. Wie Sie wissen, sagt unser geschätzter Kollege Simon Flexner, dass das Poliovirus über die olfaktorischen Nervenbahnen in den Körper gelangt und von dort aus direkt das zentrale Nervensystem befällt.«
»Ja, das wissen wir«, sagte Dr. Morgan. »Sie könnten Ihre Maske abnehmen, damit wir Sie besser verstehen können – Sie werden den Leichnam schon nicht infizieren, wenn er dann mal da ist.«
Ein paar der Ärzte lachten.
Unten im Operationssaal hatte Dr. Sabin ihn nicht gehört, oder zumindest tat er so. »Und da Dr. Flexner das sagt, was tut die Wissenschaftsgemeinde? Sie sucht nach Wegen, um das Virus am Eintreten durch die Nase zu hindern. Sie verschreibt Nasenstöpsel und gibt Kindern Zinkpuder oder Pikrinsäure in die Nase. Nichts davon funktioniert oder noch schlimmer. Einige der Kinder haben ihren Geruchssinn für immer verloren. Unsere Kollegen scheinen Hippokrates vergessen zu haben: ›Erstens nicht schaden.‹«
»Wir vergessen Hippokrates keineswegs«, erklärte ein Arzt, »wenn wir versuchen, ein Kind zu retten!«
Dr. Sabin wartete, bis es auf der Galerie wieder ruhiger wurde. »In der Zwischenzeit sterben weitere Kinder an Polio. Doch niemand fragt sich, ob es nicht sein könnte, dass Flexners Schlussfolgerung auf einer fehlerhaften Arbeit beruht.«
»Aber warum sollten wir das denken?«, rief Dr. Morgan ins Mikrophon. »Simon Flexner ist die führende Autorität in Sachen Polio.«
Dr. Sabin legte seinen Kopf schräg und lächelte leicht. »Wenn etwas nicht funktioniert, sollte man sich dann nicht fragen, warum es nicht funktioniert?«
Hinter dem Glas murrten die Ärzte. Neben Dorothy sagte Barry: »Für wen hält der sich?«
Dr. Sabin warf einen finsteren Blick auf die Tür des Operationssaals, ehe er fortfuhr: »Erstens beruhte Flexners Schlussfolgerung, das Poliovirus würde durch die Nase in den Körper gelangen, auf Untersuchungen an Rhesusaffen. Was, wenn sich das Poliovirus bei ihnen anders verhält als bei anderen Primaten, allen voran dem Menschen? Ich habe bereits herausgefunden, dass dies der Fall ist. Was für den Rhesusaffen gilt, gilt nicht notwendigerweise für uns.
Zweitens ist mir aufgefallen, dass die Obduzenten in Flexners Studien verschmutzte Skalpelle verwendet und keinen Wert auf Sterilität gelegt haben. Vermutlich dachten sie, das spiele keine Rolle mehr, da die Patienten bereits verstorben waren. Aber sehen Sie, es spielt eine Rolle. Wenn Polioviren auf einem Skalpell ein ansonsten sauberes Gewebestück kontaminieren, könnte man daraus falsche Schlüsse ziehen.« Er blickte zu der Reihe Ärzte hinauf. »Dasselbe gilt für einen Obduzenten, der keine Maske trägt.«
»Glauben Sie, Sie könnten Polio haben?«, spottete Dr. Morgan.
»Haben wir bewiesen, dass das unmöglich ist? Meine Herren, wenn es um Polio geht, haben wir so gut wie nichts bewiesen.« Er lief jetzt auf und ab, seine Verärgerung wuchs. »Flexners Arbeit war schlampig, aber wir haben sie nicht in Frage gestellt, weil Flexner der Beste war. All die Jahre, die wir vergeudet haben wegen einer früheren Fehlannahme.«
Der Chefarzt beugte sich zum Mikrophon. »Woher wissen Sie, dass sie vergeudet sind?«
»Wo ist der Leichnam?«, polterte Dr. Sabin. »Robbie! Los, suchen Sie ihn!«
Robbie trollte sich.
Widerwillig richtete Dr. Sabin seine Aufmerksamkeit wieder auf die Galerie über sich. Mit finsterer Miene zog er seine Maske herunter. »Bei allen sterilen Gewebeentnahmen, die Dr. Ward und ich bisher durchgeführt haben, konnten wir kein einziges Mal das Poliovirus im Bulbus olfactorius nachweisen. Es ist schlichtweg nicht da.«
»Sie behaupten also, Simon Flexner hätte sich geirrt!«, sagte Morgan.
»Im Kern – ja.«
»Aber wie gelangt das Virus dann ins Nervensystem, um die Lähmungen hervorzurufen? Welchen Weg nimmt es?«
»Jetzt wird es interessant.« Dr. Sabin hielt inne, als würde er diese Information nur widerwillig teilen. »Beim Rhesusaffen ist das Poliovirus im Gewebe des Verdauungstrakts vielleicht nicht nachzuweisen, aber beim Menschen ist es das definitiv.«
Dorothy ließ sich zurücksinken. Das ergab keinen Sinn. Polio war eine Erkrankung des Nervensystems, sie lähmte ihre Opfer, manchmal so weit, dass sie nicht mehr atmen konnten, wie das arme Kind, das sie obduzieren würden. Doch andere Wissenschaftler hatten bereits Polioviren im menschlichen Stuhl nachgewiesen. Wollte Sabin damit andeuten, dass das Virus den Verdauungstrakt nicht nur passierte, sondern darin heranreifte? Wie gelangte es dorthin? Wie konnte es die Kinder von dort aus lähmen?
Robbie stürmte in den Operationssaal. »Es gibt eine Verzögerung bei der Freigabe der Leiche.«
Dr. Sabin riss die Hände hoch. »Das kann nicht sein. Ich habe alle nötigen Papiere.«
»Die Mutter weigert sich.«
»Weiß sie denn nicht, dass es zum Wohl der Wissenschaft ist?«, rief er, als wäre das die wichtigste Motivation im Leben aller Menschen.
»Ein paar Krankenschwestern reden mit ihr, aber sie können sie nicht umstimmen.«
»Tun Sie etwas!«, schrie er.
Seine Ideen brannten in Dorothy wie ein Schluck Whiskey. Sich jetzt zurückzuziehen tat weh, aber jemand musste helfen.
Sie bahnte sich ihren Weg an Hosenbeinen vorbei. »Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte.« Stirnrunzelnd machte Dr. Morgan ihr Platz, als sie den verchromten Mikrophonkopf nach oben bog. Ihre Stimme durchschnitt die Luft. »Dr. Sabin.«
Er beschattete seine Augen. »Dr. Horstmann?«
»Ich kenne die Mutter. Ich kann versuchen, mit ihr zu reden.«
»Ja«, sagte Dorothys Oberarzt. »Ja, lassen Sie Dorothy gehen.«
Dr. Morgan entließ sie mit einer Handbewegung. »Gehen Sie. Dies ist ohnehin kein Ort für Frauen.«
Dorothy saß im Warteraum neben der Mutter des Patienten, einer jungen Frau mit zarten Armen und Handgelenken, die neben Dorothy mit ihren kräftigen Wikingerknochen einer anderen Spezies anzugehören schien.
»Mrs. Brooks, mein aufrichtiges Beileid zum Tod Ihres Sohnes Richard.«
Die Frau hob das Gesicht. Weiche rosige Schwellungen hatten die Augen zu schmalen Schlitzen werden lassen. »Ich kenne Sie. Sie sind diejenige, die herausgekommen ist und mir gesagt hat, dass er gegangen ist.« Zwischen den Zeilen schwangen die Worte mit: Sie sind diejenige, die ihn verloren hat.
»Ist Mr. Brooks hier?«
Die Frau zupfte an dem schlaffen Volant an ihrem Hals. »Es gibt keinen Mr. Brooks. Er ist letztes Jahr an einem blutenden Magengeschwür gestorben.«
Dorothy wollte nur, dass die Frau jetzt nicht allein war, und nun hatte sie es bloß noch schlimmer gemacht. »Gibt es jemanden, der bei Ihnen sein kann?«
»Meine Schwester Carolyn. Aber ich habe sie losgeschickt, um einen Anwalt zu suchen.« Der Kopf der Frau schwang auf ihrem dünnen Hals vor und zurück, und die weichen braunen Locken wippten im Takt mit. »Ich weiß, dass ich irgendwelche Papiere unterschrieben habe, aber ich habe meine Meinung geändert. Ich kann Richard das nicht antun.« Sie schluckte hörbar. »Ich bin seine Mutter. Zählt das nicht?«
»Doch. Es zählt. Vollkommen.«
Die Mutter starrte auf den Schnappschuss in ihrer Hand. »Ich weiß, dass Sie ihn für die Forschung haben wollen.«
»Ja. Um anderen zu helfen.«
Mrs. Brooks Gesicht verzerrte sich. »Können Sie nicht einfach Affen nehmen?«
»Es heißt, dass man den Menschen am besten am Menschen studiert.« Dorothy seufzte. »Ich fürchte, das ist wahr.«
Mrs. Brooks ließ das Foto in ihrem Schoß sinken. »Er hatte 38 Grad Fieber und hat sich übergeben. Er sagte, er wolle ins Bett. Seine Arme und Beine fühlten sich komisch an, er konnte sie nicht richtig bewegen, aber er wollte einfach nur ins Bett.« Sie ballte die Fäuste und bohrte den Daumennagel in das Foto. »Ich wollte ihn ins Krankenhaus bringen, aber er bettelte mich an, es nicht zu tun. Er fürchtete sich vor dem Krankenhaus. Es ist der Ort, an dem sein Dad gestorben ist.«
»Es tut mir so leid.«
»Ich sagte zu Richie, in Ordnung, schlaf ein wenig. Wir werden sehen, wie du dich morgen fühlst.« Sie hob den Kopf. »Ich habe ihn umgebracht, weil ich gewartet habe.«
»Sie haben Ihr Bestes getan.«
»Aber das hat nicht gereicht!«
Genauso wenig wie Dorothys Behandlung ihres Sohnes. Der Raum zwischen ihr und dieser armen Mutter war so dicht mit Schuldgefühlen gefüllt, dass man sie in Blöcke hätte schneiden können.
»Haben Sie Kinder?«, fragte Mrs. Brooks.
Ihre Blicke trafen sich.
»Nein. Ich wünschte, ich hätte eines.« Dorothy hatte noch nie einer Seele davon erzählt. Sie gestand es sich selbst kaum ein.
Mrs. Brooks berührte den gezackten Rand des Fotos. »Wann immer ich etwas Schwieriges tun musste, sagte ich mir, du hast ein Baby zur Welt gebracht, Milly. Wenn du die Qual der Geburt überstanden hast, dann kannst du alles schaffen.«
Dorothy hatte während ihres Praktikums in der Geburtshilfe genügend Babys auf die Welt geholfen, um feierlich zu nicken.
Mrs. Brooks sah, dass Dorothy wusste, was sie meinte. »Aber eine Geburt dauert Stunden. Dies hier … das wird niemals aufhören. Was soll ich mir jetzt sagen? Wie soll ich weiterleben?«
Dorothy würde nicht wegsehen. Diese Frau hatte die Wahrheit verdient. »Ich weiß es nicht. Aber Sie werden es.«
Sie saßen zusammen, der Kummer der Frau erfüllte den leeren Warteraum.
Mrs. Brooks schaute vom Schnappschuss auf. »Wenn ich ihn den Ärzten überlasse, wird es anderen helfen?«
Dorothy nickte. »Ja.«
»Dann nehmen Sie mein Baby. Jemand muss doch irgendetwas gegen diese schreckliche Krankheitmachen.« Die Frau schaute wieder auf das Foto hinunter.
Dr. Sabin war nicht der einzige Held.
An diesem Abend saß Dorothy im Diner gegenüber dem Krankenhaus vor einer Tasse angebranntem Kaffee und sah zu, wie Barry sich ein weiteres Stück Zucker aus der Schale fischte. Das Restaurant war vernebelt von Tabakqualm und dem Dampf bratender Hamburger, an den Tischen saßen junge Privatdozenten mit Pfeife und ausgebeulten Aktentaschen, Medizinstudenten mit glasigem Blick und Zigarette rauchende Doktoranden mit aufgerollten Hemdsärmeln. Bis auf die zwei Kellnerinnen mit weißen Hauben und Schürzen und eine Krankenschwester, die mit einem Arzt an einem Tisch saß, war Dorothy die einzige Frau.
»Ich weiß nicht, was Sabin und Ward vorhaben, außer Aufmerksamkeit zu erregen.« Barry ließ den Zuckerwürfel in seine Tasse plumpsen und rührte um. »Ist es wirklich wichtig, wie das Poliovirus ins Nervensystem gelangt? Was zählt, ist, wie wir es behandeln, sobald es da ist.«
Dorothy schaute über den Rand ihrer eigenen Tasse. Es machte eine Menge aus. Um Polio zu besiegen, musste man das Virus im Körper außer Gefecht setzen, bevor es das Nervensystem angriff. Dabei würde es außerordentlich helfen, wenn man wüsste, wo im Körper man es am besten angreifen konnte. Wieso leuchtete ihm das nicht sofort ein?
»Wie auch immer, es tut mir leid, dass Sie die Vorstellung verpasst haben, Dot, aber danke, dass Sie die Mutter zur Vernunft gebracht haben. Wenn Sie sie nicht festgehalten hätten, bis diese beiden Pfeifen fertig waren, wäre die Vorstellung ausgefallen.«
Ihr kochte das Blut in den Adern. »Ich habe weder versucht, sie zu überreden, noch habe ich sie festgehalten. Es war ihre Entscheidung, uns ihren Sohn zu überlassen. Sie wollte ihren Beitrag zur Forschung leisten.«
Er legte den Kopf in den Nacken, um seine Tasse bis auf den letzten Tropfen zu leeren. »Danke jedenfalls, dass Sie sich geopfert haben. Das war sehr anständig von Ihnen.«
Sah er denn nicht, was für ein Opfer diese Frau gebracht hatte? Sie wollte gerade erwidern, dass ihr Einsatz überhaupt nichts mit Anstand zu tun hatte, als Albert Sabin das Diner betrat.
3
Jemand hatte in der Jukebox etwas von Glenn Miller ausgewählt. Das Stimmengewirr der zumeist jungen Männer übertönte fast das Wimmern der Klarinetten und das Klirren des billigen Bestecks auf den Keramiktellern. Über der Wolke aus Bratfett und Zwiebelgeruch, die vom Grill aufstieg, tickte eine Kit-Kat-Uhr Dorothys nächster Schicht entgegen. Aber warum sollte sie in ihre Wohnung zurückkehren? Sie war viel zu aufgeregt, um schlafen zu können.
Barry lehnte sich gegen die hohe Rückenlehne seiner Bank. Er trug das karierte Sporthemd mit dem offenen Kragen, das seine Frau für ihn gestärkt und gebügelt hatte. Sein kürbisfarbenes Haar wirkte wie angeklebt – bis auf diese eine widerspenstige Strähne, mit der Dorothy eine gewisse Verbundenheit empfand, weil ihr ganzes Haar aus widerspenstigen Strähnen bestand. Einmal mehr sah er eher aus wie ein kleiner Junge als wie ein Erwachsener im arbeitsfähigen Alter. »Glauben Sie wirklich, Sie werden beweisen, dass die olfaktorischen Nervenbahnen nichts mit Polio zu tun haben?«
Dr. Sabin, der neben Dorothy saß, hielt inne. Die Ärmel seines makellosen schwarzen Anzugs ruhten auf der Tischkante. »Ja.« Er biss von seinem Hamburger ab.
Ihr Blick wanderte zu seiner Hand, mit der er das Brötchen hielt. An seinem Finger steckte ein Ehering. Das hatte sie sich schon gedacht. Jeder heiratete auf dem College, wenn nicht sogar direkt nach der Highschool. Außer ihr. Oh, mit ihr schlafen wollten viele Männer. Sie erlebte es immer wieder – je kleiner sie waren, desto mehr wollten sie sie zurechtstutzen. Aber kein Mann wollte auf Dauer Mary Todd für ihren Abraham Lincoln spielen.
»Was glauben Sie, wie es sonst in den Körper gelangt?«
Dr. Sabin kaute zu Ende und schluckte. »Nun, Barry, meine Arbeit ist noch nicht veröffentlicht. Ich müsste Sie umbringen, wenn ich es Ihnen erzählen würde.«
Barrys Wangen wurden noch rosiger, als sie es ohnehin schon waren. Das sollte ein Witz sein, aber andererseits auch nicht. Wenn jeder Wirtschaftszweig ein Dschungel war, in dem nur die Stärksten überlebten, war der akademische Urwald einer der härtesten. Jeder kämpfte darum, in seiner Domäne der König zu sein. Sabin musste glauben, er habe etwas, das ihn zum König machen würde.
»Aber worauf zielen Sie ab?«, fragte Barry.
Dorothy mischte sich ein. »Er vermutet, dass das Poliovirus durch den Mund in den Körper gelangt. Was bedeutet, dass wir ganz neu überlegen müssen, wie es sich im Körper ausbreitet, wenn wir es jemals besiegen wollen.«
Dr. Sabin ließ seinen Hamburger sinken und schaute sie an.
»Na dann viel Glück«, sagte Barry. »Die Menschen werden jeden Mann für einen Gott halten, der Polio besiegt.«
»Oder jede Frau«, sagte sie. Sollte Sabin sie doch anstarren. Sie war daran gewöhnt. »Ich weiß nicht, ob man dann ein Gott ist, aber auf jeden Fall hat man etwas sehr Gutes getan.«
»Sie dürfen natürlich auch ein Gott sein.« Barry stand auf. »Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie beide jetzt verlassen muss, aber meine Frau wartet auf mich, und ich habe …« Er schaute zur Katzenuhr, deren Schwanz über dem Grill hin- und herschwang, »… etwa sechs Stunden, um ihr und den Kindern zu beweisen, dass ich noch am Leben bin, und etwas Schlaf zu bekommen.« Er grüßte und ging, so dass Dorothy sich in der heiklen Lage befand, mit einem gutaussehenden, fast fremden Mann auf derselben Bank in einer Nische zu sitzen. Er war so nah, dass sie seine Hitze spürte, als er sich erneut seinem Essen widmete.
»Wartende Ehegatten scheinen das Thema des Abends zu sein«, sagte er leichthin. Ein englischer Akzent schlich sich in seine Stimme. »Robbies scheint ihn am Telefon festzuhalten. Ich möchte Sie nicht von Ihrem fernhalten.«
»Ich bin nicht verheiratet.« Sie spürte, wie sich die Blutgefäße in ihrem Gesicht füllten. Sie war wieder auf der Highschool, die einsame Bohnenstange, die allein an der Wand lehnte.
»Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich hierbleibe, bis Robbie zurückkommt?«
»Überhaupt nicht.« Sie trank etwas Wasser. Oh ja, in seiner Stimme lag eindeutig ein Hauch von very british. Sie stellte sich eine Kindheit mit Nannys, Ponyreiten und Privilegien vor.
Er schob seinen Teller über den Tisch und setzte sich auf die andere Bank der Nische. »Wie kommen Sie darauf, dass wir ganz neu überlegen müssten, wie sich das Poliovirus im Körper ausbreitet?«
Sie spürte, wie sich ihre Gliedmaßen mit dem größeren Abstand entspannten. »Darauf läuft es doch hinaus, oder nicht? Zumindest dachte ich das, als Sie sagten, Sie würden bei Ihren Obduktionen im Darmgewebe nach Polioviren suchen.«
»Wie kommen Sie darauf, dass sich das Virus im Darmgewebe finden lässt?«
»Das haben Sie selbst gesagt. Ich wüsste gerne, was Sie glauben, wie es dort hinkommt.«
Er musterte sie aus schmalen Augen, lächelte und nahm seinen Hamburger.
War das der streng geheime Teil, den sein Partner erwähnt hatte? Es wäre auf jeden Fall eine Neuigkeit in der Welt der Wissenschaft. Ein Geheimnis, das er gewiss gut hüten würde.
Sie drängte ihn trotzdem.
»Denken Sie dabei an einen Impfstoff?«
»Einen Impfstoff? Würden wir damit nicht das Pferd von hinten aufzäumen?«
»Ich verstehe, dass Sie vorsichtig sind, nach dem, was mit Dr. Brodie passiert ist.«
Vor zwei Jahren hatte der Wissenschaftler Maurice Brodie siebentausend Kindern und Erwachsenen in New York einen Impfstoff injiziert, der in einer Formaldehydlösung abgetötete Polioviren enthielt. Es endete mit einer Katastrophe, drei Kinder waren direkt nach der Gabe gelähmt. Als Brodie bald darauf starb, hieß es, er habe einen Herzinfarkt erlitten, doch viele in der Wissenschaftsgemeinde glaubten, er sei aus Verzweiflung über das Leid, das er angerichtet hatte, von eigener Hand gestorben.
Dr. Sabin schluckte seinen Bissen herunter. »Brodie hat sich von anderen zur Eile drängen lassen. Ich kannte ihn – er war ein guter Mann. Sie sollten keine Gerüchte über ihn verbreiten.«
»Ich habe keine Gerüchte über ihn verbreitet. Ich sagte nur, dass ich verstehe, warum Sie vorsichtig sind, was eine Polioimpfung angeht.«
Er schob sich den letzten Bissen seines Hamburgers in den Mund. »Wenn Sie unbedingt über medizinische Fortschritte reden wollen«, sagte er und wischte sich die Finger an der Serviette ab, »sollten wir über Penizillin sprechen. Zwei englische Gentlemen, Dr. Florey und Dr. Heatley, haben Flemings Mittel erfolgreich einem 43-jährigen Polizisten verabreicht …«
»Ja, ich weiß. Der Mann hatte sich beim Rosenschneiden einen Kratzer auf der Wange geholt und durch Streptokokken hervorgerufene Abszesse im Gesicht entwickelt. Er bekam eine Sepsis, die er vermutlich nicht überlebt hätte, also pumpten sie ihn mit Penizillin voll.« Auch Dorothy las die wissenschaftlichen Fachzeitschriften. »Er hat überlebt.«
»Bis er wenige Tage später doch starb. Aber er hätte vermutlich länger gelebt, wenn ihnen nicht das Penizillin ausgegangen wäre, bevor er vollständig geheilt war. Jetzt, wo klar ist, dass Penizillin Millionen Leben retten könnte, können die Arzneimittelhersteller das Mittel gar nicht schnell genug für den Einsatz auf den Schlachtfeldern Europas produzieren. Sie werden sehen, Penizillin wird, sobald es in ausreichender Menge zur Verfügung steht, den Gang der Geschichte verändern.« Er holte tief Luft. »Stellen Sie sich vor, wie es sich anfühlen muss, so eine Entdeckung zu machen.«
Sie dachte an die unersättlichen Streptokokkenbakterien in ihrem Labor, die unter dem Mikroskop das Agar verschlangen. Die kleinen Ungeheuer würden eines Tages ihren Meister finden, genau wie die Staphylokokken und andere Bakterien. Weniger Kinder würden an Streptokokken im Rachenraum sterben. Weniger Kinder würden einer Hirnentzündung erliegen, die als harmlose Ohrenschmerzen begonnen hatte, oder an etwas so Simplem sterben wie einer entzündeten Blase am Zeh, wie es dem Sohn von Präsident Coolidge im Teenageralter passiert war. Dorothy stellte sich vor, Eltern nicht mehr so albtraumhaft häufig mitteilen zu müssen, dass sie ihr Kind verloren hatten.
Drüben auf dem Grill brutzelten die Hacksteaks für die Hamburger. Dr. Sabin würde bald aufbrechen. Sie nahm den letzten Schluck Kaffee und griff nach ihrer Handtasche.
»Erzählen Sie mir von sich«, sagte er.
Sie musste schlucken. Das hatte sie nicht erwartet.
Eine neue Platte fiel in der Jukebox auf den Teller, Billie Holiday schmachtete im lärmigen Diner aus dem Lautsprecher. Dr. Sabin lächelte. »Lassen Sie mich raten – Sie kommen von einer Farm.«
Unwillkürlich musste sie lachen. »Komme ich nicht.«
Er drohte ihr mit dem Finger. »Das glaube ich nicht. Sie haben so eine goldige Art …«
Sie war nicht sicher, wodurch sie sich am meisten gekränkt fühlte. Hielt er sie für so unbedeutend, dass er sich diese Vertraulichkeit erlauben konnte, oder glaubte er, sie sei gerade erst vom Kohlanhänger gefallen?
Er lächelte. »Es ist nur so, dass ich selbst einige Zeit auf dem Land gelebt habe.« Ach ja. Die Ponys und Nannys. »Es war eine sehr glückliche Zeit.«
»Kommen Sie aus New York oder England oder …?«
Er unterbrach sie. »Wo kommen Sie her, wenn nicht von einer Farm?«
Sie packte ihre Handtasche. »San Francisco.«
»Exotisch. Ich war noch nie dort.«
Erinnerungen stiegen in ihr auf, an den klebrigen lackierten Holztresen unter ihren Armen, wenn sie nach der Schule ein Solei verschlang. An das metallische Quietschen der Straßenbahn in ihren Gleisen in der Carl Street, das Knistern des Stromabnehmers an der Oberleitung. Rubinrotes Licht, das durch das Buntglasfenster einer Villa fällt, während ein Kind am Klavier eine falsche Note spielt.
Mit einem Schaudern verdrängte sie die Bilder.
Dr. Sabin beobachtete sie. »Wo wurden Sie ausgebildet?«
Sie atmete aus. »San Francisco City and County Hospital.«
»Sie sind in der Stadt auf die Universität gegangen, in der Sie aufgewachsen sind.«
»Ja.« Sie schaute zur Tür.
»Ich auch.«
Sie würde zu viel sagen. Sie machte Anstalten, aus ihrer Bank zu rutschen.
»Ich sollte eigentlich Zahnarzt werden«, sagte er.
Aufrichtig interessiert hielt sie inne. »Sie?« Sie sollte Klavierlehrerin werden. Sie mochte Musik, und in der Highschool war der stetige Strom zahlender Schüler das einzige Einkommen der Familie gewesen, nachdem die Bar, in der ihre Eltern arbeiteten, wegen der Prohibition geschlossen worden war. Sie hatte sich damit abgefunden, ihr Leben lang zu den Häusern von süßen, unmusikalischen, reichen Kindern zu fahren, bis irgendwann zufällig ein einsamer Holzfäller-Typ auf der Suche nach einer Frau vorbeikommen würde.
Doch eines Abends brachte der Vater eines Schülers, ein Arzt, sie nach Hause, als er zu einem Notfall herausgewunken wurde; ein Kleinkind hatte ein Farnblatt gegessen. Dorothy sah zu, wie er dem erschlafften Kind Brechwurzelsirup einflößte, und kurz darauf konnte das kleine Mädchen nach heftigem Erbrechen den tränenüberströmten, aber glücklichen Eltern zurückgegeben werden. In diesem Moment kam ihr der Gedanke, dass ihre Ansprüche vielleicht zu niedrig waren. Wie wunderbar wäre es, Menschen zu heilen! Wenn nur jemand in der Lage gewesen wäre, ihren Pop zu heilen.
In der folgenden Woche schaute sie sich genauer in der vergoldeten Villa des Arztes um, während seine Tochter Chopin verstümmelte. Ihr Interesse war geweckt. All dieser Luxus rührte daher, dass er Menschen heilte?
Auf der Heimfahrt fragte sie den Arzt, ob sie ihm einmal bei der Arbeit zusehen könne. Er hatte die buschigen Brauen über der Hornbrille hochgezogen. Vielleicht hatte er gedacht, sie würde es sich anders überlegen, sobald sie einmal zugesehen hatte, wie er einen komplizierten Bruch richtete. Vielleicht empfand er Mitleid mit Henry Horstmanns ungeschlachter Tochter. Wer weiß – vielleicht gefiel ihm auch die Vorstellung, seine eigene Mozart mordende Tochter könnte eines Tages selbst so eine verrückte Bitte vortragen. Aus welchem Grund auch immer, er willigte ein. Dorothy durfte eine Woche lang bei seinen Runden im Krankenhaus mitlaufen, was ihn bei den anderen Ärzten nicht unbedingt beliebt machte.
Während dieser Zeit wurde sie Zeuge, wie ein sechzehnjähriger Junge mit Meningitis, in Fötusstellung und bewusstlos, am Mittwoch experimentell mit einem Sulfonamid behandelt wurde. Am Donnerstag wachte er auf, streckte sich und lächelte seine Mutter an. Da wusste Dorothy, dass sie Medizin studieren würde. Sie würde auch solche Wunder vollbringen. Sie sah keinen Grund, warum Frauen es nicht schaffen sollten. Ihre Mutter und sie führten den Haushalt. Ärztin zu werden und sich um das Wohlergehen anderer zu kümmern schien die natürlichste Fortsetzung davon zu sein.
Zum Glück war sie so naiv gewesen.
»Mein Onkel wollte, dass ich in seiner Praxis in New York City mitarbeite«, sagte Sabin. »Aber während des Studiums fand ich heraus, dass ich die Arbeit an Zähnen hasse, und habe aufgehört. Er hat mich verstoßen.«
»Was haben Sie dann gemacht?«
»Ich habe Medizin studiert und am Bellevue Hospital meine Ausbildung gemacht, bis ich mich endlich ins Rockefeller Institute eingeschmeichelt habe, um zu forschen. Ich habe einfach nicht lockergelassen. Ich kann ziemlich … hartnäckig sein.«
Das glaubte sie gern. Aber er hatte es damit bis ins Rockefeller Institute geschafft. Geld konnte das bewirken. Sie zwickte sich in Gedanken selbst. Sei nicht neidisch auf ihn. Du bist, was du bist. Komm damit klar.
»Ich war noch nie in New York«, sagte sie mit einem leisen Lachen, als sei es ganz erstaunlich, dass sie es noch nie bis dorthin geschafft hatte. Die Wahrheit war, dass Nashville die einzige Stadt war, die sie jemals gesehen hatte, abgesehen von Spokane, wo sie geboren worden, und San Francisco, wo sie aufgewachsen war. Sie hatte vor, das eines Tages zu ändern.
»Es ist eine großartige Stadt. Ich könnte Sie herumführen. Der Broadway, die Metropolitan Oper, das Oscar’s für einen Drink im Waldorf, das neue Rockefeller Center …«
Sie herumführen! Der Mann war verheiratet, sie würde sich von ihm nirgendwohin führen lassen. Aber es gab etwas, auf das sie schon immer neugierig gewesen war, so albern es auch war.
»Waren Sie jemals auf einer Konfettiparade?«
Er begann zu strahlen. »Sie sind wunderbar. Die Geehrten, der Autokorso, die jubelnde Menge, selbst die Wolkenkratzer – alles wird von einem Wirbelsturm aus Papier verdeckt.« Je begeisterter er erzählte, desto schwächer wurde sein englischer Akzent. »Der Lärm der Sirenen, der Jubel und die Schiffshörner auf dem Fluss sind ohrenbetäubend. So ein Getöse haben Sie noch nie gehört. Können Sie sich vorstellen, wie es sich anfühlen muss, im Mittelpunkt dieser Bewunderung zu stehen?«
Schrecklich, dachte sie. »Das können Sie mir erzählen, sobald man eine Parade für Sie organisiert hat, für die Entdeckung des Polioimpfstoffs.«
Er wurde still. Sie spürte, dass es wichtig war, jetzt nicht zu lächeln.
Ohne sie aus den Augen zu lassen, bückte er sich, als wollte er etwas aufheben, das unter den Tisch gefallen war, oder seine Hosenbeine hochziehen. »Ich war auf Lindberghs Parade, und auf der für die Frau, die durch den Ärmelkanal geschwommen ist, Gertrude Wie-heißt-sie-doch-gleich.« Er richtete sich auf. »Ich war auf den Paraden von Amelia Earhart und Admiral Byrd, als er aus der Antarktis zurückkam. All das Konfetti!«
Er beugte sich über den Tisch und berührte Dorothys Haar. Er ließ seinen Finger lange verweilen, es war fast eine Liebkosung. War es eine Liebkosung?
»Hoppla, ich glaube, Sie haben ein Stückchen davon in Ihrem Haar.« In seiner Handfläche lag ein weißes Stück Papier.
Sie tastete ihren Kopf ab. »Wo habe ich das denn her?«
»Von der Parade, die man für Sie ausgerichtet hat.«
Er hatte es vom Fußboden aufgehoben. Was für ein schrecklicher Süßholzraspler! »Eine schöne Bescherung! Jetzt verteile ich schon Konfetti!«
»Sie sind perfekt.«
Ihr Herz sank. Darum ging es ihm also. Er war nur ein weiterer Mann, der sie bezwingen wollte.
Doch bevor sie die Flucht ergreifen konnte, begann er, ihr von seinem Leben in New York zu erzählen. Von seinem Zimmer im vierten Stock ohne Fahrstuhl in der Bleeker Street, als er ein einfacher Medizinstudent war; von seiner wilden Zeit beim New Yorker Gesundheitsamt, als er und sein Kumpel verängstigte Bewohner in Mietskasernen, zumeist Ausländer, überreden mussten, ihre kranken Kinder herauszubringen, damit sie ihnen helfen konnten.
Sie vergaß ihr Bedürfnis, zu fliehen. Manchmal mischte sich ein leichter Brooklyneinschlag in seine arrogante schmallippige Ostküstensprechweise. Dann wiederum schimmerte der englische Akzent durch, nur um von einer osteuropäischen Betonung gekapert zu werden. Hatte er diesen Akzent bei der Arbeit in den Mietskasernen aufgeschnappt? Was Akzente anging, war sie eine Expertin.
In der Highschool hatte sie jede Spur ihres deutschen Einschlags verbannt, aber sie arbeitete immer noch an ihrer Grammatik. Die Sprache verriet einen schneller als alles andere.
»Als Will Brebner und ich …«
Sie riss die Augen auf. »Will Brebner? Doch nicht derselbe Will Brebner, der …«
»… der starb, nachdem er bei der Forschung am Poliovirus von einem Laboraffen gebissen wurde? Genau der. Er unterhielt sich gerade mit mir, als der Affe ihn biss.«
»Oh nein. Das tut mir aufrichtig leid.«
Ihre Kellnerin kam, um zu fragen, ob sie Kuchen wollten. Er scheuchte sie fort, bevor Dorothy sagen konnte, ob sie gern ein Stück hätte.
»Brebner war ein großartiger Wissenschaftler. Ein großartiger Freund. Wir wurden beide inspiriert von dem Buch Mikrobenjäger. Wir nannten uns die ›Seuchendetektive‹. Kitschig, was?«
»Nein, überhaupt nicht. Ich liebe diesen Teil der Medizin.«
»Wir wollten den Fall Polio aufklären.« Dr. Sabin sah sich im Restaurant um, das vom Lärm männlicher Stimmen und Geschirrgeklapper erfüllt war. »Jetzt bin nur noch ich übrig.«
Was sollte sie dazu sagen? »Es ist gut von Ihnen, dass Sie für ihn weitermachen.«
»Oh, an mir gibt es nichts Gutes.« Er sprach leise. »Er hat aufgeschrien, als der Affe ihn gebissen hat. Als ich seine Wunde mit Jod einpinselte, machte er Witze über Tiere, die seine Finger mit Bananen verwechselten. Es hat ihn hier erwischt.« Er tippte an die Stelle zwischen Ring- und Mittelfinger.
Erneut fiel ihr Blick auf den Ehering.
»Ich sagte ihm, er solle ins Krankenhaus gehen. Er wollte nicht. Er sagte nein, es gehe ihm gut, und machte sich wieder an die Arbeit.«
Die hemdsärmeligen Doktoranden am Nachbartisch brachen auf. Dr. Sabin wartete, bis sie verschwunden waren, ehe er fortfuhr.
»Die Bisswunde schien gut zu verheilen. Dann, drei Tage später, begann die Stelle anzuschwellen und wurde rot. Ein hässlicher roter Streifen wanderte seinen Arm hinauf. Als er Fieber bekam, meldete er sich in der Ambulanz vom Bellevue Hospital, wo sie ihm eine Tetanusspritze verpassten. Sein Zustand verbesserte sich. Nach weiteren drei Tagen waren wir sicher, dass er über den Berg war. Seine hübsche junge Braut backte uns einen Kuchen, um zu feiern. Erdbeerkuchen.«
Dorothy zuckte zusammen.
»Am nächste Tag wachte er mit heftigen Schmerzen von der Hüfte abwärts auf. Er konnte kein Wasser lassen. Die Reflexe in den Beinen und im Abdomen funktionierten nicht. Er bestand darauf, dass wir ihm ein Antikörperserum gaben, aber das half nicht. Am nächsten Tag konnte er die unteren Gliedmaßen nicht mehr bewegen. Er begann, unkontrolliert zu hicksen, und dann konnte er nicht mehr atmen. So schnell es ging, schoben wir ihn in eine Eiserne Lunge – in dasselbe Gerät, in das er die kränksten seiner eigenen Patienten gesteckt hatte.«
Das mechanische Zischen einer Eisernen Lunge schien für einen Moment den Krach im vollen Diner zu übertönen.
»Fünf Stunden lang blieb ich bei Bill Brebner und sah ihm beim Sterben zu – als er Krampfanfälle hatte, als er Schaum vor den Mund bekam, als ich sein Todesröcheln hörte. Er war neunundzwanzig Jahre alt. Ich war sechsundzwanzig.«
»Es tut mir so leid.«
»Wissen Sie, was mich immer noch verfolgt? In diesen fünf Stunden, in denen mein bester Freund starb, war mein einziger Gedanke, dass es nicht Polio ist. Die Symptome stimmten nicht. Er hatte etwas anderes.« Er rieb sich den Mund, sichtlich aufgewühlt. »Was stimmt nicht mit mir?«
»Sie sind Wissenschaftler.«
Er lächelte schwach. »Ich fand heraus, dass Bill ein brandneues Virus hatte – das erste Herpesvirus, das erwiesenermaßen von einem Tier auf einen Menschen übertragen wurde. Ich habe es B-Virus genannt, nach Brebner. Als würde das genügen.«
»Die Welt ist durch dieses Wissen eine bessere.«
»Bill Brebner hilft das nicht mehr.«
In der Küche klapperten Teller. Sabin ließ nicht zu, dass sie den Blick abwandte. »Ich war bei seiner Obduktion dabei. Bei der Autopsie meines besten Freundes. Ich habe gesehen, wie sie ihn auseinandergenommen haben. Und das ist der springende Punkt – ich habe daraus gelernt. Ich musste ein eiskalter Hund sein, aber ich habe daraus gelernt. Ich würde jedes Mal wieder zusehen.« Auf seine provozierende, herausfordernde Art reckte er sein Kinn in die Höhe. »Bleiben Sie bei der klinischen Medizin. Man muss herzlos sein, wenn man in der Forschung etwas erreichen will.«
»Was, wenn ich herzlos bin?«
»Sie? Herzlos? Ich denke nicht.«
Ein Lächeln wuchs auf seinem Gesicht, als sie ihn anstarrte. Sie erwiderte es nicht. »Ich bin es leid, dass Polio den Mrs. Brooks dieser Welt ihre Richies raubt.«
»Was?«
»Ich sagte, dass ich herzlos sein werde, wenn es nötig ist.«
»Ich glaube, Sie wissen nicht, was das bedeutet.«
Mit einem Klingeln schwang die Tür zum Diner auf. Dorothy fuhr zusammen, ihr Herz pochte.
Robbie Ward stürmte auf ihren Tisch zu wie ein Footballstar mit dem Ball. »Tut mir leid! Notfall zu Hause. Das Pony meiner Kleinen hat bei einer Aufführung mitgemacht, und ich musste alles darüber hören.«
»Dann auf, Gentlemen!«, sagte Dorothy. »Sie beide sollten sich besser mit Ihren Proben auf den Weg machen.«
Dr. Sabin ließ sich nicht hetzen. Er stand auf und griff in seine Manteltasche. »Wenn Sie einmal in Cincinnati sind und gerne mein Labor sehen möchten, hier ist meine Karte. Sie haben Forschergeist«, fügte er hinzu, als sie sie entgegennahm. »Was Ihr Herz angeht, steht das Urteil noch aus.« Er setzte den Hut auf und breitete die Arme aus, damit sie vorgehen konnte.
Als sie an seiner Sitzbank vorbeikam, fiel ihr Blick zufällig nach unten. Dort neben dem Tischbein lag eine weiße Papierserviette. Eine Ecke von der Größe des Konfettischnipsels fehlte.
4
Cincinnati, Ohio, 1941
Wer wollte schon ein Einhorn? Offenbar niemand. In den letzten zwei Monaten war allen Kollegen, die Dorothy kannte, sowohl aus dem Vanderbilt als auch aus ihrem Studium, nach ihrer Assistenzzeit entweder eine Anstellung oder ein Stipendium angeboten worden. Selbst Barry war nach Baylor berufen worden, an die Alma Mater seines Papas. Die Alma Mater von Dorothys Papa war die Schule der harten Schläge gewesen.
Daran würde sie jetzt nicht denken. Sie war in Cincinnati und machte einen Sonntagmorgenspaziergang durch den grünen Stadtteil Walnut Hills, um die Zeit totzuschlagen, bis ihr Bus nach Nashville abfuhr. Am Vorabend war sie in die Stadt gekommen, zur Hochzeitsfeier einer ihrer Lieblingskrankenschwestern aus der Klinik. Sie hatte keine Ahnung, wie man gemächlich spazieren ging, also stolzierte sie forsch an Rasenflächen vorbei, die nach Ahorn und gemähtem Gras rochen. Unvermittelt fand sie sich an der Kirche wieder, in der die Trauung stattgefunden hatte. Die Fenster des Altarraums waren, wie man ihr erklärt hatte, von Tiffany. Im Morgenlicht mussten sie atemberaubend sein.
Sie stand vor dem Steingebäude und legte den Kopf in den Nacken, um einen besseren Blick auf das Fenster zu bekommen, als Orgelmusik und ein liebenswert unharmonischer Gesang durch die offene Tür nach draußen drangen. Ihr schien, als könnte sie die Zusammengehörigkeit der Menschen, die dort drin versammelt waren, körperlich spüren – und ihr eigenes schreckliches Getrenntsein.
»Sie sind aber groß!«
Dorothy blinzelte. Neben ihr stand ein winziges Männchen und hielt seinen Strohhut fest, als er zu ihr aufschaute. Mit einer vom Alter rostigen Stimme fragte er: »Wie groß sind Sie?«
Dorothy schob ihre Tasche am Arm ein Stück höher. »Vermutlich zu groß.«
Sie spürte die üblichen neugierigen Blicke in ihrem Rücken, als sie über den Kirchhof und hinaus auf die Straße schritt. Sie ging weiter, zu ihrem Hotel, um … um was? Auf ihrem Bett zu sitzen und sich in ihrer Einsamkeit zu suhlen?
Sie zog die weißen Handschuhe aus und wühlte in ihrer Handtasche. Ein Auto fuhr vorbei, der aufgewirbelte Kies drückte ihren Rock gegen die Nylonstrümpfe.
Er hatte gesagt, sie solle ihn besuchen, wenn sie einmal in Cincinnati sei. Sie brauchte zwar dringend eine Stelle, aber sie hatte nicht vorgehabt, sich bei ihm zu melden. Obwohl die Kinderstation des Krankenhauses von Cincinnati sich in der Polioforschung langsam einen Namen machte und obwohl sie wünschte, sie könnte diesem Miststück Polio in den Hintern treten, hatte sie um dieses Krankenhaus und den Chefarzt der Pädiatrie einen großen Bogen gemacht. Sie war gut darin, Menschen einzuschätzen. Das ergab sich so mit einem Vater wie Pop, und sie wurde das Gefühl nicht los, dass Sabin nicht ganz offen zu ihr gewesen war. Abgesehen von seinem Bekenntnis zur Herzlosigkeit gab es etwas, das er zurückhielt, etwas, von dem sie ahnte, dass es sie zu Fall bringen könnte. Ob sie herzlos genug sei – was für ein Unsinn!
Und doch wühlte sie sich bereits durch ein Nest aus Taschentüchern, Lippenstiften und Haarklammern. Wahrscheinlich brauchte sie sich keine Sorgen machen, ihm zu begegnen. Wer war schon an einem Sonntag im Labor?
Sie fand seine Karte.
Eine verschwommene Gestalt bewegte sich auf der anderen Seite der Milchglastür. Er musste genauso besessen von der Arbeit sein wie sie. Sie ergriff den Türknauf und tauchte ein in einen Gifthauch aus Bunsenbrennerqualm und Formaldehyd.
Dr. Sabin wich von seinem Platz neben einer jungen Frau zurück, die in ein Mikroskop schaute. Ihr Gesicht war hinter einer Kaskade blonder Haare verborgen, die sich aus ihrer Laborhaube gelöst hatten. Hastig richtete die Frau sich auf. Dorothy starrte auf die Schulter der Frau. Hatte Dr. Sabins Hand gerade darauf gelegen?
»Miss Horstmann?« Dr. Sabin stand auf, ein aufrichtiges Lächeln im Gesicht. »Sind Sie es wirklich?«
Sie überlegte, ob sie ihn daran erinnern sollte, dass sie Dr. Horstmann war. »Ich fürchte, ja.«
»Wie lange ist es her? Zwei Monate? Was führt Sie nach Cincinnati?«
»Eine Hochzeit.«
»Sieh an, sieh an. Ich bin froh, dass Sie mich besuchen. Barbara«, sagte er zu der Frau, »das ist Miss Horstmann. Sie ist Assistenzärztin im Vanderbilt. Verzeihung, bitte. Es muss Dr. Horstmann heißen, nicht wahr?«