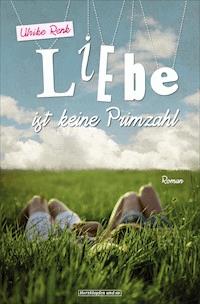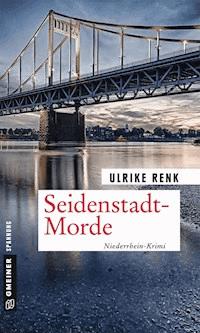9,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Von Liebe und Seide ...
Im Jahr 1753 reist die 25-jährige Mennonitin Anna von Radevormwald nach Krefeld. Sie soll ihrem Onkel den Haushalt führen. Unterwegs lernt sie Claes kennen, der sich bei einem Überfall schützend vor sie stellt. Anna verliebt sich in ihn, doch fühlt er sich schon einer anderen versprochen. Die Geschichte einer Frau, die ihren eigenen Weg geht, bis sie endlich den Mann findet, der sie liebt.
Eine opulente Familiensaga über die Seidenweberei im 18. Jahrhundert, die auf authentischen Quellen beruht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 625
Ähnliche
Ulrike Renk
Die Frau des Seidenwebers
Historischer Roman
Impressum
ISBN E-Pub 978-3-8412-0065-5ISBN PDF 978-3-8412-2065-3ISBN Printausgabe 978-3-7466-2618-5
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertungist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesonderefür Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischenSystemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung morgen, Kai Dietrich unter Verwendungeines Motives von akg images und © The Art Archive
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Danksagung
Für Thomas
»You can’t tell me, it’ s not worth trying for
I can’t help it, there is nothing I want more«
›Bryan Adams‹
Kapitel 1
Es war bitterkalt und dunkel, als Anna aufstand. Sie machte sich nicht die Mühe, die Kerze zu entzünden. Sie schüttelte den Kopf, vermeinte den Schnee und Reif aus ihren langen, dunklen Haaren rieseln zu spüren. Es hatte geschneit in der Nacht, der letzten Nacht, die sie in diesem Zimmer, in diesem Bett, in diesem inzwischen verhassten Haus verbracht hatte.
Da Vollmond war, hatte sie den feinen Pulverschnee durch die Dachpfannen und Strohpuppen rieseln sehen. Wie feine Nadelstiche hatte sie ihn auf ihrer Haut gespürt. Sie strich sich über ihr Gesicht, fuhr mit gespreizten Fingern durch die Haare, flocht dann einen festen Zopf.
Der Mond war inzwischen untergegangen, und es würde noch einige Stunden dauern, bevor die Sonne aufging. Es war die Stunde der Wesenlosigkeit zwischen Nacht und Tag, ein tiefes Schweigen lag über dem Haus.
In dieser letzten Nacht hatte sie keinen Schlaf gefunden, hatte sich immer und immer wieder in die Decken eingewickelt, gewälzt, die Augen geschlossen und versucht, alle Gedanken und Ängste zu verbannen. Es war ihr nicht gelungen.
Mit einer schnellen Bewegung schlüpfte sie aus ihrem Nachtgewand, zog die klamme Wäsche an, die dicken Strümpfe. Das Reisekleid lag über dem Stuhl. Anna zwängte sich hinein, schloss die Haken. Ihre Schuhe standen unten im Flur.
Sie drehte sich um ihre Achse, obwohl sie nichts sah. Noch einmal atmete sie den modrigen Geruch des Mansardenzimmers ein. Nun war er vermischt mit dem metallenen Geruch von feinem Schnee und Eis.
Die Diele vor der Tür war locker und knarzte, wenn sie darauf trat. Drei Jahre lang hatte sie vermieden, das Brett zu berühren, denn das Geräusch ging durch das stille Haus. Heute nicht. Diesmal trat sie wuchtig auf, genoss den Ton, sah gleichsam vor ihrem inneren Auge die Schwägerin ein Stockwerk tiefer aus dem Schlaf hochschrecken.
Christine, die Frau ihres Bruders, die ihr das Leben zur Hölle gemacht hatte, sie würde nun im Bett sitzen, in dem großen Bett, das einst Annas Eltern gehört hatte und in dem Anna geboren worden war. Christine würde dort sitzen und schimpfen.
»Friederich, deine Schwester macht Lärm. Tu was!«
Dann würde sie sich wieder hinlegen, sich in die Daunendecke kuscheln. Der kleine Ofen in der Ecke des Raumes strahlte bestimmt eine angenehme Wärme aus. Kein Schnee, kein Eis, kein Zugwind störten ihren Schlaf.
Nein, Anna wollte nicht neiden. Sie gönnte Christine alles Glück der Welt. Langsam stieg sie die steile Stiege hinab, einen kurzen Moment stockte sie auf dem Absatz, hielt die Luft an und lauschte. Kein Ton war zu hören.
In der Küche glimmte noch das Feuer. Anna legte einige Scheite auf und blies in den Ofen. Sie rieb ihre kalten Finger aneinander, hockte vor der Glut. Gleich schon würden die Flammen auflodern und Wärme verstrahlen.
Ein letztes Mal würde sie das Frühstück bereiten. Aus der Kammer neben der Küche hörte sie Geräusche. Auch das Mädchen war schon wach. Sie würde die Öfen in den Wohnräumen anfachen und Wasser holen.
Anna überlegte, ob sie ihren Bruder wecken sollte. Um neun mussten sie in Solingen sein, um die Postkutsche nach Düsseldorf zu erreichen. Es war vier Uhr in der Frühe, die Zeit drängte. Sie konnte sich nicht entschließen, die Treppe noch mal hochzusteigen. Endlich hörte sie Geräusche, ihr Bruder schien erwacht zu sein.
Sie strich über das raue Holz des Gesindetisches in der Küche, während Sophia nebenan den Tisch deckte. Als Anna klein gewesen war, hatten sie in der Küche gefrühstückt. Für Gäste wurde der Tisch in der Stube gedeckt. Seit Christine in diesem Haus wohnte, war alles feiner geworden, aber nicht besser.
Vor fünf Jahren waren Annas Eltern an Diphtherie gestorben. Friederich übernahm die Leinenfärberei, und Anna führte ihm den Haushalt. Auch wenn der Verlust der Eltern schwer war, hatten sie es doch gut miteinander. Bis Christine gekommen war.
»Verdammt, es ist kalt!« Hans, der Knecht, trat ein, schüttelte den Schnee von den Schultern, stellte sich an den Herd und rieb sich die Hände.
»Nicht fluchen, Hans.« Anna lächelte.
»Ich habe die Kutsche fertig gemacht, aber wir werden an der Steigung Probleme haben.«
»Warum?«
»Es ist glatt. Ich habe Bauer Stünnes schon gestern Bescheid gegeben. Wir müssen seine Pferde vorspannen, um die Steigung zu schaffen.«
Unruhig rührte Anna die Buchweizengrütze um. Sie spürte ihr Herz in der Brust schlagen, es fühlte sich an, als wäre dort ein kleines Tier gefangen. Nur einmal war sie bisher so weit gereist, vor sechs Jahren. Doch damals war sie zusammen mit ihrem Vater gefahren. Bis Solingen wollte Friederich mitkommen, aber ab da würde sie auf sich alleine gestellt sein, zum ersten Mal in ihrem Leben.
»Ich habe Eure Truhe schon aufgeladen, Mademoiselle Anna. Die Pferde stehen bereit.« Hans nahm sich eine irdene Schüssel und hielt sie Anna hin. Sie gab ihm Grütze und sah ihm zu, wie er zufrieden aß. Sie selbst verspürte keinen Hunger. Trotzdem schnitt sie einige Scheiben von dem frischgebackenen Brot. Es war noch zu warm, um es mit Butter zu bestreichen. Auch vom Speck schnitt sie etwas ab. In der Kammer waren noch Äpfel, auch davon steckte sie sich welche ein. Sie rochen süß nach Sonne.
»Guten Morgen.« Friederich betrat die Küche. »Fertig?«
»Willst du nicht frühstücken?«
Annas Bruder schüttelte den Kopf. »Ich habe dir noch mal genau aufgeschrieben, welche Verbindungen du nehmen musst. Und auch an wen du dich zu wenden hast, wenn du in Kaiserswerth angekommen bist. Außerdem habe ich Onkel Arnold einen Brief geschrieben.«
Anna spürte einen dicken Kloß im Hals, mühsam versuchte sie zu schlucken. Schweiß rann ihr den Rücken hinunter. Sie biss sich auf die Unterlippe. Ihr Bruder musterte sie mit zusammengezogenen Augenbrauen.
»Wir müssen los«, sagte er und drehte sich um. »Ist die Kutsche fertig, Hans?«
Der Knecht nickte.
Im Flur vor dem Spiegel rückte Anna ihre Haube zurecht. Sie nahm ihren Mantel und das Umschlagtuch. Noch einmal ging sie langsam durch die Räume im Erdgeschoss. Vermutlich würde sie nie wieder nach Radevormwald zurückkehren.
Es war kalt und dunkel. Anna zog das Tuch fester um ihre Schultern, trotzdem wollte sich kein wohliges Gefühl einstellen. Sie zitterte, aber nicht nur vor Kälte. Die Zukunft und das, was vor ihr lag, machten ihr Angst. Vor drei Monaten, als der Brief des Onkels gekommen war, hatte sie es als Chance angesehen. Seine älteste Tochter Katrina würde heiraten. Da sie ihm den Haushalt führte, seit seine Frau vor einem Jahr im Wochenbett gestorben war, brauchte er nun Hilfe.
Anna hatte sich entschlossen, zu ihm nach Krefeld zu ziehen. Voller Freude stürzte sie sich in die Vorbereitungen. Doch nun beschlichen sie Zweifel und Ängste. Was, wenn sie mit dem Onkel nicht auskäme? Wenn er ähnlich hart mit ihr umspringen würde wie ihre Schwägerin? Vom Regen in die Traufe?
Würde sie Anschluss finden in der Fremde, würde sie sich dort wohlfühlen? Niemand konnte ihr diese Fragen beantworten. Sie umklammerte den Bügel ihrer Ledertasche, die sie auf dem Schoß hielt, schloss die Augen und betete.
Sie musste eingenickt sein, denn als der Wagen abrupt anhielt, kippte sie zur Seite und stieß sich den Kopf. Draußen war das erste Licht des Morgens zu erahnen. Trotzdem konnte sie nicht viel erkennen. Hans war vom Kutschbock abgestiegen und leuchtete mit der Öllampe. Sie konnte ihn nur schemenhaft erkennen.
Anna öffnete den Wagenschlag und stieg aus. »Ist etwas passiert?«
»Alleine schaffen wir die Steigung nicht. Stünnes ist nicht da.« Hans brummte mürrisch.
»Wann hast du mit ihm gesprochen?«, fragte Friederich.
»Gestern. Wenn er nicht kommt, haben wir ein Problem. Dann können wir direkt umkehren.« Friederich sprang vom Kutschbock.
Die Pferde schnaubten. Anna trat neben sie und streichelte dem einen Tier über die Nüstern. Sie mochte den Geruch, die weiche Haut und die großen Augen der Pferde.
»Wenn wir die Postkutsche verpassen, kannst du erst im Frühjahr nach Krefeld,« sagte ihr Bruder.
Anna konnte den Ärger in seiner Stimme hören.
»Warum?«
»Die Postkutsche fährt nur einmal in der Woche. Wir haben Anfang November, und die Straßenverhältnisse werden nicht besser. Ich finde es jetzt schon riskant.«
»Der Onkel braucht mich aber jetzt.«
»Das weiß ich, Anna. Ich kann ja nichts dafür, dass es so lange gedauert hat, bis wir alles geklärt hatten. Die politische Lage ist zudem angespannt, wie du weißt.«
Ihre Familie gehörte zu den wenigen Mennoniten, die im Bergischen Land verblieben waren, nachdem der katholische Erzherzog vom Berg die Täufergemeinden aufgelöst hatte. Sie wurden geduldet, aber hatten mit manchen Repressalien zu kämpfen. Immer wieder hatte ihr Bruder überlegt zu konvertieren, doch bislang war es bei den Überlegungen geblieben.
Nach Krefeld waren viele der Familien geflohen. Dort durften sie ihren Glauben frei ausüben, sogar eine schlichte Kirche war gebaut worden.
»Warum …« Anna zögerte. Schon seit Wochen brannte ihr eine Frage auf den Lippen, bisher hatte sie sich jedoch nicht getraut, diese auch zu stellen. Nun erschien ihr der richtige Zeitpunkt gekommen. »Warum zieht ihr nicht mit um? Der Onkel hat es dir doch schon oft angeboten.«
Langsam wurde es heller. Anna konnte seinen Umriss erahnen. Friederich trat neben sie. Er schüttelte den Kopf.
»Das Geschäft läuft gut hier. Ich habe meinen Kundenstamm, ich kenne meine Arbeiter. In Krefeld müsste ich ganz von vorne anfangen. Vermutlich würde Onkel Arnold mich bei sich anstellen, aber das wäre nicht dasselbe, wie ein eigenes Geschäft zu leiten. Ich könnte Christine nicht das Leben bieten, das sie jetzt hat.«
Anna nickte. Sie hatte sich gedacht, dass Christine bei dieser Entscheidung eine große Rolle spielte. Im Grunde war sie auch froh, endlich von ihrer Schwägerin wegzukommen. Doch um ihren Bruder tat es ihr leid. Sie legte ihm die Hand auf den Arm, spürte den dicken Wollstoff, der von Raureif benetzt war. Er roch leicht nach Tabak und Leder, genauso wie ihr Vater immer gerochen hatte. Anna schloss für einen Moment die Augen, schluckte die Tränen hinunter.
»Du wirst es gut bei Onkel Arnold haben, er gleicht Vater sehr. Und das Leben in Krefeld wird sicherlich anders, aber auch besser für dich sein. Ich weiß«, Friederich stockte, »dass du es nicht leicht hattest in den letzten Jahren.«
Plötzlich schnaubten die Pferde und wieherten. Hinter dem Hügel erklang die Antwort.
»Dem Himmel sei Dank, Bauer Stünnes!« Friederich ging ihnen entgegen.
Anna stampfte mit den Füßen auf, versuchte das Blut zum Zirkulieren zu bringen.
Es erschien ihr eine Ewigkeit zu dauern, bis die Männer die beiden zusätzlichen Pferde vor den Wagen gespannt hatten. Doch endlich war es geschafft. Sie öffnete die Tür der Kutsche, wollte einsteigen, aber ihr Bruder hielt sie zurück.
»Es ist zu gefährlich. Der Boden ist vereist, die Radspuren sind tief. Die Kutsche könnte wegrutschen oder umkippen. Wir werden laufen. Allerdings in sicherer Entfernung.«
»Es ist schon schwierig, eine Kutsche bei normalen Wetterverhältnissen hier hochzuziehen.« Der Bauer fluchte und schwang die Peitsche. »Auf, auf, vorwärts!«
»Zu dumm, dass es keinen anderen Weg gibt. Über den Fluss kommen wir bei dem Wetter auch nicht, seit die Brücke eingestürzt ist. Wir müssen diesen Umweg nehmen.« Auch Friederich schaute sich besorgt zu dem Wagen um.
Endlich hatten die Pferde Tritt gefasst und zogen nun die Kutsche langsam den steilen Abhang nach oben. Immer wieder schwankte das Gefährt. Durch den Anstieg wurde Anna warm. Sie konnte ihre Füße wieder fühlen, wie tausend kleine Nadeln stach es dort. Doch das war besser als das taube Gefühl der Kälte, fand sie.
Keuchend erreichten sie den Kamm des Hügels. Friederich bedankte sich beim Bauern, der erleichtert schien, diese schwierige Aufgabe gemeistert zu haben. Sobald die beiden zusätzlichen Pferde abgespannt worden waren, schnalzte Hans, und die Kutsche setzte sich wieder in Bewegung.
Allmählich wurde es hell. Anna konnte die Umgebung erahnen. Sie starrte nach draußen, doch durch ihren Atem beschlug die Scheibe. Als die Fichten von Erlen und Weiden abgelöst wurden, wusste sie, dass sie sich der Wupper näherten. Sie würden über die Kräwinklerbrücke fahren und danach Remscheid erreichen.
Der Wagen fuhr nun schneller. Hier war die Straße breiter und besser instand gehalten. Anna konnte es hören, als sie die Steinbrücke befuhren. Das Klappern der Hufe und auch das Geräusch der Räder wurden lauter. Die Sonne ging in dem Moment über den Hügeln auf, als sie in der Mitte der Brücke waren. Der Anblick war wunderschön, und Anna hielt für einen Moment die Luft an.
Die kleine Stadt war schon zum Leben erwacht. Vor einem Gasthaus hielten sie an.
»Für eine längere Rast ist keine Zeit, aber kurz aufwärmen können wir uns.« Friederich öffnete den Wagenschlag und half Anna heraus.
Ihnen schlug der Duft von Kohlsuppe entgegen. Das Feuer im Kamin brannte heimelig. Anna stellte sich davor, um sich zu wärmen. Ihr Bruder brachte ihr einen Humpen warmes Bier. Anna trank es hastig, spürte die Wärme, die sich endlich wieder in ihrem Körper ausbreitete.
»Wir müssen weiter, Anna, sonst verpassen wir die Postkutsche.« Friederich kam mit einem Schwall kalter Luft in den Schankraum. Er legte ein Geldstück auf den Tisch und nickte der Wirtsfrau zu.
Diesmal setzte er sich nicht auf den Kutschbock, sondern stieg mit Anna in den Wagen.
»Die erste Hälfte der Strecke haben wir geschafft. Jetzt noch mal so weit, und wir sind in Solingen. Dort steigst du in die Postkutsche. Diese nimmt dich mit bis nach Düsseldorf. Dort wirst du mit der Fähre übersetzen. Ich hoffe, alles klappt reibungslos.« Er sah an ihr vorbei. Ihr Bruder knetete unruhig seine Hände. Anna wusste, dass er nicht ohne Grund zu ihr in den Wagen gestiegen war. Irgendetwas wollte er ihr sagen.
»Die Reiseroute haben wir doch schon besprochen. Ich nehme nicht an, dass sich etwas geändert hat.« Anna lächelte.
»Nein, nein. Ich wollte nur sichergehen, dass du dir alles gemerkt hast.«
»Friederich, du hast es mir mindestens zehn Mal erklärt und auch aufgeschrieben.« Sie beugte sich vor und ergriff seine Hand. »Da ist doch noch etwas anderes, oder?«
Er erwiderte ihren Griff, hielt ihre Finger zwischen beiden Händen. Endlich schaute er sie an.
»Anna, wir sind ein Stück unseres Lebens gemeinsam gegangen. Du hast mich immer unterstützt, warst immer für mich da. Nach dem Tod der Eltern hast du mich aufrecht gehalten. Ich möchte dir dafür danken.«
»Aber das war doch selbstverständlich.« Anna biss sich auf die Lippe. Ihr Bruder war kein Mann der großen Worte, sie wusste, wie viel Überwindung es ihn kostete, dies auszusprechen.
»Vielleicht sehen wir uns nie wieder, Anna. Ist dir das bewusst?«
Sie nickte. Wieder spürte sie den Kloß in ihrem Hals und schluckte hart.
»Du wirst es gut haben in Krefeld. Onkel Arnold wird für dich sorgen. Die Gemeinde dort ist groß, und sicherlich findest du auch einen Mann, der dich liebt und ehrt.«
Anna zwinkerte heftig. Sie wollte jetzt nicht weinen.
»Ich freue mich auf die Zukunft. Wirklich.« Sie versuchte zu lächeln.
»Ich finde dich trotzdem sehr tapfer. Ich weiß, es war nicht leicht bei uns für dich in den vergangenen Jahren.« Ihr Bruder senkte den Kopf. »Es war auch nicht leicht für Christine, und so manches harsche Wort hat sie nicht so gemeint, da bin ich mir sicher.«
O doch, das hat sie, dachte Anna, sagte es aber nicht. Viele der Vorfälle zwischen ihr und ihrer Schwägerin hatte Friederich gar nicht mitbekommen. Er verließ morgens das Haus und kehrte erst abends zurück. Die langen Stunden dazwischen hatte sie mit Christine alleine verbracht. Sie war ihrer Gehässigkeit, ihren Vorwürfen und auch dem harten Tagewerk schutzlos ausgeliefert gewesen.
»Nun ja.« Friederich ließ ihre Hand los, nestelte an seiner Manteltasche. Er zog ein kleines Samtsäckchen hervor und öffnete die Kordel. In seiner Hand schimmerte es plötzlich. »Dies ist Mutters Schmuck. Ihr Ehering und die Kette, die ihr Vater zu meiner Geburt geschenkt hat.«
Mit großen Augen starrte Anna auf die Schmuckstücke. Ihre Mutter hatte sie immer getragen, sie gehörten zu ihr, und irgendwie hatte Anna geglaubt, dass sie auch damit begraben worden war.
»Ich wollte Christine die Sachen schenken, sobald sie das erste Kind geboren hat.« Friederich räusperte sich. Die Ehe war in den drei Jahren kinderlos geblieben. »Aber nun ist der Zeitpunkt gekommen, dir die Sachen zu geben.«
Anna hielt den Atem an. Sie war überwältigt. »Das … das kann ich nicht annehmen, Friederich. Ich wusste gar nicht …«
»Doch, das kannst du.« Er nahm ihre Hand, drehte die Handfläche nach oben und legte das Samtsäckchen hinein. »Es gehört dir. Ich hätte es dir schon längst geben sollen, geben müssen.« Dann schloss er ihre Finger über dem Schmuck.
»Aber, Friederich.« Anna schüttelte den Kopf. Eine Haarsträhne löste sich unter ihrer Haube. »Ihr werdet bestimmt Kinder haben. Christine …«
»Nein. Mutters Schmuck gehört dir. Dir allein. Komm, leg die Kette um. Ich helfe dir.«
Anna besah den Schmuck, Tränen stiegen ihr in die Augen. Sie streichelte über das kühle Gold. Dann streifte sie den Ring über. Er war schlicht, nur eine Perle zierte ihn. Vater hatte oft erzählt, wie er den Ring in Amsterdam gesehen und gekauft hatte. Das war lange, bevor er ihre Mutter ehelichte.
»Dieser Ring war wie geschaffen für die Frau, die ich lieben würde«, hatte er immer gesagt und dann seine Frau voller Stolz und Liebe angesehen.
Friederich nahm Anna die Kette ab und riss sie damit aus ihren Gedanken. »Dreh dich um und öffne deinen Mantel.«
Sie tat, wie er ihr gesagt hatte, fühlte die eisige Luft auf ihrem Hals, spürte seinen warmen Atem, als er sich vorbeugte und ihr die Kette umlegte. Es dauerte einen Moment, bis er den Verschluss eingehakt hatte. Die Kette war schwer und fühlte sich ungewohnt an. Anna griff nach dem Medaillon, hielt es in ihrer Hand fest. Sie schloss die Augen. Das Bild ihrer Mutter stand vor ihr, als hätte sie sie erst gestern gesehen.
»Danke«, quetschte sie heraus.
»Es gibt noch etwas.« Die Stimme ihres Bruders klang belegt, er räusperte sich mehrfach. Anna schloss den Mantel, zog das Tuch wieder um ihre Schultern und drehte sich zu ihm um. Nun war sie diejenige, die seinem Blick auswich.
»Ich möchte dich um etwas bitten.« Wieder lehnte sich Friederich nach vorne und ergriff ihre Hände. »Ich möchte, dass du mir schreibst. Ich werde versuchen, auch nach Krefeld zu kommen, so es meine Geschäfte zulassen. Ich habe vor, meine Handelsbeziehungen über den Rhein hin zu erweitern.«
Anna nickte stumm.
»Falls du Sorgen oder Kummer hast, lass es mich wissen. Nach Christine bist du der wichtigste Mensch in meinem Leben.«
Anna hob den Kopf und sah ihn an. Nach Christine, diese Worte taten ihr weh. War sie nicht blutsverwandt mit ihm? Stand sie ihm nicht eigentlich näher?
»Ich nehme an, dass Onkel Arnold einen passenden Mann für dich finden wird. Jemand, der dich so liebt, wie du es verdienst. Und obwohl ich unserem Onkel vertraue, würde ich davon gerne erfahren.«
»Ach, Friederich. Erstmal werde ich mich doch einleben müssen in der fremden Stadt bei den fremden Menschen. Und dann soll ich doch dem Onkel den Haushalt führen. In den nächsten Jahren wird für mich nicht die Zeit sein, um eine Ehe zu schließen.« Anna schnaubte leise. Es hatte einen Mann gegeben, den sie nett fand, mehr als nett. Doch ihn zog es weg vom dörflichen Leben. Er suchte das Abenteuer. Vor drei Jahren war er nach Genua aufgebrochen, und seitdem hatte niemand mehr von ihm gehört. Der Gedanke, noch mal ihr Herz zu verlieren, machte Anna Angst.
»Du bist fast sechsundzwanzig. Irgendwann in den nächsten Jahren solltest du auch eine Familie gründen.« Besorgt schaute Friederich sie an. Er ahnte, was in ihren Gedanken vor sich ging. »Nicht jeder ist auf Abenteuer aus oder ein Hallodri.«
Anna neigte den Kopf. Das Thema behagte ihr nicht. So manche Nacht hatte sie weinend auf dem Fenstersitz in ihrem Zimmer verbracht, bis Christine sie schließlich in das Mansardenzimmer abgeschoben hatte.
»Ich werde mich allen Herausforderungen stellen, Friederich. Gott hat einen Plan, das weiß ich. Und vielleicht bedeutet dieser Plan, für Onkel Arnolds Familie zu sorgen und da zu sein.«
Friederich seufzte. Dann griff er wieder in seine Manteltasche. »Hier ist noch etwas.«
Diesmal war es ein Ledersäckchen, das schwer in seiner Hand zu wiegen schien.
»Geld?«, fragte Anna erstaunt. »Du hast mir schon Geld gegeben. Ich habe es in den Saum meines Mantels genäht. Außerdem die Bürgschaften.«
»Ja, ich weiß. Der Zoll und die Reise sind auch bezahlt. Aber wer weiß, was noch so passiert. Es sind seltene Goldmünzen, die Vater im Garten vergraben hatte.«
»Das kann ich unmöglich annehmen.« Anna hob abwehrend die Hände. In diesem Moment schien die Sonne durch das Kutschenfenster, und der Goldreif an ihrem Finger funkelte auf.
»Doch, das kannst du. Es ist nur ein Teil und wenig genug. Nimm es bitte.« Friederich schien die Luft anzuhalten. »Bitte.« Das Wort klang gepresst.
Anna schüttelte den Kopf.
»Bitte, Anna. Ich habe sowieso das Gefühl, dich im Stich zu lassen.«
»Aber es war doch meine Entscheidung zu gehen.«
»Trotzdem.«
Anna war überrascht, als sie Solingen erreichten. Atemlos betrachtete sie das Stadtbild. Bisher war sie nur wenige Male so weit weg von zu Hause gewesen. Alles erschien fremd und neu.
Plötzlich erreichten sie viel zu schnell die Poststation. Die Kutsche wartete schon. Schnell wurde ihr Gepäck verladen. Dann nahm Anna ihren Bruder noch einmal in den Arm.
»Mach es gut«, sagte er und stopfte ihr den Geldbeutel, den er die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte, in die Manteltasche. Sie bemerkte es wohl und nahm es hin.
»Danke, Friederich. Möge Gott mit dir sein.«
»Und mit dir. Wir werden uns wiedersehen.«
Anna stieg in die Postkutsche. Sie war der einzige Passagier an diesem Morgen, und kaum hatte sie Platz genommen, fuhr die Kutsche schon los.
Kapitel 2
Solange sie konnte, winkte sie ihrem Bruder. Schließlich bog die Kutsche in eine Gasse, und sie verlor ihn aus den Augen. Viele kleine Fachwerkhäuser schmiegten sich in den winkeligen Gassen aneinander. Die Kutsche konnte auf dem Kopfsteinpflaster nur langsam fahren. Abwässer waren gefroren, und immer wieder rutschten die Pferde auf den vereisten Pfützen aus. Anna sah aus dem Fenster, versuchte nicht an den Abschied zu denken, sondern all das Neue in sich aufzunehmen. Doch immer wieder verschwamm ihr Blick. Das kalte Metall des Goldringes ihrer Mutter fühlte sich schwer und ungewohnt an ihrem schlanken Finger an. Unbewusst drehte und rieb sie den Ring. Das Metall erwärmte sich. Der Ring war ihr zu groß, sie würde ihn enger machen lassen müssen. Sie erinnerte sich an die Hände ihrer Mutter, die durch ständige Arbeit rau und schrundig geworden waren. Nie hatten diese Hände geruht. Sie hatte den Haushalt geführt, die Küche verwaltet und selbst abends, wenn die Familie vor dem Kaminfeuer saß, war Näh- oder Flickzeug in ihren Fingern.
Sieben Kinder hatte ihre Mutter ihrem Vater geboren, fünf davon begraben. Nur Friederich und Anna hatten überlebt.
Der Ring gehört von Rechts wegen Christine, dachte Anna und war doch froh, dass ihr Bruder sich so entschieden hatte. Ganz fest glaubte Anna daran, dass Christine ihm einen Erben gebären würde. Sie wünschte es ihrer Schwägerin von Herzen und war davon überzeugt, dass die Härte in Christines Wesen auch von ihrer Kinderlosigkeit herrührte.
Die Kutsche wurde noch langsamer und hielt schließlich an. Sie standen vor einer großen Kirche mit einem imposanten Turm. Es war die lutheranische Kirche, wie Anna wusste. Vor ein paar Monaten waren sie hier gewesen, um einen Prediger zu hören.
Ein Mann mit hochrotem Kopf riss den Wagenschlag auf und stieg keuchend ein. Als er Anna sah, zögerte er kurz, ließ sich aber dann mit einem lauten Seufzer ihr gegenüber nieder und schloss die Tür. Mit ihm zusammen waren ein Schwall eiskalter Luft und der Geruch von Kohl und Pfeifentabak in die Kutsche gedrungen.
»Einen wunderbaren Tag wünsche ich Euch, schöne Frau. Was ein Glück, dass ich die Kutsche noch erwischt habe. Bis zur Poststation habe ich es nicht mehr geschafft, aber ich wusste, dass sie hier vorbeikommt, und habe mich einfach mitten auf die Straße gestellt.« Der Mann holte tief Luft. »Verzeiht.« Wieder pustete er laut die Luft hinaus.
Anna lachte. »Nun kommt erst einmal zu Euch.«
»Jaja. Ich bin seit gestern unterwegs. Von Frankfurt her. Irgendeine Brücke war gesperrt, dann gab es einen Brand, schließlich ist das Wagenrad gebrochen. So ein Elend! Ich bin von der Postkutsche runter, habe mich mitnehmen lassen, aber kam nur vom Regen in die Traufe. Und schließlich bin ich in Solingen gelandet. Aber das Posthaus war voll. Ich habe eine Unterkunft in einer anderen Pension gefunden.« Er räusperte sich, und Anna meinte, eine leichte Röte aus dem Kragen den Hals hoch und über die Wangen kriechen zu sehen. Irgendwas war passiert, das ihn aufgehalten hatte. Sie konnte sich schon denken, was oder wer es war, und verkniff sich ein Lachen.
»Nun habt Ihr die Postkutsche ja doch erreicht. Das ist doch alles, was zählt. Ihr kommt von Frankfurt und wollt nach Düsseldorf?«
»Ja, genau.« Der Mann hustete kurz und fuhr sich über die Haare. Sie waren in einem hellen Ton, ohne gepudert zu sein, er hatte sie flüchtig zu einem Zopf zusammengefasst. Anna war sich sicher, dass er normalerweise die Haareüber den Ohren eingedreht hatte. Dazu war wohl heute keine Zeit gewesen. Nun nahm sie auch ein sehr blumiges Parfüm wahr, ein Hauch von Duft, der aus seinen Kleidern drang. Der Mann war groß und hager, hatte eine strenge Nase, aber gütige Augen. Um seine Mundwinkel hatten sich tiefe Falten eingegraben, doch ebenso waren Lachfältchen wie Speichen eines Wagenrades um seine Augen zu erkennen. Das Parfüm passte nicht zum ihm und war auch sicher nicht seines.
»Eigentlich muss ich nach Krefeld. Aber dorthin führt ja noch kein Postweg, auch wenn König Friedrich es längst versprochen hat. So muss man über Umwege reisen und den letzten Teil der Strecke privat realisieren.«
»Ach«, entfuhr es Anna. »Nach Krefeld. Dort will ich auch hin.«
Verwundert zog der Mann die Augenbrauen hoch. »So weit und alleine?«
»Nun ja. Ich fahre, um bei meinem Onkel zu leben. Meine Eltern sind verstorben.« Wieder drehte Anna den Ring an ihrem Finger. Es würde eine Angewohnheit werden, da war sie sich jetzt schon sicher. »Und mein Bruder kann mich nicht die ganze Strecke begleiten. Er hat Verpflichtungen.«
»Dann werden wir gemeinsam reisen.« Der Mann lächelte, und die Lachfältchen vertieften sich. Er war Anna auf Anhieb sympathisch. »Ich habe mich, verzeiht, noch gar nicht vorgestellt. Claes ter Meer.« Er erhob sich halb, reichte ihr die Hand.
»Anna te Kloot.«
»Madame te Kloot, wie angenehm Euch als Reisebegleitung anzutreffen. Ihr seid nicht zufällig mit Arnold te Kloot verwandt?«
»Mademoiselle te Kloot.« Anna versuchte nicht zu kokettieren. Sie wollte keinen falschen Eindruck erwecken. »Ja, das ist mein Onkel, zu dem ich reise.« Sie warf einen Blick aus dem Fenster, doch inzwischen hatten sie die Stadt verlassen und fuhren durch die Hügel des Bergischen Landes. »Meine Familie stammt aus Radevormwald. Mein Onkel lebt allerdings schon seit Jahrzehnten in Krefeld und führt dort seine Geschäfte.«
»Ich weiß. Er ist unser Nachbar. Meine Mutter hat auf der Mühlenstraße eine kleine Rossmühle. Und Ihr reist zu Eurem Onkel?« Ter Meer sah sie interessiert an.
»Ja. Ich werde ihm den Haushalt führen. Seine älteste Tochter tat dies bisher, aber sie wird heiraten.«
Ter Meer schmunzelte. »Ich weiß. Sie heiratet meinen Bruder Adam. Wir werden quasi miteinander verwandt sein.«
Anna sah ihn erstaunt an. »Das ist doch nicht Euer Ernst. Ach, wie erfreulich!«
Tausend Gedanken schossen ihr durch den Kopf. Gab es so was wie Zufall, oder war es Schicksal, dass sie auf dieser Reise diesen Mann traf? Bis vor wenigen Augenblicken hatte sie sich ganz verloren gefühlt, doch nun war hier jemand, der aus ihrer zukünftigen Heimat stammte und mit dem sie über vier Ecken verschwägert sein würde.
»Dann kennt Ihr sicher meine Familie?«, fragte sie und beugte sich interessiert vor.
»O ja. Sie haben eine Leinenbleicherei. Das hat mein Vater bis zu seinem Tod auch gemacht. Meine Mutter hat, wie gesagt, die Mühle, und Adam hilft ihr damit. Ich und mein Bruder Abraham versuchen uns jetzt in Bandweberei. Deshalb war ich auch in Frankfurt.«
»Welch unverhofftes Treffen! Ich bin froh, dass Eure Reise so verlaufen ist, und wir nun zusammen fahren können. Ich hatte mich doch etwas verloren gefühlt, zumal ich Krefeld nicht gut kenne.«
»Wart Ihr schon einmal dort?«
»Ja, aber das ist Jahre her.«
Das Geräusch der Hufe und des Wagens hatte sich wieder verändert, sie hatten die gepflasterte Straße verlassen. Im Herbst und im Frühjahr, wenn der Boden matschig war, bildeten sich tiefe Furchen durch die Räder. Diese Furchen waren nun gefroren. Hin und wieder kam die Postkutsche aus der Spur und schwankte gewaltig. Mehrfach hielt Anna vor Schreck die Luft an.
»Keine Sorge«, beruhigte ter Meer sie. »Ich bin schon oft mit der Post gereist, und nur einmal ist der Wagen umgestürzt. Die Kutscher sind erfahren und besonnen.«
Inzwischen hatte sich der Himmel zugezogen. Das Licht war gelblich-grau, dicke Wolken zogen im Westen auf.
Die Zeit schien wie im Fluge zu verstreichen. Er erzählte von der Stadt, von der Gemeinde, denn auch die ter Meers waren Mennoniten.
»Unsere Gemeinde ist groß. Wir haben ein eigenes Gotteshaus, viele Prediger finden den Weg nach Krefeld.«
»Ja, darauf freue ich mich. In Radevormwald können wir uns zu dem Glauben nicht offen bekennen.«
Die Landschaft veränderte sich. Hin und wieder hielten sie an, der Kutscher lieferte Post und Zeitungen aus, nahm Briefe an und so manch anderes Stück, was verschickt werden sollte.
Die Unterbrechungen waren nur kurz. Ein etwas längerer Aufenthalt war in Hilden vorgesehen, doch auf Grund der Wetterlage – inzwischen fielen dicke Schneeflocken – beschlossen sie, weiterzufahren und erst in Eller Rast zu machen.
In Hilden stieg eine Frau zu und setzte sich neben Anna. Obwohl die Kutsche auf ihren gepolsterten Lederbänken vier Leuten bequem Platz bot, musste Anna sich ganz in die Ecke quetschen und hatte immer noch das Gefühl, erdrückt zu werden.
»Madame Brues«, stellte sie sich vor und musterte ter Meer mit strengem Blick. Sie versuchte kurz, sich zu Anna umzudrehen, gab aber rasch schnaufend auf. Sie verströmte einen strengen Schweißgeruch, gemischt mit dem von saurer Milch. Anna atmete durch den Mund.
Von nun an war es mit der gepflegten Konversation vorbei, die Anna von ihren düstern Gedanken und Sorgen abgelenkt hatte. Madame Brues redete. Ein Wortschwall brach wie ein rauschender Bach aus ihr hervor. Sie holte immer wieder tief und geräuschvoll Luft, ließ aber niemand anderen zu Wort kommen.
Zuerst ließ sie sich über den frühen und ungewöhnlich scharfen Wintereinbruch aus, dann über das Wetter und seine Phänomene im Allgemeinen, und schließlich berichtete sie detailliert über ihre weitläufige Familie.
Anna sah zu Claes ter Meer hinüber. Die ersten zwanzig Minuten hatte er versucht, dem Monolog zu folgen und hin und wieder einen Einwand eingeworfen. Da aber Madame Brues überhaupt nicht reagierte, gab er es auf. Sein Blick wurde zunehmend glasiger. Zweimal unterdrückte er ein Gähnen. Anna lächelte belustigt. Der Mittag war lange verstrichen. Dadurch, dass es so bedeckt und duster war, konnte Anna nicht einschätzen, wieviel Zeit schon vergangen war. Es erschien ihr, als würde sie seit Ewigkeiten in der Kutsche sitzen. Der Rücken tat ihr weh, ihre Füße spürte sie wegen der Kälte kaum. Immer wieder griff sie zu ihrem Hals, befingerte die Kette, drehte den Ring an ihrem Finger.
Plötzlich verlangsamte die Kutsche ihre Fahrt. Sollten sie etwa schon in Eller sein? Anna sehnte sich danach, aufzustehen und ihre eingefrorenen Glieder zu bewegen. Ein lauter Ruf erscholl. Anna beugte sich noch weiter vor, konnte aber nicht erkennen, wer dort war. Vor ihnen war eine Landwehr, und offensichtlich mussten sie die May passieren.
»Nanu?« Auch Claes ter Meer beugte sich vor und schaute nach draußen. »Was hält uns auf?«
Endlich hatte Madame Brues ihren Monolog beendet. »Hoffentlich ist das kein Überfall«, hauchte sie.
»Ein Überfall?« Ter Meer lachte. »Hier? Unmöglich. Wer sollte uns überfallen?«
»Die Franzosen. Es sind Truppen in Benrath und Erkrath stationiert. Immer wieder gibt es Soldaten, die Höfe überfallen. Sie wollen Nahrung und Geld. Manchmal schänden sie die Frauen.« Der riesige Busen der Frau wogte aufgeregt, ihre Hände zitterten. Die dicken Schweinsbäckchen und das Doppelkinn färbten sich rötlich. »Ich brauche mein Riechsalz!«
Vor sich auf dem Boden stand ein Korb, sie beugte sich keuchend vor, konnte ihn aber nicht ergreifen.
»O Himmel …«, stöhnte Madame Brues. »Mein Riechsalz. Im Korb.«
Sie wedelte mit den Händen, schob sich zurück, drückte Anna noch mehr in die Ecke und schloss die Augen.
Ter Meer lachte leise, lehnte sich nach vorne und öffnete den Korb. Schnell fand er das gesuchte Gefäß und reichte es Madame Brues.
»Beruhigen Sie sich! Ich werde nachsehen, was los ist.« Er öffnete den rechten Kutschenschlag und stieg aus.
Anna öffnete die linke Tür, zwängte sich aus dem Sitz und sprang nach draußen.
Plötzlich hörte sie aufgeregte Stimmen. Die Männer sprachen französisch. Ihr Vater hatte nicht nur dafür gesorgt, dass seine Kinder lesen und schreiben konnten, sie hatten auch gute Kenntnisse in Französisch, Englisch sowie Niederländisch.
Gebannt blieb Anna stehen und lauschte.
Kapitel 3
»Wir haben den Zoll schon bezahlt.« Der Kutscher schien ärgerlich. »Hier ist das Siegel.«
»Dann zahlt Ihr noch mal.« Die Stimme klang unfreundlich. Es war tatsächlich ein Franzose.
»Warum sollte ich?«
»Gibt es ein Problem?« Claes ter Meer war an den Kutschbock getreten. Anna ging zwei Schritte weiter nach vorne. Nun sah sie einen Reiter, der schräg vor der Postkutsche stand. Sie drückte sich an die Wand des Wagens, um nicht entdeckt zu werden.
»Diese beiden französischen Offiziere verlangen Zoll. Ich habe den Zoll aber schon entrichtet«, sagte der Kutscher empört.
»Meine Herren, wie Ihr seht, hat unser Kutscher das Siegel. Der Zoll ist bezahlt. Wir möchten unsere Fahrt nun fortsetzen«, sagte Claes ter Meer nachdrücklich. Auch er sprach fließend Französisch.
»Wir werden Euch nicht durchlassen, solange Ihr nicht bezahlt habt.« Das sagte jemand, der auf der anderen Seite der Kutsche stand und den Anna nicht sehen konnte. Es klang gehässig.
Das Pferd des Reiters vor der Kutsche ging plötzlich zwei Schritte nach hinten. Er trug einen dunklen Wollmantel, hohe Lederstiefel und weiße Hosen. Mit einem Handgriff zog er eine Pistole aus dem Futteral am Sattel. Sein Mantel öffnete sich dabei. Anna konnte die blaue Uniformjacke mit den roten Aufschlägen erkennen. Der Griff der Pistole war aus ziseliertem Silber. Er spannte den Hahn.
Anna wich zurück. Die Tür des Wagens war zugefallen. Anna tastete sich am Gefährt entlang. Hinter dem Wagen ging sie in die Hocke. Links und rechts der Straße waren Gräben, dahinter kahle, schneebedeckte Felder. Es gab keinen Unterschlupf, kein Versteck.
Was würden die Männer tun? Würden sie den Zoll erpressen? Möglicherweise mit Gewalt? In ihrer Manteltasche wog das Ledersäckchen mit den Goldstücken ihres Bruders schwer. Der eine Franzose hatte nicht nur die Pistole, auch einen Degen führte er mit sich, und er machte durchaus den Eindruck, als ob er damit umgehen konnte.
Anna kroch zur rechten Seite, spähte hinter der Kutsche hervor. Auch der zweite Mann war beritten, er trug ebenfalls eine französische Uniform. Er hatte den Degen in der Hand, die Spitze der Waffe zeigte auf ter Meer.
»Ihr wollt euch nicht wirklich mit uns anlegen, mon ami?«
»Was Ihr hier tut ist unrechtmäßig. Nennt mir Euren Namen!«
»Damit Ihr uns meldet?« Der Franzose lachte schallend. Es klang böse. »Hast du das gehört, Jean-Paul? Dieser Deutsche ist lustig.«
»Wir werden ihm den Witz schon austreiben. Wie viele Passagiere führt Ihr mit Euch außer dem Witzbold dort, Kutscher?«
»Zwei. Es sind beides Frauen. Ich bitte Euch, lasst uns in Frieden weiterziehen, und wir werden kein Wort über diese Begegnung verlieren.«
Anna konnte die Angst in der Stimme des Kutschers hören.
»Wenn Ihr nicht zahlt, hat Euer letztes Stündlein geschlagen. Frauen sagtet Ihr? Wo sind sie?«
Anna hörte, dass er sein Pferd an der Kutsche entlangleitete. Blitzschnell kroch sie unter den Wagen und hoffte, dass er sie nicht sehen würde.
Mit dem Degen öffnete der Franzose den Wagenschlag.
»Schöne Frau«, sagte er zu Madame Brues. »Darf ich Euch bitten, den Wagen zu verlassen? Kutscher, sprachet Ihr nicht von zwei Frauen? Hier ist nur eine. Wo ist die andere?«
Anna fluchte leise.
»Nein, nein«, hörte sie ter Meer laut und deutlich sagen. Lauter als zuvor, so als wolle er jemanden warnen. »Nur eine Dame reiste mit mir zusammen. Die zweite Dame hat uns an der letzten Station verlassen. Nicht wahr, Kutscher?«
»Nein, es …«
»Kutscher!«
Der Postler verstummte. Anna begriff, dass ter Meer sie schützen wollte.
Das Gefährt schaukelte und schwankte, als Madame Brues ausstieg. Sie blieb dicht am Wagen stehen. Anna konnte erkennen, dass die Frau vor Furcht zitterte. »Was wollt Ihr von uns?«, fragte sie mit hoher Stimme in einem gebrochenen Französisch.
»O Gaston, diese Frau wiegt zwei weitere auf! Lieber Herrgott, zwischen diesen Brüsten kannst du einen Mann ersticken.« Jean-Paul lachte rau.
»Für solche Spielchen haben wir keine Zeit, Jean-Paul!« Gaston klang verärgert. »Nimm ihr das Geld ab! Dürfte ich auch um Eure Börse bitten, werter Herr?«, sagte er zu ter Meer.
»Meine Börse? Ich führe keine mit mir. Ich bin geschäftlich unterwegs und habe fast nur Bürgschaften bei mir, die werden euch nicht weiterbringen. Ein paar Geldstücke habe ich – sie sind allerdings in der Kutsche. Soll ich sie holen?«
Der Franzose schwieg, überlegte.
In der Kutsche? Anna überlegte. Claes hatte eine größere Reisetasche unter den Sitz geschoben. War dort seine Börse oder vielleicht noch etwas anderes? Vielleicht besaß er eine Waffe, denn Geld führte man am Leibe bei sich. Aber das konnte nicht sein. Er war Mennonit, genau wie sie. Zu ihrem Glauben gehörte auch, dass sie sich nicht verteidigten, selbst dann nicht, wenn sie angegriffen wurden. »Halte dem Feind auch die andere Wange hin«, war eine der wichtigsten Überzeugungen ihres Glaubens.
»In der Kutsche?« Der Franzose lachte. »Ihr glaubt doch nicht, dass ich Euch in die Kutsche an Euer Gepäck lasse. Wer weiß, was sich dort so findet.«
Offensichtlich hatte er den gleichen Gedanken wie Anna, nur wusste er nicht, dass ter Meer Mennonit war.
»Was ist denn in Euren Manteltaschen? Umstülpen reicht mir«, fuhr er fort.
Anna war zur rechten Seite des Wagens gekrochen. Sie konnte die Stiefel von ter Meer sehen und die Beine der Pferde. Claes ging einen Schritt nach vorne.
»Zwei Goldstücke, werter Herr, mehr trage ich nicht bei mir.«
»Das ist ja kaum zu glauben!«
Unterdessen bedrängte der andere Franzose Madame Brues. »Was habt Ihr an Geld dabei? Schmuck?«
»Ich habe kein Geld, nur ein paar Münzen.« Ihre Stimme klang schrill.
Anna wandte sich wieder der linken Seite zu, schob sich nach vorne, versuchte etwas zu sehen.
Sie sah Madame Brues’ Schuhe, den Rocksaum, dahinter die Beine des Pferdes des Franzosen.
Madame Brues drehte sich um, langte in die Kutsche, wollte wohl ihren Korb holen.
»Ich habe nur wenig Geld, aber Ihr könnt alles haben, solange Ihr mich am Leben lasst.«
Der Offizier lachte schroff. »Aber sicher, Madame.«
Er sprang vom Pferd. Anna sah die schwarzen Stiefelschäfte, dann trat er hinter die Frau. »Bleibt so«, befahl er mit tiefer Stimme. »Das ist ideal. Lehnt Euch einfach vor.«
»Nein … nein …«, schrie sie, dann ging ihr Schreien in Wimmern über.
»Gaston, das musst du dir anschauen. So ein Hinterteil hast du noch nie gesehen.«
»Bitte, Monsieur, nicht …«, flehte Madame Brues.
Der Franzose zog seinen Degen. Mit der Spitze der Waffe hob er den Rocksaum an.
»Mon Dieu!«
Anna blieb wie erstarrt liegen. Würde er die Frau schänden?
Nun beugte sich der Franzose vor, griff nach dem Rock und schob ihn hoch. Seine Pistole, die er wohl in die Manteltasche gesteckt hatte, fiel herunter. Sie landete weich im Schnee, nur eine Armlänge von Anna entfernt.
Ich könnte, dachte sie und schob sich näher an den Wagenrand heran, ich könnte einfach danach greifen. Der runde Griff war aus dunklem Holz, der Waffenlauf mit ziseliertem Silber verziert. Anna wurde sich bewusst, dass sie keine Ahnung hatte, wie die Waffe funktionierte. Sie hatte noch nicht einmal eine Pistole in der Hand gehalten. Zwar besaß ihr Bruder zwei Gewehre, doch diese nutzte er ausschließlich für die Jagd.
Plötzlich hörte sie Stoff reißen, Madame Brues schrie auf.
»Welch unvergleichlicher Anblick! Geradezu monströs. Ein Berg an Fleisch, ach, was sage ich da, ein ganzes Gebirge.« Der Franzose lachte wieder. »Dieses gilt es zu besteigen.«
Mit der flachen Hand klatsche er auf die nackte Haut der Frau. Wieder schrie sie auf, und dann begann sie monoton zu beten.
»Gegrüßet seiest du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Lebens, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seiest du …«
Anna schob sich ein wenig nach vorne, streckte vorsichtig die Hand aus. Die Waffe – sie wollte die Waffe erreichen. Warum tat ter Meer denn nichts? Der Kutscher? Wie konnten sie dies nur hinnehmen? Anna wusste, dass diese Gedanken ungerecht waren, dass den Männern die Hände gebunden waren, sie wurden in Schach gehalten von dem anderen Franzosen.
Nur noch ein Stückchen fehlte, nur noch wenige Zentimeter, dann würde sie die Pistole fassen können. Ihr Herz klopfte heftig in ihrer Brust, ihr Atem ging stoßweise, kleine Dampfwölkchen bildeten sich vor ihrem Mund. Sie presste die Lippen zusammen, versuchte langsamer und flacher zu atmen.
Sie streckte die Hand aus, erreichte den Lauf der Waffe, wollte ihn umfassen, als der Schuh des Franzosen auf ihre Hand trat.
»Was haben wir denn hier?« Er bückte sich, spähte unter den Wagen, nahm seine Waffe mit einem schnellen Griff an sich. »Ein kleines Vögelchen, ein Mäuschen. Kommt heraus!«
Anna biss sich auf die Lippen, verfluchte sich selbst.
»Nun macht schon. Allez, allez!«
Langsam kroch sie unter dem Wagen hervor. Der Soldat hielt die Waffe auf sie gerichtet. Madame Brues lehnte immer noch mit dem Oberkörper im Wagen. Doch sie schien zu begreifen, dass der Franzose nun abgelenkt war. Mit einer schnellen Bewegung ließ sie die Röcke wieder über ihr Hinterteil fallen.
»Was für ein hübsches Vögelchen haben wir denn hier?« Der Franzose ließ seinen lüsternen Blick über Anna gleiten. Sie zog den Mantel am Kragen enger zusammen, hatte aber trotzdem das Gefühl, von seinem Blick ausgezogen zu werden. Beschämt senkte sie den Kopf.
Der französische Offizier war groß, viel größer als sie. Kräftig war er zudem. Sein Gesicht war fleischig und aufgedunsen, geplatzte Äderchen bedeckten die Wangen und die knollige Nase. Sein Atem stank nach Branntwein, stellte Anna fest, als er auf sie zutrat.
»Nun denn, da haben wir ja ein noch attraktiveres Objekt. Wie schön Euch zu treffen, Madame. Ihr wolltet Euch doch nicht wirklich meine Waffe aneignen?« Er lachte. Mit dem Lauf der Pistole fuhr er an ihrer Haube entlang, berührte ihre Wange.
»Ein Schuss aus dieser Waffe kann Ihnen das hübsche Haupt rauben.« Er drückte den Lauf ein wenig fester gegen ihren Kopf, zwang sie das Kinn zu heben. »Na, haben wir Angst?«
Aus den Augenwinkeln nahm Anna eine Bewegung wahr. Mit erhobenen Händen kam Claes ter Meer von der anderen Seite der Kutsche, hinter ihm der andere Soldat.
»Lass es, Jean-Paul. Es hält uns nur auf. Ich habe das Geld dieses Mannes und die Abgabe für die nächsten zwei Zollstationen vom Kutscher. Das sollte reichen.«
»Schau dir dieses hübsche Vögelchen an! Sie hatte sich unter der Kutsche versteckt. So eine leckere Zugabe kann ich mir einfach nicht entgehen lassen.« Mit der Waffe fuhr er an Annas Hals entlang. Dann riss er ihr mit einem Ruck den Mantel auf, der Knopf sprang auf den Boden, legte seine linke Hand auf ihren Ausschnitt, strich über ihre Brüste.
Anna schloss entsetzt die Augen. Sie spürte seinen harten Griff, seine fordernde Hand. Seine Finger zwangen sich zwischen Stoff und Haut, er zog an ihrem Kleid, die Haken und Ösen platzten auf. Mit einem weiteren Ruck zog er das Oberteil auseinander.
Die kalte Luft stach wie Nadeln auf ihrer nackten Haut. Tränen schossen ihr in die Augen.
»Wenn Ihr nicht wollt, dass ich Euer Kleid vollständig ruiniere, sollten Ihr Euch nun freiwillig entkleiden, Madame!«
Seine Hand fuhr an ihrem Körper entlang, er öffnete den Mantel noch weiter, stutzte kurz und zog dann die kleine Lederbörse aus ihrer Tasche.
»Voilà!«
»Bitte …«, flehte Anna. Im Saum ihres Mantels hatte sie ihr restliches Geld eingenäht, würde er auch das finden?
Seine Hand glitt wieder über ihren Hals, er befingerte die Kette, riss sie ab und steckte auch sie in seine Tasche.
»Bitte … das ist die Kette meiner Mutter, gebt sie mir zurück.«
»Ich werde Euch etwas ganz anderes geben, wenn Ihr nicht Eure Röcke lüftet.« Nun klang er bedrohlich.
Plötzlich knallte es. Das Geräusch scholl über die weiten Felder, ein Schwarm Krähen stieg mit lauten Krächzen in die Luft. Jean-Pauls Pferd bäumte sich erschrocken auf, auch das andere Tier wich zurück.
Claes ter Meer hielt eine rauchende Pistole in der Hand.
»Verflucht, das kann man fast bis zur May hören. Egal, wie betrunken die Besatzung dort ist, das wird sie aufwecken! Was hast du getan, Gaston?«, schrie Jean-Paul. Er griff nach den Zügeln seines Pferdes, zog es zu sich heran und sprang auf. »Lass uns verschwinden!«
»Er hat meine Waffe …«
»Vergiss deine Waffe. Allez, allez, schnell weg.« Schon gab er dem Pferd die Sporen und sprengte davon.
Gaston zügelte sein Pferd, das aufgeregt hin und her tänzelte, ritt auf Anna zu. Sie hatte den Mantel vor ihrer Brust zusammengeklaubt, stand zitternd da, Tränen liefen ihr über die Wangen.
»Es tut mir leid, Madame. Ich wollte nur Geld. Aber wenn mein Kamerad getrunken hat, ist er kaum aufzuhalten.« Dann wendete er sein Pferd und ritt hinter seinem Spießgesellen davon.
Kapitel 4
»Sind sie weg?«, fragte Madame Brues mit tränenerstickter Stimme. Es klang dumpf aus dem Inneren des Wagens.
»Um Gottes willen!« Der Kutscher war vom Bock gesprungen, sein Gesicht war totenblass. »Was haben die Kerle gemacht?«
Anna versuchte mit zitternden Fingern ihr Kleid zu schließen. Einige Haken war nur aufgesprungen und nicht abgerissen. Notdürftig bedeckte sie ihre nackte Haut. Ter Meer trat zu ihr, wandte jedoch den Blick ab, um sie nicht zu beschämen. Immer noch hielt er die Pistole in der Hand, es roch nach Pulver.
»Es war wie im Traum. Dieser Gaston beobachtete Euch und seinen Kumpan, beachtete mich für einen Augenblick nicht. Ich habe gehandelt, ohne nachzudenken. Grundgütiger!« Entsetzt ließ er die Waffe fallen. »Ich hätte ihn verletzen können oder gar Schlimmeres.«
»Habt Ihr geschossen?« Madame Brues hatte sich nun umgedreht und richtete ihre Kleidung.
»Nein, der Schuss löste sich aus der Waffe, als ich sie ihm aus der Hand riss. Aber ich habe gar nicht nachgedacht. Was hätte ich mit der Pistole getan? Ihn bedroht? O Gott!« Er schüttelte den Kopf.
Anna hatte den Mantel, so gut es ging, verschlossen, ihr Umschlagtuch fest vor der Brust verknotet. Sie trat auf ihn zu und legte die Hand auf seinen Arm.
»Ihr wolltet helfen. Gott wird das verstehen.« Anna rieb sich die Tränen von den Wangen. Plötzlich stellte sie fest, dass der Ring ihrer Mutter verschwunden war. Sie musste ihn verloren haben. Verstört suchte sie den Boden ab, konnte ihn aber nicht entdecken.
»O nein. Der Ring …«
»Was ist denn, Kindchen?« Madame Brues zog mit lautem Ploppen einen Korken aus einem kleinen Krug, den sie aus ihrem Korb gefischt hatte. Sie trank einen großen Schluck, reichte Anna dann den Krug.
Vorsichtig schnupperte Anna, es roch nach scharfem Branntwein. Normalerweise trank sie so etwas nicht, doch dies war keine normale Situation. Der Branntwein rann ihr scharf die Kehle hinunter, sie musste husten, hätte sich beinahe verschluckt. Keuchend reichte sie die Flasche an ter Meer weiter. Auch er trank gierig.
Anna bückte sich wieder, spähte unter den Wagen.
»Was sucht Ihr denn?«, fragte ter Meer.
»Den Ring meiner Mutter, die letzte Erinnerung, die ich an sie habe. Der Kerl hat mir die Kette geraubt – aber ich hatte noch den Ring. Ich muss ihn verloren haben.«
In diesem Moment brachen die Wolken auf. Die Sonne stand tief am Himmel, dunkelrot leuchtete sie über die verschneiten Felder.
Etwas blitzte im Sonnenlicht auf. Claes bückte sich.
»Ein Goldreif mit einer Perle? Dieser hier?«
Wieder standen Tränen in Annas Augen, doch diesmal vor Erleichterung. Sie streifte den Ring über, ballte die Faust zusammen. »Danke.«
»Es wird bald dunkel, wir sollten uns beeilen«, drängte der Kutscher. »Übrigens, keine Sorge, ich habe ihnen nicht das Zollgeld gegeben. Ich habe für solche Fälle immer einen Beutel mit Kupferknöpfen.«
»Macht Euch keine Gedanken, guter Mann. Wir haben Glück im Unglück gehabt.« Ter Meer klopfte ihm auf die Schulter. »Und Ihr habt recht, wir sollten schleunigst aufbrechen.«
Anna kauerte sich in die Ecke der Kutsche. Immer wieder kontrollierte sie, ob das Tuch ihre Brust bedeckte. Sie erwähnte nicht, dass der Franzose ihr Geld genommen hatte.
»Was passiert denn nun?«, fragte Madame Brues. »Werden wir den Vorfall der Kommandantur melden? Ich habe so was noch nie erlebt. Aber ich habe davon gehört, dass die Franzosen immer frecher und aufdringlicher werden. Dagegen sollte der König etwas tun.«
»Dem König sind die Hände gebunden. Österreich und Russland üben Druck aus. Er hat kaum eine Wahl, als die Truppen hier zu lassen. Allerdings billigen die Kommandeure der französischen Truppen solche Taten auch nicht, es wird schwer geahndet.« Ter Meer schaute besorgt zu Anna. »Habt Ihr Euch beruhigt, Mademoiselle te Kloot?«
Anna nickte abwesend. In Gedanken ging sie immer wieder die Szene mit Jean-Paul durch. Sie hatte sich sein Gesicht eingeprägt, wie eingebrannt in ihrem Hirn sah sie es vor sich. Die dicken Lippen, die fleischige Nase, die wabbelnden Wangen und das fette Kinn. Dazu eiskalte hellblaue Augen. Jean-Paul. Niemals würde sie diesen Mann vergessen, der sie derart an ihre Grenzen gebracht hatte.
Kurze Zeit später erreichten sie die Zollstation. Lautes Lachen erscholl aus dem Gebäude und Gesang.
»Ich gehe nachschauen«, sagte der Kutscher zu ihnen.
»Es klingt, als seien sie betrunken.« Madame Brues seufzte schwer.
»Davon sprach doch auch der eine Franzose.« Ter Meer schüttelte verärgert den Kopf. »Keine Moral mehr heutzutage.«
Die Dämmerung fiel nun schnell herein, schon bald würde es dunkel sein. Obwohl der Branntwein sie kurzzeitig gewärmt hatte, zitterte sie nun wieder. Die Wahrscheinlichkeit, die Fähre heute noch zu erreichen, schwand mit jeder Minute.
»Wir werden es nicht schaffen«, murmelte sie.
Ter Meer sah sie besorgt an. »Die Fähre? Nein, auf keinen Fall. Und selbst wenn, in der Dunkelheit zu fahren käme einem Selbstmord gleich. Ich vermute, dass wir hier nächtigen werden.«
»Hier?« Anna starrte in die Dämmerung. »Aber hier ist doch nichts.«
»O doch, neben jeder Zollstation ist für gewöhnlich ein Gasthaus. Und hier ist ganz sicher eines, ich habe hier schon mal genächtigt. Das Essen war einfach, aber gut, der Kamin groß, und die Strohmatratzen waren einigermaßen sauber.«
Anna schluckte hart, so hatte sie sich diese Reise nicht vorgestellt. Eine Nacht in einem fremden Gasthaus? Sie hatte Angst, dass die Franzosen zurückkommen würden, Angst vor anderen betrunkenen Soldaten.
»Macht Euch keine Sorgen, wir bleiben zusammen«, versuchte ter Meer sie zu beruhigen.
Anna nickte stumm. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis der Kutscher zurückkehrte. Doch schließlich trat er aus dem Zollhaus. Er schüttelte den Kopf, öffnete dann den Wagenschlag.
»Sie sind betrunken. Ich habe versucht, mit Ihnen zu reden, aber es war nichts zu machen.« Eine Salve lauten Gelächters klang vom Zollhaus zu ihnen. Der Kutscher schaute sich kurz um, wandte sich dann wieder seinen Passagieren zu. Er hatte die Stirn in Furchen gelegt, sah ärgerlich aus. »Nur der Zöllner war noch einigermaßen ansprechbar. Ich habe ihn aufgefordert, den Vorfall der Kommandantur zu melden. Wahrscheinlich haben sich die beiden Spitzbuden darauf spezialisiert, einsame Zollstationen ausfindig zu machen. Elendig ist das.«
»Aber nicht zu ändern«, sagte ter Meer. »Guter Mann, wir sind fast erfroren. Wie geht es nun weiter?«
»Bis nach Eller haben wir mindestens zwei weitere Stunden Fahrt, je nach Zustand der Straße. Dorthin führt nur ein einfacher Karrenweg. Es ist unverantwortlich, diesen in der Dunkelheit zu befahren. Und auch zu gefährlich, einen weiteren Überfall sollten wir nicht riskieren. Außerdem müssen die Pferde gefüttert und getränkt werden. Ich schlage vor, dass wir im Wirtshaus ›Zur Linde‹ Quartier nehmen und morgen in aller Frühe weiterfahren.« Er schaute sie der Reihe nach an. Ter Meer und Madame Brues nickten eifrig.
»Mademoiselle?« Der Kutscher sah sie fragend an.
»Was immer Ihr meint«, sagte Anna erschöpft.
»Es ist hier gleich ein Stück die Straße hinunter.« Er schloss die Wagentür wieder, und kurz darauf setzte sich die Kutsche in Bewegung. Wenige Minuten später hielt sie jedoch wieder an.
Sie stiegen aus. Zwei große Fackeln beleuchteten ein schönes Fachwerkhaus. Im Hof stand ein großer Baum. Wahrscheinlich die Linde, die dem Anwesen ihren Namen gegeben hatte.
Der Kutscher öffnete die große Holztür und führte sie in einen großen, anheimelnd warmen Raum. Im Kamin knisterte ein Feuer, es duftete nach Braten und frischem Bier. Sie bekamen zu essen und zu trinken, kleine, aber saubere Zimmer. Erschöpft fiel Anna in den Schlaf.
Kapitel 5
Früh am nächsten Morgen – draußen war es noch dunkel – klopfte jemand an die Tür zu ihrem Zimmer. Anna fuhr erschrocken hoch. Verwirrt sah sie sich um und wusste im ersten Augenblick nicht, wo sie war. Dann kehrten langsam die Erinnerungen zurück.
Das Letzte, woran sie sich erinnern konnte, war, dass sie mit der Wirtsfrau im Gesindezimmer gesessen hatte.
Auf der kleinen Kommode stand eine Kerze, die fast heruntergebrannt war. Anna schaute sich um. Außer der Kommode standen nur das Bett und ein Stuhl in der kleinen Kammer. Über dem Stuhl hingen ihr Kleid und ihr Mantel.
Wieder klopfte es an die Tür. »Mademoiselle te Kloot? Wir wollen gleich aufbrechen.«
»Ja.«
In der Wirtstube flackerte ein munteres Feuer im Kamin. Der Tisch davor war reich gedeckt. Auf einmal merkte Anna, wie sehr ihr Magen knurrte.
»Habt Ihr gut geschlafen?« Die Wirtsfrau brachte einen Krug mit warmem Schwarzbier. »Nehmt Euch! Wir brauen es selbst. Es ist das Beste zur Stärkung. Ihr habt ja noch eine lange Reise vor Euch.«
»Ich habe ganz wunderbar geschlafen. Mir tut zwar alles weh, aber das liegt bestimmt nicht an Eurem Bett.«
»Nein, daran ist die Kutschfahrt schuld. Mögt Ihr einen Teller Eintopf?«
Anna nickte, setzte sich an den Tisch, schenkte sich von dem Bier ein und trank.
Kurz darauf stellte ihr die Magd einen Teller dampfenden Eintopfs hin. Anna aß hungrig. Sie brach sich einen Kanten von dem noch warmen Brot ab, wischte damit den Teller aus.
»Guten Morgen.« Claes ter Meer nahm ihr gegenüber Platz.
Er war unrasiert, und sein Gesicht erschien verquollen.
»Guten Morgen. Wir wollen bald los?«
»So schnell es geht. Immerhin haben wir noch eine lange Strecke vor uns.«
Er kniff die Augen zusammen und unterdrückte ein Gähnen.
»Ich habe wunderbar geschlafen. Ihr nicht? Mein Bett war sauber und bequem.« Anna lächelte ihm zu.
»Doch, ja, das war meines wahrscheinlich auch. Wirklich erinnern kann ich mich nicht. Lange geschlafen habe ich auch nicht. Der Wirt hat gestern noch ein neues Bierfass angestochen. Er und die anderen Männer haben sich sehr für den Überfall interessiert. Es gab noch andere, ähnliche Vorkommnisse in der Gegend. Die Kommandantur hat bisher nichts dagegen unternommen. Dürfte auch schwer sein.«
»Dann seid Ihr also erst spät ins Bett gekommen?«
»Eher sehr früh – kann höchstens zwei Stunden her sein. Sei’s drum, wir brauchen uns gleich nur in die Kutsche zu setzen und uns befördern zu lassen.« Er schenkte sich einen Becher Bier ein, nahm sich ein Stück Brot.
Erst als sie fast fertig waren, tauchte Madame Brues auf. Sie schien atemlos und gehetzt, ließ sich auf den Stuhl neben Anna fallen und seufzte tief.
»Guten Morgen«, begrüßte Anna sie. »Gut geschlafen?«
»Gut geschlafen?« Madame Brues nahm sich einen Becher Bier. »Wie ein Stein. Ich hatte das Gefühl, ich würde gar nicht mehr wach werden. Nein, nein, ich werde zu alt für solch anstrengenden Reisen.«
»Nun, noch heute, dann haben wir es hoffentlich überstanden.«
Der Kutscher kam aus der Küche, wo er seine Mahlzeit zu sich genommen hatte. »Guten Morgen, die Herrschaften. Der Knecht ist dabei, die Pferde anzuspannen, wir können bald aufbrechen.«
»Moment, ich habe noch gar nicht richtig gefrühstückt«, empörte sich Madame Brues. Dann schaute sie auf Annas Teller. »Und ich habe keinen Eintopf. Wirtin!«
Es verblüffte Anna, welche Mengen an Nahrung die Frau in sich aufnehmen konnte. Nach zwei Tellern Eintopf, vier gekochten Eiern, vier dicken Scheiben Brot mit Butter und Honig verspeiste die Frau auch noch ein großes Stück geräucherten Speck. Dann trank sie den dritten Becher Bier, rülpste einmal, rieb sich das Fett vom Kinn und stand auf. »Von mir aus können wir nun.«
Madame Brues legte einige Taler auf den Tisch. Anna nahm ihre Tasche und suchte verzweifelt darin. Irgendwo würde sie doch sicher noch ein oder zwei Taler finden, sie hatte ein paar lose Geldstücke für ein Essen eingepackt, aber nun fand sie sie nicht. Ihr restliches Geld war im Saum ihres Mantels eingenäht. Sie würde ihn auftrennen müssen.
»Der Schuft hat Euch gestern Euer Geld abgenommen, nicht wahr?« Claes ter Meer war neben sie getreten. »Ihr habt es zwar nicht gesagt, aber ich habe gesehen, wie er etwas aus Eurer Manteltasche gezogen hat.«
»Ja, hat er. Ich habe noch Geld …«
»Ich habe Eure Zeche schon beglichen. Kommt, die Kutsche wartet.«
»Das kann ich nicht annehmen, Monsieur ter Meer.« Anna schüttelte den Kopf.
»Ihr seid meine zukünftige Nachbarin, Eure Cousine wird meinen Bruder ehelichen. Wir werden das in Krefeld klären. Und nun sollten wir los.« Er zwinkerte ihr zu und reichte ihr den Mantel.
Ganz schwach war die Morgendämmerung zu erkennen, als sie losfuhren. Alle drei schwiegen, hingen ihren Gedanken nach. Die Kutsche schaukelte sachte, und schon bald schnarchte Madame Brues vor sich hin.
Hin und wieder sah Anna zu Claes. Er war ein perfekter Gentleman, höflich, gebildet und zuvorkommend. Sie konnte sich nicht daran erinnern, ob er von seiner Frau gesprochen hatte. Vielleicht, dachte sie und lächelte, vielleicht war er noch nicht verheiratet.
Immer wieder fiel sein Kopf auf die Brust, er schreckte hoch, riss die Augen auf und nickte kurze Zeit später wieder ein.
Zu gerne hätte sie sich neben ihn gesetzt, ihn in den Arm genommen, seinen Kopf an ihre Brust gedrückt und seinen Schlaf bewacht. Doch natürlich kam so etwas nicht in Frage. Nicht einmal hatte sie beobachtet, dass ihr Bruder ihre Schwägerin in den Arm nahm. Ihr Elternhaus war hellhörig, deshalb wusste sie, dass das Feuer der Leidenschaft durchaus im Schlafzimmer der beiden aufloderte, doch vor anderen zeigten sie es nicht.
Langsam erwachte der Tag, aber das Licht blieb grau, und aus allen Dingen schien die Farbe gewichen zu sein. Wie ausgewaschen lag die Landschaft da. Sie fuhren an Feldern vorbei. Hin und wieder leuchteten einige Schlehen auf, wiegten sich sanft im Wind.
Anna schaute nach draußen, der Himmel war kalt und feucht. Trotzdem fror sie nicht so wie am Tag zuvor. Die wenigen Stunden Schlaf hatten ihr gutgetan.
Hin und wieder vermeinte sie, Hufgetrappel zu vernehmen, aber es war nur das Echo der Postkutsche oder ihre Einbildung. Immer noch fürchtete sie sich vor einem erneuten Überfall.