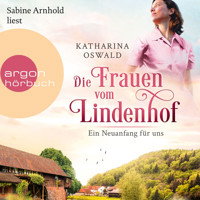Die Frauen vom Lindenhof: Ein Neuanfang für uns / Zusammen können wir träumen / Gemeinsam der Zukunft entgegen - Drei Romane in einem Band E-Book
Katharina Oswald
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER digiBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Lindenhof-Saga
- Sprache: Deutsch
Drei Frauen kämpfen um Selbstbestimmung und die Liebe: Tauchen Sie ein in die mitreißende Lindenhof-Saga. Ein Neuanfang für uns: Hohenlohe 1953: Nach dem Tod des Vaters kommen Marianne, ihre Mutter und ihre kleinen Schwestern kaum über die Runden. Die alte Schreinerei, einst Stolz der Familie, verfällt. Doch Marianne will sich dem Schicksal nicht ergeben. Zu sehr liebt sie den Duft der Werkstatt, die sanfte Wärme des Holzes unter ihren Fingern. Sie will wieder aufbauen, etwas ganz Neues wagen. Nur wer traut ihr das als Frau in diesen Zeiten zu? Marianne muss um ihren Traum kämpfen. Doch dann verliebt sie sich ausgerechnet in den traumatisierten Kriegsheimkehrer Alexandre ... Zusammen können wir träumen: 1980: Corinna Wagner will gerade ihr langersehntes Literaturstipendium antreten, da bekommt sie schreckliche Nachrichten: Auf dem Lindenhof hat es ein Unglück gegeben, sie muss sofort die Nachfolge ihrer Eltern antreten und die Leitung übernehmen. Ihre ehemalige Freundin Petra könnte ihr dabei eine Stütze sein, doch die Entfremdung der beiden ist nicht so leicht zu überwinden. Und dann ist da noch der Journalist Marc: Ist er wirklich an Corinna interessiert oder will er den Lindenhof noch tiefer in den Abgrund reißen? Gemeinsam der Zukunft entgegen: 1999: Franziska Wagner wünscht sich nichts sehnlicher, als ihr Talent für Holzarbeit zu leben und die Zukunft des Lindenhofs mitzugestalten. Doch ihre Großmutter Marianne lässt sie nicht. Zu tief sitzen ihre Vorurteile gegen Franziskas Herkunft. Marianne möchte den Hof viel lieber an ihre Nichte Helena übergeben, die hinter ihrem Rücken Übles im Schilde führt. Franziska reißt aus und geht ins Erzgebirge - auf den Spuren ihrer anderen Familie und der berühmten Seiffener Holzkunst. Dort lernt sie Christian kennen. Wird ihre Liebe Franziska endgültig vom Lindenhof trennen oder wird sie wieder mit den Wagners zusammenfinden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1500
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Katharina Oswald
Die Frauen vom Lindenhof: Ein Neuanfang für uns / Zusammen können wir träumen / Gemeinsam der Zukunft entgegen
Drei Romane in einem Band
Über dieses Buch
Drei Frauen kämpfen um Selbstbestimmung und die Liebe: Tauchen Sie ein in die mitreißende Lindenhof-Saga.
Ein Neuanfang für uns: Hohenlohe 1953: Nach dem Tod des Vaters kommen Marianne, ihre Mutter und ihre kleinen Schwestern kaum über die Runden. Die alte Schreinerei, einst Stolz der Familie, verfällt. Doch Marianne will sich dem Schicksal nicht ergeben. Zu sehr liebt sie den Duft der Werkstatt, die sanfte Wärme des Holzes unter ihren Fingern. Sie will wieder aufbauen, etwas ganz Neues wagen. Nur wer traut ihr das als Frau in diesen Zeiten zu? Marianne muss um ihren Traum kämpfen. Doch dann verliebt sie sich ausgerechnet in den traumatisierten Kriegsheimkehrer Alexandre ...
Zusammen können wir träumen: 1980: Corinna Wagner will gerade ihr langersehntes Literaturstipendium antreten, da bekommt sie schreckliche Nachrichten: Auf dem Lindenhof hat es ein Unglück gegeben, sie muss sofort die Nachfolge ihrer Eltern antreten und die Leitung übernehmen. Ihre ehemalige Freundin Petra könnte ihr dabei eine Stütze sein, doch die Entfremdung der beiden ist nicht so leicht zu überwinden. Und dann ist da noch der Journalist Marc: Ist er wirklich an Corinna interessiert oder will er den Lindenhof noch tiefer in den Abgrund reißen?
Gemeinsam der Zukunft entgegen: 1999: Franziska Wagner wünscht sich nichts sehnlicher, als ihr Talent für Holzarbeit zu leben und die Zukunft des Lindenhofs mitzugestalten. Doch ihre Großmutter Marianne lässt sie nicht. Zu tief sitzen ihre Vorurteile gegen Franziskas Herkunft. Marianne möchte den Hof viel lieber an ihre Nichte Helena übergeben, die hinter ihrem Rücken Übles im Schilde führt. Franziska reißt aus und geht ins Erzgebirge - auf den Spuren ihrer anderen Familie und der berühmten Seiffener Holzkunst. Dort lernt sie Christian kennen. Wird ihre Liebe Franziska endgültig vom Lindenhof trennen oder wird sie wieder mit den Wagners zusammenfinden?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Andrea Bottlinger und Claudia Hornung schreiben gemeinsam als Katharina Oswald. Beide sind in Baden-Württemberg geboren und lieben es, sich in Frauenschicksale verschiedener Jahrzehnte hineinzudenken. Sie kennen sich schon lange und ergänzen sich beim Schreiben perfekt: Andrea achtet immer auf die Struktur der Geschichte, und Claudia vertieft sich ganz in die Details und Emotionen. Zusammen haben sie eine mitreißende Familiensaga geschaffen.
Inhalt
Buch 1 Ein Neuanfang für uns
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Epilog
[Inhaltswarnung]
Buch 2 Zusammen können wir träumen
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Epilog
[Inhaltswarnung]
Buch 3 Gemeinsam der Zukunft entgegen
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Epilog
Nachwort
Inhaltswarnung
Katharina Oswald
Die Frauen vom Lindenhof - Ein Neuanfang für uns
Kapitel 1
Hohenlohe, im Advent 1953
Marianne stand vor dem Haus und hob den Kopf.
In der kalten Winterluft war ihr, als könnte sie aus dem nahen Wald die vertrauten Geräusche hören: Das Kreischen der Säge, die lauten Stimmen der Männer, während sie die schweren Stämme mit purer Muskelkraft über den Platz vor dem Holzlager wuchteten, um sie anschließend zu entrinden und in stabile Bretter zu zerlegen. Dazu die Geräusche aus der Schreinerei des Vaters – das stetige Bohren, Hämmern, Fräsen und Schleifen, und das Lachen des Großvaters, der den Hobel weglegte und sie in die Arme nahm, wenn sie voller Neugier hereinlugte. Sie meinte den unvergleichlichen Geruch von Sägespänen und frischem Holz wahrzunehmen; ein Geruch, den Marianne mit Erinnerungen an unbeschwerte Kindheitstage verband.
Doch heute roch es vor allem nach Schnee.
Im Dach der Schreinerei klaffte ein Loch, dort arbeitete schon seit Jahren niemand mehr.
Marianne atmete tief ein, riss sich von ihren Erinnerungen los und lud den Korb mit Wäsche auf den Leiterwagen. Die Gartenbank unter der Linde im Hof war mit Raureif überzogen. Schwere Wolken hingen über den Waldenburger Bergen und kündigten den Winter an. Noch fielen keine Flocken. Wenn sie sich sputete, würde sie vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück sein.
»Marianne?« Die Mutter tauchte im Türrahmen auf. Fröstelnd verschränkte sie die Arme vor der Brust. »Vergiss nicht, nach neuen Aufträgen zu fragen.«
»Natürlich nicht.«
Marianne nickte der Mutter zu, bevor sie den Handwagen packte und mit raschen Schritten den Hof verließ.
Als sie am Weiher und der alten Sägemühle vorbeiging, knirschte der gefrorene Boden unter ihren Sohlen. Das Geräusch hallte weit durch die Stille, die das ehemals geschäftige Treiben ersetzt hatte.
Auf dem Wasser bildeten sich erste zarte Eiskristalle. Bestimmt war auch der nahe gelegene Neumühlsee bald zugefroren. Ihr Vater hatte das Eis immer getestet, bevor sie und die Kinder aus dem Dorf es hatten betreten dürfen. Auch während des Krieges hatte er so ein wenig Freude in die düstere Zeit gebracht. Erst 1944 hatte man ihn eingezogen, als die Wehrmacht auch jene Männer an die Front schickte, deren Arbeit bis dahin als kriegswichtig galt. Er war nicht lebend heimgekehrt.
Marianne fror, sie zog die Schultern hoch und stapfte weiter. Vielleicht sollte sie, sobald es kalt genug war, Lottchen mit zum Weiher nehmen. Ihre jüngste Schwester hatte die Nachmittage auf dem See nie erlebt. Sie war in dem Jahr geboren, in dem ihr Vater gestorben war. Vielleicht hätte sie Freude daran über das Eis zu schlittern. Und vielleicht würde ihr Jauchzen die Stille für einen Moment vertreiben.
Ein Eichhörnchen huschte vor Marianne über den Weg. Flink und geschickt erklomm es den Baum, unter dem es wohl seine Vorräte für den Winter vergraben hatte. Keckernd beschwerte es sich über die Störung.
Marianne blieb stehen. »Komm wieder runter«, lockte sie. »Ich tu dir nichts.«
Das hübsche Tier mit dem dichten, rotbraun glänzenden Fell dachte gar nicht daran. Es musterte sie nur aus seinen dunklen Knopfaugen und schien zu warten, dass sie weiterging.
Mariannes Blick wanderte vom Eichhörnchen über den Baum wieder zur Schreinerei. Auch wenn der Lärm des Betriebs die Wildtiere verscheucht hatte, wünschte sie sich die Vergangenheit zurück.
Noch gehörte die brachliegende Werkstatt ihrer Familie. Weil der Lindenhof am Weiher ein Stück abseits des Dorfes lag und die Zufahrtswege schlecht waren, schien er in Vergessenheit geraten zu sein. Unkraut wucherte über weite Teile des Geländes, und hinter dem offenen Tor des Holzlagers klaffte eine ebensolche leere Dunkelheit wie unter dem Loch im Dach.
Marianne presste die Lippen zusammen.
Sie sollte den Blick lieber in die Zukunft richten, auch wenn die Bilder aus der Vergangenheit sie immer wieder einholten.
An das brennende Waldenburg im April 1945 würde Marianne sich ewig erinnern. Bis weit über die Hohenloher Ebene hinweg hatte man die Rauchschwaden ziehen sehen und das Artilleriefeuer gehört. Niemand in der Gegend hatte mit diesem Ausmaß an Zerstörung gerechnet, zumal der Ort bis dahin fast verschont geblieben war. Doch dann hatte der sinnlose, schreckliche Krieg noch mit voller Wucht zugeschlagen.
Marianne hatte zusammen mit ihrer Mutter, dem wenige Monate alten Lottchen und der sechsjährigen Henni im Kohlenkeller gekauert und die Einschläge am ganzen Körper gespürt.
Mittlerweile waren jedoch genug Jahre vergangen, dass die Wunden heilen und die Menschen anpacken konnten, um das Land und ihr Leben wieder aufzubauen.
Marianne wünschte, auch ihre Familie hätte das Geld dafür. Sie wünschte, sie könnte etwas von bleibendem Wert schaffen, anstatt nur Botengänge zu erledigen und im Haushalt zu helfen.
Sogar mitten auf dem Weg zum Lindenhof stand das Unkraut hoch. Vorsichtig zog Marianne ihren Leiterwagen an den mit Reif überzogenen Disteln vorbei.
Sie war nicht weiter zur Schule gegangen, weil die Mutter sie daheim brauchte. Aber würde sie nicht viel mehr für ihre Familie tun können, wenn sie einen richtigen Beruf erlernte? Jetzt da es an arbeitsfähigen Männern mangelte, taten das viele Frauen. Und mit dem Familienbetrieb könnte sie auch all die glücklichen Momente ihrer Kindheit wieder aufleben lassen.
Vielleicht irgendwann einmal. Bald.
Marianne würde die Hoffnung nicht aufgeben.
Der Dezemberwind biss ihr in die Augen, und ihre Hände, die den Wagen zogen, wurden vor Kälte taub. Sie schob den wollenen Schal ein Stück höher und verbarg ihr Gesicht darin. Als sie die ersten Häuser des Dorfes erreichte, atmete sie auf.
Von der Bäuerin, der sie das ausgebesserte Jäckchen und die festliche Bluse lieferte, wurde sie herzlich empfangen. »Sag deiner Mutter besten Dank. So feine Spitzenkragen kriegt man nicht einmal in Hall!«
»Ich werd’s ausrichten.« Marianne wusste, dass ihre Mutter sich über das Lob freuen würde. »Ich soll außerdem fragen, ob es noch etwas zu nähen gibt?«
Die Bäuerin schüttelte den Kopf. »Vorerst brauche ich nichts mehr. Ich fürchte, es wird im Dorf auch sonst niemand Arbeit für dich haben. Du weißt ja, über den Winter gibt’s auf den Äckern und im Garten wenig zu tun, da sitzen die Frauen dann abends am Kamin und nähen oder stricken selbst.« Sie drückte Marianne einige Münzen in die Hand.
Die verstaute das Geld sorgfältig im Beutel.
»Das sind fünfzig Pfennig mehr, als wir ausgemacht hatten«, erklärte die Bäuerin. »Außerdem ist hier noch Mehl und Rübenzucker. Wenn ihr sonst noch was braucht, komm ruhig vorbei. Hungern soll in unserm Dorf keiner müssen.«
»Wir hungern nicht.« Die Antwort kam schnell und ein bisschen zu heftig über Mariannes Lippen.
»Na, an dir und deinen Schwestern ist aber nichts dran!« Die Bäuerin lachte. Dann wurde sie wieder ernst. »Schon gut. Ich weiß, dass ihr’s nicht leicht habt da draußen.«
»Wir kommen zurecht«, beharrte Marianne leise. Wie gut oder schlecht sie das taten, ging niemanden etwas an.
Vielleicht war das der Grund, warum Henriette sich vor den Botengängen immer drückte; das Gefühl, der Freundlichkeit und dem Wohlwollen anderer ausgeliefert zu sein. Marianne versuchte das Unbehagen abzuschütteln, als sie weiter über die Dorfstraße stapfte und einem Haufen Pferdeäpfel auswich.
Leider behielt die Bäuerin recht. Egal, wo Marianne auch klopfte und fragte, es gab derzeit nichts zu nähen. Auf sämtlichen Höfen war man ausreichend mit Unterkleidern, Blusen, Kittelschürzen oder Bettwäsche versorgt.
Am Ende der Dorfstraße, kurz bevor der holprig steile Weg zum nächsten Weiler abzweigte, lag der Milchhof. Dort war Lisbeth, die Schwiegertochter des Milchbauern, gerade dabei Mist aus dem Kuhstall zu schaufeln.
»Hallo«, rief sie und winkte.
Eine vorwitzige Strähne hatte sich aus ihrem blonden Zopf gelöst, und die klobigen Schuhe starrten vor Dreck. Dennoch war sie die ansehnlichste Frau, die Marianne kannte. Netter als die meisten im Dorf war Lisbeth obendrein.
»Wie geht’s deinem Großvater?«, erkundigte sie sich. »Hustet er noch?«
»Langsam wird’s besser.« Marianne blieb vor der offenen Stalltür stehen. »Der Zwiebelsaft hilft.«
Lisbeth nickte. »Bei meinen beiden Rackern hat der Saft sich auch schon oft bewährt.«
Während sie sich unterhielten, genoss Marianne die dampfige Wärme, die aus dem Innern des Stalls drang. In den Sommermonaten half sie gelegentlich, die Milchkühe auf die Waldweide zu treiben, denn Lisbeths Zwillingsbuben waren dafür noch zu klein. Beim Heuwenden hatte sie auch mitangepackt, manchmal sogar beim Flachsrupfen. Warum sollte sie daheim herumsitzen, wenn sie bei der Ernte helfen und so etwas dazuverdienen konnte?
»Magst du kurz reinkommen und dich aufwärmen?«, fragte Lisbeth. »Wie wär’s mit einer Tasse heißer Milch mit Honig?«
»Ich muss gleich weiter«, wehrte Marianne ab. Immer wenn sie länger keine Milch gekauft hatte, bot Lisbeth ihr so welche an, damit sie sie annehmen konnte, ohne sich in ihrem Stolz verletzt zu fühlen. Marianne war Lisbeth dafür sehr dankbar, und manchmal, wenn der Hunger zu groß war, nahm Marianne Lottchen auf ihrem Rundgang mit.
Von Lisbeth würde sie die Milch auch umsonst bekommen, das wusste sie. Aber da war Marianne ganz wie ihre Mutter; es war ihr unangenehm, solche Großzügigkeit anzunehmen, lieber tauschte sie ihre Arbeitskraft gegen die Milch ein. Oder sie sammelte Nüsse, Pilze, Kräuter oder Brombeeren, irgendetwas fand sich immer, das man anbieten konnte, um niemandem etwas schuldig bleiben zu müssen.
»Na gut. Aber du hast noch genug Zeit, dass ich dir ein Geschenk für Karl-Otto mitgeben kann, oder nicht?«
»Ein Geschenk?« Marianne war neugierig, und für ihren Großvater nahm sie gerne etwas entgegen.
Lisbeth nickte. »Meine Schwiegermutter macht doch manchmal Käse. Und sie sagt, früher hat der Karl-Otto ihren Walnusskäse so gern gegessen.«
Bevor Marianne Einspruch gegen ein so edles Geschenk erheben konnte, lehnte Lisbeth die Mistgabel an die Stallwand und eilte ins Haus. »Ich bin gleich wieder da!«
Marianne wartete, bis die Milchbäuerin mit einem in Stoff gewickelten Päckchen wiederkam. »Vielleicht freut er sich darüber.«
Marianne schluckte gegen einen plötzlichen Kloß in ihrem Hals an, während sie den Käse entgegennahm. Ihr Großvater hatte nicht mehr gesprochen, seit sein Sohn gefallen war. Sie bezweifelte, dass er sich überhaupt noch über etwas freuen konnte.
»Vielleicht«, sagte sie dennoch.
Lisbeth blickte sie voller Mitgefühl an. Sie griff mit ihren stämmigen Armen wieder nach der Mistgabel. »Ein Elend ist’s mit diesem Krieg. So viele Junge hat er sich geholt und die Alten kaputtgemacht im Kopf. Und was aus den Frauen wird? An die denkt keiner.«
»Müssen wir eben selbst an uns denken«, sagte Marianne. Der Wunsch, diese Worte in Taten umzusetzen, wuchs seit einiger Zeit beständig in ihr.
Sie verabschiedete sich mit dem Versprechen, dass Lottchen am nächsten Tag zum Anklopfa kommen würde. Wie es Brauch war, zogen die Kinder jedes Jahr im Advent mit Säckchen von Haus zu Haus, sagten Verse auf und bekamen dafür Äpfel oder Weihnachtsgebäck geschenkt.
Während Marianne zügig ausschritt, um den nächstgelegenen Weiler zu erreichen, konnte sie wieder den Schnee in der klaren Luft riechen. Es würde bestimmt bald schneien. Sie liebte den Winter, wenn er sich von seinen schönen Seiten zeigte: Lottchens Strahlen an jedem Adventsmorgen, wenn sie einen Strohhalm in die kleine Krippe legen durfte, damit das geschnitzte Jesuskind bis zum Heiligabend weich darin lag und der Duft von Bratäpfeln oder frisch gebackenen Springerle aus dem Ofen. Die weniger schöne Seite am Winter aber war, dass es mehr Zeit zum Grübeln gab …
Der Weg wurde steiler, der Wagen rumpelte hinter Marianne her und zog schwer an ihren Armen.
Bald darauf hatte sie den Weiler auf halber Höhe nach Waldenburg erreicht. Dort lieferte sie das Hemd ab, das ihre Mutter nicht nur genäht, sondern vor dem Einpacken auch noch sorgfältig gebügelt hatte.
Die Bäuerin bedankte sich hocherfreut. »Das lege ich meinem Hermann unter den Weihnachtsbaum. Na, der wird Augen machen.« Das Geld, das sie Marianne aushändigte, hatte sie heimlich abgezweigt. »Um ihn zu überraschen. Weil er immer sagt, dass ich zwei linke Hände hab, wenn’s ums Handarbeiten geht.« Sie schmunzelte. »Dafür kann ich aber besser kochen als seine Mutter, sagt er.«
Ja, das sah man dem Hermann inzwischen an, dass er gut bekocht wurde. Marianne freute sich ebenfalls über die Dosen mit eingemachter Wurst, die sie zusätzlich bekam. Die aß sogar ihr Großvater gern. Seine Suppe wurde öfter kalt, weil er sich beim Essen in Gedanken verlor, aber wenn es Wurst gab, war sein Teller schneller leer als Mariannes. Sie war jedes Mal froh, wenn er mit Appetit aß, hieß das doch, dass trotz seines Schweigens noch immer ein Lebenswille in ihm steckte.
Aber es gab auch hier keinen neuen Auftrag.
Marianne marschierte weiter bergauf, um das allerletzte Päckchen auszuliefern. Im Wagen lag noch ein Wintermantel, an dem die Mutter lange gesessen hatte. Sogar ein Stück Pelz zierte den Kragen. Die Frau des Schuhmachers hatte das teure Kleidungsstück bestellt und das Material dafür selbst besorgt. Sie gab Marianne das abgezählte Geld und dazu ein großes Glas eingemachter Birnen. Als Marianne ihr erzählte, dass ihrer Mutter mehrere Nähnadeln in dem schweren Stoff abgebrochen waren, lief sie, um einige aus ihrem Nähkästchen zu holen. »Nimm die ruhig mit, ich benutze sie fast nie.«
Dankbar nahm Marianne die Nadeln entgegen. So waren wieder ein paar Groschen gespart.
Marianne warf einen prüfenden Blick zum Himmel und beschloss, noch an den anderen Türen zu klopfen und nach Aufträgen für ihre Mutter zu fragen. Leider vergeblich. Überall, wo sie vorsprach, erhielt sie abschlägige Antworten.
Ihre Schritte verlangsamten sich unwillkürlich, als sie sich dem letzten Haus einer Straße näherte. Es war größer und schöner als die Nachbarhäuser. Ein Fachwerkgiebel zierte den zweigeschossigen Bau, der Bauerngarten war umrahmt von einem Steinmäuerchen, über das im Sommer prächtige Wicken rankten. Jetzt waren davon natürlich nur ein paar verdorrte braune Triebe zu erkennen. Aber Marianne wusste, wie farbenfroh es hier aussah, wenn alles in voller Blüte stand.
Sie war oft hier gewesen. Früher. Der Holzhändler Hartmann war der wichtigste Geschäftspartner ihres Vaters gewesen und sein Sohn Fritz viele Jahre ihr bester Freund.
Mit mulmigem Gefühl näherte sie sich dem Grundstück. Nur der Gedanke an einen Winter voller Hunger trieb sie weiter.
»Grüß Gott«, rief sie dem alten Hartmann zu, der gerade Brennholz hackte. Er musterte Marianne unfreundlich, ehe er sich wortlos abwandte und krachend das nächste Scheit in zwei Hälften hieb.
Eine Frau trat mit einer Schüssel Hühnerfutter in den Hof. Bei Mariannes Anblick erstarrte sie. »Was hast du hier zu suchen?«, fragte sie barsch.
Marianne holte tief Luft. »Meine Mutter lässt fragen, ob …«
Weiter kam sie nicht. Mit einer herrischen Geste scheuchte die Frau sie davon. »Verschwinde! Gegen die Barbara haben wir nichts, die trifft ja keine Schuld. Aber dich wollen wir hier nie mehr sehen.«
Marianne spürte eine Mischung aus Trauer und Zorn in sich aufsteigen. »Bitte, ich …« Sie schluckte gegen den Kloß in ihrer Kehle an.
»Scher dich fort, verfluchtes Wagnermädel! Du kommst ganz nach deinem Großvater. Der hat, als er jünger war, auch nichts als Ärger bedeutet.«
»Mein Großvater?« Marianne spürte, wie Wut in ihr aufwallte, wo der doch seit Jahren nichts anderes tat, als schweigend vor dem Kamin zu sitzen. Aber ihr Protest ging im Gackern der Hühner unter.
Die Frau wies mit dem Finger auf Marianne. »Ich war Fritz’ Dote, glaub bloß nicht, dass ich dir jemals verzeihe, was du ihm angetan hast.«
»Ich habe gar nichts getan! Der Fritz hat …«
»Schweig!«, fuhr ihr die Frau über den Mund. »Der Herrgott wird dich strafen dafür! Der lässt sich von einer wie dir nichts vormachen.« Sie spuckte verächtlich vor Marianne aus.
Das war zu viel. Das musste sie sich nicht bieten lassen. Nicht von dieser scheinheiligen alten Hexe! Aber bevor Marianne ein böses Wort herausrutschte, presste sie die Lippen fest zusammen. Es würde ihr doch nur noch mehr Ärger einbringen.
»Gut«, murmelte sie. »Ich geh schon …«
Aber gar nichts war gut.
In ihren Augen brannten Tränen, als sie weiterging und den Wagen ruckartig hinter sich herzog. Das Glas mit den Birnen klirrte, als es gegen den Rand schlug. Wenn sie nicht achtgab, würde sie nur klebrige Scherben nach Hause bringen, doch für den Moment war ihr das egal. Sie wollte nicht mehr an den Fritz denken, wollte die diffuse Mischung aus Schuld und Wut nicht spüren, die jeder Gedanke an ihn auslöste. Es war nicht ihre Schuld gewesen! Und doch fühlte es sich so an. Auch weil manche sie nicht vergessen ließen.
»Schluss damit.« Marianne wischte sich übers Gesicht, beschleunigte ihre Schritte und blies Atemwolken in die Luft. Die aufgewühlten Gefühle begrub sie tief in ihrem Inneren.
Durchgefroren erreichte sie endlich ihr Heimatdorf. Aus den Fenstern leuchtete heimeliger Kerzenschein, die Familien saßen in ihren warmen Küchen am Abendbrottisch.
Als Marianne in die Zufahrt zum Lindenhof einbog, fielen einzelne Flocken vom Himmel. Sie blieb stehen, schloss die Augen und legte den Kopf in den Nacken. Wartete, bis die erste Schneeflocke auf ihrer erhitzten Wange landete. Ein Kuss des Winters!
Trotz erfüllte sie bis in die Zehenspitzen.
Mochte dieser Winter auch hart werden, Marianne war fest entschlossen, das Beste daraus zu machen. Und im Neuen Jahr würde sie ihr Leben ganz neu anpacken!
Sie streckte die Arme aus und drehte sich im Kreis wie ein Kind, bis ihr schwindelig wurde. Immer dichter fielen die Flocken. Tanzten um die kahlen Äste der Linde, tupften weiße Stellen auf die Haselhecke und den Holunder.
»Lottchen, Henni! Kommt raus, es schneit!«
Kapitel 2
Banat, Rumänien, Juni 1951
Schreie gellten durch die Nacht.
Alexandres Hand zog das Messer, noch ehe er richtig wach war. Vorsichtig kroch er durch die Dunkelheit der Scheune, um durch eine Ritze im Tor nach draußen zu spähen.
Vom Mondlicht beleuchtete Schemen rannten über den Hof, näherten sich dem Wohnhaus und brachen die Tür auf. Florins Frau kreischte, als die Soldaten sie an den Haaren nach draußen zerrten, eines der Kinder weinte.
Alexandres Herz hämmerte. Sein Atem ging stoßweise. Wo war Florin? Hatten sie ihn umgebracht?
Jetzt knallte ein Schuss. Aber es war nur der Anführer der Truppe, der sich damit Gehör verschaffte. Zornig brüllte er Befehle. Zwei Soldaten kamen auf die Scheune zu.
Alexandre schob sich in seinem Versteck blitzschnell nach hinten. Packte das Bündel mit seinen wenigen Habseligkeiten und riss die Stiefel an sich. Ohne sie würde er auf der Flucht nicht weit kommen.
Über den Heuboden robbte er zur Rückseite der Scheune. Dort gab es eine Stelle mit lockeren Brettern. Vielleicht suchten sie nicht gründlich genug, und es reichte, wenn er sich eine Weile ganz still verhielt. Schließlich wusste niemand, dass er hier war. Bei einer Deportation von allen Bewohnern des Dorfes würde sein Fehlen nicht auffallen.
Mit derben Tritten stießen die Milizen das Scheunentor auf. Alexandre verharrte mitten in der Bewegung. Unverständliche rumänische Wortfetzen drangen an sein Ohr. Er hörte ein klatschendes Geräusch und das Weinen des Kindes draußen verstummte abrupt.
Alexandre biss die Zähne zusammen. Er konnte nichts tun. Wenn sie ihn fanden, wäre das sein Ende.
Warum verfolgte ihn der Tod nur überallhin?
Krieg. Vertreibungen. Plünderungen. Gewalt. Die Wiederholung von sinnlosen Gräueltaten.
Würde es denn niemals aufhören?
Florin hatte ihn gewarnt und fortgeschickt, als er die ersten Gerüchte gehört hatte. »Sie nennen es Umsiedlung. Aber die Bărăgan-Steppe ist kein Ort zum Leben. Verschwinde, solange du noch kannst, Vagabund. Dich hält hier nichts.«
»Ich dachte, wir sind Freunde?«
Florins Antwort war ein Schnauben gewesen. »Genau deshalb sage ich dir: Geh! Oder sehnst du dich zurück nach dem Lager?«
Nein, das tat er ganz sicher nicht.
»Geh nach Hause«, hatte Florin gesagt. »Schließ dich einer Gruppe Wanderarbeiter oder fahrender Händler an und kehr in deine Heimat zurück. Auch wenn du dort keine Familie hast, die auf dich wartet, dein Platz ist nicht hier.«
Das war vorgestern gewesen.
Alexandre hätte auf ihn hören sollen. Nun war es zu spät.
»Eh!« Der scharfe Ruf galt ihm.
Sie hatten seinen Schlafplatz entdeckt. Das zerdrückte Heu verriet trotz der Finsternis seine Anwesenheit.
Alexandre schnellte hoch und warf sich mit seinem ganzen Gewicht gegen die morschen Bretter der Rückwand. Krachend splitterten sie und gaben den Weg frei.
Flüche erklangen in seinem Rücken. Wieder knallte ein Schuss. Die Soldaten riefen Verstärkung herbei. Vielleicht weil sie nicht wussten, mit wem sie es zu tun hatten. Nicht ahnen konnten, dass er außer dem Messer keine Waffe besaß.
Im Lauf zog Alexandre ungelenk seine Stiefel an. Beinahe wäre er dabei gestürzt. Gerade noch rechtzeitig fing er sich und hetzte durch den Obstgarten hinter Florins Haus.
Wenigstens kannte er die Gegend. Fast ein Jahr hatte er im Banat verbracht. Nun streckten der Krieg und seine Häscher auch hier ihre gierigen Krallen nach ihm aus.
Dass er Florin im Stich lassen musste, konnte er nur schwer ertragen. Aber man hatte ihn bereits in der Vergangenheit für einen Spion der Deutschen gehalten. Wenn er jetzt blieb und sich zu erkennen gab, würde er die Situation für Florins Familie nur noch verschlimmern. Das war das Letzte, was er wollte.
Also blieb Alexandre nichts als die Flucht. Er musste sich irgendwie nach Jugoslawien durchschlagen. Weg hier!
An den schweren Schritten und lauten Stimmen erkannte er, dass ihm gleich mehrere Milizen auf den Fersen waren. Wieder wurde geschossen. Etwas streifte Alexandres Ohr.
Er stolperte panisch, bis er begriff, dass es nur ein Ast gewesen war.
Motorengeräusch näherte sich. Scheinwerfer leuchteten die Umgebung ab. In der Ferne hörte Alexandre Hundegebell.
Verdammt! Damit hatte er nicht gerechnet. Hatten sie das ganze Dorf umzingelt und Straßensperren errichtet?
Blindlings schlug er einen Haken und wandte sich dann nach rechts, dem Ufer der Bega zu. Allein sein Instinkt trieb ihn weiter. Wenn er den alten Kahn erreichte, mit dem Florins Nachbar manchmal zum Fischen fuhr, hatte er vielleicht noch eine Chance zu entkommen.
Inzwischen zweifelte er nicht mehr daran, dass die Soldaten ihn erschießen würden, wenn sie ihn zu fassen bekamen. Florin war derjenige, der geschickt verhandeln konnte, nicht Alexandre. Und jetzt war er auf sich allein gestellt.
Der feuchte Dunst des Flusses stieg ihm in die Nase. Er hob kurz den Kopf, um sich zu orientieren.
Wieder peitschten Schüsse durch die Nacht.
Etwas warf ihn nach vorn. In seiner Schulter loderte Schmerz auf. Mit Mühe unterdrückte er einen Aufschrei. Das Bündel glitt aus seinen kraftlosen Fingern, als er über die Uferböschung rutschte. Ein paar Stockenten stoben aus dem Schilf auf. Ihr lautes Flattern und Quaken mischte sich mit den Rufen der Milizen. Wenigstens lenkte das die Hunde ab.
Alexandre keuchte.
Er hielt den Kopf gesenkt und presste sich gegen den Boden. Aus der Schulter, wo ihn die Kugel getroffen hatte, sickerte Blut und verklebte das schweißfeuchte Hemd.
Dann hörte er das Plätschern. Direkt vor ihm hob sich ein dunkler Schatten vom Wasser ab.
Der alte Kahn!
Jetzt erspähte Alexandre auch die Menschen darin. Radu, der halbwüchsige Sohn des Nachbarn kämpfte mit einem Ruder, das sich im Uferschlick verfangen hatte. Neben ihm kauerte ein Mädchen, das Alexandre nicht kannte. Sie war leichenblass und zitterte. Vielleicht Radus heimliche Freundin?
Für Fragen blieb keine Zeit. Für Überlegungen auch nicht.
Schon war Alexandre im Wasser. Mit aller Kraft stemmte er sich gegen den Kahn und richtete den Bug zur Flussmitte aus.
Vielleicht konnte er wenigstens diesen beiden helfen. Zwei Menschenleben zu retten war besser, als gar nichts zu tun.
»Alexandru«, wisperte Radu.
Er streckte die Hand aus und versuchte, ihn mit ins Boot zu hieven. Alexandre wehrte ab.
»Lass! Ich bin zu schwer.«
Er wollte nicht riskieren, den Kahn zum Kentern zu bringen. Mit dem verletzten Arm klammerte er sich am Heck fest. Schob das Boot vom Ufer weg. Seine Schulter pulsierte vor Schmerz. Beinahe wurde ihm schwarz vor Augen.
Noch nicht, dachte er verzweifelt. Noch nicht!
Erst wollte er die beiden in Sicherheit wissen. Die Stadt war nicht weit. Selbst mit nur einem Ruder ließ sie sich noch vor Sonnenaufgang erreichen.
Während Radu den Kahn stumm durch die Nacht lenkte, kniete das Mädchen hinter ihm. Sie sah auf Alexandre hinunter und ihre Lippen bewegten sich unablässig, als flüstere sie ein Gebet.
Endlich gelangten sie in tieferes Wasser. Die Strömung der Bega erfasste den Kahn, nahm ihn mit sich. Mit beiden Beinen machte Alexandre Schwimmstöße unter Wasser, bis seine Kräfte erlahmten. Seine Glieder waren schwer wie Blei.
Plötzlich schmeckte die Luft nach Rauch. Hinter ihnen färbte Feuerschein den Nachthimmel rußig rot. Die Miliz fackelte die leeren Häuser ab.
Radu stammelte Verwünschungen. Seine Stimme bebte. Aber er hörte nicht auf zu rudern – weg von der Gefahr in ihrem Rücken.
Alexandre spürte den Sog der Tiefe. Seine nasse Kleidung und die schweren Stiefel zogen ihn nach unten. Er bräuchte nur loszulassen und alles wäre vorbei.
Schmerzkaskaden jagten durch seine Schulter.
Radu raunte dem Mädchen etwas zu, und sie legte ihre schmale Hand auf seine. Hielt ihn fest.
»Halt durch, Alexandru!«
Er schloss die Augen. Jeder Atemzug war eine Qual. Seine Finger, die sich um das Holz krampften, spürte er schon gar nicht mehr. Nur die behutsame Berührung des Mädchens. Sanft wie ein Pinselstrich auf seiner Haut.
Durchhalten.
Wenn ihm bloß nicht so kalt wäre …
Mehr tot als lebendig zogen sie ihn später aus dem Wasser. Im ersten fahlen Licht des heraufdämmernden Morgens blickte er in Radus erschöpfte Augen. Das Mädchen rannte mit wehendem Haar auf die nahegelegenen Häuser zu.
»Sie holt Hilfe«, versprach Radu. »Du schaffst es!«
Alexandre stöhnte leise. Ja. Er wusste, dass er es schaffen würde. Es war offensichtlich, dass der Tod ihn nicht wollte. Heute Nacht hatte er ihn ein weiteres Mal zurück in die Welt gestoßen.
Stellte sich nur die Frage, warum.
Kapitel 3
Hohenlohe, 1953
Manchmal, wenn sie etwas Zeit zum Nachdenken brauchte, nahm Marianne den langen Weg zurück nach Hause. Er führte ein Stück über Felder, die jetzt, wenige Tage vor Weihnachten, unter einer weißen Decke lagen. Marianne genoss es, über den unberührten Schnee zu laufen und in der Landschaft ihre Spur zu hinterlassen.
Sie folgte dem schmalen Pfad bis zur Kirche. Normalerweise war es dort außerhalb des Gottesdienstes angenehm ruhig. Doch nun stand die Witwe Weingärtner im Eingangstor des Kirchhofs und redete sichtlich erbost auf den Pfarrer ein.
In den Armen hielt sie ein Bündel Tannenreisig, wohl um die Gräber ihrer Angehörigen abzudecken. Bei jedem Wort, das sie ausspuckte, wippten die Zweige, wie um ihr beizupflichten.
»Das ist doch nicht richtig! Wer bitte denkt sich so ein Gesetz aus? Jetzt soll es also Entschädigungen geben, für die Opfer des Nationalsozialismus, und jeder dahergelaufene Lump kann behaupten, er wär eins gewesen? Uns haben die Amerikaner sämtliche Häuser zerschossen, aber können wir einen Antrag stellen? Nein. Wer entschädigt uns? Niemand!«
Sie schnaubte vor Empörung, die Zweige bebten.
Marianne verzog das Gesicht. Früher, als der Großvater noch nicht verstummt war, hatte er gegen solche verbohrten Leute wie die Weingärtners gewettert. »Die sind der Tod aller Menschlichkeit«, hatte er gesagt. Marianne vermisste seine Stimme und seine klare, unbeugsame Haltung so sehr.
»Das dürfen Sie nicht vergleichen, Frau Weingärtner«, sagte der Pfarrer geduldig. »Im dritten Reich ist vielen Menschen durch die Nationalsozialisten Unrecht geschehen. Wenn sich die Politik jetzt bemüht, das mit Geld wiedergutzumachen, kann ich daran nichts Schlechtes finden.«
»Eine Unverschämtheit ist das«, grollte die Witwe. »Viele, die damals im Gefängnis saßen, hatten es verdient. Mörder, Diebe und Unruhestifter – von denen gab es früher genau so viele wie heutzutage. Ich verstehe wirklich nicht, warum die jetzt entschädigt werden sollen.«
Der Pfarrer runzelte bei ihren Worten die Stirn, legte ihr aber beschwichtigend die Hand auf den Arm. Augenblicklich verstummte sie. Pfarrer Laurenz kannte seine Schäfchen gut und wusste mit ihnen umzugehen. Eine zeternde Frau Weingärtner brachte ihn jedenfalls nicht aus der Ruhe. Marianne bewunderte ihn dafür. Sie musste schwer an einem bösen Kommentar schlucken, der ihr auf der Zunge lag. Aber es brachte nichts, sich mit ihr anzulegen. Die Witwe hatte Einfluss im Dorf, kannte alles und jeden, und arm war sie auch nicht.
Jetzt wurde sie Mariannes Anwesenheit gewahr. »Ach, sieh an, das Wagnermädel. Willst du auch auf den Friedhof?«
Marianne verneinte. Vielleicht sollte sie einfach weitergehen, aber sie wollte auch nicht unhöflich wirken.
Die Augen der Witwe wurden schmal. »Neulich habe ich deine Schwester getroffen. Wie alt ist die Henriette jetzt?«
Irgendetwas an der Art, wie die Weingärtner sie anguckte, sorgte dafür, dass Marianne sich wie bei einem Verhör fühlte. Sie antwortete knapp. »Vierzehn. Im Mai wird sie fünfzehn.«
»Dann ist sie ja bald mit der Schule fertig. Und feiert sie im Frühjahr dann Konfirmation?«
Marianne nickte und fragte sich gleichzeitig, worauf Frau Weingärtner hinauswollte.
»Ihr solltet auf sie achtgeben. Sie ist hübsch.« So wie die Witwe das betonte, klang es eher nach einem Vorwurf als nach einem Kompliment. »Die hübschesten Mädchen haben schnell die größten Flausen im Kopf, stimmt’s?«
Marianne presste die Lippen aufeinander. Sie würde gewiss nicht über Henriette herziehen, auch wenn sie daheim nicht immer einer Meinung waren. »Meine Schwester ist ein anständiges Mädchen. Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
Die Augen von Frau Weingärtner verengten sich noch weiter. »Ich meine nur, so viel Bewunderung von den jungen Männern kann einem schnell zu Kopfe steigen.«
Nun reichte es aber wirklich! Sonst würde die Weingärtner als Nächstes noch so weit gehen und behaupten, es dauere nicht lange, bis Henriette mit einem dicken Bauch heimkäme. »Woher wollen Sie das wissen, Frau Weingärtner? Ich glaube nicht, dass Sie diese Sorge jemals haben mussten.«
Es dauerte einen Moment, dann schnappte die Weingärtner empört nach Luft. »Also … Also, solche Frechheiten muss ich mir nun wirklich nicht anhören!« Sie wandte sich betont würdevoll dem Pfarrer zu. »Einen schönen Tag noch, Herr Pfarrer.« Dann reckte sie das Kinn und rauschte in Richtung der Gräber davon.
Mit tadelnd erhobenem Zeigefinger wandte sich der Pfarrer an Marianne. »Das war nicht allzu freundlich.«
»Sie war ja auch nicht allzu freundlich«, gab Marianne zurück.
»Das mag sein, aber Gleiches mit Gleichem zu vergelten ist eine Sache des Alten Testaments, nicht des Neuen. Sei freundlich zu deinen Mitmenschen, auch wenn sie diese Freundlichkeit nicht erwidern.«
Ohne wirklich zu bereuen, was sie gesagt hatte, senkte Marianne den Kopf. »Es tut mir leid.«
Der Pfarrer lächelte sie nachsichtig an. »Die Kirche könnte übrigens ein neues Altartuch gebrauchen, falls deine Mutter Zeit dafür hat.«
Das war ein Hoffnungsschimmer, denn seit Mariannes letztem Rundgang waren keine neuen Aufträge hereingekommen. Stickarbeiten waren außerdem aufwendig und kosteten Zeit. Dafür gab es sicher guten Lohn, zumal der Pfarrer nicht mit Naturalien bezahlen würde. Mit dem Geld könnten sie diesen Winter überstehen.
»Sag, kann ich deinen Großvater auch zur Messe erwarten? Vielleicht an Weihnachten zu Lottchens Krippenspiel? Das wäre doch ein schöner Anlass.«
Verlegen scharrte Marianne mit der Schuhspitze. Seit dem Tod ihres Vaters hatte ihr Großvater keinen Fuß ins Dorf gesetzt und schon gar nicht in die Kirche.
»Er kann nicht …« Wie sollte sie das ausdrücken? Marianne suchte nach den richtigen Worten. »Die meiste Zeit ist er im Kopf ganz weit weg. Irgendwo anders. Er reagiert kaum, wenn man ihn anspricht. Ich versuche immer wieder, mit ihm zu reden, aber er antwortet nie, auch wenn ich denke, dass er mich hört. Es tut mir leid.«
Pfarrer Laurenz nickte. »Gott kann warten«, sagte er und reichte Marianne mit gütiger Miene die Hand. »Und wenn Gott das kann, kann ich es auch.«
Marianne rang sich ein Lächeln ab. Warten würden sowohl Gott als auch der Pfarrer da vermutlich lange müssen.
Am Abend half Marianne ihrer Mutter, den Tisch zu decken. Während sie die Teller abzählte, schaute sie sich suchend um. »Kommt Großvater zum Essen?«
Er wollte sich nicht immer dazusetzen. Manchmal musste man ihm einen Teller Suppe auf sein Zimmer bringen und hoffen, dass er zumindest ein paar Löffel davon schlürfte.
Die Mutter hob die Schultern. »Magst du ihn fragen gehen? Ich glaube, er ist schon wieder drüben.«
Marianne nickte und stellte die Teller ab. Eilig schlüpfte sie in den Mantel und trat ein weiteres Mal an diesem Tag in die Kälte hinaus.
Drüben – das war die Schreinerei. Marianne stapfte über den verschneiten Waldweg und schon bald ragte das verwahrloste Gebäude dunkel vor ihr auf. Sie wusste nicht, was den Großvater daran immer wieder anzog. Auf sie wirkte all die Zerstörung furchtbar trostlos. Wie gern hätte sie irgendetwas getan, um die Schreinerei wieder instand zu setzen! Dann wäre es anders.
Die Tür knarrte in den rostigen Angeln, als Marianne sie aufschob. Das schwache Licht des Winterabends fiel durch das Loch im Dach, ringsum lagen geborstene Balken und Ziegelscherben.
Und inmitten all der Zerstörung saß der Großvater, im warmen Schein einer Laterne, auf einem Hocker vor der alten Werkbank.
»Kommst du zum Essen?«, rief Marianne ihm zu.
Er hob nicht einmal den Kopf.
Marianne seufzte. Sie wollte nicht noch lauter rufen, also ging sie hinüber und setzte sich neben ihn. Für eine Weile schwiegen sie beide. Ihn noch einmal aufzufordern, zum Essen zu kommen, würde nichts nützen. Stattdessen suchte sie nach einem Anfang für ein Gespräch.
»Der Pfarrer hat nach dir gefragt«, sagte sie schließlich.
Ihr Großvater gab nicht zu erkennen, ob er sie gehört hatte oder nicht. Stattdessen drehte er die Holzscheibe in den Händen. Marianne hatte ihn in den letzten Tagen oft damit gesehen und sich gewundert, was er damit anfangen wollte. Sonst schnitzte er aus dem Holz der alten Linde meist nur kleinere Figuren. Inzwischen hatte er die Ränder der Scheibe sorgfältig geschliffen. Erst nach einem Moment bemerkte Marianne die vier kleinen Löcher auf der Unterseite. Ihr Großvater nahm einen dünnen Stab, hielt ihn mit einem Ende gegen das Loch. Er passte. Er steckte ihn hinein.
Marianne sah ihm dabei interessiert zu. Holzarbeiten hatte sie schon immer spannend gefunden. Gerne hatte sie sich als Kind in die Schreinerei geschlichen. Die große Säge dort machte aus Baumstämmen glatte Bretter, mit Hilfe von Maschinen wurden Schranktüren gebaut und Stuhlbeine gedrechselt. Sie liebte es, dem Fallen der Späne zuzusehen und zu beobachten, wie sich langsam die Dinge aus dem Holz formten.
»Wird das ein Tisch?«
Die Schultern des Großvaters wirkten entspannter als vorhin noch. Und lag da nicht ein leichtes Lächeln auf seinem Gesicht? Marianne fasste das als zustimmende Antwort auf.
»Ich wünschte, du könntest mir so etwas beibringen«, fuhr sie fort. Vor allem, um die Stille zu füllen. »Weißt du noch, wie ich als Kind immer in den Schuppen mit den Holzresten geschlichen bin, um mir dort ein Stück zu holen? Und dann habe ich mir ein Küchenmesser von Mutter genommen und versucht, etwas zu schnitzen.«
Die Muskeln im Gesicht des Großvaters zuckten. Schmunzelte er? Marianne war sich nicht sicher.
»Ich weiß«, sagte sie. »Das Ergebnis war nicht besonders ansehnlich, und ich hab mich geschnitten. Vater ist böse geworden, als er meinen blutenden Finger und die krummen Tierchen entdeckt hat, die ich für Fritz’ Geburtstag geschnitzt hatte.«
Das war damals gewesen, als sie und Fritz einfach nur Freunde gewesen waren, als noch niemand von Heirat gesprochen hatte, um die Schreinerei und die Holzhandlung des Dorfes zusammenzubringen.
Ein schnelles Ausstoßen der Luft durch die Nase hätte man beinahe als missbilligendes Schnaufen des Großvaters verstehen können. Er hatte den Stab für das Tischbein wieder aus dem Loch gezogen, glatt poliert und schnitzte nun vorsichtig mit einem richtigen Schnitzmesser Rillen und Kerben hinein. Wie bei einem besonders edlen Esstisch.
»Der wird sicher schön«, sagte Marianne.
Der Großvater hielt inne. Er drehte das Messer, hielt es mit dem Griff voran in ihre Richtung. Dann auch den Stab.
Abwehrend hob sie beide Hände. »Ich würde es nur ruinieren.« Das hatte ihr Vater gesagt, als er die Holztiere gesehen hatte. Sie habe gutes Holz ruiniert.
Ihr Großvater hielt ihr einfach beides weiter hin.
Schließlich seufzte Marianne, griff erst nach dem Schnitzmesser, dann nach dem Lindenholz. Sie hielt den Stab so, wie sie es zuvor bei ihrem Großvater gesehen hatte und setzte die Schneide des Messers ganz vorsichtig dort an, wo er aufgehört hatte zu schnitzen.
Hoffentlich machte sie nichts kaputt. Ihre Hände waren klamm von der Kälte, und sie hatte keinerlei Übung.
Sie schabte ein klein wenig Holz ab. Nicht viel. Dann schabte sie noch einmal, gab mehr Druck auf das Messer, und die leicht geschwungene Form des Tischbeins gewann an Tiefe. Ein Stück Späne fiel zu Boden, und plötzlich hatte Marianne wieder den überwältigenden Holzgeruch in der Nase, der diesen Raum früher ständig erfüllt hatte.
Sie wurde ein wenig mutiger, drehte den Stab ein wenig und versuchte, den Bogen gleichmäßiger zu formen. Mehr Späne fielen. Sie war sich nicht sicher, ob sie es richtig machte, aber mit dem Schnitzmesser ging es viel besser als mit dem stibitzten Küchenmesser von damals.
Es war, als könnten ihre Finger die Form ertasten, die das Holz annehmen sollte.
»Das macht Spaß«, sagte sie.
Ihr Großvater lächelte.
Kapitel 4
Am Morgen des Heiligen Abends blühten Eisblumen am Fenster der Kammer unter dem Dach, die Marianne sich mit Henriette teilte. Von der Schwester war nur ein Büschel Haare zu sehen, so tief hatte sie sich in ihrem Federbett vergraben. Früher war sie in klaren Winternächten manchmal zu Marianne unter die Decke geschlüpft und hatte ihr die eiskalten Zehen in die Waden gebohrt.
»Erzähl mir eine Geschichte«, hatte sie dann schlaftrunken gemurmelt. Während Marianne in den Nachthimmel geschaut und flüsternd das Märchen von Schneeweißchen und Rosenrot oder von den sechs Schwänen erzählt hatte, war Henriette wieder eingeschlafen.
Das schien eine Ewigkeit her.
Marianne schob die Füße in die Holzpantinen, die vor dem Bett standen. Die Kälte kroch sofort aus dem eisigen Holz unter ihre Haut.
Henriette schlief so fest, dass sie gar nicht merkte, wie Marianne die Dachkammer verließ.
In der Küche fachte sie als Erstes die Glut im Ofen an. Im Winter achteten sie darauf, das Feuer nie ganz ausgehen zu lassen, auch wenn sie ansonsten sparsam mit dem Vorrat an Kohle und Briketts umgingen. Die Asche kam in den Eimer, damit streute sie den Weg zum Abort und zum Holzschuppen, damit niemand bei Glatteis ausrutschte. Im Sommer nutzten sie die Asche als Dünger im Gemüsegarten oder auf dem Kartoffelacker.
Während das Wasser im Kessel auf dem Herd heiß wurde, wusch Marianne sich flink und flocht den zerzausten Zopf neu, ehe sie das Brot in Scheiben schnitt und das Gsälz auf den Tisch stellte. Für Lottchen erwärmte sie Milch, für alle anderen goss sie Tee auf. Etliche Kräuter wie Minze, Melisse, Salbei oder die Kamillenblüten hatte sie selbst gesammelt und getrocknet; die Natur war überaus freigiebig mit ihren Schätzen, wenn man wusste, wo sie zu finden waren. Und sie kosteten nichts.
Ein kleiner Wirbelwind fegte zur Tür herein. »Guten Morgen. Huch!« Lottchens Umarmung fiel stürmisch aus, weil sie an der Schwelle über den Saum des geblümten Nachthemdes stolperte, das ihr zu lang war – sie hatte es erst kürzlich von Henriette geerbt.
Lachend fing Marianne sie auf. »Du bist ja früh wach!«
»Heut ist doch Weihnachten«, erinnerte Lottchen.
»Wirklich? Nein, so was! Das hätte ich fast vergessen.«
Marianne drückte die zappelnde kleine Schwester an sich. Lottchen wand sich flugs wieder aus der Umarmung und legte den Kopf schief. »Bist du sehr traurig?«, fragte sie.
»Warum sollte ich denn traurig sein?«
»Na, weil das Christkind nur den Kindern Geschenke bringt.«
»Ach, Süße!« Marianne fuhr ihr liebevoll durchs Haar. »Das ist schon richtig so.«
Sie hoffte, Lottchen bekäme nicht mit, dass es in manchen Familien im Dorf durchaus üblich war, sich gegenseitig zu Weihnachten zu beschenken, auch unter den Erwachsenen. Auf dem Lindenhof war dafür kein Geld übrig.
»Hilfst du mir schnell die Hühner zu füttern? Danach wecken wir die anderen, hm?«
»Ja.« Lottchen hopste aus der Küche, aufgekratzt und voller Erwartungen an dieses Weihnachtsfest, auf das sie den ganzen Advent über hingefiebert hatte.
In Gummistiefeln und dicken Jacken stapften sie über den Hof zum Hühnerstall, um die Hühner zu versorgen. Mit fünf frisch gelegten Eiern wurden sie belohnt.
»Frühstück«, rief Lottchen, als sie mit geröteten Wangen wieder das Haus betraten. »Aufwachen, es gibt Frühstück!«
Zum Krippenspiel am Nachmittag in der Dorfkirche fanden sich vor allem jene Familien ein, für die der Weg zur Christmette um Mitternacht zu weit oder zu beschwerlich war. Bis auf den letzten Platz waren die Kirchenbänke belegt.
Hell leuchteten die Kerzen auf dem Altar, neben dem fleißige Helfer eine provisorische Krippe errichtet hatten. Pfarrer Laurenz begrüßte die Anwesenden, lediglich unterbrochen vom üblichen Husten, Schniefen und Füßescharren. Lottchen reckte stolz ihren Stab mit dem Goldpapierstern in die Höhe. Sie spielte einen Engel, der den Hirten auf dem Feld die frohe Botschaft von der Geburt Jesu überbrachte. Als sie an die Reihe kam, sagte sie fehlerfrei und ohne zu stocken ihren Vers auf. Schade nur, dass der Großvater ihren Auftritt verpasste.
Beim feierlichen Singen der Gemeinde spürte Marianne, wie ihr Herz weit wurde. Neben ihr erklang Hennis klare Stimme, dahinter der Sopran der Mutter, die immer zu leise sang, als ob sie ihrer Treffsicherheit bei den hohen Tönen misstraute. Nach der kurzen Weihnachtsansprache segnete Pfarrer Laurenz die Anwesenden, ehe er sie hinaus in die frostige Dämmerung entließ.
»Macht ho-och die Tü-hür, die To-hor macht weit …« Lottchen sang und hüpfte den ganzen Weg nach Hause, ihren Sternenstab wie eine Trophäe erhoben.
Hin und wieder stäubte Schnee auf ihre Köpfe, wenn der Wind über die weiß beladenen Wipfel der Bäume strich. Henriette grummelte vor sich hin, während sie die Flocken von ihrer Sonntagskleidung klopfte. Sie hatte lange auf hochwertigen Stoff gespart und die Mutter überredet, ihr einen Mantel nach der aktuellen Mode zu schneidern. Sorgsam achtete sie seitdem darauf, dass kein Krümel Dreck daran kam.
Marianne dagegen wartete, bis Lottchen in ihre Richtung schaute, und schüttelte sich dann wie ein Hund. Flocken stoben in alle Richtungen. Ihre kleine Schwester lachte und machte es ihr sofort nach. Henriette warf ihnen entrüstete Blicke zu und hielt ausreichend Abstand.
Wieder daheim bereitete Marianne den Kartoffelsalat zu, während ihre Mutter sich um den Braten kümmerte, den sie aus einer großen Menge Nüsse und Gemüse und einer kleinen Menge Fleisch gemacht hatte. Henriette deckte währenddessen den Tisch in der Stube. Dort aßen sie sonst nur sonntags oder die seltenen Male, wenn Besuch kam. Dann wurde das gute Porzellan benutzt und Servietten durch die hölzernen Ringe gesteckt. Einiges davon hatte in den Kriegszeiten gelitten, es gab nicht mehr genügend passende Gläser zu den Tellern. Dennoch wirkte es insgesamt sehr festlich.
Heute stand außerdem das Tannenbäumchen auf dem Nähtisch, in dem sich Barbaras Maschine praktischerweise versenken ließ. Sie hatten es mit Strohsternen geschmückt, eine kunstvoll mit Borte verzierte Schleife diente als Christbaumspitze.
»Oh, sieht das fein aus!« Lottchen klatschte vor Freude in die Hände. Dann rückte sie die hölzernen Tierfiguren gerade, die um die kleine Krippe standen. Dabei hatte sie Ochs und Esel bestimmt schon zehn Mal ordentlich aufgereiht. »Ob das Christkind wohl bald kommt, was meint ihr?«
»Solange du ihm hier auflauerst, bestimmt nicht. Husch, raus mit dir aus der Stube!« Henriette scheuchte sie hinaus.
Lottchen ließ sich nicht entmutigen. Gleich darauf spähte sie aus dem Küchenfenster nach draußen in die Dunkelheit und drückte ihre Nase an der Scheibe platt, um einen heimlichen Blick auf das Christkind zu erhaschen. »Warum dauert das Warten bloß soooooo lange?«
Am Ende erklang das Glöckchen, ohne dass sie auch nur einen Flügelhauch entdeckt hätte. Sie flitzte zurück in die Stube, wo nun ein großes Päckchen unter dem Baum lag und die Kerzen brannten, aber Henni wollte nichts bemerkt haben. Der Großvater am Kachelofen war ohnehin wieder in seiner eigenen Welt versunken.
»Ihr müsst das Christkind doch gesehen haben«, rief Lottchen.
»Weihnachtszauber«, behauptete Marianne und lächelte Henni zu. Wenn es darum ging, ihrer kleinen Schwester den Kinderglauben zu lassen, waren sie sich ausnahmsweise einig.
Wenig später saßen alle um den festlich geschmückten Tisch und ließen sich nach einem Dankgebet das Weihnachtsessen schmecken. Der Braten duftete himmlisch und dunkle Soße gab es reichlich dazu. In den schönen Gläsern sah der Most beinahe wie edler Wein aus.
Als Nachtisch hatte Marianne die Porzellanschale mit Gutsle und Quittenbrot gefüllt, doch heute war Lottchen mehr an dem geheimnisvollen Geschenk unter dem Tannenbaum als an den süßen Leckereien interessiert. Als sie vor Neugier kaum noch still sitzen konnte, erlaubte die Mutter ihr, es auszupacken.
»Schaut nur!« Jubelnd befreite Lottchen eine Stoffpuppe aus dem knisternden Packpapier, das mit ausgeschnittenen Sternen beklebt war. »Wie wunderschön sie ist.«
Marianne gab ihr recht. Sie kannte die Puppe ja bereits, die ihre Mutter spät abends genäht, ausgestopft und eingekleidet hatte. Damit sie Lottchen ähnlich sah, hatte sie ihr sogar braune Zöpfe aus Wollfäden geflochten. »Nenn sie doch Liesel, dann heißt sie fast so wie du.«
»Wie ich?« Lottchen zog die Nase kraus. Außer dem Lehrer in der Dorfschule nannte sie eigentlich niemand Lieselotte, wie sie in Wirklichkeit hieß. Doch die Vorstellung, ihren Namen mit der Puppe zu teilen, gefiel ihr offensichtlich. »Ja, das mach ich. So soll sie heißen.«
Auch Henni bewunderte Liesel gebührend, ehe sie das Buch mit dem abgegriffenen Einband von der Anrichte holte. »Liest du uns noch die Weihnachtsgeschichte vor, Mama?« Auch wenn sie in ihrer schicken Kleidung schon recht erwachsen wirkte, war Henriette doch noch ein Kind.
Bei den letzten Weihnachtsfesten hatte Barbara Wagner das Vorlesen übernommen, doch heute schüttelte sie den Kopf. »Meine Augen sind müde, lass das Marianne machen.«
»Oh ja, bitte.« Erwartungsvoll schmiegte Lottchen die Wange an die Schulter ihrer Schwester. »Lies du vor.«
Marianne nahm das Buch. Ein weiterer Schritt, den sie in den Kreis der Erwachsenen tat. Während der Großvater sich den Rücken am Kachelofen wärmte, hielt er wie so oft sein Schnitzmesser in der Hand. Beständig rieselten die Späne vor seinen Füßen zu Boden. Er arbeitete an dem Tisch, den er vor ein paar Tagen begonnen hatte. Eines der Beine war ein bisschen unregelmäßig. Aber er wirkte zufrieden damit, nicht so, als hätte Marianne seine Arbeit ruiniert.
Eine friedvolle Stimmung lag über der beheizten Stube, und Marianne fühlte sich beschenkt, hier zu Hause zu sein, dazu zu gehören, auch wenn ihre Familie seit dem Tod des Vaters schmerzhaft unvollständig war.
Aber der Krieg war Vergangenheit. Inzwischen waren bessere Zeiten angebrochen, Jahre des Aufbaus und Neubeginns. Es lag eine Zukunft vor ihnen, in der es galt, beherzt die Chancen zu ergreifen, die sich darboten. Sie musste nur die richtige Chance finden.
Wieder blickte sie zu dem kleinen Tisch in den Händen ihres Großvaters, gerade groß genug, dass Liesel daran würde sitzen können. So wie ihr Großvater mit Holz zu arbeiten, das war ihr Traum! Und vielleicht konnte sie sich den ja doch erfüllen. Zumindest wollte sie es versuchen.
Marianne wandte sich an ihre Mutter. »Ich finde, wir sollten den Betrieb wieder aufbauen.«
»Was?«, fragte Barbara überrascht.
»Unsere Schreinerei. Es ist doch schade, wenn drüben alles verrottet. Warum versuchen wir nicht, den Betrieb wieder in Gang zu bringen?«
»Wie stellst du dir das denn vor?« Barbara runzelte die Stirn. Ihre hageren Hände verknoteten sich ineinander. »Es ist ja kaum mehr was da, sie haben doch fast alles geplündert. Und es gibt eh keinen Schreiner mehr auf dem Hof.«
»Was ist mit Großvater?« Marianne deutete mit dem Kinn zu ihm hinüber. Er war zwar kein gelernter Schreiner, wie es ihr Vater gewesen war, aber er kannte sich mit Holz aus, schließlich hatte er Jahrzehnte in der Sägemühle und der angrenzenden Werkstatt mitgearbeitet. »Er schnitzt jeden Tag. Die Arbeit mit Holz bedeutet ihm viel.«
Manchmal dachte sie, dass es nur die kleinen Holzfiguren waren, die ihn am Leben erhielten. An kaum etwas anderem zeigte er Interesse. Vielleicht konnte man ihn mit einer Aufgabe wieder ins Leben zurückholen. Vielleicht war es genau das, was ihm fehlte? Etwas, das seiner kranken Seele helfen konnte, wieder gesund zu werden.
»Ich könnte es von ihm lernen.« Kaum hatte Marianne die Worte ausgesprochen, überfielen sie Zweifel. Wieder hörte sie ihren Vater sagen, sie habe gutes Holz ruiniert.
Ihre Mutter lächelte nachsichtig. »Dann können wir ja über deine Pläne reden, wenn du es gelernt hast.«
Das war kein Nein, aber auch keine große Hilfe. Vielleicht klang sogar milder Spott in den Worten mit. Denn wie sollte Marianne das Handwerk lernen, wenn sie kaum Werkzeug zur Verfügung hatte und die Schreinerei in Trümmern lag?
Entmutigt blickte sie zu ihrem Großvater. Wenn er doch nur sprechen und ihr beipflichten könnte!
Soeben schlüpfte Lottchen neben ihn auf die Ofenbank und sah treuherzig zu ihm auf. Während sie die Puppe über sein Knie wandern ließ, fragte sie, ob er nicht ein Puppenbettchen für ihre Liesel bauen könnte.
»Das würde ihr gefallen«, versicherte sie. »Dann braucht sie keine Angst zu haben, dass ihr schönes Kleid zerdrückt wird, weil sie mit mir in einem Bett schlafen muss.«
Karl-Otto hielt einen Moment lang inne. Seine Züge schienen weicher zu werden, als er seine jüngste Enkelin betrachtete. Aber auf ihre Bitte ging er nicht ein.
Barbara räusperte sich. »Du könntest versuchen, ein paar von seinen Schnitzfiguren zu verkaufen.«
»Ja, vielleicht.« Aber das war nicht das, was Marianne sich vorgestellt hatte. Sie konnte allerdings noch nicht in Worte fassen, was es stattdessen war.
»Ich denke darüber nach.«
Kurz vor Mitternacht lauschten sie den Kirchenglocken, die zur Christmette läuteten, dann räumte Barbara die leeren Mostgläser vom Tisch in der Stube. Lottchen gähnte. Vor Müdigkeit konnte sie kaum noch die Augen offen halten.
»Komm, es ist allerhöchste Zeit für dich.« Marianne hob sie hoch, um sie ins Bett zu tragen.
Der Großvater schlurfte davon, während Henriette das letzte Quittenbrot naschte und dann der Mutter half, die Kerzen in der Stube zu löschen.
»Träum schön, Liesel«, sagte Lottchen schläfrig zu ihrer Puppe. »Und denk dran, alles, was du in der Weihnachtsnacht träumst, geht im Neuen Jahr in Erfüllung.«
Marianne hoffte, das galt nicht nur für Puppenträume.
Erst jetzt fiel Marianne auf, wie viel Zeit ihr Großvater in der Schreinerei verbrachte. Immer, wenn sie nach ihm suchte, fand sie ihn dort. Der Tisch war längst fertig, nun schnitzte er an einem anderen Stück. Fasziniert schaute Marianne ihm dabei zu, selbst wenn das bedeutete, stundenlang in der Kälte zu sitzen. Sie machte es sich zur Gewohnheit, bei solchen Gelegenheiten eine Kanne heißen Tees mitzubringen, so dass sie sich beide aufwärmen konnten.
Es dauerte nicht lange, bis Marianne erkannte, was aus dem schmalen Holzteil in Karl-Ottos Hand werden sollte.
»Das wird ein Pfosten für Liesels Bett, richtig?«
Der Großvater antwortete nicht, arbeitete nur ruhig weiter. Aber Marianne war sich sicher. Die Größe der anderen Teile, die vor ihm auf der Werkbank lagen, stimmte genau. Die Puppe würde dort sehr gut hineinpassen.
»Vielleicht kann ich das Bettzeug dafür machen.« Ihre Nähkünste reichten lange nicht an die ihrer Mutter heran, aber dafür würde es reichen. Und für Lottchens Puppenbett war Marianne sogar bereit zu nähen. Auch wenn sie noch viel lieber beim Schnitzen geholfen hätte.
Als selbst der Tee sie nicht mehr warmhielt, stand Marianne auf, um sich zu bewegen.
Am Ende der Werkhalle erhob sich der Aufbau mit der großen Kreissäge. Ihr Vater hatte das Sägewerk selbst konstruiert und nach seinen Bedürfnissen anfertigen lassen; der vordere Teil war so breit, dass ganze Baumstämme zerteilt werden konnten. Der hintere Teil diente dazu, um Bretter, Türen oder Möbelteile zuzusägen.
Als Kind hatte Marianne immer großen Ärger bekommen, wenn sie sich in die Nähe der Kreissäge verirrt hatte, und sie konnte auch verstehen, warum. Wenn man dem rotierenden Sägeblatt zu nahe kam, riskierte man schnell, seine Finger einzubüßen oder sogar mehr.
Nun rostete das Ungeheuer vor sich hin, seine Zähne hatten ihre Schärfe verloren, der Holzaufbau wirkte morsch. Dieses Ungetüm würde sich womöglich nicht so einfach reparieren lassen. Selbst wenn es ihr irgendwie gelang, das Dach abdichten zu lassen, um in den Räumen der Schreinerei arbeiten zu können, würde sie vorerst wohl darauf verzichten müssen, die große Kreissäge wieder in Betrieb zu nehmen. Sie würde also nur kleinere Teile mit der Hand zusägen können, keine wuchtigen Bretter für Tische und Schränke, für Betten und …
Marianne hielt inne.
Sie drehte sich zum Großvater um, der selbstvergessen im Lichtkreis seiner Laterne saß. Eine Insel der Wärme und des Lebens in diesem toten Raum.
Wer sagte denn, dass sie große Tische, Schränke und Betten herstellen musste?
»Puppenmöbel!«
Ihre Mutter zuckte zusammen, als Marianne in die Küche stürmte. Sie ließ beinahe die Kartoffel fallen, die sie gerade schälte. »Wie bitte?«
»Wir könnten in der Schreinerei Puppenmöbel herstellen!«
Je öfter Marianne es aussprach, desto mehr hoffte sie, dass ihre Mutter begreifen würde, wie gut ihre Idee war. Sie sah in ihrer Fantasie schon alles genau vor sich: Die kleinen Schränke, Bettchen und Wiegen, das komplette Inventar für Puppenhäuser und Puppenstuben.
Ihre Mutter ließ das Schälmesser sinken. »Hast du diese fixe Idee noch immer nicht aufgegeben?«
»Es ist keine fixe Idee«, protestierte Marianne. »Steht auf dem Dachboden nicht noch das halbfertige Puppenhaus von Vater?« Er hatte es angefangen, bevor er damals an die Front geschickt worden war. Henriette hatte nie damit spielen wollen, deshalb hatten sie es weggeräumt. »Vielleicht kann ich das Puppenhaus fertig bauen. Seine Arbeit fortführen.«
Zwar würde sie ihrem Vater nie beweisen können, was in ihr steckte, und er würde sie nie dafür loben, egal wie sehr sie sich anstrengte. Aber vielleicht wüsste er es dennoch zu schätzen.
Barbara blickte sie lange und nachdenklich an. »Du meinst es wirklich ernst, hm?«
Marianne nickte entschlossen. Auch die tiefe Stirnfalte ihrer Mutter änderte daran nichts. Sie würde so lange üben, bis die Werkstücke, die sie schnitzte, nicht unregelmäßiger waren als die aus der Hand ihres Großvaters. Und was hatte sie schon zu verlieren? Sie konnten nicht ewig von den Näharbeiten ihrer Mutter leben, und für Marianne kam das auch gar nicht in Frage.
»So würde Vaters Erbe nicht länger brachliegen. Es ist doch viel zu schade drum! Bestimmt müsste man einiges reparieren oder neu anschaffen, aber …«
»Wir haben kein Geld für solche Träumereien«, unterbrach ihre Mutter sie.
»Aber wir könnten doch …«
»Marianne, hör auf! Niemand wird dir oder mir zutrauen, die Schreinerei zu führen. Wir haben keinerlei Erfahrung damit.«
»Um Erfahrungen zu sammeln, müssten wir es ja auch erst mal probieren«, begehrte Marianne auf. »Lass es mich doch wagen! Wie schwer kann das schon sein, dass ich es nicht lernen könnte?«
Die Miene der Mutter wurde verständnisvoller. »Hängt dein Herz denn so sehr an unserer Schreinerei?«
»Ja! Ich will arbeiten, aber ich will dafür nicht weggehen. Wir müssen nur irgendwie das Dach reparieren.« Sie seufzte. »Ich weiß, das wird teuer. Aber vielleicht zahlen sie bald auch Entschädigungen für Gefallene. Für die überlebenden Opfer des Nationalsozialismus tun sie das ja schon.«
»Sie tun … was?« Aus irgendeinem Grund wirkte ihre Mutter plötzlich sehr aufgeregt.
»Ich habe die Witwe Weingärtner darüber reden hören«, sagte Marianne. »Wieso, stimmt etwas nicht?«
»Schließ bitte die Tür.«
Verwirrt folgte Marianne der Aufforderung. Die Mutter legte Kartoffel und Messer beiseite und wischte sich die Hände an der Schürze ab.
»Erinnerst du dich, wie wir euch während des Krieges erzählt haben, dass Großvater nach Amerika gegangen sei?«
»Ja.« Marianne hatte ihn damals beneidet und wäre gerne mit ihm auf die Reise gegangen. »Aber was hat das mit …?«
Ihre Mutter hob die Hand. »Er war nie in Amerika. Er ist verhaftet worden und war lange Zeit in Buchenwald.«
»Im KZ Buchenwald?« Davon hatte Marianne in der Schule gehört. Sie wusste, dass den Menschen dort schreckliche Dinge widerfahren waren, aber es hatte sich nie ganz real angefühlt. Nun betraf es ihren Großvater.
Jetzt ergab auch so vieles andere einen Sinn. Kurz vor der Erntezeit 1944 war er damals auf den Lindenhof zurückgekehrt, schweigsam und hohlwangig. Sie hatte ihn beinahe nicht wiedererkannt mit seinem grauen Bartgestrüpp, den hängenden Schultern und dem ausgezehrten Körper. Den Bart hatte er gleich am ersten Tag abrasiert, der Rest war geblieben. Er hatte nicht ausgesehen wie einer, der dem Krieg nach Amerika entkommen war.
»Redet er deshalb nicht mehr? Nicht nur wegen Papas Tod?«
Die Mutter hob die Schultern. »Er hat nie über diese Zeit gesprochen.«
Mariannes Gedanken jagten im Kreis. Auch die Frage, weswegen der Großvater damals verhaftet worden war, schoss ihr durch den Kopf. Aber dann verstand sie plötzlich, worauf ihre Mutter hinauswollte.
»Also steht ihm auch eine Entschädigung zu.«
Barbara Wagner nickte. »Die könnte ihm vielleicht sogar helfen. Das Unrecht, das ihm widerfahren ist, hat er nie verwunden. Aber wenn er eine Entschädigung bekommt …«