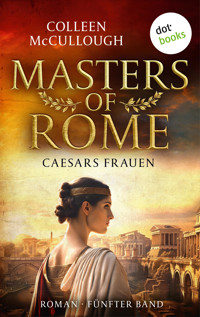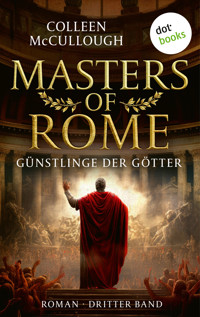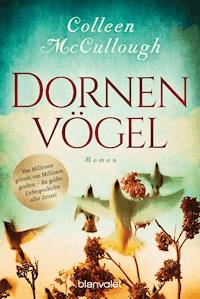5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihr ganzes Leben war sie unsichtbar, nun will diese Lady ihr eigenes Schicksal bestimmen. Byron/Australien, um die Jahrhundertwende. Die schüchterne Missy Wright ist klug und liebeswürdig – doch mit über 30 wird sie in ihrer Heimatstadt längst als alte Jungfer gehandelt. So verbringt sie ihre Tage mit ihrer Mutter Drusilla und Tante Octavia in einem kleinen Haus am Stadtrand oder flieht sich heimlich in die Welten zahlloser Liebesromane. Als eines Tages ein geheimnisvoller Gentleman nach Byron kommt, gerät bald die ganze Stadt in Aufruhr – und auch Missy kann ihre Neugier nicht leugnen … doch niemals würde sich ein stattlicher Mann wie John Smith für ein Mauerblümchen wie Missy interessieren – bis sie ihm eines Tages buchstäblich in die Arme fällt und nicht nur Missys Herz höher zu schlagen scheint … »Ohne Zweifel Colleen McCulloughs bewegendstes Buch seit ›Dornenvögel‹.« New York Post Das bezaubernde Romantik-Highlight aus Australien von Bestsellerautorin Colleen McCullough wird alle Fans von Di Morrissey begeistern. LeserInnen-Stimmen: »Eine wunderbare Geschichte um eine verspätete Liebe und um den Wandel in der Zeit. Sehr zu empfehlen!« Lovelybooks-Leserin »Ein echter Klassiker unter den Liebesromanen, eine bezaubernde Geschichte, meisterhaft erzählt.« Lovelybooks-Leserin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Byron/Australien, um die Jahrhundertwende. Die schüchterne Missy Wright ist klug und liebeswürdig – doch mit über 30 wird sie in ihrer Heimatstadt längst als alte Jungfer gehandelt. So verbringt sie ihre Tage mit ihrer Mutter Drusilla und Tante Octavia in einem kleinen Haus am Stadtrand oder flieht sich heimlich in die Welten zahlloser Liebesromane. Als eines Tages ein geheimnisvoller Gentleman nach Byron kommt, gerät bald die ganze Stadt in Aufruhr – und auch Missy kann ihre Neugier nicht leugnen … doch niemals würde sich ein stattlicher Mann wie John Smith für ein Mauerblümchen wie Missy interessieren – bis sie ihm eines Tages buchstäblich in die Arme fällt und nicht nur Missys Herz höher zu schlagen scheint …
Über die Autorin:
Colleen McCullough (1937-2015) wurde in Wellington geboren und wuchs in Sydney auf. Nach einem Studium der Neurologie arbeitete sie in verschiedenen Krankenhäusern in Australien und England, bevor sie einige Jahre nach Amerika ging, um an der Yale University zu forschen und zu lehren. Hier entdeckte sie auch ihre Liebe zum Schreiben, wobei ihre ersten beiden Romane, »Tim« und »Die Dornenvögel«, direkt zu internationalen Bestsellern aufstiegen.
Bei dotbooks veröffentlichte Colleen McCullough ihre Romane »Die Frauen von Missalonghi« und »Die Stadt der Hoffnung«.
Außerdem erschien Ihre historische Reihe »Masters of Rome« mit den Einzeltiteln:
»Adler des Imperiums«, »Die Krone der Republik«, »Günstlinge der Götter«, »Das Blut des Spartacus«, »Caesars Frauen«, »Tochter des Adlers« und »Die Wasser des Rubikon«.
***
eBook-Neuausgabe August 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1987 unter dem Originaltitel »The Ladies of Missalonghi« bei Century Hutchinson, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1989 unter dem Titel »Die Ladies von Missalonghi« bei Heyne, München.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1987 by Colleen McCullough
Copyright © der deutschen Erstausgabe by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Motivs von © Adobe Stock / AD LUCEM sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-172-8
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13, 4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Colleen McCullough
Die Frauen von Missalonghi
Australienroman
Aus dem Englischen von Eva Schönfeld
dotbooks.
Widmung
Meiner Mutter, die sich endlich ihren Traum erfüllen konnte, in den Blue Mountains zu leben.
Anmerkung der Autorin
Für diejenigen Leser, die sich an der Schreibweise Missalonghi (statt Missolunghi) stoßen: Diese war zu Anfang unseres Jahrhunderts in Australien allgemein üblich.
Kapitel 1
»Kannst du mir verraten, Octavia, warum wir nie auf einen grünen Zweig kommen?« fragte Mrs. Drusilla Wright ihre Schwester und fügte seufzend hinzu: »Wir brauchen ein neues Dach.«
Miss Octavia Hurlingford ließ die Hände in den Schoß sinken, schüttelte vergrämt den Kopf und seufzte ebenfalls. »Ach Gott … Meinst du wirklich?«
»Denys ist der Meinung.«
Da ihr gemeinsamer Neffe Denys Hurlingford Inhaber der hiesigen Eisenwarenhandlung war und außerdem eine gutgehende Spenglerei betrieb, galt sein Wort in solchen Dingen als unumstößliches Gesetz.
»Was wird das wieder kosten? Muß es denn ein ganzes Dach sein? Kann man die schadhaften Stellen nicht reparieren?«
»Denys sagt, es ist dermaßen verrostet, daß sich der Versuch gar nicht lohnt. Es wird also auf etwa fünfzig Pfund hinauslaufen – leider.«
Bedrücktes Schweigen folgte. Jede der beiden Schwestern zermarterte sich ihr Hirn auf der Suche nach irgendeinem Ausweg aus der finanziellen Klemme. Sie saßen nebeneinander auf einem Roßhaarsofa, das auch einmal bessere Tage gesehen hatte; aber die lagen so weit zurück, daß man sich kaum noch daran erinnerte. Mrs. Drusilla Wright säumte mit mikroskopisch feinen, haargenauen Stichen ein weißes Bettuch, und Miss Octavia Hurlingford war mit einer Häkelarbeit beschäftigt, die an Feinheit der Arbeit ihrer Schwester nicht nachstand.
»Wir könnten die fünfzig Pfund abheben, die Vater bei meiner Geburt auf der Bank eingezahlt hat«, ließ sich die dritte Anwesende vernehmen, Missy Wright, die hörbar um eine Art ›Wiedergutmachung‹ bemüht war, weil es ihr nie gelang, auch nur einen Penny von ihrem Butter- und Eiergeld zurückzulegen. Sie saß auf einem niedrigen Schemel und verfertigte ecrufarbene Klöppelspitze. Ihre Finger bewegten sich mit einer Geschicklichkeit, wie sie sich nur bei einer Arbeit einstellt, bei der man schon lange kaum noch hinzusehen oder nachzudenken braucht.
»Danke, nein«, sagte Drusilla.
Und damit war das einzige Gespräch beendet, das während der zweistündigen Handarbeitszeit am Freitagnachmittag geführt wurde, denn bald danach schlug die alte Dielenstanduhr viermal. Dies war das Signal für alle drei Damen, sich zu erheben und, wie unter dem automatischen Zwang des Althergebrachten, ihre Arbeiten für heute wegzulegen – jede in einen eigenen Beutel aus einförmig grauem Flanell, den sie dann in je einer Schublade einer verschrammten alten Mahagonikommode verstauten.
Der Tagesablauf im Hause Missalonghi wurde niemals abgewandelt. Nach der zweistündigen Handarbeitssitzung im ›zweitbesten‹ Zimmer kam ein weiterer Zeitabschnitt an die Reihe, der anderen Aufgaben gewidmet war. Drusilla begab sich an das Harmonium, ihr einziger Reichtum und ihre einzige Freude, während Octavia und Missy sich in die Küche verfügten, um das Abendessen vorzubereiten und nebenbei die Außenarbeiten zu erledigen.
In den paar Sekunden, die alle drei vor der Türschwelle verharrten, glichen sie drei Hühnern, die nicht recht wissen, wem der Vortritt gebühre, war die Familienähnlichkeit von Drusilla und Octavia deutlich zu erkennen. Beide waren – für Frauen – ungewöhnlich groß, und ihre Gesichter waren gleichermaßen lang, knochig und so hell, daß sie bleichsüchtig wirkten. Aber während Drusilla ziemlich breit und kräftig von Körperbau war, hatte Octavia einen ›kleinen Verdruß‹, wie man es damals nannte; das heißt, sie war von Kind an etwas verwachsen und litt an Arthritis. Missy, Drusillas Tochter, war auch nicht klein, reichte aber nicht an das Gardemaß der übrigen Hurlingfords heran. Auch sonst hatte sie äußerlich nichts mit ihnen gemein, denn sie war so dunkel wie alle anderen blond und obendrein erbarmungswürdig mager, und ihre Gesichtszüge hatten schon gar nichts mit denen ihrer behäbigeren Verwandtschaft zu tun.
Die Küche, ein großer kahler Raum an der Rückseite der zugigen Eingangsdiele, trug mit ihren braungestrichenen Holzwänden einen guten Teil zur allgemeinen Ungemütlichkeit des Hauses bei.
»Schäl erst die Kartoffeln, bevor du die Bohnen pflücken gehst«, sagte Octavia, indem sie sich eine voluminöse braune Schürze umband, um ihr braunes Kleid vor etwaigen Spritzern zu bewahren. Während Missy ihrem Wunsch nachkam (drei Kartoffeln genügten), stocherte die Tante in der Glut des schwarzen Eisenherdes unter dem dicken alten Ofenrohr, schob Feuerholz hinein, richtete die Klappe, um mehr Zug in die Sache zu bringen, und setzte den großen Wasserkessel auf. Dann wandte sie sich zur Speisekammer, um, wie immer, schon jetzt das Rohmaterial für das Frühstück des nächsten Tages herauszunehmen.
Einen Moment später kam sie mit dem Ausruf »Ach, wie ärgerlich!« an den Küchentisch, eine braune Papiertüte in der Hand. Ein kleineres Rinnsal von Haferflocken rieselte zu Boden wie angeschmutzter Schnee. »Sieh bloß! Da waren wieder die Mäuse dran!«
»Reg dich nicht auf, ich stelle eben heute abend ein paar Fallen hin«, erwiderte Missy ohne besonderes Interesse. Sie war gerade dabei, ihre drei geschälten Kartoffeln in einen kleinen Wassertopf zu tun und eine Prise Salz hinzuzufügen.
»Mausefallen über Nacht retten unser Frühstück nun auch nicht mehr. Du mußt noch schnell zu Onkel Maxwell laufen und neue Haferflocken kaufen. Geh und laß dir von deiner Mutter das Geld geben.«
»Können wir nicht ein einziges Mal auf unser Porridge verzichten?« Missy haßte Porridge.
»Im winter?« Octavia starrte sie an, als sei sie wahnsinnig geworden. »Ein schöner großer Napf Porridge ist billig, mein Kind, und die beste Grundlage für den ganzen Tag. Und nun beeil dich gefälligst!«
Die Harmoniummusik auf der anderen Seite der Diele war ohrenbetäubend. Drusilla war eine herzlich unbegabte Spielerin, die aber nie etwas anderes zu hören bekommen hatte, als daß sie sehr gut sei. Immerhin war sie streng mit sich und übte unerbittlich jeden Nachmittag, den Gott werden ließ, zwischen vier und sechs. Einen gewissen Sinn hatte es, denn sonn- und feiertags tobte sie ihren Mangel an Talent vor der Gemeinde von Byron aus, die sich hauptsächlich aus Mitgliedern der Hurlingford-Familie zusammensetzte. Da diese glücklicherweise alle unmusikalisch waren, fand man allgemein, Drusillas Spiel sei eine sehr würdige Umrahmung des Gottesdienstes (zumal es nichts kostete).
Missy schlich in den ›Salon‹, nicht in das Zimmer, wo sie ihre Handarbeiten machten, sondern in ein größeres, das für bedeutendere Gelegenheiten reserviert war und wo das Harmonium stand. Drusilla fiel über Bach her wie ein Ritter, der seinen Rivalen im Turnier unter Donnergetöse niederrennt, mit steifem Rücken, zurückgeworfenem Kopf, geschlossenen Augen und zuckenden Lippen.
»Mutter?« Das geflüsterte Wort war nur ein Hauch…
Doch es drang durch. Drusilla öffnete die Augen und sah sich um, mehr mit einem Ausdruck der Resignation als des Ärgers.
»Ja?«
»Entschuldige die Störung, aber ich muß frische Haferflocken holen, bevor Onkel Maxwell seinen Laden zumacht. Die Mäuse haben die Tüte angefressen.«
Drusilla seufzte. »Na schön, bring mir mein Portemonnaie.«
Missy holte es, und Drusilla fischte ein Sixpence-Stück aus dem schmalen Behältnis. »Aber nimm wieder die einfachen, hörst du! Bei den abgepackten zahlt man ja hauptsächlich für den Markennamen und die bunte Schachtel.«
»Nein, Mutter, die Markenhaferflocken schmecken viel besser, und man muß sie nicht die ganze Nacht köcheln lassen wie die Rohware.« Eine schwache Hoffnung regte sich in Missys Brust. »Wenn du und Tante Octavia Markenflocken essen würdet, verzichte ich gern … Das macht dann den Preisunterschied wieder wett.«
Drusilla sagte sich und ihrer Schwester ständig, daß sie den Tag noch zu erleben hoffe, an dem ihre schüchterne Tochter endlich etwas Eigeninitiative zeigen würde, aber schon mit dem eben geäußerten kleinen Vorschlag lief Missy gegen eine Mauer mütterlicher Autorität, deren Drusilla sich gar nicht bewußt war. »Kommt gar nicht in Frage!« erwiderte sie scharf. »Porridge ist im Winter unser wichtigstes Nahrungsmittel, und die lose Sorte ist erheblich billiger als das bißchen Herdfeuer.« Ihr Ton milderte sich etwas; sie sprach jetzt mehr ›von Frau zu Frauc »Welche Temperatur haben wir eigentlich?«
Missy sah nach dem Thermometer, das in der Diele hing. »Zweiundvierzig!«i rief sie in den Salon zurück.
»Dann essen wir heute in der Küche und bleiben den ganzen Abend lang dort!« rief Drusilla über die Schulter und nahm ihren Bach unbarmherzig wieder in Angriff.
Kapitel 2
Eingehüllt in ihren braunen Sergemantel, einen braunen Wollschal und eine braune Strickmütze, das Sixpence-Stück ihrer Mutter sorgsam in einem ihrer braunen Wollhandschuhe verborgen, eilte Missy aus der Haustür, über den säuberlich gepflasterten Gartenweg und zur Pforte hinaus auf die Landstraße. In ihrer Einkaufstasche lag ein geliehenes Buch, das sie bei dieser Gelegenheit zurückgeben und gegen ein anderes eintauschen wollte. Sie kam selten genug dazu; aber wenn sie sich heute besonders sputete, brauchten Mutter und Tante gar nicht zu wissen, daß sie noch etwas anderes getan hatte, als bei Onkel Maxwell Haferflocken zu kaufen. Leider würde heute abend Tante Livilla höchstpersönlich in der Bibliothek thronen, so daß Missy nur ein ›belehrendes‹ Buch bei ihr ausleihen konnte und keinen Roman, aber in Missys Augen war auch ein langweiliges Buch besser als gar keines. Und nächsten Montag würde Una wieder Dienst tun; falls Missy dann von zu Hause wegkam, konnte sie sich ihren Roman holen.
Die Luft war von einem dichten, weichen Dunst erfüllt, der sich zwischen Nebel und Regen in der Schwebe hielt und sich auf der Hecke, die das Grundstück von ›Haus Missalonghi‹ einfriedete, in dicken Tropfen niederschlug. Kaum hatte Missy die Gordon Road erreicht, so begann sie zu rennen, mußte aber schon an der ersten Biegung ihr Tempo mäßigen, weil sie – wieder einmal – auf der linken Seite diese rätselhaften Stiche bekam, die wirklich schauderhaft weh taten. Bei normalem Gehen wurde es allerdings bald besser, und so trottete sie denn etwas gesetzter dahin und begann sich zu freuen, wie immer, wenn sie die seltene Chance bekam, allein und unbewacht den Grenzen von Missalonghi zu entrinnen. Nachdem die Seitenstiche gänzlich abgeklungen waren, hatte sie auch wieder einen Blick für das vertraute Bild, das ihr die Stadt Byron und ihre Umgebung an einem nebligen Winternachmittag boten.
Alle Bauten und Straßen von Byron hatten einen Namen, der irgendwie mit dem Werk des Dichterfürsten zusammenhing; so hieß Drusillas Haus Missalonghi nach dem Ort, wo Lord Byron allzufrüh seine Seele ausgehaucht hatte. Diese bizarre Namensgebung war eine Tat des Ersten Sir William Hurlingford, Missys Urgroßvater, welcher die Stadt gegründet hatte, und zwar kurz nach der Lektüre von childe haroldii. Er war damals so begeistert, ganz selbständig ein Werk der Weltliteratur entdeckt und sogar verstanden zu haben, daß er fortan jeden, den er kannte, dazu nötigte, vollkommen unverdauliche Mengen Byron zu verschlingen. Und so entstanden auch die Namen: Missalonghi lag an der Gordon Road, die Gordon Road mündete in die Noel Street und die Noel Street in die Byron Street, die natürlich die Hauptstraße war; auf der besseren Seite der Stadt schlängelte sich die George Street einige Meilen lang dahin, bis sie über den Rand des gewaltigen Jamieson-Tales abwärts führte. Es gab sogar eine kleine Sackgasse namens Caroline Lamb Place (natürlich auf der falschen Seite der Eisenbahnlinie, wie übrigens auch Missalonghi); hier wohnte etwa ein Dutzend sehr auffallender Dämchen in drei Häusern, deren zahlreiche männliche Besucher aus dem Villenviertel, zum größeren Teil aber aus dem großen Mineralwasserabfüllbetrieb kamen, der den Südrand der Stadt verunzierte.
Es gehörte zu den rätselhafteren, aber interessanten Charakterzügen des Ersten Sir William, daß er seine Nachkommen noch auf dem Sterbebett verpflichtete, der Natur nicht ins Handwerk zu pfuschen und die Funktion des Caroline Lamb Place in keiner Weise zu verändern; infolgedessen war und blieb dies ein entschieden zwielichtiger Ort, und nicht nur aufgrund der Kastanien, die ihn beschatteten. Auch sonst war der Erste Sir William seinem Drang gefolgt, »jedem Ding einen ordentlichen Namen zu geben«, und hatte alle seine Töchter auf altrömische Namen taufen lassen, weil diese gerade in der höheren Gesellschaft Mode waren. Seine Nachfahren setzten die Tradition fort, und so gab es Julias, Aurelias, Antonias und Augustas; nur ein Zweig der Familie hatte nach der Ankunft des fünften Sohnes das System zu verbessern gesucht, indem sie die Söhne fortan römisch numerierten. Der Hurlingford-Stammbaum konnte sich im Lauf der Zeit eines Quintus, eines Sextus, eines Septimus, eines Octavius und eines Nonius rühmen … Nur Decius kam tot zur Welt, was ihm keiner verdenken konnte.
Oh – wie hübsch! Missy hielt in ihrem Gang inne, um ein großes radförmiges Spinnennetz zu bewundern, das sich, über und über von Nebeltröpfchen beperlt, vor der Baumkulisse auf der anderen Seite der Gordon Road befand. In der Mitte saß eine sehr dicke Spinne, um die ein viel kleinerer ›Freier‹ in eindeutiger Absicht herumkletterte. Missy verspürte weder Furcht noch Ekel, sondern nur etwas Neid. Dieses glückliche Geschöpf war nicht nur mit sich und seiner selbsterbauten Welt im Lot; es schwenkte sozusagen das Urbanner der Frauenbefreiung, indem es das mickrige Männchen einfach benutzte und dann verspeiste, sobald es seinen Zweck erfüllt hatte. O du glückliche, glückliche Spinnenfrau! Wenn einer ihr Weltwerk zerstörte, baute sie sich unverdrossen ein neues, und dank ihrer angeborenen Geschicklichkeit wieder so schön, so ätherisch, daß seine Vergänglichkeit gar nichts zur Sache tat. Und wieder saß sie wie eine Muttergöttin, von unerheblichen Männchen umbuhlt, im Mittelpunkt ihres Weltalls …
Himmel, die Zeit! Missy setzte sich abermals in Trab, bog in die Byron Street ein und hielt auf die Reihe von Geschäften zu, die einen Block im Zentrum der Stadt bildeten, kurz bevor die Straße sich grandios verbreiterte und mit dem Park, dem Bahnhof, dem marmorverkleideten Hotel und der imposanten ›ägyptischen‹ Fassade der Byron-Thermalbäder aufwartete.
Im Geschäftsbereich gab es den Material- und Produktenladen, Besitzer: Maxwell Hurlingford; die Eisenwarenhandlung, Besitzer: Denys Hurlingford; den Hutsalon ›CHEZ ALICIA‹, Besitzerin: Aurelia Marshall, geborene Hurlingford; die Schmiede (seit neuestem auch mit einer Benzinpumpe ausgestattet!), Besitzer: Thomas Hurlingford; die Großbäckerei, Besitzer: Walter Hurlingford; das Bekleidungs- und Textilienkaufhaus, Besitzer: Herbert Hurlingford; den Zeitungs- und Schreibwarenladen, Besitzer: Septimus Hurlingford; den Tea-Room ›Trauerweide‹, Besitzerin: Julia Hurlingford; die Leihbücherei, Besitzerin: Livilla Hurlingford; die Metzgerei, Besitzer: Robert Hurlingford-Witherspoon; den Süßwaren- und Tabakladen, Besitzer: Percival Hurlingford; und das Cafe ›Olymp‹, Besitzer: – erstaunlicherweise ein gewisser Nikos Theodoropoulos.
Wie es sich angesichts ihrer Wichtigkeit gehörte, war die Byron Street auf der ganzen Strecke zwischen Noel Street und Caroline Lamb Place asphaltiert. An hervorragender Stelle erinnerte eine Pferdetränke aus prunkvoll poliertem Granit an den edlen Stifter und Gründer, den Ersten Sir William, desgleichen eine Reihe von soliden Anpflockpfählen unter den Markisen der Geschäfte. Zu beiden Seiten der Allee standen wunderschöne alte Gummibäume, und das Ganze machte einen friedlichen und wohlhabenden Eindruck.
Es gab nur wenige Privatwohnungen im Zentrum von Byron. Die Bürgerschaft profitierte reichlich von den Sommerfrischlern, die in den heißen Monaten der drückenden Schwüle der Küstenniederung entfliehen wollten, und von den Kurgästen, die das ganze Jahr hindurch kamen, um ihre rheumatischen Leiden in den heißen Mineralquellen zu lindern, die ein geologischer Tüftler vor einigen Jahrzehnten unter dem Stadtgebiet entdeckt hatte. Darum war die Byron Street in ihrer ganzen Länge von Gästehäusern und Fremdenpensionen gesäumt – die meisten natürlich im Besitz von Hurlingfords. Was die Gäste betraf, so fanden diejenigen, die nicht gerade auf den Penny schauen mußten, jeden wünschbaren Komfort; das weiträumige und elegante Kurhotel bot sogar Privatbäder, die ausschließlich dem Gebrauch der eigenen Hausgäste Vorbehalten waren. Für die anderen, deren Mittel nur zu einem billigeren Logis, eventuell mit Halbpension, ausreichten, standen die allgemeinen Heilbäder von Byron zur Verfügung, die etwas spartanisch, aber sauber waren und sich nur ein Stückchen weiter in der Noel Street befanden.
Und auch wer es sich gar nicht leisten konnte, nach Byron zu kommen, brauchte auf eine belebende Trinkkur nicht zu verzichten. Der Zweite Sir William hatte die byron bottle erfunden; als solche war sie in ganz Australien und im Südpazifik bekannt: eine künstlerisch stilisierte, kristallklare Flasche, die eine Pinteiii reinen Byron-Quellwassers enthielt. Ärztlich beglaubigte Eigenschaften: nervenstärkend, mild, aber nie auf schädliche Art abführend und von entschiedenem Wohlgeschmack. »Vichy-Wasser ist nichts dagegen!« sagten die Weltenbummler unter den Gästen, die schon das Glück gehabt hatten, Frankreich zu bereisen. Die gute alte byron bottle war nicht nur besser, sondern auch wesentlich billiger. Und für jede leere bekam man ein Flaschenpfand zurück. Kluge Aktienkäufe bei den australischen Glaswerken hatten der extrem billigen, aber bemerkenswert einträglichen heimischen Industrie die letzten Glanzlichter aufgesetzt, und da sie weiterhin blühte und gedieh, brachte sie allen männlichen Nachkommen des Zweiten Sir William enorme Summen ein. Der Dritte Sir William, Enkel des Ersten und Sohn des Zweiten, war der gegenwärtige Beherrscher des Mineralwasserimperiums, mit all der Rücksichtslosigkeit und Raffgier seiner gleichnamigen Vorgänger.
Maxwell Hurlingford, der in direkter Linie von dem Ersten Sir William abstammte und schon deshalb ein schwerreicher Mann war, hatte es gar nicht nötig, einen großen Produktenhandel zu führen und sich noch selbst in den Laden zu stellen. Indessen waren Gewinnsucht und Geiz in den meisten Hurlingfords nie totzukriegen, dazu kamen noch die alten calvinistischen Lebensregeln, die der Clan von jeher befolgte: Ein Mann hat ohn’ Unterlaß zu arbeiten, um Gnade vor den Augen des Herrn zu finden. Laut dieser Devise hätte Maxwell Hurlingford eigentlich ein Heiliger auf Erden sein müssen; doch leider hatte er es bisher nur zu einer Mischung aus Geizkragen und Haustyrann gebracht.
Als Missy den Laden betrat, unterstrich das mißtönende Scheppern einer Glocke die ganze Atmosphäre, die der asketische, aber geschäftstüchtige Besitzer um sich verbreitete. Er tauchte denn auch sofort aus den düsteren Regionen im Hintergrund auf, wo die Jutesäcke mit allen möglichen Getreidesorten und Futtermitteln lagerten, denn Maxwell versorgte nicht nur die Gastronomie und die Bevölkerung von Byron mit Lebensmitteln, sondern auch deren Pferde, Kühe, Schweine, Schafe und Kleinvieh. Ein lokaler Witzbold hatte das Wort geprägt, daß Maxwell Hurlingfords Weizen am schönsten blühe, wenn allen andern die Ernte verhagelt sei.
Jetzt blickte er Missy mit seinem gewohnten griesgrämigen Ausdruck entgegen und zeigte ihr eine große Futterschaufel, von deren Inhalt ein staubiges Gespinst herunterhing.
»Sieh dir das an!« knurrte er (in diesem Moment war er seiner Schwester Octavia unheimlich ähnlich). »Wieder mal die Motten drin! Und überall Mehlkäfer!«
»Ach je! Auch in den losen Haferflocken?«
»In allem.«
»Dann nehm’ ich diesmal wohl besser eine Packung richtige Frühstücksflocken. Die sind doch sicher in Ordnung.«
»Nur gut, daß Pferde nicht so heikel sind«, murrte er, warf die Schaufel in den Vorratsraum und quetschte sich hinter den Ladentisch.
Kaum hatte er die Markenpackung von einem Regal geholt, als die Klingel wieder schrillte, diesmal besonders durchdringend, denn die Tür flog auf, und ein Mann kam herein, der außer einem Schwall frostiger Nebelluft eine überwältigende Ausstrahlung von Zielstrebigkeit und Energie mitbrachte.
»Donnerwetter noch einmal, draußen friert man sich den Arsch ab!« verkündete der Neuankömmling und klatschte geräuschvoll die Hände aneinander.
»Sir!« verwahrte sich Maxwell. »Nicht vor den damen!«
»Huch!« machte der Fremde, was nicht gerade nach einer angemessenen Entschuldigung klang. Statt dessen lehnte er sich an den Tresen und grinste Missy, die mit offenem Mund dastand, verschmitzt an. »Damen, auch noch in der Mehrzahl? Ich sehe hier höchstens ’ne halbe!«
Weder für Missy noch für Onkel Maxwell war es ganz klar, ob diese Bemerkung sich lediglich auf ihre schmächtigen Körpermaße in einer von Riesen bewohnten Stadt bezog oder ob er sie absichtlich mit der Anspielung beleidigte, er halte sie nicht für eine wirkliche Dame. Und bevor Onkel Maxwell eine seiner berühmt scharfen Antworten gefunden hatte, zog der Fremde schon seelenruhig einen langen Einkaufszettel hervor.
»Ich brauche sechs Sack Haferkleie, einen Sack Mehl, einen Sack Zucker, eine Schachtel Zwölfer-Patronen, eine Speckseite, sechs Dosen Backpulver, zehn Pfund Dosenbutter, zehn Pfund Rosinen, ein Dutzend Büchsen mit hellem Sirup, sechs Töpfe Pflaumenmus und eine Zehnpfunddose Arnott’s gemischte Biskuits.«
»Es ist fünf Minuten vor fünf«, erklärte Onkel Maxwell steif, »und ich pflege um Punkt fünf zu schließen.«
»Dann beeilen Sie sich gefälligst!« erwiderte der Fremdling ungerührt.
Missys Haferflockenpackung stand noch auf dem Tresen. Sie fummelte ihr Sixpence-Stück aus dem Handschuh und reichte es Onkel Maxwell, der es geistesabwesend nahm, ohne daran zu denken, ihr etwas herauszugeben. Sie wartete ein Weilchen vergebens auf das fällige Kleingeld, fand aber nicht den Mut zu der Frage, ob ein Grundnahrungsmittel wirklich soviel kosten könne, auch wenn es noch so nett eingepackt sei. Schließlich nahm sie die Schachtel an sich und verließ den Laden, nicht ohne noch einen verstohlenen Blick auf den Fremden geworfen zu haben.
Draußen stand ein mit zwei Pferden bespannter Wagen, der ihm gehören mußte, denn vorhin war er noch nicht dagewesen. Eine solide, praktische, offenbar neue Equipage, denn die Radspeichen glänzten noch kräftig gelb gegen den dunkel lackierten Wagenkasten, und die Pferde sahen gesund und wohlgenährt aus und schienen nicht nur leistungsfähig, sondern auch ziemlich lebhaft zu sein.
Drei Minuten vor fünf. Wenn sie die Reihenfolge ihres Auftretens in Onkel Maxwells Laden umdrehte, konnte sie ihre Verspätung auf die lange Bestellung des Fremden und seine Grobheit schieben – und so noch ein paar Minuten für die Bücherei herausschlagen.
Byron besaß keine öffentliche Stadtbibliothek; dies war in Australien selbst in größeren Städten zu jener Zeit eine Seltenheit. Aber hier füllte seit einigen Jahren eine private Leihbücherei die Lücke aus. Livilla Hurlingford, eine Witwe mit einem sehr ›teuren‹ Sohn, war von ihrer chronischen Geldnot, verbunden mit der Notwendigkeit, stets ›achtbar‹ zu bleiben, auf den Gedanken gebracht worden, die wohlbestückte Bibliothek ihres Hauses zu ergänzen und den Bürgern gegen mäßige Leihgebühren zu eröffnen. Die neue Einrichtung hatte sich bald durchgesetzt, und da der allgemeine Geschäftsschluß in Byron um fünf Uhr nachmittags war und viele Leser erst dann kommen konnten, hatte Tante Livilla ihre Hauptgeschäftszeit auf die späteren Nachmittags- und Abendstunden verlegt.
Bücher waren Missys einziger Trost und Halt. Sie durfte einen kleinen Teil des Geldes behalten, das sie beim Verkauf von Missalonghis Butter und Eiern erzielte, und dieses kärgliche Taschengeld gab sie stets bis zum letzten Penny für Leihgebühren in Tante Livillas Bibliothek aus. Sowohl ihre Mutter als auch (besonders) Tante Octavia mißbilligten ihre Lesewut, denn Missy hätte ihrer Meinung nach lieber »ein bißchen was auf die hohe Kante legen« sollen (bekanntlich hatte ihr Vater ihr nur fünfzig Pfund hinterlassen); andererseits waren sie zu fair, um eine einmal gegebene Erlaubnis zurückzuziehen, nur weil Missy sich in diesem einen Punkt als Verschwenderin erwies.
Vorausgesetzt, Missy erfüllte die ihr übertragenen Pflichten in Haus, Stall und Garten – davon wurde nicht um Haaresbreite abgewichen –, durfte sie also lesen, während ihr strengstens untersagt wurde, etwa allein im Busch spazierenzugehen; auch dies war einer der seltsamen Wünsche, die sie manchmal äußerte. Durch den Busch zu gehen hieß, sich leichtfertig den schrecklichsten Gefahren auszusetzen, jeder Art Gewalttat bis zum Mord, und war einem schutzlosen Mädchen, auch wenn es schon über dreißig war, unter keinen Umständen zu gestatten. Aus ähnlichen Gründen hatte Drusilla ihrer Cousine Livilla anbefohlen, Missy nur gute Bücher zu verabreichen, nicht etwa Romane oder skandalöse Biographien, überhaupt nichts, was auf bedenkliche Weise mit dem anderen Geschlecht zu tun hatte. Und Tante Livilla befolgte diese Anweisung gewissenhaft, da sie dieselben Ansichten darüber hatte, was unverheiratete Damen lesen sollten bzw. dürften.
Aber seit etwa einem Monat hegte Missy ein sündiges Geheimnis: sie bekam und las die herrlichsten Romane. Tante Livilla hatte nämlich eine Assistentin eingestellt, die montags, dienstags und samstags die Bibliothek übernahm und es der älteren Dame ermöglichte, sich volle vier Tage hintereinander von den Mäkeleien ihrer Stammkunden und der Badegäste zu erholen, die entweder schon alles gelesen hatten oder deren Extrawünsche sie nicht erfüllen konnte. Natürlich war die neue Helferin auch eine Hurlingford, allerdings nicht aus Byron, sondern der Sproß einer Seitenlinie aus Sydney.
Und ausgerechnet diese Dame von Welt – ihr Vorname war Una – hatte die schüchterne und gehemmte Missy Wright, von der sonst kaum jemand Notiz nahm, auf den ersten Blick ins Herz geschlossen, als hätte sie sofort erkannt, daß diese das Zeug zu einer aufrichtigen Freundin hatte. Sie hatte Missy auch gleich in erstaunlichem Maße ausgeforscht; sie kannte Missys Tageslauf, Familienumstände, Aussichten (keine), Kümmernisse und Träume. Hierauf hatte sie ein narrensicheres System ausgearbeitet, um Missy in den Genuß verbotener Früchte‹ zu bringen, ohne daß Tante Livilla es merkte, und Missy mit entsprechendem Lesestoff versorgt – vom tollsten Abenteuerroman bis zur rührendsten Liebesgeschichte.
Heute, Freitag nachmittag, würde nun leider Tante Livilla im Dienst sein, so daß Missy sich wieder etwas ›Bildendes‹ ausleihen mußte … Aber, o Wunder, als sie die Glastür öffnete und das mollig warme Bücherzimmer betrat, saß da Una am Pult, und von der gefürchteten Tante war keine Spur zu sehen!
Was Missy an Una so anzog, war außer ihrer sprudelnden Lebhaftigkeit und ihrem freundlichen Verständnis nicht zuletzt ihr hinreißendes Aussehen. Ihre Größe kennzeichnete sie zwar als eine echte Hurlingford, aber ihre Figur war viel besser, da schlanker, als die der bisher bewunderten Familienschönheit Alicia, und an Eleganz stand sie ihr ebenfalls in nichts nach. Hellhäutig und hellhaarig wie die Schneekönigin in Andersens Märchen, brachte sie es dennoch fertig, weder fahl noch fad auszusehen, wie es das Schicksal aller Hurlingford-Damen war (mit Ausnahme von Alicia, welcher Gott wenigstens, als sie heranwuchs, dunkle Brauen und Wimpern gegeben hatte, und Missys, die sowieso dunkel war). Was Una allen voraushatte, war ein seltsames inneres Leuchten, das ihr eigen war und oft aus ihren gletscherkühlen Augen zu strahlen schien – wenn sie nicht gerade mutwillig funkelten –, es schimmerte aus ihren langen, ovalen, wohlgepflegten Nägeln und aus ihrem Haar, das sie entzückend nach der letzten Mode in duftigen Löckchen hochfrisiert trug und das in Scheitelhöhe in einen silberblond glitzernden Knoten auslief … Die Luft um sie her schien vor Lebendigkeit zu vibrieren – faszinierend! Der lebenslange Umgang mit niemand anderem als den hiesigen Hurlingfords hatte Missy in Unkenntnis darüber gelassen, daß es tatsächlich Menschen mit einer gewissen ›Ausstrahlung‹ gab, und nun war sie innerhalb eines Monats gleich zweien begegnet: erst Una und vor knapp 10 Minuten dem groben Fremdling in Onkel Maxwells Laden, der vor Energie blaue Funken zu sprühen schien…