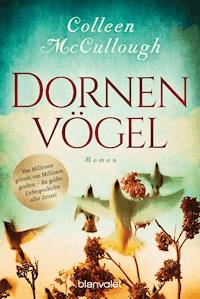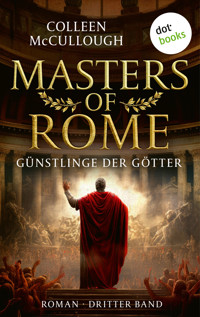
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Masters of Rome
- Sprache: Deutsch
Er wird zum mächtigsten Mann der römischen Geschichte – dies ist sein Anfang. 83 v. Chr.: Ihre Vorfahren erhoben den kleinen Stadtstaat Rom zum strahlenden Mittelpunkt eines mächtigen Weltreichs. Nun sehen der junge Julius Caesar und sein Kumpane Pompeius einer glänzenden Zukunft entgegen – sie müssen sich nur noch beweisen. Während die Diktatur des Sulla und die brutalen Machtkämpfe der Adelsfamilien Rom von innen heraus erschüttern, sucht Pompeius auf dem Schlachtfeld seinen Weg zur Konsulwürde. Derweil ist der kluge und ehrgeizige Julius gefangen im Amt des Priesters, das sein eifersüchtiger Onkel Sulla ihm auferlegte, um seinen unvermeidlichen Aufstieg zu verhindern … Band 3 der glorreichen historischen Saga »Masters of Rome« für Fans von Robert Harris und Simon Scarrow.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 873
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
83 v. Chr.: Ihre Vorfahren erhoben den kleinen Stadtstaat Rom zum strahlenden Mittelpunkt eines mächtigen Weltreichs. Nun sehen der junge Julius Caesar und sein Kumpane Pompeius einer glänzenden Zukunft entgegen – sie müssen sich nur noch beweisen. Während die Diktatur des Sulla und die brutalen Machtkämpfe der Adelsfamilien Rom von innen heraus erschüttern, sucht Pompeius auf dem Schlachtfeld seinen Weg zur Konsulwürde. Derweil ist der kluge und ehrgeizige Julius gefangen im Amt des Priesters, das sein eifersüchtiger Onkel Sulla ihm auferlegte, um seinen unvermeidlichen Aufstieg zu verhindern …
Über die Autorin:
Colleen McCullough (1937-2015) wurde in Wellington geboren und wuchs in Sydney auf. Nach einem Studium der Neurologie arbeitete sie in verschiedenen Krankenhäusern in Australien und England, bevor sie einige Jahre nach Amerika ging, um an der Yale University zu forschen und zu lehren. Hier entdeckte sie auch ihre Liebe zum Schreiben, wobei ihre ersten beiden Romane direkt zu internationalen Bestsellern aufstiegen.
Colleen McCullough veröffentlichte bei dotbooks Ihre Romane »Die Frauen von Missalonghi« und »Die Stadt der Hoffnung«. Außerdem erschien von der Autorin das mitreißende Historienepos »Masters of Rome« mit den Einzeltiteln »Adler des Imperiums«, »Die Krone der Republik«, »Günstlinge der Götter«, »Das Blut des Spartacus«, »Caesars Frauen«, »Tochter des Adlers« und »Die Wasser des Rubikon«.
***
eBook-Neuausgabe März 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »Fortune’s Favorites« bei William Morrow & Co., New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Günstlinge der Götter – Band 1: Die Weggefährten« bei Bertelsmann
Copyright © der englischen Originalausgabe 1993 bei Colleen McCullough
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 bei C. Bertelsmann Verlag GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/Mr. Bolota, javier
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-535-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Colleen McCullough
Günstlinge der Götter
Masters of Rome 3
Aus dem Englischen von Helmut Dierlamm, Enrico Heinemann und Reinhard Tiffert
dotbooks.
TEIL EINS
April 83 v. Chr.bis Dezember 82 v. Chr.
Kapitel 1
Der Verwalter hielt die Öllampe mit den fünf brennenden Dochten empor, bis sie die beiden Schlafenden auf dem Bett erleuchtete, aber er wußte, daß das Licht nicht hell genug war, um Pompeius zu wecken. Dazu brauchte er dessen Frau.
»Domina!«
Verwirrt schlug Antistia die Augen auf – es war nicht üblich, daß Diener Pompeius’ Schlafzimmer betraten. Sie vergewisserte sich, daß das Laken ihren Körper züchtig bedeckte, dann setzte sie sich auf.
»Was gibt es? Was ist denn los?«
»Eine dringende Nachricht für den Herrn«, sagte der Verwalter grob. »Weckt ihn und sagt ihm, er solle ins Atrium kommen!« Die Flammen seiner Lampe flackerten und rauchten, als er auf dem Absatz kehrtmachte. Die Tür schloß sich, und Antistia blieb im Dunkeln zurück.
Dieser schreckliche Mensch! Das hatte er absichtlich getan! Zum Glück wußte sie noch, daß ihr Unterkleid am Fußende des Bettes lag. Sie zog es an und rief laut nach Licht.
Pompeius störte das alles nicht. Als Antistia mit einer Lampe in der Hand und eingewickelt in eine warme Decke wieder an das Bett trat, schlief er noch immer. Nicht einmal die Kälte schien er zu spüren, obwohl er bis zur Hüfte nackt dalag.
Bei anderen Gelegenheiten – und aus anderen Gründen – hatte Antistia versucht, ihn wachzuküssen, doch stets vergeblich. Pompeius mußte gerüttelt und geschüttelt werden.
»Was ist denn?« fragte er, setzte sich auf und fuhr mit den Händen durch sein dichtes gelbes Haar. Die Stirnlocke über dem hohen Haaransatz stand keck nach oben, seine blauen Augen musterten Antistia aufmerksam. So war Pompeius: im einen Augenblick wie tot, im nächsten hellwach – ein typischer Soldat. »Was ist los?« fragte er nochmals.
»Im Atrium wartet ein Bote mit einer wichtigen Nachricht auf dich.«
Antistia hatte ihren Satz noch nicht beendet, als Pompeius schon aufgesprungen und in Pantoffeln und Tunika geschlüpft war, ohne darauf zu achten, daß ein Ärmel der Tunika ihm über die sommersprossige Schulter rutschte.
Antistia blieb einen Augenblick unentschlossen stehen. Pompeius hatte den Leuchter nicht mitgenommen – er sah im Dunkeln wie eine Katze –, nichts hinderte sie also, ihm zu folgen. Zwar wußte sie, daß er darüber kaum erfreut sein würde, aber Frauen hatten schließlich ein Anrecht darauf, zu erfahren, was so wichtig war, daß ihre Männer geweckt werden mußten! Also tastete Antistia sich mit ihrer kleinen Lampe durch die Dunkelheit des großen Korridors entlang. Sie bog um eine Ecke und stieg eine Treppe hinunter, und schon war sie der furchteinflößenden gallischen Festung entronnen und befand sich in einer zivilisierten römischen Villa, inmitten freundlicher Farben und schön verputzter Wände.
Diener eilten geschäftig hin und her und hatten überall helle Lichter angezündet. Und da war auch Pompeius. Obgleich nur mit einer Tunika bekleidet, sah er aus wie Mars persönlich. Eine herrliche Gestalt!
Auch er hatte sie bemerkt und hätte ihre Frage vielleicht sogar beantwortet, wäre in diesem Augenblick nicht sichtlich verstört Varro eingetreten. Damit war Antistias Gelegenheit vorüber, von Pompeius zu erfahren, was die ganze Aufregung bedeutete.
»Varro!« rief Pompeius. »Varro!« Er stieß einen Schrei aus, markerschütternd und schauerlich und ganz und gar unrömisch. Genau so hatten einst die Gallier geschrien, als sie über die Alpen geströmt waren und weite Teile Italiens erobert hatten, darunter Picenum, wo Pompeius herstammte.
Antistia zuckte zusammen. Sie sah, daß auch Varro erschrak.
»Was gibt es?«
»Sulla ist in Brundisium gelandet!«
»Brundisium! Woher weißt du das?«
»Das spielt keine Rolle!« Pompeius packte den kleinen Varro bei den Schultern und schüttelte ihn. »Endlich, Varro! Das Abenteuer hat begonnen.«
»Abenteuer?« Varro starrte ihn an. »So werde doch endlich erwachsen, Magnus! Das hier ist kein Abenteuer, sondern ein Bürgerkrieg, und zwar schon wieder auf italischem Boden!«
»Das ist mir egal!« rief Pompeius wild. »Für mich ist es ein Abenteuer. Wenn du wüßtest, wie sehr ich auf diese Nachricht gewartet habe, Varro! Seit Sullas Abreise ist Italien so zahm wie der Schoßhund einer vestalischen Jungfrau.«
»Und die Belagerung Roms?« Varro unterdrückte ein Gähnen.
Die Begeisterung auf Pompeius’ Gesicht erlosch. Er ließ die Hände sinken, trat einen Schritt zurück und sah Varro finster an. »Davon möchte ich lieber nicht sprechen«, sagte er barsch. »Sie haben den nackten Leichnam meines Vaters an einen Esel gebunden und durch die Straßen geschleift!«
Dem armen Varro schoß das Blut in den fast kahlen Schädel. »Bitte verzeih mir, Magnus! Ich wollte nicht ... ich meine, ich würde nie ... ich bin dein Gast, verzeih mir!«
Doch Pompeius lachte bereits wieder und klopfte Varro auf den Rücken. »Es war ja nicht deine Schuld, ich weiß!«
In dem großen Zimmer war es eiskalt; Varro verschränkte frierend die Arme auf der Brust. »Ich breche besser sofort nach Rom auf.«
Pompeius starrte ihn erstaunt an. »Rom? Du gehst nicht nach Rom, du kommst mit mir! Was erwartet dich in Rom? Eine Herde meckernder Schafe und im Senat ein Haufen ständig zankender alter Weiber. Komm mit mir, das ist viel lustiger!«
»Wohin willst du?«
»Ich schließe mich natürlich Sulla an.«
»Dazu brauchst du mich nicht, Magnus. Steige auf dein Pferd und reite los. Ich bin überzeugt, Sulla findet unter seinen jüngeren Militärtribunen einen Platz für dich. Du hast viel Kampferfahrung.«
»Ach Varro!« Pompeius schlug verzweifelt die Hände zusammen. »Ich gehe doch nicht als Militärtribun zu Sulla! Ich bringe ihm drei weitere Legionen! Bin ich denn Sullas Lakai? Nie! Diesmal werde ich sein gleichberechtigter Partner sein.«
Unwillkürlich schnappte Antistia nach Luft und hätte beinahe laut aufgeschrien; dann zog sie sich rasch in eine Ecke des Zimmers zurück, wo ihr Mann sie nicht sehen konnte. Pompeius hatte ihre Anwesenheit schon wieder vergessen, und sie wollte, sie mußte einfach weiter zuhören.
In den zweieinhalb Jahren ihrer Ehe hatte Pompeius Antistias Seite nur einmal länger als einen Tag verlassen. Wie schön war es bisher gewesen, seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu genießen! Gekitzelt, gescholten, gezaust, gestreichelt, gebissen, heftig umarmt, hingeworfen ... traumhaft. Wer hätte gedacht, daß sie, Tochter eines Senators von bescheidenem Rang und Vermögen, jenen Gnaeus Pompeius heiraten würde, der sich selbst Magnus nannte, der Große. Reich genug, um jede zu heiraten, Herr über halb Umbria und Picenum und so gutaussehend, daß ihn alle für eine Reinkarnation Alexanders des Großen hielten – was für einen Mann hatte ihr Vater für sie gefunden! Dabei war sie schon fast verzweifelt gewesen, so klein war ihre Mitgift.
Natürlich wußte sie, warum Pompeius sie geheiratet hatte: Er hatte die Hilfe ihres Vaters gebraucht, der zufällig der für die Anklage gegen Pompeius zuständige Richter war. Die Anklage war natürlich frei erfunden gewesen, ganz Rom wußte das. Cinna hatte verzweifelt nach Geld gesucht, um Soldaten anzuwerben, und wollte deshalb das Vermögen des Pompeius an sich reißen. Dem jungen Pompeius wurden Dinge vorgeworfen, für die im Grunde sein Vater Pompeius Strabo verantwortlich war: daß er sich nach der Eroberung der Stadt Asculum Picentum widerrechtlich einen Teil der Beute angeeignet habe, namentlich ein Jagdnetz und einige Stapel Bücher. Kleinigkeiten also. Denn es ging nicht um das Ausmaß des Vergehens, sondern um die Strafe. Wurde Pompeius verurteilt, so war es den Cinna hörigen Geschworenen, die das Strafmaß bestimmten, völlig freigestellt, seinen gesamten Besitz zu pfänden.
Ein richtiger Römer hätte beschlossen, den Fall vor Gericht auszufechten und notfalls die Geschworenen zu bestechen. Nicht so Pompeius, dessen Gesicht den Gallier in ihm verriet. Er hatte es vorgezogen, die Tochter des Richters zu heiraten. Das war im Oktober gewesen, und im Verlauf der Monate November und Dezember hatte Antistias Vater sich als Meister der Untätigkeit erwiesen. Der Prozeß gegen seinen Schwiegersohn fand nie statt; er wurde hinausgezögert durch schlechte Omen, Vorwürfe der Bestechlichkeit gegenüber den Geschworenen, Senatsversammlungen und verschiedene andere Hindernisse. Schließlich überredete der Konsul Carbo Cinna im Januar, woanders nach dem so dringend benötigten Geld zu suchen. Pompeius’ Vermögen war nicht mehr in Gefahr.
Gerade achtzehn, war Antistia mit ihrer Aussteuer zu Pompeius’ Besitzungen im Nordosten der italischen Halbinsel gereist und hatte sich in den trutzigen schwarzen Mauern seiner Burg den bräutlichen Freuden hingegeben. Sie war ein hübsches Mädchen, reif für das eheliche Bett, und so war ihr Glück lange Zeit ungetrübt gewesen. Doch dann begann eine nagende Unruhe sie heimzusuchen. Schuld daran war nicht ihr Mann, den sie über alles bewunderte, sondern dessen Gefolge, Diener und andere, die Antistia verachteten und sie dies auch deutlich spüren ließen. Sie hatte das tapfer ertragen – solange Pompeius jeden Abend nach Hause kam. Doch nun wollte er in den Krieg ziehen, wollte Legionen ausheben und für Sulla kämpfen! Was sollte sie tun, wenn ihr geliebter Magnus sie nicht mehr vor den Beleidigungen seiner Leute schützen konnte?
Pompeius versuchte immer noch, Varro zu überreden, sich ebenfalls Sulla anzuschließen, doch der pedantische kleine Mann, der so altklug daherredete, obwohl er erst zwei Jahre im Senat war, wehrte ab.
»Wie viele Truppen hat Sulla denn?« fragte er.
»Fünf Veteranenlegionen, sechstausend Reiter, einige Freiwillige aus Mazedonien und dem Peloponnes und fünf Kohorten Spanier, die dem dreckigen Schwindler Marcus Crassus gehören. Insgesamt etwa neununddreißigtausend Mann.«
Varro rang die Hände. »Ich sage es nochmals, Magnus, werde erwachsen! Ich komme soeben aus Ariminum, wo sich Carbo mit acht Legionen und einer riesigen Reiterei aufhält – und das ist erst der Anfang! Allein in der Campania befinden sich sechzehn weitere Legionen! Drei Jahre lang haben Cinna und Carbo Truppen ausgehoben, und jetzt stehen in Italien und dem italischen Gallien hundertfünfzigtausend Soldaten unter Waffen. Mit ihnen kann Sulla es nicht aufnehmen!«
»Sulla wird sie schlagen«, erwiderte Pompeius ungerührt. »Schließlich bringe ich ihm drei Legionen der kampferprobten Veteranen meines Vaters. Carbos Soldaten sind blutige Anfänger.«
»Du willst tatsächlich ein eigenes Heer aufstellen?«
»Ja.«
»Aber du bist erst zweiundzwanzig, Magnus. Du kannst nicht erwarten, daß die Veteranen deines Vaters in deine Dienste treten!«
»Warum nicht?« Pompeius war ehrlich erstaunt.
»Du bist noch acht Jahre zu jung, um dich für den Senat zu qualifizieren, und Konsul kannst du erst in zwanzig Jahren werden. Selbst wenn die Soldaten deines Vaters in deine Dienste treten würden, es wäre absolut ungesetzlich, sie darum zu bitten. Du bist ein einfacher Bürger, und Bürger heben keine Heere aus.«
»Die Regierung Roms ist seit drei Jahren ungesetzlich«, gab Pompeius zurück. »Cinna war viermal Konsul, Carbo zweimal, Marcus Gratidianus war zweimal Stadtprätor. Fast die Hälfte des Senats wurde geächtet, Appius Claudius wurde verbannt, obwohl er ein gültiges Statthalteramt hatte, und Fimbria trifft in Kleinasien Vereinbarungen mit König Mithridates – das ist doch alles ein Witz!«
Varro brachte es fertig, wie ein gekränktes Maultier dreinzuschauen, was für einen Sabiner der Rosea Rura nicht sonderlich schwierig war, denn Maultiere gab es dort reichlich. »Die Angelegenheit muß durch eine neue Verfassung gelöst werden«, sagte er.
Pompeius lachte laut heraus. »Ach Varro, du bist ein hoffnungsloser Phantast! Wenn diese Angelegenheit durch eine neue Verfassung gelöst werden könnte, würden dann hundertfünfzigtausend Soldaten in Italien und im italischen Gallien stehen?«
Wieder rang Varro die Hände, doch dann gab er sich geschlagen. »Also gut, ich komme mit.«
Pompeius strahlte, legte den Arm überschwenglich um Varros Schultern und schob ihn in Richtung des Korridors, der zu seinen Gemächern führte. »Wunderbar!« rief er. »Du wirst die Geschichte meiner ersten Feldzüge schreiben; schließlich hast du einen besseren Stil als dein Freund Sisenna. Ich bin der bedeutendste Mann unserer Zeit und verdiene es, einen eigenen Geschichtsschreiber an meiner Seite zu haben.«
Doch Varro behielt das letzte Wort. »Der bedeutendste Mann, in der Tat! Deshalb nennst du dich wohl auch Magnus? Ich bin beeindruckt!« Er schnaubte. »Der Große! Mit zweiundzwanzig Jahren! Dein Vater konnte sich lediglich nach seinen schielenden Augen nennen!«
Aber Pompeius hörte diese Spitze nicht mehr, denn er war vollauf damit beschäftigt, dem Verwalter und dem Waffenmeister eine Reihe von Befehlen zu erteilen.
Auf einmal war das Atrium wieder leer. Nur Pompeius stand noch da. Und Antistia. Er trat zu ihr.
»Du dummes kleines Kätzchen, du wirst dir eine Erkältung holen«, schalt er und küßte sie zärtlich. »Marsch ab ins Bett, mein Schatz.«
»Kann ich dir nicht beim Packen helfen?« Ihre Stimme hatte einen verzweifelten Unterton.
»Das tun meine Leute für mich. Aber du darfst zusehen.«
Ein Diener mit einem schweren Armleuchter ging ihnen voraus. An Pompeius geschmiegt und immer noch die kleine Lampe in der Hand, betrat Antistia die Kammer, in der sich die Rüstungen ihres Mannes befanden. Es war eine beeindruckende Sammlung. Nicht weniger als zehn Brustpanzer aus Gold, Silber, Stahl und Leder, an denen mit Riemen verschiedene Auszeichnungen befestigt waren, hingen an Stangen, und an Haken in der Wand waren Schwerter und Helme, Ledergürtel und wattierte Unterkleider aufgemacht.
»Bleib hier, Mäuschen, und sei schön artig!« Pompeius hob seine Frau wie eine Feder auf und setzte sie auf zwei aufeinandergestellte große Truhen, so daß ihre Beine in der Luft baumelten.
Dort vergaß er sie. Mit seinen Dienern ging er jeden einzelnen Gegenstand durch: Was war nützlich, was nötig? Als Pompeius alle Truhen der Kammer durchwühlt hatte, setzte er seine Frau achtlos auf einen anderen Platz, um auch noch die Truhen zu durchstöbern, auf denen sie gesessen hatte. Den wartenden Sklaven warf er dies und jenes zu, und er redete dabei so heiter mit sich selbst, daß Antistia jede Hoffnung verlor, er werde sie, das Haus oder das Leben als Zivilist vermissen. Natürlich hatte sie schon immer gewußt, daß er zuallererst Soldat war und die herkömmlichen Interessen anderer Männer seines Ranges wie Rhetorik, Rechtsgelehrsamkeit, Regierungsgeschäfte, Versammlungen und die Ränke und Intrigen der Politik nicht teilte und sogar verachtete. Wie oft hatte sie ihn sagen hören, er werde sich auf seinem Speer in den elfenbeinernen Amtsstuhl des Konsuls schwingen, nicht mit schönen Reden! Jetzt ging er also daran, seinen Vorsatz in die Tat umzusetzen. Er zog wie vor ihm sein Vater in den Krieg. Sobald der letzte Sklave vollbeladen davongewankt war, glitt Antistia von ihrer Truhe und stellte sich vor ihren Gatten hin.
»Bevor du gehst, muß ich mit dir reden, Magnus.«
Es war offensichtlich, daß Pompeius das als eine reine Zeitverschwendung ansah, doch er blieb stehen. »Was ist denn?«
»Wie lange wirst du fort sein?«
»Keine Ahnung«, erwiderte er fröhlich.
»Mehrere Monate? Ein Jahr?«
»Einige Monate vermutlich. Sulla wird Carbo schnell besiegen.«
»Dann möchte ich nach Rom zurückkehren und während deiner Abwesenheit im Haus meines Vaters wohnen.«
Pompeius schüttelte den Kopf. »Auf keinen Fall. Während ich mit Sulla gegen Carbo Krieg führe, spaziert meine Frau nicht in Carbos Rom herum. Du bleibst hier.«
»Deine Diener und alle anderen Leute hier mögen mich nicht. Ich werde es schwerhaben, wenn du nicht da bist.«
»Unsinn«, gab er zurück und wollte gehen.
Doch Antistia war entschlossen, sich nicht abwimmeln zu lassen. »Bitte, liebster Gatte, höre mir nur ein paar Minuten zu. Ich weiß, Zeit ist wertvoll, aber immerhin bin ich deine Frau.«
Pompeius seufzte. »Also gut, aber fasse dich kurz!«
»Ich kann unmöglich hier bleiben!«
»Doch, das kannst du.« Er trat von einem Fuß auf den andern.
»Sobald du fort bist, Magnus – und sei es auch nur für wenige Stunden –, behandeln deine Leute mich unfreundlich. Ich habe mich nie beklagt, weil du immer gut zu mir warst und mich bis auf das eine Mal, als du zu Cinna nach Ancona gingst, nie verlassen hast. Doch jetzt werde ich ganz allein sein, weil es in diesem Haushalt keine andere Frau gibt. Es wäre wirklich besser, wenn ich bis zum Ende des Krieges im Haus meines Vaters wohnen könnte.«
»Kommt nicht in Frage. Dein Vater steht auf Carbos Seite.«
»Nein. Er ist sein eigener Herr.«
Nie zuvor hatte sie sich ihm so energisch widersetzt oder ihm auch nur widersprochen. Pompeius reagierte gereizt. »Sieh mal, Antistia, ich habe Gescheiteres zu tun, als hier mit dir herumzustreiten. Du bist meine Frau, und du bleibst hier in meinem Haus.«
»Wo dein Verwalter mich verhöhnt und mich im Dunkeln sitzen läßt, wo ich keine eigenen Diener habe und niemanden, der mir Gesellschaft leistet.« Sie versuchte, ruhig und vernünftig zu klingen, doch allmählich geriet sie in Panik.
»Das ist doch völliger Unsinn!«
»Nein, Magnus. Ich weiß nicht, warum alle auf mich herabsehen, aber sie tun es.«
»Natürlich tun sie das!« Ihre Begriffsstutzigkeit ärgerte ihn.
Ihre Augen weiteten sich. »Natürlich? Wie meinst du das?«
Er zuckte die Achseln. »Meine Mutter war eine Lucilia. Meine Großmutter auch. Und du, was bist du?«
»Eine gute Frage. Was bin ich?«
Er merkte, daß sie aufgebracht war, und wurde gleichfalls wütend. Er schickte sich an, in seinen ersten großen Krieg zu ziehen, und diese unbedeutende Person erdreistete sich, ihm eine Szene zu machen. Hatten Frauen denn überhaupt keinen Verstand? »Du bist meine erste Frau«, sagte er.
»Deine erste Frau?«
»Noch.«
»Ach so.« Nachdenklich sah sie ihn an. »Du meinst, du hast nur die Tochter des Richters geheiratet.«
»Das hast du doch gewußt.«
»Aber es ist lange her. Ich dachte, du hättest mich in der Zwischenzeit liebgewonnen. Und ich komme aus einer Senatorenfamilie, unsere Heirat war durchaus standesgemäß.«
»Wenn du einen gewöhnlichen Mann geheiratet hättest, ja. Doch für mich bist du nicht gut genug.«
»Woher dieser Dünkel, Magnus? Hast du dich deshalb nie in mich ergossen? Weil ich nicht gut genug bin, deine Kinder zu gebären?«
»Ja«, schrie er und wollte das Zimmer verlassen.
Sie folgte ihm mit ihrer kleinen Lampe, so verärgert, daß sie sich nicht darum kümmerte, ob ihnen jemand zuhörte. »Ich war gut genug, um dir zu helfen, als Cinna hinter deinem Geld her war!«
»Darüber haben wir bereits gesprochen«, sagte er und ging schneller.
»Wie vorteilhaft für dich, daß Cinna tot ist!«
»Vorteilhaft für Rom und alle guten Römer.«
»Du hast Cinna umbringen lassen!«
Laut hallten ihre Worte durch den steinernen Korridor, der breit genug für eine ganze Armee war. Pompeius blieb abrupt stehen.
»Cinna starb während eines Saufgelages.«
»In Ancona – deiner Stadt, Magnus! Deiner Stadt! Kurz nachdem du ihn dort besucht hast!« schrie sie.
Einen Augenblick lang war es totenstill, dann fand sie sich plötzlich an die Wand gepreßt. Pompeius hatte die Hände um ihren Hals gelegt, jedoch ohne zuzudrücken.
»Das sagst du nicht noch einmal«, flüsterte er.
»Mein Vater sagt das«, würgte sie heraus. Ihre Kehle war trocken.
Der Griff um ihren Hals wurde fester. »Dein Vater mochte Cinna nicht. Aber gegen Carbo hat er nichts, weshalb es ein Vergnügen für mich wäre, ihn zu töten. Doch dich zu töten, wäre kein Vergnügen. Ich bringe keine Frauen um. Aber hüte deine Zunge, Antistia. Ich bin an Cinnas Tod nicht schuld; es war ein Unfall.«
»Ich will nach Rom zu meinen Eltern!«
Pompeius ließ sie los und gab ihr einen Stoß. »Die Antwort lautet nein. Und jetzt laß mich in Ruhe!«
Er rief nach dem Verwalter und verschwand. Antistia hörte, wie er dem widerwärtigen Menschen befahl, dafür zu sorgen, daß sie die nähere Umgebung der Burg nicht verließ, solange er im Krieg war. Zitternd ging Antistia ins Schlafzimmer zurück, das sie zweieinhalb Jahre lang mit Pompeius geteilt hatte. Als dessen erste Frau. Die nicht gut genug war, ihm Kinder zu gebären. Wie oft hatte sie sich gefragt, weshalb er sich, wenn sie sich liebten, stets vorzeitig zurückzog.
Antistia traten die Tränen in die Augen. Wenn sie jetzt anfing zu weinen, würde sie stundenlang nicht aufhören können. Die jähe Enttäuschung einer noch nicht erloschenen Liebe war schrecklich.
Wieder hörte sie in der Ferne einen markerschütternden barbarischen Schrei und dann Pompeius’ Stimme. »Auf in den Krieg! Sulla ist in Italien, es ist Krieg!«
Kapitel 2
Kurz nach Tagesanbruch führte Pompeius in glitzernder silberner Rüstung und begleitet von seinem achtzehnjährigen Bruder und Varro eine kleine Gruppe von Schreibern zum weiträumigen Marktplatz von Auximum. Er stellte die Standarte seines Vaters auf, auf der ein Specht abgebildet war, und wartete ungeduldig, bis die Schreiber sich hinter einigen auf Böcken ruhenden Tischen versammelt hatten und alle Schreibfedern gespitzt waren, Papier bereitlag und Tinte in schweren Steinbehältern aufgelöst war.
Inzwischen hatte sich auf dem Platz und den angrenzenden Straßen und Gassen eine große Menschenmenge versammelt. Behende sprang Pompeius auf ein behelfsmäßiges Podium unter der Standarte. »Wir sind am Ziel!« schrie er. »Lucius Cornelius Sulla ist in Brundisium gelandet und fordert, was ihm zusteht: ein Imperium, einen Triumph und das Privileg, seinen Lorbeer Jupiter Optimus Maximus auf dem Kapitol in Rom zu Füßen legen zu dürfen! Im vergangenen Jahr hat ein anderer Lucius Cornelius – der sogenannte Cinna – versucht, nicht weit von hier die Veteranen meines Vaters für sich zu gewinnen. Es gelang ihm nicht; er mußte sterben. Heute seht ihr mich vor euch stehen, und ich sehe viele Veteranen meines Vaters vor mir. Ich bin sein Erbe! Seine Leute sind auch meine. Seine Vergangenheit ist meine Zukunft. Ich ziehe nach Brundisium und kämpfe für Sulla, denn er ist im Recht. Wer von euch begleitet mich?«
Er drückt sich kurz und einfach aus, dachte Varro voller Bewunderung. Vielleicht hatte Pompeius recht, wenn er sich mit dem Speer und nicht mit schönen Reden auf den Elfenbeinstuhl des Konsuls schwingen wollte. Die Männer folgten seiner Rede begeistert. Er hatte kaum geendet, da redeten die Frauen bereits davon, daß ihre Männer und Söhne bald in den Krieg ziehen würden; einige rangen bei dem Gedanken verzweifelt die Hände. Andere gingen unverzüglich daran, Kleidersäcke mit Tuniken und Socken zu füllen, wieder andere blickten beflissen zu Boden, damit niemand sah, wie sie verschlagen lächelten. Die Männer schoben aufgeregte Kinder aus dem Weg und drängten sich um die Tische der Schreiber. Wenige Augenblicke später begannen diese eifrig zu schreiben.
Varro beobachtete den Trubel von seinem erhöhten Platz auf den Stufen des alten Picus-Tempels. Waren diese Männer einem Aufruf Pompeius Strabos genauso begeistert gefolgt? Nein. Strabo war unnahbar gewesen, ein strenger Führer, wenngleich ein ausgezeichneter Soldat. Sie hatten ihm gutwillig, aber ohne Begeisterung gedient. Bei seinem Sohn war das offensichtlich anders. Er ist ein Phänomen, dachte Varro. Die Myrmidonen hätten nicht fröhlicher für Achilles in den Kampf ziehen können, und auch nicht die Mazedonier für Alexander den Großen. Sie liebten ihn! Er war ihr Vorbild, ihr Glücksbringer, ihr Sohn und ihr Vater.
Eine massige Gestalt setzte sich auf die Stufen neben ihn, und als Varro den Kopf wandte, sah er ein rotes Gesicht und üppige rote Haare. Intelligente blaue Augen musterten ihn, den einzigen Fremden weit und breit.
»Wer bist du?« fragte der rote Riese.
»Ich heiße Marcus Terentius Varro und bin ein Sabiner.«
»Ein Sabiner wie wir? Na, das ist jedenfalls schon lange her.« Er deutete mit seiner schwieligen Hand auf Pompeius. »Sieh ihn dir an! Wie haben wir auf diesen Tag gewartet, Sabiner. Ist er nicht der Busenfreund der Götter?«
Varro lächelte. »Ich würde es zwar anders ausdrücken, aber ich weiß, was du meinst.«
»Ah! Du bist nicht nur ein Herr mit drei Namen, du bist auch noch gebildet. Wohl ein Freund von ihm?«
»Möglich.«
»Und was treibst du, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen?«
»In Rom bin ich Senator, in Reate züchte ich Stuten.«
»Stuten? Keine Maulesel?«
»Es ist einträglicher, Stuten zu züchten als ihre gemischte Nachkommenschaft. Ich besitze Land in der Rosea Rura und auch einige Zuchtesel.«
»Und wie alt bist du?«
»Zweiunddreißig.« Varro amüsierte sich königlich.
Plötzlich hörte der Riese auf zu fragen. Er legte sich so hin, daß er den Ellbogen auf die Stufe über ihm aufstützen konnte, dann streckte er seine langen Beine aus und kreuzte sie. Fasziniert sah der schmächtige Varro schmutzige Zehen, die fast so lang waren wie seine Finger.
»Und wie heißt du?« fragte er und fiel dabei unwillkürlich in die lokale Mundart.
»Quintus Scaptius.«
»Hast du dich anwerben lassen?«
»Alle Kriegselefanten Hannibals hätten mich nicht davon abhalten können.«
»Dann bist du ein Veteran?«
»Ich bin als Siebzehnjähriger in die Armee seines Vaters eingetreten. Das war vor acht Jahren, aber ich habe schon an zwölf Feldzügen teilgenommen, ich müßte also nicht mehr dienen, wenn ich nicht wollte.«
»Aber du willst?«
»Hannibals Elefanten, Marcus Terentius, Hannibals Elefanten!«
»Dann bist du wohl Zenturio?«
»Vielleicht in diesem Feldzug.«
Während sie sich unterhielten, blickten Varro und Scaptius unverwandt auf Pompeius, der vor einem der Tische stand und immer wieder Männer aus der Menge freudig begrüßte.
»Er sagt, er will noch diesen Monat losmarschieren«, sagte Varro, »aber das kann ich mir nicht vorstellen. Zugegeben, er hat erfahrene Soldaten, aber woher bekommt er Waffen und Rüstungen? Woher Lastesel, Wagen und Nahrungsmittel? Und woher das Geld, um alles zu finanzieren?«
Scaptius grunzte, offensichtlich amüsiert. »Darum braucht er sich nicht zu sorgen! Als der Krieg gegen die Italiker ausbrach, teilte sein Vater Waffen und Rüstungen an uns alle aus, und nach seinem Tod befahl der Junge uns, sie zu behalten. Jeder bekam einen Maulesel, und die Zenturionen erhielten Karren und Ochsen, damit wir bereit sein würden, wenn es wieder soweit war. Und in unseren Speichern lagern genug Weizen und andere Nahrungsmittel; unsere Frauen und Kinder werden also nicht verhungern.«
»Und das Geld?« fragte Varro leise.
»Geld?« Scaptius schnaubte verächtlich. »Wir haben seinem Vater gedient, ohne viel Geld zu bekommen. Früher gab es nicht viel Geld. Wenn er welches hat, wird er es uns geben. Wenn nicht, kommen wir auch ohne aus. Er ist ein guter Herr.«
»Ich weiß.«
Varro verfiel wieder in Schweigen und betrachtete Pompeius mit neuem Interesse. Die Unabhängigkeit Pompeius Strabos im Bundesgenossenkrieg war zur Legende geworden: Er hatte es verstanden, seine Legionen zusammenzuhalten, auch wenn ihm befohlen worden war, sie aufzulösen, und dadurch den Lauf der Ereignisse in Rom beeinflußt. Als Cinna nach dem Tod des Gaius Marius die Bücher der Schatzkammer durchgesehen hatte, hatte er festgestellt, daß keine größeren Beträge ausbezahlt worden waren. Jetzt wußte Varro auch, warum Pompeius Strabo gar nicht daran gedacht hatte, seine Truppen zu bezahlen. Warum auch, wenn sie ihm praktisch gehörten?
In diesem Augenblick verließ Pompeius seinen Platz vor dem Tisch und kam zu ihnen.
»Ich muß los, um einen Lagerplatz zu finden«, sagte er zu Varro. Dann grinste er den Herkules an Varros Seite breit an. »Wie ich sehe, bist du früh eingetroffen, Scaptius.«
Scaptius erhob sich schwerfällig. »Ja, Magnus. Ich gehe jetzt nach Hause und hole meine Rüstung.«
Alle nannten ihn also Magnus! Varro stand auf. »Ich komme mit dir, Magnus.«
Die Menge zerstreute sich, und nach und nach kehrten die Frauen wieder auf den Marktplatz zurück. Die Händler konnten nun endlich ihre Marktbuden aufstellen, und Sklaven schleppten die Waren herbei. Berge schmutziger Wäsche wurden auf dem Pflaster um den großen Brunnen vor dem Schrein der Laren abgeladen, und zwei Mädchen schürzten die Röcke und wateten in das seichte Wasser. Eine Stadt wie jede andere, dachte Varro, als er Pompeius folgte. Sonne und Staub, ein paar schattige Bäume, summende Insekten, das Gefühl, daß alles schon immer so gewesen ist, und Menschen, die viel zuviel voneinander wußten. Es gab keine Geheimnisse in Auximum!
»Ein wilder Menschenschlag«, sagte Varro zu Pompeius, als sie den Marktplatz verließen und zu ihren Pferden gingen.
»Es sind Sabiner, Varro, genau wie du, auch wenn sie vor Jahrhunderten aus dem Gebiet östlich der Apenninen gekommen sind.«
»Nicht ganz so wie ich.« Varro ließ sich von einem Stallburschen des Pompeius in den Sattel helfen. »Ich mag zwar Sabiner sein, doch bin ich weder von Natur noch von meiner Ausbildung her Soldat.«
»Aber du hast doch im Bundesgenossenkrieg gedient.«
»Schon. Ich war ja bei sechs Feldzügen dabei. Wie schnell das damals ging! Doch seit dem Ende des Krieges habe ich weder Schwert noch Kettenpanzer getragen.«
Pompeius lachte. »Du redest wie mein Freund Cicero.«
»Marcus Tullius Cicero? Der geniale Anwalt?«
»Ja. Er haßte den Krieg. Mein Vater konnte nicht verstehen, daß Cicero einfach nicht dafür geschaffen war. Doch er war trotzdem ein guter Kamerad. So hielten wir meinen Vater bei Laune, ohne ihm zuviel erzählen zu müssen.« Pompeius seufzte. »Als Asculum Picentum fiel, wollte er unbedingt unter Sulla in der Campania dienen. Ich habe ihn vermißt!«
Innerhalb von zwei Marktwochen hatte Pompeius seine drei Freiwilligenlegionen in einem gut befestigten Lager fünf Meilen von Auximum entfernt am Ufer eines Nebenflusses des Aesis untergebracht. Im Lager wurde streng auf Hygiene geachtet. Pompeius Strabo hatte als Mensch ländlicher Herkunft im Hinblick auf Jauchegruben, Latrinen, Abfallbeseitigung und Abwasserkanalisation immer dasselbe getan: Wenn der Gestank unerträglich wurde, zog er weiter. Deshalb war er vor der römischen Porta Collina am Fieber gestorben, und die Bewohner des Viminal und des Quirinal, deren Quellen von seinen Abfällen verschmutzt waren, hatten seine Leiche aus Rache grausam geschändet.
Gebannt beobachtete Varro, wie das Heer seines jungen Freundes Gestalt annahm, und er staunte über Pompeius’ Geschick in Fragen der Organisation. Keine Einzelheit, so unbedeutend sie auch sein mochte, wurde übersehen, und trotzdem schritt das große Unternehmen rasch und reibungslos voran. Ich gehöre zum kleinen Kreis der Vertrauten eines wahren Genies, dachte Varro. Pompeius wird den Lauf der Welt und unsere Einstellung zu ihr ändern. Er kennt keine Angst, und sein Selbstbewußtsein ist grenzenlos.
Allerdings hatten auch schon andere vor Beginn einer Schlacht Großes vollbracht. Was würde Pompeius tun, wenn der Krieg richtig begann, wenn er auf Widerstand stieß, wenn er sich Carbo oder Sertorius, nein, Sulla selbst gegenübersah? Das würde die wahre Prüfung sein! Ob als Parteigänger oder Gegner, das Verhältnis zwischen dem alten und dem jungen Stier würde die Zukunft des jungen bestimmen. Würde er sich beugen? Konnte er sich beugen? Wie sah die Zukunft eines jungen Mannes aus, der so sicher und selbstbewußt war? Gab es irgendeine Kraft oder irgendeinen Menschen auf der Welt, der seinen Willen brechen konnte?
Nach Pompeius’ Überzeugung bestimmt nicht. Obwohl nicht mystisch veranlagt, hatte er instinktive Vorstellungen von sich selbst. Seine Unbesiegbarkeit, Unverwundbarkeit und Unverletzlichkeit schrieb er seinem glücklichen Schicksal zu. Er glaubte, es fließe nicht nur Götterblut in seinen Adern, sondern es umgebe ihn auch eine Art göttlicher Schutz. Von Kindheit an hatte er von großen Taten geträumt. Im Geist hatte er zehntausend Schlachten geschlagen, war hundert Male im Triumphwagen gefahren und hatte wie ein Mensch gewordener Jupiter über Rom geherrscht, das ihm als dem bedeutendsten Menschen aller Zeiten zu Füßen lag.
Doch von anderen Träumern unterschied sich Pompeius dadurch, daß er die Welt zugleich mit scharfem Verstand betrachtete, sämtliche Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten berücksichtigte und keiner Tatsache auswich, ob sie nun so groß war wie ein Berg oder so klein wie ein Tropfen klaren Wassers. Seine großartigen Tagträume waren der geistige Amboß, auf dem er die Wirklichkeit schmiedete und den Gegebenheiten des tatsächlichen Lebens anpaßte.
Er stellte also Zenturien, Kohorten und Legionen auf, bildete Soldaten aus und inspizierte ihre Ausrüstung. Er sonderte Tragtiere aus, die zu alt waren, und ließ die Achsen der Wagen auf ihre Festigkeit prüfen, indem er sie etwa in vollem Tempo über die holprige Furt unterhalb des Lagers jagte. Alles mußte vollkommen sein.
Zwölf Tage nachdem Pompeius begonnen hatte, seine Truppen zusammenzustellen, kam Nachricht aus Brundisium: Sulla marschiere auf der Via Appia Richtung Rom und werde in jedem Dorf und in jeder Stadt jubelnd empfangen. Der Bote berichtete Pompeius auch, Sulla habe seinen Soldaten einen persönlichen Treueid abverlangt. Wer in Rom je an Sullas Entschlossenheit gezweifelt hatte, daß er einer künftigen Verfolgung wegen Hochverrats zuvorkommen werde, wurde eines Besseren belehrt: Jetzt, da Sullas Heer geschworen hatte, dem Feldherrn auch gegen Rom die Treue zu halten, schien der Krieg unausweichlich.
Sullas Soldaten, fuhr der Bote fort, hätten ihrem Feldherrn ihr ganzes Geld angeboten, damit er, während sie durch Calabria und Apulia zogen, für jedes Weizenkorn und alles Gemüse und Obst, das sie verzehrten, bezahlen könne. Kein Groll der Bauern sollte das Kriegsglück ihres Feldherrn verderben. Es sollte kein Blutbad geben und keine verwüsteten Felder, keine Vergewaltigungen und keine hungernden Kinder. Alles sollte nach Sullas Wunsch geschehen, und er könnte sie später entlohnen, wenn er Herr über Italien und Rom war.
Pompeius war enttäuscht, daß der Süden der Halbinsel Sulla mit solchem Jubel empfing. Er hatte gehofft, Sulla werde in Schwierigkeiten geraten und ihn dringend brauchen, wenn er mit seinen drei Legionen bei ihm eintraf. Damit war jetzt nicht mehr zu rechnen, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Pläne der Situation anzupassen.
»Wir marschieren an der Küste bis Buca, dann landeinwärts nach Beneventum«, sagte er zu den drei Zenturionen, die seine Legionen befehligten. Befehlshaber der Legionen hätten eigentlich adlige Militärtribunen sein müssen. Pompeius hätte solche auch gefunden, doch hätten sie sein Recht, eine Armee zu befehligen, in Frage gestellt. Deshalb hatte er es vorgezogen, seine Offiziere aus seinen eigenen Leuten zu wählen, auch wenn gewisse hochgeborene Römer dies bestimmt beanstanden würden.
»Wann brechen wir auf?« fragte Varro.
»Acht Tage vor Ende des Monats April.«
Da betrat Carbo den Schauplatz, und Pompeius mußte seine Pläne nochmals ändern. Gnaeus Papirius Carbo, zweimaliger Konsul Roms und jetziger Statthalter über das italische Gallien, lagerte mit seinen acht Legionen und seiner Reiterei vor den Toren Ariminums am Adriatischen Meer. Die Stadt lag strategisch sehr günstig: Von dort konnte Carbo in drei Richtungen vorrücken: auf der Via Aemilia durch das italische Gallien in Richtung der westlichen Alpen, entlang der Adriatischen Küste nach Brundisium und auf der Via Flaminia nach Rom.
Seit achtzehn Monaten wußte er, daß Sulla kommen würde, und dann mußte er nach Brundisium. Andererseits gab es in Rom immer noch zu viele Männer, die sich zu gegebener Zeit Sulla anschließen würden, obwohl sie vorgaben, völlig neutral zu sein. Diese Männer waren in der Lage, die derzeitige Regierung zu stürzen, deshalb kam auch Rom als Ziel in Frage. Carbo wußte außerdem, daß Metellus Pius das Ferkel in Liguria gelandet war. Metellus befehligte zwei gute Legionen, die er mitgenommen hatte, als er von Carbos Anhängern aus der Provinz Africa vertrieben worden war. Er würde sich bestimmt Sulla anschließen, sobald er von dessen Ankunft erfuhr, und dadurch wurde auch das italische Gallien verwundbar.
Sechzehn Legionen standen zwar in der Campania, viel näher bei Brundisium als Carbos Truppen. Doch wie verläßlich waren die Konsuln dieses Jahres, Norbanus und Scipio Asiagenus? Ende des vergangenen Jahres war er von zwei Dingen überzeugt gewesen: daß Sulla im Frühjahr ankommen werde und daß Rom Sulla eher Widerstand leisten werde, wenn er, Carbo, nicht dort war. Deshalb hatte er dafür gesorgt, daß seine beiden treuen Anhänger Norbanus und Scipio Asiagenus zu Konsuln gewählt wurden, und sich dann selbst zum Statthalter des italischen Gallien ernannt, um von dort die Lage kontrollieren zu können. Zumindest theoretisch hatte er eine gute Wahl getroffen: Weder Norbanus noch Scipio Asiagenus konnten auf Sullas Gnade hoffen. Norbanus war ein ehemaliger Klient des Gaius Marius, Scipio Asiagenus war während des Bundesgenossenkrieges als Sklave verkleidet aus Aesernia geflohen, wofür Sulla ihn verachtete. Aber waren die beiden stark genug? Würden sie ihre sechzehn Legionen wie Feldherren einsetzen und ihre Chancen nützen?
Überrascht hatte Carbo, daß Pompeius Strabos Sohn, kaum dem Kindesalter entwachsen, schon die Kühnheit hatte, drei Veteranenlegionen seines Vaters auszuheben und sich Sulla anzuschließen. Nicht daß Carbo den jungen Mann ernst nahm. Es waren die drei Veteranenlegionen, die ihm Sorgen bereiteten. Sobald Sulla über sie verfügte, würde er sie erfolgreich einsetzen.
Carbos Quästor, der tapfere Gaius Verres, hatte die Nachricht von Pompeius’ geplantem Feldzug überbracht.
Carbo runzelte die Stirn. »Der Bursche muß gestoppt werden, ehe er Unheil anrichtet«, sagte er. »Ich hoffe nur, Metellus Pius verläßt Liguria nicht, während ich gegen den jungen Pompeius ziehe, und die Konsuln sind Sulla gewachsen.«
»Mit Pompeius bist du schnell fertig«, sagte Gaius Verres überzeugt.
»Ganz meine Meinung, aber das macht ihn nicht weniger lästig«, sagte Carbo. »Schicke mir jetzt die Legaten.«
Die Legaten waren schwer zu finden. Während Verres von einem Teil des riesigen Lagers zum anderen eilte, gingen ihm die verschiedensten Dinge durch den Kopf. Der Gedanke an Sulla ließ ihm keine Ruhe. Er war zwar noch nie mit diesem zusammengekommen – schließlich war sein Vater nur ein bescheidener Hinterbänkler im Senat, und im italischen Krieg hatte er zuerst unter Gaius Marius und dann unter Cinna gedient. Doch erinnerte er sich daran, wie Sulla bei seiner Amtseinführung als Konsul ausgesehen hatte und wie beeindruckt er damals von dessen Erscheinung gewesen war. Von Natur aus nicht kriegerisch veranlagt, hatte Verres nicht daran gedacht, sich Sullas Feldzug im Osten anzuschließen; im Rom Cinnas und Carbos ließ sich gut leben. Verres wollte sein, wo das Geld war, denn er hatte einen kostspieligen Geschmack in Sachen Kunst und war sehr ehrgeizig. Erst jetzt, als er Carbos Legaten suchte, begann er sich zu fragen, ob es nicht an der Zeit war, ins andere Lager überzuwechseln.
Mit dem alten Jahr war Gaius Verres’ offizielle Amtszeit als Quästor zu Ende gegangen, und er hatte es Carbo zu verdanken, daß er seinen Posten noch innehatte. Carbo hatte ihn zum Quästor ernannt und war so zufrieden mit ihm gewesen, daß er seine Dienste auch im italischen Gallien nicht entbehren wollte. Als Quästor war er für die Gelder und Konten seines Vorgesetzten zuständig und hatte für Carbo beim Schatzamt die Summe von mehr als zwei Millionen Sesterzen erwirkt. Carbo sollte damit seine Soldaten bezahlen und verpflegen, außerdem sich selbst, den Legaten, Dienern und Quästoren einen angemessenen Lebensstil ermöglichen.
Obwohl der April noch nicht vergangen war, waren bereits über anderthalb Millionen Sesterzen ausgegeben, was bedeutete, daß Carbo das Schatzamt in Kürze um mehr Geld bitten mußte. Carbos Legaten führten ein luxuriöses Leben, und er selbst bediente sich schon seit langem nach Belieben öffentlicher Gelder. Auch Gaius Verres hatte seine Hände tief in die Geldsäcke gesteckt. Bisher waren seine Unterschlagungen niemandem aufgefallen, und jetzt gab es keine Veranlassung mehr, sich zurückzuhalten. Sobald Carbo auszog, um die drei Veteranenlegionen des Pompeius niederzuschlagen, würde er verschwinden. Denn es war an der Zeit, das Lager zu wechseln.
In der Morgendämmerung des darauffolgenden Tages zog Carbo mit vier Legionen, jedoch ohne Reiterei, gegen Strabos Sohn ins Feld. Die Sonne stand noch nicht hoch, als auch Gaius Verres aufbrach, nur begleitet von seinen Dienern. Verres folgte Carbo nicht nach Süden, sondern wandte sich nach Ariminum, wo Carbos Geld in den Gewölben eines ortsansässigen Bankiers lagerte. Nur zwei Personen waren berechtigt, das Geld zu holen: Statthalter Carbo und sein Quästor. Verres ließ sich achtundvierzig Ledersäcke mit jeweils einem halben Talent aushändigen und lud sie auf die von ihm gemieteten zwölf Maulesel. Er brauchte nicht einmal einen Grund vorzubringen, warum er das Geld holte. Die Nachricht von Sullas Landung hatte sich in Windeseile in Ariminum verbreitet, und der Bankier wußte, daß Carbo mit der Hälfte seines Heeres unterwegs war.
Es war noch lange nicht Mittag, als Gaius Verres die Stadt mit sechshunderttausend Sesterzen aus Carbos Kriegskasse verließ. Er ritt zunächst auf einem Umweg zu seinem eigenen Anwesen im oberen Tal des Tiber und begab sich dann auf die Suche nach Sulla.
Carbo marschierte inzwischen, ohne zu wissen, daß Verres sich aus dem Staub gemacht hatte, an der Adriatischen Küste entlang auf das Lager des Pompeius in der Nähe des Aesis zu.
Er war so siegesgewiß, daß er sich Zeit ließ und auch keine Vorkehrungen traf, sein Kommen zu verheimlichen. Das ganze Unternehmen würde lediglich eine Übung für seine zumeist unerfahrenen Soldaten sein. Zwar klang es furchterregend, daß drei Legionen von Pompeius Strabos Veteranen sie erwarteten, aber Carbo war erfahren genug, um zu wissen, daß eine Armee nur so gut war wie ihr Befehlshaber. Und der Befehlshaber dieser Armee war noch ein Kind! Ihn zu besiegen, war deshalb ein Kinderspiel.
Als Pompeius erfuhr, daß Carbos Truppen anrückten, stieß er einen freudigen Schrei aus und ließ sofort alle Soldaten zusammenrufen.
»Wir brauchen unsere Heimat nicht einmal zu verlassen, um unsere erste Schlacht zu schlagen«, rief er. »Carbo kommt persönlich aus Ariminum, um gegen uns zu kämpfen. Er hat bereits so gut wie verloren! Ihr fragt, warum? Weil er weiß, daß ich euch befehlige. Vor euch hat er Respekt, vor mir nicht. Dabei sollte man doch annehmen, daß der Sohn eines Schlächters weiß, wie man Knochen bricht und Fleisch schneidet! Doch Carbo ist ein Narr! Er glaubt, der Sohn des Schlächters sei sich zu fein, um sich mit dem Handwerk seines Vaters die Hände schmutzig zu machen. Doch er täuscht sich! Das wißt ihr so gut wie ich. Wir werden ihm eine Lektion erteilen!«
Und das taten sie denn auch. Carbos vier Legionen näherten sich dem Aesis in geordneten Reihen und warteten diszipliniert, bis Späher ausgekundschaftet hatten, wo man den Fluß, der wegen des Tauwetters in den Apenninen über die Ufer getreten war, am besten überqueren konnte. Carbo wußte zwar, daß Pompeius nicht weit unterhalb der Furt lagerte, doch seine Verachtung war derart, daß er nicht auf den Gedanken kam, Pompeius könnte ihm entgegenziehen.
Pompeius hatte seine Streitkräfte geteilt und eine Hälfte bereits vor Carbos Ankunft über den Aesis geschickt. Er nahm Carbo in die Zange, als zwei von dessen Legionen den Fluß überquert hatten und zwei weitere Legionen sich dazu anschickten. Pompeius’ Soldaten brachen gleichzeitig aus ihren jeweiligen Verstecken hinter Büschen und Bäumen und trieben Carbos Männer vor sich her. Pompeius selbst mußte als Feldherr freilich darauf verzichten, Carbo persönlich zu verfolgen, so gern er es auch getan hätte. Wie er von seinem Vater gelernt hatte, durfte sich ein Feldherr nie weit von seinem Lager entfernen, für den Fall, daß die Schlacht eine unglückliche Wendung nahm und ein rascher Rückzug erforderlich wurde. Pompeius mußte also zusehen, wie Carbo und sein Legat Lucius Quinctius die beiden Legionen, die auf der anderen Seite des Flusses verblieben waren, sammelten und mit ihnen nach Ariminum zurückkehrten. Auf Pompeius’ Seite überlebte kein Soldat des gegnerischen Heeres. Der Sohn des Schlächters verstand sein Handwerk also noch besser als sein Vater!
Er stieß einen triumphierenden Schrei aus. Jetzt war es an der Zeit, Sulla entgegenzuziehen.
Zwei Tage später brach Pompeius mit seinen drei Legionen auf. Er saß auf einem großen Schimmel, dem »Staatspferd« seiner Familie, wie er sagte – einem Pferd also, das der Staat bezahlte. Die Armee zog durch Gebiete, die noch vor wenigen Jahren erbittert gegen Rom gekämpft hatten; hier wohnten die südlichen Picenter, die Vestiner, die Marrukiner und die Frentaner, jene Völker, die danach gestrebt hatten, die italischen Bundesgenossen aus der langen Abhängigkeit von Rom zu befreien. Für ihre Niederlage war hauptsächlich Lucius Cornelius Sulla verantwortlich, dem Pompeius nun entgegenzog. Dennoch versuchte niemand, das Vorrücken der Armee zu behindern; einige ließen sich sogar als Soldaten anwerben, denn die Kunde, daß Pompeius Carbo geschlagen hatte, eilte ihm voraus. Der Kampf um Italien war verloren, und nun wollte man lieber auf der Seite Sullas stehen als auf der Seite Carbos.
In bester Stimmung verließen Pompeius’ achtzehntausend Veteranen in Buca die Küste und marschierten auf einer gut ausgebauten Straße nach Larinum. Zwei Wochen später trafen sie in der blühenden kleinen Stadt inmitten reicher Felder und Wiesen ein. Nicht einmal der aufmerksame Varro nahm den versteckten Haß in den Blicken der Bürger und Frauen wahr, die Pompeius willkommen hießen und ihn mit sanftem Druck zum Weitermarschieren drängten.
Nahe bei Larinum kam es erneut zum Kampf. Carbo hatte sofort nach Rom gemeldet, der Sohn des Schlächters sei mit drei Veteranenlegionen unterwegs, und in Rom tat man alles, um eine Vereinigung der Heere von Pompeius und Sulla zu verhindern. Zwei der in der Campania stationierten Legionen unter dem Befehl von Gaius Albius Carrinas wurden in Marsch gesetzt, um Pompeius aufzuhalten. Das Gefecht war kurz und heftig und schnell entschieden. Sobald Carrinas erkannte, daß er keine Chance hatte, zog er sich eilig zurück. Große Verluste hatte er nicht zu beklagen, aber sein Respekt vor dem Sohn des Schlächters war gewachsen.
Wie auf Flügeln eilten Pompeius’ Soldaten voran. Als sie zweihundert Meilen hinter sich gebracht hatten, erhielt jeder einige Schlucke sauren, verdünnten Weins. Schließlich erreichten sie Saepinum, und dort erfuhr Pompeius, daß Sulla nicht weit entfernt an der Via Appia lagere.
Zuerst mußte allerdings noch eine weitere Schlacht geschlagen werden. Lucius Junius Brutus Damasippus, der Bruder von Pompeius Strabos altem Freund und erstem Legaten, wollte Pompeius in der wilden Gegend zwischen Saepinum und Sirpium aus dem Hinterhalt überfallen. Doch Pompeius sah sich in seinem grenzenlosen Selbstvertrauen erneut bestätigt: Seine Späher fanden heraus, wo Brutus Damasippus sich mit seinen beiden Legionen versteckt hielt, und Pompeius fiel ohne Vorwarnung über sie her. Mehrere hundert Männer von Brutus Damasippus kamen um, bevor es diesem gelang, in Richtung Bovianum zu fliehen.
Pompeius hatte in drei Schlachten gesiegt, aber in keinem Fall versucht, seine Feinde zu verfolgen. Doch wenn Varro und die drei Zenturionen glaubten, er habe dies nicht getan, weil er die Gegend nicht kenne oder den Hinterhalt einer noch größeren Streitmacht befürchte, täuschten sie sich. In Pompeius’ Kopf hatte nur ein Gedanke Platz: die bevorstehende Begegnung mit Lucius Cornelius Sulla.
Immer wieder beschwor er das triumphale Schauspiel in seiner Phantasie herauf: Zwei gottgleiche Männer mit Haaren wie Feuer und starken und schönen Gesichtszügen glitten Raubkatzen gleich von ihren Pferden und gingen gemessenen Schrittes auf einer dicht von Einheimischen und Reisenden gesäumten Straße aufeinander zu. Hinter den beiden Feldherrn standen ihre Heere, und aller Augen waren auf sie gerichtet. Zeus schritt Jupiter entgegen, Ares dem Mars, Herakles dem Milon, Achill dem Hektor. Die erste Begegnung der beiden Giganten dieser Welt, der beiden Sonnen des Universums! Die untergehende Sonne brannte zwar noch heiß und stark, aber ihr Lauf näherte sich dem Ende; die aufgehende Sonne dagegen stieg am Firmament immer höher, dem Zenit entgegen. Sullas Sonne sinkt im Westen, dachte Pompeius frohlockend, während meine Sonne im Osten aufgeht!
Pompeius sandte Varro voraus. Er sollte Sulla grüßen, ihm von Pompeius’ Vormarsch berichten und ihm die Zahl der getöteten Feinde und die Namen der besiegten Generäle nennen. Varro sollte Sulla bitten, ihm auf der Straße entgegenzukommen, damit alle sehen konnten, daß er in friedlicher Absicht kam, um sich und seine Truppen dem bedeutendsten Mann seiner Zeit zur Verfügung zu stellen. Dem bedeutendsten Mann seiner Zeit, aber nicht dem bedeutendsten Mann aller Zeiten – soweit wollte Pompeius nicht einmal in einer blumigen Begrüßungsrede gehen.
Pompeius hatte genau überlegt, was er tragen wollte. Zuerst hatte er beabsichtigt, sich ganz in Gold zu kleiden, doch dann waren ihm Zweifel gekommen, ob dies nicht zu protzig wirkte. Jetzt sah er sich in einer einfachen weißen Toga daherschreiten, ohne alle militärischen Auszeichnungen und nur mit dem schmalen Purpurstreif des Ritters an der rechten Schulter der Tunika. Doch würden weiße Toga und weißes Pferd nicht zu einer unförmigen Masse verschmelzen? Also wollte er die silberne Rüstung tragen, die sein Vater ihm nach der Belagerung von Asculum Picentum geschenkt hatte. In ihr gefiel er sich am besten.
Als Gnaeus Pompeius Magnus sich schließlich von seinem Stallburschen in den Sattel des weißen Staatspferdes helfen ließ, trug er nur einen einfachen Brustpanzer aus Stahl mit schmucklosen Lederriemen und einen gewöhnlichen Helm. Nur sein Pferd hatte er herausgeputzt, denn er war Ritter der achtzehn ursprünglichen Zenturien der ersten Klasse, und seine Familie war seit Generationen Empfänger eines Staatspferdes. Das Pferd verschwand nahezu unter der Pracht seines Schmuckes, unter Silberknöpfen und Schmuckscheiben, einem mit Silber besetzten, scharlachroten Geschirr, einer bestickten Decke, unter einem reichverzierten und geschmückten Sattel und verschiedenen laut klimpernden silbernen Anhängern. Pompeius beglückwünschte sich selbst zu seiner Erscheinung, als er in der Mitte der Straße entlangritt, gefolgt von seinen Soldaten in Reih und Glied. Er sah aus wie ein einfacher Soldat, der sich auf sein Handwerk verstand. Sollte das Pferd von seinem Ruhm künden!
Beneventum lag auf der anderen Seite des Flusses Calor, an der Stelle, wo die Via Appia auf die von der apulischen und calabrischen Küste kommende Via Minucia stieß. Die Sonne stand senkrecht am Himmel, als Pompeius von einer Anhöhe zur Furt des Calor hinuntersah. Und dort, am jenseitigen Ufer, wartete Lucius Cornelius Sulla mitten auf der Straße. Er saß auf einem unaussprechlich müde aussehenden Maultier, und nur Varro begleitete ihn. Wo war das Volk? Wo waren Sullas Legaten, seine Truppen?
Instinktiv drehte Pompeius den Kopf und befahl dem Standartenträger der vorausmarschierenden Legion, die Soldaten anzuhalten. Dann ritt er ganz allein den Hang hinunter auf Sulla zu. Sein Gesicht war wie versteinert. Als Pompeius auf hundert Schritt herangekommen war, fiel Sulla mehr oder weniger von seinem Maultier. Er konnte sich nur auf den Beinen halten, weil er einen Arm um den Hals des Maultiers schlang und sich mit der anderen Hand an dessen schmutzigem Ohr festhielt. Mühsam richtete er sich auf und schickte sich an, Pompeius schwankend über die breite, leere Straße entgegenzugehen.
Pompeius glitt vom Rücken seines silbern glänzenden Pferdes, obgleich er fürchtete, daß auch ihm die Beine versagen könnten, so sehr hatte die Überraschung ihn geschwächt. Doch seine Beine trugen ihn. Zumindest einer von uns muß die Würde bewahren, dachte er, und schritt aus.
Selbst aus der Entfernung hatte er erkannt, daß dieser Sulla, den er vor sich sah, nichts mit dem Sulla gemein hatte, an den er sich zu erinnern glaubte. Je näher er kam, desto deutlicher sah er, wie schrecklich Zeit und Krankheit Sulla zugesetzt hatten. Doch er war vor Entsetzen noch wie betäubt und empfand kein Mitgefühl oder gar Mitleid, sondern nur eine so intensive körperliche Abneigung, daß er einen Augenblick lang glaubte, er müsse sich erbrechen.
Sulla war betrunken. Pompeius hätte ihm das verziehen, wäre es der Sulla gewesen, den er am Tag seines Amtsantritts als Konsul kennengelernt hatte. Doch von der Schönheit und Faszination jenes Menschen war nichts geblieben, nicht einmal die Würde grauer oder weißer Haare. Der Sulla, den er vor sich sah, hatte seinen kahlen Schädel mit einer Perücke bedeckt, einem häßlichen Gewirr rötlichbrauner Locken, unter dem vor den Ohren in zwei geraden, silbernen Strähnen seine eigenen Haare hervorwuchsen. Sulla hatte keine Zähne mehr; sein eingekerbtes Kinn war dadurch länger geworden, und der Mund unter der unverwechselbaren Nase mit der leichten Einbuchtung an der Spitze sah aus wie eine gezackte Narbe. Die Haut seines Gesichts schälte sich; an manchen Stellen war sie blutigrot, an anderen so weiß wie früher. Und obwohl Sulla bis auf die Knochen abgemagert war, mußte er vor nicht allzu langer Zeit sehr dick gewesen sein, denn sein Gesicht war runzlig, und auch an seinem Hals hing die Haut schlaff und faltig herab.
Pompeius kämpfte mit Tränen der Enttäuschung. Wie konnte sein Stern vor diesem Jammerbild menschlichen Elends strahlen?
Fast hatten sie einander erreicht. Pompeius streckte die rechte Hand aus. Er hielt die Finger gespreizt und die Handfläche senkrecht nach oben.
»Imperator!« rief er.
Sulla kicherte und streckte Pompeius unter gewaltiger Anstrengung die Hand entgegen. »Imperator!« rief er, dann fiel er gegen Pompeius. Sein feuchter, fleckiger Lederharnisch stank nach Sodbrennen und Wein.
Plötzlich stand Varro an Sullas Seite. Gemeinsam halfen sie Lucius Cornelius Sulla auf den Rücken seines schmutzigen Maultiers.
»Er wollte dir unbedingt entgegenreiten«, sagte Varro leise. »Nichts konnte ihn davon abbringen.«
Pompeius drehte sich im Sattel seines Staatspferdes um und bedeutete seinen Truppen durch ein Handzeichen, sich in Bewegung zu setzen. Dann nahmen er und Varro Sulla in die Mitte und ritten in Richtung Beneventum.
»Ich kann es immer noch nicht glauben!« stöhnte Pompeius, nachdem sie den nahezu bewußtlosen Sulla seinen Männern übergeben hatten.
»Die letzte Nacht war für ihn besonders schlimm«, sagte Varro. Er wußte nicht, wie sehr Pompeius in seinen Phantasien enttäuscht worden war.
»Was meinst du damit?«
»Seine Haut. Als Sulla so krank wurde, daß die Ärzte um sein Leben fürchteten, schickten sie ihn nach Aedepsus, einen kleinen Badeort außerhalb der Stadt Chalkis auf Euböa. Die Ärzte des dortigen Tempels sollen die besten in ganz Griechenland sein. Und sie haben ihm wirklich das Leben gerettet! Er durfte kein reifes Obst, keinen Honig, kein Brot und keinen Kuchen essen und keinen Wein trinken. Doch die Bäder haben seine Gesichtshaut in Mitleidenschaft gezogen. Seit er in Aedepsus war, leidet er an Anfällen schlimmsten Juckreizes und kratzt sich das Gesicht blutig. Er ißt immer noch kein Obst, keinen Honig, kein Brot und keinen Kuchen. Nur Wein bringt ihm Erleichterung, deshalb trinkt er ihn.« Varro seufzte. »Er trinkt viel zu viel.«
»Und warum nur im Gesicht? Warum nicht auch an Armen und Beinen?« fragte Pompeius, der nicht wußte, ob er diese Geschichte glauben sollte.
»Er hatte einen schlimmen Sonnenbrand im Gesicht. Du erinnerst dich sicher, daß er in der Sonne immer einen breitkrempigen Hut trug. Doch einmal bestand er trotz seiner Krankheit darauf, einer Zeremonie beizuwohnen, die in einem kleinen Ort zu seinem Empfang veranstaltet wurde. Aus Eitelkeit trug er einen Helm statt des Hutes. Vermutlich hat das seine Haut ruiniert.« Varro schien fasziniert, Pompeius war abgestoßen. »Sein Kopf sieht aus wie eine mit Mehl bestreute Maulbeere. Außergewöhnlich!«
»Du sprichst so salbungsvoll wie diese griechischen Ärzte«, sagte Pompeius, der sich allmählich von seinem Schock erholte. »Wo sind wir untergebracht? Weit von hier? Und was ist mit meinen Männern?«
»Ich nehme an, Metellus Pius hat deinen Männern ein Lager zugewiesen. Wir sind nicht weit von hier in einem schönen Haus untergebracht. Wenn du jetzt frühstücken willst, können wir danach zu deinen Männern hinausreiten.« Varro legte die Hand auf Pompeius’ sehnigen Arm. Er hätte gern gewußt, was in Pompeius vorging. Daß Pompeius kein Mitleid empfand, hatte er gemerkt. Aber warum war er so niedergeschlagen?
Kapitel 3
An jenem Abend veranstaltete Sulla zu Ehren der beiden Neuankömmlinge ein großes Bankett in seinem Quartier; dort sollten sie die anderen Legaten kennenlernen. Die Nachricht von Pompeius’ Ankunft, von seiner Jugend und Schönheit und von der Verehrung, die seine Soldaten ihm entgegenbrachten, hatte sich in Beneventum wie ein Lauffeuer verbreitet. Amüsiert betrachtete Varro die verärgerten Mienen von Sullas Legaten. Sie sahen aus wie kleine Kinder, denen die Amme eine köstliche Honigwabe weggenommen hatte. Als Sulla Pompeius dann auch noch den Ehrenplatz auf seiner eigenen Liege einräumte und niemanden zwischen sich und Pompeius kommen ließ, stand blanker Haß in ihren Augen. Pompeius ließ sich freilich nicht aus der Ruhe bringen. Er machte es sich mit sichtlichem Vergnügen bequem und unterhielt sich mit Sulla, als wären sie allein.
Sulla war jetzt nüchtern. Der Juckreiz schien nachgelassen zu haben, und die wunden Stellen seines Gesichts waren verschorft. Er war ruhig und freundlich und offensichtlich von Pompeius beeindruckt. Varro fühlte sich in seiner Meinung über Pompeius bestätigt.
Er begann sich nach den anderen Anwesenden umzusehen, zunächst nach dem Mann, der neben ihm lag – Appius Claudius Pulcher, den er mochte und schätzte. »Ist Sulla noch fähig, uns zu führen?« fragte er ihn.
»Er ist so brillant wie eh und je. Wenn wir es schaffen, ihn nüchtern zu halten, wird er Carbo besiegen, Carbo mag an Truppen aufbieten, was er will.« Appius Claudius erschauerte und zog eine Grimasse. »Spürst du das Böse, das in diesem Raum anwesend ist, Varro?«
»Ganz deutlich«, sagte Varro, obgleich er nicht annahm, daß Appius Claudius die Atmosphäre meinte, die er selbst spürte.
»Ich habe mich in den kleineren Tempeln Delphis ein wenig mit diesem Thema beschäftigt«, fuhr Appius Claudius fort. »Um uns herum wirken höhere Mächte, unsichtbare Mächte natürlich. Die meisten Menschen spüren sie nicht, aber du und ich, Varro, wir registrieren genau, was bestimmte Orte ausstrahlen.«
»Was für Orte?« fragte Varro verblüfft.
»Unter uns und überall um uns«, erklärte Appius Claudius mit Grabesstimme. »Höhere Mächte – anders kann ich es nicht ausdrücken. Wie kann man das Unsichtbare beschreiben, das nur empfängliche Menschen wie wir wahrnehmen? Ich meine nicht die Götter auf dem Olymp oder irgendwelche göttlichen Wesen.«
Appius Claudius redete pausenlos weiter, während Varro seine Aufmerksamkeit anderen Anwesenden zuwandte. Zunächst versuchte er, die Legaten Sullas einzuschätzen.
Da waren einmal Philippus und Cethegus, zwei Wendehälse, die nach jedem Wechsel der Amtsinhaber sofort bestrebt waren, auch den neuen Herren von Rom zu dienen, und das schon seit dreißig Jahren. Philippus war der nach außen Erfolgreichere der beiden; er war nach einigen vergeblichen Versuchen Konsul und unter Cinna und Carbo sogar Zensor geworden, was den Höhepunkt der politischen Karriere eines Mannes darstellte. Cethegus hingegen, ein patrizischer Cornelier und entfernter Verwandter Sullas, hatte es vorgezogen, seine Macht im Hintergrund auszuüben, indem er die anderen Hinterbänkler im Senat manipulierte. Die beiden lagen nebeneinander, unterhielten sich laut und ignorierten alle anderen.
Auch die jungen Legaten Verres, Catilina und Ofella blieben unter sich. Was für ein Trio! Varro war überzeugt, daß alle drei Schurken waren, obgleich Ofella mehr um sein Ansehen besorgt schien als um irgendwelche zukünftigen Profite. Bei Verres und Catilina dagegen gab es keinen Zweifel: Ihre einzige Triebfeder war die Habgier.
Auf einer weiteren Liege lagen drei ehrenwerte und aufrechte Männer: Mamercus, Metellus Pius und Varro Lucullus, ein adoptierter Varro und in Wirklichkeit der Bruder von Sullas treuestem Gefolgsmann Lucullus. Sie machten aus ihrer Abneigung gegen Pompeius kein Hehl.
Mamercus war Sullas Schwiegersohn, ein ruhiger, vernünftiger Mensch, der Sullas Vermögen gerettet und Sullas Familie sicher nach Griechenland gebracht hatte.