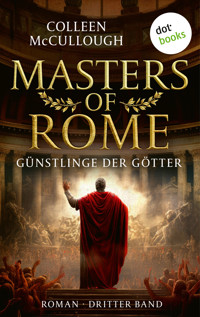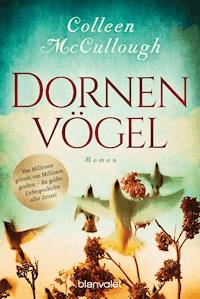
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die tragischste Liebesgeschichte aller Zeiten ...
Anfang des 20. Jahrhunderts macht Paddy Cleary sich mit seiner Familie von Irland auf ins ferne Australien, wo sie sich ein neues Leben aufbauen wollen. Die Arbeit auf der Schaffarm »Drogheda« verspricht finanzielle Sicherheit, doch das raue Land stellt seine Bewohner auf eine harte Probe. Als die Clearys ihre Probleme gerade bewältigt zu haben scheinen, entbrennt eine leidenschaftliche aber fatale Liebe zwischen der jüngsten Tochter Meggie und dem attraktiven Priester Ralph de Bricassart …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1252
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Anfang des 20. Jahrhunderts beschließt der Ire Paddy Cleary, mit seiner Frau und den sieben Kindern ins südöstliche Australien auszuwandern, um dort auf der Schaffarm »Drogheda« für seine Schwester Mary Carson zu arbeiten. Die Beschäftigung auf der Farm verspricht bescheidenen Wohlstand, doch das Leben im rauen Buschland fordert stetige Opfer von den Clearys. Trotz familiärer Spannungen und der harten Arbeit scheint die Familie nach und nach zur Ruhe zu finden – aber der Friede soll nicht von langer Dauer sein. Das größte Drama bahnt sich an, als der nach Sydney versetzte Pater Ralph de Bricassart zu Besuch kommt und seinem einstigen Schützling Meggie Cleary wiederbegegnet: Meggie hegt seit Kindertagen eine große Zuneigung zu dem attraktiven Pater, der mit der Familie eng verbunden ist. Mittlerweile ist das Mädchen von damals zur Frau herangereift, und Ralph kann sich ihrem Charme und ihrer Anmut nicht länger entziehen …
Autorin
Colleen McCullough wurde 1937 im neuseeländischen Wellington geboren. Sie studierte Neurologie, arbeitete in verschiedenen Krankenhäusern in England und Amerika und war als Dozentin an der Yale-Universität tätig, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Ihre Romane, allen voran Dornenvögel, erreichten auf der ganzen Welt ein riesiges Lesepublikum. Bis zu ihrem Tod im Januar 2015 lebte sie abgeschieden auf der kleinen Insel Norfolk Island im Südpazifik.
Colleen McCullough
Dornenvögel
Roman
Deutsch
von Günter Panske
Da gibt es die Legende von einem Vogel, der in seinem Leben nur ein einziges Mal singt, doch singt er süßer als jedes andere Geschöpf auf dem Erdenrund. Von dem Augenblick an, da er sein Nest verlässt, sucht er nach einem Dornenbaum und ruht nicht, ehe er ihn nicht gefunden hat. Und wenn er im Gezweig zu singen beginnt, dann lässt er sich so darauf nieder, dass ihn der größte und schärfste Dorn durchbohrt. Doch während er stirbt, erhebt er sich über die Todesqual, und sein Gesang klingt herrlicher als das Jubeln der Lerche oder das Flöten der Nachtigall. Ein unvergleichliches Lied, bezahlt mit dem eigenen Leben. Aber die ganze Welt hält inne, um zu lauschen, und Gott im Himmel lächelt. Denn das Beste ist nur zu erreichen unter großen Opfern … So jedenfalls heißt es in der Legende.
1. TEIL
1915–1917
MEGGIE
1
Am 8. Dezember 1915 hatte Meggie Cleary ihren vierten Geburtstag. Nach dem Abräumen des Frühstücksgeschirrs drückte ihre Mutter ihr wortlos ein braunes Papierpäckchen in die Arme und befahl ihr, nach draußen zu gehen. So hockte Meggie sich hinter den Stechginster beim Vordertor und begann, ungeduldig und mit ungeschickten Fingern am Einwickelpapier zu zerren. Es roch schwach nach dem Wahine General Store, wo es so verwirrend viele Dinge zu kaufen gab. Der Geruch verriet ihr, dass – wunderbarerweise – wohl auch dieses Päckchen mit seinem Inhalt dort gekauft worden war. Ja, gekauft. Nichts von anderen Abgelegtes war es und auch nichts Hausgemachtes.
Durch eine aufgerissene Ecke im Papier schimmerte es hell, fast wie Gold. Meggie attackierte die schützende Hülle heftiger. Lange Streifen von braunem Papier riss sie fort.
»Agnes! Oh, Agnes!«, sagte sie zärtlich und blickte verwirrt auf die Puppe, die da wie in einem zerrupften Nest lag.
Ein Wunder, o ja. Den Wahine General Store hatte Meggie erst ein einziges Mal von innen gesehen, vor einer halben Ewigkeit: im Mai – als Belohnung dafür, dass sie besonders brav gewesen war. Ihre Mutter neben sich, nahm sie bei der Fülle ringsum vor lauter Aufregung kaum etwas genauer wahr. Mit einer Ausnahme allerdings: Agnes.
Die wunderschöne Puppe, gekleidet in eine Krinoline aus rosa Satin mit cremefarbenem Spitzenbesatz allüberall, saß auf dem Ladentisch, und Meggie taufte sie auf der Stelle Agnes. Von den Namen, die sie kannte, passte einzig dieser für ein so makelloses Geschöpf. Während der folgenden Monate sehnte sie sich zwar nach Agnes, aber ohne jede Hoffnung. Meggie besaß keine Puppe und wusste nicht, dass kleine Mädchen und Puppen zusammengehörten. Zufrieden spielte sie mit den Sachen, die ihre Brüder fortgeworfen hatten, mit den Schleudern und den Pfeifen, mit den lädierten Soldaten. Wenn sie dabei schmutzig wurde, kümmerte sie das kaum.
Dass Agnes zum Spielen da sein könnte, dieser Gedanke kam ihr überhaupt nicht. Sacht strich sie über das rosafarbene Kleid – wie viel schöner war es doch als alles, was sie bisher bei irgendeiner Frau gesehen hatte! – und hob die Gliederpuppe hoch. Nicht nur die Arme und die Beine ließen sich bewegen, wie Meggie herausfand, sondern auch der Kopf. Ja, sogar in der überaus schlanken Taille war Agnes beweglich. Ihr goldenes Haar türmte sich zu einer wunderbar hohen Frisur, die winzige Perlen zierten. Über den Spitzenbesatz des Halsausschnitts lugte ein Stückchen fahler Busen. Das wunderschöne, fein bemalte Gesicht, offenbar aus einer Art Keramikmasse bestehend, war unglasiert geblieben, sodass die zart getönte Haut eine matte, natürliche Schattierung besaß. Die blauen Augen, gleichsam umkränzt von Wimpern aus richtigem Haar, wirkten erstaunlich lebensecht. Auf einer der wie rötlich überhauchten Wangen befand sich ganz oben ein Schönheitsfleck. Die dunkelroten Lippen waren leicht geöffnet, sodass man die winzigen weißen Zähne sehen konnte. Meggie setzte sich die Puppe vorsichtig auf den Schoß, kreuzte behaglich die Füße und tat dann nichts – außer dass sie Agnes betrachtete.
Und damit war sie auch noch beschäftigt, als Jack und Hughie durch das raschelnde Gras nah am Zaun herbeikamen. Dort wucherte es dicht, weil man mit der Sense so schlecht herangelangen konnte.
Wie alle Cleary-Kinder außer Frank hatte Meggie rotes Haar, auffällig und verräterisch. Jack gab seinem Bruder einen Stoß in die Rippen und streckte triumphierend die Hand aus. Die Jungen grinsten einander an. Sofort trennten sie sich. Jetzt waren sie Soldaten, die einen Maori-Verräter in die Zange nahmen. Doch Meggie hätte sie ohnehin nicht gehört. Leise summend saß sie, völlig in die Betrachtung der schönen Agnes versunken.
»Was hast du da, Meggie?«, rief Jack, auf sie zustürzend. »Zeig’s uns!«
»Ja, zeig’s uns!« Kichernd war Hughie auf der anderen Seite aufgetaucht.
Meggie presste die Puppe an sich und schüttelte den Kopf. »Nein, sie ist meine! Ich habe sie zum Geburtstag bekommen!«
»Zeig sie uns, los schon! Wir wollen sie uns nur mal ansehen.«
Stolz und Freude gewannen die Oberhand. Sie hielt die Puppe so, dass ihre Brüder sie sehen konnten. »Da, ist sie nicht schön? Sie heißt Agnes.«
»Agnes? Agnes?« Jack tat, als müsse er sich erbrechen. »So ein blöder Name, da kommt’s einem ja hoch! Warum nennst du sie nicht Margaret oder Betty?«
»Weil sie Agnes ist!«
Hughie sah, dass es eine Gliederpuppe war. Er stieß einen Pfiff aus. »He, Jack, sieh mal! Die kann den Arm bewegen, sogar die Hand!«
»Wo? Lass mal sehen.«
»Nein!« Wieder presste Meggie die Puppe an sich. In ihren Augen zeigten sich Tränen. »Nein, ihr macht sie kaputt! Oh, Jack, lass sie mir doch – sie zerbricht!«
»Pah!« Seine schmutzigen, braunen Finger schlossen sich fest um ihr Handgelenk. »Soll ich dir tausend Stecknadeln verpassen? Und sei bloß nicht so eine Heulsuse, sonst erzähle ich’s Bob.« Weißlich spannte sich ihre Haut unter seinen hart quetschenden Fingern. Hughie packte die Puppe beim Kleid und zog.
»Gib schon her, sonst mach’ ich mal Ernst!«, sagte Jack.
»Nein, nicht! Bitte, Jack, nicht! Du machst sie bestimmt kaputt! Lass sie mir doch! Nimm sie mir nicht weg, bitte!« Trotz seines harten, schmerzenden Griffs hielt sie die Puppe noch immer umklammert, versuchte, sich zu wehren, schluchzend, strampelnd.
»Hab’ sie!«, schrie Hughie triumphierend, als es ihm gelang, Meggie die Puppe zu entwinden.
Die beiden Jungen fanden Agnes nicht weniger faszinierend, als Meggie sie gefunden hatte. Im Handumdrehen hatten sie die Puppe ausgezogen. Nackt lag sie vor ihnen, und die Jungen zogen und zerrten an ihr herum – ließen sie gliederverrenkende akrobatische Kunststücke vorführen: ein Bein mit dem Fuß hinter dem Kopf; dann der Kopf brutal ins Genick gedreht; anderes mehr.
Meggie stand weinend, doch ihre Brüder beachteten sie nicht weiter. Und Meggie selbst dachte nicht daran, zu irgendjemandem um Hilfe zu laufen. Wer sich in der Cleary-Familie nicht aus eigener Kraft behaupten konnte, durfte kaum mit Hilfe oder Mitgefühl rechnen. Das galt auch für Mädchen.
Das hochgetürmte Goldhaar der Puppe fiel über ihre Schultern herab. Die winzigen Perlen versprühten gleichsam im hohen Gras, waren nicht mehr zu sehen. Ein schmutziger Schuh trat absichtslos auf das herumliegende Kleidchen. Dreck aus der Schmiede haftete jetzt auf dem Satin. Meggie ließ sich auf die Knie fallen und kroch verzweifelt umher, um die Puppenkleidung vor schlimmerem Schaden zu bewahren. Dann tastete sie unter den hohen Grashalmen nach den winzigen Perlen.
Vor Tränen konnte sie nichts sehen, und was sie empfand, was ihr fast buchstäblich das Herz zerriss, war für sie ein völlig neues Gefühl: Bis jetzt hatte sie noch nie etwas besessen, dessen Verlust es wert gewesen wäre, dass man darum trauerte.
Frank steckte das Hufeisen in kaltes Wasser. Es zischte, und er richtete sich auf, straffte den Rücken. Tat gar nicht mehr weh nach all dem Krummstehen. Es schien also, dass er sich jetzt doch an die Arbeit in der Schmiede gewöhnt hatte. Würde auch allmählich Zeit, hätte sein Vater bestimmt gesagt: nach rund einem halben Jahr.
Aber Frank brauchte keinen, der ihm ins Gedächtnis rief, wie lange es her war, dass er ins Joch von Esse und Amboss geriet. Er hatte die Zeit gemessen, sehr genau, wenn auch weniger in Tagen und Wochen als in Hass und Zorn.
Er warf den Hammer in seinen Kasten, schob sich mit zitternder Hand das glatte, schwarze Haar aus der Stirn und band sich den alten Lederschurz ab. Sein Hemd lag in der Ecke auf einem Haufen Stroh. Mit schweren Schritten ging er darauf zu, stand dann sekundenlang und starrte auf die stellenweise zerborstene Schuppenwand, als ob sie gar nicht vorhanden wäre.
Er war klein, nur knapp über eins sechzig, und so dünn, wie junge Burschen es häufig sind. Doch auf den Schultern und an den Armen zeigten sich bereits deutlich erkennbare Muskelpartien. Zweifellos hatte die harte Arbeit mit dem Hammer dafür gesorgt. Auf seiner hellen, sehr reinen Haut glänzte Schweiß. Dunkel wie seine Haare waren auch seine Augen, und das gab ihm irgendwie einen fremdländischen Einschlag. Weder seine vollen Lippen noch die recht breite Nase gehörten zu den üblichen Familienmerkmalen. Von der Seite seiner Mutter her floss in seinen Adern Maori-Blut, und das schlug durch. Er war fast sechzehn Jahre alt, während Bob kaum elf war, Jack zehn, Hughie neun, Stuart fünf und die kleine Meggie drei. Aber halt, das stimmte nicht mehr. Ihm fiel ein, dass Meggie heute, am 8. Dezember, vier geworden war.
Er schlüpfte in sein Hemd und verließ den Schuppen.
Das Haus, auf einem kleinen Hügel gelegen, befand sich etwa dreißig Meter oberhalb der Stallungen, den Schuppen mit eingeschlossen. Es war so wie fast alle Häuser auf Neuseeland: an vielen Stellen gleichsam auswuchernd, aus Holz, hatte nur ein Erdgeschoss – nicht ohne Grund: Zumindest theoretisch bestand so eine größere Chance, dass bei einem Erdbeben vielleicht noch etwas von ihm stehenblieb. Überall rundum wuchs Stechginster, gerade jetzt von gelben Blüten wie übersät. Das Gras war grün und üppig, und anders kannte man das auf Neuseeland eigentlich auch nicht. Selbst wenn mitten im Winter manchmal den ganzen Tag über im Schatten der Frost nicht wich, wurde das Gras keineswegs braun, und der lange, milde Sommer färbte es nur in noch satterem Grün. Der Regen fiel sacht. Er peitschte nicht herab auf die zarte Zerbrechlichkeit dessen, das da wuchs; er zerstörte nicht. Es gab keinen Schnee, und die Sonne hatte gerade genügend Kraft, um zu liebkosen, nicht um zu versengen.
Doch Geißeln kannte auch Neuseeland. Nur waren es nicht die Geißeln des Himmels, sondern eher der Erde: jene ungeheuren Kräfte der Zerstörung, die unaufhörlich in ihrem Bauch brodelten und deren heimtückisches Lauern sich mitteilte durch ein Zittern, das man buchstäblich in den Beinen spüren konnte. So vernichtend war jene urgewaltige Kraft, dass dreißig Jahre zuvor ein ganzer hochaufragender Berg verschwunden war. Dampf entwich wild zischend aus Rissen und Spalten in Hügelhängen, Vulkane spien Rauch zum Himmel empor, und das Wasser der Gebirgsbäche sprudelte warm. Riesige Seen aus Schlamm brodelten ölig, und das Meer brandete gegen Klippen, die bei der nächsten Flut vielleicht schon nicht mehr stehen würden. Stellenweise war die Erdkruste nur dreihundert Meter dick.
Und doch war es ein sanftes, anmutiges Land. Hinter dem Hügel mit dem Haus dehnte sich eine Ebene, die so grün war wie der Smaragd an Fiona Clearys Verlobungsring. Tausende gelblicher Punkte schienen hineingetupft in diese Fläche – und entpuppten sich, wenn man näher kam, als Schafe. Unter dem hellblauen Himmel bildeten dann die Hügel gleichsam einen muschelartigen Kranz für jenen wunderschönen Berg, der über 2500 m hoch war. Von Schnee gekrönt, besaß er eine kegelförmige Gestalt von so unglaublicher Symmetrie, dass selbst jene, die ihn – wie Frank – Tag für Tag sahen, nie aufhörten, ihn wie ein Wunder zu bestaunen.
Es war ein recht steiler Anstieg, den Hügel hinauf zum Haus; dennoch ging Frank ziemlich rasch. Und bald schon sah er die kleine Gruppe dort beim Ginster.
Frank war es gewesen, der seine Mutter nach Wahine gefahren hatte, weil sie für Meggie diese Puppe kaufen wollte – einen Vers konnte er sich darauf allerdings immer noch nicht machen. Zum Geburtstag so unpraktische Dinge zu schenken entsprach keineswegs ihrer Gewohnheit. Dafür fehlte es ganz einfach an Geld, und keines der Kinder hatte je ein Spielzeug geschenkt bekommen. Man bekam immer nur etwas zum Anziehen: Geburtstage und Weihnachtsfeste dienten nicht zuletzt dazu, den recht kümmerlichen Bestand an Bekleidung zu ergänzen. Was nun Meggie betraf, so hatte sie offenbar bei ihrem bislang einzigen Besuch in der Stadt diese Puppe gesehen, und Fiona hatte das nicht vergessen. Als Frank sie deshalb befragte, murmelte sie nur, dass ein Mädchen eine Puppe brauche, und wechselte hastig das Thema.
Jack und Hughie zogen und bogen so an der Puppe herum, als wollten sie ihr die Glieder aus den Gelenken reißen. Von Meggie konnte Frank nur den Rücken sehen. Hilflos stand sie, während ihre Brüder mit Agnes ihr gewalttätiges Spiel trieben. Ihre weißen Strümpfe waren verrutscht und hingen beutelig herab. Unter dem Saum ihres braunen Samtkleides sah man mehrere Zentimeter rosiger Haut. Über ihren Rücken fiel in erstaunlicher Fülle das sorgfältig gelockte Haar herab, nicht rot eigentlich und auch nicht golden, sondern irgendeine Schattierung dazwischen. Die Taftschleife, welche die vorderen Locken hielt, hing jetzt sehr schlaff und unordentlich. Meggie hatte irgendetwas in der Hand, das Kleidchen der nackten Puppe offenbar. Mit der anderen Hand stieß sie gegen Hughie – versuchte vergeblich, ihn beiseitezuschieben.
»Ihr verdammten kleinen Schweinehunde!«
Jack und Hughie sprangen auf und gaben Fersengeld. Vergessen war die Puppe. Wenn man Franks fluchende Stimme hörte, machte man sich besser umgehend aus dem Staub.
»Wehe, ich erwische euch noch mal, wenn ihr die Puppe anfasst!«, schrie Frank hinter ihnen her. »Dann kriegt ihr von mir was auf eure vollgeschissenen Ärsche!«
Er beugte sich zu Meggie und nahm ihre Schultern zwischen seine Hände. Sacht schüttelte er sie.
»Nun weine nicht mehr! Komm schon – jetzt sind sie ja weg, und deine Puppe werden sie nie wieder anfassen, das verspreche ich dir. Und nun lächle mich mal an. Ist heute doch dein Geburtstag, nicht?«
Die Tränen strömten ihr über die Wangen, und sie blickte Frank aus grauen Augen an, die so groß und so voller Tragik waren, dass er fühlte, wie es ihm die Kehle zuschnürte. Er zog einen schmutzigen Lappen aus seiner Hosentasche, wischte ihr damit ungeschickt übers Gesicht, hielt dann ihre kleine Nase zwischen dem Stoff.
»Schnauben!«
Sie tat es und bekam dann, während ihre Tränen trockneten, einen Schluckauf. »Oh, Fra-Fra-Frank, die ha-ha-hatten mir Agnes weggeno-no-nommen!« Heftig sog sie die Luft durch die Nase. »Ihr Haa-Haa-Haar fiel herab, und sie verlo-lo-lor all die hübschen, tleinen Per-Per-Perlen, die da drin wa-wa-waren. Sie sind alle ins Gra-Gra-Gras gefallen, und ich kann sie nicht finden!«
Wieder stürzten Tränen aus ihren Augen, fielen Frank auf die Hand. Ein oder zwei Sekunden blickte er auf seine feuchte Haut, dann leckte er die Tropfen ab.
»Na, dann müssen wir sie ja finden, nicht? Aber du kannst nichts finden, wenn du weinst, weißt du, und was soll eigentlich diese Babysprache? Seit einem halben Jahr habe ich nicht mehr gehört, dass du ›tlein‹ statt ›klein‹ sagst! Hier, schnaub dir noch mal die Nase, und dann heb sie auf, die arme … Agnes? Wenn du ihr nicht ihre Sachen anziehst, bekommt sie ja einen Sonnenbrand.«
Auf seine Aufforderung setzte sie sich an den Wegrand. Er schob ihr sacht die Puppe in die Arme und begann dann, im Gras umherzukriechen. Schließlich hielt er etwas hoch und rief triumphierend:
»Da! Eine Perle! Die erste! Die anderen finden wir auch noch alle, wart nur ab.«
Bewundernd sah Meggie zu, wie er Perle auf Perle fand und jedes Mal hochhielt. Aber dann dachte sie daran, wie leicht Agnes bei ihrer gewiss sehr empfindlichen Haut einen Sonnenbrand bekommen konnte, und sie begann, die Puppe anzuziehen. Wirklich beschädigt schien sie nicht zu sein. Die Arme und Beine waren schmutzig, das Haar sehr zerzaust …
Meggie zerrte an einem der beiden Schildpattkämme, die in ihrem eigenen Haar steckten, jeweils über den Ohren. Sie zog ihn heraus und begann, damit Agnes zu kämmen. Die Puppe hatte echtes Haar – Menschenhaar. Es war blond gefärbt, und die einzelnen Haare, kunstvoll verknotet und mit Leim befestigt, hafteten an einem Stück Leinwand.
Meggie kämmte. Die Zinken ihres Kamms verfingen sich im zottligen Haar der Puppe, und das Mädchen zerrte ungeschickt. Plötzlich passierte es, das Furchtbare. Das ganze Haar löste sich und hing jetzt als wirres Knäuel an den Zinken des Kamms. Über Agnes’ glatter Stirn war nichts, kein Kopf, kein kahler Schädel. Nur ein grauenvolles, klaffendes Loch. Zitternd beugte Meggie sich vor und spähte hinein. Die zarten Konturen des Puppengesichts, hier fanden sie sich gleichsam in umgestülpter Form wieder … die Wangen, das Kinn … zwischen den leicht geöffneten Lippen schimmerten die Zähne, nur dass sie auf dieser Seite schwärzlich wirkten, sehr hässlich … und ein Stück darüber befanden sich die beweglichen Puppenaugen … zwei entsetzliche Kugeln mit Draht daran, der Agnes’ Kopf durchbohrte …
Meggie stieß einen schrillen Schrei aus – gar nicht wie ein Kind. Sie schleuderte Agnes fort und schrie und schrie, am ganzen Körper zitternd, das Gesicht in den Händen verborgen. Dann spürte sie, wie Frank sie tröstend in die Arme nahm, und sie drängte sich Schutz suchend an ihn und legte ihren Kopf auf seine Schulter und fühlte sich mehr und mehr beschwichtigt; nahm sogar wahr, wie gut er doch roch, ganz nach Pferden und Schweiß und Eisen.
Als sie wieder ruhig war, ließ Frank sich von ihr erzählen, was sie so entsetzt hatte. Und dann nahm er die Puppe, blickte in ihren hohlen Kopf und fragte sich unwillkürlich, ob seine Kinderwelt früher auch so voll sonderbarer Schrecken gewesen war. Doch die bedrängenden Erinnerungen, die in ihm aufstiegen, hatten mit Menschen zu tun und ihrem Getuschel und ihren kalten Blicken; und mit dem kummervollen, wie verkniffenen Gesicht seiner Mutter; und mit dem Zittern ihrer Hand, die seine umschloss; und mit der eigentümlich gekrümmten Haltung ihrer Schultern.
Was hatte Meggie bloß gesehen, dass sie fast so etwas wie einen Schreikrampf bekam? Was war da in dem Kopf? Hätte Agnes, als sich ihr Haar löste, geblutet, Meggie wäre längst nicht so entsetzt gewesen. Bei den Clearys kam es mindestens einmal pro Woche vor, dass jemand heftig blutete.
»Ihre Augen, ihre Augen!«, flüsterte Meggie und weigerte sich, die Puppe anzusehen.
»Sie ist wunderschön, Meggie«, versicherte er. Er hielt sie noch in den Armen, unmittelbar vor sich ihr Haar, prachtvolles Haar, eine solche Fülle, eine solche Farbe.
Erst nach einer kleinen Ewigkeit brachte er sie dazu, wieder einen Blick auf Agnes zu werfen. Und eine weitere kleine Ewigkeit verging, bis er sie dazu überreden konnte, in das aufklaffende Loch des Puppenkopfs zu schauen. Er zeigte ihr, wie der Mechanismus der Augen funktionierte, wie sorgfältig alles gearbeitet war, damit sie sich, je nachdem, öffneten oder schlossen.
»Komm«, sagte er schließlich, »es wird Zeit, dass du hineingehst.« Mit Schwung hob er sie hoch, nahm auch die Puppe. »Wir werden Mum bitten, das bei ihr wieder in Ordnung zu bringen, nicht? Wir werden ihre Kleider waschen und bügeln und das Haar wieder befestigen. Und die Perlen … na, damit mach’ ich richtige Nadeln, damit sie nicht so einfach aus dem Haar rausfallen können und du Agnes prima frisieren kannst.«
Fiona Cleary schälte in der Küche Kartoffeln. Sie war eine sehr hübsche Frau, zart, ein wenig unter Mittelgröße, doch ihr Gesicht wirkte ziemlich hart und streng. Sie besaß eine ausgezeichnete Figur mit immer noch zierlicher Taille, trotz der sechs Kinder, die sie zur Welt gebracht hatte. Sie trug ein graues Baumwollkleid, das so lang war, dass sein Saum den makellos sauberen Boden berührte. Zum Schutz hatte sie sich eine enorm große, weiße und gestärkte Schürze vorgebunden. Das Trägerband schlang sich hinten um ihren Hals, auf dem Rücken in Höhe der Taille sah man eine perfekt gebundene, ein wenig steif abgespreizte Schleife. Von morgens bis abends war dies hier ihr Reich, die Küche und außerdem der Garten hinter dem Haus; und ihr Arbeitsleben glich einem kreisförmigen Pfad, der in sich selbst mündete und den sie unentwegt mit ihren derben, schwarzen Stiefeln abschritt: vom Herd zur Wäsche, von dort zum Gemüsegarten, dann zur Wäscheleine und wieder zurück zum Herd.
Sie legte ihr Messer auf den Tisch und starrte Frank und Meggie an. Ihr schön geformter Mund krümmte sich an den Winkeln abwärts.
»Meggie, heute Morgen habe ich dich dein Sonntagskleid anziehen lassen unter der Bedingung, dass du’s nicht schmutzig machst. Nun sieh sich das bloß mal einer an! Was für ein kleines Dreckferkel bist du doch!«
»Mum, es war nicht ihre Schuld«, erklärte Frank. »Jack und Hughie haben ihr die Puppe weggenommen, um zu sehen, wie sich die Arme und die Beine bewegen lassen. Aber das kann man alles wieder in Ordnung bringen, meinst du nicht? Ich hab’s Meggie versprochen.«
»Lasst mal sehen.« Fee streckte die Hand nach der Puppe aus.
Sie war eine eher wortkarge Frau. Niemand kannte ihre Gedanken, nicht einmal ihr Mann. Ohne Klage, ohne Widerrede tat sie, was immer er ihr befahl, es sei denn, sie hatte sehr gewichtige Gegengründe. Den Jungen war schon der Verdacht gekommen, sie habe vor Daddy einen genauso großen Heidenrespekt wie sie selbst. Aber falls das zutraf, so verbarg sie es wie unter einer schützenden Hülle: hinter einer Außenfront von Ruhe, Beherrschtheit und Strenge. Nie lachte sie, nie verlor sie die Fassung.
Nachdem sie die Puppe eingehend betrachtet hatte, legte sie sie auf die Küchenanrichte beim Herd und blickte zu Meggie.
»Morgen früh werde ich ihre Kleider waschen und sie frisieren. Frank könnte ihr vielleicht heute Abend nach dem Tee das Haar wieder ankleben und sie baden.«
Ihre Stimme klang eher sachlich als trostvoll. Meggie nickte und lächelte unsicher. Manchmal wünschte sie sich so sehr, ihre Mutter lachen zu hören, doch stets hoffte sie vergeblich darauf. Sie spürte, dass da etwas Besonderes war, das sie beide miteinander verband – etwas, das Daddy und die Jungen nicht mit ihnen teilten. Und doch: Es schien keinen Weg zu geben, der vorbeiführte an diesem abweisenden Rücken, den nie ruhenden Füßen. Ein gleichsam abwesendes Nicken war oft ihre einzige Antwort, während sie in rastlosem Hin und Her vom Tisch zum Herd, vom Herd zum Tisch wechselte und arbeitete, arbeitete, arbeitete.
Außer Frank konnte keines der Kinder ahnen, dass Fee immer und ewig müde war, oft knochentief müde. Es gab so viel zu tun, doch an Geld fehlte es und an Zeit. Und nur ein Paar Hände war da, um alles zu erledigen. Sie sehnte den Tag herbei, an dem Meggie alt genug sein würde, ihr zu helfen. Bereits jetzt übernahm das Kind einfache Aufgaben, aber mit seinen vier Jahren konnte es die Last natürlich noch nicht wirklich erleichtern. Sechs Kinder insgesamt, doch nur eines – und dazu noch das jüngste – ein Mädchen. All ihre Bekannten empfanden gleichzeitig Mitleid und Neid, aber dadurch wurde die Arbeit auch nicht getan. In ihrem Nähkorb befand sich ein wahrer Berg ungestopfter Socken, und ihre Stricknadeln steckten in einem angefangenen Strumpf. Hughie wuchs aus seinen Pullovern heraus, und bei Jack war’s noch nicht so weit, dass der die seinen an Hughie hätte weitervererben können.
Ein reiner Zufall wollte es, dass Padraic Cleary in dieser Woche, der Woche von Meggies Geburtstag, nach Hause kam. Mit der Saison für die Schafschur war es noch nicht so weit, und er hatte gerade in der Nähe einen vorübergehenden Job: pflügen und pflanzen. Von Beruf war er Schafscherer, doch das war Saisonarbeit und dauerte von der Mitte des Sommers bis zum Ende des Winters; danach kam dann das Lammen. Meist fand er reichlich Arbeit, um den Frühling und den ersten Sommermonat zu überbrücken. Er half beim Lammen und beim Pflügen und sprang auch beim Melken ein, wenn irgendwer in einer Molkerei diese ewige Zweimal-pro-Tag-Routine mal satthatte. Wo es Arbeit gab, dorthin machte er sich auf. Seine Familie ließ er in dem großen, alten Haus zurück, und sie musste sehen, dass sie allein zurechtkam. Das war keineswegs grob oder gefühllos von ihm: Wenn man nicht das Glück hatte, Land zu besitzen, blieb einem gar nichts anderes übrig.
Als er kurz nach Sonnenuntergang kam, brannten die Lampen, und Schatten huschten unruhig über die Wände und die hohe Decke. Auf der Hinterveranda spielten die Jungen mit einem Frosch. Nur Frank war nicht dabei. Doch Padraic wusste, wo er sich befand. Vom Holzhaufen her klangen die regelmäßigen Schläge einer Axt. Rasch gab er Jack einen Tritt ins Hinterteil, zog Bob am Ohr.
»Los, ihr kleinen Faulpelze! Helft Frank drüben beim Holz! Und seht zu, dass ihr damit fertig seid, bevor Mum den Tee auf dem Tisch hat. Sonst setzt es was!«
Gleich darauf war er in der Küche und nickte Fiona zu, die am Herd stand. Er gab ihr keinen Kuss, umarmte sie auch nicht. Ein solcher Austausch von Zärtlichkeiten zwischen Mann und Frau gehörte nach seiner Überzeugung ins Schlafzimmer. Seine Stiefel waren von Schlamm überkrustet, und als er sie jetzt auszog, benutzte er dazu den Stiefelknecht. Meggie kam hereingehüpft. Sie brachte ihm seine Hausschuhe, und er lächelte ihr zu: Wie stets, wenn er sie sah, überkam ihn ein eigentümliches Gefühl, eine Art Erstaunen. Wie hübsch war sie doch, und wie schön war ihr Haar! Er griff nach einer Locke, zog sie lang, ließ sie wieder los – nur um zu sehen, wie sie für Augenblicke hin und her tanzte. Dann hob er Meggie hoch und setzte sich auf den einzigen bequemen Stuhl, den es in der Küche gab, einen sogenannten Windsor-Stuhl. Er stand nicht weit vom Feuer, auf seiner Sitzfläche lag ein Kissen. Padraic seufzte behaglich, zog seine Pfeife hervor, klopfte sie am Stuhlbein aus. Aschen- und Tabakreste fielen auf den Fußboden, er achtete nicht weiter darauf. Meggie machte es sich auf seinem Schoß bequem und schlang ihre Arme um seinen Hals. Und dann wandte sie ihr Gesicht zu ihm empor und tat, was sie fast immer tat, wenn er abends zu Hause war. Sie spielte eine Art Spiel: beobachtete, wie das Licht gleichsam durch die kurzen, goldenen Stoppeln seines Bartes filterte.
»Wie geht’s dir, Fee?«, fragte Padraic Cleary.
»Gut, Paddy«, erwiderte seine Frau. »Hast du heute die untere Koppel geschafft?«
»Ja, ich bin fertig damit. Gleich morgen früh kann ich mit der oberen anfangen. Aber, Herrgott, was bin ich müde!«
»Hat MacPherson dir wieder diese alte Stute gegeben?«
»Aber ja. Könnte das Tier doch mal selber nehmen und mir den Rotschimmel überlassen, nicht? Fällt ihm nicht ein. Meine Arme fühlen sich wie aus den Gelenken gerissen. Ich schwöre dir, diese Stute hat das härteste Maul in En Zed.«
»Na, lass nur. Old Robertson hat nur gute Pferde, und du wirst schon bald dort sein.«
»Kann gar nicht bald genug sein.« Er stopfte groben Tabak in seine Pfeife und nahm aus dem großen Kasten beim Herd einen Span, den er kurz ins Feuerloch hielt. Das Holz flammte auf, und er lehnte sich zurück und sog die Luft durch den Pfeifenstiel so tief ein, dass aus dem Pfeifenkopf eigentümliche Blubbergeräusche klangen. »Wie fühlt man sich denn mit vier, Meggie?«, fragte er.
»Ziemlich gut, Daddy.«
»Hat Mum dir dein Geschenk gegeben?«
»Oh, Daddy, wie habt ihr das nur erraten, dass ich Agnes so gernhaben wollte?«
»Agnes?« Er warf Fee einen raschen Blick zu, lächelte. Seine Augenbrauen hoben sich fragend. »Ist das ihr Name: Agnes?«
»Ja. Sie ist wunderschön, Daddy. Ich möchte sie den ganzen Tag ansehen.«
»Sie kann von Glück sagen, dass sie noch was zum Ansehen hat«, erklärte Fee grimmig. »Jack und Hughie bekamen die Puppe nämlich zwischen die Finger, bevor Meggie überhaupt Gelegenheit hatte, einen richtigen Blick darauf zu werfen.«
»Nun ja, Jungs sind Jungs. Ist der Schaden schlimm?«
»Nichts, was sich nicht wieder in Ordnung bringen lässt. Bevor sie die Sache auf die Spitze treiben konnten, ist Frank ihnen dazwischengefahren.«
»Frank? Was hatte denn der hier zu suchen? Der sollte doch den ganzen Tag in der Schmiede arbeiten. Hunter will seine Tore haben.«
»Er war den ganzen Tag in der Schmiede. Er kam nur her, um irgendein Werkzeug zu holen«, sagte Fee hastig. Was seinen ältesten Sohn betraf, so war Padraic doch wirklich zu streng.
»Oh, Daddy, Frank ist der beste Bruder! Er hat meine Agnes gerettet, und nach dem Tee wird er für mich ihr Haar wieder ankleben.«
»Das ist gut«, sagte ihr Vater schläfrig. Er lehnte den Kopf zurück und schloss die Augen.
Es war heiß, so dicht am Herd, doch das schien ihn nicht zu stören. Glänzende Schweißperlen traten auf seine Stirn. Er schob die Arme hinter den Kopf und nickte ein.
Das dichte, lockige rote Haar, das sich in den verschiedensten Schattierungen bei den Cleary-Kindern fand, hatten sie von ihrem Vater, doch gar so grellrot wie bei ihm sah man es bei ihnen nicht. Er war ein kleiner Mann, der ganz aus Stahl und aus stählernen Federn zu bestehen schien. Die krummen Beine zeugten von einem Leben mit Pferden, und die Arme wirkten eigentümlich verlängert, was vom jahrelangen Schafscheren kam. Seine Brust und seine Arme waren golden behaart; bei dunklen Haaren hätte dieses Geflecht wohl hässlich ausgesehen. Die hellblauen Augen schienen stets ein wenig zusammengekniffen zu sein, wie bei einem Seemann, der in endlos weite Fernen späht. Sein Gesicht wirkte sympathisch, und stets lag der Hauch eines eigentümlichen Lächelns auf seinen Zügen, weshalb andere Männer ihn auf den ersten Blick mochten. Seine Nase war eine wahrhaft klassisch römische Nase, was seine irischen Mitbrüder verwundert haben musste – allerdings ist an irischen Gestaden so manches Schiff gelandet oder auch gestrandet. Noch immer sprach er in der schnellen, weichen und verwischten Art der Galway-Iren, doch nach fast zwanzig Jahren auf der anderen Seite des Globus klang alles ein wenig gedeckter und auch langsamer als früher – etwa wie bei einer alten Uhr, die mal wieder richtig aufgezogen werden müsste. Er war ein zufriedener Mensch, und mit dem harten und schweren Leben, das er führen musste, kam er besser zurecht, als das den meisten gelang. Zwar konnte er sehr streng sein, und er schrieb eine »Handschrift«, die keiner so leicht vergaß. Dennoch beteten ihn, mit einer Ausnahme, alle seine Kinder an. War nicht genügend Brot für die ganze Familie da, so verzichtete er für seinen Teil darauf. Und hieß es, entweder ein neues Kleidungsstück für ihn oder aber für einen seiner Sprößlinge, so kam ganz selbstverständlich das Kind an die Reihe. Das war gewiss ein größerer Beweis für seine Liebe, als es eine Million flüchtiger Küsse gewesen wäre. Allerdings brauste er leicht auf, und es konnte geschehen, dass es völlig mit ihm durchging: Er hatte einmal einen Mann getötet. Doch das Glück hatte ihm zur Seite gestanden. Der Mann war ein Engländer gewesen, und im Hafen von Dun Laoghaire lag ein Schiff, das im Begriff stand, nach Neuseeland auszulaufen.
Fiona ging zur Hintertür und rief: »Tee!«
Einer nach dem anderen marschierten die Jungen herein. Die Nachhut bildete Frank mit einem Armvoll Holz, das er in den großen Kasten beim Herd fallen ließ. Padraic hob Meggie von seinen Knien und stellte sie auf die Füße. Dann ging er zum Kopfende des Esstischs auf der anderen Seite der Küche. Die Jungen nahmen an den Längsseiten Platz, und Meggie krabbelte auf die Holzkiste, die ihr Vater auf den ihm zunächst stehenden Stuhl gestellt hatte.
Schnell und geschickt füllte Fee das Essen auf ihrem Arbeitstisch direkt in die Teller. Dann trug sie jeweils zwei zum Esstisch hinüber, zuerst für Paddy, dann für Frank und so weiter bis zu Meggie – für sich selbst zuletzt.
»Ooooch! Stew!«, sagte Stuart und zog ein Gesicht. »Warum heiße ich bloß nach so was – Stew-art!«
»Iss!«, befahl sein Vater grollend.
Die Teller waren groß, und Fee hatte sie buchstäblich mit Essen vollgehäuft: gekochte Kartoffeln, Lamm-Stew und Bohnen, frisch aus dem Garten. Trotz der allgemeinen Seufzer und sonstigen Bekundungen von Überdruss aß jeder, Stu nicht ausgenommen, seinen Teller leer und putzte ihn dann mit einer Brotscheibe blank. Anschließend wurden weitere Schnitten verdrückt, diesmal dick mit Butter und Stachelbeermarmelade bestrichen.
Fee setzte sich, schlang ihr Essen in sich hinein, war bereits wieder auf den Füßen und eilte zu ihrem Arbeitstisch zurück, wo sie mit einer Kelle große Mengen Biskuit, mit viel Zucker und Marmelade angerichtet, in Suppenteller schöpfte. Darüber goss sie dampfend heiße Custard-Sauce. Und wieder trug sie, jeweils zwei Teller nehmend, alles zum Esstisch. Und nahm dann mit einem Seufzer Platz – diesmal konnte sie mit Muße essen.
»Oh!«, rief Meggie glücklich und ließ ihren Löffel in die Custard-Sauce klatschen. »Jam-Roly-Poly!«
»Na, Meggie-Mädchen, ist ja dein Geburtstag. Da hat Mum dir deinen Lieblingspudding gemacht«, sagte ihr Vater lächelnd.
Diesmal meckerte niemand. Was immer der Pudding enthalten mochte, er wurde mit Genuss verspeist: Für Süßes waren die Clearys allemal zu haben.
Trotz der Riesenmengen kalorienreicher Nahrung hatte keiner von ihnen überflüssiges Fett auf den Rippen. Was immer sie in sich hineinstopften, wurde praktisch im Handumdrehen in Energie umgesetzt, sei es beim Spiel, sei es bei der Arbeit.
Jetzt schenkte Fee aus ihrer Riesenkanne für jeden Tee ein. Man trank, man unterhielt sich, oder man las, eine Stunde lang oder auch länger. Paddy, den Kopf in einem Bibliotheksbuch, schmauchte seine Pfeife. Immer wieder musste Fee nachgießen. Auch Bob beschäftigte sich mit einem Buch aus der Bibliothek, während die jüngeren Kinder Pläne für den nächsten Tag schmiedeten. In die Schule mussten sie jetzt nicht, denn die langen Sommerferien waren da, und die Jungen hatten allerlei Arbeiten im Haus und im Garten zugeteilt bekommen: Sie schienen recht begierig, diese in Angriff zu nehmen.
Überall, wo es draußen nötig war, sollte Bob den Anstrich erneuern. Für Jack und Hughie gab es gleich mehrere »Bereiche«: den Holzhaufen, die Außengebäude und die Melkerei. Für Stuart blieb der Gemüsegarten. Nun: samt und sonders Kinderspiel − jedenfalls im Vergleich zu den Schrecken der Schule.
Ab und zu hob Paddy die Nase aus seinem Buch und fügte der Liste einen weiteren Job hinzu. Fee schwieg, und Frank saß nur müde und schlaff da und trank eine Tasse Tee nach der anderen.
Schließlich winkte Fee Meggie herbei. Wie stets, bevor sie sie zusammen mit Stu und Hughie zu Bett brachte, band sie ihr das Haar mit Stofffetzen hoch. Jack und Bob entschuldigten sich und gingen nach draußen, um die Hunde zu füttern. Frank trug Meggies Puppe zum Arbeitstisch und machte sich daran, ihr wieder das Haar anzukleben.
Padraic klappte sein Buch zu und legte seine Pfeife in die große, schillernde Paua-Muschel, die ihm als Aschenbecher diente.
»Nun, Mutter, ich geh’ jetzt zu Bett.«
»Gute Nacht, Paddy.«
Fee räumte das Geschirr vom Esstisch fort und holte dann von einem Haken an der Wand eine große galvanisierte Wanne herunter, die sie auf ihren Arbeitstisch stellte, ein Stück von der Stelle entfernt, wo Frank mit der Puppe beschäftigt war. Dann nahm sie den schweren, gusseisernen Kessel vom Herd, in dem sich heißes Wasser befand. Das goss sie in die Wanne. Aus einer alten Blechdose schüttete sie kaltes Wasser hinzu. Hinter einer Art Drahtgeflecht war Seife. Sie begann, das Geschirr abzuwaschen.
Frank arbeitete an der Puppe, ohne auch nur einmal den Kopf zu heben. Aber als dann der Tellerstapel anwuchs, stand er wortlos auf, holte ein Geschirrtuch und begann abzutrocknen. Die behände Art, mit der er sich zwischen Arbeitstisch und Küchenanrichte hin- und herbewegte, zeugte von langer Vertrautheit. Es war ein heimliches, keineswegs ungefährliches Spiel, das er und seine Mutter spielten; denn die strengste Regel in Paddys Reich betraf die angemessene Verteilung der Pflichten. Hausarbeit war Frauensache, und damit hatte sich’s. Kein männliches Mitglied der Familie durfte bei »weiblichen« Aufgaben auch nur helfen. Doch Abend für Abend tat Frank eben dies, wenn Paddy zu Bett gegangen war: Er half seiner Mutter, und sie ermunterte und ermutigte ihn dazu, indem sie mit dem Geschirrspülen wartete, bis sie beide den dumpfen Aufprall von Paddys Latschen auf den Fußboden gehört hatten. Noch nie war Paddy danach in die Küche zurückgekommen.
Fee blickte Frank liebevoll an. »Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde, Frank. Dabei ist das gar nicht gut für dich. Du wirst morgen früh sehr müde sein.«
»Ist schon in Ordnung, Mum. So ein bisschen Geschirrabtrocknen bringt mich nicht um. Ist wenig genug, um dir das Leben etwas leichter zu machen.«
»Das gehört nun mal mit zu meiner Arbeit, Frank. Macht mir auch nichts weiter aus.«
»Ich wünschte nur, wir würden irgendwann mal reich werden, damit du ein Dienstmädchen haben könntest.«
»Das ist Wunschdenken!« Sie wischte ihre seifigen, roten Hände am Geschirrtuch ab und stemmte sie dann in die Hüften, seufzend. Aufmerksam betrachtete sie ihren Sohn, und in ihren Augen zeigten sich, undeutlich noch, Sorge und Unruhe: Sie spürte seine bittere Unzufriedenheit, die stärker und verzehrender zu sein schien als das übliche Aufbegehren eines Arbeiters gegen sein Los. »Frank, hab bloß keine großen Rosinen im Kopf. Denn das führt zu nichts Gutem. Wir gehören nun einmal zur arbeitenden Klasse. Und das bedeutet, dass wir nicht reich werden und uns auch keine Dienstmädchen leisten können. Sei zufrieden mit dem, was du bist und was du hast. Wenn du so etwas sagst, dann beleidigst du Daddy, und das hat er nicht verdient. Das weißt du. Er trinkt nicht, er spielt nicht, und er arbeitet furchtbar hart für uns. Kein Penny, den er verdient, wandert in seine Tasche. Alles kommt uns zugute.«
Die muskulösen Schultern spannten sich ungeduldig, das dunkle Gesicht wirkte hart und grimmig. »Aber was ist denn so Schlechtes daran, wenn man sich vom Leben mehr wünscht als nur Plackerei? Und was ist so verkehrt, wenn ich meine, es wäre gut, wenn du ein Dienstmädchen hättest?«
»Es ist nicht richtig, weil es nicht sein kann! Du weißt, dass kein Geld da ist, um dich auf der Schule zu lassen, und wenn du nicht auf der Schule bleiben kannst, wie soll dann je mehr aus dir werden als ein Mann, der sich mit seiner Hände Arbeit sein Brot verdienen muss? Dein Akzent, deine Kleidung und deine Hände beweisen, dass du dich durch körperliche Arbeit ernähren musst. Aber es ist ja keine Schande, Schwielen an den Händen zu haben. Genau wie Daddy sagt – wenn ein Mann schwielige Hände hat, weißt du, dass er ein ehrlicher Kerl ist.«
Frank zuckte die Schultern und schwieg. Das Geschirr wurde fortgeräumt. Fee holte ihren Nähkorb hervor und setzte sich auf Paddys Stuhl beim Feuer. Frank arbeitete an der Puppe weiter.
»Arme kleine Meggie!«, sagte er plötzlich.
»Warum?«
»Als diese kleinen Schlingel heute an ihrem Püppchen herumzerrten, stand sie weinend da, und – und ihre ganze Welt schien in Scherben zu liegen.« Er blickte auf die Puppe, deren Haar wieder an Ort und Stelle saß. »Agnes! Wo, um Himmels willen, hat sie solch einen Namen her?«
»Sie muss gehört haben, wie ich von Agnes Fortescue-Smythe sprach – nehme ich jedenfalls an.«
»Als ich ihr die Puppe zurückgab, sah sie ihr in den Kopf und starb fast vor Angst. Irgendwas an den Augen erschreckte sie, aber was, weiß ich auch nicht.«
»Meggie sieht immer Dinge, die es gar nicht gibt.«
»Es ist ein Jammer, dass nicht genug Geld da ist, um die Kleinen auf der Schule zu lassen. Sie sind so gescheit.«
»Oh, Frank! Wenn Wünsche Pferde wären, könnten Bettler vielleicht reiten«, sagte seine Mutter müde. Sie fuhr sich mit der Hand über die Augen. Ihre Finger zitterten leicht. Sie stach die Stopfnadel tief in ein Knäuel grauer Wolle. »Ich kann nicht mehr. Ich bin zu müde, um noch richtig zu sehen.«
»Geh zu Bett, Mum. Ich werde die Lampen ausblasen.«
»Sobald ich das Feuer geschürt habe.«
»Das mach’ ich schon.« Er stand auf und setzte die zierliche Puppe auf die Küchenanrichte hinter ein Kuchenblech – dieses gleichsam als Schutzschild benützend. Doch im Grunde war er nicht im mindesten darüber besorgt, dass sich die Jungen ein zweites Mal an Agnes vergreifen würden. Sie fürchteten seine Vergeltung mehr als eine Bestrafung durch ihren Vater. Irgendwie haftete ihm etwas Gewalttätiges an. War er mit seiner Mutter oder seiner Schwester zusammen, so merkte man nichts davon. Doch die Jungen hatten alle darunter zu leiden.
Fee beobachtete ihn, und das Herz tat ihr weh. Etwas Wildes und Verzweifeltes sprach aus ihm, ein manchmal geradezu unbändiger Trotz. Wenn er und Paddy sich nur besser miteinander vertragen wollten. Aber sie waren kaum jemals derselben Meinung. Fortwährend stritten sie sich. Vielleicht zeigte Frank sich um sie, Fee, allzu besorgt. Vielleicht hatte er tatsächlich ein bisschen was von einem Muttersöhnchen an sich. Falls das zutraf, war es ihre Schuld. Immerhin bewies es, dass er ein gutes, liebevolles Herz besaß. Er wollte ihr das Leben nur ein wenig leichter machen. Und wieder sehnte sie den Tag herbei, an dem Meggie alt genug war, um ihr zu helfen: Dann brauchte er sich mit der Extraarbeit für seine Mutter nicht mehr so zu plagen.
Sie nahm eine kleine Lampe vom Tisch, stellte sie jedoch wieder zurück. Dann ging sie zu Frank, der jetzt vor dem Herd hockte und Brennholz ins Feuerloch nachschob. Auf seinen weißen Armen traten die Adern hervor, in die Haut seiner feingeformten Hände war der Arbeitsschmutz so tief eingegraben, dass er sie nie richtig sauber bekam.
Wie zaudernd streckte Fee ihre Hand aus, und ganz sacht strich sie Frank das glatte, schwarze Haar aus den Augen. Es war das Äußerste an zärtlicher Geste, wozu sie sich je bringen konnte.
»Gute Nacht, Frank, und danke schön.«
Als Fee lautlos durch die Tür zum vorderen Teil des Hauses trat, huschten und zuckten die Schatten vor ihr her.
Frank und Bob teilten sich das erste Schlafzimmer. Leise öffnete sie die Tür und hielt die Lampe in den Raum. Das Licht fiel über das Doppelbett in der Ecke. Bob lag auf dem Rücken, den Mund geöffnet, mit unruhig zitternden und zuckenden Gliedern. Sie trat zu ihm und drehte ihn auf die Seite, ehe er, in der Rückenlage, einem immer schlimmer werdenden Alptraum zum Opfer fallen konnte. Dann stand sie einen Augenblick und betrachtete ihn. Wie sehr er doch Paddy glich!
Im nächsten Zimmer lagen Jack und Hughie: fast schon ineinanderverschlungen. Furchtbare Lausejungs. Heckten dauernd etwas aus, waren aber nicht bösartig. Vergeblich versuchte Fee, die beiden jetzt voneinander zu lösen und das Bettzeug wieder in Ordnung zu bringen. Die Rotschöpfe mit den krausen Locken ließen sich einfach nicht voneinander trennen. Mit einem leisen Seufzer gab Fee den Versuch auf. Wie brachten es die beiden nur fertig, sich trotzdem im Schlaf zu erholen? Es schien ihnen sogar ausgezeichnet zu bekommen.
Das Zimmer, in dem Meggie und Stuart schliefen, hätte sie sich heller und fröhlicher gewünscht, waren diese beiden da doch die Kleinsten, die Nestlinge sozusagen. Doch der Raum mit den braunen Wänden, an denen kein einziges Bild hing, und dem braunen Linoleum auf dem Fußboden wirkte eher trist und trüb und unterschied sich in dieser Hinsicht in nichts von den anderen Schlafzimmern.
Stuart schien gleichsam umgestülpt. Dort, wo sein Kopf hätte sein sollen, fand sich ein Stück Nachthemd, das sich über sein Hinterteil spannte. Fee tastete nach dem Kopf, der dicht bei den Knien lag. Wieder einmal wunderte sie sich, dass der Junge unter der Bettdecke nicht erstickte. Mit den Fingerkuppen strich sie über das Laken und erstarrte für einen Augenblick. Wieder nass! Nun, das würde bis morgen früh warten müssen, und dann war mit Sicherheit auch das Kissen nass. Das ging immer so bei ihm: Er drehte sich mit dem Kopf zum Fußende und nässte dann zum zweiten Mal ein. Nun, ein Bettnässer unter fünf Jungen, das ging noch.
Meggie lag zu einem kleinen Bündel zusammengerollt, Daumen im Mund, Kopf wie umkränzt von lauter mit Stoffstreifen umwickelten Locken. Das einzige Mädchen. Fee betrachtete sie nur mit einem flüchtigen Blick, bevor sie hinausging. An Meggie war nichts Geheimnisvolles. Sie war ein Mädchen, und Fee wusste, welches Los sie erwartete. Das löste bei ihr weder Neid noch Mitleid aus.
Die Jungen hingegen waren etwas ganz anderes. Sie waren Wunder: männliche Wesen, die wie durch geheimnisvolle Alchimie aus ihrem, Fionas, weiblichen Körper gekommen waren. Es fiel gewiss nicht leicht, im Haus ohne Hilfe auskommen zu müssen, andererseits war es jedoch die Sache wert. Unter den Männern seines Standes genoss Paddy, seiner Söhne wegen, besonderes Ansehen. Ein Mann, der Söhne gezeugt hatte, war auf jeden Fall ein richtiger Mann.
Sie betrat das Schlafzimmer, in dem sie und Paddy schliefen. Leise zog sie die Tür hinter sich zu, stellte die Lampe auf eine Kommode. Mit flinken Fingern öffnete sie die fast zahllosen winzigen Knöpfe ihres Kleides, die vom hohen Kragen bis zum Mittelteil reichten. Sodann zog sie die Arme heraus. Auch aus dem Kamisol befreite sie sich, hielt es jedoch sofort vor ihre Brust. Jetzt schlüpfte sie, ohne das Kamisol loszulassen, mit einiger Mühe in ein langes Nachthemd. Und erst nachdem sie züchtig bedeckt war, legte sie die übrigen Kleidungsstücke ab, Kamisol und Unterhosen und locker geschnürtes Korsett.
Nun zog sie die Nadeln aus dem sorgfältig hochgesteckten Haar. In goldener Flut fiel es herab. Wunderschönes Haar war es, kräftig und voll Glanz und sehr glatt. Doch so aufgelöst, so buchstäblich ungebunden und frei blieb es nur wenige Sekunden. Schon hob Fee die Ellbogen über den Kopf und die Hände in den Nacken. Rasch und geschickt begann sie, das Haar zu flechten.
Dann wandte sie sich zum Bett herum und hielt unbewusst für den Bruchteil einer Sekunde den Atem an. Doch Paddy schlief, und sie seufzte erleichtert auf. Nicht, dass es nicht nett gewesen wäre, wenn Paddy dafür in Stimmung war, denn er war ein scheuer, zärtlicher, rücksichtsvoller Liebhaber.
Doch … nun, es war ratsam, mit dem nächsten Kind zu warten, bis Meggie zwei oder drei Jahre älter war.
2
Wenn die Clearys sonntags zur Kirche fuhren, musste Meggie mit einem der älteren Jungen zu Hause bleiben, und sie sehnte den Tag herbei, an dem auch sie würde mitfahren dürfen. Padraic Cleary war der Meinung, dass kleine Kinder außer im eigenen Haus in keinem Haus sonst etwas zu suchen hatten, und das schloss Gotteshäuser mit ein. Ging Meggie erst einmal zur Schule und konnte man darauf vertrauen, dass sie still saß, so durfte sie auch zur Kirche mit. Vorher nicht. Und so stand sie jeden Sonntagmorgen beim Ginsterbusch am Vordertor, traurig, tief bedrückt, während die Familie in den alten Klapperkasten stieg und der als Meggies Hüter abbeorderte ältere Bruder ganz so tat, als wäre er heilfroh, auf diese Weise dem Gottesdienst zu entkommen. Dabei klebten alle Clearys gleichsam mit Elementarkraft aneinander. Der Einzige, der da eine Ausnahme machte, war Frank. Er genoss es durchaus, von den anderen getrennt zu sein.
Religion war für Paddy ein unerschütterlich fester Bestandteil seines Lebens. Als er Fee geheiratet hatte, wurde das von katholischer Seite recht unwillig akzeptiert, denn Fee war ein Mitglied der Kirche von England – war es zumindest bis dahin gewesen. Paddy zuliebe gab sie ihren Glauben auf, weigerte sich jedoch, stattdessen seinen anzunehmen. Weshalb, ließ sich schwer sagen. Allerdings gehörten die Armstrongs zu den alten Pioniergeschlechtern mit dem sozusagen makellosen Wappen des anglikanischen Glaubens, während Paddy ein armer Einwanderer war, dazu noch einer außerhalb des Schoßes ihrer Kirche. Lange bevor dort die ersten »offiziellen« Siedler eintrafen, hatte es in Neuseeland bereits Armstrongs gegeben, und das war so etwas wie ein kolonialer Adelsbrief. Aus der Armstrong-Perspektive ließ sich nur feststellen, dass Fee eine schockierende Mesalliance eingegangen war.
Roderick Armstrong hatte den Neuseeland-Clan auf höchst sonderbare Weise begründet.
Das Ganze begann mit einem Ereignis, das auf das England des 18. Jahrhunderts viele unvorhergesehene Auswirkungen haben sollte: mit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Bis 1776 waren alljährlich über eintausend verurteilte Verbrecher von England nach Virginia sowie Nord- und Süd-Carolina deportiert worden. Dort hatten sie Zwangsarbeit zu leisten unter Bedingungen, die nicht besser waren als jene für Sklaven. Die britische Rechtsprechung zu dieser Zeit konnte nicht anders als grausam und gnadenlos genannt werden. Auf Mord, Brandstiftung, das geheimnisvolle Verbrechen der »Verkörperung von Ägyptern« und Diebstahl (sofern das Gestohlene einen Wert von mehr als einem Shilling hatte) stand der Tod am Galgen. Bei minderen Delikten musste der Täter mit Deportation nach Amerika rechnen, und zwar auf Lebenszeit.
Als dann 1776 die Amerikaner sozusagen die Tore dichtmachten, wusste England bald nicht mehr, wohin mit seinen Verurteilten. Die Gefängnisse waren zum Bersten gefüllt. Was sich dort nicht mehr unterbringen ließ, stopfte man in die Rümpfe abgetakelter Schiffe, die in den Flussmündungen festgemacht lagen. Irgendetwas musste geschehen, und es geschah auch etwas.
Mit großem Widerstreben – weil die Kosten für das Unternehmen mehrere tausend Pfund betrugen – gab man Captain Arthur Philip den Befehl, nach dem Great South Land, dem Großen Südland, in See zu stechen. Das war im Jahr 1787. Seine Flotte von elf Schiffen hatte über eintausend Verurteilte an Bord, außerdem Matrosen, Seeoffiziere und ein Kontingent Marinesoldaten. Eine ruhmreiche Odyssee auf der Suche nach Freiheit war dies wirklich nicht. Ende Januar 1788, acht Monate nach dem Aufbruch von England, erreichte die Flotte die Botany Bay. Seine Verrücktheit George III. hatte für seine Sträflinge einen neuen Abladeplatz gefunden: die Kolonie Neusüdwales.
1801 wurde Roderick Armstrong im Alter von zwanzig Jahren zur Deportation auf Lebenszeit verurteilt. Spätere Armstrong-Generationen behaupteten, er sei vornehmer Abstammung gewesen. Seine Familie, in Somerset ansässig, habe nach der Amerikanischen Revolution ihr Vermögen verloren. Und von einem Verbrechen könne bei ihm überhaupt nicht die Rede sein. Allerdings hatte kein Armstrong je ernsthafte Anstrengungen unternommen, die Vergangenheit des berühmten Vorfahren zu erforschen. Man sonnte sich im Abglanz seiner angeblichen Gloriole und improvisierte im Übrigen ein wenig.
Wie es um seine Herkunft auch bestellt sein mochte, der junge Roderick Armstrong war jedenfalls ein Heißsporn. Während der unglaublich harten achtmonatigen Überfahrt nach Neusüdwales erwies er sich als ganz besonders schwieriger Fall, aber er starb nicht – verweigerte sozusagen auch hierin den Gehorsam. Als er 1803 in Sydney eintraf, wurde es mit ihm noch schlimmer, und so wurde er zur Norfolkinsel gebracht und in das Gefängnis für Widerspenstige gesteckt. Doch nichts konnte ihn gefügig machen. Man ließ ihn hungern. Man pferchte ihn in eine Zelle, die so klein war, dass er dort nicht sitzen, nicht liegen, ja nicht einmal richtig stehen konnte. Man prügelte ihn, bis er einer einzigen blutigen Masse glich. Man kettete ihn an einen Felsen im Meer und ließ ihn halb ertrinken. Und er lachte seinen Peinigern ins Gesicht: ein Haufen Knochen in dreckigen Lumpen, mit Narben am ganzen Körper und ohne einen Zahn im Mund. Doch in ihm brannte eine Flamme aus Erbitterung und Trotz, die unverlöschbar zu sein schien. Am Anfang eines jeden Tages schwor er sich, nicht zu sterben, und am Ende eines jeden Tages lachte er triumphierend, weil er noch am Leben war.
1810 schaffte man ihn nach Van-Diemens-Land und steckte ihn in einen Trupp von Kettensträflingen, der durch das eisenharte Sandsteingelände hinter Hobart mit Pickhacken eine Straße zu bahnen hatte. Roderick benutzte bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit seine Picke, um damit dem Oberaufseher ein Loch in den Brustkorb zu hacken. Sodann massakrierten er und zehn weitere Sträflinge weitere fünf Aufseher, indem sie ihnen Zentimeter für Zentimeter das Fleisch von den Knochen schabten, bis die Männer unter gellendem Geschrei verendeten. Denn Sträflinge wie Aufseher waren Bestien – Urwesen gleichsam, die keine menschlichen Gefühle mehr kannten.
Mit dem Schnaps und dem Proviant ihrer Opfer kämpften sich die elf Männer voran durch endlose, kalte Regenwälder. In der Walfangstation Hobart stahlen sie ein Langboot und machten sich auf über die Tasman-See. Proviant hatten sie nicht mehr, und sie hatten auch kein Trinkwasser und keine Segel. Als das Langboot an die wilde Westküste von Neuseelands Südinsel gespült wurde, waren nur noch Roderick Armstrong und zwei andere Männer am Leben. Nie ließ er über diese unglaubliche Fahrt ein Wort fallen, aber man flüsterte sich zu, die drei hätten nur überlebt, indem sie ihre schwächeren Gefährten töteten und aßen.
Neun Jahre waren seit seiner Deportation aus England vergangen. Noch immer war er ein junger Mann, doch er sah aus wie sechzig. Als 1840 die ersten »amtlich genehmigten« Siedler eintrafen, hatte er im reichen Canterbury-Distrikt der Südinsel für sich längst Land gerodet und außerdem eine Maori-Frau geheiratet – ohne irgendeine Trauungsurkunde allerdings – und mit ihr dreizehn hübsche halbpolynesische Kinder gezeugt. Gegen 1860 waren die Armstrongs Kolonial-Aristokraten. Ihre männlichen Sprösslinge schickten sie nach England auf exklusive Schulen, und ihre Abstammung von einem wahrhaft bemerkenswerten Mann bewiesen sie durch ein wahrhaft bemerkenswertes Besitzstreben, das sich mit einem erstaunlichen Quantum List und Verschlagenheit paarte. Rodericks Enkelsohn James hatte Fiona gezeugt, die 1880 zur Welt gekommen war: das einzige Mädchen unter insgesamt fünfzehn Kindern.
Vielleicht entbehrte Fee die protestantischen Rituale ihrer Jugend, die einfacher und nüchterner gewesen waren. Anmerken ließ sie sich davon jedoch nichts. Sie respektierte Paddys religiöse Überzeugungen und besuchte mit ihm die Messe. Auch sorgte sie dafür, dass ihre Kinder ausschließlich an einen katholischen Gott glaubten. Aber da sie nie konvertiert war, fehlte es denn doch an gewissen Dingen, zum Beispiel an den Tisch- oder den Gute-Nacht-Gebeten – eben an ausgeübter Alltagsfrömmigkeit.
Außer der einen Fahrt vor nunmehr anderthalb Jahren hatte Meggie noch keine weitere gemacht. Damals war es nach Wahine gegangen, wo sie im General Store dann Agnes gesehen hatte. Aber das war auch alles gewesen. Sonst war sie noch nie von zu Hause fortgekommen.
Am Morgen ihres ersten Schultages war sie so aufgeregt, dass sie ihr Frühstück erbrach. Also musste sie gesäubert werden. Also blieb gar nichts anderes übrig, als ihr das schöne neue marineblaue Kleid mit dem großen weißen Matrosenkragen auszuziehen und sie wieder in diesen scheußlichen braunen wollenen Fetzen zu stecken, der sie am Hals immer zu würgen schien, weil er zu eng schloss.
»Und, Herrgott noch mal, Meggie, wenn dir das nächste Mal übel wird, dann sag mir das! Sitz nicht einfach da, bis es zu spät ist! Und jetzt musst du dich beeilen, denn wenn du zu spät kommst, gibt Schwester Agatha dir bestimmt was mit dem Stock. Benimm dich und halte dich an deine Brüder.«
Als Fee Meggie schließlich zur Tür hinausschob, hüpften Bob, Jack, Hughie und Stu am Vordertor bereits ungeduldig von einem Fuß auf den anderen.
»Los, Meggie, sonst kommen wir zu spät!«, rief Bob und setzte sich in Bewegung.
Seine Brüder folgten ihm, und Meggie ihrerseits folgte den Jungen. Um einigermaßen mitzuhalten, müsste sie in eine Art Laufschritt fallen.
Es war kurz nach sieben. Die sanfte Sonne schien schon seit mehreren Stunden, und nur an schattigen Stellen fand sich auf dem Gras noch Tau. Die Straße nach Wahine war eigentlich nur ein Feldweg mit zwei tiefen Furchen, den Spuren rollender Wagenräder. Im hohen Gras zu beiden Seiten blühten mit üppiger Pracht rötliche Kapuzinerkresse und weiße Calla. Dahinter befanden sich Holzzäune, die fremden Besitz begrenzten oder, präziser: vor dem Eindringen Unbefugter schützten oder doch schützen sollten.
Auf dem Weg zur Schule marschierte Bob immer oben auf den Zäunen zur rechten Hand entlang, wobei er seine Schultasche gern auf dem Kopf balancierte. Die Zäune zur linken Hand waren gleichsam Jacks Revier, sodass für die drei jüngeren Clearys die »Straße« blieb. Es ging einen ziemlich steilen Anstieg hinauf, und oben, wo die Robertson-Straße in die Wahine-Straße mündete, blieben sie einen Augenblick keuchend stehen, fünf leuchtend rote Schöpfe vor dem weiß-blauen Himmel. Jetzt ging es hügelabwärts, und das ließ man sich schon eher gefallen: Die Kinder fassten sich bei den Händen und liefen den grasbewachsenen Wegrand hinab, bis er unter einem wahren Blumengewirr gleichsam verschwand. Hätten sie nur Zeit dafür gehabt, so wären sie unter Mr. Chapmans Zaun hindurchgekrochen, um wie Steinbrocken den Hang hinunterzukugeln.
Vom Cleary-Haus bis Wahine waren es etwa acht Kilometer, und als Meggie in der Ferne endlich die Telegrafenpfähle sah, zitterten ihr die Beine. Bob warf ihr ungeduldige Blicke zu. Seine Ohren waren gleichsam schon für das Läuten der Schulglocke gespitzt. Das Gesicht seiner kleinen Schwester war ziemlich rot und wirkte dennoch irgendwie blass. Seufzend gab Bob seine Schultasche Jack.
»Komm, Meggie«, sagte er brummig. »Das letzte Ende trage ich dich huckepack.« Scharf musterte er seine Brüder: Dass die ja nicht glaubten, er sei im Gemüt jetzt plötzlich pflaumenweich!
Meggie kletterte auf seinen Rücken und machte sich’s dort bequem. Jetzt konnte sie sich in aller Behaglichkeit Wahine ansehen.
Viel zu sehen gab es da allerdings nicht. Wahine war kaum mehr als ein großes Dorf, zu beiden Seiten einer in der Mitte geteerten Straße gelegen. Das größte Gebäude war das zweistöckige Hotel. Dort überspannte ein von Pfeilern gestützter Baldachin den Gehsteig, hauptsächlich zum Schutz gegen die Sonne. Das zweitgrößte Gebäude war der General Store, der sich gleichfalls einer solchen schützenden Plane rühmen durfte. Außerdem standen vor seinen vollgepfropften Fenstern Sitzbänke, auf denen sich Passanten ausruhen konnten. Vor der Freimaurerhalle stand ein Fahnenmast, an dem in der steifen Brise ein ziemlich zerlappter Union Jack flatterte. So etwas wie eine Automobilwerkstatt gab es in der Stadt noch nicht, denn der Besitz von »pferdelosen Kutschen« war auf einige wenige beschränkt. Doch nicht weit von der Freimaurerhalle stand eine Schmiede mit einem Stall dahinter, und fast unmittelbar neben dem Pferdetrog sah man die Benzinpumpe. Das einzige Gebäude in der gesamten Siedlung, das wirklich den Blick auf sich zog, war ein sonderbar hellblauer Laden – sehr unbritisch: Alle anderen Gebäude trugen einen Anstrich von nüchternem Braun. Die öffentliche Schule und die anglikanische Kirche standen Seite an Seite, direkt gegenüber der Heiligen-Herz-Kirche und der katholischen Schule.
Während die Cleary-Kinder am General Store vorübereilten, erklang die Glocke der katholischen Schule, fast unmittelbar gefolgt vom lauteren Schall der größeren Glocke vor der öffentlichen Schule. Bob fiel in eine Art Trab, und sie liefen auf einen kiesbestreuten Hof, wo sich gerade rund fünfzig Kinder vor einer kleinen Nonne formierten, die einen biegsamen Stock schwang, der länger zu sein schien als sie. Ohne dass es ihm gesagt werden musste, stellte Bob sich mit seinem Trupp abseits der anderen Kinder auf, den Blick auf den Stock der Nonne gerichtet.
Das Herz-Jesu-Kloster hatte zwei Stockwerke, was man jedoch nicht sofort bemerkte, da es hinter einer Umfriedung ein Stück von der Straße entfernt stand. Im oberen Stockwerk wohnten die drei Barmherzigen Schwestern mit einer vierten Nonne, die als Haushälterin fungierte und die man nie zu Gesicht bekam. Im Erdgeschoss gab es drei große Räume, wo unterrichtet wurde. Rings um das rechteckige Gebäude lief eine breite, schattige Veranda. Dort durften sich die Kinder, hauptsächlich während der Pausen, an Regentagen aufhalten. An Sonnentagen war das verboten. Es gab mehrere große Feigenbäume auf dem Grundstück, und hinter der Schule fiel das Gelände ab und bildete unten eine kreisförmige Grasfläche, die man euphemistisch »Kricketplatz« getauft hatte. Tatsächlich wurde dort am häufigsten Kricket gespielt.