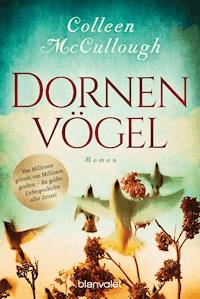Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Masters of Rome
- Sprache: Deutsch
Das lodernde Feuer der Vergeltung ergreift die Einheit des Imperiums … 99 v. Chr.: Für seine herausragenden Verdienste im Militär wird Sulla mit der corona graminea ausgezeichnet – eine Ehrung des Volkes, die ihm die Aufmerksamkeit der römischen Adelsfamilien einbringt, denen jede Intrige zum Erhalt ihrer Privilegien recht ist. Machthungrig und bereits viel zu lange im Schatten seines alten Freundes Gaius Marius, kann Sulla nicht länger warten bis der Retter der Republik endlich abtritt. Und so – mit dem Heer, das er eigentlich gegen den pontischen König Mithridates führen sollte – marschiert Sulla gegen Rom selbst. Doch der Kampf der Titanen ist noch nicht entschieden, denn der Erste Mann Roms verfällt langsam dem Wahnsinn … Band 2 in dem herausragend recherchierten Historienepos »Masters of Rome« von der Bestsellerautorin Colleen McCullough – für Fans von Simon Scarrow.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1755
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
99 v. Chr.: Für seine herausragenden Verdienste im Militär wird Sulla mit der corona graminea ausgezeichnet – eine Ehrung des Volkes, die ihm die Aufmerksamkeit der römischen Adelsfamilien einbringt, denen jede Intrige zum Erhalt ihrer Privilegien recht ist. Machthungrig und bereits viel zu lange im Schatten seines alten Freundes Gaius Marius, kann Sulla nicht länger warten bis der Retter der Republik endlich abtritt. Und so – mit dem Heer, das er eigentlich gegen den pontischen König Mithridates führen sollte – marschiert Sulla gegen Rom selbst. Doch der Kampf der Titanen ist noch nicht entschieden, denn der Erste Mann Roms verfällt langsam dem Wahnsinn …
Über die Autorin:
Colleen McCullough (1937-2015) wurde in Wellington geboren und wuchs in Sydney auf. Nach einem Studium der Neurologie arbeitete sie in verschiedenen Krankenhäusern in Australien und England, bevor sie einige Jahre nach Amerika ging, um an der Yale University zu forschen und zu lehren. Hier entdeckte sie auch ihre Liebe zum Schreiben, wobei ihre ersten beiden Romane direkt zu internationalen Bestsellern aufstiegen.
Colleen McCullough veröffentlichte bei dotbooks Ihre Romane »Die Frauen von Missalonghi« und »Die Stadt der Hoffnung«. Außerdem erschien von der Autorin das mitreißende Historienepos »Masters of Rome« mit den Einzeltiteln »Adler des Imperiums«, »Günstlinge der Götter«, »Das Blut des Spartacus«, »Caesars Frauen«, »Tochter des Adlers« und »Die Wasser des Rubikon«.
***
eBook-Neuausgabe April 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1991 unter dem Originaltitel »The Grass Crown« bei William Morrow & Co., New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1991 unter dem Titel »Eine Krone aus Gras« bei C. Bertelsmann Verlag GmbH
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1991 by William Morrow & Co., New York
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1991 bei C. Bertelsmann Verlag GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Mihi_Tamasila und AdobeStock/DALU11 und Dennis
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ma)
ISBN 978-3-98952-645-7
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Colleen McCullough
Die Krone der Republik
Masters of Rome 2
Aus dem Amerikanischen von Hans Bangerter, Karl-Heinz Dürr und Enrico Heinemann
dotbooks.
Widmung
TEIL I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
TEIL II
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
TEIL III
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
TEIL IV
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
TEIL V
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
TEIL VI
Kapitel 24
TEIL VII
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
TEIL VIII
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
TEIL IX
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
TEIL X
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Die handelnden Personen
Die Konsuln
Lesetipps
Widmung
FÜR
FRANK ESPOSITO
DEN ICH SEHR BEWUNDERE,IN LIEBE UND DANKBARKEIT
TEIL I
Kapitel 1
»Das Aufregendste, was in den letzten fünfzehn Monaten passiert ist«, sagte Gaius Marius, »das war doch der Elefant, den Gaius Claudius bei den Römischen Spielen zeigte.«
Aelia strahlte. »Ganz wunderbar war er«, rief sie, lehnte sich auf ihrem Stuhl nach vorne und griff in die Schale mit den großen grünen Oliven, die aus Hispania Ulterior importiert worden waren. »Wie er auf seinen Hinterbeinen herumtapste! Und auf allen vieren tanzte! Und auf einem Sofa saß und sich selbst mit dem Rüssel fütterte!«
Lucius Cornelius Sulla sah seine Frau verächtlich an und sagte kalt: »Was gefällt den Menschen eigentlich so daran, wenn Tiere Menschen nachäffen? Der Elefant ist die edelste Kreatur der Welt. Gaius Claudius Pulchers Tier kam mir wie eine doppelte Karikatur vor – die Karikatur eines Menschen und die eines Elefanten.«
Für den Bruchteil einer Sekunde entstand eine Pause, die von allen im Speisezimmer Anwesenden mit Unbehagen registriert wurde. Dann lenkte Julias fröhliches Lachen die Aufmerksamkeit von der unglücklichen Aelia ab. »Ach komm, Lucius Cornelius, er war der absolute Liebling von allen!« sagte sie. »Ich habe ihn jedenfalls auch sehr bewundert – er war so klug und so eifrig! Und wie er den Rüssel hob und im Rhythmus mit der Trommel trompetete – erstaunlich! Und er schien es gern zu tun.«
»Seine Farbe gefiel mir so gut«, warf Aurelia ein, um auch etwas zu sagen. »Rosa!«
Aber Lucius Cornelius Sulla hörte schon nicht mehr zu. Er hatte sich umgedreht und redete nun mit Publius Rutilius Rufus.
Julia seufzte mit traurigen Augen. »Gaius Marius«, sagte sie zu ihrem Mann, »ich glaube, es ist Zeit, daß wir Frauen uns zurückziehen und euch Männer dem Wein überlassen. Entschuldigt uns bitte.«
Marius’ Hand kam über den schmalen Tisch zwischen seiner Liege und Julias Stuhl; Julia umfing sie liebevoll mit ihrer eigenen Hand und versuchte, sich von seinem verzerrten Lächeln nicht noch mehr bekümmern zu lassen. Es war doch schon so lange her! Aber noch immer waren in seinem Gesicht die Spuren jenes heimtückischen Schlaganfalls zu lesen. Und was die ergebene und liebende Ehefrau nicht einmal sich selbst eingestand: Der Schlaganfall hatte auch in Gaius Marius’ Geist seine Spuren hinterlassen. Sein Temperament ging nun zu leicht mit ihm durch, kleine Kränkungen, die zudem weitgehend eingebildet waren, machten ihm mehr zu schaffen, und er begegnete seinen Feinden unversöhnlicher als vorher.
Julia stand auf, löste mit einem ganz besonderen Lächeln, das nur für ihren Mann bestimmt war, ihre Hand aus der seinen und legte sie auf Aelias Schulter. »Komm, meine Liebe«, sagte sie, »wir gehen ins Kinderzimmer hinunter.«
Aelia und Aurelia standen auf. Die drei Männer blieben liegen, unterbrachen ihr Gespräch allerdings, bis die Frauen und die Sklaven das Zimmer verlassen hatten.
»Schweinebacke kommt also endlich nach Hause«, sagte Lucius Cornelius Sulla, als er sicher war, daß seine verabscheute zweite Frau außer Hörweite war.
Marius rutschte ruhelos auf seinem Ende der mittleren Liege hin und her. Er runzelte die Stirn, aber sein Stirnrunzeln wirkte nicht mehr so unheilvoll wie früher, da die linke Gesichtshälfte infolge der anhaltenden Lähmung traurig herabhing.
»Was für eine Antwort erwartest du von mir, Lucius Cornelius?« fragte er schließlich.
Sulla lachte kurz. »Eine ehrliche Antwort natürlich, was sonst? Allerdings war meine Bemerkung ja gar nicht als Frage formuliert, Gaius Marius.«
»Ich weiß. Aber sie verlangt trotzdem nach einer Antwort.«
»Stimmt«, sagte Sulla. »Schön, ich formuliere sie um. Was sagst du dazu, daß Schweinebacke aus dem Exil zurückgerufen wird?«
»Nun, in bin nicht gerade entzückt vor Freude.« Marius warf Sulla einen schnellen und durchdringenden Blick zu. »Du vielleicht?«
Sie haben sich einander unmerklich entfremdet, dachte Publius Rutilius Rufus, der allein auf der zweiten Liege ruhte. Vor drei Jahren – oder sogar noch vor zwei Jahren – wäre ein so angespanntes, argwöhnisches Gespräch zwischen den beiden undenkbar gewesen. Was war geschehen? Und wessen Schuld war es?
»Ja und nein, Gaius Marius«, sagte Sulla und starrte in seinen Weinbecher. »Ich langweile mich!« knurrte er dann mit zusammengebissenen Zähnen. »Wenn Schweinebacke in den Senat zurückkehrt, wird es vielleicht wieder interessanter. Mir fehlen die Schlachten, die ihr zwei immer ausgetragen habt.«
»In diesem Fall wirst du enttäuscht werden, Lucius Cornelius. Ich werde nicht in Rom sein, wenn Schweinebacke zurückkehrt.«
Sulla und Rutilius Rufus setzten sich auf.
»Nicht in Rom?« sagte Rutilius Rufus schrill.
»Nein, ich werde nicht in Rom sein«, wiederholte Marius und grinste mit säuerlicher Genugtuung. »Mir ist gerade ein Gelübde eingefallen, das ich vor meinem Sieg über die Germanen vor der Göttin Magna Mater abgelegt habe. Ich gelobte, im Fall eines Sieges eine Pilgerfahrt zu ihrem Heiligtum in Pessinus zu unternehmen.«
»Gaius Marius, das kannst du nicht tun!« sagte Rutilius Rufus.
»Das kann ich sehr wohl, Publius Rutilius! Und das werde ich auch!«
Sulla ließ sich auf den Rücken fallen und lachte. »Die Schatten des Lucius Gavius Stichus!« rief er.
»Von wem sprichst du?« fragte Rutilius Rufus, der sich immer gerne ablenken ließ, wenn er Tratsch witterte.
»Von dem verstorbenen Neffen meiner verstorbenen Stiefmutter.« Sulla grinste immer noch. »Vor vielen Jahren zog er in mein Haus ein – es gehörte damals meiner Stiefmutter. Er wollte mich loswerden, indem er mich bei Clitumna schlechtmachte, und er spekulierte darauf, mich bloßstellen zu können, wenn er mit mir in Clitumnas Haus wohnte. Also ging ich. Kehrte Rom den Rücken. Mit dem Ergebnis, daß er nur noch sich selbst bloßstellen konnte – was er sehr wirkungsvoll besorgte. Clitumna hatte in kürzester Zeit genug von ihm.« Sulla wälzte sich auf den Bauch. »Kurz darauf starb er«, fuhr er nachdenklich fort und unterbrach sein Lächeln durch einen theatralischen Seufzer. »Ich hatte seine Pläne durchkreuzt!«
»Es besteht also die Aussicht, daß die Heimkehr von Quintus Caecilius Metellus Numidicus Schweinebacke nicht der erhoffte Triumph wird«, sagte Marius.
»Darauf trinke ich«, sagte Sulla und hob seinen Becher.
Ein schwer zu brechendes Schweigen entstand. Die alte Übereinstimmung war nicht mehr da, und Sullas Antwort hatte sie auch nicht wiederhergestellt. Vielleicht, dachte Publius Rutilius Rufus, war die frühere Eintracht in Wirklichkeit eine Zweck- und Kampfgemeinschaft gewesen, keine tiefverwurzelte Freundschaft. Aber wie konnten Marius und Sulla all die Jahre vergessen, in denen sie die äußeren Feinde Roms gemeinsam bekämpft hatten? Wie konnte die Unzufriedenheit ihres jetzigen Lebens in Rom die ganze Vergangenheit auslöschen? Saturninus hatte das Ende des alten Lebens bedeutet. Saturninus und der unselige Schlaganfall von Marius. Dann sagte Publius Rutilius Rufus sich: Unsinn, Publius Rutilius Rufus! Marius und Sulla sind eben beide Männer, die immer aktiv und mit wichtigen Dingen beschäftigt sein müssen. Sie sitzen nicht gerne zu Hause herum – so ganz ohne Amt und Würden. Sobald sie wieder zusammen in den Krieg ziehen können oder ein Saturninus auftaucht, der König von Rom werden will, schnurren sie wieder miteinander wie zwei Katzen, die einander das Gesicht lecken.
Aber die Zeit verging. Er und Gaius Marius standen in ihrem sechzigsten Lebensjahr, Lucius Cornelius Sulla war zweiundvierzig. Da Publius Rutilius Rufus sich nicht in den trügerischen Tiefen eines Spiegels zu betrachten pflegte, wußte er nicht, wie gut er selbst dem Ansturm des Alters standgehalten hatte. Aber seine Augen waren noch sehr gut, zumindest auf die Entfernung, in der er jetzt Gaius Marius und Lucius Cornelius Sulla vor sich sah.
Gaius Marius war in letzter Zeit um einiges schwerer geworden und mußte sich neue Togen schneidern lassen. Ein gewichtiger Mann war er immer gewesen, aber gesund und wohlproportioniert. Sein zusätzliches Gewicht verteilte sich nun auf Schultern, Rücken, Hüften, Schenkel und auch auf seinen muskulös wirkenden Bauch. Die zusätzliche Last, die er mit sich herumtragen mußte, hatte sein Gesicht ein wenig geglättet, das nun größer, runder und dank des zurückweichenden Haaransatzes höher wirkte. Die linksseitige Lähmung übersah Rutilius Rufus bewußt und verweilte statt dessen auf den erstaunlichen Augenbrauen – sie waren so gewaltig, buschig und eigenwillig wie eh und je. Die Brauen des Gaius Marius hatten schon so manchen Bildhauer in Verzweiflung gestürzt! Die römischen oder italischen Bildhauer, die den Auftrag erhielten, eine Stadt, ein öffentliches Gebäude oder irgendein freies Grundstück, auf dem unbedingt eine Statue aufgestellt werden mußte, mit einem in Stein gehauenen Bildnis des Marius zu verschönern, wußten ja wenigstens, was ihnen bevorstand, noch ehe sie Gaius Marius zu Gesicht bekamen. Reiste dagegen ein gefeierter griechischer Bildhauer aus Athen oder Alexandria nach Rom, um ein Ebenbild des seit Scipio Africanus meistporträtierten Mannes zu schaffen, erschien auf seinem Gesicht angesichts dieser Brauen das blanke Entsetzen. Die Künstler gaben ihr Bestes, aber Gaius Marius’ Gesicht war auch auf einfachen Zeichnungen auf einer Holztafel oder einem Stück Leinwand stets nur der Hintergrund für die alles dominierenden Brauen.
Das beste Porträt seines alten Freundes, das Rutilius Rufus kannte, war eine mit schwarzer Farbe auf die Außenwand von Rutilius Rufus’ Haus grob hingeworfene Zeichnung. Sie bestand nur aus ein paar Strichen – eine einzige sinnliche Kurve deutete die volle Unterlippe an, eine andere die funkelnden Augen – wie hatte der unbekannte Maler es fertiggebracht, mit Schwarz funkelnde Augen darzustellen? –, die Augenbrauen bestanden nur aus jeweils zehn Strichen. Und doch war es Gaius Marius, wie er leibte und lebte, mit all seinem Stolz, seiner Klugheit, seiner Unbezähmbarkeit, in einem Wort, seinem Charakter. Wie sollte man diese Art von Kunst beschreiben? Vultum in peius fingere ... ein mit Boshaftigkeit geformtes Gesicht, aber so gut gemacht, daß aus der Boshaftigkeit Wahrheit geworden war. Doch noch bevor Rutilius Rufus hatte überlegen können, wie er das gelungene Porträt auf seiner Mauer retten konnte, ohne daß es in tausend Stücke zerfiel, war es von einem Regenguß abgewaschen worden.
Auch der begabteste Zeichner hätte kein solches Porträt von Lucius Cornelius Sulla machen können. Ohne den Zauber der Farbe wäre Sulla ein beliebiger, einigermaßen gutaussehender Mann gewesen: ein wohlgeformter Kopf, ebenmäßige Züge, alles in allem ein typisch römisches Gesicht, ganz im Gegensatz zu Gaius Marius’ Gesicht. Erst die Farbe machte Sulla zu einer einzigartigen Erscheinung. Zweiundvierzig war er, und seine Haare waren noch so voll wie eh und je – und was für Haare! Weder mit rot noch mit golden waren sie hinreichend beschrieben. Dicht, gewellt und vielleicht ein wenig zu lang. Und Augen wie Gletschereis, ein ganz blasses Blau, umgeben von einem Blau, so dunkel wie eine Gewitterwolke. An diesem Abend sahen seine schmalen, geschwungenen Brauen und seine kräftigen, langen Wimpern braun aus. Aber Publius Rutilius Rufus hatte Sulla schon in weniger entspannten Situationen erlebt und wußte, daß er heute, wie er es häufig tat, Antimon aufgetragen hatte; in Wirklichkeit waren seine Brauen und Wimpern nämlich so hell, daß man sie überhaupt nur sehen konnte, weil seine Haut von einem blassen, fast pigmentlosen Weiß war.
Frauen waren von Sulla so fasziniert, daß sie Verstand, Urteilsvermögen und Tugendhaftigkeit verloren. Sie schlugen alle Warnungen in den Wind, brachten Gatten, Väter und Brüder zur Verzweiflung und kicherten verlegen, wenn er sie im Vorbeigehen auch nur mit einem Blick streifte. Ein so fähiger, kluger Mann! Ein hervorragender Soldat, ein tüchtiger Beamter, ein nahezu perfekter Organisator und dazu so tapfer, wie man es von einem Mann nur wünschen konnte. Und doch waren Frauen sein Verhängnis. Das dachte jedenfalls Publius Rutilius Rufus, dessen angenehmes, aber eher alltägliches und farblich unauffälliges Gesicht ihn nicht von Tausenden anderer Männer unterschied. Nicht daß Sulla ein Schürzenjäger oder Weiberheld gewesen wäre; nach Rutilius Rufus’ Meinung benahm er sich bewundernswert korrekt. Aber zweifellos hatte ein Mann, der danach strebte, die oberste Sprosse der politischen Leiter Roms zu erklimmen, bessere Chancen, wenn er nicht wie Apollo aussah. Gutaussehende Männer, denen die Frauen zu Füßen lagen, weckten das Mißtrauen anderer Männer. Man verachtete sie als Leichtgewichte oder Weichlinge oder fürchtete, von ihnen Hörner aufgesetzt zu bekommen.
Im Vorjahr, erinnerte Rutilius Rufus sich, hatte Sulla für die Prätur kandidiert. Alles schien für ihn zu sprechen. Seine militärischen Erfolge waren glänzend und wurden auch gebührend gewürdigt – Gaius Marius hatte dafür gesorgt, daß die Wahlmänner erfuhren, welch unschätzbare Dienste Sulla ihm als Quästor, Volkstribun und schließlich Legat geleistet hatte. Sogar Catulus Caesar, der keinen besonderen Grund hatte, Sulla zu mögen, hatte sich für ihn eingesetzt und seine Verdienste im italischen Gallien im Jahr der Niederschlagung der germanischen Kimbern gerühmt. Dann, während der wenigen, kurzen Tage, als Lucius Appuleius Saturninus die Republik bedroht hatte, war es der unermüdliche Sulla gewesen, der es Gaius Marius ermöglicht hatte, der Bedrohung Herr zu werden. Denn immer wenn Gaius Marius einen Befehl erteilt hatte, war es Sulla gewesen, der ihn ausführte. Quintus Caecilius Metellus Numidicus »Schweinebacke«, wie Marius, Sulla und Rutilius Rufus ihn nannten, hatte, bevor er ins Exil ging, aller Welt zu verstehen gegeben, daß die erfolgreiche Beendigung des afrikanischen Krieges gegen König Jugurtha seiner Meinung nach allein Sulla zu verdanken sei und daß Marius sich zu Unrecht mit dessen Lorbeeren geschmückt habe. Allein Sulla habe erreicht, daß Jugurtha gefangengenommen worden sei, und jedermann wisse, daß der Krieg in Afrika erst mit der Gefangennahme Jugurthas wirklich zu Ende gewesen sei. Als Catulus Caesar und ein paar andere ultrakonservative Stimmen im Senat Schweinebacke zustimmten, daß der Verdienst für den Sieg über Jugurtha eigentlich Sulla gebühre, schien der Aufstieg von Sullas Stern unaufhaltsam und seine Wahl zu einem der sechs Prätoren eine Gewißheit. Und bei alledem mußte noch Sullas eigenes Verhalten in der Sache berücksichtigt werden – er war so bewundernswert bescheiden und gerecht. Im Wahlkampf hatte er bis zuletzt darauf bestanden, die Gefangennahme Jugurthas müsse Marius zugeschrieben werden, da er selbst nur Marius’ Befehle ausgeführt habe. So etwas wurde von den Wählern gewöhnlich honoriert. Loyalität zum Feldherrn auf dem Schlachtfeld wie auf dem Forum war eine vielgepriesene Tugend.
Es kam freilich anders. Als sich die Wahlmänner der Zenturien in den saepta auf dem Marsfeld versammelten und die Zenturien nacheinander ihre Stimme abgaben, gehörte Lucius Cornelius Sulla, dessen Name allein schon so aristokratisch und vornehm klang, nicht zu den sechs erfolgreichen Kandidaten. Und damit nicht genug: Einige der Männer, die Sulla vorgezogen worden waren und lediglich mittelmäßige Leistungen vorweisen konnten, hatten nicht einmal patrizische Vorfahren.
Warum diese Niederlage? Das war unmittelbar nach dem Wahltag die einzig brennende Frage, die Sullas Anhänger beschäftigte. Er selbst äußerte sich nicht, obwohl er die Antwort kannte. Ein wenig später erfuhren auch Rutilius Rufus und Marius, was Sulla schon wußte. Der Grund für seine Niederlage hatte einen Namen und war körperlich nicht besonders groß: Caecilia Metella Delmatica, die gerade neunzehn Jahre alte Frau des Senatsältesten Marcus Aemilius Scaurus, der Konsul gewesen war, als die Germanen zum ersten Mal aufgetaucht waren, Zensor, als Metellus Numidicus Schweinebacke nach Afrika in den Kampf gegen Jugurtha gezogen war, und Senatsvorsitzender seit seiner Zeit als Konsul, die nun schon neunzehn Jahre zurücklag. Eigentlich war Delmatica vertraglich dem Sohn des Scaurus versprochen worden, aber dieser, ein erklärter Feigling, hatte sich nach dem Rückzug Catulus Caesars aus Tridentum das Leben genommen. Und Metellus Numidicus Schweinebacke, verantwortlich für seine siebzehnjährige Nichte, hatte sie prompt Scaurus selbst zur Frau gegeben, obwohl sie vierzig Jahre jünger als ihr Ehemann war.
Natürlich hatte niemand Delmatica gefragt, was sie von dieser Vereinigung hielt, und zuerst hatte sie es nicht einmal selbst gewußt. Geblendet von der enormen auctoritas und dignitas ihres Mannes, war sie außerdem froh, dem stürmischen Haushalt ihres Onkels Metellus Numidicus entrinnen zu können. Dort wohnte zu diesem Zeitpunkt auch dessen Schwester, eine Frau, deren sexuelle Neigungen und hysterisches Benehmen das Zusammenleben mit ihr zu einer Qual machten. Von Scaurus wurde Delmatica dann sofort schwanger (was zu einer weiteren Steigerung seiner auctoritas und dignitas führte), und neun Monate später gebar sie ihm eine Tochter. Inzwischen hatte sie freilich bei einem von ihrem Mann gegebenen Abendessen Sulla kennengelernt, und die beiden fühlten sich mit schmerzhafter Heftigkeit zueinander hingezogen.
Sulla war sich der Gefahr bewußt, die Scaurus’ junge Frau für ihn bedeutete, und unternahm nichts, die Bekanntschaft mit ihr zu vertiefen. Ganz anders Delmatica. Sie wartete, bis die Leichname des Saturninus und seiner Freunde mit all der Ehre verbrannt worden waren, die ihnen als noch nicht verurteilte römische Bürger zukam, und bis Sulla begann, sich im Rahmen seines Wahlkampfes für die Prätur auf dem Forum und in der Stadt bekannt zu machen. Dann lenkte auch sie ihre Schritte immer häufiger auf das Forum und in die Stadt. Wo immer Sulla sich aufhielt, war auch Delmatica in der Nähe, hinter einem Sockel oder einer Säule verborgen und das Gesicht verhüllt, damit niemand sie erkannte.
Sulla lernte schnell, Orte wie den Porticus Margaritaria zu meiden, wo eine Frau aus patrizischer Familie nicht weiter auffiel, weil es dort viele Juweliergeschäfte gab. So hatte Delmatica zwar selten Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, aber für Sulla bedeutete ihr Verhalten eine Wiederbelebung eines alten, schrecklichen Alptraums vergangener Zeit; damals hatte Julilla ihn unter einer Lawine aus Liebesbriefen begraben, die sie oder ihr Mädchen ihm immer dann in die Falten seiner Toga schoben, wenn er nicht wagte, sich dagegen zu wehren, weil er kein Aufsehen erregen wollte. Das Ganze hatte in einer confarreatio geendet, einer praktisch unauflösbaren, offiziell geschlossenen Ehe, die mit all ihrer Bitterkeit, ihren Anfechtungen und ihrer Demütigung bis zu Julillas Selbstmord gedauert hatte – eine weitere schreckliche Episode der zahlreichen Begegnungen Sullas mit Frauen, die danach trachteten, ihn zu zähmen.
Also suchte Sulla die schäbigen, stinkenden und überfüllten Gassen der Subura auf und vertraute sich der einzigen Freundin an, die den Abstand zu ihm wahren konnte, den er im Augenblick so verzweifelt brauchte – Aurelia, der Schwägerin seiner toten Frau Julilla.
»Was soll ich tun?« rief er. »Ich sitze in der Falle, Aurelia, es ist genau wie bei Julilla! Ich werde sie nicht los!«
»Das Problem ist, daß diese Weiber so wenig zu tun haben«, sagte Aurelia grimmig. »Kindermädchen für die Kleinen, kleine Feste mit Freundinnen, die sich nur durch die Menge an Tratsch unterscheiden, den sie verbreiten, Webstühle, die sie nicht anzurühren gedenken, und Köpfe, die zu leer sind, als daß sie sich mit einem Buch trösten könnten. Die meisten von ihnen können mit ihren Ehemännern nichts anfangen, weil sie Vernunftehen schließen mußten – entweder waren ihre Väter auf politischen Machtzuwachs erpicht, oder ihre Gatten hatten es auf die Mitgift oder das zusätzliche Ansehen abgesehen. Wenn die Frauen den Alltagstrott dann ein Jahr lang mitgemacht haben, sind sie reif für eine Dummheit, wie zum Beispiel eine Liebesaffäre.« Aurelia seufzte. »In der Liebe können sie wenigstens frei wählen, Lucius Cornelius, wo können sie das sonst noch? Die Klügeren begnügen sich mit Sklaven, die Dummen verlieben sich ernsthaft. Und damit haben wir es leider in diesem Fall zu tun. Delmatica, das arme dumme Kind, ist ganz von Sinnen! Und du bist die Ursache ihres Wahnsinns.«
Sulla kaute auf seiner Lippe und verbarg seine Gedanken, indem er auf seine Hände starrte. »Nicht willentlich«, sagte er.
»Ich weiß das! Aber weiß es auch Marcus Aemilius Scaurus?«
»Ich hoffe bei den Göttern, daß er gar nichts weiß!«
Aurelia schnaubte. »Ich könnte mir denken, er weiß eine ganze Menge.«
»Warum hat er mich dann nicht aufgesucht? Oder soll ich ihn aufsuchen?«
»Darüber denke ich gerade nach«, sagte Aurelia, Eigentümerin eines großen Mietshauses, Vertraute von vielen, Mutter von drei Kindern und einsame Ehefrau, die stets beschäftigt war und doch nie geschäftig tat.
Sie saß seitlich an ihrem großen Arbeitstisch, der ganz mit Papieren und Buchrollen bedeckt war. Trotzdem zeugte der Tisch nicht von Unordnung, sondern lediglich von viel Arbeit.
Wenn sie mir nicht helfen kann, dachte Sulla, kann mir niemand helfen. Die einzige andere Person, die er noch um Rat hätte fragen können, war in dieser Situation nicht zuverlässig. Aurelia war nur eine Freundin, Metrobius war noch sein Liebhaber mit allen gefühlsmäßigen Komplikationen, die ein solches Verhältnis mit sich brachte, ganz zu schweigen von der Tatsache, daß Metrobius männlichen Geschlechts war. Der junge griechische Schauspieler hatte am Vortag eine scharfe Bemerkung über Delmatica fallen lassen. Da erst war Sulla voller Schrecken klargeworden, daß offenbar ganz Rom über ihn und Delmatica redete, denn die Welt von Metrobius war meilenweit entfernt von der Welt, in der sich Sulla mittlerweile bewegte.
»Sollte ich Marcus Aemilius Scaurus aufsuchen?« fragte er noch einmal.
»Ich finde, du solltest lieber mit Delmatica selbst sprechen, aber ich sehe keine Möglichkeit, wie du das bewerkstelligen kannst«, sagte Aurelia mit gespitzten Lippen.
Sulla kam ein Gedanke. »Könntest du sie vielleicht hierher einladen?«
»Auf gar keinen Fall!« Aurelia war entsetzt. »Lucius Cornelius, du bist sonst ein besonders nüchtern und praktisch denkender Mann, aber manchmal scheinst du deinen angeborenen Verstand nicht benutzen zu wollen! Verstehst du denn nicht? Marcus Aemilius Scaurus läßt seine Frau mit Sicherheit beobachten. Bisher hast du deinen Ruf nur retten können, weil ihm die Beweise für seinen Verdacht fehlten.«
Sulla zeigte seine langen Eckzähne, aber es war kein Lächeln. Einen unvorsichtigen Augenblick lang ließ er seine Maske fallen, und Aurelia bekam jemanden zu sehen, den sie nicht kannte. Aber – stimmte das wirklich? Oder sah sie vielleicht jemanden, dessen Existenz sie schon immer geahnt hatte, den sie aber bisher nie zu Gesicht bekommen hatte? Jemand, dem alle menschlichen Eigenschaften fehlten, ein nacktes Ungeheuer mit Klauen, das nur den Mond anheulen konnte. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie furchtbare Angst.
Ihr sichtliches Erschauern verscheuchte das Ungeheuer. Sulla setzte seine Maske wieder auf und stöhnte.
»Aber was soll ich dann tun, Aurelia? Was kann ich tun?«
»Als du mir das letzte Mal von ihr erzählt hast – allerdings vor zwei Jahren –, sagtest du, du seist in sie verliebt, obwohl du sie nur dieses eine Mal getroffen hättest. Ganz ähnlich wie bei Julilla, nicht? Das macht es ja so schlimm. Sie weiß natürlich nichts von Julilla außer der Tatsache, daß du früher eine Frau hattest, die sich das Leben nahm – was bestens geeignet ist, deine Anziehungskraft auf Frauen noch zu steigern. Es suggeriert nämlich, daß es für eine Frau gefährlich ist, dich zu kennen und zu lieben. Was für eine Herausforderung! Nein, ich fürchte, die arme kleine Delmatica hat sich hoffnungslos in den Schlingen verfangen, die du – wie unbeabsichtigt auch immer – ausgelegt hast.«
Aurelia dachte einen Augenblick nach und sah ihm dann in die Augen. »Sage nichts, Lucius Cornelius, und unternehme nichts. Warte, bis Marcus Aemilius Scaurus zu dir kommt. So wirkst du am unschuldigsten. Aber sorge dafür, daß er keinerlei Beweise für die Untreue seiner Frau findet, auch keine indirekten. Verbiete deiner Frau, das Haus zu verlassen, wenn du zu Hause bist – für den Fall, daß Delmatica einen deiner Sklaven besticht, sie einzulassen. Das Problem ist, daß du Frauen weder verstehst noch besonders magst. Deshalb weißt du nicht, wie du ihren Schlichen begegnen kannst, und fällst auf sie herein. Ihr Mann muß zu dir kommen. Sei freundlich zu ihm, ich bitte dich! Er ist ein alter Mann mit einer jungen Frau: Der Besuch wird ihm schwerfallen. Daß seine Frau ihn nicht betrogen hat, hat er nur deinem Desinteresse zu verdanken. Deshalb mußt du alles Erdenkliche tun, um seinen Stolz nicht zu verletzen. Bedenke, daß ihm an Macht und Einfluß nur Gaius Marius gleichkommt.« Sie lächelte. »Diesen Vergleich würde er zwar zurückweisen, aber er stimmt. Wenn du Prätor werden willst, kannst du dir nicht leisten, ihn zu verletzen.«
Sulla beherzigte Aurelias Rat, aber leider nicht vollständig. Er machte sich einen schlimmen Feind, weil er kein Mitgefühl zeigte und Scaurus nicht half, das Gesicht zu wahren.
Nach dem Gespräch mit Aurelia geschah zunächst sechzehn Tage lang nichts, außer daß Sulla nun nach Scaurus’ Aufpassern Ausschau hielt und alles vermied, was Scaurus als Hinweis auf die Untreue seiner Frau auslegen konnte. Sulla fiel auf, daß sich Scaurus’ Freunde und seine eigenen Bekannten grinsend verstohlene Blicke zuwarfen; das war sicher nichts Neues, aber bisher hatte er es nicht bemerkt.
Das Schlimmste war, daß er Delmatica immer noch begehrte – oder liebte – oder von ihr besessen war – oder alles zusammen. Es war wie bei Julilla. Der Schmerz, der Haß und das Verlangen, jeden zusammenzuschlagen, der ihm über den Weg lief. Von einem Traum, in dem er mit Delmatica schlief, konnte er übergangslos in einen anderen Traum hinübergleiten, in dem er ihr den Hals brach und zusah, wie sie mit verrückten Zuckungen über ein vom Mond beschienenes Rasenstück in Circei tanzte – nein, nein, so hatte er seine Stiefmutter umgebracht! Immer öfter öffnete er das Geheimfach des Schreines, in dem die Maske seines Vorfahren Publius Cornelius Sulla Rufinus, des Jupiterpriesters ruhte, nahm die Giftfläschchen und die Schachtel heraus, die das weiße Pulver enthielt – damit hatte er Lucius Gavius Stichus und den Muskelprotz Hercules Atlas umgebracht. Pilze? Mit ihnen hatte er seine Geliebte umgebracht – iß diese Pilze, Delmatica!
Aber seit dem Tod Julillas war viel Zeit vergangen. Sulla war erfahrener geworden und kannte sich selbst besser. Er konnte Delmatica genausowenig töten, wie er Julilla hatte töten können. Bei Frauen aus altem Patriziergeschlecht gab es keine andere Möglichkeit, als die Sache bis zum bitteren Schluß auszusitzen. Eines fernen Tages würden er und Caecilia Metella Delmatica beenden, was er in diesem Augenblick nicht anzufangen wagte.
Dann endlich klopfte Marcus Aemilius Scaurus an seine Tür. Der zähe Alte nahm auf Sullas Klientenstuhl Platz und blickte mit seinen wachen grünen Augen, die seinen kahlen Schädel und sein faltiges Gesicht Lügen straften, verdrossen in die freundliche Miene seines Gastgebers. Hätte er doch nur zu Hause bleiben können, statt seinen Stolz überwinden und diese vollkommen absurde Situation durchstehen zu müssen!
»Wahrscheinlich weißt du, warum ich hier bin, Lucius Cornelius«, sagte Scaurus mit erhobenem Kopf, die Augen gerade auf sein Gegenüber gerichtet.
»Ich glaube ja«, antwortete Sulla nur.
»Ich bin gekommen, um mich für das Betragen meiner Frau zu entschuldigen und dir zu versichern, daß ich nach diesem Gespräch sogleich dafür sorgen werde, daß meine Frau dich nicht weiterhin belästigt.« Da! Es war draußen. Und er lebte noch und war nicht vor Scham gestorben. Aber in Sullas ruhigem, sachlichen Blick glaubte er eine Spur von Verachtung zu entdecken. Einbildung, vielleicht, aber das war es, was Scaurus zu Sullas Feind machte.
»Es tut mir sehr leid, Marcus Aemilius.« Sag was, Sulla! Mach es dem alten Narren leichter! Laß ihn nicht so dasitzen, vor den Scherben seines Stolzes! Denk an das, was Aurelia sagte! Aber die Worte wollten nicht kommen. Sie wirbelten bruchstückhaft durch seinen Kopf, und die Zunge lag ihm stumm und schwer wie ein Stein im Mund.
»Es wäre für alle Beteiligten besser, wenn du Rom verlassen würdest«, sagte Scaurus schließlich. »Geh nach Spanien. Wie ich höre, könnte Lucius Cornelius Dolabella tatkräftige Hilfe gebrauchen.«
Sulla riß in übertriebener Überraschung die Augen auf. »Tatsächlich? Ich wußte nicht, daß die Lage so ernst ist! Aber selbst wenn sie es ist, Marcus Aemilius, ich kann hier nicht alles stehen- und liegenlassen und nach Hispania Ulterior gehen. Ich bin jetzt seit neun Jahren Senator, und es wird Zeit, daß ich mich um die Prätur bemühe.«
Scaurus schluckte, beherrschte sich aber eisern. »Nicht dieses Jahr, Lucius Cornelius«, sagte er freundlich. »Nächstes Jahr, oder das Jahr danach. Für dieses Jahr mußt du Rom den Rücken kehren.«
»Marcus Aemilius, ich habe nichts Verkehrtes getan!« Doch, das hast du, Sulla! Was du jetzt tust, ist verkehrt! Du trittst ihn mit Füßen! »Ich bin eigentlich schon drei Jahre zu alt für die Prätur, die Zeit läuft mir davon. Ich muß dieses Jahr kandidieren, und deshalb muß ich in Rom bleiben.«
»Bitte überlege es dir noch einmal.« Scaurus stand auf.
»Ich kann nicht, Marcus Aemilius.«
»Wenn du kandidierst, Lucius Cornelius«, sagte Scaurus ruhig, »wirst du es nicht schaffen, das versichere ich dir. Und auch nicht im nächsten Jahr und allen darauffolgenden Jahren. Ich verspreche es dir. Nimm dieses Versprechen ernst! Verlasse Rom.«
»Ich wiederhole, Marcus Aemilius, es tut mir sehr leid. Aber ich muß in Rom bleiben und für die Prätur kandidieren.«
Damit war der Kampf zwischen den beiden ausgebrochen. Marcus Aemilius Scaurus mochte an auctoritas, an öffentlichem Einfluß, und an persönlicher Würde eingebüßt haben, aber er konnte immer noch mit Leichtigkeit verhindern, daß Sulla zum Prätor gewählt wurde. Die Namen anderer, geringerer Männer wurden in die fasti, den römischen Amtskalender, eingetragen; es waren Narren, Nullen, Mittelmaß. Aber Prätoren.
Publius Rutilius Rufus hatte die Geschichte von seiner Nichte Aurelia erfahren und sie Gaius Marius weitererzählt. Daß der Senatsvorsitzende Scaurus nicht wollte, daß Sulla Prätor wurde, war für jedermann leicht erkennbar; der Grund dafür war weniger offensichtlich. Einige behaupteten, es habe damit zu tun, daß die arme Delmatica sich in Sulla verknallt habe, aber nach viel Gerede war man allgemein der Ansicht, dies allein reiche als Erklärung nicht aus. Scaurus verkündete seinen Freunden und auf dem Forum, er habe dem Mädchen genügend Zeit gegeben, sein fehlerhaftes Verhalten selbst einzusehen, und es dann freundlich, aber bestimmt zurechtgewiesen.
»Armes Ding – irgendwann mußte es ja passieren«, sagte er eifrig zu ein paar Senatoren, nachdem er sich vergewissert hatte, daß noch viele andere Ohren in Hörweite waren. »Ich wünschte nur, sie hätte sich jemand anders ausgesucht als ein bloßes Geschöpf des Gaius Marius. Na ja, er muß ein hübscher Bursche sein.«
Es war perfekt eingefädelt. So perfekt, daß die Experten vom Forum und die Senatoren zu dem Schluß kamen, der wahre Grund hinter Scaurus’ Widerstand gegen Sullas Kandidatur sei Sullas allseits bekannte Verbindung mit Gaius Marius. Denn nachdem Gaius Marius es geschafft hatte, sechsmal Konsul zu werden, was es noch nie gegeben hatte, war sein Stern im Sinken begriffen. Seine Glanzzeit war vorbei, und er fand nicht einmal mehr genügend Unterstützung für eine Kandidatur als Zensor. Was bedeutete, daß Gaius Marius, der sogenannte dritte Gründer Roms, niemals den Rängen der höchsten Konsulare angehören würde, die alle Zensoren gewesen waren. Gaius Marius war im politischen Leben Roms eine verbrauchte Kraft, mehr eine Kuriosität als eine Bedrohung anderer, ein Mann, dem oberhalb der dritten Klasse niemand mehr zujubelte.
Rutilius Rufus schenkte sich Wein nach. »Willst du wirklich nach Pessinus reisen?« fragte er Marius.
»Warum nicht?«
»Ich frage dich, warum? Ich meine, Delphi könnte ich noch verstehen, auch Olympia oder sogar Dodona. Aber Pessinus? Mitten in Anatolien – in Phrygien! Der rückständigste, unwirtlichste Ort der Welt, wo der Aberglaube herrscht und es im Umkreis von Hunderten von Meilen keinen anständigen Tropfen Wein zu trinken gibt und keine Straße, die besser wäre als ein Saumpfad! Nur rauhe Hirten, wohin man blickt, und an der Grenze Barbaren aus Galatien! Wirklich, Gaius Marius! Willst du Battakes in seinen goldenen Kleidern und mit seinem juwelenverzierten Bart sehen? Dann bestelle ihn doch nach Rom! Er wird mehr als entzückt sein, seine Bekanntschaft mit einigen unserer fortschrittlicheren Damen zu erneuern – sie weinen ihm immer noch nach.«
Marius und Sulla brachen in Gelächter aus, noch ehe Rutilius Rufus ans Ende seiner leidenschaftlichen Rede kam, und plötzlich war die Anspannung, unter der der Abend bisher gelitten hatte, der Unbefangenheit und Harmonie gewichen.
»Du willst dir König Mithridates ansehen«, sagte Sulla. Es war eine Feststellung, keine Frage.
Die Augenbrauen zuckten, und Marius grinste. »Nein wirklich! Wie kommst du darauf, Lucius Cornelius?«
»Ich kenne dich doch, Gaius Marius. Du bist ein gottloser alter Furz! Die einzigen Gelübde, die ich dich je habe ablegen hören, hatten damit zu tun, daß du Legionären oder eingebildeten Kriegstribunen in den Hintern treten wolltest. Es gibt nur einen Grund, warum du deinen dicken alten Wanst in die anatolische Wildnis schleppen würdest, und der ist, selbst nachzuschauen, was in Kappadokien vor sich geht und was genau König Mithridates damit zu tun hat.« Sulla lächelte so froh wie seit vielen Monaten nicht mehr.
Marius sah erschrocken Rutilius Rufus an. »Hoffentlich bin ich nicht für jedermann so leicht zu durchschauen wie für Lucius Cornelius!«
Jetzt mußte Rutilius Rufus lächeln. »Ich glaube kaum, daß irgendwer deine Absicht auch nur ahnt«, sagte er. »Selbst ich habe dir geglaubt – du gottloser alter Furz!«
Unwillkürlich, wie es Rutilius Rufus schien, drehte sich Marius’ Kopf zu Sulla zurück, und dann waren sie auch schon dabei, eine großartige neue Strategie auszutüfteln. »Das Problem sind unsere völlig unzuverlässigen Informationsquellen«, sagte Marius eifrig. »Ich meine, seit Jahren ist doch kein fähiger Mann mehr in diesem Teil der Welt gewesen. Emporkömmlinge haben es bis zum Prätor gebracht, und von denen traue ich keinem zu, einen verläßlichen Bericht abzuliefern. Was wissen wir eigentlich mit Sicherheit?«
»Sehr wenig.« Auch Sulla war ganz bei der Sache. »Galatien ist ein paarmal überfallen worden, von Nikomedes im Westen und von Mithridates im Osten. Dann, vor ein paar Jahren, heiratete der alte Nikomedes die Mutter des kleinen Königs von Kappadokien – sie war damals die Regentin, glaube ich. Und Nikomedes nannte sich dann König von Kappadokien.«
»So ist es«, nickte Marius. »Ich nehme an, er war nicht erfreut, als Mithridates die Mutter ermorden ließ und das Kind wieder auf den Thron setzte.« Er lachte leise. »Aus war’s mit König Nikomedes von Kappadokien! Ich weiß nicht, wie er glauben konnte, Mithridates würde der Heirat tatenlos zusehen – die ermordete Königin war immerhin Mithridates’ Schwester!«
»Und ihr Sohn regiert immer noch. Er heißt – ach, sie haben so exotische Namen! Ariarathes?«
»Schon der siebte Ariarathes, um genau zu sein«, sagte Marius.
»Und was geht deiner Meinung nach jetzt dort vor?« Sullas Neugier war durch Marius’ offensichtliche Kenntnis der schwierigen östlichen Verhältnisse geweckt worden.
»Ich weiß es nicht genau«, antwortete Marius. »Wahrscheinlich nichts, was über die normalen Streitereien zwischen Nikomedes von Bithynien und Mithridates von Pontus hinausginge. Aber ich schätze, er ist ein interessanter Bursche, dieser junge König Mithridates von Pontus. Ich würde ihn gerne kennenlernen. Schließlich, Lucius Cornelius, ist er kaum älter als dreißig, aber er hat sein Territorium schon von Pontus auf die wichtigsten Gebiete um das Schwarze Meer ausgedehnt. Ich spüre ein Kribbeln unter der Haut. Ich habe das Gefühl, er wird Rom noch Ärger machen.«
Publius Rutilius Rufus hielt es für höchste Zeit, sich auch an dem Gespräch zu beteiligen. Er stellte seinen Weinbecher mit einem lauten Knall auf dem Tisch vor seiner Liege ab und ergriff das Wort: »Du glaubst wahrscheinlich, daß Mithridates ein Auge auf unsere Provinz Asia geworfen hat.« Er nickte bedächtig. »Eigentlich ein naheliegender Gedanke. Die Provinz ist ungeheuer reich! Und das zivilisierteste Land der Welt! Griechisch, noch bevor die Griechen griechisch waren! Homer lebte und schrieb in unserer Provinz Asia, könnt ihr euch das vorstellen?«
»Ich könnte es mir wahrscheinlich viel besser vorstellen, wenn du dich selbst auf der Lyra begleiten würdest«, lachte Sulla.
»Aber jetzt im Ernst, Lucius Cornelius! Für König Mithridates ist die Eroberung unserer Provinz Asia sicher kein Witz – und deshalb müssen wir ihn ernst nehmen.«
»Ich glaube, es kann keinen Zweifel geben, daß Mithridates ein Auge auf unsere Provinz geworfen hat«, sagte Marius.
»Aber er ist ein Orientale«, warf Sulla ein. »Alle orientalischen Könige fürchten sich vor Rom – sogar Jugurtha fürchtete sich vor Rom. Erinnert euch nur an die Beleidigungen und Demütigungen, die er eingesteckt hat, bevor er endlich gegen uns in den Krieg zog. Wir mußten ihn geradezu zum Krieg zwingen.«
»Aber ich glaube, Jugurtha wollte von Anfang an Krieg gegen uns führen«, sagte Rutilius Rufus.
Sulla runzelte die Stirn. »Da bin ich anderer Meinung. Er träumte vielleicht davon, Krieg gegen uns zu führen, glaubte aber, daß es ein Traum bleiben würde. Wir haben ihm den Krieg aufgezwungen, als Aulus Albinus auf der Suche nach Kriegsbeute in Numidien einfiel. So fangen unsere Kriege übrigens fast immer an! Ein nach Gold gierender Feldherr, dem man keine Kinderparade anvertrauen sollte, darf römische Legionen führen, und schon begibt er sich auf die Suche nach Beute – nicht im Interesse Roms, sondern im Interesse seines eigenen Geldbeutels. Carbo und die Germanen, Caepio und die Germanen, Silanus und die Germanen – die Liste ließe sich endlos fortsetzen.«
»Du schweifst vom Thema ab, Lucius Cornelius«, sagte Marius leise.
»Entschuldigung, du hast recht.« Sulla grinste seinen alten Befehlshaber ohne jede Verlegenheit freundlich an. »Auf jeden Fall bin ich der Meinung, daß die Situation im Osten sehr viel Ähnlichkeit mit der Situation hat, die in Afrika herrschte, bevor Jugurtha gegen uns in den Krieg zog. Wir wissen, daß Bithynien und Pontus alte Rivalen sind, und wir wissen auch, daß sowohl König Nikomedes als auch König Mithridates Expansionsgelüste haben, zumindest innerhalb Anatoliens. Denn in Anatolien gibt es zwei sagenhaft reiche Länder, die den beiden den Mund wässrig machen: Kappadokien und unsere Provinz Asia. Wer Kappadokien hat, der hat leichten Zugriff auf Kilikien und besitzt fruchtbares Ackerland. Wer unsere Provinz Asia mit ihrer Küste hat, dem liegt das ganze Ägäische Meer mit einem halben Hundert ausgezeichneter Häfen und einem reichen Hinterland zu Füßen. Ein König, den nicht nach beiden Ländern gelüstete, wäre kein Mensch.«
»Nun, wegen Nikomedes von Bithynien mache ich mir keine Sorgen«, unterbrach Marius. »Er ist vollständig an Rom gekettet und weiß das. Ich glaube auch nicht, daß unsere Provinz Asia in Gefahr ist – zumindest jetzt noch nicht. Es geht um Kappadokien.«
Sulla nickte. »So ist es. Die Provinz Asia ist römisch. Und ich glaube nicht, daß König Mithridates sich in einer Hinsicht sehr vom Rest seiner orientalischen Kollegen unterscheidet: Seine Furcht vor Rom ist wahrscheinlich immer noch so stark, daß er es nicht wagen wird, unsere Provinz zu überfallen – egal, in welchem verwahrlosten Zustand sich diese befindet. Aber Kappadokien ist nicht römisch. Es liegt zwar in unserem Einflußbereich, aber mir scheint, Nikomedes und der junge Mithridates sind beide zu dem Schluß gekommen, Kappadokien sei so abgelegen und unwichtig, daß Rom keinen Krieg darum führen würde. Andererseits benehmen sie sich wie Diebe, die sich das Land heimlich aneignen wollen. Sie verstecken ihre Motive hinter Marionetten und Verwandten.«
Von Marius kam ein Grunzen. »Heimlich würde ich es nicht gerade nennen, wenn der alte König Nikomedes die Regentin von Kappadokien heiratet!«
»Nein, aber die neue Situation hielt ja nicht lange an. König Mithridates war so erbost, daß er seine eigene Schwester ermordete! Und im Handumdrehn hatte er ihren Sohn wieder auf den kappadokischen Thron gesetzt.«
»Leider ist Nikomedes unser offizieller Freund und Verbündeter und nicht Mithridates«, sagte Marius. »Schade, daß ich nicht in Rom war, als das entschieden wurde.«
»Na, hör mal!« rief Rutilius Rufus empört. »Die Könige von Bithynien dürfen sich seit über fünfzig Jahren offiziell Freunde und Verbündete nennen! Bei unserem letzten Krieg gegen Karthago war auch der König von Pontus ein offizieller Freund und Verbündeter. Aber der Vater des jetzigen Mithridates machte jede Freundschaft mit Rom unmöglich, als er Manius Aquillius’ Vater Phrygien abkaufte. Seit damals unterhält Rom keine Beziehungen mehr mit Pontus. Außerdem ist es unmöglich, zwei Königen den Status eines Freundes und Verbündeten zu verleihen, die miteinander verfeindet sind, außer wenn dieser Status einen Krieg zwischen den beiden verhindern würde. Im Fall von Bithynien und Pontus hat der Senat entschieden, wenn der Status beiden Königen verliehen würde, würde das ihr Verhältnis zueinander nur verschlechtern. Also wurde Nikomedes von Bithynien der Vorzug gegeben, denn Bithynien hat einen besseren Ruf als Pontus.«
»Ach, Nikomedes ist ein alter Narr!« sagte Marius ungeduldig. »Seit über fünfzig Jahren regiert er schon, und als er seinen Vater vom Thron stieß, war er auch kein Kind mehr. Ich glaube, er ist schon über achtzig. Und er bringt in Anatolien alles durcheinander!«
»Indem er sich wie ein dummes altes Huhn aufführt, willst du wahrscheinlich sagen.« Rutilius Rufus begleitete diese Bemerkung mit strengem Blick, der sehr an seine Nichte Aurelia erinnerte, auch wenn er nicht ganz so direkt war. »Meinst du nicht auch, Gaius Marius, daß du und ich bald in dem Alter sind, in dem man uns auch dumme alte Hühner nennen kann?«
»Nun regt euch bloß nicht auf!« sagte Sulla grinsend. »Ich weiß schon, was du meinst, Gaius Marius. Nikomedes ist längst ein Greis, ob er nun noch regieren kann oder nicht. Und man muß wohl davon ausgehen, daß er es noch kann. Zwar ist kein orientalischer Königshof so stark hellenisiert wie seiner, aber orientalisch ist er trotzdem noch. Nikomedes braucht nur eine einzige Unachtsamkeit zu begehen, und schon würde sein Sohn ihn vom Thron jagen. Er ist also nach wie vor wachsam und verschlagen. Aber er ist nörgelig und mißgünstig geworden. Jenseits der Grenze dagegen, in Pontus, steht ein Dreißigjähriger – vital, intelligent, aggressiv und selbstsicher. Nein, wir können kaum erwarten, daß Nikomedes Mithridates in Schach hält.«
»Stimmt«, meinte Marius. »Wir müssen damit rechnen, daß es ein ungleicher Wettstreit wird, falls es zum offenen Schlagabtausch kommt. Nikomedes hat lediglich geschafft, zu behalten, was er schon zu Beginn seiner Regentschaft hatte; Mithridates dagegen ist ein Eroberer. Oh ja, Lucius Cornelius, ich muß diesen Mithridates kennenlernen!« Er lehnte sich auf seinen linken Ellbogen und sah Sulla erwartungsvoll an. »Komm mit mir, Lucius Cornelius, ich bitte dich darum! Hast du eine Alternative? Noch ein langweiliges Jahr in Rom. Schweinebacke schwafelt im Senat, und Metellus das Ferkel sonnt sich in dem Ruhm, seinen Papa heimgeholt zu haben.«
Aber Sulla schüttelte den Kopf. »Nein, Gaius Marius.«
Rutilius Rufus knabberte nachdenklich an seinem Fingernagel. »Wißt ihr, wer den offiziellen Brief unterschrieben hat, der Quintus Caecilius Metellus Numidicus Schweinebacke aus dem Exil auf Rhodos zurückrief? Wie ich gehört habe, Konsul Metellus Nepos und – man stelle sich vor – kein anderer als das Ferkel selbst! Nicht unterschrieben hat dagegen Quintus Calidius, der Volkstribun, der den Rückruferlaß durchsetzte! Unterschrieben von einem blutjungen Senator, der obendrein ein privatus ist!«
Marius lachte. »Armer Quintus Calidius! Hoffentlich hat das Ferkel ihn für seine Mühe anständig bezahlt.« Er sah Rutilius Rufus an. »Sie bleiben sich treu, die Meteller, was? Als ich Volkstribun war, haben sie mich auch immer wie den letzten Dreck behandelt.«
»Das hattest du auch nicht anders verdient«, sagte Rutilius Rufus. »Damals hattest du doch nichts anderes im Sinn, als jedem Meteller, der Politiker war, das Leben schwer zu machen! Auch dann noch, als sie meinten, dich in die Pflicht genommen zu haben. Wie wütend Delmaticus war!«
Bei diesem Namen zuckte Sulla zusammen und merkte, wie er rot wurde. Delmaticus, Schweinebackes verstorbener älterer Bruder, war Delmaticas Vater. Wie ging es Delmatica? Was hatte Scaurus mit ihr gemacht? Sulla hatte sie seit Scaurus’ Besuch nie mehr zu Gesicht bekommen. Es ging das Gerücht, sie dürfe Scaurus’ Haus nie mehr verlassen. Sulla sagte laut: »Ich habe übrigens aus zuverlässiger Quelle erfahren, daß dem Ferkel eine gute Heirat bevorsteht.«
Sofort wurden die Erinnerungen durch die Gegenwart verdrängt.
»Davon weiß ich nichts!« sagte Rutilius Rufus leicht beleidigt. Er hielt seine Quellen für die besten in ganz Rom.
»Aber es stimmt trotzdem, Publius Rutilius.«
»Dann sag schon!«
Sulla steckte eine Mandel in den Mund und kaute eine Weile darauf herum, bevor er weitersprach. »Ein guter Wein, Gaius Marius«, sagte er und füllte seinen Becher aus dem Krug, der in Reichweite hingestellt worden war, als man die Sklaven fortgeschickt hatte. Dann mischte er den Wein bedächtig mit Wasser.
»Erlöse ihn von seiner Neugier, Lucius Cornelius, bitte!« seufzte Marius. »Publius Rutilius ist das größte Tratschmaul im Senat.«
»Das ist er, aber du mußt zugeben, daß wir dieser Tatsache höchst unterhaltsame Briefe verdankten, als wir in Afrika und Gallien waren«, sagte Sulla lächelnd.
»Wen?« rief Rutilius Rufus, der nicht abzulenken war.
»Licinia Minor, die jüngere Tochter keines Geringeren als unseres praetor urbanus Lucius Licinius Crassus Orator höchstselbst.«
»Du machst Witze!« japste Rutilius Rufus.
»Keineswegs.«
»Sie ist doch noch gar nicht alt genug!«
»Am Tag vor der Hochzeit wird sie sechzehn, habe ich gehört.«
»Abscheulich!« knurrte Marius mit zusammengezogenen Brauen.
»Wirklich, ich muß sagen, das geht allmählich zu weit!« sagte Rutilius Rufus mit echter Besorgnis. »Achtzehn ist das richtige Alter, und ein Mädchen sollte keinen Tag vorher heiraten! Wir sind schließlich Römer und heiraten keine Kinder wie die Orientalen!«
»Na ja, Ferkel ist wenigstens erst Anfang dreißig«, sagte Sulla beiläufig. »Wie ist das denn mit der Frau von Scaurus?«
»Je weniger darüber gesprochen wird, desto besser!« sagte Publius Rutilius Rufus barsch. Seine Erregung verebbte. »Crassus Orator muß man übrigens bewundern. Natürlich hat er genügend Geld für die Mitgift seiner Töchter, aber er hat sie trotzdem außergewöhnlich gut untergebracht. Die ältere hat keinen Geringeren als Scipio Nasica geheiratet, und jetzt heiratet die jüngere das Ferkel, den einzigen Sohn und Erben. Ich fand es schon schlimm genug, als die ältere, Licinia, mit siebzehn an einen Rohling wie Scipio Nasica verheiratet wurde. Wißt ihr schon, daß sie schwanger ist?«
Marius klatschte nach dem Verwalter. »Geht nach Hause, ihr beiden! Wenn sich das Gespräch bloß noch um Weibertratsch dreht, haben wir alle anderen Themen erschöpft. Schwanger! Setze dich doch gleich zu den Frauen ins Kinderzimmer, Publius Rutilius!«
Die Gäste hatten ihre Kinder zum Abendessen zu Marius mitgebracht, und diese schliefen bereits, als die Eltern gingen. Draußen in der Gasse standen zwei große Sänften: eine für Sullas Kinder Cornelia Sulla und den kleinen Sulla, die andere für die drei Kinder Aurelias, Julia Major, genannt Lia, Julia Minor, genannt Ju-ju, und den kleinen Caesar. Während die Erwachsenen noch im Atrium standen und sich leise unterhielten, trugen ein paar Sklaven die schlafenden Kinder zu den Sänften und legten sie behutsam hinein.
Der Mann, der den kleinen Caesar trug, war Julia, die automatisch mitzählte, unbekannt. Dann zuckte sie zusammen und packte Aurelia heftig am Arm.
»Das ist ja Lucius Decumius!« flüsterte sie aufgeregt.
»Aber natürlich«, antwortete Aurelia erstaunt.
»Aurelia, das darfst du nicht!«
»Unsinn, Julia. Ich brauche Lucius Decumius als starken Beschützer. Du weißt, daß mein Heimweg durch eine zwielichtige Gegend führt. Ich muß durch ein Viertel, in dem Diebe und Straßenräuber hausen und Gott weiß wer sonst noch – ich weiß es nach sieben Jahren immer noch nicht! Ich lasse mich nicht oft von zu Hause weglocken, aber wenn ich einmal ausgehe, lasse ich mich immer von Lucius Decumius und ein paar von seinen Brüdern abholen. Und der kleine Caesar schläft sehr unruhig. Aber wenn Lucius Decumius ihn trägt, rührt er sich nicht.«
»Ein paar von seinen Brüdern?« flüsterte Julia entsetzt. »Willst du vielleicht sagen, daß es bei dir zu Hause noch mehr von seiner Sorte gibt?«
»Nein!« erwiderte Aurelia verächtlich. »Ich meine seine Brüder vom Kreuzwegeverein, Julia – seine Untergebenen.« Sie sah verärgert aus. »Ach, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch zu diesen Familienessen komme! Warum könnt ihr nicht verstehen, daß ich mein Leben im Griff habe und dieses besorgte Getue und Geglucke nicht brauche?«
Julia sagte nichts mehr, bis sie mit Gaius Marius zu Bett ging. Der Haushalt war zur Ruhe gekommen, die Sklaven hatten sich in ihr Quartier zurückgezogen, die Tür zur Straße war verschlossen, und dem Göttertrio, das über jedes römische Haus wachte, war ein Opfer gebracht worden: Vesta, der Beschützerin des Herdfeuers, den Penaten, den Schutzgeistern der häuslichen Vorräte, und dem lar familiaris, dem Schutzgeist der Familie.
Im Bett sagte sie endlich: »Aurelia war heute sehr schwierig.«
Marius war müde. Das kam in letzter Zeit viel öfter vor als früher, und Marius schämte sich deswegen. Statt jetzt zu tun, was er am liebsten getan hätte, nämlich sich auf die linke Seite zu drehen und einzuschlafen, blieb er auf dem Rücken liegen, legte den linken Arm um seine Frau und stellte sich auf ein Gespräch über Frauen und ihre häuslichen Sorgen ein. »Soso«, sagte er.
»Kannst du nicht dafür sorgen, daß Gaius Julius nach Hause kommt? Aurelia verwandelt sich langsam in eine vertrocknete alte Vestalin, sie wird ganz – wie soll ich sagen – säuerlich. Boshaft. Saftlos! Ja, das ist das richtige Wort: saftlos. Und das Kind verschleißt sie.«
»Welches Kind?« sagte Marius schläfrig.
»Ihr zweiundzwanzig Monate alter Sohn, der kleine Caesar. Ein erstaunliches Kind, Gaius Marius! Ich weiß, daß solche Kinder gelegentlich geboren werden, aber ich selbst habe nie eines gekannt und nicht einmal in unserer Bekanntschaft von einem gehört. Wir Mütter sind ja froh, wenn unsere Söhne wissen, was dignitas und auctoritas bedeuten, nachdem sie mit ihren Vätern im Alter von sieben zum ersten Mal auf dem Forum waren. Aber dieser Winzling weiß es jetzt schon, obwohl er seinen Vater noch nie gesehen hat! Glaube mir, der kleine Caesar ist ein wirklich erstaunliches Kind.«
Julia kam in Fahrt. Noch etwas fiel ihr ein, und sie begann unruhig zu zappeln. »Gestern habe ich übrigens mit Mucia gesprochen, der Frau von Crassus Orator, und sie sagte mir, ihr Mann habe ihr stolz erzählt, daß einer seiner Klienten einen Sohn wie den jungen Caesar habe.« Sie knuffte Marius in die Seite. »Du kennst die Familie sicher, Gaius Marius, sie stammt nämlich aus Arpinum.«
Bis jetzt hatte er nicht richtig zugehört, aber das Zappeln und der Rippenstoß bewirkten, daß er wieder einigermaßen aufwachte. »Arpinum? Wer?« murmelte er. Arpinum war seine Heimat, dort hatten seine Vorfahren gelebt.
»Marcus Tullius Cicero. Der Klient von Crassus Orator und sein Sohn tragen denselben Namen.«
»Die Familie kenne ich, leider. Eine schöne Bande! Streitsüchtiges Pack. Sie haben uns vor ungefähr hundert Jahren ein Stück Land gestohlen und sind vor Gericht auch noch durchgekommen damit. Seit damals gibt es eigentlich keinen Kontakt mehr zwischen uns.« Seine Augen schlossen sich wieder.
»Aha.« Julia kuschelte sich enger an ihn. »Jedenfalls ist der Junge jetzt acht und so begabt, daß er auf dem Forum in die Schule gehen wird. Crassus Orator meint, er wird einiges Aufsehen erregen. Ich denke, wenn der kleine Caesar acht ist, wird er auch Aufsehen erregen.«
»Uaah!« Marius gähnte laut.
Noch einmal setzte Julia ihren Ellbogen ein. »Du schläfst ja schon, Gaius Marius! Wach auf!«
Seine Augen klappten wieder auf, und aus seinem Rachen drang ein polterndes Geräusch. »Willst du mich noch einmal ums Kapitol scheuchen?«
Kichernd schmiegte sie sich an ihn. »Auf jeden Fall, diesen kleinen Cicero habe ich noch nicht kennengelernt, aber meinen Neffen, den kleinen Gaius Julius Caesar, kenne ich sehr gut, und ich sage dir eines, er ist nicht – normal. Das sagt man zwar meist nur bei Menschen, denen geistig etwas fehlt, aber ich finde, man kann auch das andere Extrem damit bezeichnen.«
Marius seufzte erschöpft. »Je älter du wirst, Julia, desto mehr redest du.«
Julia überhörte seine Bemerkung. »Der kleine Caesar ist noch keine zwei Jahre alt, aber manchmal wirkt er wie hundert! Große Worte und richtig formulierte Sätze – und er weiß sogar, was die großen Worte bedeuten!«
Plötzlich war Marius hellwach, und seine Müdigkeit war verflogen. Er setzte sich auf und sah seine Frau an. Auf ihrem lächelnden Gesicht lag das warme Licht der kleinen Nachtlampe. Ihr Neffe! Ihr Neffe namens Gaius! Was hatte die Syrerin Martha ihm prophezeit, als er dem alten Weib zum ersten Mal in Gaudas Palast in Karthago begegnet war? Sie hatte gesagt, er werde der Erste Mann von Rom und sieben Mal Konsul sein. Aber, hatte sie hinzugefügt, der größte aller Römer werde er nicht sein. Das werde ein Neffe seiner Frau namens Gaius sein! Damals hatte er sich gesagt: nur über meine Leiche. Niemand wird mir den Rang ablaufen. Und jetzt gab es dieses Kind, eine lebendige Tatsache.
Er legte sich wieder hin. Seine Müdigkeit war in Gliederschmerzen übergegangen. Er hatte soviel Zeit, soviel Kraft, soviel Leidenschaft in den Kampf gesteckt, der Erste Mann von Rom zu werden, daß er jetzt nicht tatenlos abwarten konnte, bis der Glanz seines Namens durch einen frühreifen Patrizier verdunkelt wurde, dessen Zeit erst kam, wenn er, Gaius Marius, schon tot war oder zu alt, um sich zu wehren. Auch wenn er seine Frau sehr liebte und sich eingestehen mußte, daß es ihr patrizischer Name war, der ihm sein erstes Konsulat ermöglicht hatte, so konnte er doch nicht zulassen, daß ihr Neffe, in dessen Adern ihr Blut floß, ihn überflügeln sollte.
Er war nun sechsmal Konsul gewesen, was bedeutete, daß das siebte Mal noch ausstand. Kein römischer Politiker glaubte ernsthaft daran, daß Marius jemals wieder an seinen vergangenen Ruhm würde anknüpfen können, daß jene glorreichen Jahre wiederkehren würden, als die Zenturien ihn dreimal in Abwesenheit zum Konsul gewählt hatten in der Überzeugung, daß er, Gaius Marius, der einzige Mann sei, der Rom vor den Germanen retten könne. Und er hatte Rom gerettet. Aber was war der Dank gewesen? Nichts als Opposition, Kritik und Intrigen. Die fortdauernde Feindschaft des Quintus Lutatius Catulus Caesar, des Metellus Numidicus Schweinebacke und einer großen und mächtigen Senatsfraktion, geeint nur durch das Ziel, Gaius Marius zu stürzen. Kleine Männer mit großen Namen, die sich nicht damit abfinden konnten, daß ihr geliebtes Rom von einem Aufsteiger, einem homo novus gerettet worden war – einem »italischen Bauern, der nicht einmal Griechisch kann«, wie Metellus Numidicus Schweinebacke sich vor vielen Jahren einmal ausgedrückt hatte.
Aber noch war nicht aller Tage Abend. Schlaganfall hin oder her, er, der Patrizier und Römer Gaius Marius, würde ein siebtes Mal Konsul werden und als der größte Römer, den die Republik jemals gekannt hatte, in die Geschichte eingehen. Und er würde keinem goldgelockten Abkömmling der Göttin Venus erlauben, in den Geschichtsbüchern seinen Glanz zu verdunkeln.
»Ich mache dich fertig, Kleiner«, sagte er laut und drückte Julia fest den Arm.
»Was sagst du da?«
»In ein paar Tagen reisen wir nach Pessinus, wir beide und unser Sohn.«
Julia setzte sich auf. »Oh Gaius Marius, wirklich? Das ist ja wunderbar! Und du willst uns tatsächlich mitnehmen?«
»So ist es. Die Konventionen kümmern mich einen Dreck. Wir werden zwei oder drei Jahre weg sein, und in meinem Alter will ich eine so lange Zeit nicht ohne Frau und Sohn verbringen. Vielleicht würde ich es, wenn ich jünger wäre. Aber da ich als privatus reise, gibt es auch keinen offiziellen Grund, warum ich meine Familie nicht mitnehmen sollte.« Lächelnd fügte er hinzu: »Ich reise auf eigene Rechnung.«
»Gaius Marius!« Julia war sprachlos.
»Wir werden uns Athen, Smyrna, Pergamon, Nikomedeia und hundert andere Orte ansehen.«
»Auch Tarsos?« fragte sie eifrig. »Ach, ich wollte immer schon die Welt bereisen!«
Seine Glieder schmerzten immer noch, aber nun gewann die Müdigkeit wieder die Oberhand. Die Augen fielen ihm zu, sein Unterkiefer entspannte sich.
Julia redete noch eine Weile, bis ihr die Superlative ausgingen. Glücklich saß sie im Bett, die Arme um die Knie geschlungen. Dann drehte sie sich zu Gaius Marius um und lächelte zärtlich. »Mein Liebster, wie wäre es ...?« fragte sie leise.
Statt einer Antwort begann er zu schnarchen. Als gute Ehefrau mit zwölfjähriger Erfahrung schüttelte sie nur lächelnd den Kopf und drehte ihn auf die rechte Seite.
Kapitel 2
Nachdem Manius Aquillius den Sklavenaufstand in Sizilien vollständig niedergeschlagen hatte, kehrte er heim. Er feierte zwar keinen Triumph, hatte sich aber doch genug Ansehen verschafft, daß der Senat ihm eine Ovation zubilligte, einen kleinen Triumph. Ein Triumphzug stand ihm nicht zu, weil er es nicht mit Soldaten eines feindlichen Staates zu tun gehabt hatte, sondern mit versklavten Zivilisten. Bürger- und Sklavenkriege nahmen im römischen Militärkodex eine Sonderstellung ein. Vom Senat beauftragt zu werden, einen zivilen Aufstand niederzuschlagen, war keine geringere Ehre und auch keine geringere Leistung, als ein ausländisches feindliches Heer zu besiegen, aber dennoch wurde dem Feldherrn in einem solchen Fall kein Triumph gewährt. Im Triumphzug wurde dem römischen Volk der Lohn des Krieges in aller Gegenständlichkeit vorgeführt – die Gefangenen, das erbeutete Geld und Kriegsbeute aller Art, von den goldenen Nägeln vormals königlicher Palasttore bis zu Packen mit Zimt und Weihrauch. Bevor die Beutestücke die Schatzkammern Roms füllten, konnte das Volk mit eigenen Augen sehen, wie einträglich das Kriegsgeschäft war – vorausgesetzt natürlich, man war Römer und Rom siegte. Bürgerkriege und Sklavenaufstände dagegen brachten keine reiche Beute, sondern nur Verluste. Römisches Eigentum, das der Feind erbeutet hatte, mußte ihm wieder abgenommen und seinen rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden, und der Staat konnte davon keinen Anteil beanspruchen.
Also hatte man die Ovation erfunden. Sie bestand wie der Triumph aus einem Umzug, sogar entlang derselben Route. Aber der Feldherr fuhr nicht auf dem altehrwürdigen Triumphwagen, bemalte sein Gesicht nicht rot und trug nicht das Gewand des Triumphators. Nicht Trompeten waren zu hören, sondern nur das weniger eindrucksvolle, schrille Gepfeife von Flöten. Kein Stier, sondern nur ein Schaf wurde dem großen Jupiter geopfert, wodurch gleichsam auch er, wie der Feldherr, den geringeren Status der Zeremonie zu spüren bekam.
Manius Aquillius war mit seiner Ovation zufrieden. Nach den Feierlichkeiten nahm er wieder seinen Platz im Senat ein, wo er jetzt als Konsular, als ehemaliger Konsul seine Meinung vor einem gleichrangigen Konsular äußern durfte, der keinen Triumph und keine Ovation gefeiert hatte.