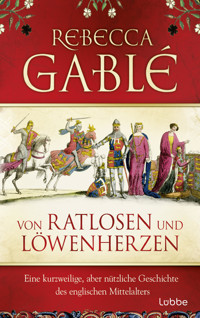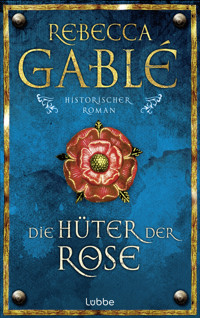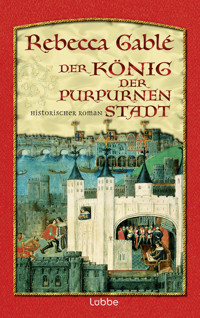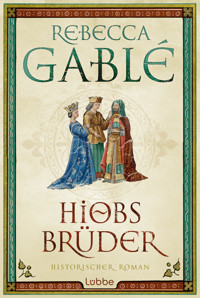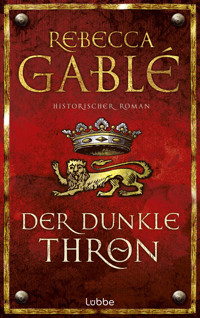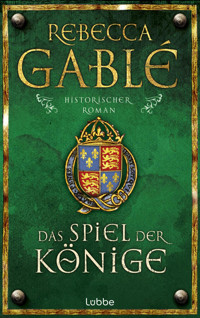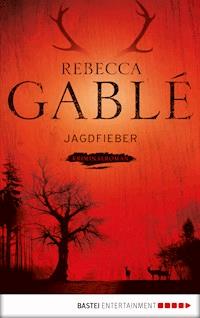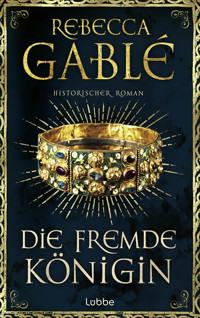
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Otto der Große
- Sprache: Deutsch
"Könige sind wie Gaukler. Sie blenden die Untertanen mit ihrem Mummenschanz, damit die nicht merken, dass das Reich auseinanderfällt"
Anno Domini 951: Der junge Gaidemar, ein Bastard vornehmer, aber unbekannter Herkunft und Panzerreiter in König Ottos Reiterlegion, erhält einen gefährlichen Auftrag: Er soll die italienische Königin Adelheid aus der Gefangenschaft in Garda befreien. Auf ihrer Flucht verliebt er sich in Adelheid, aber sie heiratet König Otto.
Dennoch steigt Gaidemar zum Vertrauten der Königin auf und erringt mit Otto auf dem Lechfeld den Sieg über die Ungarn. Schließlich verlobt er sich mit der Tochter eines mächtigen Slawenfürsten, und der Makel seiner Geburt scheint endgültig getilgt. Doch Adelheid und Gaidemar ahnen nicht, dass ihr gefährlichster Feind noch lange nicht besiegt ist, und als sie mit Otto zur Kaiserkrönung nach Rom aufbrechen, droht ihnen dies zum Verhängnis zu werden ...
Rebecca Gablé, Bestsellerautorin und Schöpferin der populären Waringham-Saga, hat nun mit ihrem Historienepos "Otto der Große" ein weiteres Meisterwerk geschaffen. Nach "Das Haupt der Welt" ist "Die fremde Königin" der zweite Band der mittelalterlichen Romanreihe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1141
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
»Könige sind wie Gaukler. Sie blenden die Untertanen mit ihrem Mummenschanz, damit die nicht merken, dass das Reich auseinanderfällt« Anno Domini 951: Der junge Gaidemar, ein Bastard vornehmer, aber unbekannter Herkunft und Panzerreiter in König Ottos Reiterlegion, erhält einen gefährlichen Auftrag: Er soll die italienische Königin Adelheid aus der Gefangenschaft in Garda befreien. Auf ihrer Flucht verliebt er sich in Adelheid, aber sie heiratet König Otto. Dennoch steigt Gaidemar zum Vertrauten der Königin auf und erringt mit Otto auf dem Lechfeld den Sieg über die Ungarn. Schließlich verlobt er sich mit der Tochter eines mächtigen Slawenfürsten, und der Makel seiner Geburt scheint endgültig getilgt. Doch Adelheid und Gaidemar ahnen nicht, dass ihr gefährlichster Feind noch lange nicht besiegt ist, und als sie mit Otto zur Kaiserkrönung nach Rom aufbrechen, droht ihnen dies zum Verhängnis zu werden … Rebecca Gablé, Bestsellerautorin und Schöpferin der populären Waringham-Saga, hat nun mit ihrem Historienepos »Otto der Große« ein weiteres Meisterwerk geschaffen. Nach »Das Haupt der Welt« ist »Die fremde Königin« der zweite Band der mittelalterlichen Romanreihe.
Über die Autorin
Rebecca Gablé studierte Literaturwissenschaft, Sprachgeschichte und Mediävistik in Düsseldorf, wo sie anschließend als Dozentin für mittelalterliche englische Literatur tätig war.
Heute arbeitet sie als freie Autorin und lebt mit ihrem Mann am Niederrhein und auf Mallorca. Ihre historischen Romane und ihr Buch zur Geschichte des englischen Mittelalters wurden allesamt Bestseller und in viele Sprachen übersetzt. Besonders die Romane um das Schicksal der Familie Waringham genießen bei Historienfans mittlerweile Kultstatus.
REBECCA GABLÉ
DIE FREMDEKÖNIGIN
Historischer Roman
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Copyright © 2017 by Rebecca Gablé
Copyright Deutsche Originalausgabe © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelgestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München unter Verwendung von Motiven von © Iron crown, 9th century. Goldsmith's art, Longobard civilization. / De Agostini Picture Library / M. Carrieri / Bridgeman Images
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
Innenillustrationen und Vorsatzkarte: Jürgen Speh, Deckenpfronn
ISBN 978-3-7325-3943-7
www.luebbe.de
www.lesejury.de
In dankbarer Erinnerung an
Ursula Lübbe
Der Tod ist ein holder, niedlicher Knabe, blühend, wie sie den Liebesgott malen, aber so tückisch nicht – ein stiller, dienstbarer Genius, der der erschöpften Pilgerin Seele den Arm bietet über den Graben der Zeit, das Feenschloss der ewigen Herrlichkeit aufschließt, freundlich nickt und verschwindet.
Friedrich Schiller,
Reich Ottos I. um 962
Stammbaum der Ottonen
DRAMATIS PERSONAE
Es folgt eine Aufstellung der wichtigsten Figuren, wobei die historischen Personen mit einem * gekennzeichnet sind.
Deutsche und Einwanderer
Gaidemar, der Bastard
Adelheid* von Burgund, Königin von Italien und des Ostfränkischen Reiches
Otto I.*, ihr Gemahl, König des Ostfränkischen Reiches und von Italien
Liudolf*, König Ottos Sohn aus erster Ehe, Herzog von Schwaben und schwarzes Schaf
Ida* von Schwaben, seine Gemahlin
Liudgard*, König Ottos Tochter aus erster Ehe
Konrad* »der Rote«, Herzog von Lothringen, ihr Gemahl
Emma*, Adelheids Tochter aus erster Ehe
Wilhelm*, König Ottos unehelicher Sohn, Erzbischof von Mainz
Heinrich*, Brun*, Mathilda* und Otto*, Adelheids und Ottos gemeinsame Kinder
Heinrich* »Henning«, König Ottos Bruder, Herzog von Bayern
Judith* von Bayern, seine Gemahlin
Brun*, König Ottos Bruder, Erzbischof von Köln
Dedi* von Wettin, Graf im Hassegau, Liudolfs Freund und Mitverschwörer
Wilhelm* »Wim« von Weimar, Graf im Südthüringgau, noch ein Mitverschwörer
Arnulf*, Pfalzgraf von Bayern, Judiths Bruder und ebenfalls Mitverschwörer
Friedrich*, Erzbischof von Mainz, Wendehals
Gero* von Merseburg, der »Slawenschlächter«, Graf der Ostmark
Wichmann* und Ekbert* Billung, König Ottos rebellische Vettern
Immed von Saalfeld, Graf im Ammergau, Gaidemars Ziehbruder
Uta von Saalfeld, Gräfin im Westergau, Gaidemars Ziehschwester
Hulda von Lüneburg, Gräfin im Salzgau, Adelheids Vertraute
Hardwin von Wieda, Graf im Liesgau, Kommandant der königlichen Panzerreiter
Sigismund, Graf im Westergau, ein Schuft
Notker* »Pfefferkorn«, Maler, Arzt und Hospitarius von St. Gallen
Ulrich*, »der heilige Krieger«, Bischof von Augsburg
Italiener
Berengar*, Markgraf von Ivrea und gelegentlich König von Italien
Adalbert*, sein Sohn
Atto* (eigentlich Adalbert Atto), Graf von Canossa
Tedald*, sein Sohn
Otbert*, Graf von Mailand
Walpert*, Erzbischof von Mailand
Guido, Pfalzgraf von Asti
Dado von Benevent, sein Schwager
Exoten
Bulcsú*, oberster Richter und Kriegsherr der Ungarn
Lehel* und Sûr*, ebenfalls ungarische Heerführer
Nakon*, Fürst der Obodriten
Stoinef*, sein Bruder und Mitregent
Tugomir*, Fürst der Heveller
Bolilut*, sein Sohn und Erbe
ERSTER TEIL 951–954
Garda, August 951
»Wenn Ihr leben wollt, müsst Ihr graben«, raunte der Mönch in dem ausgefransten, staubigen Habit.
Adelheid blickte nicht auf und ging weiter zur Kapelle, ohne ihren Schritt zu verlangsamen. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass der Mönch seinen Weg in entgegengesetzter Richtung fortsetzte – nicht hastig, nicht gemächlich, aber würdevoll, so wie Mönche eben gingen. Sie wusste trotzdem, dass dieser Mann nicht war, was er zu sein vorgab.
So wie alle Männer in ihrem Leben.
Die Morgensonne lugte bereits über die Burgmauer und ließ die staubige Erde hier und da wie Juwelen funkeln. Trotz der frühen Stunde herrschte schon reges Treiben im Innenhof: In der Schmiede auf der Nordseite sang der Hammer. Drei dienstfreie Wachen hatten sich an der offenen Tür versammelt und fachsimpelten mit dem Schmied. Mägde scharten sich um einen Eselskarren, der Brot, Kohlköpfe und fangfrischen Fisch aus dem Dorf heraufgebracht hatte. Alle wirkten geschäftig, aber jeder fand Zeit, der Gefangenen auf dem Weg zur Frühmesse einen kurzen Blick zu schenken. Manche waren mitfühlend, andere hämisch, die meisten undurchschaubar.
Adelheid betrat die dämmrige, schlichte Kapelle, während die beiden Wachen, die sie hergeleitet hatten, vor der Kirchentür Aufstellung nahmen. Stumm wie üblich, denn ihnen war wie allen Burgbewohnern verboten, das Wort an sie zu richten. Vater Giovanni stand bereits vor dem Altar und murmelte auf Latein vor sich hin, den Rücken zu der kleinen Gemeinde, die aus drei alten Weibern und einem blinden Mönch bestand.
Adelheid kniete sich in den buttergelben Sonnenfleck, der durch die Fensteröffnung über dem Altar auf den Boden fiel, und faltete die Hände. Die Sonne färbte die Dunkelheit vor ihren geschlossenen Lidern rötlich und wärmte ihr das Gesicht wie eine liebkosende Hand. Es war ein schönes Gefühl.
Heilige Jungfrau, voll der Gnaden. Heute ist der einhundertundneunzehnte Tag meiner Gefangenschaft, wie du zweifellos weißt. Seit fast vier Monaten bete ich zu dir, mich aus der Hand meiner Feinde zu befreien, aber es nützt nichts. Bruder Guido ermahnt mich, nicht den Glauben zu verlieren und mich darauf zu besinnen, dass ich eine burgundische Prinzessin und die Königin von Italien bin. Ich weiß, ich muss tapfer sein. Vor allem für Emma. Aber es wird von Tag zu Tag schwieriger. Heute früh beim Aufwachen habe ich mich dabei ertappt, dass ich keinen Funken Hoffnung mehr hatte. Und da kommt ein Fremder und sagt, ich solle graben. Hast du ihn mir geschickt? Bitte, heilige Muttergottes, lass mich an der richtigen Stelle graben. Und bitte, bitte lass es keine Falle sein …
»Wo haben sie Euch hingebracht?«, fragte Anna furchtsam, kaum dass die schwere Tür zu ihrem Kellerverlies mit dem vertrauten, hallenden Poltern zugefallen war.
»Zur Kapelle. Ich durfte die Frühmesse hören«, antwortete Adelheid.
»Gelobt sei Jesus Christus«, murmelte Bruder Guido. Er war nicht nur Benediktiner, sondern ebenso Priester und konnte somit selber die Messe feiern. Aber ohne Kirche, vor allem ohne Brot und Wein, fühlte es sich immer falsch an, wie gemogelt.
»Hier, die Wache hat unser Essen gebracht.« Die Magd wies auf den kleinen, wackeligen Tisch: ein Laib Brot und ein Krug Brunnenwasser. Das war alles, so wie jeden Tag. Für drei Erwachsene und ein Kind.
Adelheid nickte. Beim Anblick des mehlbestäubten Brotes sammelte sich zu viel Speichel in ihrem Mund, doch sie wusste, sie musste sich beherrschen und noch ein wenig warten. Wenn sie ihren Anteil schon jetzt am frühen Morgen anknabberte, würde sie wieder die ganze Nacht nicht schlafen können vor Hunger.
Sie kniete sich ins feuchte Bodenstroh und beugte sich über ihre schlummernde Tochter. Eine Fackel steckte in einem eisernen Wandhalter, und in ihrem Licht sah Adelheid die unnatürliche Blässe des Kindes. Emmas Geburtstag fiel auf den Tag des heiligen Cyprian im September, und falls sie ihn noch erlebte, würde es ihr dritter sein. Sie war immer zart gewesen. Selbst als Säugling hatte Emma nie Speck aufgewiesen; die älteren Hofdamen und Dienerinnen in Pavia hatten die Köpfe darüber geschüttelt. Aber jetzt war das Gesichtchen ausgezehrt, und unter den Augen lagen Schatten wie mit Holzkohle aufgemalt. Adelheid nahm Emmas kleine Hand in ihre und hauchte einen Kuss darauf. Fang ja nicht an zu heulen, schärfte sie sich ein. Das hilft niemandem.
Das Kind wurde nicht wach.
Adelheid richtete sich auf. »Ein Fremder in einer Mönchskutte hat mir auf dem Weg zur Kapelle zugeflüstert, ich solle graben«, berichtete sie Anna und Guido. Sie hielt die Stimme gesenkt. Sie war allein mit ihrer Magd und ihrem Kaplan, aber sie fürchtete immer, die Wachen könnten sie durch ein verstecktes Loch in der Mauer belauschen.
»Graben?«, wiederholte Anna, ebenso leise, aber unverkennbar ungläubig. »Durch Ziegel?«
»Aber was ist unter den Ziegeln?«, gab Adelheid zu bedenken.
»Fels«, antwortete der Bruder prompt. »Erinnert Euch an unsere Ankunft: Diese Burg thront auf einem Felsrücken über dem See.«
Adelheid nickte und streckte die Hand aus. »Gebt mir Euer Speisemesser, Bruder Guido.«
»Aber meine Königin, Ihr müsst doch einsehen, dass es keinen Zweck hat«, wandte er nachsichtig ein. Er war schmächtig, von eher kleinem Wuchs und mit einem sanftmütigen Wesen gesegnet, aber weil er hier der einzige Mann war, tat er gern so, als besitze nur er einen Funken Verstand. »Wir müssen uns in Geduld fassen und beten, dass Gott diese Prüfung bald vorübergehen lässt. Das ist das Einzige, was wir tun können.«
»Nur zu, betet, das kann keinesfalls schaden. Aber wenn wir nicht bald hier herauskommen, wird es für Emma zu spät sein. Also werde ich graben.«
Er löste das stumpfe, kurze Messer von der geflochtenen Kordel, die ihm als Gürtel diente, und legte es in ihre wartende Hand, warnte aber: »Wenn sie Euch erwischen, wird es furchtbar werden.«
»Ich weiß.«
Ihr Verlies lag tief in den Eingeweiden der Festung. Als die Gefangenen im Frühling hergebracht worden waren, hatten sie in der feuchten Kälte hier unten erbärmlich gefroren, aber inzwischen hatte die Sommerhitze, die draußen in der lebenden Welt das Gras verdorren ließ, den Keller ein wenig aufgewärmt. Der fensterlose Kerker war niedrig, maß jedoch acht mal zehn Schritte. Nicht wirklich genug Platz, um für einen männlichen und zwei – oder zweieinhalb – weibliche Gefangene den Anstand zu wahren, aber wenigstens hatten sie mit Hilfe einer Schnur und einer Decke eine Ecke abtrennen können, wo der Eimer stand, in den sie ihre Notdurft verrichten mussten. An der gegenüberliegenden Wand hatten sie ihre Schlafdecken ausgebreitet, nur für Emma gab es ein Schaffell. Der gesamte Boden war mit einer Strohschicht bedeckt, die halbwegs üppig und in vier Monaten immerhin einmal erneuert worden war. Den Blick nach unten gerichtet, schritt Adelheid langsam durch das Verlies, traf ihre Wahl willkürlich, sank etwa in der Raummitte auf die Knie und schob das Stroh beiseite. Die schmalen, roten Ziegel, die darunter zum Vorschein kamen, waren wie Fischgräten verlegt, schwärzlicher Lehm füllte die Fugen. Adelheid kratzte diese um drei der Ziegel vorsichtig mit Bruder Guidos Messer aus und wischte die Klinge gelegentlich im Stroh ab. Dann nahm sie den ersten Backstein zwischen Daumen und Zeigefinger beider Hände und ruckelte. Der längliche Ziegel löste sich anstandslos. Überrascht starrte Adelheid darauf hinab, legte ihn hastig beiseite und löste den nächsten. Innerhalb kürzester Zeit hatte sie den Bodenbelag auf einer Fläche von sechs oder acht Handtellern gelöst.
Es raschelte, als Anna sich zu ihr ins Stroh hockte. »Und? Was ist unter den Ziegeln?«
»Schutt«, antwortete die junge Königin.
Bruder Guido hörte mitten im Credo auf zu beten und gesellte sich zu ihnen. »Und unter dem Schutt?«
Einen Moment sahen sie sich an, dann klaubten sie alle drei mit bloßen Händen das lose Material aus dem kleinen Erdloch. Zwei weitere Ziegel lösten sich vom Rand der Grabung. Der Schuttbelag bestand aus kleinen Kieseln und Gesteinssplittern, und die Schicht war vielleicht einen Spann tief. Darunter kam zu ihrer Verblüffung ein Eichenbrett zum Vorschein, und als sie auch das freigelegt und angehoben hatten, stieß Anna einen kleinen Schrei aus. »Heiliger Mauritius!«
»Was ist los?«, fragte Emma schlaftrunken.
Adelheid wandte sich zu ihr um. »Gar nichts.« Sie lächelte ihrer Tochter zu. »Alles ist gut, mein Liebling.«
Und vielleicht, vielleicht war das heute ausnahmsweise einmal keine Lüge.
Unter dem Holzbrett war der Fels, vor dem Guido sie gewarnt hatte, aber er formte ein so tiefes Loch, dass Emma sich darin hätte verstecken können. Und damit nicht genug, war der Fels porös. Als der Mönch das achtlos beiseitegelegte Messer zur Hand nahm und halbherzig damit an der Kante herumstocherte, bröckelte ein faustgroßes Stück heraus und kullerte abwärts. Adelheid steckte den Arm in das Loch, fischte den Brocken heraus und wog ihn in beiden Händen. »Leicht.«
»Aber selbst wenn der ganze Burgfels aus diesem porösen Stein besteht, brauchen wir Jahre, um uns ins Freie zu graben«, prophezeite der Mönch düster.
»Ich glaube nicht, Bruder Guido«, widersprach Adelheid versonnen.
»Wieso nicht?«
Ehe sie antworten konnte, hob Anna den Kopf. »Schritte!«
Adelheid sprang auf die Füße und schob hastig das Holzbrett zurück. Aber noch ehe Bruder Guido auch nur den ersten Ziegel wieder an seinen Platz gelegt hatte, rasselte der Riegel der Kerkertür.
Langsam schwang die Tür auf, und Berengar von Ivrea trat ein, eine Fackel in der linken Faust. »Nun, meine spröde Schöne? Hast du es dir überlegt? Bist du heute vielleicht gewillt, dem Witwenstand zu entsagen?«
Er war ein breitschultriger Mann um die fünfzig in einem verschrammten Lederwams, und das mächtige Schwert an seiner Seite wäre gar nicht nötig gewesen, um zu betonen, welch ein gefährlicher Krieger er war. Man sah es an dem scharfkantigen Gesicht mit dem gelockten, graumelierten Bart, vor allem an den Augen. Kühl und berechnend betrachteten sie die Gefangene, und immer schien ein Hauch von grausamer Belustigung darin zu glimmen, so als sei all das hier nur ein Streich, als sei nichts auf der Welt wirklich ernst.
Adelheid schüttelte langsam den Kopf. »Ich kann Euren Sohn nicht heiraten, Graf Berengar, so schmeichelhaft Euer Ansinnen auch sei.«
Er verschränkte die Arme vor der breiten Brust und sah an ihrer rechten Schulter vorbei. »Was ist mit eurem wackeren Mönchlein? Hat ihn der Schlag getroffen?«
Adelheid wandte den Kopf. Bruder Guido lag mit dem Gesicht nach unten und mit ausgebreiteten Armen auf dem Boden. Er hatte gerade noch Zeit gefunden, den Strohbelag über das freigelegte Brett und die gelösten Ziegel auszubreiten, und hatte sich darübergeworfen, um etwaige verräterische Spuren zu verdecken.
»Er verrichtet eine Buße«, erklärte Adelheid. »Er schweigt und fastet seit drei Tagen.«
»Ah. Ist er endlich der Verlockung erlegen und hat deine kleine Zofe besprungen? Oder am Ende gar dich?«
Adelheid würdigte ihn keiner Antwort. Sie wusste ganz genau, warum er ständig solche Dinge zu ihr sagte. Und was es in Wahrheit war, das er von ihr wollte. Vermutlich hätte er es sich längst genommen, hätte ihm nicht so viel daran gelegen, dass sie seinen Adalbert heiratete, einen pickeligen Jüngling von fünfzehn Jahren. Allein die Ehre seines Sohnes war es, die Berengar bewog, sich zu zügeln. Aber wie lange noch, war unmöglich vorherzusagen, denn er war es gewöhnt, sich zu nehmen, was er wollte. Die Erkenntnis, wie ausgeliefert sie ihm war, erfüllte Adelheid mit erdrückender Furcht und gab ihr das Gefühl, klein und wertlos zu sein. Doch weil sie ahnte, dass genau das seine Absicht war, setzte sie alles daran, sich nicht einschüchtern zu lassen.
»Welch große Tapferkeit Ihr beweist, indem Ihr eine schutzlose Witwe beleidigt«, versetzte sie frostig. »Aber nachdem Ihr meinen Gemahl vergiftet habt, denkt Ihr vermutlich, es spielt keine Rolle, was Ihr sagt oder tut. Denn tiefer kann man wohl kaum sinken.«
Berengar von Ivrea lachte in sich hinein, so als gefiele ihm ihr Schneid. Dann hob er beiläufig die Rechte und schlug Adelheid ins Gesicht. So viel ungehemmte Kraft lag in dem Hieb, dass sie taumelnd ins Stroh fiel. Anna stieß einen kleinen Schrei aus, Emma ein erbarmungswürdiges Wimmern.
Die junge Königin von Italien stützte die Hände ins Stroh, kam wieder auf die Füße und wischte sich mit dem Handrücken das Blut ab, das aus dem linken Nasenloch rann. »Würdet Ihr meiner Zofe wohl erlauben, mit meiner Tochter einen Moment hinaus in die Sonne zu gehen? Ehe wir unsere Unterhaltung fortsetzen?« Ihre Stimme bebte nicht, und sie flehte auch nicht. Aber es war nicht weit davon entfernt.
»Nichts da, Herzblatt«, knurrte Berengar. »Die kleine Emma soll ruhig sehen, was es einem Weib einbringt, so störrisch zu sein. Das kann ein Mädchen gar nicht früh genug lernen, scheint mir.«
Es war keine neue Erkenntnis, dass Berengar von Ivrea vollkommen mitleidlos und unbarmherzig sein konnte. Er war schon der mächtigste Mann in der Lombardei gewesen, als Lothar – Adelheids Gemahl – vor fünf Jahren König geworden war. Und er war die eiserne Faust hinter Lothars Thron gewesen. Doch irgendwann hatte ihm das nicht mehr genügt, und dann war der junge, kerngesunde König plötzlich und scheinbar unerklärlich erkrankt und gestorben. Jeder in der Lombardei, in ganz Italien wusste, dass Berengar dahintersteckte. Und Lothar war kaum unter der Erde gewesen, als Berengar sich zum König ausrufen ließ. Doch nach lombardischem Recht gehörte die Krone Adelheid, denn sie war die Erbin ihres Gemahls. Und deswegen wollte Berengar sie mit seinem Sohn vermählen und würde vor nichts haltmachen, um sein Ziel zu erreichen.
Er trat einen Schritt zurück und stieß die Tür auf. »Komm herein, mein Junge.«
Nach einem winzigen Zögern trat Adalbert in den dämmrigen Kerker. Er war großgewachsen wie sein Vater und nicht mehr so spindeldürr wie noch vor einem Jahr. Seine Haltung war stolz, der Blick der dunklen Augen herausfordernd und missmutig. Es war schlimmer geworden mit den Pickeln. Selbst im zuckenden Fackelschein sah Adelheid die roten, eitrigen Pusteln auf Stirn und Wangen und die kraterartigen Narben, die ihre Vorgänger hinterlassen hatten. Eine Bürde für einen Jungen in Adalberts Alter, wusste sie, und fast hätte sie ihn bedauern können. Hätte er nicht seine Reitgerte mitgebracht.
»Nur zu, sag der Königin, was du auf dem Herzen hast«, forderte Berengar ihn auf. Es klang gönnerhaft. Er gab sich nie die geringste Mühe, zu verhehlen, dass er Adalbert verachtete.
»Du wirst heute endlich einwilligen, mich zu heiraten, Adelheid«, sagte der Jüngling, aber der Befehlston missglückte, weil er mit einem stimmbrüchigen Kiekser endete. »Wir sind es satt … Ich bin es satt, darauf zu warten.«
»Ich bedaure, Adalbert.« Adelheid war nur vier Jahre älter als der Junge, doch als sie sah, wie ihre Zurückweisung ihn kränkte, hatte sie das Gefühl, ihm Trost spenden zu müssen. Wie eine ältere Schwester es vielleicht getan hätte. »Es liegt nicht an dir, verstehst du. Aber mein Witwenjahr ist noch nicht vorüber. Meine Trauer schmerzt mich noch zu sehr, als dass ich jetzt schon einen neuen Gemahl wählen könnte.«
Der Tonfall war genau der falsche gewesen, erkannte sie mit sinkendem Herzen. Adalbert stieg die Zornesröte ins Gesicht und brachte seine Pickel förmlich zum Leuchten. »Du hochmütiges Miststück«, stieß der Junge wütend hervor und hob den Arm mit der Gerte. »Ich werd dir deine Trauer austreiben!«
Adelheid wandte den Kopf nach rechts und hob schützend die Arme vors Gesicht. Der erste Hieb traf sie auf Hals und Schulter, und sie staunte über die Schärfe des Schmerzes. Emma fing an zu schluchzen. Pfeifend fiel der zweite Schlag, dieses Mal auf die linke Brust, und Adelheid musste sich auf die Zunge beißen, um still zu bleiben.
Heilige Muttergottes, lass nicht zu, dass sie Emma wehtun.
Zwischen ihren schmalen Unterarmen sah sie Berengar seinem Sohn die Gerte aus der Hand reißen und den Jungen beiseitestoßen.
Adelheid wandte ihnen den Rücken zu und schloss die Augen.
Und egal, wie sie mich zurichten, gib mir die Kraft zu graben …
Gaidemar wusste, dass ihm die Zeit davonlief.
Über dem Westufer versank die Sonne wie eine geschmolzene Kupfermünze, und allmählich nahm der Himmel eine taubenblaue Tönung an. Das Wasser des Sees schimmerte einen Ton dunkler und kräuselte sich in sachten Wellen. Grillen sangen im hohen Ufergras, und irgendwo in der Nähe trällerte ein Distelfink im Gebüsch.
Das schrille Gezwitscher ging ihm auf die Nerven. Gaidemar kramte den Wetzstein aus dem Beutel am Gürtel, zog das unscheinbare Messer aus der versteckten Hülle im Ärmel und fing an, die Klinge zu schärfen. Das beruhigte ihn, und das ungewohnte Geräusch stopfte dem Distelfink den Schnabel.
Gut so.
Es war eine Woche her, dass er die Königin im Burghof abgepasst und ihr im Vorbeigehen den Rat zugeflüstert hatte, der möglicherweise ihr Leben retten konnte. Aber hatte sie ihn überhaupt gehört? Falls ja, würde sie tun, was er gesagt hatte? Falls ja, konnte sie wirklich einen Weg in die Freiheit graben?
Gaidemar hatte keine Ahnung.
Er wusste nur dies: Wenn sie nicht bald kam, war sein Plan gescheitert, und er würde sich etwas anderes überlegen müssen. Und zwar schnell. Denn sollte Berengar von Ivrea zu der Erkenntnis gelangen, dass Adelheid von Burgund sich nicht dazu bewegen ließ, seinen Sohn zu heiraten, würde er sie töten.
Das hätte Gaidemar nicht unbedingt den Schlaf geraubt – schließlich kannte er die Dame ja überhaupt nicht –, aber es hätte bedeutet, seinen König zu enttäuschen. Und das war nie ratsam. Für einen Mann in seiner Position erst recht nicht.
Er spähte durch das mannshohe Schilf, in dem er sich verborgen hielt. Im nahen Dorf flammten die ersten Lichter in den bescheidenen Holzhütten auf und blinzelten in die Dämmerung, aber kein Mensch war auf der staubigen Straße zu entdecken. Die Fischer von Garda gingen früh schlafen, wusste er, denn sie fuhren lange vor Sonnenaufgang auf den See hinaus. Gaidemar hatte reichlich Zeit gehabt, sie und ihren Lebensrhythmus zu studieren. Anders als sie schlief er tagsüber ein paar Stunden und durchwachte die Nächte. Er wusste, falls Adelheid überhaupt jemals kommen würde, dann im Schutz der Dunkelheit.
Er legte Messer und Wetzstein beiseite, denn im schwindenden Licht konnte er einen Wanderer nicht rechtzeitig kommen sehen und mit dem schleifenden Geräusch womöglich unwillkommene Aufmerksamkeit auf sich lenken. Er musste vorsichtig sein. Mochte er auch im Auftrag des Königs hier sein, führte er doch kein besiegeltes Pergament mit sich, um das zu beweisen. Und selbst wenn. Es hätte den fürchterlichen Berengar todsicher nicht davon abgehalten, ihn diskret aus der Welt zu schaffen. Denn wer sollte es je herausfinden? König Ottos Macht mochte fünfhundert Meilen weit und über die Alpen bis hierher reichen, aber sein Blick eher nicht.
Gaidemar griff seufzend nach seinem Proviantbeutel und fischte ein Stück altbackenes Brot heraus, als er ein Geräusch hörte. Leise, verstohlen – wie das Huschen eines kleinen Tieres. Er spähte angestrengt zum Eingang der Höhle hinüber, der wie das schiefe Maul eines Ungeheuers in der schroffen Felswand gähnte. Doch nichts rührte sich dort. Falscher Alarm, wieder einmal. Er wusste ja nicht einmal, ob er an der richtigen Stelle wartete. Das ganze Unterfangen war hoffnungslos, er hatte es ja von Anfang an gewusst …
Er ließ sich auf die Ellbogen zurücksinken, biss ein kleines Stück von seinem Brot ab, suchte und fand die ersten Sterne am wolkenlosen Abendhimmel. Er kontrollierte auch seine Weinvorräte und fand den Schlauch über halb voll. Doch er genehmigte sich nur einen kleinen Schluck. Wenn er einschlief und sie verpasste, würde er sich das nie verzeihen. Falls sie denn je kam und nicht längst tot war.
Mit einem ungeduldigen Laut schüttelte Gaidemar den Kopf, als könne er das sinnlose Kreisen seiner Gedanken damit zum Stillstand bringen.
Die letzten zwei, drei Stunden vor dem Morgengrauen waren immer die schlimmsten. Seine Lider wurden so schwer, als hätten die Feen ihm einen Streich gespielt und winzige Bleigewichte an seine Wimpern geknotet. Von Nacht zu Nacht wurde es schwieriger, standhaft und vor allem wach zu bleiben. Ein wenig steif erhob er sich aus dem Schilf und wandte sich zum Seeufer, um sich mit ein paar Händen voll Wasser zu erfrischen. Am besten wäre es vermutlich, ich stecke gleich den Kopf hinein, überlegte er, als er aus dem Augenwinkel ein Licht sah.
Er blieb stehen und drehte langsam den Kopf in die Richtung. Es war der unstete Schein einer Fackel, der im Höhleneingang zu verharren schien.
Gaidemar verließ sein Versteck im Schilf und bewegte sich so lautlos wie möglich auf den flackernden Lichtpunkt zu. Als er vielleicht noch zehn Schritte entfernt war, erkannte er einen Mönch, der die Fackel hielt, und zwei schmale Frauengestalten, von denen eine ein kleines Kind vor die Brust gebunden trug. Er nahm die Rechte vom Heft seines Messers, trat bis an den Rand des Lichtkleckses und verneigte sich.
»Erschreckt nicht, edle Königin«, bat er leise.
Die kleinere Frau zog hörbar die Luft ein, es war fast ein Schrei. Aber die andere mit dem Kind, die voranging, stand still wie ein Findling. »Wer seid Ihr?« Es klang herausfordernd, auch wenn die Stimme ein wenig bebte.
Das war weiß Gott kein Wunder.
»Mein Name ist Gaidemar. König Otto schickt mich.« Das war nur fast richtig, aber für lange Erklärungen hatten sie jetzt keine Zeit.
Sie atmete tief durch. »Um was zu tun?«
»Euch zur Flucht zu verhelfen, wenn ich kann.«
»Ach wirklich? Und woher weiß ich, dass Ihr nicht Graf Berengar dient und mich geradewegs zu ihm zurückbringt?«
Die Fackel flackerte und fauchte in der kühlen Nachtbrise, die um diese Stunde immer über den See strich, doch Gaidemar sah die Furcht in den Gesichtern der Flüchtlinge: Der Mönch starrte ihn mit undurchschaubarer Miene an, aber Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Die Dienerin atmete zu flach und schnell. Und die junge Königin hatte die Hände schützend auf den Rücken ihrer Tochter gelegt und die Augen zu weit aufgerissen.
»Warum hätte ich dann zu Euch kommen und Euch raten sollen zu graben?«, entgegnete Gaidemar.
»Es sähe ihm ähnlich«, erwiderte sie prompt. »Er ist ein Spieler, und je grausamer das Spiel, desto mehr erheitert es ihn.«
»Verstehe. Nun, wir können hier herumtrödeln und debattieren, bis die Sonne wiederkommt, edle Königin, aber ich schätze, in einer, spätestens zwei Stunden wird man Eure Flucht bemerken. Darum riskiert Ihr nicht viel, wenn Ihr Euch mir anvertraut. Denn tut Ihr es nicht, schnappen sie Euch auf jeden Fall.«
»Was fällt Euch ein, Ihr unverschämter Lump«, empörte sich der Bruder zischend. »Wisst Ihr eigentlich, wen Ihr vor Euch habt?«
Die Königin hob gebieterisch die Hand, und Gaidemar fuhr die Frage durch den Sinn, ob man Prinzessinnen solche Gesten lehrte wie das Lesen und Sticken.
»Er hat recht«, beschied Adelheid ihren Begleitern. »Vergebt mein Zögern, Gaidemar. Wir haben schwere Monate hinter uns und können nicht so recht glauben, dass sie vorüber sein sollen.«
Er machte ihr nichts vor. »Das sind sie ja auch noch nicht. Es ist ein ziemlich weiter Weg bis zu dem Ort, wo Ihr in Sicherheit sein werdet.«
»Wo bringt Ihr uns hin?«, verlangte der Mönch zu wissen.
Gaidemar blickte nochmals zum Himmel auf und wies dann nach Osten. »Erst einmal in das Kornfeld dort drüben. Bis es hell wird, erreichen wir kein besseres Versteck. Aber wenn wir Glück haben, werden sie glauben, Ihr seiet schon gestern Abend entkommen und viel weiter weg von der Burg, dann werden sie die umliegenden Felder nicht durchkämmen.«
»Und falls doch?«, fragte Adelheid.
»Dann lassen wir uns etwas einfallen«, gab er brüsk zurück – mit mehr Selbstsicherheit, als er empfand.
»Ich bin überzeugt, in der Kunst seid Ihr unübertroffen«, sagte die junge Königin mit einem Lächeln.
Es war matt und eine Spur spöttisch, dieses Lächeln, aber trotzdem verspürte Gaidemar ein sonderbares Durchsacken in der Magengegend, so als hätte er eine Stufe übersehen.
Er wandte ihr abrupt den Rücken zu. »Kommt hier entlang. Und löscht die Fackel.«
Schweigend folgten ihm die Flüchtlinge. Der halbvolle Mond erhellte ihnen den Weg und übergoss den See mit einem silbrigen, unirdischen Schimmer. Sie kehrten dem Gewässer den Rücken und schlugen einen schmalen Pfad ein, der sich fast unsichtbar durch die braun versengte Wiese schlängelte und bei einer Einsiedelei endete. Diese war schon lange verlassen, hatte Gaidemar bei seinen Erkundungsgängen herausgefunden. Die unfachmännisch aufgestapelten Bruchsteine waren mehrheitlich heruntergepurzelt, sodass man nur noch den Grundriss des winzigen Kapellchens erahnen konnte. Gleich dahinter begannen die Felder, und die nächtlichen Wanderer hatten Glück: Hier war Gerste angebaut, und sie stand reif und so hoch, dass sie ihnen fast bis an die Hüfte reichte.
Gaidemar teilte die Halme behutsam, um sie nicht abzuknicken. »Macht einen großen Schritt hinein. Trampelt so wenig wie möglich nieder, und geht im Gänsemarsch.«
Sie befolgten seine Anweisungen, und er bildete die Nachhut. Als sie vielleicht hundert Schritt weit ins Korn vorgedrungen waren, ließ er sie anhalten. »Hier sollten wir fürs Erste sicher sein. Legt Euch hin, und sobald es hell wird, haltet die Köpfe unten.«
Dankbar sanken die beiden Frauen und der Mönch ins duftende Korn. Die Königin löste behutsam die löchrige Decke, in welcher sie das Kind getragen hatte, und bettete das kleine Mädchen auf die Erde. »Gott sei gepriesen, dass mein Knoten gehalten hat«, sagte sie leise. »Es war eine gefährliche Kletterei in der Höhle, und meistens brauchte ich beide Hände, um mich festzuhalten.«
Gaidemar nickte, setzte sich im Schneidersitz vor sie und streckte ihr wortlos seinen Proviantbeutel entgegen.
»Danke.« Nach einigen Fehlversuchen gelang es ihr, den Knoten zu lösen, und sie förderte Brot, Feigen und Ziegenkäse zutage.
»Vermutlich nicht das, was ihr gewöhnt seid«, entschuldigte sich Gaidemar vorsichtshalber, wenngleich er bei seiner ersten Feige ein paar Tage zuvor geglaubt hatte, er sei gestorben und wider alle Wahrscheinlichkeit im Paradies gelandet. »Aber es hätte Argwohn erregt, wenn ich im Dorf nach edleren Speisen gefragt hätte.«
Die Königin reichte ihrer Magd eine Frucht und antwortete kopfschüttelnd: »Brot und Wasser sind wir gewöhnt, nichts sonst. Dies hier ist ein Festmahl für uns.« Sie gab die zweite Feige an den Mönch weiter und begann, an der dritten zu knabbern.
»Ich habe auch Wein.« Gaidemar holte den Schlauch aus der Tasche, die er über der Schulter getragen hatte, und gab ihn ihr.
»Ihr zuerst«, sagte Adelheid mit einer einladenden Geste.
»Das ist nicht nötig«, wollte Gaidemar abwehren. »Ich hatte vorhin …«
»Ihr zuerst«, wiederholte sie, und er hörte etwas Stählernes in ihrer Stimme, das er einem Schilfhalm wie ihr nie zugetraut hätte, etwas ganz und gar Unbeugsames. »Mein Gemahl starb an vergiftetem Wein, und ich habe nur Euer Wort, dass Ihr in König Ottos Diensten steht und nicht in Graf Berengars. Also werdet Ihr vor mir trinken.«
»Oh. Verstehe.« Er nahm ihr den Schlauch wieder ab und trank einen ordentlichen Zug. Er war nicht wütend. Sie hatte ja völlig recht mit ihrem Argwohn.
Adelheid ließ ihn nicht aus den Augen, vergewisserte sich, dass er nicht nur vorgab zu trinken. Als sie erkannte, dass er sie nicht hinters Licht führte, entspannten sich ihre Züge. Sie ergriff den Schlauch mit ihren schmalen Händen und trank durstig.
»Soll ich Emma wecken und ihr zu essen geben?«, fragte die Dienerin. »Sie hatte so furchtbaren Hunger gestern Abend.«
Adelheid setzte ab und schüttelte den Kopf. »Lass sie schlafen. Verzeiht mir, Gaidemar, ich habe Euch meine Begleiter noch gar nicht vorgestellt. Dies ist Bruder Guido, mein Kaplan. Und Anna, meine Zofe. Sie sind meiner Tochter und mir freiwillig in die Gefangenschaft gefolgt.«
»Ja, das habe ich gehört«, antwortete er. Und er fand, es sprach für die beiden treuen Seelen, aber ebenso für die junge Königin. Er wartete, bis sie ihren ärgsten Hunger gestillt hatten, ehe er fragte: »Es stimmt also wirklich, dass der Fels unter dem Bergfried teilweise brüchig und von Höhlen durchzogen ist?«
Bruder Guido nahm einen anständigen Zug aus dem Weinschlauch, setzte ab und wischte sich mit dem Handrücken über die Lippen. »Es stimmt. Der ganze Boden unseres Kerkers war mit Holzbrettern abgedeckt, unter denen sich loser Stein und Kavernen verbargen. Wir haben an einem der tieferen Löcher begonnen zu graben und den Schutt, den wir aushoben, in die übrigen verfüllt. Ich hatte trotzdem keine Hoffnung, dass wir einen Weg in die Freiheit finden könnten, doch die Königin hat nie den Mut verloren.«
Adelheid zog die schmalen Schultern hoch. »Ich hatte den Höhleneingang im Felsen gesehen, als man uns herbrachte. Ich habe gebetet, dass wir einen Zugang zu den Höhlen finden, wenn wir nur lange genug graben, aber … es wurde von Nacht zu Nacht schwerer, daran zu glauben.« Sie sah auf ihre schlafende Tochter hinab und strich ihr behutsam eine verirrte Haarsträhne von der Wange. Dann sah sie Gaidemar wieder an. »Ich konnte es mir nicht leisten aufzugeben.«
Er nickte und wandte den Blick ab. Nicht nur bezaubernd und verdammt mutig, sondern obendrein auch noch nett, dachte er verdrossen. Das hat mir so gerade noch gefehlt …
»Aber woher wusstet Ihr von der Beschaffenheit der Felsen und der Höhle?«, wollte sie wissen.
»Ein Schäfer hat mir davon erzählt. Ich traf ihn draußen auf den Hügeln, als ich die Burg auskundschaften wollte. Er war nicht gut auf Graf Berengar zu sprechen, weil …« Gerade noch rechtzeitig besann er sich, dass er hier Damen vor sich hatte. Eine Königin gar. Und wer konnte wissen, ob ihr in Berengars Händen nicht das Gleiche passiert war wie der Tochter des Schäfers. Gaidemar wechselte die Richtung. »Es war nicht schwer, ihm den besten Fluchtweg zu entlocken. Jedenfalls, nachdem ich ihn gebeten hatte, langsamer zu reden. Das Deutsch, das ihr hier in der Lombardei sprecht, klingt höchst sonderbar für jemanden, der in Thüringen aufgewachsen ist.«
»Und ich nehme an, Ihr seid nicht wirklich ein Mönch?«, fragte Adelheid und wies auf seine Verkleidung.
Gaidemar musste sich ein Grinsen verbeißen. »Ich bin ein Panzerreiter, edle Königin.«
»Oh.« Es klang beeindruckt. Offenbar war der Ruf von König Ottos handverlesenen Reitersoldaten über die Alpen gelangt. »Und wenn ich fragen darf, wer genau seid Ihr? Gaidemar … von wo?«
»Gaidemar von Nirgends«, klärte er sie auf. »Ich bin ein Bastard.«
Die Zofe starrte ihn an und hatte für den Moment das Kauen vergessen. Bruder Guido räusperte sich pikiert. Was die Königin von der Eröffnung hielt, war unmöglich zu sagen, denn sie ließ es sich nicht anmerken. »Vergebt mir«, bat sie. »Ich hätte nicht fragen sollen. Ich glaubte, König Ottos Reiterlegionen bestünden aus jungen Edelleuten.«
»Fragt, so viel Ihr wollt, es macht mir nichts aus. Ich hatte beinah zweiundzwanzig Jahre Zeit, mich daran zu gewöhnen, was ich bin.«
»Doch wenn Ihr ein Panzerreiter seid, wo ist dann Euer Ross?«, wollte Bruder Guido wissen.
Gaidemar schnitt eine kleine, schmerzliche Grimasse. Das war ein sehr wunder Punkt. »In einem Mietstall nicht weit von hier an der Straße nach Verona. Ich konnte es nicht mit herbringen, es hätte Aufsehen erregt und nicht zu meiner Verkleidung gepasst. Es ist auch nicht so einfach, ein Pferd in einem Kornfeld zu verstecken …« Aber er konnte es kaum erwarten, seinen treuen Amelung wieder auszulösen. Und dieses grässliche Mönchsgewand loszuwerden.
»Wie wunderschön der Nachthimmel ist«, sagte die Königin leise, den Kopf in den Nacken gelegt. »Ich habe mich manches Mal gefragt, ob ich den Himmel noch einmal wiedersehe.«
»Ja. Das kann ich mir vorstellen.« Gaidemar schnallte die zusammengerollte Wolldecke von seiner Tasche und streckte sie ihr entgegen. »Hier. Versucht, ein paar Stunden zu schlafen.«
Adelheid nahm die Decke mit größter Selbstverständlichkeit. Sie war eine Königin und sicher gewöhnt, dass andere sich bereitwillig ins stachelige Korn legten – Hauptsache, sie ruhte weich gebettet …
Bald kehrte Stille ein in der kleinen Mulde im Feld. Der Mönch und die beiden Frauen schliefen reglos und still – ein tiefer Erschöpfungsschlaf –, nur die kleine Emma warf sich hin und her und wimmerte einmal, vermutlich von bösen Träumen geplagt. Gaidemar saß mit angezogenen Knien bei ihnen und fragte sich, wie die vergangenen Monate wohl für diese Menschen gewesen sein mochten. Die Königin hatte einen ordentlichen Bluterguss am linken Jochbein, hatte er vorhin im Fackelschein gesehen. Und von Berengar und seinen Überredungskünsten einmal ganz abgesehen, wie hatten sie bei Wasser und Brot ausgeharrt, wo vermutlich keiner von ihnen vorher je Hunger gekannt hatte? Womit hatten sie die endlosen, öden Tage verbracht?
Er hatte keine Ahnung, aber er fand, es verdiente Respekt, dass sie den Mut nicht verloren, sondern die klitzekleine Chance ergriffen hatten, die sich ihnen bot, und sich mit bloßen Händen einen Weg in die Freiheit gegraben hatten. Das machte ihm ein wenig Hoffnung, denn es waren gute Voraussetzungen für den weiten und gefahrvollen Weg, der noch vor ihnen lag.
Ingelheim, August 951
Liudolf spürte, dass er den anderen davonzog, und er beugte den Oberkörper weiter vor. Nicht um weniger Windwiderstand zu bieten, sondern es war eher, als wolle er eins mit seinem Pferd werden. »Komm schon, Beli. Ich weiß, dass das hier noch nicht alles ist.«
Aber Beli war ein sturer Dickschädel – vielleicht verstanden sie sich deswegen so gut – und neigte dazu, seine Reserven aufzusparen, bis es zu spät war, statt sich von seinem Reiter anspornen zu lassen.
»Komm schon«, versuchte der Prinz es noch einmal, es war ein verschwörerisches und einschmeichelndes Flüstern. »Vertrau mir nur dieses eine Mal.«
Beli machte einen Satz, dass es Liudolf beinah die Arme aus den Schultern riss. Sein ganzer Leib schien sich zu strecken, und der Hufschlag wurde schneller.
»Na also!«, rief der Prinz lachend und spuckte die rauen Haare der fliegenden Mähne aus, die sich in seinen Mund verirrt hatten.
Sie kamen aus dem Schatten der Bäume auf die ansteigenden Wiesen, die die Pfalz umgaben, und die Hitze traf Ross und Reiter wie ein Schmiedehammer. Aber Beli ließ sich nicht beirren und galoppierte mit unveränderter Geschwindigkeit hügelan.
Zu seiner Linken glaubte Liudolf einen der Verfolger zu hören. Er riskierte einen blitzschnellen Blick über die Schulter, und tatsächlich: Sein Halbbruder holte auf.
Fluchend schaute der Prinz wieder nach vorn. »Jetzt, Beli«, drängte er. »Dies ist der Augenblick.«
Schaumflocken flogen von Belis Maul, aber er wurde nicht langsamer. Unaufhaltsam wie ein reißender Strom näherte er sich der einsamen Schlehe, die die Ziellinie markierte. Wilhelms Fuchs schob sich neben sie, Liudolf hörte ihn und sah seinen Kopf am Rand seines Blickfeldes, aber er wusste, der Sieg war ihm nicht mehr zu nehmen, und er stieß ein triumphales Lachen aus und reckte die linke Faust in die Luft, als die Schlehe vorbeiflog.
Sobald er aufhörte zu treiben, fiel Beli in Schritt und keuchte ausgepumpt.
Liudolf klopfte ihm selig den schweißnassen Hals. »Du bist einfach der Beste. Ich schwöre, ich hatte nie zuvor einen Gaul wie dich …«
»Oh, gewiss doch. Und vermutlich nimmst du ihn heute Nacht mit in dein Quartier und hüllst ihn in seidene Decken …«, brummte sein Bruder, der an seiner Seite ebenfalls in Schritt gefallen war.
»Nein, vielen Dank, ich kann mir bessere Gesellschaft am Abend vorstellen«, entgegnete Liudolf lachend. »Du warst gar nicht übel, Bruder. Für einen Pfaffen, meine ich.«
Wilhelm schenkte ihm ein Lächeln – scheinbar nachsichtig, in Wahrheit jedoch gefährlich – und würdigte ihn keiner Antwort.
»Nimm den Mund lieber nicht so voll«, warf ihr Schwager Konrad ein, der die Schlehe auf seinem etwas zu stämmigen Braunen als Letzter passiert hatte. »Wilhelm hätte dich geschlagen, wäre das Ziel hundert Schritte weiter gewesen.«
»Ja, und ich hätte grüne Haare, wäre meine Mutter eine Waldfee gewesen«, gab Liudolf unbeeindruckt zurück.
»Was man ihr nun wirklich nicht nachsagen kann«, bemerkte Wilhelm und lenkte seinen herrlichen Wallach mit den Knien Richtung Torhaus. »Kommt, es wird Zeit. Reiten wir zurück.«
Schweren Herzens wendete auch Liudolf sein Pferd. »Ja.« Er seufzte. »Wir sind schließlich nicht zum Vergnügen hier …«
»Sag das nicht«, widersprach Konrad und warf sich die lange, ewig unordentliche Blondmähne zurück über die massigen Schultern. »Der Wein, den sie in Ingelheim zum Essen einschenken, ist immer hervorragend.«
Konrad war ein Bär von einem Kerl und ein paar Jahre älter als Liudolf und sein Bruder. Mit seinen beinah dreißig Jahren hätte er eigentlich der Besonnene in ihrem ungleichen Kleeblatt sein müssen. Aber Konrad war ein Draufgänger und ein Raufbold, zu hitzköpfig, um vernünftig zu sein. Falls überhaupt einer von ihnen über diese weithin überschätzte Eigenschaft verfügte, dachte Liudolf oft, dann war es Wilhelm mit seiner wortkargen Art und seiner frommen Bücherbildung, die ihn freilich nicht daran hinderten, ein paar höchst weltliche Laster zu pflegen. In aller Diskretion, natürlich.
Liudolf sah von seinem Bruder auf seiner linken Seite zu seinem Schwager auf der rechten, atmete tief durch und dankte dem Himmel für diese beiden Freunde. Gerade in schweren Stunden brauchte ein Mann Freunde, und Liudolf ahnte, dass es schwere Stunden sein würden, die ihm bevorstanden.
Ingelheim zählte zu den komfortableren Pfalzen – den königlichen Burgen, die über das ganze Reich verstreut lagen und dem ewig umherziehenden Hof als Herbergen dienten. Zehn Meilen westlich von Mainz nahe dem Rheinufer gelegen, war sie vornehm und großzügig angelegt, weil Karl der Große sie erbaut hatte.
Die drei jungen Männer ritten durch das hölzerne Torhaus in der Südwand der Palisade und gelangten in den grasbewachsenen Innenhof, wo Knechte und Wachen herbeikamen, um ihnen die Pferde abzunehmen.
Liudolf, Wilhelm und Konrad wandten die Schritte zum Westrand der Anlage, wo die Aula Regia – die vornehme Steinhalle – sich über den niedrigen hölzernen Wirtschaftsgebäuden und Wohnquartieren erhob wie eine thronende Königin über ihren knienden Untertanen.
Zwei Wachen flankierten den Eingang und neigten die Köpfe, als sie die Ankömmlinge erkannten. »Der König hat alle rausgeworfen und wollte nicht gestört werden, Prinz, aber Euch sollen wir reinlassen«, erklärte der Linke.
»Danke, Wido.«
Mit mehr Entschlossenheit, als er empfand, trat Liudolf durch das mächtige, zweiflügelige Bronzetor, Wilhelm und Konrad einen halben Schritt hinter ihm.
Der riesige Hauptsaal der Halle lag verlassen, die langen Bänke und Tische waren leer. Nur hier und da zeugten ein paar Brotkrümel oder eine abgenagte Birne auf der Tischplatte davon, dass hier heute früh noch eine große Hofgesellschaft das Frühstück eingenommen hatte.
Die Halle mit den hübschen Rundbogenfenstern hatte beinah etwas Sakrales, und dort, wo in einer Kirche der Altar war, stand hier auf der Empore die hohe Tafel in einer Scheibe aus Sonnenlicht, das durch das östliche Fenster fiel. An der Mitte dieser Tafel saß eine einsame, unverkennbar königliche Gestalt: groß, breitschultrig, und das blonde Haar leuchtete wie gesponnenes Gold im Sonnenschein. Nur die Haltung wirkte untypisch gebeugt, und als Liudolf näher trat, erkannte er den Grund. Der König hatte ein Buch vor sich auf dem Tisch liegen.
»Vater«, grüßte der junge Mann mit einem Lächeln, aber verhaltener als sonst für ihn üblich. Liudolf liebte und bewunderte seinen Vater – man konnte praktisch gar nicht anders –, aber er verspürte auch immer ein leises Unbehagen in seiner Gegenwart. So als hätte er vorsorglich schon einmal ein schlechtes Gewissen, weil er neben dem untadeligen König immer wie ein hoffnungsloser Sünder dastand.
König Otto hob den Kopf und strahlte. »Ah, da seid ihr also wieder. Wilhelm, sei so gut, komm her und hilf deinem alten Herrn.«
Wilhelm umrundete die Tafel, schnürte unterwegs den dunklen Mantel auf und schlang ihn sich über den linken Arm, während er neben den König trat. »Wobei?«
Otto wies auf die rechte Spalte der rechten Seite des dicken Buches. »Dieses Wort hier. Ich weiß, ich kenne es, aber es entzieht sich mir wie ein Fisch, den man mit bloßen Händen zu fangen versucht.«
Wilhelms Blick folgte dem langen, schwieligen Finger auf der elfenbeinfarbenen Pergamentseite. »Ministratores«, las er mühelos.
»Ein recht langes Wort«, murmelte der König zu seiner Verteidigung.
Wilhelm nickte, entgegnete jedoch: »Dann seid nur froh, dass nicht Peradulescentulus dort steht.«
Der König ließ sich gegen die Sessellehne sinken und seufzte. »Ich beneide dich um deine Finesse.«
»Beneidet mich nicht, mein König«, gab Wilhelm mit einem sparsamen Lächeln zurück. »Sie wurde mit ziemlich vielen Rutenschlägen erkauft, und meine halbe Kindheit war ich wütend, weil ich Bücher studieren musste, während Liudolf Fechten lernte.«
»Ich erinnere mich gut daran«, sagte der König. »Bis schließlich mein kluger Bruder Brun deine weitere Erziehung übernahm und verkündete, auch ein zukünftiger Bischof müsse ein Schwert führen können. Heute scheint mir, es wäre gescheiter gewesen, meine beiden Söhne in der einen wie der anderen Kunst unterweisen zu lassen, denn auch ein Prinz sollte des Lesens mächtig sein.«
»Zum Glück ist es dafür nun zu spät«, bemerkte Liudolf mit Inbrunst, nahm den goldenen Weinkrug, der am Tischende stand, und schenkte ein paar Becher voll.
»Sag das nicht«, widersprach der König boshaft. »Man ist nie zu alt, um lesen zu lernen. Schau mich an.«
Der König hatte es Liudolfs Mutter auf dem Sterbebett versprochen: Er werde das Lesen erlernen und das Wort Gottes und die gelehrten Schriften studieren, wie sie es sich wünschte. Liudolf fand immer, es war ein sonderbarer, unsinniger letzter Wunsch. Und er war ein wenig gekränkt gewesen, dass die Königin ihrem Gemahl nicht aufgetragen hatte, nachsichtig und gütig für ihre Kinder zu sorgen, wie andere Mütter es doch ganz gewiss getan hätten. Liudolf war zwar schon sechzehn gewesen, als sie starb, aber trotzdem hätte er ihre posthume mütterliche Fürsprache gut gebrauchen können. Genau genommen brauchte er sie heute – fünf Jahre später – noch genauso dringend …
Er stellte einen der Pokale neben das kostbare Manuskript. »Aber Ihr seid der König, Vater. Normalsterbliche wie wir können nur verzweifeln, wenn wir Euch nacheifern wollen.«
Otto ignorierte den Becher und blätterte die nächste Seite um. Den Blick auf die bräunlichen Buchstaben gerichtet, erwiderte er milde: »Und doch wäre es für meinen Erben vielleicht ratsam, es wenigstens dann und wann zu versuchen, denkst du nicht?«
Das Poltern der Eingangstür ersparte Liudolf, antworten zu müssen. »Ah, hier kommen die Damen …«, mutmaßte er freudestrahlend, doch als er den Kopf wandte, sickerte das Lächeln aus seinen Mundwinkeln. Weder seine Schwester noch seine Gemahlin hatten die Halle betreten, sondern sein Onkel.
König Otto klappte sein Buch zu und schob es ein Stück beiseite. »Henning. Gut. Somit wären alle Herzöge des Reiches versammelt. Setzt euch. Wir müssen beraten. Nein, Wilhelm, leiste uns Gesellschaft«, sagte er zu Liudolfs Halbbruder, der sich schon abwenden wollte.
Kommentarlos setzte Wilhelm sich dem König gegenüber auf eine unkomfortable, kleine Holzbank. Er war nur ein Bastard und konnte deswegen keinen Adelstitel bekleiden, aber allen war klar, dass der König ihn für ein hohes Kirchenamt vorgesehen hatte. Damit würde Wilhelm eines Tages so mächtig sein wie jeder Herzog – wenn nicht mächtiger. Und um ihn mit der Reichspolitik vertraut zu machen, bat der König seinen unehelichen Erstgeborenen immer häufiger zu den Ratssitzungen.
Liudolf glitt auf den Platz zur Rechten des Königs, ehe sein Onkel sich dort breitmachen konnte. Konrad setzte sich zu Wilhelm auf die Bank, während Onkel Henning den bequemen Sessel auf der anderen Seite des Königs einnahm.
»Also?«, begann Otto und sah in die Runde. »Was hören wir aus der Lombardei?«
»Nichts Gutes«, antwortete Henning düster. »Berengar von Ivrea hat über den Sommer viel Rückhalt gewonnen.«
»Aber er hat den jungen König ermorden lassen«, warf Konrad angewidert ein. »Wie können die italienischen Grafen ihm nur folgen?«
»Sie folgen dem, der Stärke und Machtwillen beweist, das ist überall auf der Welt gleich«, belehrte Henning ihn unwirsch. »Und es war unserer Sache dort nicht gerade förderlich, dass Liudolf über die Alpen gezogen ist und versucht hat, die lombardische Krone für sich selbst zu ergattern …«
»Wie oft muss ich mir das noch anhören?«, knurrte Liudolf. »Ich wollte der armen Adelheid aus der Klemme helfen, nichts weiter. Sie ist schließlich eine Cousine meiner Frau, sollte dir das entfallen sein, Onkel. Aber du musstest ja die allgemeine Verwirrung ausnutzen, um selbst über die Alpen zu ziehen und dir das Friaul unter den Nagel zu reißen. Ich bin nicht sicher, wie dienlich das unserer Sache war.«
»Das Friaul gehört traditionell zu Bayern, dessen Herzog ich zufällig bin«, gab Henning zurück. Gelangweilt, selbstgefällig – ganz und gar unerträglich, wie üblich.
»Und du hast recht daran getan, es zu nehmen«, sagte der König beschwichtigend zu seinem Bruder.
Liudolf stieß hörbar die Luft aus. Das war ja klar, lag ihm auf der Zunge, aber er würgte es mühsam hinunter. Verstohlen und aus dem Augenwinkel betrachtete er den Bruder seines Vaters, der mit der unversehrten linken Hand Rosinen und Nüsse aus der Tonschale auf dem Tisch klaubte und sie sich mit seinen legendär miserablen Tischmanieren allesamt gleichzeitig in den Mund stopfte. Die verkrüppelte Rechte lag auf der Tischplatte und steckte wie üblich in einem Handschuh aus feinstem Rehleder, dessen elegant bestickte Stulpe den halben Unterarm umschloss. Er gab Henning immer einen verwegenen Anstrich, dieser Handschuh. Obendrein sah der Herzog von Bayern auch noch unverschämt gut aus. Um die dreißig, das Haupt- und Barthaar voll und blond, die Augen hell wie die Flügel eines Bläulings, genau wie die Augen des Königs, nur stechender. Lange hatte Henning gegen den König rebelliert und nach seiner Krone getrachtet. Vor zehn Jahren hatte er sogar ein Mordkomplott gegen ihn geschmiedet. Doch zu Liudolfs größtem Bedauern hatte er dafür nicht den Kopf verloren, sondern war genau hier in Ingelheim in Festungshaft gelandet. Und danach hatte sich irgendetwas geändert. Liudolf hatte nie so recht begriffen, was genau oder warum. Jedenfalls hatte Henning dem König die letzten zehn Jahre treu gedient, ihm die Wünsche praktisch von den Augen abgelesen und sich möglicherweise sogar sein Vertrauen erworben. Dabei träumte Onkel Henning in Wahrheit immer noch von der Königswürde, und auch deswegen verabscheute er Liudolf, den Kronprinzen. Er war gerissen und völlig frei von Skrupeln. Man war gut beraten, ihm niemals den Rücken zuzudrehen.
»Das Friaul ist ein wertvolles Bollwerk gegen die Ungarn, und wir sollten diejenigen sein, die es kontrollieren«, erklärte der König seinem Sohn mit der typischen Geduld, sah dann zu seinem Bruder und fügte hinzu: »Und ich wäre dankbar, wenn wir auf haltlose gegenseitige Anschuldigungen verzichten könnten.«
»Und doch wird die Frage wohl erlaubt sein, was Liudolf getrieben hat, ohne Eure Erlaubnis Truppen in die Lombardei zu führen.«
Konrad schnalzte mit der Zunge. »Es war kaum mehr als eine Leibwache und …«
»Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt«, unterbrach der König scharf, und mit einem Mal wirkte er erhaben und unnahbar wie eine Marmorstatue. Liudolf staunte immer wieder darüber, wie sein Vater sein von Gott verliehenes Königtum offenbaren konnte, wenn es seinen Absichten diente, plötzlich und unübersehbar wie das Aufflammen einer Fackel. Und es ließ niemanden je unbeeindruckt.
Onkel Henning hob augenblicklich die behandschuhte Rechte zu einer Geste des Einlenkens.
Otto richtete den geruhsamen Blick auf Liudolf, betrachtete ihn einen Moment schweigend und sagte dann bedächtig: »Es war überflüssig und ungehörig, ohne meine Erlaubnis nach Italien zu ziehen, und es hat unserer Sache geschadet.«
Liudolf biss die Zähne zusammen, gab sich dann einen Ruck und sagte mit gesenktem Kopf: »Es tut mir leid, mein König. Vergebt mir.«
»Von Herzen. Aber tu es nie wieder, mein Sohn.«
Die unausgesprochene Drohung kränkte Liudolf. Er hatte sich entschuldigt, was ihm nie leichtfiel, und er fand es ungerecht, dass sein Vater ihn trotzdem weiter demütigte. Und das Unerträglichste war Hennings Gesicht. Die gekräuselte Lippe und das amüsierte Funkeln in den Augen verrieten, wie sehr er sich an Liudolfs Unbehagen weidete.
»Bei allem Respekt, mein König«, meldete Konrad sich zu Wort. »Aber Liudolf ist der Herzog von Schwaben und hat lediglich schwäbische Interessen gewahrt. Ich habe Mühe zu erkennen, wo sein Fehltritt liegen soll.«
»Dann will ich es dir erklären«, erwiderte Otto, die Stirn ein wenig gefurcht. »Die Sicherung der Lombardei ist eine Reichsangelegenheit, das weiß man jenseits der Alpen genauso gut wie hier. Und wenn meine Herzöge in meinen Angelegenheiten vorpreschen wie übereifrige Jagdhunde, statt meine Anordnungen zu befolgen, schadet das unser aller Ansehen.« Er sprach ruhig, aber eine unüberhörbare Schärfe lag in seinem Tonfall. »Und nun wüsste ich gerne, wie es mit dieser Reichsangelegenheit steht.«
Zu Liudolfs Verwunderung war es sein Bruder, der das Wort ergriff. »Ich habe einen Mann nach Garda geschickt, der Adelheid aus Berengars Klauen befreien soll.«
»Gut. Erst wenn das geschehen ist, können wir handeln. Vorher riskieren wir mit jedem Schritt, dass auch sie unter rätselhaften Umständen das Leben verliert wie ihr Gemahl.«
»Du hast einen Mann geschickt?«, fragte Henning ungläubig. »Er muss ein Recke wie Roland sein, dass er die unglückselige Adelheid ganz allein aus der Festung von Garda befreien soll …«
Wilhelm deutete ein Schulterzucken an. Ganz anders als Liudolf konnte er Hennings Herablassung immer von sich abperlen lassen. »Ich habe ihm angeboten, so viele Männer mitzunehmen, wie er für richtig hielt, doch er sagte, bei einem so heiklen Auftrag sei mehr als einer immer zu viel.«
»Wer ist er?«, fragte der König neugierig.
»Ein Panzerreiter aus Thüringen. Sein Name ist Gaidemar, und er ist …«
»Ich erinnere mich an Gaidemar«, warf Otto ein, und man hörte, dass er sich mit Wohlwollen erinnerte. »Er war noch ein Grünschnabel, als wir gegen meinen Schwager nach Westfranken gezogen sind, aber er hat Hugos Männer das Fürchten gelehrt, vor allem mit der Wurflanze.«
»Das ist der Mann«, bestätigte Wilhelm, und er sah den König ganz sonderbar an, so als wolle er mit seinem Blick ein Loch in dessen Schädel bohren, um zu sehen, was Otto dachte. Liudolf wurde überhaupt nicht klug aus den stummen Botschaften, die sein Vater und sein Bruder tauschten. Aber dann wandte Wilhelm seine Aufmerksamkeit der Schale auf dem Tisch zu, wählte mit Sorgfalt eine Rosine aus und rollte sie zwischen Daumen und Mittelfinger der Rechten hin und her, statt sie zu essen. »Ich habe seinen Weg seit Eurem Westfrankenzug dann und wann verfolgt, Vater, und ich glaube, wenn irgendwer diese Tat vollbringen kann, dann er.«
Henning ließ nicht locker. »Und wenn du dich täuschst? Was wird aus der schönen Adelheid, wenn dein famoser Panzerreiter erwischt und aufgeknüpft wird?«
»Dann haben wir nichts verloren bis auf einen guten Mann«, entgegnete Otto.
»Ja, aber Berengar wird aus ihm herausholen, wer ihn geschickt hat, eh er ihn aufhängt, und dann steht Ihr da wie ein …« Er überlegte es sich im letzten Moment anders und ließ das Wort unausgesprochen.
Der König stützte einen Moment das Kinn auf die Faust und dachte nach. Die anderen Männer in der Halle wussten es besser, als das Wort zu ergreifen, und warteten schweigend.
Schließlich regte sich Otto und sagte: »Ich ziehe nach Rom.«
Der Ankündigung folgte verdattertes Schweigen. Liudolf tauschte einen Blick mit Konrad und formte mit den Lippen tonlos: »Rom?«
Sein Schwager zog ratlos Augenbrauen und Schultern hoch.
»Das wird den Heiligen Vater über die Maßen entzücken, mein König«, prophezeite Wilhelm spöttisch.
»Ja, ganz sicher«, stimmte Henning mit einem Lächeln zu, das ebenso mutwillig wie boshaft war. »Aber was genau wollt Ihr in Rom, mein König?«
»Das werde ich wissen, wenn ich dort bin«, antwortete Otto geheimnisvoll. »Aber wenn ich schon einmal jenseits der Alpen bin – mit meinem Gefolge von … hm, sagen wir, zweitausend Mann –, werde ich nach der jungen Königin Adelheid sehen und mich von ihrem Wohlergehen überzeugen.«
»Wozu?«, fragte Liudolf verständnislos. »Und wenn Ihr auf einmal so um ihr Wohlergehen besorgt seid, weshalb rügt Ihr mich dann dafür, dass ich ihr zu Hilfe kommen wollte?«
Der König musterte ihn einen Moment forschend, ehe er sagte: »Ich möchte einen Blick auf sie werfen, mein Sohn. Was ich natürlich eigentlich will, ist Adelheids Krone. Vielleicht finde ich ja einen etwas … eleganteren Weg, sie zu bekommen, als Berengar.«
Wilhelm und Konrad tauschten einen verwunderten Blick. Henning runzelte die Stirn und beäugte den König unsicher, so als ginge er im Kopf alle möglichen Deutungen dieser sonderbaren Ankündigung durch und finde eine absurder als die andere. Ausnahmsweise konnte Liudolf dieses eine Mal mit seinem Onkel fühlen, denn ihm erging es genauso. Und ihn beschlich ein ganz fürchterlicher Verdacht.
Lombardei, August 951
»Wir müssen schneller werden«, drängte Gaidemar.
»Das sagt Ihr andauernd«, beschwerte sich Bruder Guido.
»Und ich werde es so lange sagen, bis es etwas nützt«, stellte der junge Panzerreiter in Aussicht. Er sah zu Adelheid hinauf, die mit ihrer Tochter im Sattel saß. »Wir müssen vor Einbruch der Dunkelheit noch ein paar Meilen schaffen, sonst werden wir unsere Verfolger niemals los.«
»Aber wir haben seit zwei Tagen keinerlei Anzeichen von Verfolgung gesehen«, wandte der Mönch ein.
»Ihr vielleicht nicht«, konterte Gaidemar ominös.
»Ich habe nichts dagegen, heute noch ein gutes Stück weiterzukommen«, ging Adelheid dazwischen. »Und ich bin gern bereit zu laufen. Warum reitet Ihr nicht, bis wir rasten, Bruder? Ihr könnt Emma eine Geschichte erzählen.« Sie wusste, dass Bruder Guido von schmerzenden Knien geplagt wurde.
Doch er lehnte entrüstet ab. »Kommt nicht infrage.«
»Wieso denn nicht? Ich bin ausgeruht, seid versichert.«
»Weil es sich nicht gehört«, erklärte der Mönch verdrossen.
Gaidemar streifte ihn mit einem Blick – halb nachsichtig, halb spöttisch. So als wolle er sagen: Gib doch zu, dass du dich vor Pferden fürchtest. Doch er sprach es nicht aus.
Er führte seinen temperamentvollen Rappen mit der Rechten und strich ihm mit der Linken abwesend über die Nüstern, während er zurückblickte. Sein dunkles, gewelltes Haar, das bis auf die breiten Schultern fiel, schimmerte matt im Sonnenschein, aber die mörderische Hitze schien dem jungen Panzerreiter nichts anhaben zu können.
Adelheid wandte sich im Sattel ebenfalls um. Der staubige Pfad, der sich zwischen einem Weinfeld und einem Mandelhain durch die Hügel schlängelte, lag verlassen und still. Der Himmel war so blau wie Lapislazuli, Grillen sangen im hohen Gras, und die Luft roch nach heißem Staub. Kein Windhauch regte sich.
Es war der dritte Tag ihrer Flucht. Sie hatten sich stetig nach Süden bewegt, und allmählich verschwanden die Berge hinter ihnen im Dunst. Diese Gegend war dünn besiedelt, und Gaidemar mied die belebte Handelsstraße, die Verona mit Bologna verband. Seit gestern Mittag waren sie keiner Menschenseele mehr begegnet.
Trotzdem war Gaidemar wachsam und angespannt. »Gibt es eine Stadt zwischen diesen Hügeln und dem Bischofssitz von Reggio Emilia?«, fragte er.
»Mantua«, antwortete Adelheid. »Es kann nicht mehr weit sein.«
Das schien ihm nicht zu gefallen. »Seid Ihr sicher?«
Sie runzelte die Stirn. »Ich lebe seit meinem sechsten Lebensjahr in diesem Land und bin seine Königin. Glaubt mir, ich bin sicher.«
Er nickte, abwesend und ohne sich zu entschuldigen. Adelheid wurde nicht so recht klug aus Gaidemar. Dabei war sie eine gute Menschenkennerin. Einer burgundischen Prinzessin und Königin von Italien blieb nichts anderes übrig, denn die Leute meinten selten das, was sie zu ihr sagten. Also musste sie sie studieren und durchschauen, um ihre wahren Absichten zu erkennen. Das hatte Adelheid sich selbst gelehrt – wie so viele andere Dinge –, doch bei Gaidemar versagte diese Fähigkeit. Er war höflich und korrekt und hatte sie sicher bis hierher gebracht. Doch er wurde vage, manchmal gar abweisend, sobald sie ein persönliches Wort an ihn richtete.
Als sie sich in dem Feld am Ufer des Gardasees verborgen hatten und die Verfolger kommen hörten, war er davongeschlichen, hatte die Suchmannschaft von ihrem Versteck fortgelockt und war so lange ausgeblieben, dass Anna und Bruder Guido schon argwöhnisch wurden. Schließlich war er wieder in ihrer Mulde im Gerstenfeld erschienen, seine unscheinbare Klinge und sein Mönchsgewand blutbesudelt. Aber etwas an seiner Miene hatte sie alle davon abgehalten, ihn zu fragen, was geschehen war.
Bei Morgengrauen waren sie aufgebrochen und unbehelligt auf die Straße gelangt, wo Gaidemar in einem Gasthaus an einer Wegkreuzung sein Pferd und seine Ausrüstung deponiert hatte. Er löste sie aus, kaufte bei der fetten Wirtin Proviant und drängte zum baldigen Aufbruch.