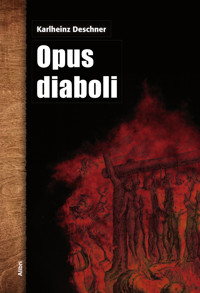14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alibri Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seine Romane schrieb Deschner 1956 und 1958, als er Anfang dreißig war. Beide sind deutlich autobiographisch geprägt. Vor allem sein literarisches Debüt Die Nacht steht um mein Haus wurde von der Kritik begeistert aufgenommen. Wolfgang Koeppen zeigte sich "außerordentlich beeindruckt", Walter Muschg nannte das Buch "eine vehemente Sache", Peter Rühmkorf sprach von einem "Buch aus Mut und Musikalität". Auch heute noch wird diese "radikale Autobiographie" (Michael Schmidt-Salomon) gewürdigt als "das Werk eines Genies ohne Welt" (Süddeutsche Zeitung). Beide Bücher gelten nach wie vor als "Juwelen der unmittelbaren Nachkriegsliteratur" (Nürnberger Nachrichten), worin sowohl der Literatur- als auch der Kirchenkritiker Karlheinz Deschner bereits deutlich vernehmbar ist. Wer seine Sachbücher schätzt, wird im literarischen Frühwerk ein erhellendes Pendant entdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Karlheinz Deschner
Die frühen autobiographischen Romane
Die Nacht steht um mein Haus
Florenz ohne Sonne
Alibri Verlag
Aschaffenburg
2024
Inhalt
Die Nacht steht um mein Haus
Florenz ohne Sonne
Karl Corino„Die Durchschlagskraft eines Geschosses ...“. Zum Prosa-Werk Karlheinz Deschners
Über den Autor
Veröffentlichungen Karlheinz Deschners
Edition der Werke Karlheinz Deschners im Alibri Verlag
Dem Andenken meiner Mutter
gest.20. August 1955
Die Nacht steht um mein Haus
Ich stand hinter dem Pult und sprach, und immer wieder fing sich mein Blick an ihm. So oft ich zu ihm sah, traf ich mitten in seine Augen. Dabei war sein Gesicht weiß und stumm wie ein Grabstein. Als ich fertig war und hinausging, folgte er mir fast auf dem Fuß. Er hatte nicht applaudiert. Ich hatte es noch gesehen. Dann kam er in den Nebenraum. Er grüßte mich nicht, er sah mich nur still an, bleich, hochmütig. Ich habe ihm sogar in den Mantel geholfen, ich weiß nicht warum. Er hat mir nicht geholfen. Der Mantel war dunkelblau, er war sehr sauber, vornehm. Als die anderen kamen, wurden wir bekannt gemacht, und dann fuhren wir ins Hotel; ein Studienrat, ein Richter, der Psychiater und ich.
Zuerst sprach er nichts; eine ganze Weile sprach er nichts, er saß bloß da, dann sagte er plötzlich, ja, meine Herren, wir sitzen hier gemütlich zusammen, wir unterhalten uns, wir sprechen über Ihren Vortrag, wir sprechen über Literatur, über Kunst, die da drüben karten ihren Skat, wir verbringen hier alle einen Abend, wir gehen wieder heim, Sie gehen wieder in Ihre Schule, Sie gehen wieder ins Gericht, Sie halten wieder Ihre Vorträge, ich behandle wieder meine Patientlein, und die drüben marschieren auch wieder ab, der eine – und nun erzählte er, was die Skatbrüder machen würden, er war ein richtiges Breimaul, und plötzlich sagte er: UND FORMOSA??! Er sah uns der Reihe nach an. Er hatte seinen Trumpf ausgespielt. Warum tun wir nichts, sagte er, warum unternehmen wir nichts, es geht um unseren Kopf, es kann morgen losgehn. Das war ja alles ganz vernünftig, aber was wollte er tun? Und nun entwickelte er seine saudumme Theorie mit dem Briefeschreiben. Ein paar hunderttausend, ein paar Millionen, ein paar hundert Millionen Briefe an Eisenhower, an Malenkow – und von da an wurde er blöde. Ich hielt ihn für einen Naiven, für einen Phantasten, einen Sektierer, er nannte oft Christus, er sprach vom Glauben, der Studienrat war einverstanden, der Richter opponierte, aber mit Takt, ich wurde ironisch, ich stänkerte, ich machte mich wahrscheinlich nicht beliebt bei ihm. Dann sagte er, er meine natürlich nicht das Christentum einer Kirche, er spreche nicht von den Bischöfen, er denke nicht an diese beamteten Statisten und Gehaltsempfänger, nein, er meine Christus, er meine die Nächstenliebe und die zehn Gebote, kurz, er gab sich sehr ethisch, sehr reif, sehr weise, der Studienrat freute sich, der Richter schwieg, und als die beiden gegangen waren, nannte er sie Hohlköpfe. Er sagte, das sind ja auch Hohlköpfe, kleine Nichtsdenker. Er sprach sehr von oben herab.
Und dann erzählte er, daß er auch schreibe. Er schreibe so ähnlich wie Henry Miller. Deshalb sei er auch in den Vortrag gegangen. Er habe zwei Bücher von Miller gelesen, und Miller interessiere ihn. Er lese sonst wenig, er kenne keine moderne Literatur, er schreibe nur für sich, stark autobiographisch, stark egozentrisch, seine Praxis gebe ihm Stoff in Hülle und Fülle. Aber er habe nicht den Wunsch, es zu veröffentlichen. Wie macht man das? frug er. Schickt man das so mit der Hand geschrieben an den Verlag? Er spielte den Naiven. Ich horchte ihn natürlich aus. Wie er arbeite, frug ich, ob er leicht schreibe. Das Material sammle sich in ihm, sagte er, er trage es mit sich herum. Ich gehe dann schwanger, sagte er, und dabei machte er eine wölbende Bewegung mit seinen weichen weißen Händen vor seinem Bauch. Es war lächerlich. Er wurde mystisch. Und dann fließt es, es fließt so aus mir heraus, sagte er, und schüttelte leicht die Hand, daß ich unwillkürlich auf seine Ärmelöffnung sah. Natürlich habe ich auch Flauten, fuhr er fort. Und ich lebe mich auch manchmal aus. Er schnaufte, er deutete die Miller-Natur an, er sprach von kolossalen Launen und Gereiztheiten, er sprach von Drei-Tage-Durchvögeln, kurz, er redete einen Haufen Quatsch, Dinge, die ich alle nicht für Ernst nahm, nur sobald er auf mich zu sprechen kam, sobald er psychologisch, psychoanalytisch wurde, traf er mich. Vielleicht rächte er sich, weil er in mir etwas spürte, noch lebendig spürte, das er schon begraben hatte. Denn er war doch eine Niete, einer, der versagt hatte. Er neidete mir meine Ambitionen. Er zerstörte. Es machte ihm Spaß, zu zerstören. Vielleicht hatte er recht. Wahrscheinlich hatte er recht. Aber ein Schwein war er doch, ein gemeiner Sadist.
Ich habe drei Stunden mir ihm gesprochen, und dann sagte er mir, Sie werden nichts, Sie bringen es zu nichts. Ja, hat Ihnen das noch niemand gesagt?! Sie kommen doch mit so vielen Leuten zusammen. Ich darf Ihnen das doch sagen? Nicht daß Sie dann etwas Dummes tun. Oh, Sie können es mir sagen. Ich bin allerhand gewohnt. Ich lächelte. Ich machte ihm Mut. Nein, Sie werden nichts. Fragmente. Genialische Fragmente vielleicht. Ich sage genialisch. GENIALISCH. Dann sagte er, Sie wissen doch, daß Sie ein Selbstmordkandidat sind?! Und dann wollte er meine Schrift sehen. Paßt ganz zu dem Bild, sagte er. Fürchterlich. Aber in sich ist sie doch einheitlich, sagte ich. Ja, sagte er, einheitlich fürchterlich. Und dann sagte er, Sie müssen sich lieben, Sie müssen sich LIEBEN. Sie müssen mit sich einverstanden sein. Sie müssen auch Ihre Schwächen in Kauf nehmen, auch den Dreck. Auch wenn die Windeln vollgeschissen sind. Er sagte, auch wenn das Kindlein die Windeln vollscheißt. Zweimal sagte er das. Was meinte er damit? Und immer wieder sagte er, Sie müssen sich lieben. Und dabei streichelte er meinen Arm, daß ich ihn für einen Schwulen hielt. Aber ich glaube, er war nur ein Sadist, ein ganz gemeiner hinterfotziger nichtskönnerischer Sadist. Alle Ärzte sind Sadisten, sagte Rolf. Ich habe mit ihm darüber geplaudert. Ich wollte es nicht glauben. Aber dieses Schwein war bestimmt ein Sadist. Er hat mich schockiert. Unter der Maske der Brüderlichkeit hat er mir einen Schlag versetzt, einen Schock. Zuerst hat er mich amüsiert, dann hat er mich schockiert, dann hat er mich wieder amüsiert, und jetzt glaube ich, das Schwein hat recht gehabt.
Ja, ich glaube es jetzt. Ich habe geschrieben. Ich habe zwei Seiten in einem Monat geschrieben. Und ich habe geschrieben wie ein Irrer. Ich habe mich am Morgen an die Maschine gesetzt, und ich bin in der Nacht weggegangen. Ich habe gefeilt und gefeilt und gefeilt, und es ist nichts herausgekommen. Zwei Seiten, und sie taugen nichts. Nein, sie taugen nichts. Ich will mir nichts einreden. Ich habe mir lange genug Zeug eingeredet. Seit fast zwanzig Jahren rede ich mir ein, ich könnte schreiben. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, wer mir diesen Vogel in den Kopf gesetzt hat, aber er sitzt noch immer dort, noch jetzt.
Ich habe mich vorhin im Spiegel betrachtet. Ich habe mich noch nie so im Spiegel betrachtet. Ich habe in mein Gesicht gesehn. Ich war so voll Haß, voll Wut, voll Scham, voll Enttäuschung, Enttäuschung, ENTTÄUSCHUNG. Ich hätte mich anspucken können, ich hätte weinen können, ich hätte in den Spiegel schlagen können, mitten hinein die Faust in die Visage, die ich hasse, die ich liebe, die ich hasse. Ja, ich hasse sie. ICH HASSE SIE. Aber ich kann es mir nicht leisten. Der Spiegel kostet Geld, und meine Nerven kosten Geld. Und ich habe kein Geld. Ich habe keinen Beruf. Ich habe keinen Namen. Aber ich habe eine Familie. Ich habe eine Frau. Ich habe eine Tochter. Und ich habe in mein Gesicht gesehn. In das Gesicht einer Niete, eines Versagers, eines Idioten. Ich war ein Hampelmann vor mir selbst. Seit zwanzig Jahren habe ich mir etwas vorgespielt, habe ich andern etwas vorgespielt, habe ich mich berufen geglaubt, auserwählt geglaubt. Und ich habe in mein Gesicht gesehn. Es war nicht rasiert, es war blaß. Falten waren um den Mund, blaue Schatten unter den Augen. Die Augen waren wäßrig. Die Tränen standen hinter der Stirn. Die Augen glänzten. Ich war verzweifelt. VERZWEIFELT. Mein ganzes Leben stand hinter meinem Gesicht, hinter dem Schädel, der schon kahl wird. Ich habe geglaubt, ein Dichter zu sein. Ich habe geglaubt, schreiben zu können. Ich wollte den Ruhm zwingen. Aber ich bin ein Hysteriker, ich bin ein Scharlatan. Ich habe die Leute angeschmiert, ich habe mich selbst angeschmiert. Ich habe nicht gelogen, und ich war doch ein erbärmlicher Lügner. Ja, ich habe Aufzeichnungen gemacht, Skizzen gemacht, Pläne gemacht, eine ganze Mappe voll. Aber es sind bloß Fragmente, Fetzen, Stimmungsfetzen, Gesprächsfetzen, lauter Fetzen. Sie sind gar nicht schlecht, aber es sind bloß Fetzen.
Dieser Psychiater, dieser Idiot, was ist das eigentlich für ein Mensch gewesen. Ich dachte an ihn, als ich vorhin in den Spiegel sah, und ich habe oft an ihn gedacht in den letzten Wochen. Ich glaube, meine Frau haßt ihn. Ich habe ihr von ihm erzählt. Er wirkt wie ein Hypnotiseur aus dem Hintergrund auf mich. Ich glaube, er hat auch noch einen Brief meiner Frau. Ich vermisse ihn seitdem. Ich habe ihm den Brief gezeigt, weil er ihre Schrift beurteilen sollte. Ich war gespannt. Ich sah ihm ins Gesicht. Er las, er las die ganze Seite, er sagte, der Text sei natürlich nicht wichtig, aber er las die ganze Seite, und dann wendete er und las weiter, schamlos, bis zum Schluß. Es war ein Verzweiflungsbrief meiner Frau. Er hat mich damals erschüttert, und das Schwein sagte: naiv, manches ist gar nicht dumm. Und er hatte vielleicht recht, obwohl der Brief erschütternd war, und meine Frau ein Prachtkerl ist, jawohl, ein Prachtkerl, ich sage das, obwohl meine Frau sich sehr wundern würde, wenn sie es hörte, denn ich quäle sie oft, und dabei könnte ich mich ankotzen, ich hänge mir selbst zum Halse heraus.
Und dann fällt mir natürlich ein, wie ich mich um sie gerissen habe damals, wie ich einen Narren aus mir gemacht habe, einen leibhaftigen Narren, einen Hysteriker, einen in Liebe gewickelten Hysteriker, das Blaue vom Himmel habe ich ihr versprochen, ich habe ihr Briefe geschrieben, die unwiderstehlich waren, wenn auch ihre Eltern meinten, und ihre Schwiegereltern meinten, und ihre Eltern meinten es vielleicht nur, weil es ihre Schwiegereltern meinten, ich habe sie bloß sexuell beherrscht. Und vielleicht habe ich sie auch sexuell beherrscht. Welche Frau wird nicht schamlos, wenn sie mit einem schamlosen Schwein zusammenlebt. Oh, es gibt tolle Dinge, es gibt tolle Dinge. Es gibt sie, auch wenn sie nicht in den Büchern stehen. Man sieht Frauenhände und denkt daran, man sieht Frauenbewegungen und denkt daran, man glaubt, das Leben entschwindet einem, ohne daß man es gesehen, gekostet, erfahren hat.
Ach was, ich habe genug gesehen, es reicht mir, was ich gesehen habe, aber ich wollte es festhalten, und es gelang mir nicht. Ich habe es versucht, ansatzweise, ich habe Jahre gewartet, ich habe es wieder versucht, ich habe noch einmal gewartet, und es ist wieder mißlungen. Zwei Seiten in einem Monat, und sie taugen nichts, sie sind konstruiert, gesucht, gescheit, sie schmecken nach Joyce, nach Dos Passos, nach Wolfgang Koeppen, es ist nicht dumm, aber es ist kein Leben, es ist nicht echt, ich müßte von mir schreiben, wenn es etwas werden sollte, ich spüre es ganz genau, nur von mir, von meinem verfluchten Ich, um das es mir ganz allein gegangen ist, seit ich lebe. Ich habe immer nur in mich hineingeguckt, und ich müßte es jetzt herausholen, aber vielleicht ist nichts drin, oder ich schäme mich, ich schäme mich zu zeigen, wie ich bin, schaut her, das bin ich, Reiher, das Schwein, das Erzschwein, der Hurenbock, der Mörder, der Ehebrecher, die Niete, die nach Unsterblichkeit trachtet, die Null, die sich ein Denkmal bauen möchte.
Er möchte sich halt ein Denkmal bauen, hat dieser Kerl zu meiner Frau gesagt. Ich habe daran gedacht, als ich in den Spiegel sah, als ich mein Gesicht sah, dieses lächerliche weibische Gesicht, das dem Weinen nahe war, dem Weinen nahe aus Scham über seine Unfähigkeit, aus Scham über die Hoffnungen, die es sich und anderen vorgegaukelt hat, ich habe daran gedacht, wie es dieser Kerl, dieser Schwinn, zu meiner Frau sagte. Er wird es ihr gesagt haben, als er ein Buch in der Hand hielt, den Krull vielleicht, er hat ihr aus dem Krull vorgelesen, und ich kann mir denken, wie er das gemacht hat, wie ein Schauspieler, mit Grimassen, mit Öl in der Stimme, und das Französisch, sagt meine Frau, sei ihm auf den Lippen zerflossen, und dabei kann er gar kein Französisch. Und er wird Professor, er habilitiert sich, er hat alles das geschafft, was ich nicht geschafft habe. Vielleicht bin ich neidisch. Ja, ich bin neidisch, aber nicht auf ihn, nur auf seine Möglichkeiten. In seiner Haut möchte ich sie nicht haben, weißgott nicht. Und vielleicht möchte ich sie überhaupt nicht haben, ich weiß nicht. Und jedenfalls ist er irgendwie auch neidisch auf mich, ich habe es mir lange eingebildet, ich habe gedacht, er ist neidisch auf meine Möglichkeiten, meine Möglichkeiten als Schriftsteller, ich habe gedacht, er sieht es mir an, daß etwas in mir steckt, was er nicht hat, daß er es ahnt, daß er es nicht zugeben will, aber daß er darum weiß, daß er es fürchtet, daß er darum betet, daß ich eine Niete bleibe, daß ich versage. Und natürlich ist er immer freundlich, wenn er mich sieht, betont freundlich, ach Paul, sagt er, komm herein, und sein Gesicht zerfließt in der Tür, und ich freue mich manchmal wahrhaftig, wenn ich ihn sehe, und doch denke ich auch über ihn siehe oben.
Wir sind alle so verlogen, in Grund und Boden verlogen, wir wollen es vielleicht gar nicht anders haben, wir wollen mit der Lüge existieren, wir sind wahrscheinlich gar nicht existenzfähig ohne die Lüge. Ich habe es ja an mir gesehen. Seit fast zwanzig Jahren lebe ich mit der Lüge. Seit fast zwanzig Jahren will ich schreiben, und im letzten Jahr hatte ich beschlossen, es endgültig zu tun. Ich wurde dreißig in diesem Jahr, und ich hatte mir den ganzen Sommer frei gehalten. Aber dann wurde ich krank, im Winter vorher wurde ich krank. Ich habe oft an diese Krankheit gedacht. Es war eine Krankheit, eine böse Sache, es war ein völliger Zusammenbruch. Ich habe oft geglaubt, sterben zu müssen oder verrückt zu werden. Es war eine Krise, eine böse Krise, und doch habe ich mir manchmal gedacht, habe ich mir manchmal in der letzten Zeit gedacht, ob ich mir nicht alles vorgemacht habe, ob es nicht bloß die Angst vor dem Schreiben war, die mich zusammenbrechen ließ, das Wissen um die Unfähigkeit, die Furcht vor der Enttäuschung. Vielleicht habe ich deshalb beschlossen, krank zu werden. Vielleicht wollte ich nur mein Versagen hinausschieben.
Ich habe alles in meinem Gesicht gesehen vorhin, in diesem widerlichen unfähigen weibischen Gesicht. Alles ist mir eingefallen, mein halbes Leben ist mir eingefallen. Vielleicht war ich schon immer ein Neurotiker, ein Hysteriker, ein Scharlatan, ein Scheißkerl. Ich habe daran gedacht, wie ich um Lottes willen eine ganze Nacht auf ihrem Fußabstreifer lag. Wie muß ich damals von Sinnen gewesen sein, was müssen die Leute von mir gedacht haben, die alte Dame, die mir aus dem zweiten Stock Decken für die Nacht herunterschickte, die beiden Schwestern, die bedauerten, daß sie kein Zimmer für mich hatten, die Familie, die mir etwas zu essen bringen wollte, wenn ich daran denke: eigentlich waren die Leute noch verrückter als ich. Und ich habe auf die Tür getrommelt, ich habe mit den Fäusten und den Schuhen auf die Tür getrommelt, und sie haben aus dem Fenster nach dem Hausmeister geschrien, und der Hausmeister kam, und ich sprach mit dem Hausmeister, und der Hausmeister sah, daß ich gar nicht verrückt war, denn ich sprach sehr ruhig und überlegen und vernünftig, und der Hausmeister ging wieder, und ich habe die Nacht auf dem Fußabstreifer verbracht, und ihr Mann kam nicht, und sonst kam auch kein Mann, es war gar keiner da, bloß sie wollte mich nicht, sie wollte Schluß machen, aber ich wollte nicht, ich wollte nicht nachgeben, noch nie konnte ich nachgeben, schon als Bub konnte ich nicht nachgeben, schon als Bub mußte ich immer der erste sein, mußte ich immer gewinnen, schon als Bub war ich ein kleiner Tyrann, und einmal habe ich unser Mädchen einen ganzen Nachmittag in die Kammer gesperrt, und Marianne dazu.
Ja, auch an Marianne habe ich vorhin gedacht. Ich habe sie mit in die Kammer gesperrt, und als ich sie herausließ, habe ich sie geohrfeigt. Ich habe sie geohrfeigt, weil sie mich liebte, weil sie zeigte, daß sie mich liebte, weil sie mir nachsah, mir Augen machte, weil sie meine Nähe suchte. Ich konnte das nicht vertragen, bis sie weg war, bis ich ein Bild von ihr sah, auf dem sie halb nackt war, und die Augen heruntergezogen, die Wimpern lang, der Blick verschleiert, glänzend, feucht, dann wollte ich sie haben. Aber ich hatte noch gar kein Mädchen gehabt, und ich fuhr zu ihr, drei Tage fuhr ich mit dem Rad, und als ich ankam, war sie ganz allein, ganz allein in einem großen Haus. Ihr Onkel war verreist, ihre Mutter war verreist, ihr Vater war schon tot. Er hatte sich aufgehängt oder war aus dem Fenster gesprungen, ich weiß nicht mehr. Sie war allein, sie hatte schon geschlafen, und als ich dann Gutnacht sagte, habe ich sie geküßt. Es war mein erster Kuß, ich erinnere mich nicht mehr genau daran, aber ich weiß noch, daß es nicht toll war. Es war so fad wie die meisten ersten Küsse, und dann schliefen wir.
Am Morgen regnete es, es regnete vierzehn Tage, solang ich dort war, regnete es. Ich kam vierzehn Tage nicht aus dem Haus. Ich war vierzehn Tage allein mit ihr. Wir saßen nebeneinander am Morgen, lasen in einem illustrierten Casanova und betrachteten die Bilder. Dann hörten wir auf und spielten Schach. Sie spielte schlecht. Sie verlor jedesmal. Ich war hart, ich ließ sie nicht gewinnen. Ich sagte mir, wenigstens einmal mußt du sie gewinnen lassen, aber ich brachte es nicht fertig. Wir spielten länger als eine Woche Schach, Mühle, Dame, aber ich ließ sie nicht gewinnen. Sie weinte fast, aber ich blieb hart. Irgendwie haßte ich sie, aber ich wußte nicht warum. Vierzehn Tage regnete es, und vor dem Fenster standen die roten Geranien in der Nässe, und ich hatte Heimweh.
Ich habe sie nie gehabt. Ich war vierzehn Tage allein mit ihr und habe sie nie gehabt. Ich erinnere mich an einen Sonntag, wo sie einmal über die Straße sprang und eine ganze Gruppe junger Burschen sich umdrehte und ihr nachguckte. Sie ging wie ein junges Raubtier. Sie war siebzehn, ich war sechzehn. Ich habe sie nie gehabt. Ich habe auch daran gedacht, als ich mein Gesicht vorhin im Spiegel sah. Sie ist mir entgangen, ich habe sie versäumt, und wenn ich an sie denke, könnte ich sie hassen, weil sie mich damals nicht verführt hat. Zwei Jahre später hat es eine Nutte in einem französischen Bordell getan, in Rochefort sur mer, als wir an unserem ersten Ausgang geschlossen in den Puff strömten, zuerst zum Photographen, dann in den Puff. Die Nutte war wie eine große Schwester zu mir, sie spielte mit mir wie mit einem Baby. Aber Marianne habe ich damals versäumt, sie war siebzehn, sie war sinnlich, sie wollte von mir genommen sein, sie war in mich verliebt, sie hatte einen Körper wie ein junges Raubtier. Ich habe sie versäumt. Ich habe auch daran gedacht vorhin. Ich habe vieles in meinem Gesicht gesehen, Versäumnisse, Enttäuschungen, Laster. Ich habe schon die dreißig überschritten und noch nichts geleistet. Plötzlich beginne ich zu ahnen, ich beginne grauenvoll zu ahnen, daß ich verdammt bin zum Scheitern, verdammt zum Nichtschaffen, zum Nichtvollenden, zum Fragment, zum Fetzen, ein Stümper. Ja ich bin unfähig, ich bin wahrhaftig unfähig. Betrachte doch dieses Gesicht, ein solches Gesicht ist unfähig, ein solches Gesicht ist fähig zum Spinnen, zum Flausenmachen, zum Überschnappen, zum Größenwahn, aber nicht zum Durchhalten, zur Energie. Ein solches Gesicht ist Scheiße, Scheiße mit Gefühl, einem solchen Gesicht müßte man in die Fresse schlagen, stundenlang in die Fresse schlagen, bis es die Besinnung verliert und vielleicht dann zur Besinnung kommt, wenn es wieder nüchtern ist. DAS DENKMAL. Er möchte sich halt ein Denkmal bauen. Und er ist doch unfähig, wollte er sagen, er ist doch genau so unfähig wie ich, wie wir alle, er ist bloß zu blöde, um es zu merken. Und dabei ist etwas in mir, ich weiß es. Vielleicht weiß es Rolf auch. Er hat mich für einen Dichter gehalten, er hat gesagt, schreibe, schreibe, schreib jetzt endlich einmal. Er hat nie auf meine Vorträge was gegeben, er hat auf meine Presse nichts gegeben, aber ich habe es auch nicht getan, es war nur ein Mittel, um Geld zu verdienen, um meinem Vater zu beweisen, daß ich existieren konnte. Und Rolf sagte: schreibe! und zu Barbara sagte er, er ist ein Dichter, und Barbara sagte, er glaubt daran, aber lieber Himmel, woher wollte er das wissen? Aus den paar Fetzen, die er kannte, aus meinen Gesprächen, aus meinen kraftlosen Ekstasen? Hätte ich doch nie diese Ambition gehabt! Hat sie jeder Mensch? Werden die andern nur früher gescheit? Geben die anderen nur früher nach? Geben die anderen nur früher auf ? Ich denke an meinen Urgroßvater. Mein Vater hat mir von ihm erzählt. Es ist fast das einzige, was er mir über meine Vorfahren erzählt hat. Er ist mit ihm als kleiner Bub auf der Landstraße gegangen, auf der Landstraße nach Ebrach, auf der Landstraße von Schwarzach nach Ebrach, durch die welligen Felder, durch die Obstbäume, durch den Wald, und ich stelle mir vor, es war Sommer, Sommer in Franken, Sommer mit etwas Staub, mit Staub und goldgrüner Luft, und ich stelle mir vor, die Schuhe meines Urgroßvaters waren schlecht, und die Schuhe meines Vaters waren schlecht, und mein Urgroßvater hatte einen Stock in der Hand, einen Haselnußstock vielleicht, was weiß ich, und so zogen sie dahin, der Alte und der Junge, und über ihnen und um sie war der Wald und das Gesumm und Gebrumm von Bienen und fernes Hähergekreisch, und manchmal flatterten kleine Falter vor ihnen her oder eine Taube klatschte laut aus den Buchen, und dann schimmerten und funkelten die Sommeräcker zu ihnen herein, und wenn sie hinauskamen, wellte sich das helle Land vor ihnen, sie sahen die Kornfelder wie blonde Vögel auf den Fluren liegen, und Pappeln züngelten in die wehenden Wolken, und alte Weidenstümpfe kauerten am Bach, und irgendwo war Sensengedengel und leises Gerufe, und kleine blauäugige Seen blickten zum Himmel, und rote Dächer rösteten in der Sonne, und es war Sommer und Geruch und ein Anflug von Staub, und die Wegwarte blühte blau an der Straße, und ich höre ihre Schritte, und ich höre die Vögel in den Apfelbäumen und den Bussard über den Wäldern, und ich rieche den Sommer und spüre den August, und ich sehe das heiße Zittern über den Feldern, und ich sehe die Kirchtürme spitz und schlank in den Himmel gekippt, und dann, ja, und dann blieb mein Urgroßvater manchmal mitten im Laufen stehen und machte mit seinem Stock eine weite Bewegung über das Land und sagte zu dem kleinen Buben, der mein Vater geworden ist: die Reiher müssen noch einmal einen Namen bekommen in der Welt. Guter Himmel, und ein halbes Jahrhundert später hat mein Vater, mein nüchterner Vater in einer schwachen Stunde zu mir gesagt, vielleicht bist du Derjenige-Welcher. Oder war das Ironie? Ich weiß es nicht.
Wie habe ich in den letzten Wochen gearbeitet, von früh bis Nacht, ich habe immer wieder gefeilt, immer wieder neu versucht, ich habe eine Seite zwanzigmal, ich habe sie vierzigmal geschrieben, ich habe es immer wieder meiner Frau vorgelesen, ich habe es selbst zweihundertmal, ich habe es vierhundertmal gelesen, ich wußte nicht mehr, wo mir der Kopf steht, ich habe gesagt, was meinst du dazu oder was meinst du dazu, oder man könnte es auch so machen oder so, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, was meinst du, sprich, wie würdest es du machen, was würdest du tun? Ach, sie wußte es nicht, ich wußte es ja selbst nicht, mir rauchte der Kopf, mir drehte sich alles im Kopf, ich glaube, sobald man auch nur eine Spur überlegt, ist man unfähig, zu schreiben, man müßte schreiben, ohne eine Sekunde nachzudenken, man müßte drauflosschreiben wie eine Maschine, so schnell und ohne alle Hemmungen, man müßte alles herausschleudern wie ein Vulkan oder wie man sich erbricht oder was weiß ich, sobald man denkt, ist es schon vorbei, das ist meine Erfahrung.
Ich war tief verzweifelt bei diesem Schreiben, aber manchmal, manchmal freilich war ich auch überzeugt. Es war selten, aber es gab doch Augenblicke, Viertelstunden, wo ich überzeugt war. Als meine Frau neulich aus der Stadt zurückkam – ich war übers Wochenende allein gewesen, ich bin kaum von der Maschine weggekommen – da hab ich ihr vorgelesen. Ich war überzeugt. Na, sagte ich, was meinst du. Ich wartete, ich wollte gelobt werden. Natürlich wußte meine Frau, daß ich gelobt werden wollte. Aber sie durfte nicht die falschen Worte wählen, sie mußte ihr Lob begründen. Doch in diesem Augenblick war ich überzeugt. Ich sagte, Mensch, das ist doch etwas, das hat Atmosphäre, das hat Schwung, da ist doch etwas drin. Wenn du andere Romananfänge liest! Wie findest du das, und das, und das, ich las ihr Dinge vor, die sie schon xmal gehört hatte, nur hatte ich jetzt vielleicht einen anderen Ausdruck, ein anderes Bild, einen anderen Satzanfang, hatte ich einen neuen Satz hinzugeschrieben oder einen weniger guten oder das, was ich dafür hielt, weggelassen. Am nächsten Tag nahm ich ihn vielleicht dann wieder auf oder strich das Ganze und schrieb etwas Neues, am nächsten Tag las ich es ihr wieder vor und sagte dann, nun, wie findest du das, guter Himmel, wie sollte sie es finden, und ich schrie, das ist Scheiße, es ist alles Scheiße, es taugt keinen Schuß Pulver, ich kann es aufgeben, ich kann mich aufhängen, wahrhaftig, ich lande noch im Irrenhaus.
Wie ich mir seit Jahren einbilde, daß ich ein Dichter bin, bilde ich mir seit Jahren ein, daß ich verrückt werde. Aber man wird leichter verrückt, als daß man ein Dichter wird, auch wenn viele große Dichter verrückt geworden sind. Zuerst haben sie geschrieben, dann sind sie verrückt geworden. Aber ich könnte verrückt werden, ohne etwas geschrieben zu haben, ich könnte verrückt werden, weil ich nichts geschrieben habe. Ich müßte schreiben, um nicht verrückt zu werden, ich müßte schreiben, um existieren zu können, oder ich muß mich verkriechen, ich muß ohne Hoffnung leben, ich muß verzichten. Aber ich werde nicht verzichten können, ich werde mich nie bescheiden können, und ich brauche die Hoffnung, aber ich bin nicht fähig, sie zu realisieren, was soll das werden, wie soll das enden. Ich habe Anlagen zum Verrücktwerden, ich weiß es. Ich bin schon oft vor dem Spiegel gestanden, ich habe Grimassen gedreht, schreckliche Grimassen, es hat mir Spaß gemacht, es hat mir großen Spaß gemacht, ich habe Grimassen vor meiner Frau gedreht, auch das hat mir Spaß gemacht, großen Spaß, und ich habe Grimassen vor meiner Tochter gedreht, und auch das hat mir Riesenspaß gemacht, und ihr übrigens auch, sie hat es nachgemacht, sie hat es fabelhaft nachgemacht, perfekt, ich habe ihr die Anlage zum Verrücktsein vererbt, ich habe sie ihr perfekt vererbt. Hätte ein solcher Mensch wie ich heiraten dürfen?
Ja, ich weiß, meine Tochter hat auch manches Gute von mir. Sie ist gut zu Tieren. Sie fragt, ist Dicker unten, es ist kalt, es ist kalt da draußen, Dicker holen, sie sagt es drei- viermal am Tag, und dann spielt sie mit ihm, streichelt ihn, beißt ihn in den großen schwarzen Kopf, und vorher war er drei Jahre eingesperrt, drei Jahre in einem Loch eingesperrt, in dem er seinen Schwanz nicht ausstrecken konnte, in dem er seinen eigenen Kot fraß, in dem er sich drei Jahre drehte wie ein Kreisel, ständig wie ein Kreisel drehte, drehte, drehte. Nun habe ich ihn endlich, nun gehört er mir, aber ich will gar kein Verhältnis zu ihm kriegen, ich behandle ihn gut, aber ich freunde mich nicht an mit ihm. Seit Heidls Tod habe ich mir geschworen, keinen Hund mehr zu halten. Dicker mußte ich nehmen, aber ich lasse ihn mir nicht zu nahe kommen. Man sollte sich mit keinem Wesen näher einlassen. Es kommt nichts heraus als Unglück, als Streit, als Haß, als Trauer. Wenn ich an die Skandäle in meiner Ehe denke, und dabei war gar nichts, es war rein nichts, es war kein Anlaß, es war nur das Zusammenleben, nur das Miteinandersein, nur die Reibung. Und was war vorher gewesen! Du lieber Himmel, ich möchte es wahrhaftig auf einem Tonband haben, wie ich vor drei Jahren mit meiner Frau gesprochen habe und wie ich heute mit ihr spreche. Und in fast allen Familien ist es doch das gleiche, derselbe Jammer, dieselbe Enttäuschung, dieselben Vorwürfe, dieselben Lügen. Und ist das vielleicht ein Trost! Und es kommt nichts dabei heraus, die sinnlosen Debatten, diese Reden und Gegenreden, dieses ewige stundenlange Hin und Her, dieses Reiben um des Reibens willen, um des Rechthabens willen, und die Magenkrämpfe nachher, und das notdürftige Versöhnen, und das Nehmen nach dem Streit, das gewaltsame Nehmen, und die Wut in der Lust, und die Lust in der Wut, oh es ist häßlich, häßlich, häßlich. Alles habe ich in meinem Gesicht gesehen vorhin, wie eine Offenbarung der Verzweiflung war es, Blick in eine Landschaft, die bald nicht mehr existiert und die immer zur Unfruchtbarkeit verurteilt war, eine Wüste, produktiv nur im Haß, im Zwietracht säen, im Zerstören.
Ich habe zerstört, ja, ich habe zerstört, ich will nicht daran denken, was ich alles zerstört habe, und warum habe ich zerstört? Weil in mir selbst nichts war als Zerstörung, als ein Chaos, ein Halbwissen, ein Nichtauskennen. Wer gibt denn Wegweiser in dieser Welt, wonach man sich richten kann! Ich weiß es nicht. Wege gibt es genug, aber es gibt keine Ziele, es gibt keine Lösungen, es gibt bloß das Ich, auf dem man herumreitet, mit dem man sich abstreitet, das man ruiniert, oh und ich habe es kräftig ruiniert, es gibt nichts in mir und nichts an mir, das ich nicht ruiniert hätte, und ich habe alles andere ruiniert, was mir entgegengetreten ist, weil ich selbst ruiniert war.
Nur den Hunden habe ich geholfen im letzten Jahr. Ich habe Dicker aus seinem Käfig geholt, und ich habe Droll das Leben gerettet, damals als ihm der Idiot die Strychninspritze verpassen wollte. Locken Sie ihn mal durchs Zimmer, sagte er, und dann kam Droll auf seinen Vorderbeinen gekrochen und das ganze Gesäß, der halbe Körper schleifte wie ein Sack hintennach. Ja, ist schon gut, ich habe schon genug gesehen, sagte der Idiot. 25 Sekunden, es ist gleich vorbei. Aber dann habe ich Droll doch wieder zusammengepackt und nach Hause gefahren, und ich habe einen Vortrag abgesagt und ein Taxi genommen und Droll am nächsten Morgen nach München gebracht, über zweihundert Kilometer bis in die Klinik gebracht, und mein Vater sagte, du bist verrückt, und ich habe das letzte Geld zusammengekratzt, aber der Hund wurde gerettet.
Und sonst habe ich hunderte von Tieren zerstört, ich habe sie erschossen, ich habe getötet, ich konnte es zuletzt nicht mehr, ich habe es aufgegeben, ich habe zu oft an die Tiere gedacht, an den Keiler, dem ich das ganze Maul zerschossen hatte, alles lag voll Zähne und Kieferknochen, und er war fort, und es war strenger Winter, und ich wußte, daß es kein tödlicher Schuß war, und daß das Tier elend verhungern mußte. Und ich habe oft an den Adler gedacht, den ich angeschossen hatte, und der dann mit schlagenden Flügeln und hohem Hals auf mich zukam, und ich habe solange mit einem Stock auf ihn eingedroschen bis er tot war. Und die Ente, die ich geflügelt hatte, und auf die ich dann einschlug bis der Rumpf ohne Kopf da lag und zuckte. Und die Sau, die ich im Sommer zwischen zwei Getreidefeldern schoß und die dann im Getreide lag und wie wild das Getreide niederwälzte, und dann klagte sie laut, der ganze Abend hing voll von ihrem Schrei, und zwanzig Schritte hinter ihr kamen plötzlich Frischlinge, viele Frischlinge, sie wackelten so schnell sie konnten mit ihren kleinen Leibern den Hang hinauf, und ich wußte jetzt, daß ich die Mutter erschossen hatte. Und der Rehbock, den ich zu tief traf, und der dann viele Wochen später mit halbverfaultem Vorderlauf, mit einem Vorderlauf, der schon stank, vom Nachbar geschossen wurde. Und der andere Bock, mein zweiter Bock, den ich abnicken wollte, weil das als weidmännischer galt, und wie ich ihn dann metzelte, wie ich dreimal auf seinen Kopf einstach, ohne die richtige Stelle zu finden, und wie das Tier unter mir zappelte und schrie, und wie ich immer wieder hochfuhr, und wie der Bock dann unter mir lag, still unter mir lag und wartete, und wie er mich mit seinen Augen ansah, und wie ich wußte, daß ich ihn umbringen mußte, daß ich verdammt war, ihn umzubringen, und oben hing der Himmel und splitterte blau über den Buchen und die Vögel piepsten und es war Sonntagnachmittag.
Ach, ich könnte Dutzende von Tieren aufzählen, die ich gefoltert habe, und Dutzende von Tieren gab es bestimmt, die ich gefoltert habe, ohne daß ich es weiß, die ich angeschossen habe und die dann irgendwo verstunken, elend irgendwo verstunken sind oder vom Hund oder vom Fuchs gerissen worden sind. DAS EDLE WEIDWERK! Die Lügen überall, diese gottverdammten Lügen, ob es sich um die Jagd handelt oder um den Krieg oder um die Politik oder um die Schlachthäuser. Wenn man heute als Schriftsteller schreibt, dann müßte man schreiben, wie ein Ertrinkender schreit, ohne zu überlegen, nur laut, laut, daß alle herzuspringen, daß sie helfen, aber wer hilft heute dem andern. Ich sehe es doch, ich sehe es doch, ich bin mit vielen Menschen zusammengekommen, um jeden ist eine Mauer, sie ist unübersteigbar, keiner geht heraus, keiner geht hinein, es ist Scham, es ist Schrecken, es ist Hochmut, es ist Eitelkeit, es ist Furcht, aber es gibt kein wirkliches Verstehen, alle Menschen schwimmen wie Inseln im Chaos, sie hängen sich an alles, sie hängen sich aneinander, sie hängen sich an Geld, ans Fressen, an die Kunst, ans Vögeln, an die Religion, ans Opium, an den Alkohol, ich weiß nicht, woran sie sich noch hängen, aber nichts hält. Nur Gott hält, sagen manche, nur Gott, aber auch nicht hier, nicht in diesem Leben, nur drüben, ja drüben, Wechsel für das Leben nach dem Tode. Ich glaube nicht daran, nein, ich glaube nicht daran, es ist Ausflucht, es ist Schwäche, es ist die Religion der Schwachen, der Feiglinge, es ist ein Wunschtraum, nein, ich will nicht daran glauben, nie will ich daran glauben, ich fürchte, daß ich auch wieder einmal daran glauben könnte, aber ich will es nicht, nein, ich will es nicht, ich will lieber verzweifeln, ich will lieber zugrundegehn als so schwach werden, so feig. Denn es ist Feigheit, der Glaube ans Jenseits ist Feigheit, und er ist Arroganz, und er ist lächerlich. Wir gehen kaputt wie alles, wir verfaulen, wir verbrennen, aber wir können es nicht ertragen, also erfinden wir, was wir brauchen, wir belügen uns ja so schön, wir haben es ja gelernt, uns zu belügen, wir sind perfekt darin, wir haben eine Jahrtausende alte Tradition, warum also sollen wir nicht weiterlügen, wo es so wohl tut, zu lügen: also lügen wir weiter und glauben, wir sind fromm und gut und gottesfürchtig, und in Wirklichkeit sind wir gottverdammte Schleimscheißer.
Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die sich religiös gaben oder die wirklich religiös waren. Wenn nicht bloß der Nutzen aus ihnen sprach, die Profitgier, die Karriere mit dem Gebetbuch in der Hand, dann habe ich immer bald gemerkt, daß diese Menschen Angst hatten, Angst vor dem Leben, Angst vor dem Tod, daß nur der Glaube sie zusammengehalten hat, daß es elende Feiglinge waren, daß sie schwach waren, daß sie versagt hatten. Ach, ich habe auch versagt, ich habe unausdenkbar versagt, und ich bin feig, und ich bin schwach, und ich bin voll Angst, aber diesem Verdummungstraum, diesem Feiglingsparadies will ich mich doch nicht in die Arme werfen. Lieber verzweifeln, ehrlich verzweifeln, nichts sehen, keine Lösung, keinen Weg, nur Chaos, aber sich nichts vormachen, ehrlich sein. Wahrhaft gut sein heißt tapfer sein, so ähnlich sagt Nietzsche. Aber diese Leute sind nicht tapfer. Ich bin auch nicht tapfer, aber ich will mit weitaufgerissenen Augen in die Verzweiflung laufen, ich will wissen, daß ich mich selbst nicht belogen habe. Und doch habe ich mich belogen, meine Eitelkeit hat mich belogen, und ich weiß nicht, wie ich ohne diese Eitelkeit leben kann, ohne Hoffnung, ohne Hoffnung. Ich sehe schon alles verwehen, die Spur meiner Füße verwehen, die Spur meiner Füße führt ins Nichts, und tappe ich denn nicht schon im Nichts, und warum will ich denn nicht ins Nichts, warum sträube ich mich denn, warum schaudere ich denn, warum liebe ich mich denn so sehr? Aber ich liebe mich doch gar nicht, ich hasse mich, ich möchte nur, daß ich liebens-würdig wäre. Sie müssen sich lieben, sagte das Rindvieh, Sie müssen sich LIEBEN. Oh, wir sind Lügner, wir sind Lügner, wir sind Virtuosen. Der Mensch ist ein virtuoses Schwein. Ich sehe mich im Spiegel, dieses Glänzen der Augen, die versagt haben, die keinen Ausweg sehen, keine Hoffnung, eine blaue wäßrige Verzweiflung, die Falten um den Mund, die Schluchten der Resignation, die Haare auf dem Kopf, die ausgehen, ausgehen über einem Schädel, der nichts hervorgebracht hat, einem Knochen, der unproduktiv war, der unproduktiv bleiben wird. Ich habe versagt, ich habe restlos versagt, ich habe zwei Seiten in einem Monat geschrieben, und sie sind nichts, sie sind nichts. Ich bin wie gelähmt, ich habe das Gefühl, keinen brauchbaren Gedanken mehr denken zu können, ich habe das Gefühl, mein Gehirn müßte aus Kot bestehen oder aus einem Haufen Würmer oder aus was weiß ich. Manchmal gehe ich spazieren. Es ist Winter jetzt, es liegt Schnee, ich gehe, ich gehe, ich gehe den Berg hinauf, ich trete in den Schnee, ich sehe auf meine Stiefelspitzen, ich sehe den Schnee abfallen, ich sehe um mich, und ich sehe die beiden Hunde, zwei schwarze Hunde, die durch den Schnee springen, manchmal ist es windig, manchmal ist es ganz still, meist ist es dämmerig, denn ich gehe gerne in der Dämmerung spazieren, die Dämmerung liegt in meinem Kopf, wir leben immer in der Dämmerung, wir leben immer auf die Nacht zu, und ich bleibe oben am Berg stehen und sehe auf das Dorf, ich sehe es klein daliegen, ein paar graue Wände und schwarze Fenster und sonst alles Schnee, und ein paar Fenster werden golden, und wenn es diesig ist, flutet das Gold heraus, es schiebt sich wie goldne Schuppen in den Nebel, nein, ich will keine Bilder suchen, keinen Dreck machen, keine Literatur, ich meine, es gibt Augenblicke, in denen ich schwach, ganz schwach ans Leben glaube, ich weiß nicht warum, es ist meist, wenn ich so draußen bin, wenn ich allein bin und durch den Schnee laufe und die Luft spüre, also es gibt Augenblicke, und mehr als Augenblicke kann man im Leben wohl nicht verlangen, mehr als ein paar Augenblicke, in denen man nicht ganz verzweifelt. Aber auch diese Augenblicke verrinnen, sie zergehen spurlos, dann hängt man sich an Menschen, dann wird man enttäuscht, dann hängt man sich an neue Menschen, dann wird man wieder enttäuscht, dann hängt man sich an Hunde, und die Hunde enttäuschen nicht, aber die Hunde sterben, Hunde werden nicht alt, und wenn man sie liebt, sterben sie um so früher. Alles, was man liebt, stirbt bald, und je mehr man es liebt, um so früher stirbt es. Was heißt überhaupt Liebe. Es sind nur Ausbruchsversuche aus dem Kerker des Ich, vereitelte Fluchtversuche, Betäubungen, Narkosen, Ekstasen, und alles endet in Enttäuschung, in Haß, in Rache, alles endet im Gegenteil, und der Kerker wird stärker, die Gitter werden stärker, die Mauern werden höher, die Verzweiflung schwillt. Und alles denke ich doch bloß, weil ich versagt habe.
Guter Gott, es ist Nachmittag, es ist Spätnachmittag jetzt, der Schnee wird schon blau vor meinem Fenster, die bläulichen Schneeflächen stehen um das Zimmer, vor einem Fenster steht ein blauroter Alpenveilchenstock, dahinter wirbelt der Schnee vor einer Hecke, wenn ich jetzt an ihr vorbeigehe, burren die Spatzen hoch, dann sehe ich zwei Apfelbäume, sie sind krumm wie Regenwürmer, sie stehen da in der Verzweiflung, im Nichts, aber sie wissen es nicht, sie stehen bloß da, wissen sie es wirklich nicht? was wissen denn wir? wir wissen nur, daß wir unglücklich sind, daß wir alle unglücklich sind, alle, außer den Leutchen, die ihr Mäulchen drehen und ihr Glück preisen, ihr feistes Spießer- und Vogelstraußglück. Und ich sehe den Schnee, ich sehe den Schnee fallen, und meine kleine Schreibtischlampe brennt, ein kleines goldenes Licht, es spiegelt sich im Bücherschrank, es spiegelt sich im schwarzen Klavier, in dem Klavier meiner Mutter, in dem Klavier, auf dem meine Mutter spielte, und manchmal sang sie dazu, ich glaube, wenn sie unglücklich war, wenn sie traurig war, wenn sie voll Sehnsucht war, und jetzt spiegelt sich das Licht meiner Schreibtischlampe darin, wie ein kleiner goldener Vogel steht es darin, wie ein Kanarienvogel im Käfig, und es ist warm im Zimmer, es ist fast zu warm, es ist ruhig, könnte ich nicht zufrieden sein, könnte ich nicht nicht ganz unglücklich sein, gewiß könnte ich es, wenn ich vernünftig wäre, wenn ich mich bescheiden könnte, wenn ich mich in meiner Nietenhaftigkeit akzeptieren könnte.