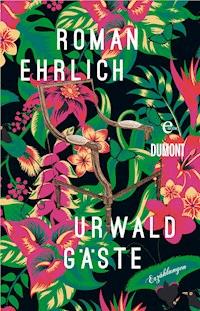9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein Roman über die Angst als das Lebensgefühl unserer Zeit Sie treffen sich Woche für Woche in einer Kneipe und erzählen sich ihre schlimmsten Ängste. Es ist ein außergewöhnliches Projekt, zu dem Christoph sie alle eingeladen hat. Er ist Regisseur und sie sind Schauspieler, Bühnenbildner, Cutter oder einfach nur Freunde. Sie haben Angst vor der Dunkelheit und der Liebe, vor Einsamkeit und Kriechtieren, vor dem Wahnsinn und vor vertauschten Krankenakten. Aus ihren Geschichten soll das Drehbuch für den Horrorfilm Das schreckliche Grauen entstehen. Nach Monaten der Vorbereitung beginnen schließlich die Dreharbeiten und ihnen wird klar, dass Christophs Ideen viel radikaler sind, als sie bisher dachten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 969
Ähnliche
Roman Ehrlich
Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Trotz allem:
für Christoph
Ich hatte mir vorher oft gedacht, dass ich gerne einmal in einem Horrorfilm mitgespielt hätte. Das war der Wortlaut meiner Gedanken: Ich hätte gerne einmal in einem Horrorfilm mitgespielt. Als wäre mein Leben damals schon fast zu Ende gewesen oder zumindest dieser eine Zug für immer abgefahren. Warum das so war, weiß ich nicht.
Man könnte vielleicht noch weiter zurückgehen und sagen, alles fing damit an, dass ich als Kind Schauspieler werden wollte. Aber davon hatte ich mich eigentlich längst schon verabschiedet. Ich wollte kein Schauspieler sein. Ich wollte auch kein grundsätzlich anderer sein als der, der ich war.
Als ich aber von Christoph angerufen wurde und er mir anbot, eine Rolle in seinem nächsten Film zu spielen, der ein Horrorfilm werden sollte, sagte ich sofort zu. Es war ein komisches Telefonat. Ich hatte sehr lange nichts von Christoph gehört, er war zu einem dieser Kontakte in meinem Telefon geworden, die man zwar nicht löscht, aber auch nie benutzt. Und ich war mir sicher: Ich bin genauso ein toter Kontakt auch für ihn.
Dann rief er mich an und fragte, ob ich Lust hätte, er suche noch Personal für seinen nächsten Film, und er habe an mich gedacht. Es sollte ein Horrorfilm werden, etwas Besonderes, etwas, das es so noch nie gegeben hat. Die ganze Art, wie Christoph mit mir sprach, wusste nicht nur nichts von der Tatsache, dass wir bis vor wenigen Sekunden noch tote Kontakte in den Telefonen des jeweils anderen gewesen waren, sondern hätte auch, das hörte ich heraus, obwohl ich eh schon wusste, dass ich mitmachen würde, keine Absage akzeptiert. Es war damals noch gar nichts Forderndes in seinem Tonfall. Nur eine Selbstverständlichkeit. Dieselbe Art Selbstverständlichkeit, mit der täglich die Entscheider in den Entscheiderpositionen darüber informieren, wie man sich zu verhalten hat und was zu tun ist. Eine selbstverständliche Führung durch den Zweifel und die Unsicherheit, von jemandem, der diesen Zweifel und diese Unsicherheit selbst nur noch als etwas fern Vergangenes kennt, wie das Fahren mit Stützrädern oder die Angst vor Schulaufgaben.
Christoph hatte eigentlich nichts davon wissen können, dass ich immer schon mal in einem Horrorfilm mitspielen wollte. Es muss ein Zufall gewesen sein, dass er für seinen Film Laiendarsteller suchte und seinen Bekanntenkreis abtelefonierte und dass es ausgerechnet ein Horrorfilm war, den er im Sinn hatte.
Ich habe nie gern Horrorfilme geschaut. Ich bin kein Fan und kann auch gar nicht nachvollziehen, wie man zu einem wird. Es macht mir keinen Spaß, Angst zu haben. Auch nicht in Gesellschaft. Und trotzdem hatte ich immer schon die Vorstellung, selbst in einem Horrorfilm mitzuspielen, sehr aufregend gefunden. Ich stellte mir vor, als die Figur, die ich in dem Film spielen würde, einen aufwendig animierten, grausamen Tod zu sterben – von einem großen Ungeheuer in zwei Hälften gebissen zu werden oder von einem elektrischen Schock so verkohlt, dass nur noch mein Skelett und eine schwarze Kruste übrig bleiben würden.
Ich glaube, der Tod, den meine Figur im Film sterben würde, war mir in meiner Vorstellung das Wichtigste. Ich stellte mir auch vor, wie ich vor einem grünen Hintergrund herumsprang, der dann später im Film durch eine animierte Schlangenhöhle ersetzt war oder durch ein schleimiges Labyrinth oder einen Planeten, der von gefährlichen Rieseninsekten bewohnt wird. Und ich stellte mir vor, wie ich dann, wenn der Film abgedreht wäre, in einem Kino sitzen und mir selbst bei alldem zusehen würde. Dabei, beim Zusehen, hätte ich aber den Effekt, sich selbst auf der Leinwand sterben zu sehen, am interessantesten gefunden. Weil ich kein Schauspieler bin, hätte ich mich sicher nicht gern dabei beobachtet, wie ich versuche, das Sterben an einer schweren Krankheit im Krankenhausbett nachzuspielen. Ich dachte, ich würde gern sehen, wie ich einen absurden, gewaltvollen Tod sterbe, und ich würde diese Erfahrung gern überleben. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass das etwas ist, was sich nicht jeder irgendwann schon einmal vorgestellt hat.
Ich habe manchmal geträumt, dass ich verschiedene Gliedmaßen verloren habe, durch einen Unfall oder Unachtsamkeit oder weil sie einfach aufhörten, fest mit meinem Körper verbunden zu sein. Vor allem meine Zähne waren mir schon sehr zahlreich ausgefallen. Aber ich war nie im Traum gestorben, obwohl ich lange schon eine Neugier und manchmal auch eine starke Sehnsucht nach dem Tod mit mir herumgetragen habe. Und ich muss wohl gedacht haben, dass mich der Anblick meines sich zum Beispiel in einem Säurebad auflösenden Körpers irgendwie beruhigen würde, weil er diese Neugier und diese Sehnsucht auf eine gefahrlose Weise bejahte und befriedigte. Es war aber ganz wichtig für mich, dass ich es sein würde, der von einem besessenen Monstertruck überfahren wird oder für ein fürchterliches Experiment bei vollem Bewusstsein obduziert.
Jede Geschichte ist eine Erzählung des Helden, der sie überlebt hat. Wahrscheinlich wollte ich der Geschichte, die mein Leben ist und die naturgemäß nur das gelebte Leben sein kann, meinen eigenen Tod hinzufügen. Ich wollte der sein, der ausgefahren war, um das Abenteuer des Sterbens zu erleben, und gleichzeitig am Ufer zurückbleiben, um es aus sicherer Distanz zu betrachten. Aber ich kann darüber heute nur noch spekulieren. Nichts davon war mir wirklich bewusst, als mir Christoph das Angebot machte, bei der nächsten Produktion dabei zu sein. Damals hätte ich einfach nur gerne einmal in einem Horrorfilm mitgespielt.
Erstes BuchUlm
Christoph war am Telefon noch gar nicht konkret geworden, was den Film betraf. In den Tagen nach unserem Gespräch konnte ich mir weiterhin alles so ausmalen, wie ich es mir immer schon ausgemalt hatte. Ich fühlte mich von einer höheren Macht erhört und beschenkt und ging eine Weile herum mit einem Gefühl in der Brust, dass vielleicht doch alles möglich wäre, was ich wollte, wenn ich nur genug Geduld aufbrächte. Die Enttäuschung kam ja erst viel später.
Damals machte ich mir hauptsächlich Sorgen darüber, als Schauspieler eine schlechte Figur abzugeben. Ich hatte so gut wie gar keine Erfahrung – ein bisschen Theater in der Schule, ein paar Komparsen- und Kleindarstellerrollen als Student. Für diesen Film aber würde ich mich an einen Ort begeben müssen, der mir völlig fremd und unbekannt war, davon hatte ich eine deutliche Vorahnung. Damals fand ich das noch aufregend. Das Gefühl tat mir gut, es machte mich im besten Sinn nervös und wach und neugierig auf die Zukunft. Heute würde ich sagen, dass es sich auch damals schon um eine dunkle Vorahnung gehandelt hat. Auch wenn das komisch klingt: eine wohlige dunkle Vorahnung. Die Kellertreppe, die man in voller Absicht hinabgeht, ohne das Licht einzuschalten. Vielleicht entsprach dieser Zustand dem Gefühl, das man hat, bevor man den Kinosaal betritt, um sich einen Horrorfilm anzuschauen. Wenn man jemand ist, der das gerne macht oder sich etwas davon verspricht.
Ich war zu dieser Zeit auch deshalb sehr offen für jede Art Angebot von außen, was ich mit mir, meiner Zeit und meinem Leben anstellen könnte, weil ich erstens sehr unzufrieden war mit meiner Arbeit in einer noch jungen Agentur in Schwabing, die Postproduktion, Marketing, Coaching- und Managementaufgaben für die deutschen Dependancen multinationaler Musik- und Filmlabels wie Universal, Sony oder Warner übernahm, und zweitens gerade erst aus einer Trennung hervorgegangen war, mit der unverbrüchlichen Gewissheit, ein unbrauchbarer Loser zu sein, dem vor einiger Zeit noch einiges Potential hätte bescheinigt werden können, von dem mittlerweile aber gesagt werden musste, dass es ihm vorne und hinten an allem fehlte, was ein Mensch brauchte, um sich selbst in der Welt zu verwirklichen. Ich war dazu übergegangen, jemanden, der mich einmal mit besten Absichten unterstützen wollte, mit meiner Schwäche und meiner Unzufriedenheit zu erpressen, um Bestätigung, Geborgenheit, Zuneigung und Wärme zu erhalten, was fast drei Jahre lang funktioniert hatte, bis irgendwann der Punkt gekommen war, an dem meine Diktatur der Unzulänglichkeit einfach so zusammenbrach und durch nichts mehr zu ersetzen war.
In der Agentur in Schwabing hatte ich noch während des Studiums zu arbeiten begonnen und hatte mir über die Jahre einen ganz guten Status aufgebaut. Die Hierarchien waren zu flach, um irgendwohin aufsteigen zu können, wir hatten zwei Chefs, die die Entscheidungen fällten und die wichtigen Gespräche führten, und waren ansonsten um die zehn Männer zwischen zwanzig und dreißig, die tief eingesunken in Bürostühlen vor hochauflösenden Computerbildschirmen saßen und die deutsche Homepage von Miley Cyrus bearbeiteten oder das Menü der Live in BerlinDVD von Atze Schröder oder Mario Barth oder Helene Fischer. Zwischen den Monitoren standen Club-Mate Flaschen, es gab einen festen Wochentag, an dem wir alle zusammen frühstückten, und einen anderen, an dem einer der Chefs scharfe Chickenwings und Pommes mitbrachte. Der Chickenwingstag war ein Freitag, den wir Dirty Friday nannten, heute ist wieder Dirty Friday, sagte mindestens einer der Chefs jeden Freitag in Erwartung des Aufjohlens, das wir ihm pflichtschuldig immer aufs Neue lieferten, als unseren Beitrag zur Arbeitsplatzatmosphäre, die nicht zuletzt davon lebte, dass nie auch nur eine einzige Frau für die Arbeit an einem der Monitore eingestellt wurde. Wir aßen die Hähnchenflügel mit unseren Händen, wischten uns das Fett von den Fingern und spielten bis spätabends Bomberman auf dem riesigen Flachbildfernseher, der in den Räumen der Agentur ebenso vorhanden war wie ein Kickertisch.
Ich kam nie vor zwanzig Uhr aus der Agentur, und jedes Mal, wenn ich aus dem großen Fahrstuhl in den Hinterhof trat und auf die Straße, wurde mir so eng in der Brust, dass ich glaubte, ich müsste heulen. Jeden Tag aufs Neue hatte ich das Gefühl, von der Geborgenheit der fremdbestimmten Struktur in mein ausschließlich aus meinen eigenen Entscheidungen und Verfehlungen bestehendes Leben überzutreten, mein eigenes Leben, das ich hasste, besonders an den Wochenenden.
Mir war vollkommen bewusst, dass alles, was wir mit unserer Zeit und Energie in dieser Agentur erarbeiteten, Mist war. Und mir war auch bewusst, dass ich die Leute, mit denen ich in dieser Agentur all diese Zeit verbrachte, nur mittelmäßig oder überhaupt nicht interessant fand. Die Kollegen, die mit mir vor den Monitoren saßen, wechselten zwar häufig (niemand blieb je so lange wie ich), waren aber am Ende doch immer irgendwie die gleichen Typen, die sich schnell an die Regeln gewöhnten, am Dirty Friday aufjohlten und bis spätabends in der Agentur Bomberman spielten oder eben nach ein paar Wochen nicht mehr auftauchten. Und trotzdem war mir mein Arbeitsalltag bei weitem erträglicher als das schwarz gähnende Loch der Fragen nach meiner Zukunft und meiner Daseinsberechtigung als Person ganz generell, das auf mich wartete, wenn ich die Agentur verließ.
Als ich dann auch keine Hälfte einer Beziehung mehr war, lag ich an den Wochenenden viel herum und schlief, und jedes Mal, wenn ich aufwachte, hatte ich ein ganz deutliches Gefühl davon, als abgetrenntes einzelnes Atom ins All hinauszutreiben. Ich wachte auf in meinem Zimmer und dachte: Das bist jetzt also du.
Zum ersten Mal bin ich Christoph in der LMU begegnet, wo wir beide für kultur- und medienwissenschaftliche Studien eingeschrieben waren. Er, um die Zeit zu überbrücken, bis man ihn an der Filmhochschule annehmen würde, und ich, weil mir nichts Besseres eingefallen war. Wir verstanden uns gut, auf Anhieb, sprachen über Filme und Musik, aber hauptsächlich über die anderen Studenten in unserem Studiengang oder in der Universität, in Deutschland allgemein, wir fanden sie rückgratlos, unbrauchbar, degeneriert, unmündig, egomanisch, ignorant, aufgesetzt mädchenhaft, ungebildet, uninteressant, ahnungslos, verkorkst und verblödet, feige, blind und taub für das Hohe und Große, allgemein und insgesamt eine riesige Enttäuschung, gemessen an den Vorstellungen und den Hoffnungen, die wir uns gemacht hatten, bevor wir an der Universität angetreten waren, beide etwas spät im Vergleich zum Durchschnitt, mit diesem kleinen Vorsprung Leben, der für unsere Überheblichkeit ausreichende Rechtfertigung war.
Der Unterschied zwischen Christoph und mir war, dass er trotz allem viele Freunde oder ihm freundlich gesinnte Menschen unter den Kommilitonen hatte, wohingegen ich unsere Feindseligkeit durchaus ernst nahm und mich auf niemanden wirklich einließ. Damals kannte ich noch genug Leute in München aus anderen Kontexten, bemühte mich noch um Anschluss oder hatte mich bemüht und war darauf auch stolz. Der Mikrokosmos an der Universität, in den jeder eingeladen ist, sich ausschließlich zu begeben für die Zeit bis zum Abschluss, war mir zu klein, wobei ich heute sagen würde, dass er sicherlich sehr viel umfangreicher war als der meiner Schwabinger Agentur.
Es vergingen ein paar Semester, bis Christoph tatsächlich einen Studienplatz an der Filmhochschule bekam und ich mich schließlich zurückgelassen wiederfand, mit den kultur- und medienwissenschaftlichen Studien und den Kommilitonen, die ich dann ganz alleine und nur für mich verachten musste, was dazu führte, dass meine Verachtung zu einem harten steinernen Kloß in meinem Bauch wurde, den ich immer deutlicher spürte, wenn ich in die Seminare ging.
Ich kann mich an einen Spaziergang erinnern, den ich mit Christoph durch die Maxvorstadt und das Museumsviertel gemacht habe, an dessen Ende er in dem glatten Neubau der Filmhochschule am Bernd-Eichinger-Platz verschwunden ist, wie ein Minister in seinem Ministerium, denn so sieht das Gebäude ja auch aus, in das ich ihm als Zivilbürger nicht folgen durfte.
Er hat natürlich nie gesagt, ich dürfte ihm nicht folgen, aber ich stellte mir vor, dass man am Eingang seinen Studentenausweis irgendwo einscannen müsste, was vielleicht ja auch so ist, und verabschiedete mich vor dem Gebäude, behauptete, ich würde mir noch eine Ausstellung ansehen wollen in der Pinakothek der Moderne, was gelogen war. Stattdessen ging ich in ein volkstümliches Brauhaus im Tal, das ich sehr mag, obwohl ich mir dort immer vorstellen muss, dass an solchen Tischen, wie sie dort stehen, von solchen Leuten, wie sie dort sitzen, vor nicht so wahnsinnig langer Zeit die NSDAP gegründet wurde und ich mir jedes Mal denke: Ja, das passt.
Ich aß an diesem Tag, daran erinnere ich mich genau, Blut- und Leberwurstgröstl mit Bratkartoffeln und Sauerkraut und trank ein Hefeweizen und observierte die Touristen und die Stammgäste mit einem kalten Blick, von dem ich mir einbildete, er sei so etwas wie mein Schicksal, der solitäre Beobachter, dem nur punktuell in seinem Leben etwas wie Freundschaft oder Zugehörigkeit gewährt wird, dessen größerer Auftrag aber im Alleinsein besteht, in der Distanz und der Analyse.
Als ich an diesem Tag nach Hause kam, dachte ich mir, dass ich gerne jemanden angerufen hätte, aber vielleicht hatte ich auch nur unbewusst registriert, dass die Zahl der toten Kontakte in meinem Telefon um einen weiteren angewachsen war, der sich jetzt um die Verwirklichung dessen kümmern musste, was sein Traum war oder seine Bestimmung, sein eigener Auftrag. Es wurde nie wirklich ausgesprochen, aber ich denke schon, dass Christoph und ich sofort wussten, als er an der Filmhochschule angenommen wurde, dass er sich jetzt mit all seiner Kraft und Energie in dieses Studium eingraben würde, dass man das von ihm erwartete und einfordern würde und dass uns dadurch unsere gemeinsame Grundlage, die ja hauptsächlich die Ablehnung der anderen gewesen war, entzogen wurde.
Ich stellte mir ein paar Monate lang immer mal wieder vor, wie es für Christoph wohl gerade lief, ob es ihm Spaß machte und ob er interessanten Leuten begegnete, die schließlich doch die hohen Erwartungen erfüllen konnten oder vielleicht sogar übertrafen, sodass er selbst dann in der Position war, aufholen zu müssen. In dieser Vorstellung waren Christophs Kommilitonen eine im besten Sinn elitäre Gruppe, in der diskutiert wurde, wo visionäre Gedanken vorgebracht wurden von Menschen, die einem mit ihrer Geistesschärfe Angst machten, auf diese produktive Art, dass man in Überstunden, nachts und früh am Morgen, an sich, an der eigenen Rhetorik, Präzision und Allgemeinbildung arbeiten möchte, bis man schließlich mithalten kann. Ich fühlte mich unmittelbar abgehängt, weil ich selbst ja nicht auf so eine elitäre Gruppe zurückgreifen konnte, an der ich mich in vergleichbarer Weise hätte schulen können. Wenn ich daran dachte, Christoph wieder zu treffen, sah ich ihn mit einem verständnisvollen und auch mitleidigen Blick dem zuhören, was ich an ihn hinreden würde. Mir tat die Vorstellung weh, dass ich dabei in Gedanken mit der neuen Gesellschaft verglichen würde, in der er sich nun befand, und es fiel mir überhaupt nicht ein zu denken, ich könnte von ihm in diesen Kreis eingeführt werden. Dafür, das war mir irgendwie von Anfang an klar, hätte ich schon auch selbst an der Filmhochschule angenommen werden müssen.
Ein paar Tage nachdem Christoph mich angerufen und gefragt hatte, ob ich bei seinem nächsten Film mitmachen wolle, kam ich auf die Idee, im Internet nach Arbeiten von ihm zu suchen. Auch wenn ich in den letzten Jahren immer mal an ihn gedacht hatte, war mir nie auch nur der Gedanke gekommen, dass ich im Internet, auf einer Videoplattform oder einer Homepage, die er vielleicht für sich angelegt hatte, einen Trailer, einen fertigen Film oder sonst einen Hinweis darauf finden könnte, was er in der Zwischenzeit gemacht und ob er etwas veröffentlicht hatte.
Ich gab seinen Namen in eine Suchmaschine ein und bekam sehr unterschiedliche Ergebnisse, von denen keines eindeutig zuzuordnen war. Dann grenzte ich die Suche auf Videos ein und fand einen Treffer bei YouTube, für einen Clip, der sehr wahrscheinlich in seiner Zeit an der Filmhochschule entstanden ist. Ich dachte, es könnte vielleicht eine Seminararbeit oder sein Abschlussfilm gewesen sein. Es handelte sich um einen Kurzfilm. Der Titel war: Der fiese Film (Teil 1).
Es begann mit einem schwarzen Bildschirm, Einblendung des Titels, ein Film von Christoph Raub, keine weiteren Namen, dann blickte man einer älteren Frau ins Gesicht, die übel zugerichtet aussah. Sie hatte zugeschwollene Augen und violette, dick und wund aussehende Lippen. Ihre Haare waren nach hinten gebunden, und entlang ihrer Ohren verliefen Nähte, die sehr grob genäht waren und deren Fäden seitlich etwas abstanden. Die Kamera filmte ihr direkt ins Gesicht, und die Frau schaute, so gut es ihr möglich war, direkt in die Linse. Dann gab es einen Schnitt, und man sah, dass sie in einem Krankenzimmer auf einem Stuhl am Tisch saß, ihr gegenüber saß Christoph, den ich gleich erkannte, obwohl er lächerlich verkleidet war. Er trug einen Schnurrbart, der überhaupt nicht zu seiner Haarfarbe passte, eine Hornbrille und auf dem Kopf eine grau-schwarz karierte Rentnermütze. Er hielt ein Mikrofon in der Hand, von dem am unteren Ende ein Kabel abging, das seine andere Hand auf Höhe des Oberschenkels festhielt und das dann aus dem Bildausschnitt herausführte. Christoph fragte die Frau, ob sie jetzt glücklich sei.
Sind Sie jetzt glücklich?
Es machte der Frau einige Mühe zu sprechen, oder besser gesagt, spielte die Frau, dass sie beim Sprechen einige Mühe hatte, was ich nicht besonders glaubwürdig fand, sodass ich mich fragen musste, ob sie keine gute Schauspielerin war oder ob dahinter eine Absicht steckte, wie bei der schlechten Verkleidung von Christoph. Ich musste an das Oberhausener Manifest und den neuen deutschen Film aus den späten Sechzigern denken, an Fassbinder, Schlöndorff und Schlingensief und all die Sachen, von denen ich wusste, dass Christoph sie großartig fand. Wahrscheinlich war es Absicht. Die Frau sagte, na ja, sie sei sich nicht so sicher. Sie tastete vorsichtig an ihrem Gesicht herum, das mir auf einmal auch sehr schlecht geschminkt vorkam, obwohl es tatsächlich gar nicht so schlecht geschminkt war. Nach der ersten OP, sagte die Frau, sei sie sehr unglücklich gewesen, sie habe sich etwas anderes vorgestellt gehabt und die Tränensäcke seien relativ schnell wieder deutlich hervorgekommen. Deshalb habe sie ja auch die Klinik gewechselt. Sie habe nach dem Aufwachen, in den ersten Tagen nach der OP, immer große Angst, dass die Schwellungen nicht mehr zurückgehen und sie für immer so aussehen werde. Das sei sicherlich irrational und unsinnig, aber welche Angst, fragte die Frau mit schlecht gespielter Emphase, sei schon rational.
Christoph klappt sich selbst das Mikrofon entgegen mit einer schnellen Bewegung, wie ein Reporter aus einer anderen Zeit, dachte ich, der investigative Härte signalisieren will. Aber ich hoffe doch schon, dass Ihnen das hier auch Spaß macht, sagt er ins Mikrofon, Sie sind hier ja schließlich nicht nur angetreten, um sich das Gesicht richten zu lassen. Wir alle hoffen, dass diesen Operationen noch viele weitere folgen werden. Die Frau sieht etwas verwirrt aus, kommt aber eh nicht mehr zu Wort.
Das ist doch sozusagen Ihr Auftrag. Sie müssen in sich selbst investieren. In Ihre Jugend und Schönheit. Für Ihren Reichtum haben so viele gelitten und sind so viele gestorben, das sind Sie denen schon mindestens schuldig, dass Sie Ihr Reichsein jetzt genießen. Es ist ja auch an Ihnen, die Geschichte zu bestätigen. Jahrhunderte der Kriege und der Brutalität müssen von Ihnen davor bewahrt werden, umsonst und sinnlos gewesen zu sein. Abermillionen sind umsonst draufgegangen, wenn nicht das Reichsein oder das Reichwerden unser Streben danach rechtfertigen würden. Das müssen Sie, die Reichen, den Armen vorleben, jeden Tag. Das ist Ihre Aufgabe und Ihre Bürde. Sie müssen genussvoll ausschließlich ignorant und egoistisch vorgehen, nur das tun, das wollen, nur das kaufen, worauf Sie Lust haben und was Ihnen individuell zugutekommt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Die Frau mit dem operierten Gesicht schaut etwas abwesend oder beschämt zur Seite und nickt, während Christoph spricht. Dann will sie etwas sagen, aber Christoph streckt seinen Arm über den Tisch und tätschelt der Frau erst auf die Wange und kneift ihr dann ins Gesicht wie einem Kind und sagt: Sie sind der singende Wohlstand, wir wollen Ihr Lied hören, es macht uns den grauen Tag ein wenig bunter. Die Frau schreit auf, weil ihr das Kneifen ins frisch operierte Gesicht natürlich weh tut, sie greift Christophs Arm, der lässt aber nicht los, sie versucht ihn zu beißen, und er schreit sie an und schlägt ihr mit dem Mikrofon auf den Kopf. Sie sind das vollsanierte Dorf in Ostdeutschland, die Seifenblase der Spekulation, Sie sind die Autobahn zwischen München und Berlin, Sie sind unsere tiefste Angst und unser größter Wunsch, wir fordern Ihr Lied, singen Sie jetzt, sing, du hässlicher Vogel, blöde Sau du, dann gibt es ein übertriebenes Geräusch, und Christoph hält einen abgerissenen Teil des Gesichts der Frau in der Hand, der wabblig und wirklich sehr schlecht aussieht, er hält ihn sich vors Gesicht und schreit ihn an, und die Frau hält sich die Stelle im Gesicht, wo der Teil fehlt, Blut läuft ihr über die Hand, sie schreit auch, und dann wird mit einem Mal scharf abgeblendet auf einen schwarzen Bildschirm. Ein paar Namen erschienen, aber nur ganz kurz, dann war das Video vorbei.
Ich schaute in der Spalte am rechten Rand, wo verwandte Filme angezeigt werden, aber nirgends war ein weiterer Teil des fiesen Films oder überhaupt ein anderer Film von Christoph aufgeführt. Ich schaute weiter unten auf der Seite nach Kommentaren, aber die Kommentarfunktion war ausgestellt. Das Video war vor meinem Aufruf 434mal angeschaut worden. Ich hatte ein sehr schlechtes Gefühl. Dann aber dachte ich mir, dass ja schon viel Zeit vergangen war und dass die Tatsache, dass keine Fortsetzung vom fiesen Film auf der Seite zu finden war, vielleicht als gutes Zeichen gedeutet werden konnte.
Ich glaube, ich wollte einfach so schnell wie möglich wieder zurück in meine eigene Vorstellung davon, was mich erwarten würde. Zumindest für die restliche Zeit, bis es wirklich losging.
Auch bei unserem nächsten Gespräch erfuhr ich von Christoph noch keine konkreten Details. Er rief mich etwa eine Woche nach meiner Zusage erneut auf dem Handy an. Ich hatte erwartet, dass wir über meine Rolle sprechen würden und über die Produktionszeiten, dass mir ein Drehbuch zugeschickt würde und dass mir jemand sagte, wie viel Zeit mir blieb, um meinen Text auswendig zu lernen. Vielleicht hatte ich auch gehofft, dass Christoph und ich wieder anfangen würden, Spaziergänge durch München zu machen, um dabei gemeinsam eine Vision zu entwickeln von meiner Figur und ihrer Psychologie. Aber Christoph sagte mir nur, dass ich in den nächsten Wochen an einigen Abenden nach Ulm kommen müsse. Er gab mir eine Adresse samt Beschreibung, wie ich vom Bahnhof dorthin kommen würde. Es handelte sich um die Adresse einer Bar. Christoph sagte, es sei ganz leicht zu Fuß zu erreichen. Dort werde alles Weitere besprochen.
Zum ersten Mal seit unserer Trennung hatte ich das ehrliche Bedürfnis, Josi anzurufen und ihr alles zu erzählen. Ich hatte in den Tagen davor schon oft das Telefon in der Hand gehabt, aber es war eher ein schlechtes Gewissen gewesen oder der Glaube, dass das etwas sei, was man zu wollen hat nach einer Trennung, den anderen anrufen und nachfragen und selbst erzählen, wie es einem ging. Ich hatte mich jedes Mal davon abhalten können, und sie hatte von sich aus noch nicht mal eine SMS geschrieben. Ich rief wieder nicht an. Ich hätte ihr das alles wirklich gern erzählt und sie auch gebeten, sich den fiesen Film im Internet anzusehen und mir zu sagen, was sie davon hielt. Aber ich hätte es nur dann getan, wenn ich nicht vorher unseren Status, die jüngste Zeit und unsere Gefühle hätte verhandeln müssen. Ich hätte es also nur dann getan, wenn sie weiterhin eingewilligt hätte, eine Art Dienstleisterin für mich zu sein. Jemand, der starke Meinungen vertritt und neugierig ist, dem man etwas zeigen kann, um sich anzuhören, was man dazu denken könnte. Meistens waren das sehr schlaue Gedanken.
Ich dachte mir dann, es wird wohl noch mehr Zeit vergehen müssen, und wenn wir uns das nächste Mal begegnen, werde ich vielleicht schon jemand sein, der in einem Film mitgespielt hat. Ich könnte ihr das dann einfach erzählen und sagen, wenn sie Lust hätte, könnte sie ja mal reinschauen, man brauche aber starke Nerven. Wahrscheinlich hatte ich auch Angst, dass sie nach Ansicht aller Fakten schon zu diesem Zeitpunkt von einer Beteiligung abraten würde und dass das die Stimme der objektiven Beobachterin aus der Distanz wäre, die wahrscheinlich, wie eigentlich immer, recht hatte.
Es war unleugbar endgültig Herbst geworden, als ich mich das erste Mal in den ICE nach Ulm setzte, der in Pasing und Augsburg hielt und insgesamt eine Stunde und vierzehn Minuten für die Strecke brauchte. Als wir aus dem Hauptbahnhof ausfuhren, spritzte Regen gegen die Scheiben, und über den Neubauten, die in den letzten paar Jahren entlang der Gleisstränge entstanden sind, waren graue Wolken zu sehen. Über diesem Grau leuchtete aber noch ein abendliches Licht, eine tiefstehende Sonne, die sich in den Glasfassaden spiegelte und die Tropfen des herabfallenden Regens aufleuchten ließ, wie Millionen winziger Kometen, die beim Eintritt in die Atmosphäre verglühen, jedenfalls sehr feierlich aussahen, und auf dem offenen Land zwischen München und Augsburg riss der Himmel dann richtig auf, und ein Wind ging durch die Felder, es wurde geerntet, was reif war, bunte Blätter überall, mir wurde richtig großartig ums Herz, ich dachte: Das ist jetzt.
Ich saß in einem Großraumabteil an einem Tisch am Fenster und sah nach draußen und sah vor diesem Draußen unscharf meine Spiegelung in der Scheibe, sah mein halbtransparentes Gesicht durch die Herbstlandschaft schweben, wie eine Rückblende in einem Film, wo Erinnerung suggeriert werden soll, hatte also gleichzeitig dieses extreme Gegenwartsgefühl von Hiersein im Jetzt und das Filmbild einer Erinnerungssequenz vor mir, vor meinen Augen, ein phantastischer Moment, fand ich, und hielt es kaum aus. Ich musste immer wieder hinsehen und mich wieder abwenden, um sicherzugehen, dass ich nicht aus der sozialen Situation, ein Mensch unter anderen in diesem Zug zu sein, völlig verlorenging. Das Bedürfnis kam auf, etwas Reisemäßiges zu tun, einer der Fahrgäste zu sein und nicht völlig in meiner Fensterwelt zu versinken. Irgendwann würde jemand kommen und die Fahrscheine kontrollieren, ein Zugestiegener würde nach dem freien Platz neben mir fragen. Ich wollte da nicht völlig abgelöst sein, der Kleber, der mich und die Welt dieser öffentlichen Interaktion zusammenhält, schien mir ohnehin schon reichlich ausgetrocknet. Ich schaute mehrfach in dem kleinen Faltblatt der Bahn nach den Ankunftszeiten in Augsburg und Ulm und las mir die Zielbahnhöfe der Anschlusszüge durch, die dort jeweils aufgelistet waren. Man hätte von diesen beiden Städten in alle Winkel des Landes reisen können, das war mir vorher gar nicht bewusst gewesen. Ich hatte mich aber wohl auch nicht besonders für das Reisen in alle Winkel des Landes interessiert. Schließlich holte ich aus meiner Tasche das Buch, das ich für die Fahrt mitgenommen hatte. Ich hätte problemlos die ganze Fahrt lang nur aus dem Fenster schauen können, hatte mir aber vorher gedacht, die Zeit bis nach Ulm zum Lesen nutzen zu wollen, und fand jetzt auch, dass das gut geeignet war, um sich hier in die Fahrgastgesellschaft zu integrieren. Obwohl ja richtiges Lesen – also nicht nur ein nach außen hin konzentriert wirkendes Hinstarren auf die immer selbe Seite – wieder eine sehr exklusive Tätigkeit gewesen wäre.
Das Buch hatte mir Josi ein paar Monate zuvor zum Geburtstag geschenkt, es hieß Die Soldatin und war ein Roman von Melanie Warga, von der ich noch nie etwas gelesen hatte. Josi kannte alle ihre Bücher, es waren mindestens zehn oder fünfzehn Romane, und fand sie sämtlich großartig. Die Soldatin handelt von einer Frau, die sich bei der Bundeswehr verpflichtet, weil sie schon längere Zeit entsprechende Tendenzen an sich festgestellt hat. Ihr ist zum Beispiel aufgefallen, dass sie Schwäche abstoßend findet oder zumindest nichts damit anfangen kann, dass sie gut im Marschieren und Navigieren ist und ihr Leben auf Grenzerfahrungen und dem Weitermachen, dem Aushalten von Extremsituationen basiert. Sie behauptet auch, irgendwo gleich am Anfang im Buch, unter Frauen wäre diese Eigenschaft sehr verbreitet, sie würden sich eigentlich sehr viel besser für diesen Beruf eignen als Männer. Josi meinte, sie habe sich, nachdem sie das Buch gelesen hatte, dahingehend ein wenig in ihrem Freundeskreis umgeschaut und feststellen müssen, dass da etwas dran sei. Schon während der Ausbildung, vor allem aber später, als sie für ihr Land in den Krieg ziehen muss, kommt es in der Geschichte der Soldatin zu Momenten des magischen Realismus, wie Josi es ausgedrückt hatte. Aber gut, hatte sie gesagt, nicht einfach nur so abgeschriebene südamerikanische Magie, sondern richtig gut, es gebe auch eine Liebesgeschichte, sehr unerwartet und sehr toll, gar nicht blöd, wirklich, sie habe so etwas noch nie gelesen.
Vor der Zugfahrt war ich in mehreren Anläufen etwa dreißig Seiten weit gekommen. Die Handlung hielt sich noch in der Grundausbildung auf und beschränkte sich auf extrem viele sehr detaillierte Beschreibungen der anderen Soldatinnen und Soldaten. Gegenstände und das Wetter spielten auch eine große Rolle, waren aber auf sehr nüchterne Art beschrieben, als sollte man aus dem Stil schon herauslesen können, dass da jemand spricht, der gelernt hat, jedes Phänomen im Kontext der nächsten Kampfhandlung als günstig oder ungünstig zu deuten. Nach jedem abgebrochenen Versuch hatte ich mir vorgenommen, wieder von vorne anzufangen, um nicht gleich beim Einstieg etwas zu verpassen. Die ersten Seiten, hatte ich gedacht, müssten doch wesentlich sein. Ich betrachtete das Titelbild, das aus der Nahaufnahme eines zerschlissenen Armeerucksacks bestand, und dann schaute ich mir lange Zeit das Schwarzweißfoto der Autorin an, das hinten im Buch abgedruckt war. Melanie Warga sah darauf aus wie eine Veteranin des Schreibens. Wie jemand, der wieder und wieder aus der langwierigen, kräftezehrenden Auseinandersetzung mit den eigenen Gedanken und Ängsten und Unzulänglichkeiten als noch etwas klüger und noch etwas weiser hervorgegangen war. Sie war auf dem Bild vielleicht fünfzig Jahre alt und schaute direkt in die Kamera mit einem Lächeln, das weder den Betrachter noch den Fotografen anlächelte, sondern das Fotografiertwerden selbst, in seiner ganzen lächerlichen Schönheit.
Das Lesen ging wieder nur sehr langsam, ich konnte mich nicht richtig konzentrieren. Ich wartete die ganze Zeit darauf, dass jetzt ein Moment des magischen Realismus passieren würde, vor allem aber auf die Liebesgeschichte, die Josi überzeugt hatte, weil ich natürlich wissen wollte, welche Art von Erzählung das war. Dabei hatte ich die ganze Zeit die Begeisterung vor Augen, mit der sie von der Ablehnung der Schwäche durch die Soldatin gesprochen hatte, was ich nur auf mich beziehen konnte, als Wink, als versteckten Hinweis auf ihre Unzufriedenheit mit mir. Das alles stand mir beim Lesen im Weg. Ich steckte minutenlang in einzelnen Zeilen fest, weil ich ihren Inhalt nicht erfassen konnte, ich schaute wieder aus dem Fenster auf den Herbst und begann mich zu fragen, was Christoph davon halten würde, von der Soldatin und von Josis Aussagen, vielleicht auch von Josi generell, wenn sie sich treffen würden. Ich erinnerte mich, dass ich früher oft abgewartet hatte, was Christoph für eine Meinung haben würde, bis ich mir eine eigene bilden wollte. Ich fand das damals sehr unsympathisch an mir. An dem frühen Abend im Zug nach Ulm spürte ich aber, dass ich wieder unterwegs war in den Einzugsbereich seiner Gedanken und Ansichten, was mir ein gutes Gefühl gab. Ich wurde ganz ruhig und legte das Buch weg, schaute mich im Wagen um und sah den Leuten ins Gesicht. Ich fand, sie sahen ahnungslos aus. Etwas würde sich verändern. Ich weiß nicht, woher genau ich diesen Glauben nahm, aber ich dachte, ich sei Teil einer sehr kleinen Gruppe, die von dieser Veränderung bereits wusste. Und ich war unterwegs, um meinen Beitrag zu leisten.
Als ich in Ulm aus meinem Zug ausstieg, war von dem abendlichen Sonnenlicht nichts mehr übriggeblieben. Der Himmel war dunkelblau, an den Autos waren die Scheinwerfer angestellt, und in den Häusern und Geschäften brannte Licht. Es war noch nicht richtig Nacht, obwohl die Sonne schon untergegangen war. Es handelte sich wohl um die sogenannte blaue Stunde. Ich sah, als ich den Bahnhofplatz überquerte, in den Fenstern der Häuser Menschen an Schreibtischen sitzen oder Wäsche aufhängen oder mit einem Telefon am Ohr eine Zigarette rauchen. Ich weiß noch, dass ich an diesem ersten Abend in Ulm bemerkte, wie sehr mir das jedes Jahr gefällt, wenn sich das öffentliche Leben auf den Straßen in die Häuser hinein verbreitert, weil überall Licht an ist und man den Leuten in die Wohnungen schauen kann. Es wird garstig in den Straßen, und gleichzeitig sind sie zu beiden Seiten behängt mit diesen orangefarbenen Kurzfilmen der häuslichen Privatheit.
Ich lief, wie es mir beschrieben worden war: Über den Bahnhofplatz und die Friedrich-Ebert-Straße in die Bahnhofstraße, dann links in die Ulmergasse, vorbei am Roten Löwen, dann rechts in die Walfischgasse. Ich ging durch den verkehrsberuhigten Einkaufsbereich der Innenstadt, in Richtung Münster, das über den Dächern aufragte, wieder verschwand, wenn ich abbog, und dann wieder auftauchte. Ich ging über feucht schimmerndes Kopfsteinpflaster und an den üblichen, immergleichen Franchisegeschäften vorbei, an Orsay, Pimkie, Wöhrl, H&M, Burger King, New Yorker, Drogeriemarkt Müller, Deichmann, Peek & Cloppenburg, Galeria Kaufhof, Fielmann, Asia-Snack-Läden mit Wasserlilien-Fototapeten und beigefarbenen Plastikmöbeln, an einem Büro der Allianzversicherung, einem Lush Seifengeschäft, Nanu-Nana, dm und Blume 2000. In meinem Kopf war ein altbekannter Monolog über die Modularisierung der Innenstädte und die Verödung und Kulturvernichtung bereits abspielbereit vorhanden, und trotzdem, obwohl mein Blick unbarmherzig umherging zwischen den Ladengeschäften und den in diesen Ladengeschäften einkaufenden Menschen, öffnete sich nicht wie gewohnt die schwarze Blüte des Ekels und der Ablehnung in meinem Gesicht. Stattdessen war ich ganz gelassen und immer noch leicht euphorisch wie vorher im Zug. Ein Zitatsplitter aus einem Buch kam in mir hochgespült. Ich konnte mich damals nicht erinnern, welches Buch es war, heute weiß ich es wieder, aber es spielt auch keine Rolle. Jedenfalls dachte ich, anstatt mich aufzuregen oder zumindest das traurige Urteil leise zu verlesen:
Alle hundert Meter verändert sich die Welt. Dass ein Ort wie der andere sein soll, ist eine Lüge. Die Welt ist wie ein Beben.
Ich erreichte die Adresse, die mir Christoph am Handy durchgegeben hatte. Es handelte sich um eine Bar-Café-Restaurant-Cocktaillounge mit bodentiefen Fenstern, die im Sommer wahrscheinlich komplett geöffnet wurden. Vor den Fenstern standen zusammengeschobene und mit Ketten verschlossene Freisitzmöbel und zusammengeklappte Ramazzotti-Sonnenschirme auf einem ein Stück weit in den Bürgersteig hineingebauten Podest aus Holz. Über der Eingangstür hing ein weißes Schild, das von der Warsteiner Brauerei gesponsert war. Auf ihm stand in schwarzen Buchstaben und einer billig wirkenden Schriftart der Name Nach(t)schub, den ich am Telefon natürlich nicht als das Wortspiel verstanden hatte, als das er sich mir jetzt darstellte.
Ich betrat das Lokal, ein Gewimmel aus Stimmen und Gelächter, es lief auch Musik, eine Frauenstimme und ein synthetischer Beat, wahrscheinlich, dachte ich gleich, Internetradio oder ein vorgeschriebener Mix, auf dessen Ablauf und Lautstärke die Kellner keinen Einfluss hatten, die sehr gestresst zwischen den engstehenden Tischen hindurchliefen, mit schwarzen Hemden und schwarzen Kellnerschürzen, auf die ebenfalls der Schriftzug der Warsteiner Brauerei aufgedruckt war. Die Kellner sahen alle sehr jung aus. Zuerst sah ich nur Männer mit Marco-Reus-Frisuren und Holzringen in den Ohrläppchen. An der Theke stand aber noch sehr aufrecht eine Frau, die einen Pferdeschwanz trug, der von einem pinken Plüschhaargummi zusammengehalten wurde. Die Einrichtung des Nach(t)schub bestand aus dunkelbraunen Einheitsmöbeln, schwer aussehende Tische und Kunstlederstühle mit hohen Lehnen. Auf den Tischen standen kleine Gestecke aus Perlen und Tüll und silbern lackierten Rosenblüten, die ein Teelicht umrahmten. Außerdem Metallständer für die laminierten Menükarten, die zu jedem Cocktail und jedem Gericht ein Foto enthielten. Fast alle Tische waren besetzt, und wo Menschen saßen, wurde sehr laut geredet. Hinter der Bar waren Glasregale vor einer milchigen Scheibe angebracht, die innen mit Schwarzlicht beleuchtet wurden und Flaschen aller möglichen Absolut Vodka Geschmacksrichtungen enthielten. An einer der Wände, die in einem kräftigen Orange angestrichen waren, hing eine Leuchtreklame für Sierra Tequila und eine Art Relief-Schild, aus dem ein Leguan und der Schriftzug Desperados hervortraten. Ich fühlte mich elend und suchte den Raum nach etwas Vertrautem ab, schaute, ob Christophs Gesicht irgendwo in einer der Gruppen zu sehen war. Ich wurde von einem Kellner gegrüßt, der ein Tablett voll leergetrunkener Weizengläser zur Bar brachte, und ich grüßte zurück, als er mich schon gar nicht mehr hören oder sehen konnte. Meine Stimme war ganz leise und belegt und ging völlig unter. Eigentlich spürte ich nur in meinem Hals, dass ich etwas sagte. Es war noch nicht mal für mich selbst zu hören.
Christoph konnte ich nirgendwo entdecken. Ich hatte ihn ja in seinem fiesen Film sofort erkannt, obwohl er verkleidet gewesen war, also ging ich davon aus, dass ich ihn auch hier nicht übersehen würde. Ich lief durch das Lokal, an der Bar vorbei in einen Durchgang, der zu einem schmalen Flur führte, von dem Toilettentüren abgingen, die mit Chicas und Señores beschriftet waren, und in dem ein Zigarettenautomat mit Touch-Display stand, wo die verschiedenen Packungen vor einer fiktiven Skyline angeordnet waren. Dann ging ich zurück ins Lokal und schaute mir nochmal jedes Gesicht an jedem Tisch an. Keine der Gruppen sah so aus, als wäre sie hier zu einer konstituierenden Sitzung für ein Horrorfilmprojekt zusammengekommen. Ich ging nach draußen auf die Straße und schaute mir den Laden von außen an. Die Geräusche wurden dumpfer, als die Tür hinter mir zufiel, waren aber trotzdem noch zu hören. Auf den Zettel, auf dem ich mir die Adresse und die Wegbeschreibung notiert hatte, brauchte ich nicht zu schauen, weil ich ja bereits vor dem Nach(t)schub stand, in der beschriebenen Gasse. Ich schaute mich um, ob es vielleicht in einem der anderen Häuser eine zweite Filiale gab, aber da waren nur Geschäfte und private Hauseingänge. Eine ganze Weile stand ich vor dem Laden und wusste nicht weiter und war davon ganz gelähmt. Ich hatte mein Rückfahrticket nach München schon gebucht und hätte jederzeit zum Bahnhof zurücklaufen und auf den nächsten Zug warten können. Ich rief Christoph auf seinem Handy an, es klingelte ein paar Mal, dann schaltete sich eine automatische Ansage ein, die mir sagte, dass er nicht erreichbar sei. Eine Mailbox hatte er offenbar nicht eingerichtet, jedenfalls gab es kein Signal, nach dem ich eine Nachricht hätte hinterlassen können.
Ich ging nochmal rein und direkt zum Tresen, wo ich eine Weile warten musste, bis mir der Junge, der an der Bar arbeitete und in großer Hast Getränke zubereitete, die bei ihm von den Kellnern mit Bons aus der elektrischen Kasse bestellt wurden, sein Ohr hinstreckte mit einer zur Muschel geformten Hand. Ich fragte ihn, ob hier von einem Christoph Raub reserviert worden sei, ich suche nach einer größeren Gruppe. Der Junge sagte: keine Ahnung, hielt ein Bierglas unter den Zapfhahn und deutete mit dem Gesicht an das Ende der Bar, wo die Frau mit dem Haargummi gerade die Kasse bediente. Ich ging zu ihr und fragte nochmal, ob es eine Reservierung gebe für eine größere Gruppe oder jemanden namens Raub oder Christoph, aber die Frau sah mich nur an mit einem übertrieben leidvollen Gesicht und sagte, es tue ihr leid, es sei sehr voll. Dann nahm sie ein Tablett auf, das von dem Jungen hinter der Bar mit Getränken bestückt worden war, und ging zu einem Tisch, an dem ein paar Männer laut aufgrölten, als sie dort ankam.
Auf meinem Handy war keine Nachricht eingegangen, es hatte auch niemand versucht, mich anzurufen. Ich fing an, mich verlassen und verarscht zu fühlen. Ich wollte mich nicht allein im Nach(t)schub an einen Tisch oder an die Bar setzen. Ich wollte grundsätzlich nicht im Nach(t)schub sein. Ich wollte, dass Christoph durch die Tür kam und sich alles aufklärte. Aber jedes Mal, wenn sie aufging, erschien nur wieder eine neue Figur, die zwar gut ins Lokal passte, aber unmöglich zu der Gruppe gehören konnte, die ich hier suchte. Ich wurde abwechselnd wütend und ängstlich und realisierte relativ bald, dass ich nicht die ganze Zeit mitten in dem vollen Lokal herumstehen und warten konnte, ohne mich immer schäbiger zu fühlen. Dann ging ich nochmal in den Flur zu den Toiletten, weil ich mir irgendwie dachte oder vielleicht einredete, dass sie ja alle gerade auf dem Klo sein könnten. Und dann sah ich, als ich den Flur ein Stück weit entlanggelaufen war, dass sich hinter dem Zigarettenautomaten und den Toilettentüren, am Ende des Flures, eine Tür befand, die mir vorher nicht aufgefallen war, weil ein großer Stahlschrank den Blick auf sie verdeckt hatte. Die Tür war ebenfalls aus Stahl, sie sah so aus, als führte sie in einen Heizungsraum oder ein Getränkelager. Ein handgeschriebener Zettel war mit Klebeband an ihr befestigt. Auf dem Zettel stand: Zutritt STRENG verboten.
Im Nachhinein denke ich mir, dass das der Punkt war, an dem ich mich noch dagegen hätte entscheiden können. In dem Moment habe ich das aber gar nicht als das Angebot wahrgenommen, das es ja vielleicht war, umzukehren und nach Hause nach München zu fahren. Ich schaute auf den Zettel, und was genau es war, kann ich heute nicht mehr sagen, aber ich sah das in Großbuchstaben geschriebene Wort STRENG und wusste, dass es eine Nachricht für mich enthielt. Es war, als ob die ausgestellte Betonung die Bedeutung des ganzen Zettels aufhob. Und als wäre es eine Art Eintrittsprüfung, dieses Wort als das zu erkennen, was es tatsächlich war: eine Einladung.
Damals dachte ich mir, dass ich ein Rätsel durchschaut hätte. Und auf einmal ergab das ganze Rumstehen und das langsame Verzweifeln im Lokal einen Sinn und fühlte sich gar nicht mehr schrecklich an. Ich drückte die Klinke der Stahltür nach unten, sie war nicht abgeschlossen, schob sie auf und betrat den Gastraum, der in den kommenden Monaten der Ort unserer Treffen werden würde.
Es ergab sich sofort ein komplett anderes Bild als im vorderen Teil des Lokals. Das Licht war nicht wirklich gemütlich, es war weiß, wie von Neonröhren, aber es kam irgendwie aus den Ecken und aus unzureichenden Quellen, sodass es trotzdem noch schummrig war. In dem Raum lag ein Dunst, wahrscheinlich von Zigaretten, aber auch von Staub, es roch nach alten Holzmöbeln und Kneipenfußboden. Vielleicht zwanzig oder dreißig Menschen saßen an schwarzlackierten Holztischen, die überall abgestoßen und runtergearbeitet waren. Kleine Plastikhalter mit Bierdeckeln und große Aschenbecher standen auf den Tischen. Es gab eine sehr schöne Bar mit einem Zapfhahn aus Messing und einem Holzregal dahinter, das voller Gläser stand. Oberhalb des Regals war ein Schild an die Wand geschraubt, das so aussah, als hätte es jahrzehntelang im Freien gehangen. Auf dem Schild stand: Café Porsche.
Hinter der Bar befand sich ein dicker Mann mit grauem Vollbart, dem ein weißes Geschirrtuch über der Schulter hing. Er rauchte eine Zigarette. Ich sah Christoph, der am anderen Ende des Raumes an dem Verstärker einer Musikanlage herumdrehte. Er hatte ein Mikrofon in der Hand und wirkte sehr konzentriert. Die Leute an den Tischen unterhielten sich, Frauen und Männer zwischen dreißig und fünfzig, sofort kamen sie mir vor wie die Gesellschaft, nach der ich die ganze Zeit gesucht hatte, nicht nur an diesem Abend. Einige hatten Biergläser vor sich, manche tranken Cola oder Orangensaft oder Wasser. Es wurde nicht sehr viel geraucht. Ein paar Leute schienen mir ebenfalls niemanden zu kennen, sie saßen und schauten auf Christoph oder in den Raum oder lasen in einem Buch oder einer Zeitung.
Am hinteren Ende des Raumes, dort, wo Christoph an dem Verstärker herumdrehte, führten drei Stufen auf eine kleine Bühne hinauf, die von einem schwarzen Vorhang eingefasst war und an deren Rückwand ich noch zwei Fensteröffnungen erkennen konnte, die zugenagelt und schwarz überstrichen waren. Vor dieser Bühne hatte jemand angefangen, ein paar Sitzreihen aufzustellen, später brachten die Leute noch die Stühle von ihren Tischen mit und stellten sie ebenfalls in die Reihen. Ich sah auch hohe Stuhlstapel an einer anderen Wand und große Aluminiumfässer, auf denen zusammengeklappte Biertische lagerten. Es lief keine Musik. Wenn man sich anstrengte, konnte man dumpf noch die Geräusche aus dem Nach(t)schub hören. Aber es klang sehr weit weg, wie aus einem anderen Haus.
Christoph schaute einmal kurz von seiner Arbeit an dem Verstärker auf und durch den Raum, und unsere Blicke trafen sich. Er nickte mir zu und lächelte, deutete mit dem Kopf in Richtung Bar, was wohl bedeutete, dass ich mir etwas zu trinken holen sollte. In seinem Blick und in seinen Gesten war sofort wieder diese Selbstverständlichkeit zu spüren, wie schon am Telefon. Mir war gleich klar, dass er sich gerade innerlich vorbereitete, auf eine Ansprache wahrscheinlich, und dass ich jetzt besser nicht zu ihm ging, dass es günstiger war, einen späteren Zeitpunkt abzuwarten, um ihn richtig zu begrüßen und zu sagen, dass es mich freute, von ihm hierfür ausgewählt worden zu sein, denn es fühlte sich ja bereits wie ein Auserwähltsein an, obwohl es zu dem Zeitpunkt überhaupt keine objektiven Anzeichen dafür gab.
Ich bestellte ein Glas Bier bei dem Mann mit dem grauen Bart und fragte ihn, ob das hier sein Laden sei. Der Mann mit dem grauen Bart sagte, ja, das ganze Teil gehöre ihm, vorne werde die Kohle gemacht, und das hier hinten, das sei sozusagen übriggeblieben aus einer besseren Zeit. Früher war das alles, sagte er und machte eine entsprechende Geste in den Raum. Da gab es nur das Café Porsche. Aber das Haus sei irgendwann saniert worden, und die Mieten in der Innenstadt könne man sich heute nicht mehr leisten, mit so einem Laden wie seinem. Da vorne, er zeigte durch die Wand auf das Nach(t)schub, würde ich selbst niemals reingehen. Ich habe die Läden studiert, die hier richtig gut laufen, und habe sozusagen aus der Distanz einen richtig gut laufenden Laden nachgebaut, der jetzt selbst richtig gut läuft und ordentlich abwirft. Ich habe da aber noch kein einziges Bier ausgeschenkt. Das hier ist jetzt mein Modell: Der Laden, den ich nie wollte, finanziert den Laden, den ich immer wollte. Irgendwie ist das auch befriedigend. Ich sehe es als eine Art Kulturschutzsteuer. Ein Reservat der Trinkkultur. Dafür bezahlen doch am besten die, die für den ganzen Niedergang verantwortlich sind, oder nicht?
Ich bemerkte erst nach ein paar Sekunden, dass ich zur Zustimmung aufgefordert war und gerade eingemeindet wurde, in eine aussterbende Art, die im Begriff war, ihre Selbstverteidigung zu organisieren. Mir war das unangenehm. Ich gratulierte dem Betreiber des Café Porsche, dem Hubi, wie ich dann später erfuhr, und prostete ihm zu, auf die Trinkkultur oder auf etwas ähnlich Blödes, dann gab es ein kurzes Fiepen und ein Räuspern, die Gespräche brachen ab, und Christoph sagte: Guten Abend! Auf eine so feierliche Art, dass ich mir doch gleich wieder gerne vorstellte, Teil eines Ganzen zu sein, das über mich selbst hinausging.
Wir sind hier, sagte er, weil wir einen Film machen wollen.
Wir wollen diesen Film gemeinsam machen, von Anfang an.
Der Arbeitstitel unseres Films lautet:
Das Schreckliche Grauen
Gelächter setzte ein unter den anderen, als wäre gerade ein Witz erzählt worden. Ich verstand nicht. Ich fand das nicht lustig. Ich fing an, mich zu fragen, ob mir vielleicht entscheidende Informationen fehlten. Ob die anderen mehr wussten als ich. Ob es bereits Vortreffen gegeben hatte, zu denen ich nicht eingeladen worden war und wenn, fragte ich mich, warum.
Das Genre, sagte Christoph, noch in das abflauende Gelächter der anderen hinein, das Genre unseres Films ist der Horror. Und der Grund, sagte er, weshalb wir uns dafür entschieden haben (und da war ich mir dann sicher, dass einige oder vielleicht sogar alle im Raum schon vorher ohne mich zusammengekommen waren), ist das fundamentale Problem unserer Gesellschaft: die Angst. Ein paar Leute nickten. Die Angst, die den Menschen in diesem Land in der Brust sitzt und im Bauch und im Nacken (Christoph fasste sich mit der flachen Hand an die entsprechenden Körperpartien, während er sprach), diese Angst ist der Motor, der das Schiff, das unsere Gesellschaft ist, antreibt, auf dem Ozean des Leidens, der Ignoranz, der Brutalität und der Kälte. Der Normalzustand unserer Gesellschaft in dieser Zeit ist der Horror. Niemand kann mir weismachen, er könnte in einer gewöhnlichen Wohnsiedlung in Deutschland abends in die beleuchteten Küchen und Wohnzimmer hineinschauen und etwas anderes dort sehen als den blanken Horror. Die Angst ist überall, und alles, was wir tun, ist von ihr bestimmt. Sie ist der Subtext der Gespräche, in der U-Bahn, im Supermarkt und an den Theken der Lokale. Sie regiert die Regierungen, die uns regieren. Sie bestimmt die Märkte und die Erziehung unserer Kinder. Einen Horrorfilm zu drehen, einen Film, der sich die fundamentalen Ängste der Menschen zur Grundlage nimmt, ist in dieser Zeit und in diesem Land, das wir bewohnen, keine Frage der Unterhaltung. Es ist eine Dokumentation. Wenn wir heute einen Horrorfilm drehen, legen wir ein Zeugnis unserer Zeit ab. Wir machen kein Drama und keine Komödie, weil wir nicht mehr daran glauben, dass unser Zustand sich in eine solche Handlung übersetzen lässt. Dem Theater unserer Zeit ist im Vollmond ein Fell gewachsen, es grunzt und schnaubt, und an seinen Fingern trägt es lange gelbe Nägel. Am Ende wird nicht getanzt, es sei denn auf den glühenden Resten unserer Städte, knöcheltief in den Eingeweiden ihrer Bewohner, in den Scherben, die man uns lässt.
Die Art, wie Christoph seine Ansprache vortrug, war offenkundig allen im Raum hochsympathisch. Er wirkte nicht wie ein Prediger, sondern wie jemand, der gekommen war, um ein Anliegen vorzubringen. Nicht untertänig, aber eben auch ohne Herrscher- oder Führergeste. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir folgt, weil ich euch hierfür brauche, vielleicht könnte man das, was zwischen seinen Worten im Café Porsche noch mitklang, so übersetzen. Aber in Wirklichkeit war es natürlich gar nicht zu übersetzen. Ich machte mir vielleicht auch da schon etwas vor.
Der Gegenstand der Angst, sagte Christoph nach einer Denkpause, die vielleicht künstlich war, aber sehr authentisch wirkte, ist das Andere. Am größten ist die Angst vor dem Anderen in uns. Kürzlich habe ich den Satz gelesen: Angst ist die Erwartung von Schmerz. Die Schmerzen, die wir fürchten, mehr als sonst irgendetwas, verwandeln unseren eigenen Körper in etwas Fremdes, Feindliches, Unberechenbares. Aber darauf kommen wir später noch zurück. Der allererste Schritt auf dem Weg zu unserem Film ist jedenfalls die Erkundung des Anderen, das wir fürchten, in uns. Wir haben, das wisst ihr selbst, kein ausreichendes Budget für diesen Film. Das ist aber kein Problem. Kein Film hatte jemals ein ausreichendes Budget. Aber es bedeutet, für uns und für euch, dass ihr nicht nur Szenografen, Kameraassistenten, Kostümbildner, Runner, Setwächter, Fahrer, Köche, Stylisten, Toningenieure, Dramaturgen, Musiker und Schauspieler seid. Ihr seid darüber hinaus der Plot, die Protagonisten und der Ort des Geschehens. Dieser Film wird weit mehr als irgendein anderer vor ihm das Produkt einer gemeinsamen Anstrengung sein. Weil wir zuallererst, bevor wir überhaupt anfangen, einen Film zu machen, uns hier treffen werden, jede Woche, solange wie wir eben brauchen, und unsere gemeinsame Erfahrung auswerten.
Ich bin davon überzeugt, dass der Feind, gegen den sich unsere Kunst noch richten kann, in diesem Punkt in der Geschichte, kein irgendwie geartetes Außen mehr ist. Er ist nicht die USA oder der IS oder der BND. Er liegt irgendwo in uns verborgen, unter der Scham und unter den Ritualen und den Erzählungen von Erfolg und Individualität. Ich bitte euch nicht darum, ich fordere euch auf, hier gemeinsam mit allen anderen in den nächsten Wochen an dieser Stelle zu graben und das Material hervorzuholen, das schließlich der Rohstoff für unseren Film sein wird. Ich erwarte nichts weniger, als dass wir dadurch gemeinsam die produktive Kraft der Angst für uns nutzbar machen und sie als das begreifen, was sie im besten Fall eben auch ist: die Schwelle zum Anderen als dem wirklich Neuen.
Ein dicker Mann, der vorne in einer der ersten Reihen saß, hob seine Hand. Zuerst dachte ich, er hebe einen Tischtennisschläger hoch, dann sah ich aber, dass es seine Hand war, die von einem Gips oder einem dicken Verband umwickelt war und mit zwei Klettverschlussriemen an einer Schiene aus dunklem Plastik fixiert. Christoph erteilte ihm das Wort, und die Stimme des Mannes fragte, unverstärkt, aber deutlich vernehmbar, ob es denn überhaupt schon einen Zeitplan gebe. Das wäre vielleicht interessant für die Leute hier zu hören. Damit man weiß, worauf man sich einlässt, rein perspektivisch. Und Christoph sagte, das hänge nicht von ihm ab und sei jetzt noch nicht vorhersehbar. Den dicken Mann fragte er, ob er vorhabe, in den Urlaub zu fahren. Dann lachten wieder ein paar, was ich wieder nicht verstand. Und nochmals an alle gerichtet, sprach Christoph ins Mikrofon und sagte, die Konditionen müssten noch verhandelt werden. Es gehe jetzt erstmal darum, herauszufinden, wer bereit sei, sich dem Projekt anzuschließen. Er sei sich sicher, dass es einige ungeklärte Fragen gebe, er werde sie heute und an den kommenden Abenden sammeln und beantworten, sobald es ihm möglich sei. Zuerst mal sei es ihm wichtig, dass wir anfingen, miteinander zu sprechen. Wie dieses Mikrofon hier funktioniert, dürfte jedem bekannt sein. Es liegt hier, und hier hinten gibt es auch noch eine Bühne, falls jemand auf entsprechende Rahmung Wert legt. Ein Gemurmel erhob sich, Christoph legte das Mikrofon zur Seite und neigte sich zu einer Frau, die an einem der Tische saß und ihm etwas in einem Notizbuch zeigte, was ich von der Bar aus nicht erkennen konnte.
Mir war das alles noch viel zu wenig. Ich hoffte, dass das jetzt nur eine Pause war. Ein paar Leute standen auf, trugen ihre leeren Gläser zur Bar, bestellten frisches Bier. Ich hatte das Gefühl, im Weg zu stehen, und trat etwas zurück. Christoph war jetzt in die Hocke gegangen, neben der Frau mit dem Notizbuch, und ließ sich von ihr etwas erklären. Die Frau hatte einen Kugelschreiber in der Hand, mit dem sie kleine Löcher in die Luft bohrte, während sie sprach. Manchmal zog sie auch eine Linie, an deren Ende sie dann eine Weile stillhielt. Es sah so aus, als markierte und verband sie Punkte auf einer Karte, die nur sie und Christoph sehen konnten. Um mich herum wurden Gespräche begonnen. Ein paar waren nah genug, um das Gesagte zu verstehen, aber ich konnte mich auf keines lang genug konzentrieren, um wirklich zu erfassen, worum es ging. Ich war auch gar nicht neugierig. Ohne dass mir das wirklich bewusst war, stand ich da zwischen den anderen und fürchtete mich. Ich denke, hauptsächlich davor, gleich in einem ersten beliebigen Gespräch entlarvt zu werden als einer, der durch einen dummen Zufall in eine exklusive Gesellschaft geraten war, deren Regeln er nicht verstand.
Ich hatte mein Bier leergetrunken und war dankbar dafür, dass ich es bereits in meiner Blase spüren konnte. Das gab mir noch ein bisschen Zeit.
Ich trat aus dem Café Porsche zurück in den Flur, der es mit dem Nach(t)schub verbindet, ging zur Toilette und stand gerade an einem der Pissoire, als hinter mir die Tür aufging. Ein lautes Schnaufen war zu hören, dann stellte sich der dicke Mann mit der Gipshand neben mich und lächelte mich an. Er hob die eingegipste Hand vor sich in die Luft und öffnete mit der anderen seinen Gürtel. Er schaute mir direkt ins Gesicht, und dadurch, obwohl es mich ja gar nicht interessierte, aber weil dort die einzige Bewegung in der Situation stattfand, musste ich mich richtig anstrengen, um seinen Blick entweder zu erwidern oder geradeaus zu schauen und nicht auf seine Hand, die die Hose aufknöpfte. Der dicke Mann fragte mich, ob ich ihm vielleicht behilflich sein könnte. Seine Augen schauten kurz nach unten und dann auf die eingegipste Hand. Er sei hier so ein bisschen eingeschränkt. Ich muss sehr bescheuert ausgesehen haben in dem Moment. Ich war vollständig überfordert. Dann hörte ich es aber schon plätschern in der Schüssel vor dem dicken Mann, und fast zeitgleich setzte ein dreckiges Lachen ein, das aus seinem ganzen dicken Körper zu kommen schien.
Ich packte etwas zu hastig ein, spülte und ging zum Waschbecken. Der dicke Mann kam nach, als ich mir gerade die Hände abtrocknete. Er bediente den Seifenspender mit der Plastikschiene an seiner versehrten Hand, öffnete dann den Wasserhahn und wusch sich die eine Hand unter dem Strahl in einer Bewegung, die so aussah, als halte er eine große Murmel in ihr verborgen. Ich trat einen Schritt zurück vom Handtuchspender, um ihm Platz zu machen. Es handelte sich um einen dieser Stofftuchspender, bei dem man sich ein frisches Stück eines einzigen, langen Stoffhandtuchs herauszieht. Man muss mit beiden Händen an dem Handtuch ziehen, damit es sich bewegt. Der dicke Mann versuchte, mit seiner gesunden Hand abwechselnd links und rechts an dem feuchten Stück zu ziehen, mit dem ich mir zuvor meine beiden Hände abgetrocknet hatte. Aber es funktionierte nicht. Ich glaube, diese Spender haben einen Mechanismus eingebaut, der verhindern soll, dass sich in ihrem Inneren etwas verkantet. Nach ein paar Versuchen schaute mich der dicke Mann sehr traurig an und fragte, in einem fast kindlichen Tonfall, ob ich ihm jetzt nicht vielleicht tatsächlich helfen könnte. Ich zog mit beiden Händen ein frisches Stück Handtuch aus dem Spender, mit dem der dicke Mann dann wieder sehr geschickt umging. Dann reichte er mir seine frisch gewaschene Hand (es war die linke) und sagte, er heiße Markus. Nachdem ich seine Hand geschüttelt und mich selbst vorgestellt hatte, fragte ich, was ihm denn passiert sei. Markus zögerte einen Moment, schaute sich kurz in der Toilette um, in der außer uns niemand war, und erzählte mir dann, mit leicht gesenkter Stimme, die Geschichte seiner Gipshand.
Er war, erzählte er mir, vor etwa zwei Wochen mit Christoph und ein paar anderen in der Kneipe. Es wurde viel getrunken, und wir haben lange zusammengesessen. Wir haben die ganze Zeit diskutiert und gestritten, wobei keiner so eine richtig feste Position vertreten hat. Es ging einfach ums Diskutieren und Streiten. Irgendwann, als wir so eine ganz nichtige Allgemeinbildungsbanalität schon viel zu lange hin und her geschoben hatten, ist mir die Geduld ausgegangen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum es ging, so wurscht war es am Ende. Es war so etwas wie die Einwohnerzahl von China oder Indien oder so – es machte einfach keinen Spaß, darüber zu streiten, weil keiner die Antwort wusste, es aber eine gab. Weißt du, was ich meine? Und weil es so wurscht war und der Streit so langweilig, habe ich mein Smartphone rausgeholt und wollte es im Internet nachschauen. Christoph ist völlig übertrieben ausgerastet. Er hat mich angebrüllt und hat mir das Telefon aus der Hand gerissen, und dann hat er es auf den Tisch gelegt und mit seinem Bierkrug ausgeholt. Markus hob an dieser Stelle seine gesunde Hand, die zur Faust geballt war, auf eine besonders dramatische Art in die Luft. Ich habe nach dem Telefon gegriffen, das ist ja scheißteuer, das Teil, und inwiefern der Rest dann Absicht gewesen ist, kann man im Nachhinein halt nur noch schwer sagen. Aber eigentlich hätte er schon noch genug Zeit gehabt, zurückzuziehen.