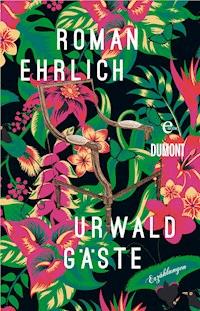19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Väter, Mütter und Dämonen – Roman Ehrlich beschreibt eine Jugend in den Neunzigern »Videotime«, so hieß die Videothek, in der Roman Ehrlichs Erzähler mit seinem Vater zahllose Filme auslieh, um sie zu Hause auf Leerkassetten zu überspielen. Es sind die neunziger Jahre in einer bayerischen Kleinstadt, deren scheinbar friedliche Ordnung vom Unheimlichen der Filme in ein anderes, fremdartiges Licht getaucht wird. Was zum Beispiel war damals mit den Vätern und Müttern los, die in Justizvollzugsanstalten oder Autohäusern arbeiteten und in ihrer Freizeit die eigenen Kinder auf dem Tennisplatz mit harten Drills trainierten oder hoffnungslos dem Zucker verfallen waren? Welche Rolle spielte man selbst dabei, wenn man jung war und die eigene Welt nur so zu wimmeln schien von Außerirdischen und Besessenen? »Videotime« ist eine Geschichte in auffallend schöner Sprache über die Gesichter und Leerstellen, die sich hinter unseren Masken und Selbstbildern verbergen. Ein beeindruckender, mit großer Souveränität erzählter Roman, der die Frage aufwirft, in welcher Zeit und Welt wir eigentlich leben – und in welcher Haut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Ähnliche
Roman Ehrlich
Videotime
Über dieses Buch
»Videotime«, so heißt die Videothek, die Roman Ehrlichs Erzähler in seiner Kindheit regelmäßig mit seinem Vater aufsucht, um dort zahllose Filme auszuleihen und sie zu Hause auf Leerkassetten zu überspielen. Es sind die neunziger Jahre in einer bayerischen Kleinstadt, deren scheinbar friedliche Ordnung vom Unheimlichen und Phantastischen der Filme in ein anderes, fremdartiges Licht getaucht wird. Der Junge bekommt mehr und mehr das Gefühl, dass die Familien aus den Filmen denen aus seiner direkten Umgebung verwandt sind – sein Alltag scheint von Dämonen, melancholischen Untoten und Außerirdischen nur so zu wimmeln. Jahrzehnte später kehrt der Erzähler in die Kleinstadt zurück. Die Eltern haben sich getrennt, die Orte seiner Kindheit sind verschlossen oder gänzlich verschwunden. Allein in den Filmen aus der Sammlung seines Vaters scheint die Möglichkeit auf, doch noch einen Zugang zur eigenen Vergangenheit zu finden. »Videotime« ist eine Geschichte über Liebe und Verantwortung, über das Verschwinden, über Gewalt und die Macht des bösen Blicks, den Prozess des Erinnerns und die Gesichter und Leerstellen, die sich hinter unseren Masken und Selbstbildern verbergen. Ein Roman von großer Souveränität, der die Frage aufwirft, in welcher Zeit und Welt wir eigentlich leben – und in welcher Haut.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Roman Ehrlich, geboren 1983 in Aichach, aufgewachsen in Neuburg an der Donau, studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und an der Freien Universität Berlin. Bislang sind von ihm die Bücher »Das kalte Jahr« (2013), »Urwaldgäste« (2014), »Das Theater des Krieges« (2017, mit Michael Disqué) und »Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens« (2017) erschienen. 2020 erschien sein Roman »Malé«, der auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand.
Inhalt
[Motto]
Aus: Total Recall [...]
Aus: Videodrome (1983)
Aus: The Neverending [...]
Aus: What Dreams [...]
Aus: The Devil [...]
Aus: The Devil [...]
Aus: Videodrome (1983)
Aus: Hitman Hart: [...]
Aus: Total Recall [...]
Aus: Crash (1996)
Aus: The Thing [...]
Aus: Universal Soldier [...]
Aus: The Thing [...]
Aus: Who Framed [...]
Aus: The Thing [...]
Aus: They Live [...]
Aus: They Live [...]
Aus: They Live [...]
Aus: Who Framed [...]
Aus: Videodrome (1983)
Aus: Crash (1996)
Aus: Natural Born [...]
Aus: Natural Born [...]
Aus: Natural Born [...]
Aus: Videodrome (1983)
Aus: Total Recall [...]
Aus: Total Recall [...]
Aus: Hitman Hart: [...]
Aus: Possession (1981)
Aus: Possession (1981)
Aus: Crash (1996)
Aus: Crash (1996)
00:00'00''
Aus: Total Recall (1990)
Die Verleihvideothek Videotime ist aus der fensterlosen Blechbaracke, in der mein Vater und ich sie jahrelang aufgesucht haben, verschwunden. Der große Schriftzug auf dem Dach, der abends von zwei Baustrahlern angestrahlt wurde und verheißungsvoll leuchtete, wurde abmontiert. Die separaten Eingangstüren für Familien- und Erwachsenenvideothek sind verschlossen.
Auf dem Parkplatz vor der Blechbaracke, die jetzt eher aussieht wie ein Lager für Maschinenteile, in der ich mir aber gerne noch einen ähnlich magischen Ort vorstellen möchte wie den, den ich jahrelang mit meinem Vater besucht habe – ein Noctarium vielleicht oder ein Labor zur Aufzucht psychoaktiver Pilze –, ist ein verbeulter Container für Bauschutt abgestellt, aus dem oben Fetzen blauer Müllsäcke herausragen, die im leichten Wind, der über den Parkplatz geht, leicht rascheln. Ein alter Passat mit abgeschraubten Nummernschildern ist in einem halbschattigen Winkel des Platzes zwischen Gestrüpp, das aus den Rissen im Asphalt wächst, permanent geparkt. An einen Baum gelehnt stehen ein paar rostige Fahrräder aneinandergeschichtet und mit einem langen Stahlseil zusammengeschnürt.
Die Einfahrt zum Parkplatz vor der fensterlosen Blechbaracke der ehemaligen Verleihvideothek geht von einer verkehrsberuhigten Wohnstraße am Stadtrand ab. Das Leuchten des Videotime-Schriftzugs war von der Straße aus von Bäumen und Hecken und Wohnhäusern verdeckt. Erst wenn man in die Einfahrt zum Parkplatz einbog, leuchtete einem das angestrahlte Schild entgegen. An der Straße selbst wies nichts auf die Videothek hin. Man musste schon wissen, dass sie da war.
Mir erschien das angestrahlte Schild auf dem Dach der Baracke, wenn mein Vater und ich mit dem Auto absichtsvoll und zielgerichtet in die Einfahrt einbogen, um auf den Parkplatz zu fahren, jedes Mal aufs Neue wie die feierliche Versicherung, dass die Videothek noch da war, für uns, ihre Stammkundschaft, dass sie geöffnet hatte, dass noch mehr neue Filme eingetroffen waren, die ausgeliehen und zu Hause angeschaut werden konnten. Ich war jedes Mal wieder in aufgeregter Erwartung, wenn mein Vater den Blinker setzte, um von der verkehrsberuhigten Wohnstraße in die Einfahrt abzubiegen, und euphorisch, nervös gespannt, wenn uns der Schriftzug nach dem Abbiegen entgegenleuchtete.
Ich erinnere mich an den Innenraum unseres Autos, die verkehrsberuhigte Wohnstraße vor der Windschutzscheibe im gelben Licht der Straßenlaternen, das in einzelnen, langgezogenen Reflexen über die Motorhaube wanderte. Innen die schwach leuchtenden Armaturen, mein Beobachten der lenkenden Hände meines Vaters aus dem Augenwinkel, vom vorüberziehenden gelben Licht der Laternen durch die Scheibe beschienen, pulsierend in diesem Licht, als dränge es von innen gegen die Haut. Mein Wissen, dass etwa zwanzig Meter vor der Einfahrt der Mittelfinger der linken Hand meines Vaters den Hebel nach oben schieben und ein grüner Pfeil zwischen Tacho und Drehzahlmesser aufleuchten würde. Sofort auch das akustische Signal des Blinkens, das elektronische Klacken, dessen kalte Bestimmtheit mir immer angenehm war, weil es das Abbiegen mit jeder Wiederholung zwingend einforderte und ein Vorbeifahren an der Einfahrt, wenn der Blinker einmal gesetzt war, sicher ausgeschlossen werden konnte.
Später ist mir aufgefallen, wie dieses Klacken in seiner rhythmischen Unnachgiebigkeit in verschiedenen Filmen eingesetzt wurde, um auf dramatische Weise menschliches Versagen oder gescheiterte Versuche des Entkommens zu inszenieren. Wenn zum Beispiel nach schweren Unfällen oder Drive-By-Shootings nur noch dieses monotone, unbeirrte Klacken des Blinkers im stehenden Fahrzeug zu hören ist, ohne Musik oder Hintergrundgeräusche, Signalgeber für einen Abbiegevorgang, der niemals stattfinden wird.
Auf meinem Schoß befanden sich auf diesen Fahrten die neutralschwarzen Plastikhüllen mit den zurückzubringenden VHS-Kassetten darin, die wir beim letzten Mal ausgeliehen und zu Hause angeschaut oder zumindest auf Leerkassetten überspielt hatten, um sie der umfangreichen Piratenvideothek meines Vaters hinzuzufügen. Für diese Raubkopiervorgänge hatte mein an sich vordergründig weitestgehend gesetzestreuer Vater, der als Vollzugsbeamter im Mittleren Dienst in der Justizvollzugsanstalt am Stadtrand angestellt war, vom befreundeten Fernsehtechnikermeister Bernd Letterau eine Kombination aus Abspiel- und Aufnahmegeräten in den heimischen HiFi-Schrank eingebaut bekommen, die hochwertig und zuverlässig waren, aber vor allem alt genug, um den Kopierschutz auf den Leihkassetten zu umgehen, da sie ihn wohl schlicht noch nicht erkannten mit ihren alten Abtastköpfen.
Letterau spielte im selben Verein in der Ü40-Herrenmannschaft Tennis, in dem mein Vater sowohl ehrenamtlich als Platzwart tätig war als auch regelmäßig meinen Bruder mit harten Drills trainierte, zu der Zeit, in der mein Bruder als Kind und Jugendlicher überregionale Hoffnungen geweckt hatte, von einem Sportausstatter mit Ausstattung gefördert wurde und geringe Summen bei Preisgeldturnieren gewann, was die Hoffnungen, die Ambitionen und die Erwartungen vor allem meines Vaters mit jedem Erfolg ein wenig steigerte und sich wiederum in noch härterem, anspruchsvollerem Training niederschlug und schließlich in eine Stressfraktur im Schlagarm meines Bruders mündete, die ihn wochenlang außer Gefecht setzte und hinterher nie wieder zu alter Form zurückfinden ließ, zu dem erbarmungslosen Durchschwingen ohne Angst, das seinen Spielstil von Anfang an geprägt und seine Gegner eingeschüchtert hatte.
Die Videothek war ein Raumschiff, das in der Kleinstadt, in der Wohnsiedlung am Stadtrand, gelandet war. Und es brachte den Kleinstadtbewohnern Nachrichten aus phantastischen Welten: fremde Orte, verstörende Bilder, Gewalt, Sex, Sternenkrieg, Dinosaurier, schnellen Witz und unendlichen Verweisreichtum, den ich nicht fassen konnte, vielleicht nie würde fassen können und umso mehr angezogen wurde, zurückwollte, mehr schauen, mehr gezeigt bekommen, was sich anderswo abspielte, wo der Verkehr nicht beruhigt war und das Leben entsprechend entfesselt.
Der Schatten, den die leerstehende Blechbaracke auf den Parkplatz wirft, zieht sich zum Gebäude hin zurück. Der permanent zwischen das Gestrüpp geparkte Passat steht jetzt schon zu mehr als der Hälfte in der Sonne dieses späten Vormittags. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass mein Vater in seiner Wohnung zu dieser Tageszeit wach vor dem Fernseher sitzt. Ich könnte zurückgehen zu seinem Haus und diesmal wirklich die Stufen hoch zu seiner Wohnung im zweiten Stock, klingeln und warten, ob er mir öffnet.
Das Glas der Frontscheibe und der vorderen Seitenfenster des Passats ist von innen beschlagen. Entweder ist der Innenraum feucht geworden, weil die bemoosten Türabdichtungen nicht mehr richtig schließen, und diese Feuchtigkeit verdunstet jetzt im warmen Sonnenlicht von den Armaturen und aus den Sitzpolstern gegen die Scheiben, oder jemand hat da drin übernachtet, geatmet, geschwitzt, liegt vielleicht jetzt noch da, denke ich, und wälzt sich. Ein Windstoß raschelt an den Fetzen der blauen Müllsäcke im verbeulten Bauschuttcontainer und bewegt die Haare auf meinem Kopf.
Zu der Zeit, als der Videotime-Schriftzug noch auf dem Dach der Baracke leuchtete, vor der ich, die schwarzen Plastikhüllen auf dem Schoß, mit dem Abschnallen so lange wartete, bis auch mein Vater sich abschnallte, nachdem er die Handbremse angezogen und seinen Schlüsselbund vom Zündschloss abgezogen hatte, mit der linken Hand den quer über die Brust verlaufenden Gurt fasste und mit dem Daumen der rechten Faust, aus der vorne der Zündschlüssel herausragte, den Öffner am Gurtschloss drückte, war der Parkplatz vor der Videothek ein in den Abendstunden häufig frequentierter Treffpunkt für die Stadtrandproleten der Kleinstadt, die sich dort gegenseitig ihre getunten Kleinwagen präsentierten, ihre Sportfahrwerke, Niederquerschnittreifen, Alufelgen, Rennlenkräder, verchromten Endrohrblenden, Heckspoiler und Wabengitterfrontschürzen. Sehr beliebt war unter den Kleinstadttunern dieser Zeit der Böse Blick, bei dem die Frontscheinwerfer mit zwei abgeschrägten Plastikstreifen so verblendet wurden, dass die Kleinwagen, wenn man vor ihnen stand und sich ihre Vorderansicht als Gesicht vorstellte, wütend wirkten. Die Stadtrandproleten wollten wohl so der latenten Niedlichkeit des Designs ihrer Kleinwagen entgegenwirken.
Das Innere der Verleihvideothek Videotime war zu jeder Tageszeit künstlich beleuchtet. An den Wänden im Eingangsbereich hingen Filmplakate, und der Boden war mit tiefdunklen, stets makellos sauber und neu wirkenden Teppichfliesen ausgelegt. Links vom Eingang ging ein kleiner Raum für Videospiele und Konsolen ab, nach rechts gelangte man in den langen Gang, der durch die Filmregale hindurchführte. Die Filmplakate am Eingang wurden zwar regelmäßig ausgewechselt, wenn ich aber daran denke, wie ich mit meinem Vater durch die Tür ins Innere eingetreten bin, sehe ich an der Wand, die der Eingangstür gegenüberliegt, immer dasselbe Plakat hängen: Total Recall – Die totale Erinnerung. Das angeschnittene Gesicht Arnold Schwarzeneggers in kalten Blautönen, das sich zur Mitte des Posters auflöst in die Dunkelheit des Alls mit den weißen Punkten der von unendlich weit her leuchtenden Sterne und dem Aufforderungstext: »Mach Dich bereit für die Reise Deines Lebens«.
Es gab nur einen einzigen Weg durch die Regalreihen, der mehrmals abknickte und einen am Ende am Verleihtresen entließ, wo man die bunten Plastikmarken abgeben konnte, die vor die Videohüllen in die schmalen Regalbretter gesteckt waren und signalisierten, ob ein Film noch verfügbar war oder nicht. Der Gang war so aufgebaut, dass der Innenraum der fensterlosen Blechbaracke maximal ausgenutzt wurde, wand sich und knickte oft genug ab, dass in den einzelnen Teilbereichen auf dem Weg zum Verleihtresen ein Gefühl von Intimität aufkommen konnte, auch wenn viele Menschen zwischen den Regalen unterwegs waren. Hinter jeder Kurve waren andere Neuerscheinungen zu erwarten, andere Suchende nach neuen Nachrichten des Raumschiffs an die Stadtrandbewohner. Der Gang war dadurch wie ein Heckenlabyrinth auf eine Weise mit jeder Biegung immer vertraut und fremd zugleich, und obwohl es nur einen einzigen Weg gab, dessen Ende bekannt war, war der eigenen Orientierung niemals ganz zu trauen.
Die Bewegung der Blätter des Baumes, an dem die Fahrräder zusammengeschichtet stehen, wirft einen unruhig wimmelnden Schatten auf den Asphalt des Parkplatzes, der sich ebenso wie die gerade, ruhige Fläche des Schattens der Baracke zum Mittag hin immer weiter zurückzieht.
Und dennoch, denke ich, obwohl vom Licht des Tages hell beschienen, löst sich alles mehr und mehr auf in eine sagenhafte Dunkelheit, wie Arnold Schwarzeneggers Gesicht im All der Totalen Erinnerung oder wie die Märchenwelt Phantásiens im Nichts der Unendlichen Geschichte, die ich zum ersten Mal als Film gesehen habe, ausgeliehen aus der verschwundenen Videothek, lange bevor ich wusste, dass es ein Buch gab, das vorher da war und dessen Autor die Verfilmung hasste und sich wünschte, sein Name würde so wenig und so selten wie möglich mit diesem Film assoziiert. Vielleicht, weil es ihm so vorkam, als würden seine Figuren und ihre liebevoll ausgedachte Welt durch diese Verfilmung in das Nichts hineingesaugt werden, das im Buch alles Phantastische und Phantasierte bedroht und auf diesem Weg in Lügen verwandelt, als die allein die phantastischen Wesen in der Wirklichkeit existieren können.
Auf dem Parkplatz vor der Baracke scheint es mir, als trennte mich selbst ein solches Nichts, so eine düster unheilvolle, alles einsaugende Gewitterwand wie in der Unendlichen Geschichte, von einer anderen Welt zu einer anderen Zeit, als hier noch der Videotime-Schriftzug auf dem Dach leuchtete und ich mit meiner Familie zusammenlebte, die Piratenvideothek gepflegt und ständig erweitert wurde und mein Vater auf Ansprachen noch wirklich reagierte. Und als würde alles und jeder, jedes Detail, das in dieser anderen Welt und Zeit eine Rolle gespielt hat, durch die Erinnerung zunächst in diese düstere Gewitterwand hineingezogen, um diesseits, in der Gegenwart, in der ich mich zu erinnern meine, als Lüge wieder hervorzukommen.
Während ich spüre, dass die Sonne des späten Vormittags über dem Parkplatz vor der Blechbaracke langsam beginnt, die Haut auf meinem Nasenrücken und meinen Wangenknochen zu verbrennen, denke ich, dass es, wie in der Unendlichen Geschichte, ein fester Glaube an die Existenz und die Wahrhaftigkeit der phantastischen Welt der Vergangenheit, der eigenen Geschichte sein muss, der sie erhält. Wo dieser Glaube fehlt, wo er nicht aufrechterhalten werden konnte, sind all ihre Figuren und Orte der unheilvollen Verwandlung ausgesetzt.
Aus: Videodrome (1983)
Die Kassetten der Piratenvideothek meines Vaters befinden sich im Keller der Mehrparteienmietskaserne, in die er gezogen ist, nachdem meine Mutter ihn und den Ort verlassen hatte – einer von vier identischen Häuserblocks aus den 50er Jahren, drei Stockwerke, drei Treppenhäuser mit zwei Wohnungen auf jeder Etage, Aufgang B, zweites Obergeschoss links, ein großes und ein kleines Zimmer, schmale Küche, fensterloses Badezimmer mit Stockflecken an der Decke und ein Kellerabteil, das von denen der anderen Parteien durch deckenhohe Zäune aus unbehandelten Holzlatten abgetrennt ist. Die Lattentüren, durch deren Spalte man in jedes Kellerabteil hineinschauen kann, sind an ihren Verschlusshaken mit Vorhängeschlössern gesichert. Am Abteil meines Vaters hängt ein Zahlenschloss, dessen vierstellige Kombination das Jahr des größten sportlichen Erfolgs meines Bruders beziffert (Bayerischer Landesmeister der Junioren).
Nach meiner Ankunft im Ort, in der Straße, im Haus meines Vaters, nachdem ich die Haustür aufgedrückt hatte, die tagsüber nie abgeschlossen ist, damit die Postboten und die Verteiler von Werbeprospekten, Amtsblättern und anderen kostenlosen Zeitungen Zugang zu den weißlackierten Aluminiumbriefkästen haben, die vor den ersten Stufen nach oben an der Treppenhauswand hängen, stand ich auf dem kühlen Steinboden, der sauber war und nach glattem, unversiegeltem Beton roch, und zögerte.
Im Treppenhaus von Aufgang B der Mehrparteienmietskaserne, die mein Vater im zweiten Obergeschoss bewohnt, führt ein schlichtes Metallgeländer an den Seitenkanten der Stufen eng um einen sehr schmalen Spalt im Treppenhauszentrum herum. Links von diesem Metallgeländer sah ich die hellen Stirnseiten der Steinstufen nach oben, wo mein Vater nicht auf mich wartete. Und auf der rechten Seite die Kante des Fußbodens, auf dem ich stand, und das Dunkle des Abgangs in den Keller.
Ich spürte eine starke Anziehung von diesem kühlen Dunklen her, das meiner Erwartung an meinen Besuch und dem sich unaufhörlich ausbreitenden Nichts um die gemeinsame Geschichte meiner Familie am ehesten zu entsprechen schien.
An den beiden Seitenwänden des Kellerabteils meines Vaters, das einen sehr schmalen und sehr kurzen Gang bildet, der an der immerkühlen, grobverputzten Hauswand endet, die es an seiner Stirnseite begrenzt, hat mein Vater zwei tiefe Bücherregale aufgestellt, in denen die vielen hundert VHS-Kassetten seiner Piratenvideothek in doppelten Reihen noch immer sorgfältig nach fortlaufender Nummerierung einsortiert stehen. Die Kassetten sind nicht mehr Teil seines Haushalts und aktiv in Benutzung, wie sie es über die Jahre unseres Zusammenlebens gewesen sind.
Der dicke Ordner mit den durch Klarsichthüllen geschützten, beidseitig mit Schreibmaschine beschriebenen Blättern, in dem der Bestand dieser Videothek indexiert ist, oftmals mit sauber ausgeschnittenen Artikeln zu den jeweiligen Filmen aus der Fernsehzeitung versehen, ist von seinem zentralen Platz auf dem Wohnzimmertisch, wo mein Vater, mein Bruder und ich uns jahrelang darübergebeugt haben und von wo ich mit dem Telefon am Ohr mögliche zu schauende Filme an meinen Schul- und Kindheitsfreund Markus Fellhauer, Sohn des Besitzers des Mercedes Fellhauer Autohauses Ernst Fellhauer, durchgegeben habe, um sie mitzubringen für einen Nachmittag vor dem riesenhaften Fernseher der sehr viel wohlhabenderen Familie, ebenfalls in das Kellerabteil ausgelagert worden.
Ich blätterte in diesem dicken Ordner zwischen den Regalen im kühlen Kellerabteil meines Vaters, ratlos und vielleicht auch in der Hoffnung, dass mir dieses Blättern etwas von der gemeinsam verbrachten vergangenen Zeit zurückbringen könnte, die mit meinem Vater nicht mehr zu besprechen ist. Ich erinnerte mich daran, wie ich über diesen Ordner gebeugt mit Markus Fellhauer telefoniert habe, und meinte ziemlich sicher zu wissen, dass Markus nie gemeinsam mit seinem Vater zur Videotime gefahren ist, um sich dort Filme auszuleihen. Und dass er wohl deswegen umso neugieriger war auf die Kassetten, die ich von zu Hause mitbringen konnte –, gleichzeitig aber auch angstvoll besorgt um ihren Inhalt, die Jugendfreiheit der Filme und ihr Potenzial, die Eltern gegen sich aufzubringen.
Das Wohnhaus der Autohausbesitzerfamilie Fellhauer, in dem Markus lebte mit seiner Mutter, die im Autohaus Sekretärin und zuständig für die Buchhaltung war, zu Hause Hausfrau und zuständig für alle Belange des Häuslichen, und die im Verlauf der Jahre, die ich im Fellhauerhaus ein und aus gegangen bin, verschiedene Schönheitsoperationen vor allem an ihrem Gesicht hat durchführen lassen, was mir bis dahin eine völlig fremde Angelegenheit war und mich besonders unmittelbar nach den Operationen, wenn die Stellen, in die die Chirurgen eingegriffen hatten, noch nicht vollständig verheilt waren, auf eine Weise ängstigte, über die ich mit niemandem wirklich sprechen konnte und daher immer auch dachte, dass diese Angst oder dieser Anblick oder meine Reaktion auf diesen Anblick vielleicht aus den gleichen unergründlichen Sphären herkommen wie die Albträume in der Nacht, und seinem Vater, der im Autohaus Besitzer, Verkäufer, Repräsentant, Chefcharmeur und Sachverständiger war und zu Hause ein zwangsneurotischer Despot, habe ich zum ersten Mal besucht, als Markus und ich noch in die Grundschule gegangen sind, in der wir uns kennengelernt haben.
Das Fellhauer’sche Wohnhaus liegt nur ein paar Straßen von dem Gewerbegebiet entfernt, in dem sich das Fellhauer’sche Mercedes-Autohaus an einer Ausfallstraße aus dem Ort befindet, auf die man gelangt, wenn man die verkehrsberuhigte Wohnstraße an der Einfahrt zur ehemaligen Videotime-Verleihvideothek vorbei stadtauswärts fährt. Oder eben zu Fuß geht, denke ich, als ich auf dem Parkplatz vor dem Passat mit den beschlagenen Scheiben stehe, zu dem ich zu Fuß gegangen bin, einem spontanen Impuls nachgebend, den ich spürte, als ich die Stufen vom Kellerabteil meines Vaters hochgestiegen war und im Begriff, weiter hochzusteigen bis zu seiner Wohnung. Ich könnte ja noch etwas Zeit draußen verbringen, dachte ich, die Mittagszeit vielleicht, zu der mein Vater ja eh höchstwahrscheinlich einen Mittagsschlaf halten würde.
Die Autohausbesitzerfamilie wohnte so sehr am Rand der Stadt, dass der Fellhauer’sche Garten hinterm Haus lediglich durch einen Holzzaun von einem der Äcker abgetrennt war, die die Kleinstadt in alle Richtungen umgeben. Das Haus selbst kam mir schon als Kind irrsinnig überdimensioniert vor für drei Personen. Alle anderen Familien, die ich kannte, wohnten in kleinen Wohnungen zur Miete. Das Fellhauer’sche Haus hatte eine eigene, straßenbreite Einfahrt, eine Doppelgarage und einen ausgebauten Hobbykeller, einen riesigen Raum, der sich fast über die gesamte Grundfläche des Hauses erstreckt haben muss, an dem nur die Deckenhöhe niedrig war und der ansonsten in seinen Dimensionen alle Keller übertraf, die ich bis dahin gekannt hatte, vor allem die üblichen Verschläge und Abteile wie das, in dem mir der Ordner in die Hände gefallen war, der mich überhaupt erst an Markus Fellhauer erinnert hatte.
Markus’ Autohausbesitzervater errichtete in diesem weitläufigen Hobbykeller auf verschiedenen Tapeziertischen, die wie in einem Showroom oder einer Messe oder für einen Wettbewerb im Raum angeordnet waren, hochkomplexe Bauten aus vielen Tausend Legosteinen, die in abschließbaren Werkzeugschrankschubladen nach Farben und Größen sortiert aufbewahrt und später in den Gebäuden, Luft- und Wasserfahrzeugen des Vaters mit Heißkleber fest verbaut wurden, so dass sie den Kindern nie zum freien Spiel zur Verfügung standen. Als Kind, das Markus besuchte, bekam man diese Bauten von Herrn Fellhauer persönlich vorgeführt und präsentiert, in einem Duktus, der wahrscheinlich auch im Autohaus zur Anwendung kam, wenn sich weniger wohlhabende Leute auf die Anlage verirrten, die sich einen Mercedes Neuwagen nie würden leisten können, ihn aber durchaus einmal bewundern durften.
Das Kinderzimmer, das Markus in seinem Elternhaus bewohnte, war von den Fellhauereltern in ökonomischer Voraussicht gleich schon als Jugend- beziehungsweise vielleicht sogar schon als Fremdenzimmer konzipiert und eingerichtet worden, mit sehr schlichten, nüchternen Möbeln, Bett, Schreibtisch, Einbauschrankwand mit ausfahrbarer Kleiderstange für Hemden und Anzüge, die Markus naturgemäß nicht besaß und wo stattdessen seine Fußballtrikots und Strickjacken hingen, die er gern in Kombination trug, was ihm das Aussehen eines irgendwie frühvergreisten, kindlichen Arbeitslosen verlieh, den Trinkern vor den Supermärkten der Kleinstadt gleichend, die ihrerseits in ihren Fußballtrikots und Strickjacken erschütternd kindlich wirkten.
Im ausgebauten Dachgeschoss der Fellhauers erstreckte sich ein Wohn- und Fernsehzimmer tatsächlich über die gesamte Grundfläche des Hauses, ein Raum, höher und noch größer, noch weitläufiger als der riesige Hobbykeller mit den Legobauten des Autohausbesitzers. Es gab dort einen Flügel, auf dem nie jemand spielte, eine Sammlung historischer Instrumente, die an die Wände gehängt waren, und Regale voller Bildbände zu Classic Cars, Auto Motor Sport Magazine sowie exklusiv für den Vertrieb gedruckte Mercedes-Benz-Kataloge zu den aktuellen Serien der letzten fünfzehn Jahre. Mittig im Raum, vor einem gigantischen Thomson Breitbildfernseher, dessen Gehäuse auch ein Schrank hätte sein können, stand die Sofagarnitur der Fellhauers, die ausladend tief und breit war und über Eck ging und auf der man als kleiner Mensch in allen Richtungen ausgestreckt liegen konnte, die aber offenbar mit einem sehr feinen, empfindlichen und überaus wertvollen Stoff bespannt war, weshalb es im Fellhauerhaus verboten war, zumindest den Kindern, sich mit Jeanshosen, Hosen mit Gesäßtaschen oder vorstehenden Nähten auf die Polster zu setzen. Und weil man meistens solche Hosen trug, musste man sie eben nach Anweisung der Fellhauereltern ausziehen, bevor man aufs Sofa durfte, um zu den streng limitierten nachmittäglichen Fernsehzeiten eine der mitgebrachten Videokassetten auf dem Riesenfernseher zu schauen.
Herr Fellhauer war herrisch, ungeduldig und jähzornig in seinem eigenen Haus, als Gegenextrem zum professionellen Charme des Autoverkäufers auf der Arbeit. Wie er war oder was in ihm vorging, während er sich auf den langen Umwegfahrten befand, die er morgens von zu Hause zum Autohaus unternahm, wofür er oft eine Stunde oder mehr Extrazeit einplante, um eben auch in den Genuss der Traumautonutzung zu kommen und seine Fahrgefühlexpertise in der eigenen Erfahrung zu verankern, bleibt für immer sein Geheimnis. Markus hatte dagegen etwas permanent Geducktes an sich, signalisierte mit seiner Körpersprache zumeist Bereitwilligkeit, die eigene Schuld einzugestehen und wiedergutzumachen. Auch wenn wir bei mir zu Hause einen der Filme aus der Piratenvideothek schauten, im Vertrauen meiner Eltern weitestgehend unbeaufsichtigt und grundsätzlich jenseits der uns angemessenen Altersfreigaben unterwegs, war Markus sein schlechtes Gewissen den eigenen Eltern gegenüber immer anzumerken, eine enorme Verkrampftheit, ein Schwitzen und ein Ringen mit den moralischen Instanzen seiner kindlichen Persönlichkeit, die bereits mächtig genug waren, um von außen deutlich sichtbare körperliche Reaktionen hervorzurufen, was eine Überführung und entsprechende Sanktionierung für seine Eltern angenehm vereinfacht haben musste.
Ich habe mit Markus Fellhauer auf der ausladenden Sofagarnitur seiner Eltern vor dem Thomson-Schrankfernseher unter einer Decke ohne Hosen gesessen, eng zusammengerückt aus Furcht, so dass sich unsere nackten Beine immer wieder ganz kurz ganz leicht berührten, was die unheimliche Spannung noch weiter steigerte und elektrisierte, und gemeinsam mit ihm und dem kindlichen Krieger Atréju dem sterbenden Werwolf Gmork in seine müden, aber nicht minder bösen, grün leuchtenden Werwolfsaugen geschaut, in den bösen Blick des Hetzers, der den jungen Krieger durch ganz Phantásien verfolgt hatte, im Auftrag, ihn zu töten. Wir hörten, wie der Werwolf Gmork dem Kriegerkind Atréju erklärte, was es mit der Grenzenlosigkeit Phantásiens auf sich hat und mit dem Nichts und seiner eigenen Rolle als Hetzer und Zerfetzer und Töter, als Markus Fellhauers Mutter nach oben ins Dachgeschoss kam, um nach uns zu sehen, mit ihrem mich auf seine eigene, besonders beunruhigende Weise gruselnden und verstörenden Blick, dem unnatürlich überstrafften, ratlos wirkenden Gesicht, fragte, was das denn sei, was wir da schauten, während Gmork sagte:
»… es ist die Leere, die zurückbleibt, eine Art Verzweiflung, sie zerstört unsere Welt.«
Aus: The Neverending Story (1984)
Es ist mehrmals vorgekommen, dass wir Filme pausiert haben, um Markus’ Mutter oder seltener Markus’ Vater zu erklären, was es mit ihnen auf sich hat und warum sie unbedenklich sind, wenn einer der beiden nach oben ins Dachgeschoss kam, um nach uns zu sehen und zu kontrollieren, was wir schauten und ob wir auch wirklich nicht mit verbotenen Hosen auf dem hochwertigen Sofabezug saßen.
Als ich im Keller meines Vaters zwischen den Regalen stand und durch den Ordner blätterte, der die Filme seiner Piratenvideothek enthält, mich an Markus Fellhauer erinnerte und an das Dachgeschoss im Haus seiner Eltern, bemerkte ich, wie ich nach einem bestimmten Film zu suchen begann, der irgendwo in der Auflistung zu finden sein musste. Ich hatte, glaube ich, das Gefühl, dass die Erinnerung an diesen bestimmten Film und die konkrete Szene des Schauens mit Markus auf dem Sofa seiner Eltern deutlicher zu mir zurückkommen würde, wenn ich ihn im Ordner finden könnte, auf ihn stoßen würde, wenn ich Markus in meiner Vorstellung noch einmal anrufen würde mit dem Vorschlag, What Dreams May Come – Hinter dem Horizont mitzubringen und anzusehen.
Der Ausschnitt aus der Fernsehzeitung, den mein Vater im Ordner unter die maschinengeschriebene Zeile zu Kassettennummer und Titel, Erscheinungsjahr und Laufzeit in die Klarsichthülle gesteckt hat, zeigt den Schauspieler Robin Williams, mit einem Dalmatiner an seiner Seite, in einer goldroten Phantasielandschaft, die dem Phantásien der Unendlichen Geschichte nicht unähnlich ist, auf einem ebenfalls goldrot schimmernden See, der im Hintergrund des Bildes in die Sturzkante eines Wasserfalls mündet, zu Fuß übers Wasser gehen.
Und tatsächlich, als ich im Kellerabteil meines Vaters im Ordner das Bild aus der Fernsehzeitung sah, die Buntheit des Bildes, das mich erinnerte an die Buntheit der Welt in diesem Film, kam die Erinnerung daran zurück, wie ich mit Markus ohne Hosen auf dem Sofa unter einer sehr weichen Baumwolldecke vor dem Riesenfernseher saß und wie wir gemeinsam seinem Vater zu erklären versuchten, dass es sich bei Hinter dem Horizont um einen sehr bunten, kindertauglichen Familienfilm handelt, der nur zufällig gerade im Moment des Heraufkommens und Kontrollierens des Autohausbesitzers an einem etwas düsteren Punkt angekommen war, der aber keinesfalls den Rest der Handlung repräsentierte, die schließlich die ganze Zeit über in einem farbenfrohen Paradies stattgefunden hatte, wo die von Robin Williams gespielte Hauptfigur in kitschigen Gemäldelandschaften herumfliegen konnte und übers Wasser gehen und so weiter.
Markus hatte auf der Fernbedienung des Videorekorders sofort gedrückt, als sein Vater die Treppen hochgekommen war und »Und was is des jetzt?« gesagt hatte, mit einem Unterton, der für mich herausfordernd klang und für Markus wohl sehr wahrscheinliche Bestrafung signalisierte. Das Bild war eingefroren, auf die nachzuckende, durchflimmerte Art, in der es Videorekorder bei stehendem Band ausgaben, und zeigte ein kleines Segelboot unter düsterem Himmel auf düsterer See, das im Begriff war, von einer Masse heranschwimmender, Arme und Hände hochreckender, leichenblasser Untoter umgerissen und zum Kentern gebracht zu werden. Die Robin Williams-Figur hielt sich in diesem zuckenden Bild auf dem zuckenden Segelboot an der Reling fest. Vorn im Bug saß eine zerflimmerte Person mit einer Laterne in der Hand. Und vor dem blutroten Segel stand eine Fährmannsgestalt, die mehr Schatten als Mensch war, mit breitkrempigem schwarzen Hut und gesenktem Kopf.
Ich verstand, dass wir es schwer haben würden, Herrn Fellhauer zu versichern, dass dies ein bunter, kinderfreundlicher Film sei, wenn wir nicht zurückspulten und ihm zeigten, wie diese Robin Williams-Figur vorher noch lachend durch die bunte Kitschlandschaft geflogen und mit dem niedlichen Dalmatiner übers Wasser geschlendert war. Es wäre, dachte ich, unserer Sache wohl dienlich, wenn wir nicht bis ganz an den Anfang spulen würden, wo diese Figur bei einem Autounfall ums Leben kam, weshalb sie ja überhaupt erst in diese bunte Landschaft gelangte, die ihre Nachtodlandschaft war, ihr Himmel oder ihr Paradies – gemacht aus Gemälden der Ehefrau, die sich ihrerseits nach dem Autounfall der Figur das Leben genommen hatte und in eine Art Unterwelt der Verdammten geraten war, da Selbsttötung Sünde ist, wie der Film uns lehrte, die die Hölle bedeuten musste für die Mörderinnen und Mörder ihrer selbst, aus der einen nichts befreien konnte, außer vielleicht, unter Aufbringung allen Mutes und Glaubens, durch den wahnsinnig gefährlichen Übertritt vom Bunten ins Dunkle, die unverbrüchliche, aufrichtige Liebe eines unverschuldet zu Tode gekommenen Toten.
Herr Fellhauer nahm Markus aber die Fernbedienung aus der Hand und spulte vor statt zurück, um zu sehen, wie lange es »damit« noch weiterging, womit er wohl die kinderunfreundliche Düsternis und den Übergriff der Untoten auf das Boot der Lebenden meinte, der ja an sich, wenn man es genau nahm, ein Übergriff von traurigen Untoten auf das Boot weniger trauriger Toter war.
Die Bilder flimmerten vorwärts durch die Handlung, von zwei bunten Blitzen längs durchschnitten, die immer dann auftraten, wenn man das Band der Kassette schnell am Abtastkopf des Videorekorders vorbeilaufen ließ. Das Boot kenterte in comichafter Geschwindigkeit, die Robin Williams-Figur tauchte in die düstere See und gelangte auf eine Weise, die in dieser raschen Abfolge der Bilder nicht mehr nachvollziehbar war, tiefer in die Totenwelt der Selbstmöderinnen und Selbstmörder hinein. Lodernde Schiffswracks rauschten vor unseren Augen vorüber, ein staksender, sehr schneller Gang der Figur über ein weites Feld aus Menschenköpfen, denen es mit jedem Schritt in die klagenden Gesichter treten musste. Dann das Innere einer auf den Kopf gestellten Kathedrale unheimlicher Größe, in deren Decke, zwischen den Kapitellen der monströsen Säulen, ein verfallenes, von toten Rosen umranktes Häuschen stand. Die Figur rannte im schnellen Vorlauf in dieses traurige Häuschen hinein und begegnete dort, zwischen zerborstenem, staubüberdecktem Mobiliar, ihrer Frau, die, wie Markus und ich aus der vorangegangenen Handlung wussten, keine Einsicht in ihr Totsein hatte, da diejenigen, die sich selbst getötet haben, mit ihrem Leben nie abschließen, sich selbst nicht vergeben und also auch den Tod nicht akzeptieren können. An dieser Stelle der Begegnung der Figur mit ihrer Frau stoppte Herr Fellhauer den schnellen Vorlauf und ließ das Band in normaler Geschwindigkeit weiterlaufen.
Markus und ich wussten, dass die beiden Kinder der Robin Williams-Figur und ihrer Frau noch vor dem Autotod der Figur und dem Selbstmord der Frau ebenfalls bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren, was sich die Frau nicht verzeihen konnte, da sie normalerweise die Kinder in die Schule gefahren hätte, das aber am Tag des Unfalls an die Haushälterin delegiert hatte, weil sie eine wichtige Ausstellung ihrer Gemälde organisieren musste. Wir dachten wohl beide, dass es besser wäre, Herrn Fellhauer, den Verkehrsunfallstatistiken und Hervorhebungen der Lebensgefährlichkeit des Autofahrens schnell aggressiv machten, die Tatsache der verunglückten Kinder vorzuenthalten. In der Hölle ihrer Verzweiflung, in die die Frau nach ihrem Selbstmord eingeschlossen war, waren aber auch die Vorwürfe, die sie sich wegen des Todes ihrer Kinder machte, unendlich, was gleich aus der Szene der Wiederbegegnung mit ihrem Mann, den sie aus endloser Trauer, Selbstvorwürfen und mangelnder Einsicht in ihren eigenen Tod nicht erkennen konnte, klarwurde. Die Frau war blass, wenn auch nicht ganz so blass wie die Untoten, die vorher das Boot zum Kentern gebracht hatten. Ihr Haar hatte in der Unterwelt ein paar graue Strähnen bekommen.
In normaler Wiedergabegeschwindigkeit erzählte die Frau ihrem Mann, den sie nicht erkannte, von den Dingen, die ihr fehlen würden. Sie habe keine saubere Kleidung, die Bücher seien verschwunden, aber am meisten fehlten ihr die kostbarsten ihrer Bilder, diejenigen, die sie an ihre verstorbenen Kinder und ihren verstorbenen Mann erinnerten. Ich beobachtete Herrn Fellhauer beim Schauen dieser Szene und versuchte, aus seinem Gesicht abzulesen, wie wahrscheinlich es war, dass er uns den Film zu Ende würde sehen lassen. Die Robin Williams-Figur war selbst im deprimierenden Totenhaus ihrer Frau, dessen Zustand dem Autohausbesitzer sicher ganz und gar nicht gefallen konnte, von einer tiefen Zerknirschung heimgesucht worden, ahnte wohl auch, dass sie unter Umständen nie zu ihrer Frau würde durchdringen und sich kenntlich machen können –, so wie es der Fährmann ins Totenreich prophezeit hatte, bevor Markus’ Vater die Treppen hochgekommen war.
»Ihr Mann«, sagt die Figur in der Szene über sich selbst, »war ein Feigling. Stark zu sein und nicht aufzugeben war seine Art, sich zu verstecken.«
Herr Fellhauer drückte wieder auf schnellen Vorlauf. Die Bilder rasten durch die restliche Handlung im Totenreich. Es war unmöglich zu verstehen, was geschah und wie die Figur es schaffte, ihre Frau davon zu überzeugen, dass sie ihr Mann war und dass sie gemeinsam aus der Hölle der Verzweiflung entfliehen konnten und in das bunte Gemäldeparadies einziehen, das sie ganz zum Schluss gemeinsam mit ihren verstorbenen Kindern bewohnen, unendlich glücklich in einem Kitschhaus am Kitschsee, mit dem niedlichen Dalmatiner, fähig zu fliegen und für immer unabhängig von gefährlichen Autofahrten, Tod und Traurigkeit. Herr Fellhauer ließ uns nur noch die letzten Minuten dieses farbenfrohen Happy Ends in normaler Geschwindigkeit anschauen und sagte dann zu mir, dass es jetzt Zeit für mich sei, nach Hause zu gehen.
Aus: What Dreams May Come (1998)
Ich frage mich, während ich vor der Baracke in der Sonne auf dem Parkplatz stehe, vor den beiden verschlossenen Türen für Familien- und Erwachsenenbereich in der dem Parkplatz zugewandten Längsseite, ob die Baracke wohl errichtet wurde, um als Verleihvideothekgenutzt zu werden oder ob es vorher noch andere Verwendungsformen gegeben hat. Gab es zur kurzen Boomzeit der Videotheken eigens gestaltete, modularisierte Zweckbauten, die auf ihre Anfordernisse ausgerichtet waren? Und bedeutete das, dass überall in der Republik vergleichbare Modulbaracken herumstanden, in Stadtrandsiedlungen, aufgegeben und verschlossen, die für einen sehr begrenzten Zeitraum ihren Anwohnern Wasserlöcher der Unterhaltung gewesen sind, an denen sie sich regelmäßig versammelten?
Es existierte ein unerlaubter Bereich in der Piratenvideothek meines Vaters, einsortiert in zweiter Reihe hinter den fortlaufend nummerierten Kassettenhüllen, auf den oberen Brettern der Regale, die mein Bruder und ich nur auf einem Stuhl stehend erreichen konnten.
Weil das kein gutes Versteck war und die Kassetten aus diesem Bereich auch zu zahlreich, um sie anderswo besser vor mir und meinem Bruder zu verbergen, war diese Sektion der Videothek von meinem Vater als für uns verboten ausgewiesen worden. Sie enthielt, so die Erklärung, die an unsere kindliche Moral und unseren Gehorsam appellierte, Filme, die noch nicht für uns freigegeben waren und zuerst von ihm gesichtet und beurteilt werden mussten, bevor sie mit einer Nummer versehen und in den Ordner aufgenommen werden konnten. Es handelte sich um die Filme, die mein Vater aus dem Erwachsenenbereich der Videothek ausgeliehen hatte, der zusätzlich zum separaten Eingang im Innern der fensterlosen Blechbaracke durch eine dünne Wand abgetrennt war, sich aber mit dem uns vertrauten Bereich denselben Verleihtresen teilte. Wenn mein Vater aus dem Erwachsenenbereich Filme auslieh, trafen wir am Tresen wieder mit ihm zusammen und legten die bunten Plastikmarken, die wir auf dem Weg durch den labyrinthischen Gang eingesammelt hatten, zu denen, die er von der anderen Seite mitbrachte. Die Person hinterm Tresen suchte dann aus großen Schubladen die entsprechenden Kassetten zusammen, wobei sie gerade bei den Filmen aus dem Erwachsenenbereich darauf achtete, sie gleich in den neutralschwarzen Plastikhüllen verschwinden zu lassen und zuunterst in den Stapel einzusortieren, den sie uns auf den Tresen stapelte.
Mein Verständnis dieser anderen Seite der Videothek war, dass dort die Hüllen der Filme zur Ansicht aufgestellt wurden, die zur freiwilligen Selbstkontrolle ab 18 Jahren ausgewiesen waren (die Plastikmarken aus diesem Teil waren alle von der gleichen signalroten Farbe wie das FSK18-Symbol). In den Statuten der Videotime war die Kontrolle der Volljährigkeit natürlich nicht mehr freiwillig, sondern obligatorisch. Die Filme ab 18 durften nur an Kunden ausgeliehen werden, die sich vorher als alt genug ausgewiesen hatten.
In meiner Vorstellung handelte es sich bei den Filmen im Erwachsenenbereich vor allem um solche von enormer Brutalität, um Gemetzel und Grusel, Folter, Horror in aller Deutlichkeit, Dämonen und Gespenster, das ganze Schattenreich der Schlurfenden, der Skelette, Zombies und Werwölfe, aber auch die konzentrierten, technisch versierten Körpertreffer des Krieges – Kopfschüsse, abgerissene Gliedmaßen, hervorquellendes Gedärm aus aufklaffenden Bauchdecken.
Es kam häufig vor, dass mein Bruder und ich unserem Vater den Auftrag, nach einem bestimmten Film zu suchen, mit auf seinen Weg in den Erwachsenenbereich der Videotime gegeben haben. Weil wir zum Beispiel wussten, dass ein neuer, hyperbrutaler Actionfilm herausgekommen war, der sicher nicht im uns zugänglichen Teil einsortiert werden würde, den wir aber sehr wahrscheinlich nach erfolgter Prüfung durch unseren Vater würden ansehen dürfen, da Waffengewalt, die Brutalität des Militärischen und Martial Arts mit offenen Knochenbrüchen recht zuverlässig als unbedenklich eingestuft wurden.
Meine Eltern waren ganz grundsätzlich uneins darüber, ob es meinem Bruder und mir erlaubt sein sollte, Filme zu schauen, die zur freiwilligen Selbstkontrolle ab 18 Jahren ausgewiesen waren. Mein Vater argumentierte in diesen Streits mit meiner Mutter immer damit, dass wir doch sehr genau wüssten, »dass das alles nicht echt ist«. Ich habe zu diesem Streit immer geschwiegen, aber ich weiß noch, wie es mich gewundert hat, dass die Unterscheidbarkeit von Realität und Fiktion in Sprüngen von 6, 12, 16 und 18 Jahren einem Menschen einleuchten sollte. Dass es sich offenbar um einen langwierigen Prozess handelte. Wie das Sammeln von Erfahrung. Oder das Wachsen der Knochen. Und dass es mich stolz gemacht hat, dass mein Vater wohl glaubte, mein Bruder und ich hätten diesen langwierigen Prozess abgekürzt, wahrscheinlich durch die vielen Filme, die wir bereits geschaut hatten. Eine beachtliche Menge im Verhältnis zu den wenigen Jahren, die wir überhaupt erst am Leben waren.
Während ich vor der leerstehenden Blechbaracke der ehemaligen Verleihvideothek, vor den verschlossenen Türen des Familien- und Erwachsenenbereichs in der Sonne des späten Vormittags auf dem Parkplatz stehe, fällt mir auf, dass ich diese andere Seite, aus der mein Vater uns jahrelang die Filme mitgebracht hat, die wir uns selbst nicht hätten ausleihen dürfen, nie betreten und nie mit eigenen Augen gesehen habe. Ich habe, vor ihrem allgemeinen Niedergang, Erwachsenenbereiche anderer Videotheken an anderen Orten betreten und gesehen. Und ich kann von diesen Anblicken ableiten, wie es wahrscheinlich auch im Erwachsenenbereich der Videotime ausgesehen hat: Die Regalwände des Gangs, der spiegelbildlich zum Familienbereich wohl auch dort drüben einen einzigen, mehrfach abknickenden Weg vom Eingang zum Verleihtresen vorgab und eine relative Intimität erlaubte, mit den obligatorischen haut- und fleischfarbenen Hüllen vollgestellt, billiges Coverdesign zu beiden Seiten, gespreizte Beine, krauses Schamhaar, offene Münder, violette Eicheln, schlundartig ausgeweitete Schließmuskeln, rot schimmernde Enddarminnenwände.
Die Vorstellung, die ich mir von der anderen Seite der Trennwand im Innern der fensterlosen Blechbaracke gemacht habe, als mein Vater dort noch die signalroten Plastikmarken für uns einsammelte, war dagegen eher die eines Gangs voller Bilder, die besonderen Mut im Schauen erforderten.
Für einige Zeit, bevor er recht plötzlich das Interesse daran verlor, habe ich mit meinem Bruder diesen Mut auf die Probe gestellt, indem wir immer wieder Filme aus dem nichtnummerierten, verbotenen Bereich der Piratenvideothek heimlich geschaut haben, wenn unsere Eltern nicht zu Hause waren. Es kam bei diesen Proben darauf an herauszufinden, wie lange man in der Lage sein würde, das Andere von der anderen Seite anzusehen. Im Wissen, dass man sich dabei in gewisser Weise nicht die Finger, aber vielleicht die Augen oder die Seele verbrannte.
Die extreme Brutalität, das Monströse, die phantastische Gewalt, die wir uns in diesen Mutproben zwangen anzusehen, ohne wegzuschauen, ohne dem Impuls zu folgen, der uns eingegeben war, die Augen zu schließen und diese Bilder nicht einzulassen in die eigene Imagination, die Träume, in denen sie wiederkehren würden, waren auf beängstigende Weise sehr wohl »echt« insofern, als sie doch aus den Menschen entsprungen waren, von ihnen und durch sie realisiert wurden. Die Tatsache, dass es sich um von Menschen Gemachtes handelte, trug eher noch zur Beunruhigung bei, da die Werke der Menschen schließlich auf etwas Dunkles, Böses, Brutales in ihnen verwiesen, das sich über das Medium des Films Sichtbarkeit verschafft hatte. Wer sich in der Fiktion so zersägte und durchbohrte, so verwandelte in derart Haariges mit derart hornigen Krallen und scharfen Zähnen, sich selbst und andere verstümmelte, zerfetzte, fraß und erbrach, dem konnte auch im wirklichen Leben außerhalb der Filme nicht getraut werden.
Die Mutproben zwischen mir und meinem Bruder wurden zunächst immer härter und schwerer, bevor er sie sehr plötzlich und unerwartet für beendet erklärte. Eine Eskalationsstufe vor dem Ende der Proben war zum Beispiel, die Filme nicht gemeinsam, sondern allein anzuschauen, wobei man dann niemanden hatte, an dem man sich festhalten konnte als Repräsentanten der gegenwärtigen Wirklichkeit. Allein mit den Bildern, dem bösen Blick, der einen aus den blutrünstigen Kreaturen heraus anschaute, wurde man nochmals in ganz anderer Intensität überwältigt, wurde die eigene kleine, gefährdete Seele in anderem Ausmaß umfangen, eingesponnen, eingesaugt und eingespeichelt.
Mein Bruder forderte mich heraus, indem er einen Tag festlegte, an dem ich in der Lage sein musste, ihm von bestimmten Details der Handlung eines Films zu erzählen, den er sich ebenfalls alleine anschauen würde. Es fiel ihm nie schwer, Fragen auszuwählen, deren Beantwortung bestimmt beweisen konnte, dass ich den Mut aufgebracht hatte hinzusehen. Ich entwickelte mit der Zeit selbst solche Fragen, und ich habe meinen Bruder niemals einer Falschbehauptung überführen können. Auf diese Weise redeten wir über die Filme nur solange, wie es nötig war, um zu beweisen, dass wir nicht gekniffen hatten. Was das Gesehene mit uns machte, wie wir es fanden und ob es uns wiederfand in Momenten, in denen wir uns wünschten, die Schwärze am Ende des Wohnungsflurs in der Nacht wäre einfach nur Schwarz, der Keller nur ein Keller, das Knacken und Klickern an den herabgelassenen Rollläden nur der Wind oder das arbeitende Holz der Ladenkästen und Fenster, haben wir nie besprochen.
Mit einem Mal hatte mein Bruder kein Interesse mehr an diesen Proben. Es wurde kein Tag zur Befragung mehr festgelegt, und der verbotene Bereich der Piratenvideothek schien ihm plötzlich völlig egal zu sein. Er kam auch nicht mehr mit, wenn mein Vater und ich zur Videotime fuhren, um neue Filme auszuleihen. Bis heute weiß ich nicht, ob er etwas gesehen hat, das ihn so nachhaltig verstörte, dass er befand, damit sei der Punkt erreicht, an dem er sich selbst schützen und zurückziehen musste. Oder ob er einfach rausgewachsen ist aus den Mutproben mit dem jüngeren Bruder und seine Neugier sich auf andere Dinge richtete, die er nicht mehr mit mir teilen wollte.
Mein Bruder ist ein paar Jahre älter als ich und mir dadurch immer ein paar Schritte voraus gewesen. Folglich war er auch immer schon einige Zeit früher desinteressiert an dem, was vorher noch absolute Begeisterung ausgelöst hatte und in mir noch immer auslöste. Oft konnte ich nicht verstehen, weshalb mein erwartungsfrohes, begeistertes Heranstürmen an ihn mit einer Sache, auf deren Großartigkeit wir uns geeinigt hatten, plötzlich falsch war, sich an ihm nicht mehr potenzierte und aufschaukelte, sondern höchstens noch eine müde, irgendwie überheblich gleichgültige Reaktion auslöste.
Das Tennis, das mein Bruder damals schon im ernsten Wettkampf mit anderen Heranwachsenden spielte, mag vielleicht auch einen Anteil gehabt haben, denke ich, während ich auf dem Videotime